Sonnentau
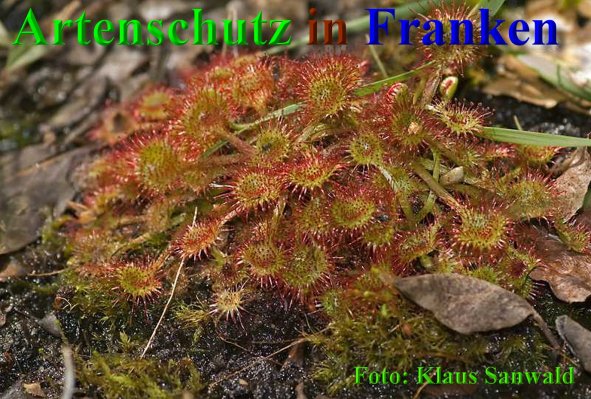
Sonnentau
Eine echte Besonderheit des Pflanzenreiches ist der Sonnentau.
Diese Pflanze liebt es sauer. Sie findet sich bevorzugt auf sehr nährstoffarmen Böden und auch in Moortypen verschiedener Art bzw. an dessen Rändern, sowie auf bestimmten Torfböden vor.
Da diese oben dargestellten Lebensräume auch in unserer Heimat sehr selten geworden sind verschwindet der Sonnentau auch zunehmend aus unserm Umfeld.
Zwischenzeitlich wird der Sonnentau auf der Roten Liste bedrohter Arten als "Gefährdet" aufgeführt, wobei die
Die im Oberbegriff als „Sonnentau“ geführte Pflanze tritt in unseren Breiten in drei Arten auf. Den Rundblättrigen Sonnentau – der Mittlere Sonnentau – der Langblättrige Sonnentau, so ihre Bezeichnung, die auf die Form der jeweiligen Pflanze hinweist.
Doch alle drei Arten haben etwas gemeinsam, sie fressen Fleisch um ihren Nachteil des gewählten Standorts in Hinsicht auf seine Nährstoffergiebigkeit ( Stickstoffbedarf ) auszugleichen.
Im Zuge der Evolution gelang es ihm eine Fangtechnik zu entwickeln die schon beachtlich ist. Es gaukelt Insekten in der Blattmitte Tautropfen vor. Beim Versuch diese zu erreichen um sich mit Wasser zu versorgen gelangt das Insekt an eine Art „Klebeschleim“ und ist damit verloren. Denn der vermeintliche Tautopfen lässt das Insekt nicht mehr los.
Je mehr sich das Insekt bemüht der Klebefalle zu entkommen, kommt es mit anderen „Klebetröpfchen“ in Kontakt und verschlimmert dadurch seine Situation. Der Prozess wurde von der Pflanze so verfeinert dass das Insekt nach und nach in die Pflanzenmitte abgedrängt wird wo der nächste Part der Nahrungsaufnahme einsetzt.
Denn nun folgt Stufe 2 – Nicht mehr „Kleben“ sondern „Verdauen“ so das Motto. Die Pflanze sondert nun Verdauungssäfte ab die das Insekt förmlich in seine Bestandteile zerlegt. Diese Verdauungssäfte basieren auf Enzymen. Was nach deren Arbeit übrig bleibt kann der Sonnentau in „flüssiger Form“ aufnehmen.
Der Mensch selbst war seit alters her von dieser Pflanze fasziniert. Schon im frühen Mittelalter wurden sie als Heilpflanze verwendet.
Aufgrund seiner Gefährdung ist es verboten diese Pflanze aus der Natur zu entnehmen.
Eine echte Besonderheit des Pflanzenreiches ist der Sonnentau.
Diese Pflanze liebt es sauer. Sie findet sich bevorzugt auf sehr nährstoffarmen Böden und auch in Moortypen verschiedener Art bzw. an dessen Rändern, sowie auf bestimmten Torfböden vor.
Da diese oben dargestellten Lebensräume auch in unserer Heimat sehr selten geworden sind verschwindet der Sonnentau auch zunehmend aus unserm Umfeld.
Zwischenzeitlich wird der Sonnentau auf der Roten Liste bedrohter Arten als "Gefährdet" aufgeführt, wobei die
Die im Oberbegriff als „Sonnentau“ geführte Pflanze tritt in unseren Breiten in drei Arten auf. Den Rundblättrigen Sonnentau – der Mittlere Sonnentau – der Langblättrige Sonnentau, so ihre Bezeichnung, die auf die Form der jeweiligen Pflanze hinweist.
Doch alle drei Arten haben etwas gemeinsam, sie fressen Fleisch um ihren Nachteil des gewählten Standorts in Hinsicht auf seine Nährstoffergiebigkeit ( Stickstoffbedarf ) auszugleichen.
Im Zuge der Evolution gelang es ihm eine Fangtechnik zu entwickeln die schon beachtlich ist. Es gaukelt Insekten in der Blattmitte Tautropfen vor. Beim Versuch diese zu erreichen um sich mit Wasser zu versorgen gelangt das Insekt an eine Art „Klebeschleim“ und ist damit verloren. Denn der vermeintliche Tautopfen lässt das Insekt nicht mehr los.
Je mehr sich das Insekt bemüht der Klebefalle zu entkommen, kommt es mit anderen „Klebetröpfchen“ in Kontakt und verschlimmert dadurch seine Situation. Der Prozess wurde von der Pflanze so verfeinert dass das Insekt nach und nach in die Pflanzenmitte abgedrängt wird wo der nächste Part der Nahrungsaufnahme einsetzt.
Denn nun folgt Stufe 2 – Nicht mehr „Kleben“ sondern „Verdauen“ so das Motto. Die Pflanze sondert nun Verdauungssäfte ab die das Insekt förmlich in seine Bestandteile zerlegt. Diese Verdauungssäfte basieren auf Enzymen. Was nach deren Arbeit übrig bleibt kann der Sonnentau in „flüssiger Form“ aufnehmen.
Der Mensch selbst war seit alters her von dieser Pflanze fasziniert. Schon im frühen Mittelalter wurden sie als Heilpflanze verwendet.
Aufgrund seiner Gefährdung ist es verboten diese Pflanze aus der Natur zu entnehmen.
Aktueller Ordner:
Pflanzen
Parallele Themen:
Acker Spark
Ackerminze
Aufrechter Igelkolben
Aufrechter Sauerklee
Augentrost
Büschelschön
Behaarte Karde
Berg Aster
Berg Sandglöckchen
Besenheide
Blutweiderich
Christrose
Drachenkopf
Dreiteiliger-Zweizahn
Echte Goldrute
Echter Rotdorn
Echtes Johanniskraut
Echtes Leinkraut
Einbeere
Färberkamille
Faulbaum
Feinstrahl
Fetthenne
Fransenenzian
Fuchs Kreuzkraut
Gefleckter Aronstab
Gelber Fingerhut
Gemeinder Stechapfel
Gemeiner Efeu
Gewöhnliche Eselsdistel (Onopordum acanthium)
Gewöhnliche Hauhechel
Gewöhnliche Waldrebe
Gewöhnlicher Froschlöffel
Gewöhnlicher Wirbeldost
Giftbeere
Golddistel
Großblütiges Springkraut
Große Brennnessel
Große Klette
Großer Wiesenknopf
Heidenelke - Blume des Jahres 2012
Herbstzeitlose
Hexenkraut
Hirse
Hohes Fingerkraut
Hohlzahn
Jungfer im Grünen
Kürbis
Kalk Aster
Kanadische Goldrute
Klatschmohn - Blume des Jahres 2017
Knäul Glockenblume
Knollen Blatterbse
Knotige Braunwurz
Kompass Lattich
Kornblume
Kreuzenzian
Krokus
Maiglöckchen
Mais
Mehlige Königskerze
Milchstern
Nesselblättrige Glockenblume
Nickendes Leimkraut
Polei Minze
Rainfarn
Raue Gänsedistel
Rossminze
Ruhrkraut
Rundblättriger Sonnentau
Schneebeere
Schwalbenwurzenzian
Schwanenblume ist Blume des Jahres 2014
Schwarzer Nachtschatten
Schwarznessel
Sichelblättriges Hasenohr
Skabiosen Flockenblume
Sonnenblume
Sonnenröschen
Sonnentau
Stechender Hohlzahn
Sumpf Herzblatt
Sumpf Kratzdistel
Sumpf Schafgarbe
Sumpf Storchschnabel
Tabakpflanze
Taubenkropf
Tausendgültenkraut
Teufelsabbiss
Thymian
Topinambur
Trauer-Nachtviole
Vielblütige Weißwurz
Vogel - Wicke
Wald Ziest
Weg-Malve
Wiesen Alant
Wiesen Storchschnabel
Wilde Kugeldistel
Wilde Möhre
Wildtulpen
Wollköpgige Kratzdistel
Zwergschwertlilie
















