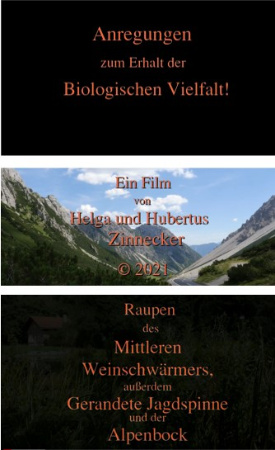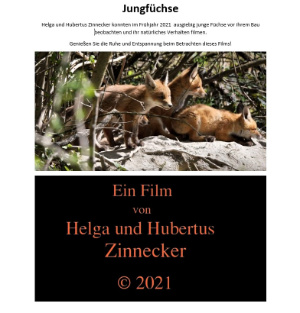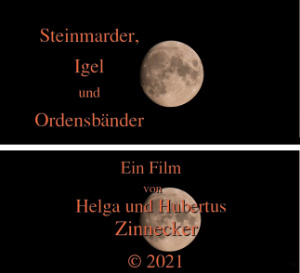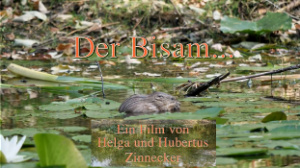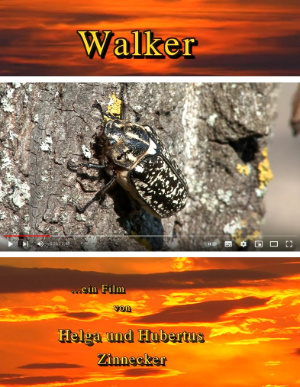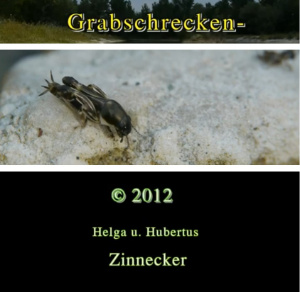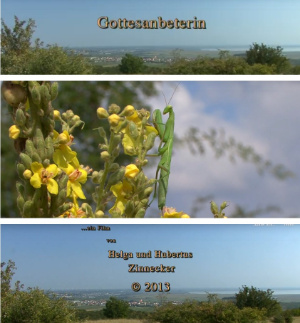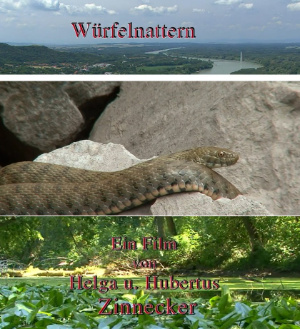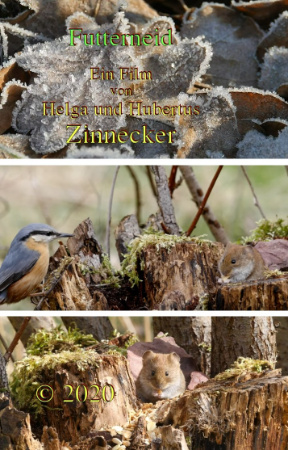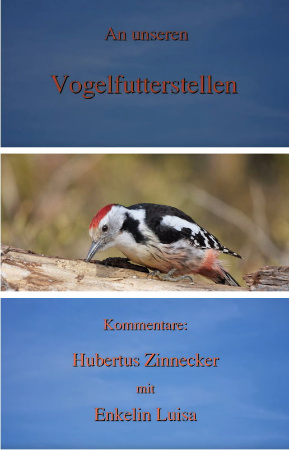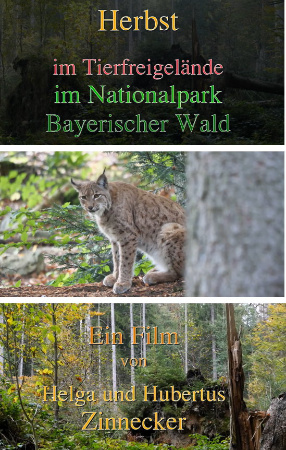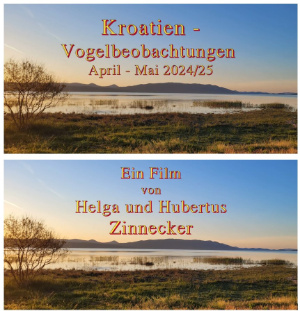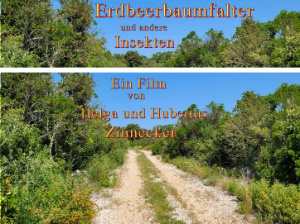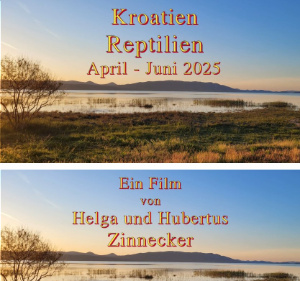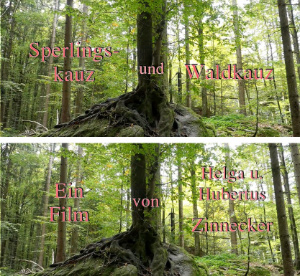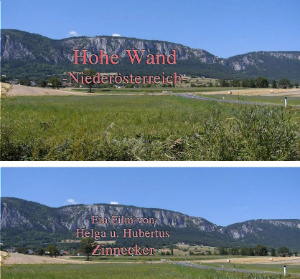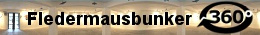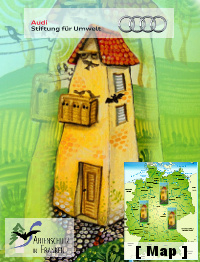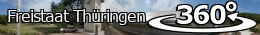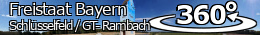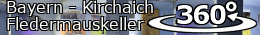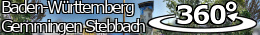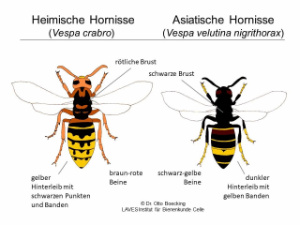BREAKING NEWS
| AiF | 22:32
Immer auf der richtigen Fährte ...
Artenschutz in Franken®
Artenschutz in Franken®
Gold-Röhrling (Suillus grevillei)

Der Gold-Röhrling (Suillus grevillei) – Ein stiller Begleiter der Lärchen
28.02./01.03.2026
Ein Spaziergänger blieb stehen, kniete sich hin und betrachtete die Pilze. Unspektakulär und doch leuchtend standen sie dort, eng verbunden mit ihrem Baum. Ohne die Lärche gäbe es sie nicht – und ohne solche stillen Partnerschaften wäre der Wald ein ganz anderer Ort.
28.02./01.03.2026
- An einem kühlen Herbstmorgen fiel das erste Sonnenlicht durch die goldgelben Nadeln einer alten Lärche. Am Fuß des Baumes schimmerte etwas Warmes im feuchten Moos – kleine, glänzende Hüte, als hätten sie das Licht selbst eingefangen.
Ein Spaziergänger blieb stehen, kniete sich hin und betrachtete die Pilze. Unspektakulär und doch leuchtend standen sie dort, eng verbunden mit ihrem Baum. Ohne die Lärche gäbe es sie nicht – und ohne solche stillen Partnerschaften wäre der Wald ein ganz anderer Ort.
Artbeschreibung
Der Gold-Röhrling, auch Goldgelber Lärchen-Röhrling genannt (Suillus grevillei), ist ein auffällig gefärbter Röhrenpilz aus der Familie der Schmierröhrlingsverwandten.
Merkmale:
Lebensweise:
Der Gold-Röhrling lebt in enger Mykorrhiza-Symbiose mit Lärchen. Er kommt daher fast ausschließlich dort vor, wo diese Bäume wachsen – in Parks, Forsten, Gärten oder naturnahen Mischwäldern. Seine Fruchtkörper erscheinen meist von Sommer bis in den späten Herbst.
Perspektiven im Wandel von Lebensraum und Klima
Die Zukunft des Gold-Röhrlings ist eng mit der Zukunft der Lärche verknüpft. Veränderungen im Klima und in der Landnutzung wirken sich daher direkt auf seine Verbreitung aus.
Langfristig hängt das Vorkommen des Gold-Röhrlings davon ab, ob stabile, gesunde Lärchenbestände erhalten bleiben.
Bedrohungen durch den Menschen
Auch direkte menschliche Einflüsse können die Art beeinträchtigen:
Der Schutz vielfältiger, naturnaher Lebensräume hilft nicht nur dem Gold-Röhrling, sondern dem gesamten Waldökosystem.
Wichtiger Hinweis
Auf unserer Internetpräsenz geben wir keinerlei Bestimmungsgarantien oder Verzehrempfehlungen. Alle Informationen dienen ausschließlich der allgemeinen Naturkunde. Zur sicheren Bestimmung muss ausnahmslos eine professionelle Beratungsstelle (z. B. Pilzsachverständige oder offizielle Pilzberatungsstellen) aufgesucht werden.
In der Aufnahme von Dieter Zinßer
Der Gold-Röhrling, auch Goldgelber Lärchen-Röhrling genannt (Suillus grevillei), ist ein auffällig gefärbter Röhrenpilz aus der Familie der Schmierröhrlingsverwandten.
Merkmale:
- Hut: Leuchtend goldgelb bis orangegelb, oft glänzend und bei feuchter Witterung stark schmierig. Durchmesser meist 5–12 cm.
- Röhren/Poren: Gelb bis goldgelb, feinporig und weich.
- Stiel: Gelblich, häufig mit einem deutlichen, häutigen Ring.
- Fleisch: Gelblich, weich, ohne starke Verfärbung beim Anschneiden.
- Geruch/Geschmack: Mild und unauffällig.
Lebensweise:
Der Gold-Röhrling lebt in enger Mykorrhiza-Symbiose mit Lärchen. Er kommt daher fast ausschließlich dort vor, wo diese Bäume wachsen – in Parks, Forsten, Gärten oder naturnahen Mischwäldern. Seine Fruchtkörper erscheinen meist von Sommer bis in den späten Herbst.
Perspektiven im Wandel von Lebensraum und Klima
Die Zukunft des Gold-Röhrlings ist eng mit der Zukunft der Lärche verknüpft. Veränderungen im Klima und in der Landnutzung wirken sich daher direkt auf seine Verbreitung aus.
- Klimawandel: Steigende Temperaturen, längere Trockenperioden und extreme Wetterereignisse können Lärchenbestände schwächen. Geschwächte Bäume bilden weniger stabile Symbiosen mit Pilzen.
- Verschiebung von Verbreitungsgebieten: In einigen Regionen könnten Lärchen künftig schlechter wachsen, während sich geeignete Standorte in höhere Lagen oder nördlichere Gebiete verlagern.
- Veränderte Fruchtzeiten: Mildere Herbste oder trockene Sommer können das Auftreten der Fruchtkörper beeinflussen – sowohl zeitlich als auch in ihrer Häufigkeit.
Langfristig hängt das Vorkommen des Gold-Röhrlings davon ab, ob stabile, gesunde Lärchenbestände erhalten bleiben.
Bedrohungen durch den Menschen
Auch direkte menschliche Einflüsse können die Art beeinträchtigen:
- Forstwirtschaftliche Veränderungen: Der Rückgang von Lärchen oder die Umstellung auf andere Baumarten reduziert geeignete Lebensräume.
- Flächenversiegelung und Bebauung: Parks, Grünflächen und Waldränder gehen verloren.
- Bodenverdichtung: Intensive Nutzung durch Fahrzeuge oder starken Besucherdruck kann das empfindliche Myzel im Boden schädigen.
- Umweltbelastungen: Schadstoffe und Bodenveränderungen beeinträchtigen das ökologische Gleichgewicht, von dem Pilz und Baum abhängig sind.
Der Schutz vielfältiger, naturnaher Lebensräume hilft nicht nur dem Gold-Röhrling, sondern dem gesamten Waldökosystem.
Wichtiger Hinweis
Auf unserer Internetpräsenz geben wir keinerlei Bestimmungsgarantien oder Verzehrempfehlungen. Alle Informationen dienen ausschließlich der allgemeinen Naturkunde. Zur sicheren Bestimmung muss ausnahmslos eine professionelle Beratungsstelle (z. B. Pilzsachverständige oder offizielle Pilzberatungsstellen) aufgesucht werden.
In der Aufnahme von Dieter Zinßer
- Leuchtend gelber Gold-Röhrling am Fuß einer Lärche
Artenschutz in Franken®
Amphibienaufstieg installiert

Wenn der Weg endet – Gefahren für wandernde Amphibien
28.02./01.03.2026
Immer wieder beobachten wir Situationen, in denen Amphibien in künstliche Strukturen geraten, aus denen sie aus eigener Kraft nicht mehr entkommen können. Steile Schächte, Bordsteinkanten, Entwässerungsanlagen oder bauliche Vertiefungen werden zur tödlichen Falle. Die Tiere bleiben darin gefangen, erschöpfen sich oder vertrocknen. In anderen Fällen stehen sie plötzlich vor einer unüberwindbaren Barriere, die ihnen den weiteren Weg versperrt – und damit den Zugang zu ihren Laichgewässern unmöglich macht.
28.02./01.03.2026
- Jedes Jahr im Frühjahr machen sich Amphibien wie die Erdkröte, der Grasfrosch oder der Teichmolch auf den Weg zu ihren angestammten Laichgewässern. Diese Wanderungen folgen uralten Routen, die sich über Generationen bewährt haben. Doch unsere heutige Landschaft hat sich stark verändert – oft mit fatalen Folgen für die Tiere.
Immer wieder beobachten wir Situationen, in denen Amphibien in künstliche Strukturen geraten, aus denen sie aus eigener Kraft nicht mehr entkommen können. Steile Schächte, Bordsteinkanten, Entwässerungsanlagen oder bauliche Vertiefungen werden zur tödlichen Falle. Die Tiere bleiben darin gefangen, erschöpfen sich oder vertrocknen. In anderen Fällen stehen sie plötzlich vor einer unüberwindbaren Barriere, die ihnen den weiteren Weg versperrt – und damit den Zugang zu ihren Laichgewässern unmöglich macht.
Das Ergebnis ist leises, oft unbemerktes Sterben und ein weiterer Verlust für ohnehin stark unter Druck stehende Amphibienpopulationen.
Eine praxisnahe Lösung aus Verantwortung
Nach intensiver Beobachtung, fachlichem Austausch und reiflicher Überlegung haben wir uns entschlossen, aktiv zu handeln. Aus dieser Arbeit heraus entstand eine Aufstiegshilfe, die speziell dafür entwickelt wurde, Amphibien sicher aus solchen Gefahrenbereichen herauszuführen oder ihnen das Überwinden von Barrieren zu ermöglichen.
Im Mittelpunkt standen dabei:
- Nachhaltigkeit bei Material und Bauweise
- Praxisnahe Funktionalität für den realen Einsatz vor Ort
- eine einfache Integration in bestehende Strukturen
- sowie die Orientierung am natürlichen Verhalten der Tiere
Die Aufstiegshilfe soll nicht nur kurzfristig helfen, sondern langfristig einen Beitrag zum Amphibienschutz leisten.
Praxistest im Frühjahr 2026
Im Frühjahr 2026 werden wir diese Aufstiegshilfe erstmals unter realen Bedingungen erproben. Dabei werden wir genau beobachten, wie sie von Erdkröte & Co. angenommen wird und welche Verbesserungen sich möglicherweise ergeben.
Selbstverständlich werden wir transparent über die Ergebnisse berichten – über Erfolge ebenso wie über Herausforderungen. Denn wir sind überzeugt: Nur durch Beobachtung, Anpassung und gemeinsames Lernen können wir wirksame Lösungen für den Artenschutz entwickeln.
In der Aufnahme
- rechtzeitig vor der einsetzenden Amphibienwanderung konnte der Amphibienaufstieg installiert werden
Artenschutz in Franken®
Winterstille – Dezember 2025 / Februar 2026

Winterstille – Dezember 2025 / Februar 2026
28.02./01.03.2026
Ende Dezember 2025 senkte sich die Kälte langsam über die Landschaft. Die Temperaturen fielen weit unter den Gefrierpunkt, und mit ihnen veränderte sich der Blick auf die Natur. Was gestern noch weich und beweglich war, erstarrte über Nacht zu feinen Strukturen aus Eis. Diese Witterung setzte sich bis in den Februar 2026 hinein fort.
An Blättern und Zweigen bildeten sich Kristalle.
Jeder Hauch von Feuchtigkeit wurde sichtbar, jede Unebenheit der Oberfläche zeichnete sich neu ab. Das Eis legte sich nicht schwer, sondern behutsam über die Pflanzen – als würde es ihre Formen bewahren wollen. Adern in Blättern traten hervor, Knospen wirkten wie in Glas eingeschlossen, Zweige wurden zu Trägern filigraner Muster.
28.02./01.03.2026
Ende Dezember 2025 senkte sich die Kälte langsam über die Landschaft. Die Temperaturen fielen weit unter den Gefrierpunkt, und mit ihnen veränderte sich der Blick auf die Natur. Was gestern noch weich und beweglich war, erstarrte über Nacht zu feinen Strukturen aus Eis. Diese Witterung setzte sich bis in den Februar 2026 hinein fort.
An Blättern und Zweigen bildeten sich Kristalle.
Jeder Hauch von Feuchtigkeit wurde sichtbar, jede Unebenheit der Oberfläche zeichnete sich neu ab. Das Eis legte sich nicht schwer, sondern behutsam über die Pflanzen – als würde es ihre Formen bewahren wollen. Adern in Blättern traten hervor, Knospen wirkten wie in Glas eingeschlossen, Zweige wurden zu Trägern filigraner Muster.
Diese frostigen Tage waren mehr als ein ästhetischer Moment. Sie zeigten, wie anpassungsfähig Pflanzen sind und wie sensibel zugleich. Unter der Eisschicht ruhte das Leben, geschützt durch jahrtausendealte Strategien des Überdauerns. Stillstand bedeutete hier nicht Ende, sondern Vorbereitung.
Solche Kälteperioden sind Teil natürlicher Winter. Sie beeinflussen ökologische Kreisläufe, regulieren Populationen und schaffen Voraussetzungen für einen Neubeginn im Frühjahr. Gleichzeitig erinnern sie daran, wie stark Witterungsextreme Landschaften prägen – und wie wichtig stabile, vielfältige Ökosysteme sind, um diese Phasen zu überstehen.
Die Aufnahmen dieser Diashow halten einen Moment fest, in dem die Natur nichts erklärt und nichts fordert. Sie zeigt sich einfach. Zerbrechlich und widerstandsfähig zugleich. Ein Winterbild, das leise erzählt, wie eng Schönheit, Ruhe und Schutz miteinander verbunden sind.
Solche Kälteperioden sind Teil natürlicher Winter. Sie beeinflussen ökologische Kreisläufe, regulieren Populationen und schaffen Voraussetzungen für einen Neubeginn im Frühjahr. Gleichzeitig erinnern sie daran, wie stark Witterungsextreme Landschaften prägen – und wie wichtig stabile, vielfältige Ökosysteme sind, um diese Phasen zu überstehen.
Die Aufnahmen dieser Diashow halten einen Moment fest, in dem die Natur nichts erklärt und nichts fordert. Sie zeigt sich einfach. Zerbrechlich und widerstandsfähig zugleich. Ein Winterbild, das leise erzählt, wie eng Schönheit, Ruhe und Schutz miteinander verbunden sind.
Artenschutz in Franken®
Stark gefährdet - Der Nördliche Kammmolch (Triturus cristatus) in Bayern

Der Nördliche Kammmolch (Triturus cristatus)
27/28.02.2026
Unter der Wasseroberfläche bewegte sich lautlos ein dunkler Körper. Mit elegantem Schlag seines seitlich abgeflachten Schwanzes glitt ein Kammmolch durch das klare Wasser. Sein gezackter Rückenkamm stand im Licht wie eine kleine Krone. Für die meisten Menschen blieb dieser Moment verborgen – doch für den Molch begann gerade die wichtigste Zeit des Jahres: die Fortpflanzungszeit.
27/28.02.2026
- Ein warmer Frühlingsregen hatte die Luft über der kleinen Senke am Waldrand erfüllt. Zwischen frischen Gräsern und jungen Weidenzweigen schimmerte ein flacher Tümpel.
Unter der Wasseroberfläche bewegte sich lautlos ein dunkler Körper. Mit elegantem Schlag seines seitlich abgeflachten Schwanzes glitt ein Kammmolch durch das klare Wasser. Sein gezackter Rückenkamm stand im Licht wie eine kleine Krone. Für die meisten Menschen blieb dieser Moment verborgen – doch für den Molch begann gerade die wichtigste Zeit des Jahres: die Fortpflanzungszeit.
Artbeschreibung
Der Nördliche Kammmolch ist die größte in Mitteleuropa vorkommende Molchart und gehört zur Familie der Echten Salamander (Salamandridae). Erwachsene Tiere erreichen eine Länge von etwa 12 bis 18 Zentimetern. Auffällig ist die dunkle, meist schwarzbraune Oberseite mit warziger Haut. Die Bauchseite ist gelb bis orange gefärbt und trägt ein individuelles schwarzes Fleckenmuster – vergleichbar mit einem Fingerabdruck.
Während der Fortpflanzungszeit im Frühjahr entwickeln die Männchen ihren charakteristischen, gezackten Rückenkamm, der vom Kopf bis zum Schwanz verläuft. Diese Phase verbringen die Tiere im Wasser. Nach der Paarungszeit wandern sie in ihre Landlebensräume ab.
Typische Lebensräume sind:
Die Nahrung besteht aus Insekten, Würmern, Schnecken und anderen kleinen Wirbellosen. Als Amphibie spielt der Kammmolch eine wichtige Rolle im Ökosystem und ist ein Indikator für naturnahe, gut vernetzte Lebensräume.
Perspektiven im Wandel: Lebensraumveränderung und Klimawandel
Die Zukunft des Nördlichen Kammmolchs ist eng mit dem Zustand seiner Gewässer verbunden. Viele seiner Fortpflanzungsgewässer sind in den vergangenen Jahrzehnten verschwunden oder stark verändert worden.
Der Klimawandel verschärft die Situation:
Gleichzeitig können extreme Wetterereignisse wie Starkregen Laich und Larven gefährden. Ohne ausreichend dauerhaft wasserführende, aber fischfreie Gewässer wird die erfolgreiche Fortpflanzung zunehmend schwieriger. Dennoch zeigt der Kammmolch eine gewisse Anpassungsfähigkeit – vorausgesetzt, geeignete Gewässer werden erhalten, neu angelegt und miteinander vernetzt.
Bedrohung durch den Menschen
Der größte Einfluss auf die Bestände des Nördlichen Kammmolchs geht vom Menschen aus. Zu den wichtigsten Gefährdungsfaktoren zählen:
Verlust von Kleingewässern
Durch Entwässerung, Bebauung oder landwirtschaftliche Nutzung verschwinden wichtige Laichgewässer.
Eintrag von Fischen
Besatzmaßnahmen in kleinen Gewässern führen häufig dazu, dass Eier und Larven gefressen werden.
Intensive Landwirtschaft
Pestizide und Nährstoffeinträge verschlechtern die Wasserqualität und beeinträchtigen die Nahrungsgrundlage.
Zerschneidung der Landschaft
Straßen und Siedlungen behindern Wanderbewegungen zwischen Wasser- und Landlebensräumen.
Lebensraumverarmung an Land
Das Entfernen von Hecken, Totholz und Saumstrukturen reduziert wichtige Versteck- und Überwinterungsplätze.
Schutzmaßnahmen wie die Anlage neuer Tümpel, der Verzicht auf Fischbesatz, extensivere Landnutzung und Amphibienleiteinrichtungen an Straßen tragen entscheidend zum Erhalt der Art bei.
In der Aufnahme
Der Nördliche Kammmolch ist die größte in Mitteleuropa vorkommende Molchart und gehört zur Familie der Echten Salamander (Salamandridae). Erwachsene Tiere erreichen eine Länge von etwa 12 bis 18 Zentimetern. Auffällig ist die dunkle, meist schwarzbraune Oberseite mit warziger Haut. Die Bauchseite ist gelb bis orange gefärbt und trägt ein individuelles schwarzes Fleckenmuster – vergleichbar mit einem Fingerabdruck.
Während der Fortpflanzungszeit im Frühjahr entwickeln die Männchen ihren charakteristischen, gezackten Rückenkamm, der vom Kopf bis zum Schwanz verläuft. Diese Phase verbringen die Tiere im Wasser. Nach der Paarungszeit wandern sie in ihre Landlebensräume ab.
Typische Lebensräume sind:
- Fischfreie, sonnige Stillgewässer wie Tümpel, Weiher oder Gräben
- Strukturreiche Umgebung mit Wiesen, Hecken und Gehölzen
- Versteckmöglichkeiten an Land, etwa unter Totholz, Steinen oder in Erdhöhlen
Die Nahrung besteht aus Insekten, Würmern, Schnecken und anderen kleinen Wirbellosen. Als Amphibie spielt der Kammmolch eine wichtige Rolle im Ökosystem und ist ein Indikator für naturnahe, gut vernetzte Lebensräume.
Perspektiven im Wandel: Lebensraumveränderung und Klimawandel
Die Zukunft des Nördlichen Kammmolchs ist eng mit dem Zustand seiner Gewässer verbunden. Viele seiner Fortpflanzungsgewässer sind in den vergangenen Jahrzehnten verschwunden oder stark verändert worden.
Der Klimawandel verschärft die Situation:
- Längere Trockenperioden lassen Kleingewässer frühzeitig austrocknen.
- Höhere Temperaturen beeinflussen die Wasserqualität und Sauerstoffverhältnisse.
- Verschobene Niederschlagsmuster können die Fortpflanzungszeit stören.
Gleichzeitig können extreme Wetterereignisse wie Starkregen Laich und Larven gefährden. Ohne ausreichend dauerhaft wasserführende, aber fischfreie Gewässer wird die erfolgreiche Fortpflanzung zunehmend schwieriger. Dennoch zeigt der Kammmolch eine gewisse Anpassungsfähigkeit – vorausgesetzt, geeignete Gewässer werden erhalten, neu angelegt und miteinander vernetzt.
Bedrohung durch den Menschen
Der größte Einfluss auf die Bestände des Nördlichen Kammmolchs geht vom Menschen aus. Zu den wichtigsten Gefährdungsfaktoren zählen:
Verlust von Kleingewässern
Durch Entwässerung, Bebauung oder landwirtschaftliche Nutzung verschwinden wichtige Laichgewässer.
Eintrag von Fischen
Besatzmaßnahmen in kleinen Gewässern führen häufig dazu, dass Eier und Larven gefressen werden.
Intensive Landwirtschaft
Pestizide und Nährstoffeinträge verschlechtern die Wasserqualität und beeinträchtigen die Nahrungsgrundlage.
Zerschneidung der Landschaft
Straßen und Siedlungen behindern Wanderbewegungen zwischen Wasser- und Landlebensräumen.
Lebensraumverarmung an Land
Das Entfernen von Hecken, Totholz und Saumstrukturen reduziert wichtige Versteck- und Überwinterungsplätze.
Schutzmaßnahmen wie die Anlage neuer Tümpel, der Verzicht auf Fischbesatz, extensivere Landnutzung und Amphibienleiteinrichtungen an Straßen tragen entscheidend zum Erhalt der Art bei.
In der Aufnahme
- Vom Verkehrstod gerettet - auf der Wanderung zum Laichgewässer befindliches Kammmolchmännchen
Artenschutz in Franken®
Europäischer Iltis / Waldiltis (Mustela putorius)

Der Europäische Iltis / Waldiltis (Mustela putorius)
27/28.02.2026
Der Iltis hielt inne, hob die Nase und prüfte die Umgebung. Ein Rascheln – vielleicht eine Maus. Mit geschmeidigen Bewegungen verschwand er zwischen Weidenwurzeln und Uferbüschen. Für den Menschen blieb er unsichtbar, doch für die Landschaft war er ein wichtiger, heimlicher Bewohner – ein Jäger der Nacht, angepasst an ein Leben zwischen Wald, Wasser und Wiesen.
27/28.02.2026
- In der Dämmerung eines milden Frühlingsabends schob sich ein schlanker Schatten lautlos durch das hohe Gras am Rand eines kleinen Baches. Die Luft roch nach feuchter Erde und frischem Laub.
Der Iltis hielt inne, hob die Nase und prüfte die Umgebung. Ein Rascheln – vielleicht eine Maus. Mit geschmeidigen Bewegungen verschwand er zwischen Weidenwurzeln und Uferbüschen. Für den Menschen blieb er unsichtbar, doch für die Landschaft war er ein wichtiger, heimlicher Bewohner – ein Jäger der Nacht, angepasst an ein Leben zwischen Wald, Wasser und Wiesen.
Artbeschreibung
Der Europäische Iltis, auch Waldiltis genannt, gehört zur Familie der Marder (Mustelidae). Mit einer Körperlänge von etwa 35 bis 45 Zentimetern (ohne Schwanz) und einem Gewicht von rund 600 bis 1.500 Gramm ist er ein mittelgroßer Vertreter seiner Familie. Typisch ist sein dunkelbraunes Fell mit hellerer Unterwolle sowie die auffällige, maskenartige Gesichtszeichnung.
Der Iltis ist überwiegend dämmerungs- und nachtaktiv. Er bewohnt strukturreiche Landschaften wie:
Als Nahrung dienen ihm vor allem Kleinsäuger, Amphibien, Vögel und deren Eier. Besonders Frösche spielen in vielen Regionen eine wichtige Rolle. Der Iltis nutzt vorhandene Verstecke wie Baumhöhlen, Wurzelbereiche, alte Baue anderer Tiere oder dichtes Gestrüpp.
Ökologisch ist der Waldiltis ein wichtiger Regulator von Kleintierpopulationen und ein Indikator für strukturreiche, naturnahe Lebensräume.
Lebensraumveränderung und Klimawandel – Perspektiven für den Iltis
Die Zukunft des Europäischen Iltis hängt stark von der Entwicklung seiner Lebensräume ab. In vielen Regionen sind Feuchtgebiete entwässert oder stark verändert worden. Da Amphibien einen bedeutenden Teil seiner Nahrung darstellen, wirkt sich der Rückgang von Gewässern und Laichplätzen direkt auf seine Bestände aus.
Der Klimawandel verstärkt diese Probleme:
Gleichzeitig kann der Iltis von milden Wintern profitieren, sofern ausreichend strukturreiche Landschaften und Rückzugsräume vorhanden bleiben. Entscheidend für seine langfristige Stabilität ist daher die Erhaltung vernetzter, vielfältiger Lebensräume mit Wasser, Deckung und ausreichend Beutetieren.
Bedrohung durch den Menschen
Die größte Gefahr für den Europäischen Iltis geht direkt oder indirekt vom Menschen aus. Zu den wichtigsten Faktoren zählen:
Lebensraumverlust und -fragmentierung
Intensive Landwirtschaft, Flächenversiegelung und die Entfernung von Hecken und Feldgehölzen reduzieren Verstecke und Wanderkorridore.
Straßenverkehr
Viele Iltisse sterben im Straßenverkehr, da sie bei ihren nächtlichen Wanderungen häufig Verkehrswege überqueren.
Rückgang von Amphibien
Gewässerverschmutzung, Pestizide und Lebensraumverlust betreffen die Nahrungsgrundlage des Iltis erheblich.
Sekundärvergiftungen
Rodentizide (Rattengifte) können über die Nahrungskette aufgenommen werden und tödlich wirken.
Schutzmaßnahmen wie die Wiederherstellung von Feuchtgebieten, die Anlage von Heckenstrukturen, Amphibienschutz sowie die Reduzierung von Giftstoffen in der Umwelt können entscheidend zum Erhalt der Art beitragen.
In der Aufnahme
Der Europäische Iltis, auch Waldiltis genannt, gehört zur Familie der Marder (Mustelidae). Mit einer Körperlänge von etwa 35 bis 45 Zentimetern (ohne Schwanz) und einem Gewicht von rund 600 bis 1.500 Gramm ist er ein mittelgroßer Vertreter seiner Familie. Typisch ist sein dunkelbraunes Fell mit hellerer Unterwolle sowie die auffällige, maskenartige Gesichtszeichnung.
Der Iltis ist überwiegend dämmerungs- und nachtaktiv. Er bewohnt strukturreiche Landschaften wie:
- Feuchtgebiete und Bachufer
- Waldränder und Heckenlandschaften
- Wiesen mit dichter Vegetation
- Extensiv genutzte Agrarflächen
Als Nahrung dienen ihm vor allem Kleinsäuger, Amphibien, Vögel und deren Eier. Besonders Frösche spielen in vielen Regionen eine wichtige Rolle. Der Iltis nutzt vorhandene Verstecke wie Baumhöhlen, Wurzelbereiche, alte Baue anderer Tiere oder dichtes Gestrüpp.
Ökologisch ist der Waldiltis ein wichtiger Regulator von Kleintierpopulationen und ein Indikator für strukturreiche, naturnahe Lebensräume.
Lebensraumveränderung und Klimawandel – Perspektiven für den Iltis
Die Zukunft des Europäischen Iltis hängt stark von der Entwicklung seiner Lebensräume ab. In vielen Regionen sind Feuchtgebiete entwässert oder stark verändert worden. Da Amphibien einen bedeutenden Teil seiner Nahrung darstellen, wirkt sich der Rückgang von Gewässern und Laichplätzen direkt auf seine Bestände aus.
Der Klimawandel verstärkt diese Probleme:
- Häufigere Trockenperioden lassen Kleingewässer verschwinden.
- Extreme Wetterereignisse verändern Vegetationsstrukturen.
- Verschiebungen in der Amphibienpopulation beeinflussen das Nahrungsangebot.
Gleichzeitig kann der Iltis von milden Wintern profitieren, sofern ausreichend strukturreiche Landschaften und Rückzugsräume vorhanden bleiben. Entscheidend für seine langfristige Stabilität ist daher die Erhaltung vernetzter, vielfältiger Lebensräume mit Wasser, Deckung und ausreichend Beutetieren.
Bedrohung durch den Menschen
Die größte Gefahr für den Europäischen Iltis geht direkt oder indirekt vom Menschen aus. Zu den wichtigsten Faktoren zählen:
Lebensraumverlust und -fragmentierung
Intensive Landwirtschaft, Flächenversiegelung und die Entfernung von Hecken und Feldgehölzen reduzieren Verstecke und Wanderkorridore.
Straßenverkehr
Viele Iltisse sterben im Straßenverkehr, da sie bei ihren nächtlichen Wanderungen häufig Verkehrswege überqueren.
Rückgang von Amphibien
Gewässerverschmutzung, Pestizide und Lebensraumverlust betreffen die Nahrungsgrundlage des Iltis erheblich.
Sekundärvergiftungen
Rodentizide (Rattengifte) können über die Nahrungskette aufgenommen werden und tödlich wirken.
Schutzmaßnahmen wie die Wiederherstellung von Feuchtgebieten, die Anlage von Heckenstrukturen, Amphibienschutz sowie die Reduzierung von Giftstoffen in der Umwelt können entscheidend zum Erhalt der Art beitragen.
In der Aufnahme
- In Deutschland nunmehr auf der Roten Liste angekommen ... der Europäische Iltis ...er wird als "im Bestand gefährdet" geführt ... ein Grund für den Rückgang sind hohe Todesraten welche das Tier durch den Straßenverkehr ereilen.
Artenschutz in Franken®
Waldvöglein (Cephalanthera damasonium)

Das Waldvöglein (Cephalanthera damasonium)
27/28.02.2026
Das Sonnenlicht fiel in schmalen Streifen durch das junge Laub eines Buchenwaldes. Zwischen den frischen Grüntönen des Frühlings entdeckte eine Spaziergängerin eine schlanke Pflanze mit zarten, cremeweißen Blüten.
Sie wirkte unscheinbar und doch besonders – fast so, als wolle sie nur von aufmerksamen Beobachtern gefunden werden. Ruhig und zurückhaltend stand dort das Weißes Waldvöglein (Cephalanthera damasonium), eine Orchidee, die das Halbdunkel des Waldes liebt.
27/28.02.2026
- Ein stiller Fund im Frühlingswald
Das Sonnenlicht fiel in schmalen Streifen durch das junge Laub eines Buchenwaldes. Zwischen den frischen Grüntönen des Frühlings entdeckte eine Spaziergängerin eine schlanke Pflanze mit zarten, cremeweißen Blüten.
Sie wirkte unscheinbar und doch besonders – fast so, als wolle sie nur von aufmerksamen Beobachtern gefunden werden. Ruhig und zurückhaltend stand dort das Weißes Waldvöglein (Cephalanthera damasonium), eine Orchidee, die das Halbdunkel des Waldes liebt.
Artbeschreibung
Das Weiße Waldvöglein gehört zur Familie der Orchideen (Orchidaceae) und ist eine mehrjährige, krautige Pflanze. Es erreicht Wuchshöhen von etwa 20 bis 60 Zentimetern. Der aufrechte Stängel trägt mehrere länglich-ovale, hellgrüne Blätter, die wechselständig angeordnet sind.
Die Blüten erscheinen von Mai bis Juni und sind cremeweiß bis leicht gelblich gefärbt. Anders als viele andere Orchideen öffnen sie sich oft nur teilweise. Die Bestäubung erfolgt vor allem durch kleine Insekten, in manchen Fällen kann sich die Art auch selbst bestäuben.
Typische Standorte sind lichte Laubwälder, besonders Buchen- und Mischwälder mit kalkhaltigen, nährstoffarmen Böden. Wie viele Orchideen lebt auch das Weiße Waldvöglein in enger Verbindung mit Bodenpilzen, die für die Keimung und Nährstoffaufnahme unverzichtbar sind.
Perspektiven im Wandel von Lebensraum und Klima
Die Zukunft des Weißen Waldvögleins hängt stark von stabilen, naturnahen Waldökosystemen ab. Die Art bevorzugt halbschattige, wenig gestörte Bereiche mit gleichmäßiger Bodenfeuchtigkeit.
Durch den Klimawandel verändern sich diese Bedingungen. Längere Trockenperioden können die Bodenfeuchtigkeit reduzieren und die empfindliche Zusammenarbeit mit Bodenpilzen beeinträchtigen. Gleichzeitig können häufigere Extremwetterereignisse wie Stürme oder Hitzeperioden die Waldstruktur verändern.
In einigen Regionen könnte eine verstärkte Austrocknung der Waldböden zu einem Rückgang geeigneter Standorte führen. Andererseits profitieren die Pflanzen dort, wo lichte Waldstrukturen erhalten oder wiederhergestellt werden.
Bedrohungen durch den Menschen
Das Weiße Waldvöglein ist regional bereits selten geworden. Die wichtigsten Gefährdungsfaktoren sind:
Der Schutz naturnaher, strukturreicher Wälder und der respektvolle Umgang mit sensiblen Lebensräumen sind entscheidend für den langfristigen Erhalt dieser Waldorchidee.
In der Aufnahme von Albert Meier
Das Weiße Waldvöglein gehört zur Familie der Orchideen (Orchidaceae) und ist eine mehrjährige, krautige Pflanze. Es erreicht Wuchshöhen von etwa 20 bis 60 Zentimetern. Der aufrechte Stängel trägt mehrere länglich-ovale, hellgrüne Blätter, die wechselständig angeordnet sind.
Die Blüten erscheinen von Mai bis Juni und sind cremeweiß bis leicht gelblich gefärbt. Anders als viele andere Orchideen öffnen sie sich oft nur teilweise. Die Bestäubung erfolgt vor allem durch kleine Insekten, in manchen Fällen kann sich die Art auch selbst bestäuben.
Typische Standorte sind lichte Laubwälder, besonders Buchen- und Mischwälder mit kalkhaltigen, nährstoffarmen Böden. Wie viele Orchideen lebt auch das Weiße Waldvöglein in enger Verbindung mit Bodenpilzen, die für die Keimung und Nährstoffaufnahme unverzichtbar sind.
Perspektiven im Wandel von Lebensraum und Klima
Die Zukunft des Weißen Waldvögleins hängt stark von stabilen, naturnahen Waldökosystemen ab. Die Art bevorzugt halbschattige, wenig gestörte Bereiche mit gleichmäßiger Bodenfeuchtigkeit.
Durch den Klimawandel verändern sich diese Bedingungen. Längere Trockenperioden können die Bodenfeuchtigkeit reduzieren und die empfindliche Zusammenarbeit mit Bodenpilzen beeinträchtigen. Gleichzeitig können häufigere Extremwetterereignisse wie Stürme oder Hitzeperioden die Waldstruktur verändern.
In einigen Regionen könnte eine verstärkte Austrocknung der Waldböden zu einem Rückgang geeigneter Standorte führen. Andererseits profitieren die Pflanzen dort, wo lichte Waldstrukturen erhalten oder wiederhergestellt werden.
Bedrohungen durch den Menschen
Das Weiße Waldvöglein ist regional bereits selten geworden. Die wichtigsten Gefährdungsfaktoren sind:
- Intensive Forstwirtschaft, die zu dichten, lichtarmen Beständen führt
- Bodenverdichtung durch Maschinen, wodurch das empfindliche Wurzel- und Pilzsystem gestört wird
- Stickstoffeinträge aus der Luft, die die Standortbedingungen verändern
- Freizeitnutzung, Trittschäden und das Verlassen von Wegen
- Pflücken oder Ausgraben, obwohl alle heimischen Orchideen unter Schutz stehen
- Verlust strukturreicher Laubwälder
Der Schutz naturnaher, strukturreicher Wälder und der respektvolle Umgang mit sensiblen Lebensräumen sind entscheidend für den langfristigen Erhalt dieser Waldorchidee.
In der Aufnahme von Albert Meier
- Die Buchenwälder sind die bevorzugte Heimat des Weißen Waldvögeleins. Einer Knabenkrautart die bis 50 Zentimeter erreichen kann und leider auch schon auf der Roten Liste angekommen ist.Die Blüten zeigt uns die zierliche Orchidee im Mai und Juni.
Artenschutz in Franken®
Bergmolch (Ichthyosaura alpestris)
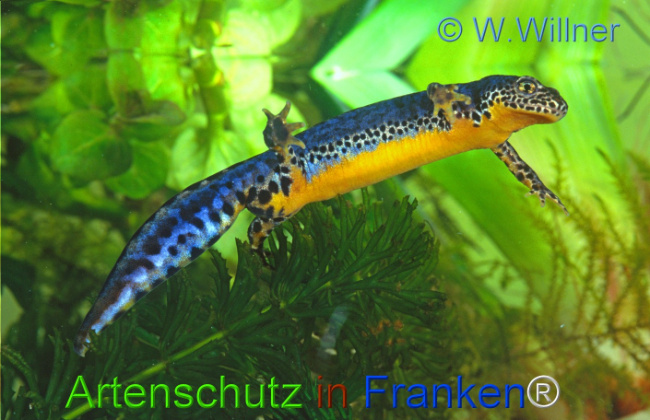
Der Bergmolch (Ichthyosaura alpestris)
26/27.02.2026
Nach einem Sommerregen lag ein kleiner Bergteich still zwischen Felsen und Wiesen. Als sich die Wolken verzogen und die Sonne das Wasser erwärmte, bewegte sich etwas unter der Oberfläche.
Ein kleiner Molch glitt elegant zwischen Wasserpflanzen hindurch. Sein Rücken war dunkel gefärbt, doch sein Bauch leuchtete in kräftigem Orange – ein auffälliger Farbakzent in der klaren Bergwelt. Es war ein Bergmolch (Ichthyosaura alpestris), ein anpassungsfähiger Bewohner unserer Mittel- und Hochlagen.
26/27.02.2026
- Ein leuchtender Fund am Bergteich
Nach einem Sommerregen lag ein kleiner Bergteich still zwischen Felsen und Wiesen. Als sich die Wolken verzogen und die Sonne das Wasser erwärmte, bewegte sich etwas unter der Oberfläche.
Ein kleiner Molch glitt elegant zwischen Wasserpflanzen hindurch. Sein Rücken war dunkel gefärbt, doch sein Bauch leuchtete in kräftigem Orange – ein auffälliger Farbakzent in der klaren Bergwelt. Es war ein Bergmolch (Ichthyosaura alpestris), ein anpassungsfähiger Bewohner unserer Mittel- und Hochlagen.
Artbeschreibung
Der Bergmolch gehört zur Familie der Salamander und Molche (Salamandridae) und ist in weiten Teilen Europas verbreitet. Er erreicht eine Körperlänge von etwa 7 bis 12 Zentimetern. Typisch ist der dunkelgraue bis bläuliche Rücken, während die Bauchseite auffallend orange bis rot gefärbt und meist ungefleckt ist.
Während der Fortpflanzungszeit im Frühjahr und Frühsommer zeigt das Männchen eine besonders intensive Färbung und entwickelt einen niedrigen, gewellten Rückenkamm. In dieser Phase lebt der Bergmolch im Wasser, wo die Paarung stattfindet. Die Weibchen legen ihre Eier einzeln an Wasserpflanzen ab.
Nach der Wasserphase verbringen die Tiere den Großteil des Jahres an Land. Dort halten sie sich in feuchten Verstecken wie unter Steinen, Totholz oder im Moos auf. Als Nahrung dienen kleine wirbellose Tiere wie Insektenlarven, Würmer und Kleinkrebse.
Typische Lebensräume sind kühle, klare Gewässer in Wäldern, auf Almen oder in naturnahen Landschaften – von Tieflagen bis in alpine Regionen.
Perspektiven im Wandel von Lebensraum und Klima
Die Zukunft des Bergmolchs hängt stark von der Verfügbarkeit geeigneter Laichgewässer und feuchter Landlebensräume ab. Kleine, fischfreie Tümpel, Quellbereiche und Bergteiche sind für die Fortpflanzung besonders wichtig.
Durch den Klimawandel verändern sich diese Lebensräume zunehmend. Längere Trockenperioden können dazu führen, dass kleine Gewässer früher austrocknen und die Entwicklung der Larven gefährdet ist. Gleichzeitig führen steigende Temperaturen in höheren Lagen zu Veränderungen der Vegetation und der Bodenfeuchtigkeit.
In höheren Gebirgsregionen könnte der Bergmolch zunächst von milderen Temperaturen profitieren. Langfristig jedoch besteht die Gefahr, dass geeignete kühle und feuchte Lebensräume seltener werden oder sich weiter nach oben verlagern.
Bedrohungen durch den Menschen
Obwohl der Bergmolch regional noch häufig vorkommt, ist er auf naturnahe Strukturen angewiesen. Menschliche Eingriffe können seine Bestände beeinträchtigen:
Der Erhalt von fischfreien Kleingewässern, naturnahen Waldbereichen und strukturreichen Landschaften ist entscheidend für den langfristigen Schutz dieser Amphibienart.
In der Aufnahme von Wolfgang Willner
Der Bergmolch gehört zur Familie der Salamander und Molche (Salamandridae) und ist in weiten Teilen Europas verbreitet. Er erreicht eine Körperlänge von etwa 7 bis 12 Zentimetern. Typisch ist der dunkelgraue bis bläuliche Rücken, während die Bauchseite auffallend orange bis rot gefärbt und meist ungefleckt ist.
Während der Fortpflanzungszeit im Frühjahr und Frühsommer zeigt das Männchen eine besonders intensive Färbung und entwickelt einen niedrigen, gewellten Rückenkamm. In dieser Phase lebt der Bergmolch im Wasser, wo die Paarung stattfindet. Die Weibchen legen ihre Eier einzeln an Wasserpflanzen ab.
Nach der Wasserphase verbringen die Tiere den Großteil des Jahres an Land. Dort halten sie sich in feuchten Verstecken wie unter Steinen, Totholz oder im Moos auf. Als Nahrung dienen kleine wirbellose Tiere wie Insektenlarven, Würmer und Kleinkrebse.
Typische Lebensräume sind kühle, klare Gewässer in Wäldern, auf Almen oder in naturnahen Landschaften – von Tieflagen bis in alpine Regionen.
Perspektiven im Wandel von Lebensraum und Klima
Die Zukunft des Bergmolchs hängt stark von der Verfügbarkeit geeigneter Laichgewässer und feuchter Landlebensräume ab. Kleine, fischfreie Tümpel, Quellbereiche und Bergteiche sind für die Fortpflanzung besonders wichtig.
Durch den Klimawandel verändern sich diese Lebensräume zunehmend. Längere Trockenperioden können dazu führen, dass kleine Gewässer früher austrocknen und die Entwicklung der Larven gefährdet ist. Gleichzeitig führen steigende Temperaturen in höheren Lagen zu Veränderungen der Vegetation und der Bodenfeuchtigkeit.
In höheren Gebirgsregionen könnte der Bergmolch zunächst von milderen Temperaturen profitieren. Langfristig jedoch besteht die Gefahr, dass geeignete kühle und feuchte Lebensräume seltener werden oder sich weiter nach oben verlagern.
Bedrohungen durch den Menschen
Obwohl der Bergmolch regional noch häufig vorkommt, ist er auf naturnahe Strukturen angewiesen. Menschliche Eingriffe können seine Bestände beeinträchtigen:
- Verlust oder Verfüllung von Kleingewässern
- Besatz von Teichen mit Fischen, die Eier und Larven fressen
- Entwässerung von Feuchtgebieten
- Intensive Forst- und Landwirtschaft, die feuchte Rückzugsräume reduziert
- Straßenverkehr, besonders während der Wanderungen zwischen Land- und Wasserlebensräumen
- Freizeitnutzung und Trittschäden an sensiblen Gewässern
- Umweltgifte und Nährstoffeinträge
Der Erhalt von fischfreien Kleingewässern, naturnahen Waldbereichen und strukturreichen Landschaften ist entscheidend für den langfristigen Schutz dieser Amphibienart.
In der Aufnahme von Wolfgang Willner
- Das Männchen im Prachtkleid während der Fortpflanzungszeit
Artenschutz in Franken®
Zweiblättrige Waldhyazinthe (Platanthera bifolia)

Die Zweiblättrige Waldhyazinthe (Platanthera bifolia)
26/27.02.2026
Es war ein warmer Frühsommerabend, als ein Wanderer auf einem schmalen Waldweg innehielt. Die Sonne war bereits hinter den Baumwipfeln verschwunden, doch ein feiner, süßer Duft lag in der Luft. Beim genaueren Hinsehen entdeckte er zwischen Gräsern und Farnen eine schlanke Pflanze mit zarten, weißen Blüten, die im Zwielicht fast zu leuchten schienen. Unscheinbar am Tag, aber geheimnisvoll und duftend in der Dämmerung – so zeigte sich die Zweiblättrige Waldhyazinthe (Platanthera bifolia), eine besondere Orchidee unserer heimischen Landschaften.
26/27.02.2026
- Ein Duft in der Abendluft
Es war ein warmer Frühsommerabend, als ein Wanderer auf einem schmalen Waldweg innehielt. Die Sonne war bereits hinter den Baumwipfeln verschwunden, doch ein feiner, süßer Duft lag in der Luft. Beim genaueren Hinsehen entdeckte er zwischen Gräsern und Farnen eine schlanke Pflanze mit zarten, weißen Blüten, die im Zwielicht fast zu leuchten schienen. Unscheinbar am Tag, aber geheimnisvoll und duftend in der Dämmerung – so zeigte sich die Zweiblättrige Waldhyazinthe (Platanthera bifolia), eine besondere Orchidee unserer heimischen Landschaften.
Artbeschreibung
Die Zweiblättrige Waldhyazinthe gehört zur Familie der Orchideen (Orchidaceae) und ist eine ausdauernde, krautige Pflanze. Ihren Namen verdankt sie den zwei auffälligen, grundständigen Blättern, die breit-oval geformt sind und flach am Boden oder leicht aufrecht stehen.
Der Blütenstand kann eine Höhe von etwa 20 bis 50 Zentimetern erreichen. Er trägt zahlreiche kleine, weiße Einzelblüten, die in einer lockeren Ähre angeordnet sind. Besonders charakteristisch ist ihr intensiver Duft, der vor allem in den Abendstunden und nachts wahrnehmbar ist. Damit lockt die Pflanze nachtaktive Bestäuber wie Schwärmer und Nachtfalter an.
Die Zweiblättrige Waldhyazinthe wächst in lichten Wäldern, auf Waldwiesen, in Moorbereichen sowie auf mageren, nicht zu trockenen Standorten. Wie viele Orchideen lebt sie in enger Symbiose mit Bodenpilzen (Mykorrhiza), die für Keimung und Nährstoffversorgung unerlässlich sind.
Perspektiven im Wandel von Lebensraum und Klima
Die Zukunft der Zweiblättrigen Waldhyazinthe ist eng mit der Qualität ihrer Lebensräume verbunden. Sie bevorzugt halbschattige, nährstoffarme und wenig gestörte Standorte. Veränderungen durch intensive Nutzung, Düngereinträge oder Verbuschung können diese empfindliche Balance stören.
Der Klimawandel bringt zusätzliche Herausforderungen mit sich. Längere Trockenperioden können das Wachstum und die Blütenbildung beeinträchtigen, da die Art auf ausreichend Bodenfeuchtigkeit angewiesen ist. Gleichzeitig können sich durch steigende Temperaturen Vegetationsperioden verschieben, was Auswirkungen auf die Synchronisation mit ihren Bestäubern hat.
In einigen Regionen könnten wärmere Bedingungen zwar eine Ausbreitung begünstigen, doch insgesamt hängt das Überleben der Art stark davon ab, ob geeignete, stabile Lebensräume erhalten bleiben.
Bedrohungen durch den Menschen
Die Zweiblättrige Waldhyazinthe ist vielerorts rückläufig. Zu den wichtigsten menschlichen Einflussfaktoren zählen:
Der Schutz extensiv genutzter Wiesen, naturnaher Wälder und feuchter Standorte sowie das Belassen ungestörter Bereiche sind wichtige Maßnahmen für den langfristigen Erhalt dieser Orchideenart.
In der Aufnahme von Albert Meier
Die Zweiblättrige Waldhyazinthe gehört zur Familie der Orchideen (Orchidaceae) und ist eine ausdauernde, krautige Pflanze. Ihren Namen verdankt sie den zwei auffälligen, grundständigen Blättern, die breit-oval geformt sind und flach am Boden oder leicht aufrecht stehen.
Der Blütenstand kann eine Höhe von etwa 20 bis 50 Zentimetern erreichen. Er trägt zahlreiche kleine, weiße Einzelblüten, die in einer lockeren Ähre angeordnet sind. Besonders charakteristisch ist ihr intensiver Duft, der vor allem in den Abendstunden und nachts wahrnehmbar ist. Damit lockt die Pflanze nachtaktive Bestäuber wie Schwärmer und Nachtfalter an.
Die Zweiblättrige Waldhyazinthe wächst in lichten Wäldern, auf Waldwiesen, in Moorbereichen sowie auf mageren, nicht zu trockenen Standorten. Wie viele Orchideen lebt sie in enger Symbiose mit Bodenpilzen (Mykorrhiza), die für Keimung und Nährstoffversorgung unerlässlich sind.
Perspektiven im Wandel von Lebensraum und Klima
Die Zukunft der Zweiblättrigen Waldhyazinthe ist eng mit der Qualität ihrer Lebensräume verbunden. Sie bevorzugt halbschattige, nährstoffarme und wenig gestörte Standorte. Veränderungen durch intensive Nutzung, Düngereinträge oder Verbuschung können diese empfindliche Balance stören.
Der Klimawandel bringt zusätzliche Herausforderungen mit sich. Längere Trockenperioden können das Wachstum und die Blütenbildung beeinträchtigen, da die Art auf ausreichend Bodenfeuchtigkeit angewiesen ist. Gleichzeitig können sich durch steigende Temperaturen Vegetationsperioden verschieben, was Auswirkungen auf die Synchronisation mit ihren Bestäubern hat.
In einigen Regionen könnten wärmere Bedingungen zwar eine Ausbreitung begünstigen, doch insgesamt hängt das Überleben der Art stark davon ab, ob geeignete, stabile Lebensräume erhalten bleiben.
Bedrohungen durch den Menschen
Die Zweiblättrige Waldhyazinthe ist vielerorts rückläufig. Zu den wichtigsten menschlichen Einflussfaktoren zählen:
- Intensivierung der Landwirtschaft mit Düngung und Bodenbearbeitung
- Aufforstung oder Verdichtung von Wäldern, wodurch lichtreiche Standorte verloren gehen
- Entwässerung von Feuchtgebieten und Mooren
- Freizeitnutzung und Trittschäden in sensiblen Lebensräumen
- Pflücken oder Ausgraben, obwohl Orchideen gesetzlich geschützt sind
- Stickstoffeinträge aus der Luft, die nährstoffarme Standorte verändern
Der Schutz extensiv genutzter Wiesen, naturnaher Wälder und feuchter Standorte sowie das Belassen ungestörter Bereiche sind wichtige Maßnahmen für den langfristigen Erhalt dieser Orchideenart.
In der Aufnahme von Albert Meier
- Naturnahe Wiesen sichern das Überleben der Zweiblättrigen Waldhyazinthe
Artenschutz in Franken®
Rothalsige Silphe (Oiceoptoma thoracicum)

Die Rothalsige Silphe (Oiceoptoma thoracicum)
26/27.02.2026
Das Insekt bewegte sich zielstrebig durch das Unterholz, als hätte es eine wichtige Aufgabe zu erfüllen. Tatsächlich war es auf der Suche nach organischem Material, das es verwerten konnte – ein stiller Helfer im Kreislauf der Natur. Die Begegnung mit der Rothalsige Silphe (Oiceoptoma thoracicum) machte deutlich, wie viele unscheinbare, aber unverzichtbare Akteure in unseren Wäldern leben.
26/27.02.2026
- An einem stillen Herbstmorgen streifte eine Naturbeobachterin durch einen lichten Mischwald. Zwischen feuchtem Laub und morschem Holz entdeckte sie eine kleine, schwarz glänzende Gestalt mit auffallend rötlichem Halsschild.
Das Insekt bewegte sich zielstrebig durch das Unterholz, als hätte es eine wichtige Aufgabe zu erfüllen. Tatsächlich war es auf der Suche nach organischem Material, das es verwerten konnte – ein stiller Helfer im Kreislauf der Natur. Die Begegnung mit der Rothalsige Silphe (Oiceoptoma thoracicum) machte deutlich, wie viele unscheinbare, aber unverzichtbare Akteure in unseren Wäldern leben.
Artbeschreibung
Die Rothalsige Silphe gehört zur Familie der Aaskäfer (Silphidae). Charakteristisch ist ihr schwarzer Körper mit dem deutlich rot bis orange gefärbten Halsschild, der ihr den deutschen Namen verleiht. Die Käfer erreichen eine Länge von etwa 10–16 Millimetern und besitzen kräftige Fühler mit keulenförmigem Ende.
Diese Art ist in großen Teilen Europas verbreitet und bewohnt vor allem Wälder, Waldränder, Parks und strukturreiche Landschaften. Wie viele Aaskäfer ernährt sich die Rothalsige Silphe überwiegend von tierischen Überresten. Dabei spielt sie eine wichtige ökologische Rolle: Sie beschleunigt die Zersetzung von Kadavern und trägt zur Rückführung von Nährstoffen in den Boden bei. Neben Aas werden auch Insektenlarven, Schnecken oder andere kleine wirbellose Tiere aufgenommen.
Die Fortpflanzung erfolgt meist in der Nähe geeigneter Nahrungsquellen. Die Larven entwickeln sich im Boden oder im Umfeld von organischem Material und durchlaufen mehrere Entwicklungsstadien, bevor sie sich verpuppen.
Perspektiven im Wandel von Lebensraum und Klima
Die Zukunft der Rothalsigen Silphe hängt stark von der Entwicklung ihrer Lebensräume ab. Strukturreiche Wälder mit Totholz, Laubstreu und einer natürlichen Tierwelt bieten optimale Bedingungen. Intensive Forstwirtschaft, das Entfernen von Totholz oder die Vereinheitlichung von Waldstrukturen können jedoch die Lebensgrundlagen einschränken.
Der Klimawandel wirkt sich zusätzlich aus. Mildere Winter können einerseits die Überlebensrate erhöhen, andererseits verändern sich Niederschlagsmuster und Bodenfeuchtigkeit – wichtige Faktoren für Larvenentwicklung und Nahrungssuche. Auch Verschiebungen in der Tierwelt beeinflussen das Angebot an Aas und damit die Nahrungsgrundlage.
Langfristig könnte sich das Verbreitungsgebiet nach Norden oder in höhere Lagen verschieben, während lokale Populationen in trockeneren oder stark veränderten Regionen zurückgehen.
Bedrohungen durch den Menschen
Die Rothalsige Silphe ist keine klassisch „bekannte“ bedrohte Art, doch verschiedene menschliche Einflüsse wirken sich indirekt auf ihre Bestände aus:
Naturnahe "Waldpflege", das Belassen von Totholz sowie eine vielfältige Landschaftsstruktur können helfen, stabile Lebensbedingungen zu erhalten.
In der Aufnahme von Albert Meier
Die Rothalsige Silphe gehört zur Familie der Aaskäfer (Silphidae). Charakteristisch ist ihr schwarzer Körper mit dem deutlich rot bis orange gefärbten Halsschild, der ihr den deutschen Namen verleiht. Die Käfer erreichen eine Länge von etwa 10–16 Millimetern und besitzen kräftige Fühler mit keulenförmigem Ende.
Diese Art ist in großen Teilen Europas verbreitet und bewohnt vor allem Wälder, Waldränder, Parks und strukturreiche Landschaften. Wie viele Aaskäfer ernährt sich die Rothalsige Silphe überwiegend von tierischen Überresten. Dabei spielt sie eine wichtige ökologische Rolle: Sie beschleunigt die Zersetzung von Kadavern und trägt zur Rückführung von Nährstoffen in den Boden bei. Neben Aas werden auch Insektenlarven, Schnecken oder andere kleine wirbellose Tiere aufgenommen.
Die Fortpflanzung erfolgt meist in der Nähe geeigneter Nahrungsquellen. Die Larven entwickeln sich im Boden oder im Umfeld von organischem Material und durchlaufen mehrere Entwicklungsstadien, bevor sie sich verpuppen.
Perspektiven im Wandel von Lebensraum und Klima
Die Zukunft der Rothalsigen Silphe hängt stark von der Entwicklung ihrer Lebensräume ab. Strukturreiche Wälder mit Totholz, Laubstreu und einer natürlichen Tierwelt bieten optimale Bedingungen. Intensive Forstwirtschaft, das Entfernen von Totholz oder die Vereinheitlichung von Waldstrukturen können jedoch die Lebensgrundlagen einschränken.
Der Klimawandel wirkt sich zusätzlich aus. Mildere Winter können einerseits die Überlebensrate erhöhen, andererseits verändern sich Niederschlagsmuster und Bodenfeuchtigkeit – wichtige Faktoren für Larvenentwicklung und Nahrungssuche. Auch Verschiebungen in der Tierwelt beeinflussen das Angebot an Aas und damit die Nahrungsgrundlage.
Langfristig könnte sich das Verbreitungsgebiet nach Norden oder in höhere Lagen verschieben, während lokale Populationen in trockeneren oder stark veränderten Regionen zurückgehen.
Bedrohungen durch den Menschen
Die Rothalsige Silphe ist keine klassisch „bekannte“ bedrohte Art, doch verschiedene menschliche Einflüsse wirken sich indirekt auf ihre Bestände aus:
- Lebensraumverlust durch intensive Land- und Forstwirtschaft
- Aufräummaßnahmen im Wald, bei denen Totholz und organisches Material entfernt werden
- Pestizide und Umweltgifte, die Insektenpopulationen allgemein reduzieren
- Straßenverkehr, der sowohl Kleintiere (als Nahrungsquelle) als auch die Käfer selbst gefährdet
- Rückgang der Biodiversität, der die Stabilität der Nahrungsnetze schwächt
Naturnahe "Waldpflege", das Belassen von Totholz sowie eine vielfältige Landschaftsstruktur können helfen, stabile Lebensbedingungen zu erhalten.
In der Aufnahme von Albert Meier
- Rothalsige Silphe (Oiceoptoma thoracicum) an einem Erdkrötenkadaver
Artenschutz in Franken®
Wenn Engagement zum Hindernis erklärt wird – warum Naturschutz unseren Wohlstand sichert

Die leisen Hüter unseres Wohlstands
25/26.02.2026
Ein paar Kilometer weiter kontrolliert ein Rentner Nistkästen. Andere erfassen Amphibienbestände, pflegen Streuobstwiesen oder kartieren Arten für die kommunale Planung. Sie alle tun das freiwillig und meist ohne öffentliche Aufmerksamkeit.
Wenn Bauprojekte angepasst werden müssen, wenn Ausgleichsflächen gefordert sind oder wenn auf den Schutz von Arten und Lebensräumen hingewiesen wird, fällt schnell ein Wort: Bremser. Naturschutz, so heißt es dann, verhindere Entwicklung, koste Geld und gefährde wirtschaftlichen Fortschritt.
Doch diese Sichtweise stellt die Realität auf den Kopf.
25/26.02.2026
- An einem frühen Samstagmorgen steht eine Frau knietief in einer Feuchtwiese und schneidet junge Gehölze zurück, damit seltene Pflanzen wieder Licht bekommen.
Ein paar Kilometer weiter kontrolliert ein Rentner Nistkästen. Andere erfassen Amphibienbestände, pflegen Streuobstwiesen oder kartieren Arten für die kommunale Planung. Sie alle tun das freiwillig und meist ohne öffentliche Aufmerksamkeit.
- Und doch werden genau diese Menschen immer häufiger als Problem wahrgenommen.
Wenn Bauprojekte angepasst werden müssen, wenn Ausgleichsflächen gefordert sind oder wenn auf den Schutz von Arten und Lebensräumen hingewiesen wird, fällt schnell ein Wort: Bremser. Naturschutz, so heißt es dann, verhindere Entwicklung, koste Geld und gefährde wirtschaftlichen Fortschritt.
Doch diese Sichtweise stellt die Realität auf den Kopf.
Wohlstand hat Wurzeln – und sie liegen in der Natur
Unser wirtschaftlicher Erfolg basiert auf funktionierenden Ökosystemen. Fruchtbare Böden, sauberes Wasser, stabile Landschaften, Bestäubung durch Insekten, natürliche Kühlung in Städten, Schutz vor Hochwasser und Erosion – all das ist keine Selbstverständlichkeit. Es ist das Ergebnis intakter Natur.
Wenn Arten verschwinden, Böden ausgelaugt werden und Landschaften ihre ökologische Stabilität verlieren, entsteht ein schleichender Verlust. Zunächst kaum sichtbar, später teuer, oft irreversibel.
Die entscheidende Frage lautet daher nicht:
Was kostet Naturschutz?
Sondern:
Was kostet es, wenn wir ihn unterlassen?
Ehrenamtliche sind keine Verhinderer – sie sind Risikomanager der Gesellschaft
Menschen, die sich ehrenamtlich dem Naturschutz widmen, verfolgen kein wirtschaftliches Eigeninteresse. Sie investieren Zeit, Wissen und Engagement in etwas, das allen zugutekommt: den Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen.
Sie pflegen Lebensräume, sichern Artenvorkommen, sammeln Daten, klären auf und bringen lokale Erfahrung in Planungsprozesse ein. Vor allem aber vertreten sie eine Perspektive, die im politischen und wirtschaftlichen Alltag oft unter Druck gerät: die langfristige Verantwortung.
Wo sie auf Probleme hinweisen, geht es nicht um Verhinderung. Es geht um Vorsorge. Um das Vermeiden von Schäden, die später deutlich höhere Kosten verursachen würden – ökologisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich.
Kurzfristiger Gewinn gegen langfristige Stabilität
Viele Konflikte entstehen dort, wo wirtschaftliche Entscheidungen unter hohem Zeit- und Renditedruck stehen. Naturschutz erscheint dann als Hindernis. Tatsächlich macht er sichtbar, wo natürliche Grenzen erreicht sind.
Eine Entwicklung, die ihre eigenen Grundlagen zerstört, ist kein Fortschritt. Sie ist ein Verbrauch von Zukunft.
Echter Wohlstand entsteht dort, wo wirtschaftliche Nutzung und ökologische Tragfähigkeit zusammen gedacht werden. Wo Flächen nicht nur verwertet, sondern erhalten werden. Wo Wachstum nicht auf Kosten der Stabilität von morgen geht.
Ein Perspektivwechsel ist überfällig
Die ehrenamtlichen Naturschützerinnen und Naturschützer dieses Landes sind keine Gegner wirtschaftlicher Entwicklung. Sie sind ihre stillen Verbündeten. Sie arbeiten nicht gegen Fortschritt – sie arbeiten dafür, dass Fortschritt Bestand hat.
Statt sie als Hemmnis zu betrachten, sollten wir sie als das erkennen, was sie sind:
Eine Gesellschaft, die dieses Engagement abwertet, riskiert mehr als nur Artenvielfalt. Sie gefährdet die Grundlagen ihres eigenen Wohlstands.
Denn am Ende entscheidet nicht allein die Stärke unserer Wirtschaft über unsere Zukunft. Entscheidend ist, ob wir die natürlichen Systeme erhalten, von denen diese Wirtschaft – und unser Leben – abhängen.
Biologischer Wohlstand ist kein Gegenpol zum wirtschaftlichen Wohlstand.
Und diejenigen, die ihn ehrenamtlich schützen, sind keine Bremser.
Wie wertvoll dieses Engagement zu bewerten ist wird vielfach erst dann sichtbar wenn niemand mehr da ist der sich diesem Engagement verschreibt!
In der Aufnahme von Johannes Hohenegger
Unser wirtschaftlicher Erfolg basiert auf funktionierenden Ökosystemen. Fruchtbare Böden, sauberes Wasser, stabile Landschaften, Bestäubung durch Insekten, natürliche Kühlung in Städten, Schutz vor Hochwasser und Erosion – all das ist keine Selbstverständlichkeit. Es ist das Ergebnis intakter Natur.
Wenn Arten verschwinden, Böden ausgelaugt werden und Landschaften ihre ökologische Stabilität verlieren, entsteht ein schleichender Verlust. Zunächst kaum sichtbar, später teuer, oft irreversibel.
Die entscheidende Frage lautet daher nicht:
Was kostet Naturschutz?
Sondern:
Was kostet es, wenn wir ihn unterlassen?
Ehrenamtliche sind keine Verhinderer – sie sind Risikomanager der Gesellschaft
Menschen, die sich ehrenamtlich dem Naturschutz widmen, verfolgen kein wirtschaftliches Eigeninteresse. Sie investieren Zeit, Wissen und Engagement in etwas, das allen zugutekommt: den Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen.
Sie pflegen Lebensräume, sichern Artenvorkommen, sammeln Daten, klären auf und bringen lokale Erfahrung in Planungsprozesse ein. Vor allem aber vertreten sie eine Perspektive, die im politischen und wirtschaftlichen Alltag oft unter Druck gerät: die langfristige Verantwortung.
Wo sie auf Probleme hinweisen, geht es nicht um Verhinderung. Es geht um Vorsorge. Um das Vermeiden von Schäden, die später deutlich höhere Kosten verursachen würden – ökologisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich.
Kurzfristiger Gewinn gegen langfristige Stabilität
Viele Konflikte entstehen dort, wo wirtschaftliche Entscheidungen unter hohem Zeit- und Renditedruck stehen. Naturschutz erscheint dann als Hindernis. Tatsächlich macht er sichtbar, wo natürliche Grenzen erreicht sind.
Eine Entwicklung, die ihre eigenen Grundlagen zerstört, ist kein Fortschritt. Sie ist ein Verbrauch von Zukunft.
Echter Wohlstand entsteht dort, wo wirtschaftliche Nutzung und ökologische Tragfähigkeit zusammen gedacht werden. Wo Flächen nicht nur verwertet, sondern erhalten werden. Wo Wachstum nicht auf Kosten der Stabilität von morgen geht.
Ein Perspektivwechsel ist überfällig
Die ehrenamtlichen Naturschützerinnen und Naturschützer dieses Landes sind keine Gegner wirtschaftlicher Entwicklung. Sie sind ihre stillen Verbündeten. Sie arbeiten nicht gegen Fortschritt – sie arbeiten dafür, dass Fortschritt Bestand hat.
Statt sie als Hemmnis zu betrachten, sollten wir sie als das erkennen, was sie sind:
- Hüter unseres Naturkapitals
- Frühwarnsystem für ökologische Risiken
- Partner für nachhaltige Planung
- Menschen, die Verantwortung über den eigenen Vorteil hinaus übernehmen
Eine Gesellschaft, die dieses Engagement abwertet, riskiert mehr als nur Artenvielfalt. Sie gefährdet die Grundlagen ihres eigenen Wohlstands.
Denn am Ende entscheidet nicht allein die Stärke unserer Wirtschaft über unsere Zukunft. Entscheidend ist, ob wir die natürlichen Systeme erhalten, von denen diese Wirtschaft – und unser Leben – abhängen.
Biologischer Wohlstand ist kein Gegenpol zum wirtschaftlichen Wohlstand.
- Er ist seine Voraussetzung.
Und diejenigen, die ihn ehrenamtlich schützen, sind keine Bremser.
- Sie sichern das, was uns morgen noch tragen soll.
Wie wertvoll dieses Engagement zu bewerten ist wird vielfach erst dann sichtbar wenn niemand mehr da ist der sich diesem Engagement verschreibt!
In der Aufnahme von Johannes Hohenegger
- Haselmaus
Artenschutz in Franken®
Kegelrobbe (Halichoerus grypus)

Die Kegelrobbe (Halichoerus grypus)
25/26.02.2026
Ihr Atem bildet kleine Wolken in der kühlen Luft. Neben ihr liegt ein Jungtier, noch mit hellem Fell, das vorsichtig die Umgebung erkundet. Möwen kreisen über dem Wasser, und mit der steigenden Flut wird die Sandbank bald verschwinden. Ruhig gleitet die Mutter schließlich ins Meer zurück – in die Welt, die ihr Zuhause und ihre Lebensgrundlage ist.
25/26.02.2026
- Der Morgennebel liegt noch über der Küste, als die ersten Wellen sanft an den Strand rollen. Auf einer Sandbank, nur wenige hundert Meter vom Ufer entfernt, hebt eine große Robbe langsam den Kopf.
Ihr Atem bildet kleine Wolken in der kühlen Luft. Neben ihr liegt ein Jungtier, noch mit hellem Fell, das vorsichtig die Umgebung erkundet. Möwen kreisen über dem Wasser, und mit der steigenden Flut wird die Sandbank bald verschwinden. Ruhig gleitet die Mutter schließlich ins Meer zurück – in die Welt, die ihr Zuhause und ihre Lebensgrundlage ist.
Artbeschreibung
Die Kegelrobbe (wissenschaftlicher Name: Halichoerus grypus) ist die größte in Europa heimische Robbenart. Ihren Namen verdankt sie der charakteristischen, kegelförmigen Kopfform, die besonders bei den Männchen deutlich ausgeprägt ist.
Typische Merkmale:
Kegelrobben leben in küstennahen Meeresgebieten des Nordatlantiks, besonders in der Nord- und Ostsee. Sie ruhen auf Sandbänken, Felsen oder abgelegenen Stränden und gehen von dort aus auf Nahrungssuche. Ihre Beute besteht hauptsächlich aus Fischen wie Hering, Dorsch oder Plattfischen. Die Jungtiere werden an Land geboren und mehrere Wochen gesäugt, bevor sie selbstständig werden.
Perspektiven bei Lebensraumveränderung und Klimawandel
In den letzten Jahrzehnten haben sich die Bestände der Kegelrobbe in Teilen Europas erfreulich erholt. Schutzmaßnahmen und Jagdverbote haben dazu beigetragen, dass die Art vielerorts zurückkehrt.
Der Klimawandel und veränderte Lebensräume stellen jedoch neue Herausforderungen dar:
Langfristig hängt die Zukunft der Kegelrobbe davon ab, ob ausreichend ungestörte Küstenbereiche und stabile Nahrungsgrundlagen erhalten bleiben.
Bedrohung durch den Menschen
Trotz ihrer Erholung ist die Kegelrobbe weiterhin verschiedenen menschlichen Einflüssen ausgesetzt. Zu den wichtigsten Gefährdungen zählen:
Der Schutz störungsarmer Rückzugsorte, nachhaltige Fischerei und ein verantwortungsvoller Umgang mit den Küsten sind entscheidend, um ein dauerhaftes Zusammenleben von Mensch und Kegelrobbe zu ermöglichen.
In der Aufnahme von Axel Donning
Die Kegelrobbe (wissenschaftlicher Name: Halichoerus grypus) ist die größte in Europa heimische Robbenart. Ihren Namen verdankt sie der charakteristischen, kegelförmigen Kopfform, die besonders bei den Männchen deutlich ausgeprägt ist.
Typische Merkmale:
- Körperlänge: bis zu 2,5 Meter (Männchen), Weibchen etwas kleiner
- Gewicht: bis etwa 300 Kilogramm
- Fellfärbung: variabel – Männchen meist dunkler mit hellen Flecken, Weibchen heller mit dunklen Flecken
- Kräftiger Körperbau und große, runde Augen
Kegelrobben leben in küstennahen Meeresgebieten des Nordatlantiks, besonders in der Nord- und Ostsee. Sie ruhen auf Sandbänken, Felsen oder abgelegenen Stränden und gehen von dort aus auf Nahrungssuche. Ihre Beute besteht hauptsächlich aus Fischen wie Hering, Dorsch oder Plattfischen. Die Jungtiere werden an Land geboren und mehrere Wochen gesäugt, bevor sie selbstständig werden.
Perspektiven bei Lebensraumveränderung und Klimawandel
In den letzten Jahrzehnten haben sich die Bestände der Kegelrobbe in Teilen Europas erfreulich erholt. Schutzmaßnahmen und Jagdverbote haben dazu beigetragen, dass die Art vielerorts zurückkehrt.
Der Klimawandel und veränderte Lebensräume stellen jedoch neue Herausforderungen dar:
- Steigende Meeresspiegel können wichtige Liegeplätze wie Sandbänke und Strände überfluten.
- Veränderungen der Fischbestände durch Erwärmung und Überfischung beeinflussen das Nahrungsangebot.
- Häufigere Stürme können Ruhe- und Wurfplätze zerstören oder unbrauchbar machen.
- Temperaturveränderungen können Wander- und Verbreitungsmuster beeinflussen.
Langfristig hängt die Zukunft der Kegelrobbe davon ab, ob ausreichend ungestörte Küstenbereiche und stabile Nahrungsgrundlagen erhalten bleiben.
Bedrohung durch den Menschen
Trotz ihrer Erholung ist die Kegelrobbe weiterhin verschiedenen menschlichen Einflüssen ausgesetzt. Zu den wichtigsten Gefährdungen zählen:
- Störungen durch Tourismus und Wassersport, besonders während der Wurf- und Ruhezeiten
- Beifang in Fischernetzen, der für die Tiere lebensgefährlich sein kann
- Meeresverschmutzung, einschließlich Plastik und Schadstoffe, die sich im Körper anreichern
- Konflikte mit der Fischerei, da Robben als Nahrungskonkurrenten wahrgenommen werden
- Schiffsverkehr und Unterwasserlärm, die Orientierung und Verhalten beeinträchtigen können
Der Schutz störungsarmer Rückzugsorte, nachhaltige Fischerei und ein verantwortungsvoller Umgang mit den Küsten sind entscheidend, um ein dauerhaftes Zusammenleben von Mensch und Kegelrobbe zu ermöglichen.
In der Aufnahme von Axel Donning
- Kegelrobbe beim Abtauchen ins Meer
Artenschutz in Franken®
„Kooperationsprojekt Wasseramsel – Schutz durch Partnerschaft“

Die Wasseramsel – Leben am fließenden Wasser
25/26.02.2026
Kurz nickt er mit dem Körper, als würde er das Gleichgewicht der Strömung prüfen. Dann springt er – nicht in die Luft, sondern direkt ins Wasser. Gegen die Strömung laufend, mit geöffneten Flügeln, sucht er unter den Steinen nach Nahrung. Wenige Sekunden später taucht er wieder auf, schüttelt das Gefieder und stimmt seinen klaren Gesang an. Es ist die Wasseramsel (Cinclus cinclus), eine Spezialistin für das Leben an und in schnell fließenden Gewässern.
25/26.02.2026
- An einem kühlen Frühlingsmorgen liegt feiner Nebel über dem Bach. Das Wasser gluckert zwischen Steinen hindurch, als ein kleiner, dunkel gefärbter Vogel auf einem Felsen landet.
Kurz nickt er mit dem Körper, als würde er das Gleichgewicht der Strömung prüfen. Dann springt er – nicht in die Luft, sondern direkt ins Wasser. Gegen die Strömung laufend, mit geöffneten Flügeln, sucht er unter den Steinen nach Nahrung. Wenige Sekunden später taucht er wieder auf, schüttelt das Gefieder und stimmt seinen klaren Gesang an. Es ist die Wasseramsel (Cinclus cinclus), eine Spezialistin für das Leben an und in schnell fließenden Gewässern.
Artbeschreibung
Die Wasseramsel ist ein etwa starengroßer Vogel mit gedrungenem Körperbau, kurzen Flügeln und einem relativ kurzen Schwanz. Ihr Gefieder wirkt dunkelbraun bis schiefergrau, auffällig ist der weiße Brustlatz, der sie unverwechselbar macht.
Ihr Lebensraum sind klare, sauerstoffreiche Bäche und Flüsse mit kiesigem oder steinigem Untergrund. Anders als die meisten Singvögel jagt die Wasseramsel ihre Nahrung unter Wasser. Sie frisst vor allem Insektenlarven, kleine Krebstiere und andere wirbellose Tiere. Dank dichter, wasserabweisender Federn und kräftiger Beine kann sie tauchen, gegen die Strömung laufen und sich sicher zwischen Steinen bewegen.
Für die Brut nutzt die Wasseramsel gut geschützte Plätze in unmittelbarer Gewässernähe, etwa unter Brücken, in Uferböschungen oder an Felsvorsprüngen. Das kugelförmige Nest wird sorgfältig aus Moos gebaut und mit feinerem Material ausgepolstert.
Perspektiven im Wandel von Lebensräumen und Klima
Die Zukunft der Wasseramsel hängt eng mit der Qualität ihrer Gewässer zusammen. Veränderungen durch längere Trockenperioden, häufigere Starkregen oder steigende Wassertemperaturen können ihre Lebensbedingungen deutlich beeinflussen. Niedrigwasser reduziert das Nahrungsangebot, während starke Hochwasser Nester zerstören oder Brutplätze unbrauchbar machen können.
Auch strukturelle Veränderungen an Fließgewässern – etwa Begradigungen oder der Verlust natürlicher Ufer – verringern die Vielfalt an geeigneten Brut- und Nahrungshabitaten. Gleichzeitig zeigt die Art eine gewisse Anpassungsfähigkeit, wenn ausreichend strukturreiche und saubere Gewässer vorhanden bleiben.
Bedrohungen durch den Menschen
Menschliche Eingriffe stellen eine zentrale Herausforderung dar. Gewässerverschmutzung, Uferverbauungen, Wasserkraftnutzung und die Beseitigung natürlicher Strukturen können Lebensräume verschlechtern oder fragmentieren. Freizeitnutzung an sensiblen Bachabschnitten kann während der Brutzeit zusätzlich stören.
Auch der Verlust alter Brücken, Mauern oder natürlicher Nischen nimmt der Wasseramsel geeignete Brutplätze. Der Schutz naturnaher Fließgewässer und ein rücksichtsvoller Umgang mit sensiblen Uferbereichen sind daher entscheidend für ihr langfristiges Überleben.
Unser Engagement für die Wasseramsel
Als Naturschutzorganisation setzen wir uns auch in diesem Jahr gezielt für die Verbesserung der Lebensbedingungen der Wasseramsel ein. Ein Schwerpunkt liegt auf der Optimierung strukturreicher Gewässerabschnitte sowie der Sicherung geeigneter Brutplätze.
Eine wichtige Rolle spielt dabei die Installation spezieller Nisthilfen an geeigneten Standorten, etwa unter Brücken oder an geschützten Uferbereichen. Diese künstlichen Brutplätze können fehlende natürliche Strukturen ersetzen und den Bruterfolg deutlich verbessern.
Unsere Maßnahmen werden in enger Zusammenarbeit mit zahlreichen Projektpartnern umgesetzt – darunter Behörden, Gewässerunterhaltungsverbände, Kommunen und engagierte Ehrenamtliche. Gemeinsam leisten wir einen Beitrag dazu, dass die Wasseramsel auch künftig unsere Bäche und Flüsse belebt.
In der Aufnahme
Die Wasseramsel ist ein etwa starengroßer Vogel mit gedrungenem Körperbau, kurzen Flügeln und einem relativ kurzen Schwanz. Ihr Gefieder wirkt dunkelbraun bis schiefergrau, auffällig ist der weiße Brustlatz, der sie unverwechselbar macht.
Ihr Lebensraum sind klare, sauerstoffreiche Bäche und Flüsse mit kiesigem oder steinigem Untergrund. Anders als die meisten Singvögel jagt die Wasseramsel ihre Nahrung unter Wasser. Sie frisst vor allem Insektenlarven, kleine Krebstiere und andere wirbellose Tiere. Dank dichter, wasserabweisender Federn und kräftiger Beine kann sie tauchen, gegen die Strömung laufen und sich sicher zwischen Steinen bewegen.
Für die Brut nutzt die Wasseramsel gut geschützte Plätze in unmittelbarer Gewässernähe, etwa unter Brücken, in Uferböschungen oder an Felsvorsprüngen. Das kugelförmige Nest wird sorgfältig aus Moos gebaut und mit feinerem Material ausgepolstert.
Perspektiven im Wandel von Lebensräumen und Klima
Die Zukunft der Wasseramsel hängt eng mit der Qualität ihrer Gewässer zusammen. Veränderungen durch längere Trockenperioden, häufigere Starkregen oder steigende Wassertemperaturen können ihre Lebensbedingungen deutlich beeinflussen. Niedrigwasser reduziert das Nahrungsangebot, während starke Hochwasser Nester zerstören oder Brutplätze unbrauchbar machen können.
Auch strukturelle Veränderungen an Fließgewässern – etwa Begradigungen oder der Verlust natürlicher Ufer – verringern die Vielfalt an geeigneten Brut- und Nahrungshabitaten. Gleichzeitig zeigt die Art eine gewisse Anpassungsfähigkeit, wenn ausreichend strukturreiche und saubere Gewässer vorhanden bleiben.
Bedrohungen durch den Menschen
Menschliche Eingriffe stellen eine zentrale Herausforderung dar. Gewässerverschmutzung, Uferverbauungen, Wasserkraftnutzung und die Beseitigung natürlicher Strukturen können Lebensräume verschlechtern oder fragmentieren. Freizeitnutzung an sensiblen Bachabschnitten kann während der Brutzeit zusätzlich stören.
Auch der Verlust alter Brücken, Mauern oder natürlicher Nischen nimmt der Wasseramsel geeignete Brutplätze. Der Schutz naturnaher Fließgewässer und ein rücksichtsvoller Umgang mit sensiblen Uferbereichen sind daher entscheidend für ihr langfristiges Überleben.
Unser Engagement für die Wasseramsel
Als Naturschutzorganisation setzen wir uns auch in diesem Jahr gezielt für die Verbesserung der Lebensbedingungen der Wasseramsel ein. Ein Schwerpunkt liegt auf der Optimierung strukturreicher Gewässerabschnitte sowie der Sicherung geeigneter Brutplätze.
Eine wichtige Rolle spielt dabei die Installation spezieller Nisthilfen an geeigneten Standorten, etwa unter Brücken oder an geschützten Uferbereichen. Diese künstlichen Brutplätze können fehlende natürliche Strukturen ersetzen und den Bruterfolg deutlich verbessern.
Unsere Maßnahmen werden in enger Zusammenarbeit mit zahlreichen Projektpartnern umgesetzt – darunter Behörden, Gewässerunterhaltungsverbände, Kommunen und engagierte Ehrenamtliche. Gemeinsam leisten wir einen Beitrag dazu, dass die Wasseramsel auch künftig unsere Bäche und Flüsse belebt.
In der Aufnahme
- Nisthilfen die sich zur nachfolgenden Montage unter z.B. Brückenkörpern anbieten, bieten einen interessanten Ansatz zur Optimierung des Fortpflanzungserfolgs, für Wasseramsel, Gebirgsstelze & Co.
Artenschutz in Franken®
Wasseramsel (Cinclus cinclus)

Die Wasseramsel – Leben am fließenden Wasser
24/25.02.2026
Kurz nickt er mit dem Körper, als würde er das Gleichgewicht der Strömung prüfen. Dann springt er – nicht in die Luft, sondern direkt ins Wasser. Gegen die Strömung laufend, mit geöffneten Flügeln, sucht er unter den Steinen nach Nahrung. Wenige Sekunden später taucht er wieder auf, schüttelt das Gefieder und stimmt seinen klaren Gesang an. Es ist die Wasseramsel (Cinclus cinclus), eine Spezialistin für das Leben an und in schnell fließenden Gewässern.
24/25.02.2026
- An einem kühlen Frühlingsmorgen liegt feiner Nebel über dem Bach. Das Wasser gluckert zwischen Steinen hindurch, als ein kleiner, dunkel gefärbter Vogel auf einem Felsen landet.
Kurz nickt er mit dem Körper, als würde er das Gleichgewicht der Strömung prüfen. Dann springt er – nicht in die Luft, sondern direkt ins Wasser. Gegen die Strömung laufend, mit geöffneten Flügeln, sucht er unter den Steinen nach Nahrung. Wenige Sekunden später taucht er wieder auf, schüttelt das Gefieder und stimmt seinen klaren Gesang an. Es ist die Wasseramsel (Cinclus cinclus), eine Spezialistin für das Leben an und in schnell fließenden Gewässern.
Artbeschreibung
Die Wasseramsel ist ein etwa starengroßer Vogel mit gedrungenem Körperbau, kurzen Flügeln und einem relativ kurzen Schwanz. Ihr Gefieder wirkt dunkelbraun bis schiefergrau, auffällig ist der weiße Brustlatz, der sie unverwechselbar macht.
Ihr Lebensraum sind klare, sauerstoffreiche Bäche und Flüsse mit kiesigem oder steinigem Untergrund. Anders als die meisten Singvögel jagt die Wasseramsel ihre Nahrung unter Wasser. Sie frisst vor allem Insektenlarven, kleine Krebstiere und andere wirbellose Tiere. Dank dichter, wasserabweisender Federn und kräftiger Beine kann sie tauchen, gegen die Strömung laufen und sich sicher zwischen Steinen bewegen.
Für die Brut nutzt die Wasseramsel gut geschützte Plätze in unmittelbarer Gewässernähe, etwa unter Brücken, in Uferböschungen oder an Felsvorsprüngen. Das kugelförmige Nest wird sorgfältig aus Moos gebaut und mit feinerem Material ausgepolstert.
Perspektiven im Wandel von Lebensräumen und Klima
Die Zukunft der Wasseramsel hängt eng mit der Qualität ihrer Gewässer zusammen. Veränderungen durch längere Trockenperioden, häufigere Starkregen oder steigende Wassertemperaturen können ihre Lebensbedingungen deutlich beeinflussen. Niedrigwasser reduziert das Nahrungsangebot, während starke Hochwasser Nester zerstören oder Brutplätze unbrauchbar machen können.
Auch strukturelle Veränderungen an Fließgewässern – etwa Begradigungen oder der Verlust natürlicher Ufer – verringern die Vielfalt an geeigneten Brut- und Nahrungshabitaten. Gleichzeitig zeigt die Art eine gewisse Anpassungsfähigkeit, wenn ausreichend strukturreiche und saubere Gewässer vorhanden bleiben.
Bedrohungen durch den Menschen
Menschliche Eingriffe stellen eine zentrale Herausforderung dar. Gewässerverschmutzung, Uferverbauungen, Wasserkraftnutzung und die Beseitigung natürlicher Strukturen können Lebensräume verschlechtern oder fragmentieren. Freizeitnutzung an sensiblen Bachabschnitten kann während der Brutzeit zusätzlich stören.
Auch der Verlust alter Brücken, Mauern oder natürlicher Nischen nimmt der Wasseramsel geeignete Brutplätze. Der Schutz naturnaher Fließgewässer und ein rücksichtsvoller Umgang mit sensiblen Uferbereichen sind daher entscheidend für ihr langfristiges Überleben.
In der Aufnahme von Andreas Gehrig
Die Wasseramsel ist ein etwa starengroßer Vogel mit gedrungenem Körperbau, kurzen Flügeln und einem relativ kurzen Schwanz. Ihr Gefieder wirkt dunkelbraun bis schiefergrau, auffällig ist der weiße Brustlatz, der sie unverwechselbar macht.
Ihr Lebensraum sind klare, sauerstoffreiche Bäche und Flüsse mit kiesigem oder steinigem Untergrund. Anders als die meisten Singvögel jagt die Wasseramsel ihre Nahrung unter Wasser. Sie frisst vor allem Insektenlarven, kleine Krebstiere und andere wirbellose Tiere. Dank dichter, wasserabweisender Federn und kräftiger Beine kann sie tauchen, gegen die Strömung laufen und sich sicher zwischen Steinen bewegen.
Für die Brut nutzt die Wasseramsel gut geschützte Plätze in unmittelbarer Gewässernähe, etwa unter Brücken, in Uferböschungen oder an Felsvorsprüngen. Das kugelförmige Nest wird sorgfältig aus Moos gebaut und mit feinerem Material ausgepolstert.
Perspektiven im Wandel von Lebensräumen und Klima
Die Zukunft der Wasseramsel hängt eng mit der Qualität ihrer Gewässer zusammen. Veränderungen durch längere Trockenperioden, häufigere Starkregen oder steigende Wassertemperaturen können ihre Lebensbedingungen deutlich beeinflussen. Niedrigwasser reduziert das Nahrungsangebot, während starke Hochwasser Nester zerstören oder Brutplätze unbrauchbar machen können.
Auch strukturelle Veränderungen an Fließgewässern – etwa Begradigungen oder der Verlust natürlicher Ufer – verringern die Vielfalt an geeigneten Brut- und Nahrungshabitaten. Gleichzeitig zeigt die Art eine gewisse Anpassungsfähigkeit, wenn ausreichend strukturreiche und saubere Gewässer vorhanden bleiben.
Bedrohungen durch den Menschen
Menschliche Eingriffe stellen eine zentrale Herausforderung dar. Gewässerverschmutzung, Uferverbauungen, Wasserkraftnutzung und die Beseitigung natürlicher Strukturen können Lebensräume verschlechtern oder fragmentieren. Freizeitnutzung an sensiblen Bachabschnitten kann während der Brutzeit zusätzlich stören.
Auch der Verlust alter Brücken, Mauern oder natürlicher Nischen nimmt der Wasseramsel geeignete Brutplätze. Der Schutz naturnaher Fließgewässer und ein rücksichtsvoller Umgang mit sensiblen Uferbereichen sind daher entscheidend für ihr langfristiges Überleben.
In der Aufnahme von Andreas Gehrig
- Wasseramsel mit Bachflohkrebs - Zu den bevorzugten Nahrungsbestandteilen der Wasseramsel zählt auch der Bachflohkrebs. Andreas Gehring ist es gelungen diese aussagekräftige Aufnahme der Nahrungsaufnahme zu erstellen.
Artenschutz in Franken®
Kleine Goldschrecke (Euthystira brachyptera)

Die Kleine Goldschrecke (Euthystira brachyptera)
24/25.02.2026
Eine kleine, goldgrün schimmernde Heuschrecke klettert nach oben und richtet sich der Sonne entgegen. Für einen Moment wirkt sie selbst wie ein Teil des Lichts. Die Wiese erwacht, doch die Kleine Goldschrecke bleibt ruhig. Ihr Leben ist unscheinbar – und gerade deshalb ein kostbarer Teil unserer Landschaft.
24/25.02.2026
- An einem warmen Julimorgen liegt Tau auf einer stillen Wiese. Zwischen Gräsern und Kräutern glitzern die Tropfen im ersten Sonnenlicht. Plötzlich bewegt sich ein Halm – vorsichtig, fast lautlos.
Eine kleine, goldgrün schimmernde Heuschrecke klettert nach oben und richtet sich der Sonne entgegen. Für einen Moment wirkt sie selbst wie ein Teil des Lichts. Die Wiese erwacht, doch die Kleine Goldschrecke bleibt ruhig. Ihr Leben ist unscheinbar – und gerade deshalb ein kostbarer Teil unserer Landschaft.
Artbeschreibung
Die Kleine Goldschrecke (wissenschaftlicher Name: Euthystira brachyptera) gehört zur Familie der Kurzfühlerschrecken. Sie ist eine eher kleine und zierliche Heuschreckenart. Charakteristisch ist ihre gelblich-grüne bis goldene Färbung, die ihr den deutschen Namen verleiht und gleichzeitig eine hervorragende Tarnung im Gras bietet.
Typische Merkmale:
Die Art lebt bevorzugt in mageren, extensiv genutzten Wiesen, an Waldrändern, auf Böschungen oder in lichten Trockenrasen. Entscheidend ist eine strukturreiche Vegetation mit nicht zu dichtem Grasbewuchs.
Perspektiven im Wandel von Lebensraum und Klima
Die Zukunft der Kleinen Goldschrecke hängt stark von der Entwicklung ihrer Lebensräume ab. Durch die Intensivierung der Landwirtschaft, häufiges Mähen und die Düngung von Wiesen verschwinden vielerorts die artenreichen, nährstoffarmen Flächen, die sie benötigt.
Der Klimawandel wirkt dabei in zwei Richtungen:
Die größte Gefahr für die Kleine Goldschrecke geht von menschlichen Eingriffen in die Landschaft aus. Dazu zählen:
Schutzmaßnahmen wie späte Mahd, Verzicht auf Düngung, die Anlage von Blühflächen und der Erhalt von Wiesenrandstrukturen können entscheidend dazu beitragen, die Lebensbedingungen der Art zu sichern.
In der Aufnahme von Johannes Rother
Die Kleine Goldschrecke (wissenschaftlicher Name: Euthystira brachyptera) gehört zur Familie der Kurzfühlerschrecken. Sie ist eine eher kleine und zierliche Heuschreckenart. Charakteristisch ist ihre gelblich-grüne bis goldene Färbung, die ihr den deutschen Namen verleiht und gleichzeitig eine hervorragende Tarnung im Gras bietet.
Typische Merkmale:
- Körperlänge: etwa 15–20 mm
- Männchen meist schlanker und etwas kleiner als Weibchen
- Relativ kurze Flügel, die selten zum Fliegen genutzt werden
- Leiser, unauffälliger Gesang (Stridulation) der Männchen
Die Art lebt bevorzugt in mageren, extensiv genutzten Wiesen, an Waldrändern, auf Böschungen oder in lichten Trockenrasen. Entscheidend ist eine strukturreiche Vegetation mit nicht zu dichtem Grasbewuchs.
Perspektiven im Wandel von Lebensraum und Klima
Die Zukunft der Kleinen Goldschrecke hängt stark von der Entwicklung ihrer Lebensräume ab. Durch die Intensivierung der Landwirtschaft, häufiges Mähen und die Düngung von Wiesen verschwinden vielerorts die artenreichen, nährstoffarmen Flächen, die sie benötigt.
Der Klimawandel wirkt dabei in zwei Richtungen:
- Mildere Temperaturen können die Ausbreitung in höhere Lagen oder nördlichere Regionen begünstigen.
- Längere Trockenperioden und Extremwetter können jedoch Lebensräume verändern oder zerstören, insbesondere wenn Vegetationsstrukturen verloren gehen.
- Wo extensiv bewirtschaftete Wiesen erhalten oder neu geschaffen werden, kann die Art stabil bleiben oder sich sogar wieder ausbreiten. Ihre Zukunft ist daher eng mit naturnaher Landnutzung verknüpft.
- Bedrohung durch den Menschen
Die größte Gefahr für die Kleine Goldschrecke geht von menschlichen Eingriffen in die Landschaft aus. Dazu zählen:
- Intensivierung der Landwirtschaft (Düngung, häufige Mahd)
- Umwandlung von Wiesen in Ackerflächen oder Baugebiete
- Flächenversiegelung und Zerschneidung von Lebensräumen
- Einsatz von Pestiziden
- Aufgabe traditioneller, extensiver Bewirtschaftungsformen
Schutzmaßnahmen wie späte Mahd, Verzicht auf Düngung, die Anlage von Blühflächen und der Erhalt von Wiesenrandstrukturen können entscheidend dazu beitragen, die Lebensbedingungen der Art zu sichern.
In der Aufnahme von Johannes Rother
- Die Kleine Goldschrecke ist in Mitteleuropa relativ weit verbreitet. Auch in unserer Region kommt diese Schreckenart häufig vor. Kleine Goldschrecken erreichen Körperlängen von 1,2 – 1,7 Zentimeter ( männliche Individuen ) und 1,8 bis 2,5 ( 2,6 ) Zentimeter ( weibliche Individuen ).Die bevorzugte Nahrung besteht aus Pflanzenteilen. Die Fortpflanzung wird nach unserem Kenntnisstand rein oberirdisch praktiziert, wobei die Larven meist im darauf folgenden Mai schlüpfen.
Artenschutz in Franken®
„Mehr als ‚Krötentragen‘: Naturschutz im Einsatz“

„Mehr als ‚Krötentragen‘: Naturschutz im Einsatz“
24/25.02.2026
Schon in den nächsten Tagen ist – bei milden Temperaturen und feuchter Witterung – mit den ersten Wanderbewegungen unserer heimischen Amphibien zu rechnen. Arten wie Erdkröte, Grasfrosch oder Molch machen sich dann auf den Weg zu ihren angestammten Laichgewässern. Für viele Tiere wird diese Wanderung jedoch zur größten Gefahr ihres Lebens.
24/25.02.2026
- Amphibienwanderung steht bevor – jetzt beginnt eine entscheidende Zeit für den Artenschutz
Schon in den nächsten Tagen ist – bei milden Temperaturen und feuchter Witterung – mit den ersten Wanderbewegungen unserer heimischen Amphibien zu rechnen. Arten wie Erdkröte, Grasfrosch oder Molch machen sich dann auf den Weg zu ihren angestammten Laichgewässern. Für viele Tiere wird diese Wanderung jedoch zur größten Gefahr ihres Lebens.
Amphibien in der Krise
Amphibien gehören zu den am stärksten bedrohten Tiergruppen weltweit. Auch in Mitteleuropa gehen die Bestände vieler Arten seit Jahren zurück. Ursachen sind vor allem:
Besonders problematisch ist, dass Amphibien sowohl an Land als auch im Wasser geeignete Lebensräume benötigen. Wird eines dieser Elemente gestört, bricht der gesamte Lebenszyklus zusammen.
Schlüsselarten im Ökosystem
Die Bedeutung von Amphibien für das ökologische Gleichgewicht wird häufig unterschätzt. Dabei erfüllen sie mehrere wichtige Funktionen:
Ein Rückgang der Amphibien wirkt sich daher weit über die Tiergruppe selbst hinaus auf ganze Lebensgemeinschaften aus.
Mehr als „Krötenträger“
Menschen, die sich ehrenamtlich im Amphibienschutz engagieren, werden manchmal abwertend als „Krötenträger“ bezeichnet. Diese Bezeichnung greift jedoch viel zu kurz. Hinter der Arbeit steckt:
Es handelt sich um aktiven Naturschutz mit großer fachlicher und gesellschaftlicher Bedeutung – und ohne dieses Engagement wären viele lokale Populationen bereits verschwunden.
Warum Zu- und Rückwanderung betreut werden müssen
Oft wird nur die Hinwanderung zu den Laichgewässern beachtet. Doch auch nach der Fortpflanzung wandern die Tiere zurück in ihre Sommerlebensräume. Eine durchgehende Betreuung ist wichtig, weil:
Nur eine vollständige Betreuung des gesamten Wanderzeitraums sichert den langfristigen Erfolg der Schutzmaßnahmen.
Blick in die Zukunft: Amphibien und Klimawandel
Der Klimawandel stellt Amphibien vor zusätzliche Herausforderungen:
Gleichzeitig zeigt sich, wie wichtig vernetzte Lebensräume, ausreichend tiefe Gewässer und langfristig betreute Schutzstrukturen sind. Anpassungsfähige Schutzkonzepte werden in den kommenden Jahren entscheidend sein.
Die bevorstehende Wanderzeit erinnert uns daran, wie verletzlich diese Tiergruppe ist – und wie viel ihr Schutz zum Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen beiträgt. Jede gesicherte Querung, jedes gepflegte Gewässer und jedes engagierte Ehrenamt hilft, die Zukunft unserer heimischen Amphibien zu sichern.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
Amphibien gehören zu den am stärksten bedrohten Tiergruppen weltweit. Auch in Mitteleuropa gehen die Bestände vieler Arten seit Jahren zurück. Ursachen sind vor allem:
- Verlust und Zerschneidung von Lebensräumen
- Straßenverkehr während der Wanderzeit
- Trockenlegung oder Verschmutzung von Gewässern
- Intensive Landnutzung und Pestizide
- Krankheiten und invasive Arten
Besonders problematisch ist, dass Amphibien sowohl an Land als auch im Wasser geeignete Lebensräume benötigen. Wird eines dieser Elemente gestört, bricht der gesamte Lebenszyklus zusammen.
Schlüsselarten im Ökosystem
Die Bedeutung von Amphibien für das ökologische Gleichgewicht wird häufig unterschätzt. Dabei erfüllen sie mehrere wichtige Funktionen:
- Natürliche Schädlingsregulation: Sie fressen große Mengen an Insekten, Schnecken und anderen Wirbellosen.
- Nahrungsgrundlage: Viele Vogel-, Säugetier- und Reptilienarten sind auf Amphibien als Beute angewiesen.
- Bioindikatoren: Aufgrund ihrer empfindlichen Haut reagieren Amphibien besonders sensibel auf Umweltveränderungen und zeigen frühzeitig Probleme in Ökosystemen an.
Ein Rückgang der Amphibien wirkt sich daher weit über die Tiergruppe selbst hinaus auf ganze Lebensgemeinschaften aus.
Mehr als „Krötenträger“
Menschen, die sich ehrenamtlich im Amphibienschutz engagieren, werden manchmal abwertend als „Krötenträger“ bezeichnet. Diese Bezeichnung greift jedoch viel zu kurz. Hinter der Arbeit steckt:
- Organisation und Betreuung von Schutzzäunen
- Erfassung von Beständen und Wanderzahlen
- Pflege und Anlage von Laichgewässern
- Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung
- Zusammenarbeit mit Behörden, Kommunen und Straßenbaulastträgern
Es handelt sich um aktiven Naturschutz mit großer fachlicher und gesellschaftlicher Bedeutung – und ohne dieses Engagement wären viele lokale Populationen bereits verschwunden.
Warum Zu- und Rückwanderung betreut werden müssen
Oft wird nur die Hinwanderung zu den Laichgewässern beachtet. Doch auch nach der Fortpflanzung wandern die Tiere zurück in ihre Sommerlebensräume. Eine durchgehende Betreuung ist wichtig, weil:
- Amphibien dieselben Gefahrenstellen erneut überqueren müssen
- besonders geschwächte Tiere nach der Laichzeit gefährdet sind
- auch Jungtiere später das Gewässer verlassen und Schutz benötigen
Nur eine vollständige Betreuung des gesamten Wanderzeitraums sichert den langfristigen Erfolg der Schutzmaßnahmen.
Blick in die Zukunft: Amphibien und Klimawandel
Der Klimawandel stellt Amphibien vor zusätzliche Herausforderungen:
- Frühere oder unregelmäßige Wanderzeiten erschweren Schutzmaßnahmen
- Austrocknende Kleingewässer gefährden die Larvenentwicklung
- Extremwetterereignisse können ganze Jahrgänge vernichten
Gleichzeitig zeigt sich, wie wichtig vernetzte Lebensräume, ausreichend tiefe Gewässer und langfristig betreute Schutzstrukturen sind. Anpassungsfähige Schutzkonzepte werden in den kommenden Jahren entscheidend sein.
Die bevorstehende Wanderzeit erinnert uns daran, wie verletzlich diese Tiergruppe ist – und wie viel ihr Schutz zum Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen beiträgt. Jede gesicherte Querung, jedes gepflegte Gewässer und jedes engagierte Ehrenamt hilft, die Zukunft unserer heimischen Amphibien zu sichern.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
- Grasfrosch
Artenschutz in Franken®
Neue Nistplätze für den Turmfalken – Gemeinsam Lebensraum sichern

Neue Nistplätze für den Turmfalken – Engagement für einen faszinierenden Kulturfolger
23/24.02.2026
Als anpassungsfähiger Kulturfolger hat der Turmfalke früh gelernt, die Nähe zum Menschen zu nutzen. Ursprünglich brütete er vor allem in Felsnischen und an natürlichen Abbruchkanten. Heute dienen ihm Kirchtürme, Scheunen, Industriegebäude, Wohnhäuser oder Brücken als Ersatzlebensräume. Dabei baut er kein eigenes Nest, sondern ist auf vorhandene Nischen, Simse oder alte Nester anderer Vogelarten angewiesen. Genau diese Abhängigkeit macht ihn jedoch zunehmend verwundbar.
23/24.02.2026
- Der Turmfalke (Falco tinnunculus) gehört zu den bekanntesten Greifvögeln Europas und ist ein charakteristischer Bestandteil unserer offenen Landschaften sowie vieler Ortschaften. Kaum ein anderer Vogel lässt sich so häufig beobachten: Mit schnellen Flügelschlägen steht er im sogenannten Rüttelflug scheinbar bewegungslos in der Luft, den Blick konzentriert auf den Boden gerichtet. Entdeckt er eine Maus oder ein anderes Kleintier, folgt ein präziser Sturzflug.
Als anpassungsfähiger Kulturfolger hat der Turmfalke früh gelernt, die Nähe zum Menschen zu nutzen. Ursprünglich brütete er vor allem in Felsnischen und an natürlichen Abbruchkanten. Heute dienen ihm Kirchtürme, Scheunen, Industriegebäude, Wohnhäuser oder Brücken als Ersatzlebensräume. Dabei baut er kein eigenes Nest, sondern ist auf vorhandene Nischen, Simse oder alte Nester anderer Vogelarten angewiesen. Genau diese Abhängigkeit macht ihn jedoch zunehmend verwundbar.
Verlust natürlicher Brutplätze
Durch energetische Gebäudesanierungen, Dachausbauten und Modernisierungen verschwinden immer mehr offene Strukturen, Spalten und Nischen. Häufig werden Einflugmöglichkeiten aus Sorge vor Verschmutzung oder aus einem missverstandenen Reinlichkeitsgedanken bewusst verschlossen. Was auf den ersten Blick sinnvoll erscheint, entzieht gebäudebrütenden Arten wie Turmfalke, Schleiereule oder Mauersegler jedoch wichtige Lebensräume.
Gleichzeitig verändern sich auch die Jagdgebiete. Intensivere Flächennutzung, der Rückgang strukturreicher Landschaftselemente und der Verlust von extensiv bewirtschafteten Flächen erschweren vielen Greifvögeln die Nahrungssuche. Umso wichtiger ist es, die vorhandenen Brutmöglichkeiten zu erhalten und gezielt neue zu schaffen.
Praktischer Naturschutz: Installation neuer Nisthilfen
Um dem Turmfalken weiterhin geeignete Brutplätze anzubieten, haben wir in den vergangenen Tagen zahlreiche neue Nisthilfen installiert. Mithilfe von Hubsteigern konnten auch hochgelegene und schwer zugängliche Standorte sicher erreicht werden. Die Kästen wurden an Gebäuden, Türmen und anderen geeigneten Strukturen angebracht – stets mit Blick auf eine gute Anflugmöglichkeit, ausreichenden Witterungsschutz und eine möglichst störungsarme Umgebung.
Speziell konstruierte Turmfalkenkästen bieten den Vögeln einen geschützten Brutraum, der ihren natürlichen Ansprüchen entspricht. Da Turmfalken ihrem Brutplatz oft über viele Jahre treu bleiben, können solche Maßnahmen langfristig zur Stabilisierung lokaler Bestände beitragen.
Ein Leben in unserer Nachbarschaft
Die Brutzeit des Turmfalken beginnt meist im Frühjahr. Das Weibchen legt in der Regel drei bis sechs Eier, die etwa vier Wochen lang bebrütet werden. Nach dem Schlupf bleiben die Jungvögel rund einen Monat im Nest und werden von beiden Eltern intensiv versorgt. In dieser Zeit reagieren Turmfalken sensibel auf Störungen – ein weiterer Grund, warum sichere und ruhige Nistplätze so wichtig sind.
Wer das Glück hat, einen Turmfalkenkasten in der Nähe zu haben, kann mit etwas Geduld faszinierende Einblicke in das Familienleben dieser eleganten Greifvögel gewinnen.
Gemeinsam für mehr Biodiversität
Während an vielen Orten Brutplätze verloren gehen, setzen wir gemeinsam mit engagierten und aufgeschlossenen Menschen bewusst ein positives Zeichen. Unser Ziel ist es, den Arten, die unsere Landschaft noch bereichern, auch in Zukunft Lebensraum zu bieten und ihre Lebensbedingungen zu verbessern.
Der Einsatz für den Turmfalken steht dabei stellvertretend für den Schutz der biologischen Vielfalt insgesamt. Naturschutz beginnt oft im Kleinen – an Gebäuden, in Gemeinden und im direkten Lebensumfeld. Jede erhaltene Nische, jeder geschützte Brutplatz und jede neu angebrachte Nisthilfe trägt dazu bei, unsere Kulturlandschaft lebendig zu halten.
Verantwortung für kommende Generationen
Biodiversität ist keine Selbstverständlichkeit. Viele Arten sind auf unsere Rücksicht und unser Engagement angewiesen. Indem wir Lebensräume erhalten und neu schaffen, übernehmen wir Verantwortung – für die Natur vor unserer Haustür und für die Menschen, die nach uns kommen.
Gemeinsam gehen wir einen Weg, der zeigt: Menschliche Nutzung und Naturschutz müssen kein Widerspruch sein. Wenn wir Lebensräume bewusst mitdenken, kann der Turmfalke auch künftig über Feldern, Wiesen und Dächern rütteln – als sichtbares Zeichen einer vielfältigen und lebenswerten Umwelt.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
Durch energetische Gebäudesanierungen, Dachausbauten und Modernisierungen verschwinden immer mehr offene Strukturen, Spalten und Nischen. Häufig werden Einflugmöglichkeiten aus Sorge vor Verschmutzung oder aus einem missverstandenen Reinlichkeitsgedanken bewusst verschlossen. Was auf den ersten Blick sinnvoll erscheint, entzieht gebäudebrütenden Arten wie Turmfalke, Schleiereule oder Mauersegler jedoch wichtige Lebensräume.
Gleichzeitig verändern sich auch die Jagdgebiete. Intensivere Flächennutzung, der Rückgang strukturreicher Landschaftselemente und der Verlust von extensiv bewirtschafteten Flächen erschweren vielen Greifvögeln die Nahrungssuche. Umso wichtiger ist es, die vorhandenen Brutmöglichkeiten zu erhalten und gezielt neue zu schaffen.
Praktischer Naturschutz: Installation neuer Nisthilfen
Um dem Turmfalken weiterhin geeignete Brutplätze anzubieten, haben wir in den vergangenen Tagen zahlreiche neue Nisthilfen installiert. Mithilfe von Hubsteigern konnten auch hochgelegene und schwer zugängliche Standorte sicher erreicht werden. Die Kästen wurden an Gebäuden, Türmen und anderen geeigneten Strukturen angebracht – stets mit Blick auf eine gute Anflugmöglichkeit, ausreichenden Witterungsschutz und eine möglichst störungsarme Umgebung.
Speziell konstruierte Turmfalkenkästen bieten den Vögeln einen geschützten Brutraum, der ihren natürlichen Ansprüchen entspricht. Da Turmfalken ihrem Brutplatz oft über viele Jahre treu bleiben, können solche Maßnahmen langfristig zur Stabilisierung lokaler Bestände beitragen.
Ein Leben in unserer Nachbarschaft
Die Brutzeit des Turmfalken beginnt meist im Frühjahr. Das Weibchen legt in der Regel drei bis sechs Eier, die etwa vier Wochen lang bebrütet werden. Nach dem Schlupf bleiben die Jungvögel rund einen Monat im Nest und werden von beiden Eltern intensiv versorgt. In dieser Zeit reagieren Turmfalken sensibel auf Störungen – ein weiterer Grund, warum sichere und ruhige Nistplätze so wichtig sind.
Wer das Glück hat, einen Turmfalkenkasten in der Nähe zu haben, kann mit etwas Geduld faszinierende Einblicke in das Familienleben dieser eleganten Greifvögel gewinnen.
Gemeinsam für mehr Biodiversität
Während an vielen Orten Brutplätze verloren gehen, setzen wir gemeinsam mit engagierten und aufgeschlossenen Menschen bewusst ein positives Zeichen. Unser Ziel ist es, den Arten, die unsere Landschaft noch bereichern, auch in Zukunft Lebensraum zu bieten und ihre Lebensbedingungen zu verbessern.
Der Einsatz für den Turmfalken steht dabei stellvertretend für den Schutz der biologischen Vielfalt insgesamt. Naturschutz beginnt oft im Kleinen – an Gebäuden, in Gemeinden und im direkten Lebensumfeld. Jede erhaltene Nische, jeder geschützte Brutplatz und jede neu angebrachte Nisthilfe trägt dazu bei, unsere Kulturlandschaft lebendig zu halten.
Verantwortung für kommende Generationen
Biodiversität ist keine Selbstverständlichkeit. Viele Arten sind auf unsere Rücksicht und unser Engagement angewiesen. Indem wir Lebensräume erhalten und neu schaffen, übernehmen wir Verantwortung – für die Natur vor unserer Haustür und für die Menschen, die nach uns kommen.
Gemeinsam gehen wir einen Weg, der zeigt: Menschliche Nutzung und Naturschutz müssen kein Widerspruch sein. Wenn wir Lebensräume bewusst mitdenken, kann der Turmfalke auch künftig über Feldern, Wiesen und Dächern rütteln – als sichtbares Zeichen einer vielfältigen und lebenswerten Umwelt.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- Bald ist es wieder soweit - die Fortpflanzungsphase der Turmfalken startet. Jedoch schwinden ihre bauwerkzugeordneten Nistplätze auch aufgrund eines fehlenden Naturbewusstseins mehr und mehr.
Artenschutz in Franken®
Die Hohe Wand
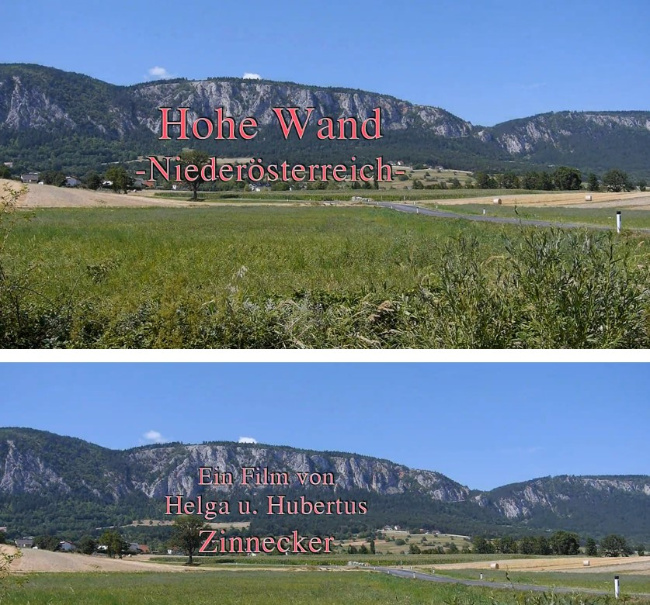
Biosphäre - Hohe Wand
23/24.02.2026
Ein neuer Film von Helga und Hubertus Zinnecker
Gämsen und Steinböcke konnten wir bei einem Besuch der Hohen Wand im südlichen Niederösterreich vom Wanderweg aus beobachten und filmen.
23/24.02.2026
Ein neuer Film von Helga und Hubertus Zinnecker
Gämsen und Steinböcke konnten wir bei einem Besuch der Hohen Wand im südlichen Niederösterreich vom Wanderweg aus beobachten und filmen.
Artenschutz in Franken®
Vom Wasserabfluss zur Dürre: Strukturarme Flächen im Klimawandel

Wasserhaushalt in Monokulturen: Schneller Abfluss – langfristige Probleme
23/24.02.2026
23/24.02.2026
- Großflächige Monokulturen – sei es im Wald oder in der Agrarlandschaft – weisen häufig eine strukturelle Vereinfachung auf: einheitliche Altersklassen, geringe Artenvielfalt, reduzierte Kraut- und Strauchschicht sowie oft verdichtete oder intensiv bearbeitete Böden. Diese Faktoren beeinflussen maßgeblich den Wasserhaushalt einer Fläche.
Beschleunigter Wasserabfluss
In strukturarmen Beständen fehlt es häufig an:
Die Folge ist eine verminderte Infiltrationsfähigkeit. Niederschläge können schlechter im Boden versickern und werden stattdessen oberflächlich abgeführt.
Entwässerungsgräben, begradigte Strukturen oder verdichtete Fahrspuren verstärken diesen Effekt zusätzlich. Wasser verlässt die Fläche schneller, anstatt im Boden gespeichert zu werden und zur Grundwasserneubildung beizutragen.
Auswirkungen auf Biodiversität
Ein beschleunigter Wasserabfluss hat direkte und indirekte Folgen für die biologische Vielfalt:
Monokulturen bieten ohnehin weniger ökologische Nischen. Wird zusätzlich die Wasserdynamik destabilisiert, verschärft sich dieser Effekt weiter.
Verlust an Regenrückhaltung und Klimaanpassung
In Zeiten des Klimawandels gewinnen Wasserrückhalt und Resilienz von Ökosystemen zunehmend an Bedeutung. Häufigere Starkregenereignisse wechseln sich mit längeren Trockenphasen ab. Landschaften mit hoher Strukturvielfalt können Niederschläge puffern, speichern und zeitverzögert wieder abgeben.
Wo Wasser jedoch rasch aus der Fläche abgeführt wird, entstehen zwei Probleme:
Es entsteht ein widersprüchliches Muster: Zunächst wird Wasser konsequent abgeführt, später wird sein Mangel beklagt. Statt kurzfristiger Maßnahmen zur Symptombekämpfung wäre ein integriertes Wassermanagement erforderlich, das Rückhalt, Bodenaufbau und Strukturvielfalt systematisch stärkt.
Erforderliche Perspektive
Ein zukunftsfähiger Umgang mit Landschaftsflächen – ob forstlich oder landwirtschaftlich genutzt – sollte folgende Aspekte berücksichtigen:
Die Stabilisierung des Wasserhaushalts ist keine isolierte Maßnahme, sondern ein zentraler Bestandteil praktischen Naturschutzes und aktiver Klimaanpassung. Strukturvielfalt, Bodenleben und Wasserrückhalt sind eng miteinander verknüpft – und bilden die Grundlage für langfristig resiliente Ökosysteme.
In der Aufnahme
In strukturarmen Beständen fehlt es häufig an:
- tiefwurzelnden, unterschiedlich wurzelnden Pflanzenarten
- dauerhaft geschlossener Bodenvegetation
- humusreichen, gut durchlüfteten Oberböden
- Totholz- und Mikroreliefstrukturen, die Wasser zurückhalten
Die Folge ist eine verminderte Infiltrationsfähigkeit. Niederschläge können schlechter im Boden versickern und werden stattdessen oberflächlich abgeführt.
Entwässerungsgräben, begradigte Strukturen oder verdichtete Fahrspuren verstärken diesen Effekt zusätzlich. Wasser verlässt die Fläche schneller, anstatt im Boden gespeichert zu werden und zur Grundwasserneubildung beizutragen.
Auswirkungen auf Biodiversität
Ein beschleunigter Wasserabfluss hat direkte und indirekte Folgen für die biologische Vielfalt:
- Feuchtlebensräume trocknen schneller aus oder verschwinden ganz.
- Bodenorganismen verlieren stabile Lebensbedingungen.
- Amphibien, Insekten und viele Pflanzenarten sind auf zeitweilig wasserführende Strukturen angewiesen.
- Mikroklimatische Ausgleichseffekte gehen verloren.
Monokulturen bieten ohnehin weniger ökologische Nischen. Wird zusätzlich die Wasserdynamik destabilisiert, verschärft sich dieser Effekt weiter.
Verlust an Regenrückhaltung und Klimaanpassung
In Zeiten des Klimawandels gewinnen Wasserrückhalt und Resilienz von Ökosystemen zunehmend an Bedeutung. Häufigere Starkregenereignisse wechseln sich mit längeren Trockenphasen ab. Landschaften mit hoher Strukturvielfalt können Niederschläge puffern, speichern und zeitverzögert wieder abgeben.
Wo Wasser jedoch rasch aus der Fläche abgeführt wird, entstehen zwei Probleme:
- Bei Starkregen steigt das Risiko von Erosion, Nährstoffaustrag und Hochwasser.
- In Trockenperioden fehlt gespeichertes Bodenwasser, sodass Vegetation und Bodenleben unter Stress geraten.
Es entsteht ein widersprüchliches Muster: Zunächst wird Wasser konsequent abgeführt, später wird sein Mangel beklagt. Statt kurzfristiger Maßnahmen zur Symptombekämpfung wäre ein integriertes Wassermanagement erforderlich, das Rückhalt, Bodenaufbau und Strukturvielfalt systematisch stärkt.
Erforderliche Perspektive
Ein zukunftsfähiger Umgang mit Landschaftsflächen – ob forstlich oder landwirtschaftlich genutzt – sollte folgende Aspekte berücksichtigen:
- Förderung gemischter, strukturreicher Bestände
- Aufbau humusreicher, lebendiger Böden
- Reduktion von Bodenverdichtung
- Wiederherstellung natürlicher Retentionsräume
- Integration von Wasserrückhalt in die Flächenplanung
Die Stabilisierung des Wasserhaushalts ist keine isolierte Maßnahme, sondern ein zentraler Bestandteil praktischen Naturschutzes und aktiver Klimaanpassung. Strukturvielfalt, Bodenleben und Wasserrückhalt sind eng miteinander verknüpft – und bilden die Grundlage für langfristig resiliente Ökosysteme.
In der Aufnahme
- Fast eines Bachlaufs gleich wird das Wasser aus monokulturell geprägten Flächen ausgeleitet. Bereits in wenigen Wochen wäre es nicht unüblich wenn über Wassermangel auf den gleichen Flächen geklagt würde. Ein durchdachtes Management würde hier sicherlich nicht fehl am Platz sein.
Artenschutz in Franken®
Europäischer Maulwurf (Talpa europaea)

Der Europäische Maulwurf (Talpa europaea)
22/23.02.2026
An einem kühlen Frühlingsmorgen bemerkte ein Gärtner frische Erdhügel, die sich wie kleine Inseln über seinen Rasen verteilten. Zunächst ärgerte er sich über das scheinbare Chaos.
Doch als er innehielt und genauer hinsah, wurde ihm bewusst: Unter der Erde arbeitete ein verborgenes Wesen – unermüdlich, lautlos und mit erstaunlicher Präzision. Während oben das Leben sichtbar blühte, entstand darunter ein ganzes Tunnelsystem. Der unsichtbare Architekt dieses unterirdischen Reiches war der Europäische Maulwurf (Talpa europaea).
22/23.02.2026
- Kleine Baumeister unter unseren Füßen
An einem kühlen Frühlingsmorgen bemerkte ein Gärtner frische Erdhügel, die sich wie kleine Inseln über seinen Rasen verteilten. Zunächst ärgerte er sich über das scheinbare Chaos.
Doch als er innehielt und genauer hinsah, wurde ihm bewusst: Unter der Erde arbeitete ein verborgenes Wesen – unermüdlich, lautlos und mit erstaunlicher Präzision. Während oben das Leben sichtbar blühte, entstand darunter ein ganzes Tunnelsystem. Der unsichtbare Architekt dieses unterirdischen Reiches war der Europäische Maulwurf (Talpa europaea).
Artbeschreibung
Der Europäische Maulwurf ist ein kleines, perfekt an das Leben im Boden angepasstes Säugetier. Er erreicht eine Körperlänge von etwa 11 bis 16 Zentimetern und wiegt zwischen 70 und 130 Gramm. Sein samtiges, schwarzes Fell ist besonders dicht und kann in alle Richtungen gelegt werden – eine ideale Anpassung für das Vor- und Rückwärtsbewegen in engen Gängen.
Charakteristisch sind seine kräftigen, schaufelartigen Vorderpfoten, mit denen er Erde effizient zur Seite drückt. Die Augen sind sehr klein und von Fell überdeckt, da das Sehvermögen unter der Erde nur eine untergeordnete Rolle spielt. Stattdessen orientiert sich der Maulwurf vor allem über seinen ausgeprägten Tast- und Geruchssinn.
Seine Nahrung besteht überwiegend aus Regenwürmern, Insektenlarven und anderen Bodenorganismen. Durch seine Grabtätigkeit lockert er den Boden, verbessert die Durchlüftung und trägt so zur Bodenfruchtbarkeit bei – eine wichtige ökologische Funktion.
Perspektiven im Wandel von Lebensraum und Klima
Die Lebensbedingungen für den Europäischen Maulwurf verändern sich zunehmend. Intensive Landwirtschaft, Bodenverdichtung durch schwere Maschinen und die zunehmende Versiegelung von Flächen verringern geeignete Lebensräume. Besonders problematisch ist die Verdichtung des Bodens, da der Maulwurf auf lockere, grabfähige Erde angewiesen ist.
Auch der Klimawandel beeinflusst seine Zukunft. Längere Trockenperioden können den Boden verhärten und die Verfügbarkeit von Regenwürmern reduzieren – seiner wichtigsten Nahrungsquelle. Gleichzeitig führen Starkregenereignisse dazu, dass Gangsysteme überflutet werden. Diese extremen Wetterbedingungen stellen eine wachsende Herausforderung dar.
Dennoch zeigt die Art eine gewisse Anpassungsfähigkeit. In naturnahen Gärten, Parks und extensiv genutzten Wiesen findet der Maulwurf weiterhin geeignete Rückzugsorte. Die Förderung strukturreicher Grünflächen kann daher einen wichtigen Beitrag zum Erhalt seiner Lebensräume leisten.
Bedrohung durch den Menschen
Der Europäische Maulwurf steht vielerorts unter indirektem Druck durch menschliche Aktivitäten. In Gärten und auf landwirtschaftlichen Flächen wird er häufig als „Schädling“ wahrgenommen, obwohl er Pflanzen nicht frisst und im Gegenteil zur natürlichen Schädlingskontrolle beiträgt.
Illegale Bekämpfungsmethoden, Fallen oder giftige Substanzen können lokale Bestände gefährden. Hinzu kommen Habitatverluste durch Bebauung, Straßenbau und intensive Flächennutzung. Aufklärung über seine ökologische Bedeutung sowie ein toleranter Umgang mit Maulwurfshügeln sind wichtige Schritte, um Konflikte zu reduzieren und die Art zu schützen.
In der Aufnahme von Thomas Köhler
Der Europäische Maulwurf ist ein kleines, perfekt an das Leben im Boden angepasstes Säugetier. Er erreicht eine Körperlänge von etwa 11 bis 16 Zentimetern und wiegt zwischen 70 und 130 Gramm. Sein samtiges, schwarzes Fell ist besonders dicht und kann in alle Richtungen gelegt werden – eine ideale Anpassung für das Vor- und Rückwärtsbewegen in engen Gängen.
Charakteristisch sind seine kräftigen, schaufelartigen Vorderpfoten, mit denen er Erde effizient zur Seite drückt. Die Augen sind sehr klein und von Fell überdeckt, da das Sehvermögen unter der Erde nur eine untergeordnete Rolle spielt. Stattdessen orientiert sich der Maulwurf vor allem über seinen ausgeprägten Tast- und Geruchssinn.
Seine Nahrung besteht überwiegend aus Regenwürmern, Insektenlarven und anderen Bodenorganismen. Durch seine Grabtätigkeit lockert er den Boden, verbessert die Durchlüftung und trägt so zur Bodenfruchtbarkeit bei – eine wichtige ökologische Funktion.
Perspektiven im Wandel von Lebensraum und Klima
Die Lebensbedingungen für den Europäischen Maulwurf verändern sich zunehmend. Intensive Landwirtschaft, Bodenverdichtung durch schwere Maschinen und die zunehmende Versiegelung von Flächen verringern geeignete Lebensräume. Besonders problematisch ist die Verdichtung des Bodens, da der Maulwurf auf lockere, grabfähige Erde angewiesen ist.
Auch der Klimawandel beeinflusst seine Zukunft. Längere Trockenperioden können den Boden verhärten und die Verfügbarkeit von Regenwürmern reduzieren – seiner wichtigsten Nahrungsquelle. Gleichzeitig führen Starkregenereignisse dazu, dass Gangsysteme überflutet werden. Diese extremen Wetterbedingungen stellen eine wachsende Herausforderung dar.
Dennoch zeigt die Art eine gewisse Anpassungsfähigkeit. In naturnahen Gärten, Parks und extensiv genutzten Wiesen findet der Maulwurf weiterhin geeignete Rückzugsorte. Die Förderung strukturreicher Grünflächen kann daher einen wichtigen Beitrag zum Erhalt seiner Lebensräume leisten.
Bedrohung durch den Menschen
Der Europäische Maulwurf steht vielerorts unter indirektem Druck durch menschliche Aktivitäten. In Gärten und auf landwirtschaftlichen Flächen wird er häufig als „Schädling“ wahrgenommen, obwohl er Pflanzen nicht frisst und im Gegenteil zur natürlichen Schädlingskontrolle beiträgt.
Illegale Bekämpfungsmethoden, Fallen oder giftige Substanzen können lokale Bestände gefährden. Hinzu kommen Habitatverluste durch Bebauung, Straßenbau und intensive Flächennutzung. Aufklärung über seine ökologische Bedeutung sowie ein toleranter Umgang mit Maulwurfshügeln sind wichtige Schritte, um Konflikte zu reduzieren und die Art zu schützen.
In der Aufnahme von Thomas Köhler
- Aus misslicher Lage gerettet .. eine Katze trug den Maulwurf mit sich und ließ dieses Tier fallen als wir uns näherten ... damit haben ihm wohl das Leben gerettet ... für uns eine nicht alltägliche Chance einige Aufnahmen am Tag von ihn zu erhaschen ...
Artenschutz in Franken®
Altbaumentnahme im Februar: Eingriffe mit weitreichenden Folgen für die Biodiversität

Kritischer Bericht zur Holzentnahme von Altbäumen im Februar
22/23.02.2026
Die Holzentnahme von Altbäumen in den Wintermonaten – insbesondere im Februar – wird forstlich häufig mit dem Hinweis auf Vegetationsruhe, bessere Befahrbarkeit der Böden und geringere Störung brütender Vögel begründet.
Diese Argumente sind nachvollziehbar, greifen jedoch aus naturschutzfachlicher Sicht zu kurz. Gerade Altbäume erfüllen zentrale Funktionen für die Biodiversität, und ihre Entnahme zu diesem Zeitpunkt kann erhebliche ökologische Auswirkungen haben, die differenziert betrachtet werden müssen.
- (Einordnung aus Sicht des praktischen Naturschutzes)
22/23.02.2026
Die Holzentnahme von Altbäumen in den Wintermonaten – insbesondere im Februar – wird forstlich häufig mit dem Hinweis auf Vegetationsruhe, bessere Befahrbarkeit der Böden und geringere Störung brütender Vögel begründet.
Diese Argumente sind nachvollziehbar, greifen jedoch aus naturschutzfachlicher Sicht zu kurz. Gerade Altbäume erfüllen zentrale Funktionen für die Biodiversität, und ihre Entnahme zu diesem Zeitpunkt kann erhebliche ökologische Auswirkungen haben, die differenziert betrachtet werden müssen.
Bedeutung von Altbäumen für die Biodiversität
Altbäume sind Schlüsselstrukturen in Waldökosystemen. Sie bieten:
Viele Arten sind auf diese Strukturen spezialisiert und können jüngere Bestände nicht als Ersatz nutzen. Die Entnahme einzelner Altbäume bedeutet daher nicht nur den Verlust eines Individuums, sondern häufig den Verlust eines komplexen Lebensraums.
Geräuschentwicklung und Störwirkungen
Der Einsatz schwerer Forstmaschinen führt zu einer erheblichen Geräuschentwicklung. Diese wirkt sich auch im Februar auf Wildtiere aus, da zahlreiche Arten in sensiblen Überwinterungsphasen sind:
Bodenverdichtung und Beeinträchtigung überwinternder Organismen
Ein zentraler, oft unterschätzter Aspekt ist die Befahrung des Waldbodens. Schwere Maschinen üben hohen Druck auf den Boden aus, selbst bei vermeintlich gefrorenen Bedingungen, die im Februar zunehmend unsicher sind.
Negative Auswirkungen:
Gerade im Winter überwintern zahlreiche Organismen im Boden:
Mechanische Belastung kann hier zu direkter Mortalität oder langfristiger Habitatdegradation führen.
Auswirkungen auf Amphibienpopulationen
Besondere Aufmerksamkeit verdient die Situation von Amphibien. Viele Arten überwintern terrestrisch in Wäldern – oft unentdeckt und in geringer Tiefe. Eine Befahrung mit schweren Maschinen kann:
Da Amphibienpopulationen europaweit rückläufig sind, ist jede zusätzliche Belastung kritisch zu bewerten.
Beitrag zur Verbreitung des Bsal-Pilzes
Ein weiterer relevanter Aspekt ist die potenzielle Verbreitung von Krankheitserregern durch forstliche Arbeiten. Der Pilz Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal) befällt insbesondere Schwanzlurche wie Salamander und Molche und kann lokale Populationen innerhalb kurzer Zeit stark dezimieren.
Schwere Maschinen können zur Verbreitung beitragen durch:
Insbesondere in feuchten Waldhabitaten mit bekannten Amphibienvorkommen stellt dies ein relevantes Risiko dar. Präventionsmaßnahmen wie gründliche Reinigung und Desinfektion von Geräten sind daher aus naturschutzfachlicher Sicht zwingend erforderlich.
Klimatische Rahmenbedingungen im Februar
Durch mildere Winter sind Böden im Februar häufig nicht mehr durchgehend gefroren. Die klassische Annahme, dass Winterbefahrung bodenschonend sei, trifft daher nicht mehr pauschal zu. Feuchte, nicht gefrorene Böden reagieren besonders empfindlich auf Druckbelastung.
Zusammenfassende Bewertung
Die Holzentnahme von Altbäumen im Februar ist aus forstwirtschaftlicher Perspektive organisatorisch nachvollziehbar, birgt jedoch erhebliche ökologische Risiken:
Für eine naturverträgliche Praxis im Sinne des praktischen Naturschutzes sollten daher folgende Aspekte geprüft werden:
Eine nachhaltige Waldnutzung kann nur dann als ökologisch verantwortungsvoll gelten, wenn sie die komplexen Wechselwirkungen im Ökosystem berücksichtigt. Die Entnahme von Altbäumen im Februar erfordert daher eine besonders sorgfältige Abwägung zwischen wirtschaftlichen Interessen und dem Schutz biologischer Vielfalt.
In der Aufnahme vom Februar
Altbäume sind Schlüsselstrukturen in Waldökosystemen. Sie bieten:
- Höhlen und Spalten als Lebensraum für Vögel, Fledermäuse und Kleinsäuger
- Totholzstrukturen für Käfer, Pilze und Moose
- Mikrohabitate wie Rindentaschen, Mulmhöhlen und Kronentotholz
- Nahrungsquellen in Form von Samen, Insektenvorkommen und Pilzen
Viele Arten sind auf diese Strukturen spezialisiert und können jüngere Bestände nicht als Ersatz nutzen. Die Entnahme einzelner Altbäume bedeutet daher nicht nur den Verlust eines Individuums, sondern häufig den Verlust eines komplexen Lebensraums.
Geräuschentwicklung und Störwirkungen
Der Einsatz schwerer Forstmaschinen führt zu einer erheblichen Geräuschentwicklung. Diese wirkt sich auch im Februar auf Wildtiere aus, da zahlreiche Arten in sensiblen Überwinterungsphasen sind:
- Säugetiere (z. B. Rehe, Wildschweine, Füchse) befinden sich in einer energetisch kritischen Phase. Störungen führen zu Fluchtreaktionen und erhöhtem Energieverbrauch.
- Fledermäuse überwintern in Baumhöhlen oder Spalten. Vibrationen und Lärm können sie zum Aufwachen zwingen, was bei wiederholter Störung lebensbedrohlich sein kann.
- Vögel halten sich zwar nicht in der Brutzeit, nutzen Altbäume jedoch weiterhin als Schlaf- und Schutzplätze.
- Neben dem akustischen Reiz sind es vor allem Erschütterungen durch Maschinenbetrieb, die empfindliche Arten beeinträchtigen.
Bodenverdichtung und Beeinträchtigung überwinternder Organismen
Ein zentraler, oft unterschätzter Aspekt ist die Befahrung des Waldbodens. Schwere Maschinen üben hohen Druck auf den Boden aus, selbst bei vermeintlich gefrorenen Bedingungen, die im Februar zunehmend unsicher sind.
Negative Auswirkungen:
- Bodenverdichtung reduziert Porenvolumen, Wasserinfiltration und Sauerstoffversorgung.
- Zerstörung von Bodenstrukturen, die für Mikroorganismen, Pilze und wirbellose Tiere essenziell sind.
- Beeinträchtigung von Mykorrhiza-Netzwerken, die für die Nährstoffversorgung der Bäume entscheidend sind.
Gerade im Winter überwintern zahlreiche Organismen im Boden:
- Amphibien wie Frösche und Molche graben sich in frostfreie Bodenschichten ein.
- Insekten (z. B. Käferlarven, Wildbienen, Schmetterlingspuppen) verbringen ihre Ruhephase in Bodenhohlräumen oder im Totholz.
- Kleinsäuger nutzen unterirdische Gangsysteme.
Mechanische Belastung kann hier zu direkter Mortalität oder langfristiger Habitatdegradation führen.
Auswirkungen auf Amphibienpopulationen
Besondere Aufmerksamkeit verdient die Situation von Amphibien. Viele Arten überwintern terrestrisch in Wäldern – oft unentdeckt und in geringer Tiefe. Eine Befahrung mit schweren Maschinen kann:
- Überwinterungsquartiere zerstören
- Tiere direkt verletzen oder töten
- Wanderkorridore fragmentieren
Da Amphibienpopulationen europaweit rückläufig sind, ist jede zusätzliche Belastung kritisch zu bewerten.
Beitrag zur Verbreitung des Bsal-Pilzes
Ein weiterer relevanter Aspekt ist die potenzielle Verbreitung von Krankheitserregern durch forstliche Arbeiten. Der Pilz Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal) befällt insbesondere Schwanzlurche wie Salamander und Molche und kann lokale Populationen innerhalb kurzer Zeit stark dezimieren.
Schwere Maschinen können zur Verbreitung beitragen durch:
- Verschleppung von kontaminiertem Bodenmaterial an Reifen und Ketten
- Verlagerung von Sporen über größere Distanzen
- Nutzung mehrerer Waldflächen ohne ausreichende Reinigung
Insbesondere in feuchten Waldhabitaten mit bekannten Amphibienvorkommen stellt dies ein relevantes Risiko dar. Präventionsmaßnahmen wie gründliche Reinigung und Desinfektion von Geräten sind daher aus naturschutzfachlicher Sicht zwingend erforderlich.
Klimatische Rahmenbedingungen im Februar
Durch mildere Winter sind Böden im Februar häufig nicht mehr durchgehend gefroren. Die klassische Annahme, dass Winterbefahrung bodenschonend sei, trifft daher nicht mehr pauschal zu. Feuchte, nicht gefrorene Böden reagieren besonders empfindlich auf Druckbelastung.
Zusammenfassende Bewertung
Die Holzentnahme von Altbäumen im Februar ist aus forstwirtschaftlicher Perspektive organisatorisch nachvollziehbar, birgt jedoch erhebliche ökologische Risiken:
- Verlust strukturreicher Lebensräume
- Störung überwinternder Tiere
- Schädigung sensibler Bodenökosysteme
- Risiko der Krankheitsverschleppung
- Langfristige Beeinträchtigung der Biodiversität
Für eine naturverträgliche Praxis im Sinne des praktischen Naturschutzes sollten daher folgende Aspekte geprüft werden:
- Strikte Auswahl und Markierung ökologisch besonders wertvoller Altbäume als Habitatbäume
- Verzicht auf Befahrung bei ungeeigneten Bodenbedingungen
- Einrichtung fester Rückegassen
- Reinigung und Desinfektion von Maschinen
- Berücksichtigung bekannter Amphibienvorkommen bei der Einsatzplanung
Eine nachhaltige Waldnutzung kann nur dann als ökologisch verantwortungsvoll gelten, wenn sie die komplexen Wechselwirkungen im Ökosystem berücksichtigt. Die Entnahme von Altbäumen im Februar erfordert daher eine besonders sorgfältige Abwägung zwischen wirtschaftlichen Interessen und dem Schutz biologischer Vielfalt.
In der Aufnahme vom Februar
- Einblicke in eine Forstabteilung die nach der Entnahme von Altbäumen eine deutliche Veränderung im ökologischen Kontext aufweist.
Artenschutz in Franken®
Große Pechlibelle (Ischnura elegans)

Die Große Pechlibelle (Ischnura elegans)
22/23.02.2026
Er setzt sich kurz auf einen Grashalm, kippt leicht nach vorn – und startet im nächsten Moment wieder zu einem schnellen Flug dicht über dem Wasser. Zwischen Spiegelungen und Lichtreflexen ist sie kaum zu erkennen, und doch prägt sie das Bild vieler Gewässer: die Große Pechlibelle.
22/23.02.2026
- An einem sonnigen Frühsommertag liegt ein kleiner Teich still zwischen Schilf und Wiesenblumen. Über der Wasseroberfläche schwirrt ein zarter, blau schimmernder Flügelblitz.
Er setzt sich kurz auf einen Grashalm, kippt leicht nach vorn – und startet im nächsten Moment wieder zu einem schnellen Flug dicht über dem Wasser. Zwischen Spiegelungen und Lichtreflexen ist sie kaum zu erkennen, und doch prägt sie das Bild vieler Gewässer: die Große Pechlibelle.
Artbeschreibung: Die Große Pechlibelle (Ischnura elegans)
Die Große Pechlibelle (Ischnura elegans) gehört zur Familie der Schlanklibellen (Coenagrionidae) und zählt zu den häufigsten Libellenarten Europas. Sie besiedelt stehende und langsam fließende Gewässer wie Teiche, Weiher, Seen, Gräben oder ruhige Flussabschnitte.
In der Aufnahme von Willibald Lang
Die Große Pechlibelle (Ischnura elegans) gehört zur Familie der Schlanklibellen (Coenagrionidae) und zählt zu den häufigsten Libellenarten Europas. Sie besiedelt stehende und langsam fließende Gewässer wie Teiche, Weiher, Seen, Gräben oder ruhige Flussabschnitte.
In der Aufnahme von Willibald Lang
- Die Große Pechlibelle ist eine sehr häufige, weit verbreitete Kleinlibelle, welche anspruchslos bei der Beschaffenheit ihrer Fortpflanzungsgewässer ist. Dieses Weibchen zeigt einen Übergangszustand zwischen der Jugendfarbmorpfe violacea und der einsetzenden, androchromen (wie die Männchen gefärbten) Altersform typica. Körperlänge von 27,0 - 34,0 mm.
Artenschutz in Franken®
Flussbarsch (Perca fluviatilis)

Der Flussbarsch (Perca fluviatilis)
21/22.02.2026
Mit präziser Bewegung schnappt er zu und verschwindet wieder im Halbdunkel. Der Flussbarsch ist kein lauter Räuber, sondern ein geduldiger Beobachter im Geflecht des Gewässers.
21/22.02.2026
- Die Wasseroberfläche eines Sees liegt ruhig im Morgenlicht. Unter ihr bewegt sich ein Schatten zwischen Wasserpflanzen und versunkenen Ästen. Plötzlich zuckt ein Schwarm kleiner Fische auseinander – blitzschnell stößt ein grünlich schimmernder Jäger hervor.
Mit präziser Bewegung schnappt er zu und verschwindet wieder im Halbdunkel. Der Flussbarsch ist kein lauter Räuber, sondern ein geduldiger Beobachter im Geflecht des Gewässers.
Artbeschreibung: Der Flussbarsch (Perca fluviatilis)
Der Flussbarsch (Perca fluviatilis) – auch einfach „Barsch“ genannt – ist einer der bekanntesten Süßwasserfische Europas. Er gehört zur Familie der Echten Barsche (Percidae) und ist in Seen, Teichen, Flüssen und langsam fließenden Gewässern weit verbreitet.
Charakteristisch ist sein hochrückiger, seitlich abgeflachter Körper mit grünlich-gelber Grundfärbung. Auffällig sind die dunklen, senkrechten Querbänder entlang der Flanken. Die Bauch- und Afterflossen sind oft rötlich gefärbt. Besonders markant sind die zwei Rückenflossen: eine vordere mit stacheligen Hartstrahlen und eine hintere mit weichen Flossenstrahlen.
Flussbarsche können je nach Lebensraum unterschiedlich groß werden. Durchschnittlich erreichen sie 20 bis 40 Zentimeter Länge, in nährstoffreichen Gewässern sind jedoch auch größere Exemplare möglich.
Jungbarsche ernähren sich zunächst von Zooplankton und kleinen wirbellosen Tieren. Mit zunehmender Größe gehen sie zur räuberischen Lebensweise über und jagen kleinere Fische, Insektenlarven und Krebstiere. Sie sind oft in Trupps oder lockeren Schwärmen unterwegs, insbesondere in jüngeren Altersstadien.
Die Laichzeit liegt meist im Frühjahr. Die Weibchen legen lange, gallertartige Laichbänder an Pflanzen, Wurzeln oder Totholz im Flachwasser ab.
Perspektive des Flussbarsches im Wandel von Lebensraum und Klima
Der Flussbarsch gilt als anpassungsfähig und besiedelt unterschiedlichste Gewässertypen. Dennoch ist auch er von Umweltveränderungen betroffen.
Lebensraumveränderung
Der Ausbau von Flüssen, Uferbefestigungen und das Entfernen von Totholz oder Wasserpflanzen führen zu einem Verlust strukturreicher Lebensräume. Gerade Jungbarsche sind auf flache, pflanzenreiche Uferzonen als Schutz- und Nahrungsräume angewiesen.
Staustufen und Gewässerverbauungen unterbrechen zudem ökologische Verbindungen. Verschmutzung, Nährstoffeinträge und Sauerstoffmangel können insbesondere in stehenden Gewässern problematisch werden.
In künstlich stark veränderten Gewässern kann sich das Gleichgewicht zwischen Raub- und Beutefischen verschieben, was langfristig Auswirkungen auf die gesamte Fischgemeinschaft hat.
Klimawandel
Steigende Wassertemperaturen beeinflussen Stoffwechsel, Wachstum und Fortpflanzung. Der Flussbarsch toleriert relativ breite Temperaturbereiche und könnte in manchen Regionen kurzfristig von wärmeren Bedingungen profitieren.
Gleichzeitig bergen höhere Temperaturen Risiken:
Besonders empfindlich reagieren frühe Entwicklungsstadien auf extreme Temperaturschwankungen oder plötzliche Hochwasserereignisse.
Langfristig hängt die Stabilität der Bestände von naturnahen Gewässerstrukturen, guter Wasserqualität und funktionierenden Nahrungsnetzen ab. Der Flussbarsch ist dabei nicht nur Räuber, sondern auch Beute größerer Fische, Vögel und Säugetiere – und somit ein wichtiger Bestandteil aquatischer Ökosysteme.
In der Aufnahme von Peter Hoffmann
Der Flussbarsch (Perca fluviatilis) – auch einfach „Barsch“ genannt – ist einer der bekanntesten Süßwasserfische Europas. Er gehört zur Familie der Echten Barsche (Percidae) und ist in Seen, Teichen, Flüssen und langsam fließenden Gewässern weit verbreitet.
Charakteristisch ist sein hochrückiger, seitlich abgeflachter Körper mit grünlich-gelber Grundfärbung. Auffällig sind die dunklen, senkrechten Querbänder entlang der Flanken. Die Bauch- und Afterflossen sind oft rötlich gefärbt. Besonders markant sind die zwei Rückenflossen: eine vordere mit stacheligen Hartstrahlen und eine hintere mit weichen Flossenstrahlen.
Flussbarsche können je nach Lebensraum unterschiedlich groß werden. Durchschnittlich erreichen sie 20 bis 40 Zentimeter Länge, in nährstoffreichen Gewässern sind jedoch auch größere Exemplare möglich.
Jungbarsche ernähren sich zunächst von Zooplankton und kleinen wirbellosen Tieren. Mit zunehmender Größe gehen sie zur räuberischen Lebensweise über und jagen kleinere Fische, Insektenlarven und Krebstiere. Sie sind oft in Trupps oder lockeren Schwärmen unterwegs, insbesondere in jüngeren Altersstadien.
Die Laichzeit liegt meist im Frühjahr. Die Weibchen legen lange, gallertartige Laichbänder an Pflanzen, Wurzeln oder Totholz im Flachwasser ab.
Perspektive des Flussbarsches im Wandel von Lebensraum und Klima
Der Flussbarsch gilt als anpassungsfähig und besiedelt unterschiedlichste Gewässertypen. Dennoch ist auch er von Umweltveränderungen betroffen.
Lebensraumveränderung
Der Ausbau von Flüssen, Uferbefestigungen und das Entfernen von Totholz oder Wasserpflanzen führen zu einem Verlust strukturreicher Lebensräume. Gerade Jungbarsche sind auf flache, pflanzenreiche Uferzonen als Schutz- und Nahrungsräume angewiesen.
Staustufen und Gewässerverbauungen unterbrechen zudem ökologische Verbindungen. Verschmutzung, Nährstoffeinträge und Sauerstoffmangel können insbesondere in stehenden Gewässern problematisch werden.
In künstlich stark veränderten Gewässern kann sich das Gleichgewicht zwischen Raub- und Beutefischen verschieben, was langfristig Auswirkungen auf die gesamte Fischgemeinschaft hat.
Klimawandel
Steigende Wassertemperaturen beeinflussen Stoffwechsel, Wachstum und Fortpflanzung. Der Flussbarsch toleriert relativ breite Temperaturbereiche und könnte in manchen Regionen kurzfristig von wärmeren Bedingungen profitieren.
Gleichzeitig bergen höhere Temperaturen Risiken:
- Sauerstoffgehalt im Wasser sinkt
- Algenblüten nehmen zu
- Konkurrenz durch wärmeliebende Arten steigt
- Veränderungen im Nahrungsangebot treten auf
Besonders empfindlich reagieren frühe Entwicklungsstadien auf extreme Temperaturschwankungen oder plötzliche Hochwasserereignisse.
Langfristig hängt die Stabilität der Bestände von naturnahen Gewässerstrukturen, guter Wasserqualität und funktionierenden Nahrungsnetzen ab. Der Flussbarsch ist dabei nicht nur Räuber, sondern auch Beute größerer Fische, Vögel und Säugetiere – und somit ein wichtiger Bestandteil aquatischer Ökosysteme.
In der Aufnahme von Peter Hoffmann
- Die Seitensicht des Flussbarsches zeigt dessen ganze Schönheit .
Artenschutz in Franken®
Hausdornfinger (Cheiracanthium mildei)

Der Hausdornfinger (Cheiracanthium mildei)
21/22.02.2026
Sie sucht keinen Menschenkontakt – nur Schutz und vielleicht ein paar Insekten, die vom Licht angezogen werden. Mit ruhigen Bewegungen verschwindet sie in einer kleinen Gespinströhre. Der Hausdornfinger ist ein stiller Mitbewohner unserer Siedlungen – meist unbemerkt, oft missverstanden.
21/22.02.2026
- An einem warmen Sommerabend steht das Fenster gekippt. Die Luft ist mild, und das Licht der untergehenden Sonne taucht den Raum in ein weiches Orange. Unbemerkt klettert eine schlanke, hell gefärbte Spinne am Fensterrahmen entlang.
Sie sucht keinen Menschenkontakt – nur Schutz und vielleicht ein paar Insekten, die vom Licht angezogen werden. Mit ruhigen Bewegungen verschwindet sie in einer kleinen Gespinströhre. Der Hausdornfinger ist ein stiller Mitbewohner unserer Siedlungen – meist unbemerkt, oft missverstanden.
Artbeschreibung: Der Hausdornfinger (Cheiracanthium mildei)
Der Hausdornfinger (Cheiracanthium mildei) gehört zur Familie der Dornfingerspinnen (Cheiracanthiidae). Ursprünglich stammt die Art aus wärmeren Regionen Europas und des Mittelmeerraums, hat sich jedoch in den vergangenen Jahrzehnten weiter nach Norden ausgebreitet.
Mit einer Körperlänge von etwa 7 bis 10 Millimetern (Weibchen etwas größer als Männchen) ist der Hausdornfinger mittelgroß. Charakteristisch ist seine gelblich-helle bis beige Grundfärbung. Der Vorderkörper wirkt etwas dunkler, die Beine sind schlank und relativ lang. Typisch sind die kräftigen, nach vorne gerichteten Kieferklauen (Cheliceren), die der Gattung ihren Namen geben.
Im Gegensatz zu vielen anderen Spinnen baut der Hausdornfinger kein klassisches Radnetz. Stattdessen lebt er als aktiver Jäger. Tagsüber hält er sich häufig in einem selbst gesponnenen, röhrenartigen Rückzugsort auf – etwa in Ecken, hinter Bildern, in Rollladenkästen oder in dichter Vegetation. Nachts geht er auf Beutefang und erbeutet kleine Insekten.
Der Biss des Hausdornfingers kann für den Menschen schmerzhaft sein, ist jedoch in der Regel medizinisch unproblematisch. Die Art gilt nicht als gefährlich, auch wenn einzelne Begegnungen zu Verunsicherung führen können.
Perspektive des Hausdornfingers im Wandel von Lebensraum und Klima
Die Ausbreitung des Hausdornfingers wird häufig im Zusammenhang mit klimatischen Veränderungen diskutiert.
Lebensraumveränderung
Die zunehmende Urbanisierung schafft neue Lebensräume für wärmeliebende Arten. Gebäude bieten geschützte Strukturen mit vergleichsweise stabilen Temperaturen. Fassaden, Gärten und Innenräume können Ersatzhabitate darstellen, insbesondere dort, wo natürliche Lebensräume durch Bebauung oder intensive Landwirtschaft zurückgehen.
Gleichzeitig führen strukturärmere Landschaften im ländlichen Raum zu einer Verschiebung von Lebensräumen in Richtung Siedlungsbereiche. Der Hausdornfinger profitiert teilweise von dieser Entwicklung, da er anpassungsfähig ist und sowohl im Freiland als auch in Gebäuden leben kann.
Klimawandel
Steigende Durchschnittstemperaturen und mildere Winter begünstigen die Ausbreitung wärmeliebender Arten nach Norden. Der Hausdornfinger gilt als Beispiel für eine Art, die von diesen klimatischen Veränderungen profitieren kann.
Längere warme Perioden können die Fortpflanzungsbedingungen verbessern und die Überlebensrate erhöhen. Gleichzeitig bleibt die Art auf ein ausreichendes Nahrungsangebot und geeignete Rückzugsorte angewiesen.
Die zunehmende Präsenz in Siedlungsräumen führt jedoch auch zu mehr Begegnungen mit Menschen. Eine sachliche Aufklärung über Biologie und Verhalten der Art ist daher wichtig, um unbegründete Ängste abzubauen.
Langfristig zeigt der Hausdornfinger, wie flexibel manche Arten auf Umweltveränderungen reagieren können. Während viele spezialisierte Arten unter Lebensraumverlust und Klimastress leiden, gelingt es anpassungsfähigen Arten, neue ökologische Nischen zu erschließen.
In der Aufnahme von Helga und Hubertus Zinnecker
Der Hausdornfinger (Cheiracanthium mildei) gehört zur Familie der Dornfingerspinnen (Cheiracanthiidae). Ursprünglich stammt die Art aus wärmeren Regionen Europas und des Mittelmeerraums, hat sich jedoch in den vergangenen Jahrzehnten weiter nach Norden ausgebreitet.
Mit einer Körperlänge von etwa 7 bis 10 Millimetern (Weibchen etwas größer als Männchen) ist der Hausdornfinger mittelgroß. Charakteristisch ist seine gelblich-helle bis beige Grundfärbung. Der Vorderkörper wirkt etwas dunkler, die Beine sind schlank und relativ lang. Typisch sind die kräftigen, nach vorne gerichteten Kieferklauen (Cheliceren), die der Gattung ihren Namen geben.
Im Gegensatz zu vielen anderen Spinnen baut der Hausdornfinger kein klassisches Radnetz. Stattdessen lebt er als aktiver Jäger. Tagsüber hält er sich häufig in einem selbst gesponnenen, röhrenartigen Rückzugsort auf – etwa in Ecken, hinter Bildern, in Rollladenkästen oder in dichter Vegetation. Nachts geht er auf Beutefang und erbeutet kleine Insekten.
Der Biss des Hausdornfingers kann für den Menschen schmerzhaft sein, ist jedoch in der Regel medizinisch unproblematisch. Die Art gilt nicht als gefährlich, auch wenn einzelne Begegnungen zu Verunsicherung führen können.
Perspektive des Hausdornfingers im Wandel von Lebensraum und Klima
Die Ausbreitung des Hausdornfingers wird häufig im Zusammenhang mit klimatischen Veränderungen diskutiert.
Lebensraumveränderung
Die zunehmende Urbanisierung schafft neue Lebensräume für wärmeliebende Arten. Gebäude bieten geschützte Strukturen mit vergleichsweise stabilen Temperaturen. Fassaden, Gärten und Innenräume können Ersatzhabitate darstellen, insbesondere dort, wo natürliche Lebensräume durch Bebauung oder intensive Landwirtschaft zurückgehen.
Gleichzeitig führen strukturärmere Landschaften im ländlichen Raum zu einer Verschiebung von Lebensräumen in Richtung Siedlungsbereiche. Der Hausdornfinger profitiert teilweise von dieser Entwicklung, da er anpassungsfähig ist und sowohl im Freiland als auch in Gebäuden leben kann.
Klimawandel
Steigende Durchschnittstemperaturen und mildere Winter begünstigen die Ausbreitung wärmeliebender Arten nach Norden. Der Hausdornfinger gilt als Beispiel für eine Art, die von diesen klimatischen Veränderungen profitieren kann.
Längere warme Perioden können die Fortpflanzungsbedingungen verbessern und die Überlebensrate erhöhen. Gleichzeitig bleibt die Art auf ein ausreichendes Nahrungsangebot und geeignete Rückzugsorte angewiesen.
Die zunehmende Präsenz in Siedlungsräumen führt jedoch auch zu mehr Begegnungen mit Menschen. Eine sachliche Aufklärung über Biologie und Verhalten der Art ist daher wichtig, um unbegründete Ängste abzubauen.
Langfristig zeigt der Hausdornfinger, wie flexibel manche Arten auf Umweltveränderungen reagieren können. Während viele spezialisierte Arten unter Lebensraumverlust und Klimastress leiden, gelingt es anpassungsfähigen Arten, neue ökologische Nischen zu erschließen.
In der Aufnahme von Helga und Hubertus Zinnecker
- Hausdornfinger in dichter Vegetation als natürlicher Lebensraum.
Artenschutz in Franken®
Entwässerung, Versiegelung und ihre Folgen ...

Entwässerung, Versiegelung und ihre Folgen – Beschleunigter Wasserabfluss, Hochwasser und Biodiversitätsverlust
21/22.02.2026
Dieses natürliche Puffersystem reduziert Hochwasserspitzen, speist das Grundwasser und schafft vielfältige Lebensräume. Durch tiefgreifende Veränderungen in der Landnutzung ist dieses Gleichgewicht jedoch vielerorts gestört.
21/22.02.2026
- In natürlichen Landschaften versickert ein großer Teil des Niederschlags direkt im Boden. Wälder, Wiesen, Moore und Auen wirken wie ein Schwamm: Sie speichern Regenwasser, geben es zeitverzögert wieder ab und stabilisieren so den Wasserhaushalt.
Dieses natürliche Puffersystem reduziert Hochwasserspitzen, speist das Grundwasser und schafft vielfältige Lebensräume. Durch tiefgreifende Veränderungen in der Landnutzung ist dieses Gleichgewicht jedoch vielerorts gestört.
Drainierung landwirtschaftlicher Flächen
Zur Verbesserung der landwirtschaftlichen Nutzbarkeit werden Flächen häufig drainiert. Unterirdische Rohrsysteme leiten überschüssiges Wasser gezielt ab, um Staunässe zu vermeiden und die Befahrbarkeit der Böden zu erhöhen.
Diese Praxis hat jedoch hydrologische Folgen:
Wenn große Flächen gleichzeitig entwässert werden, gelangt Wasser nahezu zeitgleich in Bäche und Flüsse. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich Abflusswellen überlagern und kritische Pegel schneller erreicht werden.
Bodenversiegelung in urbanen Räumen
In Städten und Siedlungsgebieten verhindert die zunehmende Versiegelung durch Straßen, Dächer und Parkflächen das Versickern von Regenwasser nahezu vollständig. Statt in den Boden einzudringen, wird es über Kanalsysteme direkt in Gewässer eingeleitet.
Die Folgen:
Je höher der Versiegelungsgrad in einem Einzugsgebiet, desto geringer ist die natürliche Rückhaltefähigkeit der Landschaft.
Auswirkungen auf die Biodiversität
Neben der Hochwasserproblematik hat der beschleunigte Wasserabfluss erhebliche ökologische Konsequenzen.
Verlust von Feuchtlebensräumen
Drainierung führt häufig zur Absenkung des Grundwasserspiegels. Moore, Feuchtwiesen und Auen verlieren ihre charakteristische Vegetation. Spezialisten wie Amphibien, Libellen oder feuchtigkeitsliebende Pflanzenarten finden weniger geeignete Lebensräume.
Moore beispielsweise sind nicht nur wichtige Kohlenstoffspeicher, sondern auch Hotspots der Artenvielfalt. Ihre Entwässerung bedeutet sowohl Klimabelastung als auch Biodiversitätsverlust.
Strukturverarmung von Gewässern
Ein schneller Abfluss verändert die Dynamik von Bächen und Flüssen. Stark schwankende Wasserstände können Laichplätze zerstören, Uferstrukturen erodieren und Sedimente verlagern. Viele Fischarten, wirbellose Wasserorganismen und Uferpflanzen sind jedoch auf stabile, strukturreiche Gewässer angewiesen.
Unterbrechung ökologischer Vernetzung
Auenlandschaften wirken als ökologische Korridore. Wenn sie durch Eindeichung, Entwässerung oder Bebauung verloren gehen, werden Lebensräume isoliert. Der genetische Austausch zwischen Populationen nimmt ab, was langfristig die Widerstandsfähigkeit von Arten schwächt.
Verstärkung klimatischer Stressfaktoren
Mit dem Klimawandel nehmen Starkregenereignisse zu. Gleichzeitig führen längere Trockenperioden zu zusätzlichem Stress für Ökosysteme. Wenn Böden ihre Wasserspeicherfunktion verlieren, verschärfen sich sowohl Dürre- als auch Hochwasserphasen. Diese Extremdynamik setzt viele Arten unter Druck, da sie auf ausgeglichene Bedingungen angewiesen sind.
Ganzheitliche Lösungen für Wasser- und Artenschutz
Ein nachhaltiger Umgang mit Niederschlagswasser dient nicht nur dem Hochwasserschutz, sondern auch dem Erhalt der Biodiversität. Wichtige Maßnahmen können sein:
Hochwasserschutz beginnt in der Fläche – und Biodiversitätsschutz ebenso. Naturnahe, wasseraufnahmefähige Landschaften sind widerstandsfähiger gegenüber extremen Wetterereignissen und bieten zugleich vielfältige Lebensräume für Pflanzen und Tiere.
In der Aufnahme
Zur Verbesserung der landwirtschaftlichen Nutzbarkeit werden Flächen häufig drainiert. Unterirdische Rohrsysteme leiten überschüssiges Wasser gezielt ab, um Staunässe zu vermeiden und die Befahrbarkeit der Böden zu erhöhen.
Diese Praxis hat jedoch hydrologische Folgen:
- Niederschläge werden schneller in Gewässer abgeführt
- Die natürliche Wasserspeicherung im Boden nimmt ab
- Die Grundwasserneubildung kann reduziert werden
- Hochwasserspitzen nach Starkregen werden verstärkt
Wenn große Flächen gleichzeitig entwässert werden, gelangt Wasser nahezu zeitgleich in Bäche und Flüsse. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich Abflusswellen überlagern und kritische Pegel schneller erreicht werden.
Bodenversiegelung in urbanen Räumen
In Städten und Siedlungsgebieten verhindert die zunehmende Versiegelung durch Straßen, Dächer und Parkflächen das Versickern von Regenwasser nahezu vollständig. Statt in den Boden einzudringen, wird es über Kanalsysteme direkt in Gewässer eingeleitet.
Die Folgen:
- Stark beschleunigter Oberflächenabfluss
- Überlastung von Entwässerungssystemen
- Erhöhtes Risiko lokaler Überflutungen
- Schnelle Pegelanstiege in Fließgewässern
Je höher der Versiegelungsgrad in einem Einzugsgebiet, desto geringer ist die natürliche Rückhaltefähigkeit der Landschaft.
Auswirkungen auf die Biodiversität
Neben der Hochwasserproblematik hat der beschleunigte Wasserabfluss erhebliche ökologische Konsequenzen.
Verlust von Feuchtlebensräumen
Drainierung führt häufig zur Absenkung des Grundwasserspiegels. Moore, Feuchtwiesen und Auen verlieren ihre charakteristische Vegetation. Spezialisten wie Amphibien, Libellen oder feuchtigkeitsliebende Pflanzenarten finden weniger geeignete Lebensräume.
Moore beispielsweise sind nicht nur wichtige Kohlenstoffspeicher, sondern auch Hotspots der Artenvielfalt. Ihre Entwässerung bedeutet sowohl Klimabelastung als auch Biodiversitätsverlust.
Strukturverarmung von Gewässern
Ein schneller Abfluss verändert die Dynamik von Bächen und Flüssen. Stark schwankende Wasserstände können Laichplätze zerstören, Uferstrukturen erodieren und Sedimente verlagern. Viele Fischarten, wirbellose Wasserorganismen und Uferpflanzen sind jedoch auf stabile, strukturreiche Gewässer angewiesen.
Unterbrechung ökologischer Vernetzung
Auenlandschaften wirken als ökologische Korridore. Wenn sie durch Eindeichung, Entwässerung oder Bebauung verloren gehen, werden Lebensräume isoliert. Der genetische Austausch zwischen Populationen nimmt ab, was langfristig die Widerstandsfähigkeit von Arten schwächt.
Verstärkung klimatischer Stressfaktoren
Mit dem Klimawandel nehmen Starkregenereignisse zu. Gleichzeitig führen längere Trockenperioden zu zusätzlichem Stress für Ökosysteme. Wenn Böden ihre Wasserspeicherfunktion verlieren, verschärfen sich sowohl Dürre- als auch Hochwasserphasen. Diese Extremdynamik setzt viele Arten unter Druck, da sie auf ausgeglichene Bedingungen angewiesen sind.
Ganzheitliche Lösungen für Wasser- und Artenschutz
Ein nachhaltiger Umgang mit Niederschlagswasser dient nicht nur dem Hochwasserschutz, sondern auch dem Erhalt der Biodiversität. Wichtige Maßnahmen können sein:
- Wiedervernässung von Mooren und Feuchtgebieten
- Schaffung und Erhalt von Retentionsräumen
- Entsiegelung geeigneter Flächen im urbanen Raum
- Dezentrale Regenwasserversickerung
- Schutz und Renaturierung von Auen
Hochwasserschutz beginnt in der Fläche – und Biodiversitätsschutz ebenso. Naturnahe, wasseraufnahmefähige Landschaften sind widerstandsfähiger gegenüber extremen Wetterereignissen und bieten zugleich vielfältige Lebensräume für Pflanzen und Tiere.
In der Aufnahme
- Das Tauwetter der vergangenen Tage führte auch dazu das zahlreiche Bereiche überflutet wurden. Einen Beitrag kann das rasche Abführen von Wasser aus landwirtschaftlichen Flächen leisten. Auch für die Biodiversität zeigen sich immense Herausforderungen.
Artenschutz in Franken®
Zwergmaus (Micromys minutus)
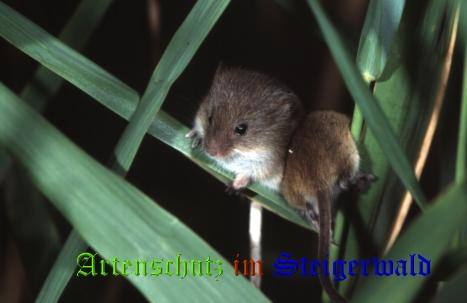
Die Zwergmaus (Micromys minutus)
20/21.02.2026
Zwischen den Samenständen balanciert es scheinbar schwerelos. Für einen Moment verharrt es, die schwarzen Knopfaugen wachsam in die Umgebung gerichtet. Kaum größer als ein Daumen, aber perfekt angepasst – die Zwergmaus lebt verborgen im Dschungel der Wiesen.
20/21.02.2026
- Im ersten Licht des Morgens biegt sich ein Halm im hohen Gras. Behutsam klettert ein winziges Tier daran empor, mit geschickten Bewegungen und einem langen, greifenden Schwanz als Stütze.
Zwischen den Samenständen balanciert es scheinbar schwerelos. Für einen Moment verharrt es, die schwarzen Knopfaugen wachsam in die Umgebung gerichtet. Kaum größer als ein Daumen, aber perfekt angepasst – die Zwergmaus lebt verborgen im Dschungel der Wiesen.
Artbeschreibung: Die Zwergmaus (Micromys minutus)
Die Zwergmaus (Micromys minutus) ist die kleinste heimische Mausart Europas. Mit einer Körperlänge von etwa 5–7 Zentimetern und einem Gewicht von nur 5–10 Gramm gehört sie zu den zierlichsten Nagetieren der Region. Auffällig ist ihr relativ langer Greifschwanz, der fast körperlang werden kann und beim Klettern als zusätzliche „Hand“ dient.
Ihr Fell ist oberseits warm braun bis rötlich gefärbt, die Bauchseite deutlich heller. Die Augen sind groß, die Ohren klein und rund. Diese Merkmale verleihen ihr ein charakteristisches, fast „kindliches“ Aussehen.
Die Zwergmaus besiedelt vor allem strukturreiche Lebensräume wie Röhrichte, Hochstaudenfluren, Getreidefelder, Feuchtwiesen und dichte Grasbestände. Besonders bemerkenswert ist ihr kugelförmiges Nest, das sie geschickt aus Grashalmen in erhöhter Position zwischen Stängeln baut. Dort zieht sie ihre Jungen geschützt vor Bodenfeinden auf.
Ihre Nahrung besteht hauptsächlich aus Samen, Gräsern, Kräutern und gelegentlich kleinen Insekten. Als dämmerungs- und nachtaktives Tier bleibt sie dem Menschen meist verborgen.
Perspektive der Zwergmaus im Wandel von Lebensraum und Klima
Die Zwergmaus ist stark an strukturreiche, deckungsreiche Vegetation gebunden. Veränderungen in der Landschaft wirken sich daher unmittelbar auf ihre Bestände aus.
Lebensraumveränderung
Die Intensivierung der Landwirtschaft, häufige Mahd, der Verlust von Feldrainen und Hecken sowie die Trockenlegung von Feuchtwiesen führen zu einem Rückgang geeigneter Lebensräume. Besonders problematisch ist der Verlust von Altgrasstreifen und ungemähten Randbereichen, die der Zwergmaus Schutz, Nahrung und Nistmöglichkeiten bieten.
Großflächige, strukturarme Agrarlandschaften erschweren Wanderbewegungen und isolieren Populationen. Dadurch kann der genetische Austausch eingeschränkt werden.
Klimawandel
Der Klimawandel beeinflusst Niederschlagsmuster, Vegetationsperioden und die Häufigkeit extremer Wetterereignisse. Längere Trockenphasen können Feuchtgebiete und Röhrichte zurückgehen lassen – wichtige Lebensräume der Zwergmaus. Starkregen oder Überschwemmungen können hingegen Nester zerstören, insbesondere wenn diese in niedriger Vegetation angelegt wurden.
Gleichzeitig können mildere Winter die Überlebensrate erhöhen, sofern ausreichend Nahrung und Deckung vorhanden sind. Die Anpassungsfähigkeit der Zwergmaus ist grundsätzlich vorhanden, doch sie bleibt auf vielfältige, strukturreiche Landschaften angewiesen.
Langfristig hängt ihre Perspektive davon ab, ob extensiv bewirtschaftete Flächen, Gewässerrandstreifen, Brachen und naturnahe Wiesen erhalten oder neu geschaffen werden. Eine kleinräumige, biodiversitätsfördernde Landnutzung kann entscheidend zur Stabilisierung ihrer Bestände beitragen.
In der Aufnahme von Hubertus Zinnecker
Die Zwergmaus (Micromys minutus) ist die kleinste heimische Mausart Europas. Mit einer Körperlänge von etwa 5–7 Zentimetern und einem Gewicht von nur 5–10 Gramm gehört sie zu den zierlichsten Nagetieren der Region. Auffällig ist ihr relativ langer Greifschwanz, der fast körperlang werden kann und beim Klettern als zusätzliche „Hand“ dient.
Ihr Fell ist oberseits warm braun bis rötlich gefärbt, die Bauchseite deutlich heller. Die Augen sind groß, die Ohren klein und rund. Diese Merkmale verleihen ihr ein charakteristisches, fast „kindliches“ Aussehen.
Die Zwergmaus besiedelt vor allem strukturreiche Lebensräume wie Röhrichte, Hochstaudenfluren, Getreidefelder, Feuchtwiesen und dichte Grasbestände. Besonders bemerkenswert ist ihr kugelförmiges Nest, das sie geschickt aus Grashalmen in erhöhter Position zwischen Stängeln baut. Dort zieht sie ihre Jungen geschützt vor Bodenfeinden auf.
Ihre Nahrung besteht hauptsächlich aus Samen, Gräsern, Kräutern und gelegentlich kleinen Insekten. Als dämmerungs- und nachtaktives Tier bleibt sie dem Menschen meist verborgen.
Perspektive der Zwergmaus im Wandel von Lebensraum und Klima
Die Zwergmaus ist stark an strukturreiche, deckungsreiche Vegetation gebunden. Veränderungen in der Landschaft wirken sich daher unmittelbar auf ihre Bestände aus.
Lebensraumveränderung
Die Intensivierung der Landwirtschaft, häufige Mahd, der Verlust von Feldrainen und Hecken sowie die Trockenlegung von Feuchtwiesen führen zu einem Rückgang geeigneter Lebensräume. Besonders problematisch ist der Verlust von Altgrasstreifen und ungemähten Randbereichen, die der Zwergmaus Schutz, Nahrung und Nistmöglichkeiten bieten.
Großflächige, strukturarme Agrarlandschaften erschweren Wanderbewegungen und isolieren Populationen. Dadurch kann der genetische Austausch eingeschränkt werden.
Klimawandel
Der Klimawandel beeinflusst Niederschlagsmuster, Vegetationsperioden und die Häufigkeit extremer Wetterereignisse. Längere Trockenphasen können Feuchtgebiete und Röhrichte zurückgehen lassen – wichtige Lebensräume der Zwergmaus. Starkregen oder Überschwemmungen können hingegen Nester zerstören, insbesondere wenn diese in niedriger Vegetation angelegt wurden.
Gleichzeitig können mildere Winter die Überlebensrate erhöhen, sofern ausreichend Nahrung und Deckung vorhanden sind. Die Anpassungsfähigkeit der Zwergmaus ist grundsätzlich vorhanden, doch sie bleibt auf vielfältige, strukturreiche Landschaften angewiesen.
Langfristig hängt ihre Perspektive davon ab, ob extensiv bewirtschaftete Flächen, Gewässerrandstreifen, Brachen und naturnahe Wiesen erhalten oder neu geschaffen werden. Eine kleinräumige, biodiversitätsfördernde Landnutzung kann entscheidend zur Stabilisierung ihrer Bestände beitragen.
In der Aufnahme von Hubertus Zinnecker
- Dank ihres Greifschwanzes ist die Zwergmaus in der Lage sich rasch zwischen den Schilfhalmen zu bewegen.Was der Regenwald für andere Tierarten - ist für die Zwergmaus der Schilfgürtel manch fränkischer Weiher.
Artenschutz in Franken®
Zwischen Konfliktdebatte und ökologischer Realität
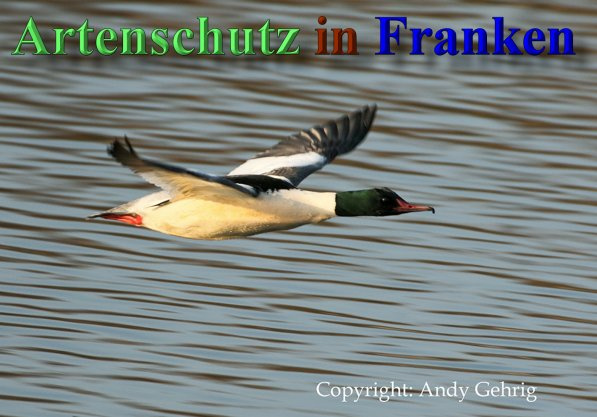
Gänsesäger (Mergus merganser) und Fischbestände – Zwischen Konfliktdebatte und ökologischer Realität
20/21.02.2026
Immer wieder wird die Frage gestellt, welchen Einfluss dieser fischfressende Wasservogel auf Fischbestände hat und ob er zur Gefährdung bestimmter Arten beiträgt. Eine differenzierte Betrachtung zeigt jedoch, dass die Zusammenhänge komplexer sind, als es auf den ersten Blick scheint.
20/21.02.2026
- Der Gänsesäger (Mergus merganser) steht seit vielen Jahren im Mittelpunkt einer kontroversen Diskussion – insbesondere dort, wo Fischerei und Naturschutz aufeinandertreffen.
Immer wieder wird die Frage gestellt, welchen Einfluss dieser fischfressende Wasservogel auf Fischbestände hat und ob er zur Gefährdung bestimmter Arten beiträgt. Eine differenzierte Betrachtung zeigt jedoch, dass die Zusammenhänge komplexer sind, als es auf den ersten Blick scheint.
Nahrung und Jagdverhalten
Der Gänsesäger (Mergus merganser) ist ein spezialisierter Fischjäger. Mit seinem schlanken, gezähnten Schnabel – der wie eine Greifzange funktioniert – hält er glitschige Beute sicher fest. Er jagt tauchend, oft in klaren Flüssen oder Seen, und erbeutet vor allem kleinere bis mittelgroße Fische. Dabei handelt es sich häufig um häufig vorkommende Arten oder um Individuen, die leicht erreichbar sind.
Wichtig ist: Der Gänsesäger ist kein selektiver „Bestandsvernichter“, sondern Teil eines natürlichen Räuber-Beute-Systems. Er entnimmt dem Gewässer Biomasse, wirkt aber gleichzeitig regulierend auf Fischpopulationen. Vor allem kranke, geschwächte oder besonders häufige Individuen werden erbeutet – ein Mechanismus, der zur Stabilisierung von Beständen beitragen kann.
Bedeutung im Ökosystem
Als natürlicher Prädator erfüllt der Gänsesäger mehrere ökologische Funktionen:
Ökosysteme sind komplexe Gefüge, in denen jede Art eine Rolle spielt. Der Gänsesäger ist seit vielen Jahrtausenden Teil dieser Systeme. Er existierte lange bevor moderne Fischerei, Gewässerausbau oder industrielle Eingriffe stattfanden. In dieser Zeit hat er keine Fischart ausgerottet. Natürliche Räuber und Beutetiere entwickeln über evolutionäre Zeiträume hinweg ein dynamisches Gleichgewicht.
Menschliche Einflüsse als entscheidender Faktor
Erst mit dem zunehmenden Einfluss des Menschen geraten viele Fischarten unter Druck. Zu den entscheidenden Faktoren gehören:
Wenn Fischbestände zurückgehen, liegt die Ursache meist in einer Kombination dieser Faktoren. In ökologisch belasteten Systemen kann der Eindruck entstehen, dass natürliche Prädatoren stärker ins Gewicht fallen. Tatsächlich wirken sie jedoch innerhalb der Rahmenbedingungen, die maßgeblich durch menschliche Eingriffe verändert wurden.
Eine isolierte Betrachtung des Gänsesägers greift daher zu kurz. Nachhaltiger Fischartenschutz erfordert vielmehr die Wiederherstellung naturnaher Gewässerstrukturen, Durchgängigkeit von Flüssen, Schutz von Auenlandschaften und eine angepasste Fischereiwirtschaft.
Historische Perspektive
Der Gänsesäger lebt seit vielen Zehntausenden Jahren auf diesem Planeten. Während Eiszeiten, Warmphasen und natürliche Klimaschwankungen hat er sich immer wieder angepasst. Über diesen langen Zeitraum sind keine Fälle bekannt, in denen er eigenständig stabile Fischpopulationen ausgelöscht hätte.
Arten geraten vor allem dann in Bedrängnis, wenn Lebensräume drastisch verändert oder zerstört werden. Mit dem großflächigen Eingreifen des Menschen in Gewässerökosysteme hat sich das ökologische Gleichgewicht vieler Regionen grundlegend verschoben. Der Gänsesäger ist dabei nicht Ursache, sondern Teil eines veränderten Systems.
Ausblick: Klimawandel und Anpassungsfähigkeit
Der Klimawandel stellt auch den Gänsesäger vor neue Herausforderungen. Steigende Wassertemperaturen verändern die Zusammensetzung von Fischgemeinschaften. Manche Kaltwasserarten geraten unter Druck, während wärmeliebende Arten zunehmen.
Der Gänsesäger zeigt eine gewisse Anpassungsfähigkeit:
Dennoch hängt seine Zukunft – wie die vieler Arten – eng mit dem Zustand der Gewässer zusammen. Klimaanpassungsstrategien im Naturschutz müssen daher immer Gewässerrenaturierung, Strukturvielfalt und die Stabilisierung natürlicher Nahrungsketten einbeziehen.
Fazit:
Der Gänsesäger ist kein isolierter Verursacher von Fischrückgängen, sondern ein natürlicher Bestandteil aquatischer Ökosysteme. Seit Jahrtausenden lebt er im Gleichgewicht mit seinen Beutetieren. Erst durch tiefgreifende menschliche Veränderungen geraten viele Arten unter Druck. Ein nachhaltiger Umgang mit unseren Gewässern erfordert daher eine ganzheitliche Perspektive, in der Prädatoren wie der Gänsesäger als integraler Bestandteil funktionierender Ökosysteme verstanden werden.
In der Aufnahme von Andreas Gehrig
Der Gänsesäger (Mergus merganser) ist ein spezialisierter Fischjäger. Mit seinem schlanken, gezähnten Schnabel – der wie eine Greifzange funktioniert – hält er glitschige Beute sicher fest. Er jagt tauchend, oft in klaren Flüssen oder Seen, und erbeutet vor allem kleinere bis mittelgroße Fische. Dabei handelt es sich häufig um häufig vorkommende Arten oder um Individuen, die leicht erreichbar sind.
Wichtig ist: Der Gänsesäger ist kein selektiver „Bestandsvernichter“, sondern Teil eines natürlichen Räuber-Beute-Systems. Er entnimmt dem Gewässer Biomasse, wirkt aber gleichzeitig regulierend auf Fischpopulationen. Vor allem kranke, geschwächte oder besonders häufige Individuen werden erbeutet – ein Mechanismus, der zur Stabilisierung von Beständen beitragen kann.
Bedeutung im Ökosystem
Als natürlicher Prädator erfüllt der Gänsesäger mehrere ökologische Funktionen:
- Regulation von Fischpopulationen: Er verhindert lokale Überpopulationen bestimmter Arten oder Jahrgänge.
- Gesundheitsfaktor: Durch die Entnahme geschwächter Individuen kann er indirekt zur genetischen Stabilität beitragen.
- Nährstoffkreislauf: Über Kot und organisches Material werden Nährstoffe zwischen Gewässer und Uferzonen transportiert.
- Indikatorart: Sein Vorkommen weist auf ausreichend strukturierte, fischreiche und relativ intakte Gewässer hin.
Ökosysteme sind komplexe Gefüge, in denen jede Art eine Rolle spielt. Der Gänsesäger ist seit vielen Jahrtausenden Teil dieser Systeme. Er existierte lange bevor moderne Fischerei, Gewässerausbau oder industrielle Eingriffe stattfanden. In dieser Zeit hat er keine Fischart ausgerottet. Natürliche Räuber und Beutetiere entwickeln über evolutionäre Zeiträume hinweg ein dynamisches Gleichgewicht.
Menschliche Einflüsse als entscheidender Faktor
Erst mit dem zunehmenden Einfluss des Menschen geraten viele Fischarten unter Druck. Zu den entscheidenden Faktoren gehören:
- Gewässerbegradigungen und Staustufen
- Verlust von Laichplätzen
- Verschmutzung und Nährstoffeinträge
- Klimabedingte Erwärmung von Flüssen und Seen
- Überfischung oder intensive Bewirtschaftung
Wenn Fischbestände zurückgehen, liegt die Ursache meist in einer Kombination dieser Faktoren. In ökologisch belasteten Systemen kann der Eindruck entstehen, dass natürliche Prädatoren stärker ins Gewicht fallen. Tatsächlich wirken sie jedoch innerhalb der Rahmenbedingungen, die maßgeblich durch menschliche Eingriffe verändert wurden.
Eine isolierte Betrachtung des Gänsesägers greift daher zu kurz. Nachhaltiger Fischartenschutz erfordert vielmehr die Wiederherstellung naturnaher Gewässerstrukturen, Durchgängigkeit von Flüssen, Schutz von Auenlandschaften und eine angepasste Fischereiwirtschaft.
Historische Perspektive
Der Gänsesäger lebt seit vielen Zehntausenden Jahren auf diesem Planeten. Während Eiszeiten, Warmphasen und natürliche Klimaschwankungen hat er sich immer wieder angepasst. Über diesen langen Zeitraum sind keine Fälle bekannt, in denen er eigenständig stabile Fischpopulationen ausgelöscht hätte.
Arten geraten vor allem dann in Bedrängnis, wenn Lebensräume drastisch verändert oder zerstört werden. Mit dem großflächigen Eingreifen des Menschen in Gewässerökosysteme hat sich das ökologische Gleichgewicht vieler Regionen grundlegend verschoben. Der Gänsesäger ist dabei nicht Ursache, sondern Teil eines veränderten Systems.
Ausblick: Klimawandel und Anpassungsfähigkeit
Der Klimawandel stellt auch den Gänsesäger vor neue Herausforderungen. Steigende Wassertemperaturen verändern die Zusammensetzung von Fischgemeinschaften. Manche Kaltwasserarten geraten unter Druck, während wärmeliebende Arten zunehmen.
Der Gänsesäger zeigt eine gewisse Anpassungsfähigkeit:
- Er kann unterschiedliche Gewässertypen nutzen.
- Er reagiert flexibel auf saisonale Veränderungen im Nahrungsangebot.
- Als Zugvogel kann er sein Verbreitungsgebiet teilweise verschieben.
Dennoch hängt seine Zukunft – wie die vieler Arten – eng mit dem Zustand der Gewässer zusammen. Klimaanpassungsstrategien im Naturschutz müssen daher immer Gewässerrenaturierung, Strukturvielfalt und die Stabilisierung natürlicher Nahrungsketten einbeziehen.
Fazit:
Der Gänsesäger ist kein isolierter Verursacher von Fischrückgängen, sondern ein natürlicher Bestandteil aquatischer Ökosysteme. Seit Jahrtausenden lebt er im Gleichgewicht mit seinen Beutetieren. Erst durch tiefgreifende menschliche Veränderungen geraten viele Arten unter Druck. Ein nachhaltiger Umgang mit unseren Gewässern erfordert daher eine ganzheitliche Perspektive, in der Prädatoren wie der Gänsesäger als integraler Bestandteil funktionierender Ökosysteme verstanden werden.
In der Aufnahme von Andreas Gehrig
- Gänsesäger im schnellen Flug dicht über der Wasseroberfläche.
Artenschutz in Franken®
Baumfalke (Falco subbuteo)

Der Baumfalke (Falco subbuteo)
20/21.02.2026
Mit eleganten Flügelschlägen und rasanter Wendigkeit verfolgt er seine Beute. Ein kurzer Moment, ein gezielter Zugriff – dann steigt der Jäger wieder empor. Hoch oben zieht er seine Kreise, scheinbar schwerelos. Der Baumfalke ist unterwegs, ein Meister der Luft.
20/21.02.2026
- Es ist ein warmer Sommerabend. Über einer weiten Wiese tanzen Libellen im goldenen Licht. Plötzlich durchschneidet ein schlanker Schatten die Luft – schnell, präzise und lautlos.
Mit eleganten Flügelschlägen und rasanter Wendigkeit verfolgt er seine Beute. Ein kurzer Moment, ein gezielter Zugriff – dann steigt der Jäger wieder empor. Hoch oben zieht er seine Kreise, scheinbar schwerelos. Der Baumfalke ist unterwegs, ein Meister der Luft.
Artbeschreibung: Der Baumfalke (Falco subbuteo)
Der Baumfalke (Falco subbuteo) ist ein mittelgroßer Greifvogel aus der Familie der Falken (Falconidae). Er ist in weiten Teilen Europas, Asiens und Nordafrikas verbreitet und zählt zu den Langstreckenziehern. Den Winter verbringt er überwiegend im südlichen Afrika.
Mit einer Körperlänge von etwa 29–36 Zentimetern und einer Flügelspannweite von rund 70–85 Zentimetern wirkt der Baumfalke schlank und sichelflügelig. Sein Gefieder ist oberseits dunkelgrau bis schieferfarben. Die Unterseite ist hell mit dunkler Längsstreifung. Besonders auffällig sind die rostroten „Hosen“ an den Unterschenkeln sowie der dunkle Bartstreif im Gesicht.
Der Baumfalke ist ein ausgesprochener Luftjäger. Seine Nahrung besteht hauptsächlich aus fliegenden Insekten wie Libellen und Käfern sowie aus kleinen Singvögeln, die er oft im schnellen Flug erbeutet. Dabei erreicht er hohe Geschwindigkeiten und zeigt beeindruckende Flugmanöver.
Als Brutplatz nutzt er meist alte Nester von Krähen oder anderen Vögeln in hohen Bäumen. Eigene Nester baut er nicht. Die Brutzeit beginnt im späten Frühjahr oder Frühsommer. In der Regel legt das Weibchen zwei bis drei Eier, die etwa vier Wochen bebrütet werden.
Bevorzugte Lebensräume sind halboffene Landschaften mit Waldrändern, Feldgehölzen, Flussauen oder auch größere Parks – immer in Kombination mit offenen Flächen, die als Jagdgebiet dienen.
Perspektive des Baumfalken im Wandel von Lebensraum und Klima
Der Baumfalke ist stark auf strukturreiche Landschaften angewiesen. Veränderungen in seinem Lebensraum wirken sich daher unmittelbar auf seine Bestände aus.
Lebensraumveränderung:
Die Intensivierung der Landwirtschaft, das Verschwinden von Feldgehölzen und alten Baumbeständen sowie der Rückgang von Feuchtgebieten reduzieren geeignete Brut- und Jagdgebiete. Der Mangel an hohen Bäumen mit alten Krähennestern kann die Brutmöglichkeiten einschränken. Gleichzeitig führt der Einsatz von Pestiziden zu einem Rückgang großer Insekten – einer wichtigen Nahrungsquelle.
Klimawandel:
Veränderte Temperatur- und Niederschlagsmuster beeinflussen das Auftreten von Insekten und Zugvögeln, also potenzieller Beute. Mildere Frühjahre können zwar zu einem früheren Nahrungsangebot führen, doch wenn Ankunft aus den Überwinterungsgebieten und Nahrungsverfügbarkeit zeitlich nicht mehr zusammenpassen, kann dies den Bruterfolg beeinträchtigen. Zudem können extreme Wetterereignisse wie Starkregen oder langanhaltende Hitzeperioden während der Brutzeit die Aufzucht der Jungvögel erschweren.
Langfristig hängt die Zukunft des Baumfalken davon ab, ob vielfältige Kulturlandschaften mit alten Baumbeständen, Hecken und artenreichen Wiesen erhalten bleiben. Schutz von Feuchtgebieten, nachhaltige Landwirtschaft und der Erhalt strukturreicher Landschaften tragen dazu bei, diesem eleganten Jäger auch künftig geeignete Lebensräume zu sichern.
In der Aufnahme von Johannes Rother
Der Baumfalke (Falco subbuteo) ist ein mittelgroßer Greifvogel aus der Familie der Falken (Falconidae). Er ist in weiten Teilen Europas, Asiens und Nordafrikas verbreitet und zählt zu den Langstreckenziehern. Den Winter verbringt er überwiegend im südlichen Afrika.
Mit einer Körperlänge von etwa 29–36 Zentimetern und einer Flügelspannweite von rund 70–85 Zentimetern wirkt der Baumfalke schlank und sichelflügelig. Sein Gefieder ist oberseits dunkelgrau bis schieferfarben. Die Unterseite ist hell mit dunkler Längsstreifung. Besonders auffällig sind die rostroten „Hosen“ an den Unterschenkeln sowie der dunkle Bartstreif im Gesicht.
Der Baumfalke ist ein ausgesprochener Luftjäger. Seine Nahrung besteht hauptsächlich aus fliegenden Insekten wie Libellen und Käfern sowie aus kleinen Singvögeln, die er oft im schnellen Flug erbeutet. Dabei erreicht er hohe Geschwindigkeiten und zeigt beeindruckende Flugmanöver.
Als Brutplatz nutzt er meist alte Nester von Krähen oder anderen Vögeln in hohen Bäumen. Eigene Nester baut er nicht. Die Brutzeit beginnt im späten Frühjahr oder Frühsommer. In der Regel legt das Weibchen zwei bis drei Eier, die etwa vier Wochen bebrütet werden.
Bevorzugte Lebensräume sind halboffene Landschaften mit Waldrändern, Feldgehölzen, Flussauen oder auch größere Parks – immer in Kombination mit offenen Flächen, die als Jagdgebiet dienen.
Perspektive des Baumfalken im Wandel von Lebensraum und Klima
Der Baumfalke ist stark auf strukturreiche Landschaften angewiesen. Veränderungen in seinem Lebensraum wirken sich daher unmittelbar auf seine Bestände aus.
Lebensraumveränderung:
Die Intensivierung der Landwirtschaft, das Verschwinden von Feldgehölzen und alten Baumbeständen sowie der Rückgang von Feuchtgebieten reduzieren geeignete Brut- und Jagdgebiete. Der Mangel an hohen Bäumen mit alten Krähennestern kann die Brutmöglichkeiten einschränken. Gleichzeitig führt der Einsatz von Pestiziden zu einem Rückgang großer Insekten – einer wichtigen Nahrungsquelle.
Klimawandel:
Veränderte Temperatur- und Niederschlagsmuster beeinflussen das Auftreten von Insekten und Zugvögeln, also potenzieller Beute. Mildere Frühjahre können zwar zu einem früheren Nahrungsangebot führen, doch wenn Ankunft aus den Überwinterungsgebieten und Nahrungsverfügbarkeit zeitlich nicht mehr zusammenpassen, kann dies den Bruterfolg beeinträchtigen. Zudem können extreme Wetterereignisse wie Starkregen oder langanhaltende Hitzeperioden während der Brutzeit die Aufzucht der Jungvögel erschweren.
Langfristig hängt die Zukunft des Baumfalken davon ab, ob vielfältige Kulturlandschaften mit alten Baumbeständen, Hecken und artenreichen Wiesen erhalten bleiben. Schutz von Feuchtgebieten, nachhaltige Landwirtschaft und der Erhalt strukturreicher Landschaften tragen dazu bei, diesem eleganten Jäger auch künftig geeignete Lebensräume zu sichern.
In der Aufnahme von Johannes Rother
- Ruhender Baumfalke auf einem hohen Ansitz am Waldrand.
Artenschutz in Franken®
Igelstäubling oder Igelbovist (Lycoperdon echinatum)

Der Igelstäubling oder Igelbovist (Lycoperdon echinatum)
19/20.02.2026
Wer genauer hinschaut, entdeckt keinen Seeigel des Waldes, sondern einen Pilz. Vorsichtig berührt, gibt er bei Reife eine feine Staubwolke frei. Der Igelstäubling zeigt sich nur dem aufmerksamen Blick – unscheinbar und doch faszinierend.
19/20.02.2026
- Nach einem warmen Sommerregen liegt der Waldboden noch feucht und duftet nach Laub und Erde. Zwischen Moos und herabgefallenen Ästen ragt ein kleines, rundes Gebilde hervor – übersät mit weichen, dunklen Stacheln.
Wer genauer hinschaut, entdeckt keinen Seeigel des Waldes, sondern einen Pilz. Vorsichtig berührt, gibt er bei Reife eine feine Staubwolke frei. Der Igelstäubling zeigt sich nur dem aufmerksamen Blick – unscheinbar und doch faszinierend.
Artbeschreibung: Der Igelstäubling oder Igelbovist (Lycoperdon echinatum)
Der Igelstäubling oder Igelbovist (Lycoperdon echinatum) ist ein Vertreter der Stäublinge innerhalb der Bauchpilze. Er wächst vor allem in Laub- und Mischwäldern, bevorzugt auf kalkhaltigen Böden, und erscheint meist vom Sommer bis in den Herbst hinein.
Typisch für diese Art ist die kugelige bis birnenförmige Fruchtkörperform mit einer Größe von etwa 3 bis 7 Zentimetern. Die Oberfläche ist dicht mit auffälligen, gebogenen, zunächst dunklen Stacheln besetzt, die an kleine Igelstacheln erinnern – daher der deutsche Name. Mit zunehmendem Alter können diese Stacheln teilweise abfallen.
Im Inneren befindet sich zunächst festes, weißes Fleisch. Mit der Reife verfärbt sich dieses oliv- bis braun und zerfällt schließlich zu einem feinen Sporenpulver. Bei Druck oder Erschütterung entweichen die Sporen in einer kleinen Staubwolke durch eine Öffnung an der Oberseite – ein typisches Merkmal vieler Stäublinge.
Der Igelstäubling lebt saprobiontisch, das heißt, er ernährt sich von abgestorbenem organischem Material und trägt damit wesentlich zum Abbau von Laub und zur Nährstoffrückführung im Wald bei.
! Wichtiger Hinweis zur Bestimmung !
Wir geben auf unserer Internetpräsenz keinerlei Bestimmungsgarantien oder Verzehrempfehlungen. Alle hier dargestellten Informationen dienen ausschließlich der allgemeinen Wissensvermittlung. Zur sicheren Bestimmung von Pilzen ist ausnahmslos eine professionelle Beratungsstelle (z. B. geprüfte Pilzsachverständige oder offizielle Pilzberatungsstellen) aufzusuchen. Eine eigenständige Bestimmung anhand von Fotos oder Textbeschreibungen kann zu gefährlichen Verwechslungen führen.
Perspektive des Igelstäublings im Wandel von Lebensraum und Klima
Der Igelstäubling ist an bestimmte Standortbedingungen gebunden. Veränderungen im Waldökosystem wirken sich daher unmittelbar auf sein Vorkommen aus.
Lebensraumveränderung:
Die Umwandlung naturnaher Wälder in monotone Forstbestände, Bodenverdichtung durch schwere Maschinen sowie der Verlust von Laub- und Mischwäldern können geeignete Standorte verringern. Da der Pilz auf abgestorbenes organisches Material angewiesen ist, spielt auch die Menge an Totholz und Laub eine wichtige Rolle. Eine intensive „Aufräumwirtschaft“ im Wald kann seine Lebensgrundlage einschränken.
Klimawandel:
Veränderte Niederschlagsmuster und längere Trockenperioden beeinflussen das Pilzwachstum stark. Pilze reagieren empfindlich auf Feuchtigkeit und Temperatur. Längere Hitze- und Dürrephasen können das Myzel im Boden schwächen oder Fruchtkörperbildung verhindern.
Andererseits können mildere Temperaturen in bestimmten Regionen eine Ausbreitung in bislang kühlere Gebiete ermöglichen – vorausgesetzt, geeignete Boden- und Waldstrukturen sind vorhanden.
Langfristig hängt die Zukunft des Igelstäublings von naturnah bewirtschafteten Wäldern, ausreichender Bodenfeuchte und einem funktionierenden Ökosystem mit reichlich organischem Material ab.
In der Aufnahme von Dieter Zinßer
Der Igelstäubling oder Igelbovist (Lycoperdon echinatum) ist ein Vertreter der Stäublinge innerhalb der Bauchpilze. Er wächst vor allem in Laub- und Mischwäldern, bevorzugt auf kalkhaltigen Böden, und erscheint meist vom Sommer bis in den Herbst hinein.
Typisch für diese Art ist die kugelige bis birnenförmige Fruchtkörperform mit einer Größe von etwa 3 bis 7 Zentimetern. Die Oberfläche ist dicht mit auffälligen, gebogenen, zunächst dunklen Stacheln besetzt, die an kleine Igelstacheln erinnern – daher der deutsche Name. Mit zunehmendem Alter können diese Stacheln teilweise abfallen.
Im Inneren befindet sich zunächst festes, weißes Fleisch. Mit der Reife verfärbt sich dieses oliv- bis braun und zerfällt schließlich zu einem feinen Sporenpulver. Bei Druck oder Erschütterung entweichen die Sporen in einer kleinen Staubwolke durch eine Öffnung an der Oberseite – ein typisches Merkmal vieler Stäublinge.
Der Igelstäubling lebt saprobiontisch, das heißt, er ernährt sich von abgestorbenem organischem Material und trägt damit wesentlich zum Abbau von Laub und zur Nährstoffrückführung im Wald bei.
! Wichtiger Hinweis zur Bestimmung !
Wir geben auf unserer Internetpräsenz keinerlei Bestimmungsgarantien oder Verzehrempfehlungen. Alle hier dargestellten Informationen dienen ausschließlich der allgemeinen Wissensvermittlung. Zur sicheren Bestimmung von Pilzen ist ausnahmslos eine professionelle Beratungsstelle (z. B. geprüfte Pilzsachverständige oder offizielle Pilzberatungsstellen) aufzusuchen. Eine eigenständige Bestimmung anhand von Fotos oder Textbeschreibungen kann zu gefährlichen Verwechslungen führen.
Perspektive des Igelstäublings im Wandel von Lebensraum und Klima
Der Igelstäubling ist an bestimmte Standortbedingungen gebunden. Veränderungen im Waldökosystem wirken sich daher unmittelbar auf sein Vorkommen aus.
Lebensraumveränderung:
Die Umwandlung naturnaher Wälder in monotone Forstbestände, Bodenverdichtung durch schwere Maschinen sowie der Verlust von Laub- und Mischwäldern können geeignete Standorte verringern. Da der Pilz auf abgestorbenes organisches Material angewiesen ist, spielt auch die Menge an Totholz und Laub eine wichtige Rolle. Eine intensive „Aufräumwirtschaft“ im Wald kann seine Lebensgrundlage einschränken.
Klimawandel:
Veränderte Niederschlagsmuster und längere Trockenperioden beeinflussen das Pilzwachstum stark. Pilze reagieren empfindlich auf Feuchtigkeit und Temperatur. Längere Hitze- und Dürrephasen können das Myzel im Boden schwächen oder Fruchtkörperbildung verhindern.
Andererseits können mildere Temperaturen in bestimmten Regionen eine Ausbreitung in bislang kühlere Gebiete ermöglichen – vorausgesetzt, geeignete Boden- und Waldstrukturen sind vorhanden.
Langfristig hängt die Zukunft des Igelstäublings von naturnah bewirtschafteten Wäldern, ausreichender Bodenfeuchte und einem funktionierenden Ökosystem mit reichlich organischem Material ab.
In der Aufnahme von Dieter Zinßer
- Igelstäubling zwischen Moos und herabgefallenem Laub.
Artenschutz in Franken®
Gimpel (Pyrrhula pyrrhula)

Der Gimpel (Pyrrhula pyrrhula)
19/20.02.2026
Sein Gefieder leuchtet zart rosarot im ersten Licht der Sonne. Während ringsum alles still wirkt, knackt er geschickt eine Samenknospe und schaut aufmerksam in die klare Luft. Ein leiser, melancholischer Pfiff durchbricht die Stille – es ist der Gimpel, der hier seit Tagen Nahrung findet. Für die Beobachterin am Fenster ist er ein seltener Farbtupfer im Grau des Winters, für sich selbst jedoch ist er vor allem eines: ein Überlebenskünstler.
19/20.02.2026
- An einem frostigen Wintermorgen sitzt ein kleiner, rundlicher Vogel im Apfelbaum eines verschneiten Gartens.
Sein Gefieder leuchtet zart rosarot im ersten Licht der Sonne. Während ringsum alles still wirkt, knackt er geschickt eine Samenknospe und schaut aufmerksam in die klare Luft. Ein leiser, melancholischer Pfiff durchbricht die Stille – es ist der Gimpel, der hier seit Tagen Nahrung findet. Für die Beobachterin am Fenster ist er ein seltener Farbtupfer im Grau des Winters, für sich selbst jedoch ist er vor allem eines: ein Überlebenskünstler.
Artbeschreibung: Der Gimpel (Pyrrhula pyrrhula)
Der Gimpel (Pyrrhula pyrrhula), auch Dompfaff genannt, gehört zur Familie der Finken (Fringillidae). Er ist in weiten Teilen Europas und Asiens verbreitet und bevorzugt strukturreiche Landschaften mit Hecken, Feldgehölzen, Mischwäldern und Gärten.
Charakteristisch ist das auffällige Gefieder des Männchens: Brust und Bauch zeigen ein kräftiges Karminrot bis Rosarot, während Kopf, Flügel und Schwanz schwarz gefärbt sind. Der Rücken ist grau, der Bürzel weiß. Weibchen wirken insgesamt matter und eher bräunlich-rosa gefärbt. Beide Geschlechter besitzen einen kräftigen, kegelförmigen Schnabel – ideal zum Knacken von Samen und Knospen.
Gimpel erreichen eine Körperlänge von etwa 14–16 Zentimetern und wirken durch ihre rundliche Gestalt besonders kompakt. Ihr Flug ist wellenförmig, begleitet von leisen, weichen Ruflauten. Die Nahrung besteht überwiegend aus Samen, Knospen, Beeren und im Sommer ergänzend aus kleinen Insekten.
Die Brutzeit beginnt meist im späten Frühjahr. Das Weibchen baut ein napfförmiges Nest in dichten Sträuchern oder niedrigen Bäumen. In der Regel werden vier bis sechs Eier gelegt, die etwa zwei Wochen bebrütet werden.
Perspektive des Gimpels im Wandel von Lebensraum und Klima
Wie viele Vogelarten steht auch der Gimpel vor Herausforderungen durch Lebensraumveränderungen und den Klimawandel.
Lebensraumveränderung:
Die Intensivierung der Landwirtschaft, das Entfernen von Hecken und Feldgehölzen sowie die zunehmende Versiegelung von Flächen führen zu einem Rückgang geeigneter Brut- und Nahrungsräume. Besonders strukturreiche Landschaften mit abwechslungsreicher Vegetation sind für den Gimpel wichtig. Der Verlust solcher Strukturen kann lokale Bestände schwächen.
Klimawandel:
Steigende Temperaturen und veränderte Niederschlagsmuster beeinflussen die Vegetation und damit das Nahrungsangebot. Wenn sich Knospenbildung und Brutzeit zeitlich verschieben, kann es zu sogenannten „phänologischen Entkopplungen“ kommen – also zu einer zeitlichen Verschiebung zwischen Nahrungsverfügbarkeit und dem Nahrungsbedarf der Jungvögel.
Gleichzeitig ermöglicht ein milderes Klima dem Gimpel in manchen Regionen, weiter nördlich zu brüten oder den Winter besser zu überstehen. Dennoch können extreme Wetterereignisse wie Spätfröste oder lange Hitzeperioden negative Auswirkungen haben.
Langfristig hängt die Perspektive des Gimpels stark davon ab, ob ausreichend strukturreiche Lebensräume erhalten oder neu geschaffen werden. Naturnahe Gärten, Heckenpflanzungen und vielfältige Waldränder können dazu beitragen, stabile Populationen zu sichern.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
Der Gimpel (Pyrrhula pyrrhula), auch Dompfaff genannt, gehört zur Familie der Finken (Fringillidae). Er ist in weiten Teilen Europas und Asiens verbreitet und bevorzugt strukturreiche Landschaften mit Hecken, Feldgehölzen, Mischwäldern und Gärten.
Charakteristisch ist das auffällige Gefieder des Männchens: Brust und Bauch zeigen ein kräftiges Karminrot bis Rosarot, während Kopf, Flügel und Schwanz schwarz gefärbt sind. Der Rücken ist grau, der Bürzel weiß. Weibchen wirken insgesamt matter und eher bräunlich-rosa gefärbt. Beide Geschlechter besitzen einen kräftigen, kegelförmigen Schnabel – ideal zum Knacken von Samen und Knospen.
Gimpel erreichen eine Körperlänge von etwa 14–16 Zentimetern und wirken durch ihre rundliche Gestalt besonders kompakt. Ihr Flug ist wellenförmig, begleitet von leisen, weichen Ruflauten. Die Nahrung besteht überwiegend aus Samen, Knospen, Beeren und im Sommer ergänzend aus kleinen Insekten.
Die Brutzeit beginnt meist im späten Frühjahr. Das Weibchen baut ein napfförmiges Nest in dichten Sträuchern oder niedrigen Bäumen. In der Regel werden vier bis sechs Eier gelegt, die etwa zwei Wochen bebrütet werden.
Perspektive des Gimpels im Wandel von Lebensraum und Klima
Wie viele Vogelarten steht auch der Gimpel vor Herausforderungen durch Lebensraumveränderungen und den Klimawandel.
Lebensraumveränderung:
Die Intensivierung der Landwirtschaft, das Entfernen von Hecken und Feldgehölzen sowie die zunehmende Versiegelung von Flächen führen zu einem Rückgang geeigneter Brut- und Nahrungsräume. Besonders strukturreiche Landschaften mit abwechslungsreicher Vegetation sind für den Gimpel wichtig. Der Verlust solcher Strukturen kann lokale Bestände schwächen.
Klimawandel:
Steigende Temperaturen und veränderte Niederschlagsmuster beeinflussen die Vegetation und damit das Nahrungsangebot. Wenn sich Knospenbildung und Brutzeit zeitlich verschieben, kann es zu sogenannten „phänologischen Entkopplungen“ kommen – also zu einer zeitlichen Verschiebung zwischen Nahrungsverfügbarkeit und dem Nahrungsbedarf der Jungvögel.
Gleichzeitig ermöglicht ein milderes Klima dem Gimpel in manchen Regionen, weiter nördlich zu brüten oder den Winter besser zu überstehen. Dennoch können extreme Wetterereignisse wie Spätfröste oder lange Hitzeperioden negative Auswirkungen haben.
Langfristig hängt die Perspektive des Gimpels stark davon ab, ob ausreichend strukturreiche Lebensräume erhalten oder neu geschaffen werden. Naturnahe Gärten, Heckenpflanzungen und vielfältige Waldränder können dazu beitragen, stabile Populationen zu sichern.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
- Besonders der männliche Gimpel fällt im Winter häufig an den Vogelfütterungsstellen auf. Lebt der Dompfaff während der Sommermonate gerne in höhere Regionen zieht es diesen Vogel im Spätherbst in die Niederungen wo man ihn dann häufiger antrifft. Ende April baut der weibliche Part bevorzugt auf Nadelbäumen unweit des Erdbodens sein Nest. In dieses setzt es seine 5 Eier ab. Bebrütet wird das Gelege 14 Tage ausnahmslos vom Weibchen. Gefüttert werden die kleinen Gimpel 16 Tage von beiden Elternteilen, im Frühstadium mit Insekten, später mit Beeren und Knospen. Dompfaffe erreichen Körperlängen von etwa 12,5 - 13 cm, sowie ein Gewicht von bis zu 41 Gramm. Also von der Statur etwa vergleichbar wie der Haussperling.
Artenschutz in Franken®
Wasserläufer (Gerridae)

Die Wasserläufer – Akrobaten der Wasseroberfläche
19/20.02.2026
Plötzlich ziehen feine, kreisförmige Wellenlinien über die spiegelglatte Oberfläche. Wie schwerelos gleiten kleine, langbeinige Insekten über das Wasser, stoßen sich ab, drehen, stoppen abrupt – ohne jemals einzusinken.
Für einen Moment scheint es, als hätten sie die Gesetze der Physik überlistet. Doch was wie Magie wirkt, ist das perfekte Zusammenspiel von Körperbau und Oberflächenspannung: Es sind Wasserläufer.
19/20.02.2026
- Ein windstiller Sommertag am Dorfteich. Libellen schwirren über dem Wasser, Schilfhalme wiegen sich sanft.
Plötzlich ziehen feine, kreisförmige Wellenlinien über die spiegelglatte Oberfläche. Wie schwerelos gleiten kleine, langbeinige Insekten über das Wasser, stoßen sich ab, drehen, stoppen abrupt – ohne jemals einzusinken.
Für einen Moment scheint es, als hätten sie die Gesetze der Physik überlistet. Doch was wie Magie wirkt, ist das perfekte Zusammenspiel von Körperbau und Oberflächenspannung: Es sind Wasserläufer.
Artbeschreibung der Wasserläufer
Die Wasserläufer gehören zur Familie Gerridae innerhalb der Ordnung der Wanzen (Heteroptera). Weltweit existieren mehrere hundert Arten, die vor allem auf stehenden oder langsam fließenden Gewässern zu finden sind.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
Die Wasserläufer gehören zur Familie Gerridae innerhalb der Ordnung der Wanzen (Heteroptera). Weltweit existieren mehrere hundert Arten, die vor allem auf stehenden oder langsam fließenden Gewässern zu finden sind.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
- Beutegreifer auf der Wasserfläche - Hochempfindliche Vibrationssinnesorgane ,die sich in den Beinen befinden, befähigen den Wasserläufer seine Beute zu orten. Er ernährt sich "räuberisch" von Insekten die ins Wasser gefallen sind.
Artenschutz in Franken®
Artenschutz in Franken®

Artenschutz in Franken®
Artenschutz als Zeichen einer ethisch-moralischen Verpflichtung, diesem Anspruch gegenüber uns begleitenden Mitgeschöpfen und deren Lebens-räume, stellen wir uns seit nunmehr fast 30 Jahren mit zahlreichen Partnern tagtäglich auf vielfältiger Art aufs Neue.
In vollkommen ehrenamtlicher, wirtschaftlich- und politisch sowie konfessionell unabhängiger Form engagieren wir uns hier mit unseren vielen Mitgliedern in abertausenden von Stunden.
Trotz der auf Franken ausgerichteten Namensgebung bundesweit für die Erhaltung der Biodiversität, sowie für eine lebendige, pädagogisch hochwertige Umweltbildung.
Auf unserer Internetpräsenz, die monatlich durchschnittlich von weit über 100.000 Besucher*innen besucht wird, berichten wir transparent auch über unser Engagement.
Artenschutz als Zeichen einer ethisch-moralischen Verpflichtung, diesem Anspruch gegenüber uns begleitenden Mitgeschöpfen und deren Lebens-räume, stellen wir uns seit nunmehr fast 30 Jahren mit zahlreichen Partnern tagtäglich auf vielfältiger Art aufs Neue.
In vollkommen ehrenamtlicher, wirtschaftlich- und politisch sowie konfessionell unabhängiger Form engagieren wir uns hier mit unseren vielen Mitgliedern in abertausenden von Stunden.
Trotz der auf Franken ausgerichteten Namensgebung bundesweit für die Erhaltung der Biodiversität, sowie für eine lebendige, pädagogisch hochwertige Umweltbildung.
Auf unserer Internetpräsenz, die monatlich durchschnittlich von weit über 100.000 Besucher*innen besucht wird, berichten wir transparent auch über unser Engagement.
In einer Dekade in der zunehmend Veränderungen, auch klimatischer Weise erkennbar werden, kommt nach unserem Dafürhalten der effektiven Erhaltung heimischer Artenvielfalt auch und gerade im Sinne einer auf-geklärten Gesellschaft eine heraus-ragende Bedeutung zu.
Der Artenschwund hat er-schreckende Ausmaße ange-nommen, welche den Eindruck der zunehmenden Leere für den aufmerksamen Betrachter deutlich erkennbar werden lässt. Eine ausge-storbene Art ist für nahezu alle Zeit verloren. Mit ihr verlieren wir eine hochwertige, einzigartige Ressource die sich den Umweltbedingungen seit meist Millionen von Jahren anpassen konnte.
Wir sollten uns den Luxus nicht leisten dieser Artenreduktion untätig zuzusehen. Nur eine möglichst hohe genetische Artenvielfalt kann die Entstehung neuer Arten effektiv ansteuern.
Im Sinne uns nachfolgender Generationen, also unserer Kinder und unserer Enkelkinder, sollten wir uns gemeinsam dazu durchringen dem galoppierenden Artenschwund Paroli zu bieten.
Nur gemeinsam wird und kann es uns gelingen diesem sicherlich nicht leichtem Unterfangen erfolgreich zu begegnen. Ohne dies jedoch jemals versucht zu haben, werden wir nie erkennen ob wir dazu in der Lage sind oder waren.
Durchdachter Artenschutz ist in unseren Augen mehr als eine Ideologie.
Er beweist in eindrucksvoller Art die Verbundenheit mit einer einzigartigen Heimat und deren sich darin befindlichen Lebensformen. Schöpfung lebendig bewahren, für uns ge-meinsam mehr als „nur“ ein Lippenbekenntnis.
Artenschutz ist für uns gleichfalls Lebensraumsicherung für den modernen Menschen.
Nur in einer intakten, vielfältigen Umwelt wird auch der Mensch die Chance erhalten nachhaltig zu überdauern. Hierfür setzten wir uns täglich vollkommen ehrenamtlich und unabhängig im Sinne unserer Mit-geschöpfe, jedoch auch ganz bewusst im Sinne unserer Mitbürger und vor allem der uns nachfolgenden Generation von ganzem Herzen ein.
Artenschutz in Franken®
Der Artenschwund hat er-schreckende Ausmaße ange-nommen, welche den Eindruck der zunehmenden Leere für den aufmerksamen Betrachter deutlich erkennbar werden lässt. Eine ausge-storbene Art ist für nahezu alle Zeit verloren. Mit ihr verlieren wir eine hochwertige, einzigartige Ressource die sich den Umweltbedingungen seit meist Millionen von Jahren anpassen konnte.
Wir sollten uns den Luxus nicht leisten dieser Artenreduktion untätig zuzusehen. Nur eine möglichst hohe genetische Artenvielfalt kann die Entstehung neuer Arten effektiv ansteuern.
Im Sinne uns nachfolgender Generationen, also unserer Kinder und unserer Enkelkinder, sollten wir uns gemeinsam dazu durchringen dem galoppierenden Artenschwund Paroli zu bieten.
Nur gemeinsam wird und kann es uns gelingen diesem sicherlich nicht leichtem Unterfangen erfolgreich zu begegnen. Ohne dies jedoch jemals versucht zu haben, werden wir nie erkennen ob wir dazu in der Lage sind oder waren.
Durchdachter Artenschutz ist in unseren Augen mehr als eine Ideologie.
Er beweist in eindrucksvoller Art die Verbundenheit mit einer einzigartigen Heimat und deren sich darin befindlichen Lebensformen. Schöpfung lebendig bewahren, für uns ge-meinsam mehr als „nur“ ein Lippenbekenntnis.
Artenschutz ist für uns gleichfalls Lebensraumsicherung für den modernen Menschen.
Nur in einer intakten, vielfältigen Umwelt wird auch der Mensch die Chance erhalten nachhaltig zu überdauern. Hierfür setzten wir uns täglich vollkommen ehrenamtlich und unabhängig im Sinne unserer Mit-geschöpfe, jedoch auch ganz bewusst im Sinne unserer Mitbürger und vor allem der uns nachfolgenden Generation von ganzem Herzen ein.
Artenschutz in Franken®
25. Jahre Artenschutz in Franken®

25. Jahre Artenschutz in Franken®
Am 01.03.2021 feierte unsere Organisation ein Vierteljahrhundert ehrenamlichen und vollkommen unabhängigen Artenschutz und erlebbare Umweltbildung.
Am 01.03.2021 feierte unsere Organisation ein Vierteljahrhundert ehrenamlichen und vollkommen unabhängigen Artenschutz und erlebbare Umweltbildung.
Und auch nach 25 Jahren zeigt sich unser Engagement keineswegs als "überholt". Im Gegenteil es wird dringender gebraucht denn je.
Denn die immensen Herausforderungen gerade auf diesem Themenfeld werden unsere Gesellschaft zukünftig intensiv fordern!
Hinweis zum 15.jährigen Bestehen.
Aus besonderem Anlass und zum 15.jährigen Bestehen unserer Organisation ergänzten wir unsere namensgebende Bezeichnung.
Der Zusatz Artenschutz in Franken® wird den Ansprüchen eines modernen und zunehmend auch überregional agierenden Verbandes gerecht.
Vormals auf die Region des Steiger-waldes beschränkt setzt sich Artenschutz in Franken® nun vermehrt in ganz Deutschland und darüber hinaus ein.
Die Bezeichnung ändert sich, was Bestand haben wird ist weiterhin das ehrenamliche und unabhängige Engagement das wir für die Belange des konkreten Artenschutzes, sowie einer lebendigen Umweltbildung in einbringen.
Im Sinne uns nachfolgender Generationen!
Auf unserer Internetpräsenz möchten wir unser ehrenamtliches Engagement näher vorstellen.
Artenschutz in Franken®
Denn die immensen Herausforderungen gerade auf diesem Themenfeld werden unsere Gesellschaft zukünftig intensiv fordern!
Hinweis zum 15.jährigen Bestehen.
Aus besonderem Anlass und zum 15.jährigen Bestehen unserer Organisation ergänzten wir unsere namensgebende Bezeichnung.
Der Zusatz Artenschutz in Franken® wird den Ansprüchen eines modernen und zunehmend auch überregional agierenden Verbandes gerecht.
Vormals auf die Region des Steiger-waldes beschränkt setzt sich Artenschutz in Franken® nun vermehrt in ganz Deutschland und darüber hinaus ein.
Die Bezeichnung ändert sich, was Bestand haben wird ist weiterhin das ehrenamliche und unabhängige Engagement das wir für die Belange des konkreten Artenschutzes, sowie einer lebendigen Umweltbildung in einbringen.
Im Sinne uns nachfolgender Generationen!
Auf unserer Internetpräsenz möchten wir unser ehrenamtliches Engagement näher vorstellen.
Artenschutz in Franken®
Kleinvogel gefunden - und jetzt?

Kleinvogel gefunden - und jetzt?
Wie verhalte ich mich beim Fund eines noch nicht flugfähigen Kleinvogels richtig?
Regelmäßig erreichen uns Anfragen die sich auf den korrekten Umgang des Tieres beim „Fund“ eines noch nicht flugfähigen Kleinvogels beziehen.
Wir vom Artenschutz in Franken® haben hier einige Informationen für Sie zusammengestellt.
Wir erklären dir das Vorgehen und die in unseren Augen wichtigsten Dos und Don'ts bei einem Fund eines kleinen, noch nicht flugfähigen Vogels in Form eines einfachen, einprägsamen Mnemonics, den du leicht merken kannst: "VOGEL"
Wie verhalte ich mich beim Fund eines noch nicht flugfähigen Kleinvogels richtig?
Regelmäßig erreichen uns Anfragen die sich auf den korrekten Umgang des Tieres beim „Fund“ eines noch nicht flugfähigen Kleinvogels beziehen.
Wir vom Artenschutz in Franken® haben hier einige Informationen für Sie zusammengestellt.
Wir erklären dir das Vorgehen und die in unseren Augen wichtigsten Dos und Don'ts bei einem Fund eines kleinen, noch nicht flugfähigen Vogels in Form eines einfachen, einprägsamen Mnemonics, den du leicht merken kannst: "VOGEL"
Jeder Buchstabe im Wort "VOGEL" steht dabei für einen wichtigen Schritt oder Hinweis:
V - Verhalten beobachten:
• Dos: Bevor du irgendetwas tust, beobachte den Vogel aus der Ferne. Manchmal (Meistens) sind die Eltern in der Nähe und kümmern sich um ihn.
• Don'ts: Den Vogel sofort anfassen oder wegtragen, ohne die Situation zu analysieren.
O - Ort sichern:
• Dos: Sicherstellen, dass der Vogel nicht durch Menschen, Hunde oder Katzen gefährdet ist.
• Don'ts: Den Vogel in gefährliche Bereiche lassen, wo er leicht verletzt werden kann.
G - Gesundheit prüfen:
• Dos: Prüfe vorsichtig, ob der Vogel verletzt ist. Wenn er offensichtlich verletzt ist, kontaktiere eine Wildtierauffangstation oder einen Tierarzt. Wende dich auch an die für die Örtlichkeit zuständige fachliche Einrichtung wie Naturschutzfachbehörde oder Umweltämter.
• Don'ts: Keine medizinische Erstversorgung versuchen, wenn du keine Erfahrung damit hast.
E - Eltern suchen:
• Dos: Versuche herauszufinden, ob die Eltern in der Nähe sind. Elternvögel kehren oft zurück, um ihre Jungen zu füttern.
• Don'ts: Den Vogel nicht sofort mitnehmen, da die Eltern ihn weiterhin versorgen könnten.
L - Letzte Entscheidung:
• Dos: Wenn der Vogel in Gefahr ist oder die Eltern nicht zurückkehren, kontaktiere eine Wildtierstation oder einen Experten für Rat und weitere Schritte.
• Don'ts: Den Vogel nicht ohne fachkundigen Rat mit nach Hause nehmen oder füttern, da falsche Pflege oft mehr schadet als hilft.
Zusammenfassung
• Verhalten beobachten: Erst schauen, nicht gleich handeln.
• Ort sichern: Gefahrenquelle ausschalten.
• Gesundheit prüfen: Verletzungen erkennen.
• Eltern suchen: Eltern in der Nähe?
• Letzte Entscheidung: Bei Gefahr oder verlassener Brut Wildtierstation kontaktieren.
Mit diesem Mnemonic kannst du dir so finden wir vom Artenschutz in Franken® recht leicht merken, wie du dich verhalten sollst, wenn du einen kleinen, noch nicht flugfähigen Vogel findest.
Wichtig!
- Bitte beachte jedoch dabei immer den Eigenschutz, denn die Tier können Krankheiten übertragen die auch für den Menschen gefährlich werden können. Deshalb raten wir vornehmlich ... immer Finger weg - Fachleute kontaktieren!
Wir vom Artenschutz in Franken® sind keine und unterhalten auch kein Tierpflegestelle da wir uns in erster Linie mit der Lebensraumsicherung und Lebensraumschaffung befassen.
Artenschutz in Franken®
Rechtliches §

Immer wieder werden wir gefragt welche rechtlichen Grundlagen es innerhalb der Naturschutz- und Tierschutzgesetze es gibt.
Wir haben einige Infos zu diesem Thema hier verlinkt:
Wir haben einige Infos zu diesem Thema hier verlinkt:
Bayerisches Naturschutzgesetz – BayNatSchG
http://www.gesetze-bayern.de/(X(1)S(fhnsotp2iqyyotymmjumqonn))/Content/Document/BayNatSchG?AspxAutoDetectCookieSupport=1
Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege
https://www.gesetze-im-internet.de/bnatschg_2009/
Tierschutzgesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/tierschg/BJNR012770972.html
http://www.gesetze-bayern.de/(X(1)S(fhnsotp2iqyyotymmjumqonn))/Content/Document/BayNatSchG?AspxAutoDetectCookieSupport=1
Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege
https://www.gesetze-im-internet.de/bnatschg_2009/
Tierschutzgesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/tierschg/BJNR012770972.html
Unser Engagement

Mehr über unser Engagement finden Sie hier:
Die Artenschutz im Steigerwald/Artenschutz in Franken®- Nachhaltigkeits-vereinbarung
www.artenschutz-steigerwald.de/de/Ueber-Uns/1001349/AiF_-_Nachhaltigkeitsvereinbarung/
Über uns
www.artenschutz-steigerwald.de/de/Ueber-Uns/
Impressum/Satzung
www.artenschutz-steigerwald.de/de/Impressum/
www.artenschutz-steigerwald.de/de/Ueber-Uns/1001349/AiF_-_Nachhaltigkeitsvereinbarung/
Über uns
www.artenschutz-steigerwald.de/de/Ueber-Uns/
Impressum/Satzung
www.artenschutz-steigerwald.de/de/Impressum/
Nachgedacht

Ein Gedicht zum Verlust der Biodiversität in unserem Land.
Artenschwund
In allen Medien tun sie es kund, bedenklich ist der Artenschwund.
Begonnen hat es schon sehr bald, durch Abholzung im Regenwald. Nicht nur um edle Hölzer zu gewinnen, man fing schließlich an zu „spinnen“. Durch Brandrodung ließ man es qualmen, und pflanzte dort dann nur noch Palmen.
Das fand die Industrie ganz prima, doch heute bejammern wir das Klima. Aber es betrifft nicht nur ferne Lande, auch bei uns ist es `ne Schande. Dass Wälder dem Profit zum Opfer fallen, dies schadet schließlich doch uns Allen.
Artenschwund
In allen Medien tun sie es kund, bedenklich ist der Artenschwund.
Begonnen hat es schon sehr bald, durch Abholzung im Regenwald. Nicht nur um edle Hölzer zu gewinnen, man fing schließlich an zu „spinnen“. Durch Brandrodung ließ man es qualmen, und pflanzte dort dann nur noch Palmen.
Das fand die Industrie ganz prima, doch heute bejammern wir das Klima. Aber es betrifft nicht nur ferne Lande, auch bei uns ist es `ne Schande. Dass Wälder dem Profit zum Opfer fallen, dies schadet schließlich doch uns Allen.
Ob Kahlschlag in Skandinavien, oder hier, die Dummen, das sind immer wir. Was unser Klima wirklich erhält, wurde zum großen Teil gefällt.
Es beginnt doch schon im Kleinen, an Straßen- und an Wegesrainen. Dort wird gemäht, ganz ohne Not, dies ist vieler Tiere Tod. Moderne Maschinen zu unserem Schrecken, lassen Schmetterlingsraupen
kläglich verrecken. Weil von den Raupen niemand profitiert, dies dann auch kaum Jemand interes-siert. Doch der Jammer ist schon groß; wo bleiben die Schmetterlinge bloß?
Auch unser Obst ist in Gefahr, denn die Bienen werden rar. Wir uns deshalb ernsthaft fragen, wer wird in Zukunft die Pollen übertragen. Eine
eingeschleppte Milbe ist der Bienen Tod und die Imker leiden Not. Dazu spritzt man noch Neonikotinoide und Glyphosat, damit man reiche Ernte hat. Das vergiftet nicht nur Tiere, sondern jetzt auch viele Biere. Glyphosat soll krebserregend sein, doch das kümmert hier kein Schwein.
Hauptsache es rollt weiterhin der Kiesel, denn man hat ja noch den Diesel. Der ist jetzt an Allem schuld und man gönnt ihm keine Huld. Elektrofahrzeuge sind die neue Devise, doch verhindern diese wirklich unsere Krise? Braunkohle und Atom, erzeugen zumeist unseren Strom. Wie nun jeder Bürger weiß, ist auch dieses Thema
heiß.
Gäbe es immerzu Sonnenschein, wäre Solarenergie fein. Aber da sind ja noch die Windanlagen, die hoch in den Himmel ragen. Wo sie dann an manchen Tagen, Vögel in der Luft erschlagen. Diese zogen erst von Süden fort, entkamen knapp dem Vogelmord. Nun hat es sie doch noch erwischt, nur werden sie hier nicht aufgetischt.
Wie haben die Ortolane schön ge-sungen, nun liegen auf dem Teller ihre Zungen. War das schön, als sie noch lebten, bevor sie auf `ner Rute klebten. Immer weniger wird ihr Gesang, uns wird es langsam angst und bang .Gesetze wurden
zwar gemacht, sie werden jedoch zumeist belacht. Wenn Vögel brutzeln in Pfanne und Schüssel, wen interessiert da das „Geschwätz“ aus Brüssel.
Es gibt ein paar Leute, die sind vor Ort und stellen sich gegen den Vogelmord. Die wenigen, die es wagen, riskieren dabei Kopf und Kragen. Wenn sie beseitigen Ruten und Fallen, oder hindern Jäger, Vögel abzuknallen. Riesige Netze, so stellen wir fest, geben den Vögeln nun noch den Rest. Wir sollten dies schnellstens verhindern, sonst werden wir mit unseren Kindern, bald keinen Vogelsang mehr hören. So manchen würde das kaum stören, doch mit diesem Artenschwund, schlägt irgendwann auch unsere Stund`.
Quelle
Hubertus Zinnecker
Es beginnt doch schon im Kleinen, an Straßen- und an Wegesrainen. Dort wird gemäht, ganz ohne Not, dies ist vieler Tiere Tod. Moderne Maschinen zu unserem Schrecken, lassen Schmetterlingsraupen
kläglich verrecken. Weil von den Raupen niemand profitiert, dies dann auch kaum Jemand interes-siert. Doch der Jammer ist schon groß; wo bleiben die Schmetterlinge bloß?
Auch unser Obst ist in Gefahr, denn die Bienen werden rar. Wir uns deshalb ernsthaft fragen, wer wird in Zukunft die Pollen übertragen. Eine
eingeschleppte Milbe ist der Bienen Tod und die Imker leiden Not. Dazu spritzt man noch Neonikotinoide und Glyphosat, damit man reiche Ernte hat. Das vergiftet nicht nur Tiere, sondern jetzt auch viele Biere. Glyphosat soll krebserregend sein, doch das kümmert hier kein Schwein.
Hauptsache es rollt weiterhin der Kiesel, denn man hat ja noch den Diesel. Der ist jetzt an Allem schuld und man gönnt ihm keine Huld. Elektrofahrzeuge sind die neue Devise, doch verhindern diese wirklich unsere Krise? Braunkohle und Atom, erzeugen zumeist unseren Strom. Wie nun jeder Bürger weiß, ist auch dieses Thema
heiß.
Gäbe es immerzu Sonnenschein, wäre Solarenergie fein. Aber da sind ja noch die Windanlagen, die hoch in den Himmel ragen. Wo sie dann an manchen Tagen, Vögel in der Luft erschlagen. Diese zogen erst von Süden fort, entkamen knapp dem Vogelmord. Nun hat es sie doch noch erwischt, nur werden sie hier nicht aufgetischt.
Wie haben die Ortolane schön ge-sungen, nun liegen auf dem Teller ihre Zungen. War das schön, als sie noch lebten, bevor sie auf `ner Rute klebten. Immer weniger wird ihr Gesang, uns wird es langsam angst und bang .Gesetze wurden
zwar gemacht, sie werden jedoch zumeist belacht. Wenn Vögel brutzeln in Pfanne und Schüssel, wen interessiert da das „Geschwätz“ aus Brüssel.
Es gibt ein paar Leute, die sind vor Ort und stellen sich gegen den Vogelmord. Die wenigen, die es wagen, riskieren dabei Kopf und Kragen. Wenn sie beseitigen Ruten und Fallen, oder hindern Jäger, Vögel abzuknallen. Riesige Netze, so stellen wir fest, geben den Vögeln nun noch den Rest. Wir sollten dies schnellstens verhindern, sonst werden wir mit unseren Kindern, bald keinen Vogelsang mehr hören. So manchen würde das kaum stören, doch mit diesem Artenschwund, schlägt irgendwann auch unsere Stund`.
Quelle
Hubertus Zinnecker
Ein Frühsommer-Bild aus Schleswig-Holstein

Ein Frühsommer-Bild aus Schleswig-Holstein ...da wir jedoch im ganzen Land wiederfinden!
Eine weite Grünlandniederung, vier riesige Mähmaschinen fahren nebeneinander mit rasanter Geschwindigkeit über ein Areal von einigen hundert Hektar Wiesen.
Wo gestern noch zahlreiche Feldvögel sangen und ihre Jungen fütterten, Wiesen- und Rohrweihen jagten, ein Sumpfohreulenpaar balzte und offensichtlich einen Brutplatz hatte, bietet sich heute ein Bild der Zerstörung. Kiebitze und Brachvögel rufen verzweifelt und haben ihre Gelege verloren.
Eine weite Grünlandniederung, vier riesige Mähmaschinen fahren nebeneinander mit rasanter Geschwindigkeit über ein Areal von einigen hundert Hektar Wiesen.
Wo gestern noch zahlreiche Feldvögel sangen und ihre Jungen fütterten, Wiesen- und Rohrweihen jagten, ein Sumpfohreulenpaar balzte und offensichtlich einen Brutplatz hatte, bietet sich heute ein Bild der Zerstörung. Kiebitze und Brachvögel rufen verzweifelt und haben ihre Gelege verloren.
Schafstelzen, Wiesenpieper und Feldlerchen hüpfen mit Würmern im Schnabel auf der Suche nach ihren längst zerstückelten Jungvögeln verzweifelt über den Boden.
Alles nichts Neues.
Das kennen wir ja. Das BNatSchG §44 erlaubt es ja schließlich gemäß der „guten fachliche Praxis“, streng geschützte Vogelarten zu töten - denn verboten ist es ja nur „ohne sinnvollen Grund“.
Aber was ist an dieser uns allen bekannten Situation anders als noch vor 10, 20 Jahren?
Die Mähmaschinen sind größer und stärker denn je, schneller denn je, mähen tiefer denn je, mähen in immer kürzeren Intervallen, mähen die Gräben bis tief in jede Grabenböschung mit ab.
Wie zum Hohn kommt nun noch ein weiterer Trecker und mäht alle Stauden der Wegesränder ab, scheinbar um das letzte verbliebene Wiesenpieper- oder Blaukehlchennnest dann auch noch zu erwischen.
23.00h: Es wird dunkel, es wird weiter gemäht. Ich denke an die Wiesenweihen, den gerade erschienenen Artikel aus der Zeitschrift dem Falken: " bei nächtlicher Mahd bleiben die adulten Weihen auf dem Nest sitzen und werden mit getötet“.
Wo ist unsere Landwirtschaft hingekommen, dass jetzt hier 4 Maschinen der neusten Generation parallel nebeneinander in rasendem Tempo mähen, dahinter wird schon gewendet und das Gras abtransportiert.
Nicht ein junger Vogel, nicht ein junger Hase hat hier die geringste Chance, noch zu entkommen.
Früher habe ich nach der Mahd noch junge Kiebitze und junge Hasen gesehen, die überlebt haben. Früher hat ein Bauer noch das Mähwerk angehoben, wenn er von oben ein Kiebitznest gesehen hat.
Hier ist nun nichts mehr, nur hunderte von Krähen und Möwen, die sich über das „Fastfood“ freuen (und nebenbei bemerkt damit einen äußerst wichtigen Beitrag zur Beseitigung von Clostridien leisten, welche die Silage verunreinigen und damit den Rinderbestand gefährden könnten - gedankt wird es den Krähen aber natürlich nicht)
Diese Entwicklung der Grünlandbewirtschaftung ist sehr besorgniserregend, nicht nur für den Vogel des Jahres, die Feldlerche. Das Wettrüsten der Landwirte ist verständlich aus deren wirtschaftlicher Sicht, aber eine ökologische Vollkatastrophe und das Ergebnis einer verfehlten Agrarpolitik.
Was ist denn der „sinnvolle Grund“, der diese Entwicklung überhaupt zulässt?
Dass die Milch und das Fleisch immer noch billiger werden, und dafür das letzte Stück Natur geschreddert wird? Ist das wirklich im Sinne der Allgemeinheit, denn es sind doch nicht nur wir Naturschützer*innen und Vogelkundler*innen, die sich über blühende Wiesen und singende Lerchen freuen.
Dieser massenhafte Vogelmord auf unserem Grünland (und natürlich Amphibien, Reptilien, Säugetiere, Insekten) wird immer aggressiver und ist vielen Menschen gar nicht bewusst.
Es müssen dringend Maßnahmen ergriffen werden, wie z.B. gesetzlich vorgeschriebene Randstreifen zu Gräben und Wegesrändern, Verbot nächtlicher Mahd, Begrenzung der Mahdhöhe- und Mahdgeschwindigkeit usw.
Ansonsten brauchen wir uns auch nicht über vogeljagende Mittelmeerländer aufzuregen - denn das was hier stattfindet ist letztendlich genauso zerstörerisch wie zum Spaß zur Flinte zu greifen.
Juni 2019
Autorin
Natascha Gaedecke
Alles nichts Neues.
Das kennen wir ja. Das BNatSchG §44 erlaubt es ja schließlich gemäß der „guten fachliche Praxis“, streng geschützte Vogelarten zu töten - denn verboten ist es ja nur „ohne sinnvollen Grund“.
Aber was ist an dieser uns allen bekannten Situation anders als noch vor 10, 20 Jahren?
Die Mähmaschinen sind größer und stärker denn je, schneller denn je, mähen tiefer denn je, mähen in immer kürzeren Intervallen, mähen die Gräben bis tief in jede Grabenböschung mit ab.
Wie zum Hohn kommt nun noch ein weiterer Trecker und mäht alle Stauden der Wegesränder ab, scheinbar um das letzte verbliebene Wiesenpieper- oder Blaukehlchennnest dann auch noch zu erwischen.
23.00h: Es wird dunkel, es wird weiter gemäht. Ich denke an die Wiesenweihen, den gerade erschienenen Artikel aus der Zeitschrift dem Falken: " bei nächtlicher Mahd bleiben die adulten Weihen auf dem Nest sitzen und werden mit getötet“.
Wo ist unsere Landwirtschaft hingekommen, dass jetzt hier 4 Maschinen der neusten Generation parallel nebeneinander in rasendem Tempo mähen, dahinter wird schon gewendet und das Gras abtransportiert.
Nicht ein junger Vogel, nicht ein junger Hase hat hier die geringste Chance, noch zu entkommen.
Früher habe ich nach der Mahd noch junge Kiebitze und junge Hasen gesehen, die überlebt haben. Früher hat ein Bauer noch das Mähwerk angehoben, wenn er von oben ein Kiebitznest gesehen hat.
Hier ist nun nichts mehr, nur hunderte von Krähen und Möwen, die sich über das „Fastfood“ freuen (und nebenbei bemerkt damit einen äußerst wichtigen Beitrag zur Beseitigung von Clostridien leisten, welche die Silage verunreinigen und damit den Rinderbestand gefährden könnten - gedankt wird es den Krähen aber natürlich nicht)
Diese Entwicklung der Grünlandbewirtschaftung ist sehr besorgniserregend, nicht nur für den Vogel des Jahres, die Feldlerche. Das Wettrüsten der Landwirte ist verständlich aus deren wirtschaftlicher Sicht, aber eine ökologische Vollkatastrophe und das Ergebnis einer verfehlten Agrarpolitik.
Was ist denn der „sinnvolle Grund“, der diese Entwicklung überhaupt zulässt?
Dass die Milch und das Fleisch immer noch billiger werden, und dafür das letzte Stück Natur geschreddert wird? Ist das wirklich im Sinne der Allgemeinheit, denn es sind doch nicht nur wir Naturschützer*innen und Vogelkundler*innen, die sich über blühende Wiesen und singende Lerchen freuen.
Dieser massenhafte Vogelmord auf unserem Grünland (und natürlich Amphibien, Reptilien, Säugetiere, Insekten) wird immer aggressiver und ist vielen Menschen gar nicht bewusst.
Es müssen dringend Maßnahmen ergriffen werden, wie z.B. gesetzlich vorgeschriebene Randstreifen zu Gräben und Wegesrändern, Verbot nächtlicher Mahd, Begrenzung der Mahdhöhe- und Mahdgeschwindigkeit usw.
Ansonsten brauchen wir uns auch nicht über vogeljagende Mittelmeerländer aufzuregen - denn das was hier stattfindet ist letztendlich genauso zerstörerisch wie zum Spaß zur Flinte zu greifen.
Juni 2019
Autorin
Natascha Gaedecke
Waldsterben 2.0 – Nein eine Chance zur Gestaltung naturnaher Wälder!

Waldsterben 2.0 – Nein eine Chance zur Gestaltung naturnaher Wälder!
Artenschutz in Franken® verfolgt seit geraumer Zeit die Diskussionen um den propagierten Niedergang des deutschen Waldes.
Als Ursache dieses Niedergangs wurde der/die Schuldige/n bereits ausgemacht. Der Klimawandel der die Bäume verdursten lässt und hie und da auch noch einige Großsäuger die unseren Wald „auffressen“. Diesen wird es vielerorts zugeschrieben, dass wir in wenigen Jahren wohl unseren Wald verlieren werden?!
Artenschutz in Franken® verfolgt seit geraumer Zeit die Diskussionen um den propagierten Niedergang des deutschen Waldes.
Als Ursache dieses Niedergangs wurde der/die Schuldige/n bereits ausgemacht. Der Klimawandel der die Bäume verdursten lässt und hie und da auch noch einige Großsäuger die unseren Wald „auffressen“. Diesen wird es vielerorts zugeschrieben, dass wir in wenigen Jahren wohl unseren Wald verlieren werden?!
Als Ursache für das infolge des Klimawandels erkennbare „Absterben“ unserer Wirtschaftswälder liegt jedoch vielmehr auch darin, dass wir unsere Wälder in den vergangenen Jahrhunderten ständig waldbaulich manipulierten und dieses auch heute noch sehr ausgeprägt und vielfach intensiver den je tun.
In dieser Zeitspanne haben wir in unserem Land nahezu alle unsere ursprünglich geformten Wälder verloren. Wir haben diesen Systemen seither ständig unsere menschliche Handschrift auferlegt um aufzuzeigen wie wir uns einen nachhaltig geformten Wirtschaftswald vorstellen. Und diesen selbstverständlich auch intensiv nutzen können.
Ohne große Rücksicht auf Pflanzen und Tiere welche in diesem Ökosystem leben.Wir haben somit keinen Wald mehr vor Augen wie dieser von Natur aus gedacht war – wir haben einen Wald vor unseren Augen wie wir uns Menschen einen Wald vorstellen.
Somit „stirbt“ nun auch nicht der Wald, sondern lediglich der vom Menschen fehlgeformte Wald.
Nun wird also fleißig darüber nachgedacht mit einem Millionenaufwand unseren Wald mit Aufforstungsprogrammen zu retten. Doch dieser Ansatz ist in unseren Augen eine weitere Verfehlung menschlichen Wirkens. Denn was hier zusammengepflanzt wird ist wieder kein sich natürlich entwickelter Wald der seine Dynamik sichtbar werden lassen kann. Nein es wird wieder ein vom Menschen manipulierter Wirtschaftswald entstehen der nur die Lebensformen in sich duldet die wir dieser Holzproduktionsfläche zugestehen.
Die Vielfalt der Arten wird hier auf immens großen Flächen abermals keine Rolle spielen.
Doch warum lassen wir es nicht einfach mal zu das wir dem Wald die Chance eröffnen uns zu zeigen wie Waldbau funktioniert und wie ein robuster Wald aussieht. „Dieser Wald“ wird uns in 50 – 70 Jahren zeigen welche Artenzusammensetzung für den jeweiligen Standort die richtige Mischung ist.
Es ist uns schon klar das bis dahin viele vom Menschen geschaffenen Wälder nicht mehr stehen werden denn sie werden tatsächlich „aufgefressen“.
Doch nicht vom Reh, welches Luchs und Wolf als Nahrungsgrundlage dringlich benötigen, wollen wir verhindern das diese sich an unseren Schafen & Co. bedienen, sondern von ganz kleinen Tieren. Der Borkenkäfer wird die Fläche für die nachfolgenden Naturwälder vorbereiten so wie wir es an mancher Stelle in Bayern sehr gut erkennen können.
Es bedarf somit in unseren Augen einem gesellschaftlichen Umdenken das endlich greifen muss.
Gerade im Sinne unserer Kinder und Enkelkinder welchen wir eine an Arten reiche Welt hinterlassen sollten.
AiF
12.08.2019
Ein sehr interessanter Bericht zu diesem Thema findet sich hier
In dieser Zeitspanne haben wir in unserem Land nahezu alle unsere ursprünglich geformten Wälder verloren. Wir haben diesen Systemen seither ständig unsere menschliche Handschrift auferlegt um aufzuzeigen wie wir uns einen nachhaltig geformten Wirtschaftswald vorstellen. Und diesen selbstverständlich auch intensiv nutzen können.
Ohne große Rücksicht auf Pflanzen und Tiere welche in diesem Ökosystem leben.Wir haben somit keinen Wald mehr vor Augen wie dieser von Natur aus gedacht war – wir haben einen Wald vor unseren Augen wie wir uns Menschen einen Wald vorstellen.
Somit „stirbt“ nun auch nicht der Wald, sondern lediglich der vom Menschen fehlgeformte Wald.
Nun wird also fleißig darüber nachgedacht mit einem Millionenaufwand unseren Wald mit Aufforstungsprogrammen zu retten. Doch dieser Ansatz ist in unseren Augen eine weitere Verfehlung menschlichen Wirkens. Denn was hier zusammengepflanzt wird ist wieder kein sich natürlich entwickelter Wald der seine Dynamik sichtbar werden lassen kann. Nein es wird wieder ein vom Menschen manipulierter Wirtschaftswald entstehen der nur die Lebensformen in sich duldet die wir dieser Holzproduktionsfläche zugestehen.
Die Vielfalt der Arten wird hier auf immens großen Flächen abermals keine Rolle spielen.
Doch warum lassen wir es nicht einfach mal zu das wir dem Wald die Chance eröffnen uns zu zeigen wie Waldbau funktioniert und wie ein robuster Wald aussieht. „Dieser Wald“ wird uns in 50 – 70 Jahren zeigen welche Artenzusammensetzung für den jeweiligen Standort die richtige Mischung ist.
Es ist uns schon klar das bis dahin viele vom Menschen geschaffenen Wälder nicht mehr stehen werden denn sie werden tatsächlich „aufgefressen“.
Doch nicht vom Reh, welches Luchs und Wolf als Nahrungsgrundlage dringlich benötigen, wollen wir verhindern das diese sich an unseren Schafen & Co. bedienen, sondern von ganz kleinen Tieren. Der Borkenkäfer wird die Fläche für die nachfolgenden Naturwälder vorbereiten so wie wir es an mancher Stelle in Bayern sehr gut erkennen können.
Es bedarf somit in unseren Augen einem gesellschaftlichen Umdenken das endlich greifen muss.
Gerade im Sinne unserer Kinder und Enkelkinder welchen wir eine an Arten reiche Welt hinterlassen sollten.
AiF
12.08.2019
Ein sehr interessanter Bericht zu diesem Thema findet sich hier
Mehr Raum für Natur – weniger Aktionismus

Mehr Raum für Natur – weniger Aktionismus
Als Naturschutzorganisation verstehen wir uns als Anwalt der biologischen Vielfalt und als Stimme für einen verantwortungsvollen, zukunftsfähigen Umgang mit unseren heimischen Ökosystemen.
Als Naturschutzorganisation verstehen wir uns als Anwalt der biologischen Vielfalt und als Stimme für einen verantwortungsvollen, zukunftsfähigen Umgang mit unseren heimischen Ökosystemen.
Vor diesem Hintergrund beziehen wir klar und sachlich begründet Stellung gegen sogenannte „Raubwildwochen“. Maßnahmen, die auf eine zeitlich gebündelte, intensive Bejagung bestimmter Beutegreiferarten abzielen, halten wir für ökologisch nicht zielführend und langfristig nicht geeignet, die komplexen Ursachen von Artenrückgängen wirksam zu adressieren.
Ökologische Systeme sind keine einfachen Ursache-Wirkungs-Ketten, sondern hochkomplexe Beziehungsgefüge. Beutegreifer wie Fuchs, Marder oder Rabenvögel übernehmen wichtige Funktionen im Naturhaushalt: Sie regulieren Bestände, entfernen kranke oder geschwächte Individuen und beeinflussen das Verhalten anderer Arten.
Prädation ist ein natürlicher Prozess und Teil evolutiv gewachsener Gleichgewichte. Eine kurzfristige Reduktion einzelner Arten greift daher häufig zu kurz und kann durch kompensatorische Effekte – etwa erhöhte Reproduktionsraten oder Zuwanderung aus benachbarten Gebieten – relativiert werden.
Gleichzeitig erkennen wir an, dass es in intensiv genutzten Kulturlandschaften zu Konflikten kommen kann.
Rückgänge bei Bodenbrütern oder Niederwildarten sind jedoch in erster Linie Ausdruck tiefgreifender Lebensraumveränderungen: großflächige Monokulturen, Verlust von Brachen, Hecken und Feldgehölzen, Entwässerung von Feuchtflächen, hohe Mahdintensität sowie zunehmende Zerschneidung durch Infrastruktur. In ausgeräumten Landschaften fehlen Deckung, Nahrung und störungsarme Rückzugsräume. In solchen Systemen wirken Prädatoren stärker, weil alternative Strukturen fehlen – nicht, weil ihre bloße Existenz das Problem darstellt.
Wir sind überzeugt, dass nachhaltiger Artenschutz an den Ursachen ansetzen muss.
Statt kurzfristiger Eingriffe plädieren wir für eine konsequent optimierte Lebensraumgestaltung:
- Wiederherstellung strukturreicher Agrarlandschaften mit Hecken, Blühstreifen, Altgrasstreifen und Feldrainen
- Erhalt und Entwicklung von Feuchtgebieten, Kleingewässern und extensiv genutzten Wiesen
- Späte und angepasste Mahdregime zum Schutz von Bodenbrütern
- Schaffung störungsarmer Rückzugsräume
- Biotopvernetzung zur Förderung stabiler Populationen
Solche Maßnahmen kommen einer Vielzahl von Arten zugute – unabhängig davon, ob sie Beute- oder Beutegreiferarten sind. Ziel muss ein funktionsfähiges, resilientes Ökosystem sein, das natürliche Regulationsmechanismen wieder stärker ermöglicht.
Darüber hinaus halten wir es für wichtig, Debatten über Artenschutz sachlich und faktenbasiert zu führen. Pauschale Schuldzuweisungen an einzelne Tierarten werden den wissenschaftlichen Erkenntnissen nicht gerecht und tragen nicht zu konstruktiven Lösungen bei.
Erfolgreicher Naturschutz erfordert Geduld, langfristige Strategien und Kooperation statt Symbolmaßnahmen.
Unsere Organisation setzt sich daher für einen integrativen Ansatz ein, der Landwirtschaft, Jagd, Naturschutz und Politik gleichermaßen einbindet. Wir möchten Brücken bauen und gemeinsam tragfähige Konzepte entwickeln, die sowohl den Schutz bedrohter Arten als auch die berechtigten Interessen der Landnutzer berücksichtigen.
Ein Nebeneinander unterschiedlicher Arten ist möglich – wenn wir Lebensräume so gestalten, dass sie Vielfalt tragen können. Unser Ziel ist eine Landschaft, die wieder Raum für natürliche Prozesse bietet und in der kurzfristige, aus unserer Sicht unzureichende Maßnahmen wie „Raubwildwochen“ nicht notwendig sind. Nachhaltiger Naturschutz bedeutet, die Grundlagen des Lebensraumes zu stärken – nicht Symptome isoliert zu bekämpfen.
In der Aufnahme
- Junges führenes Fuchsweibchen erschossen und weggeworfen wie ein Stück Schmutz! Für solche Situationen haben wir wirklich keinerlei Verständnis. Man kann zu Füchsen stehen wie man mag, doch wo bleibt die Ehrfurcht vor der Natur wenn eine junge Fuchsmutter, die noch dazu Jungen "führte" einfach erschossen wird!