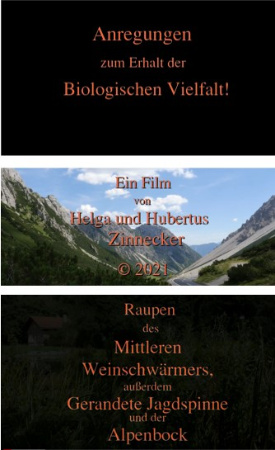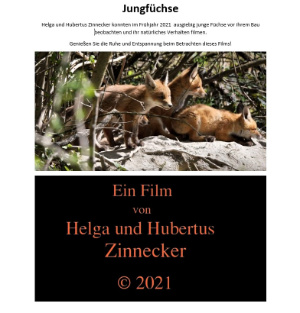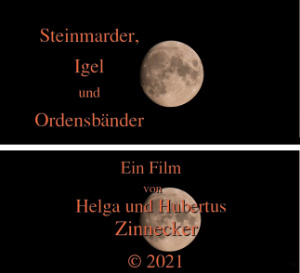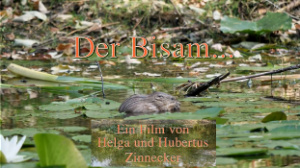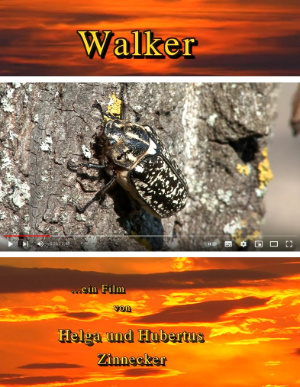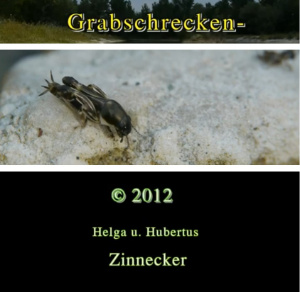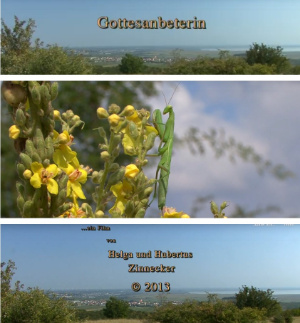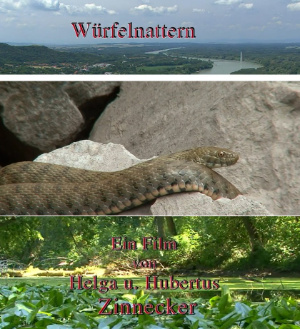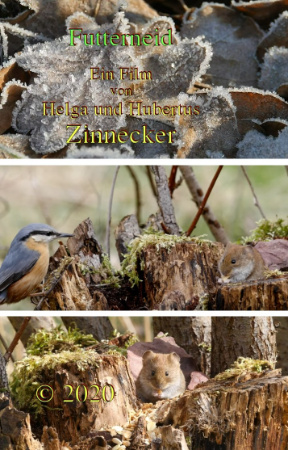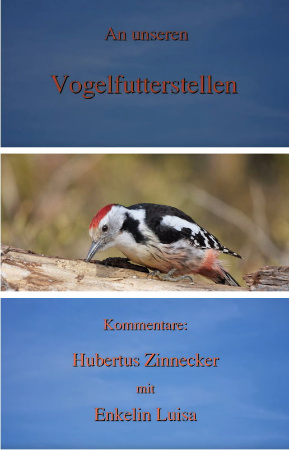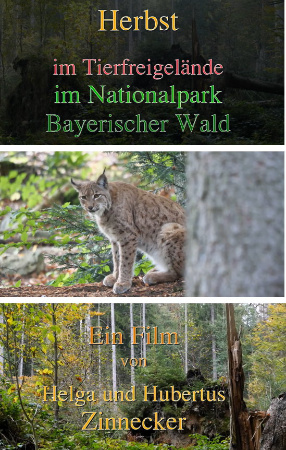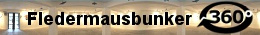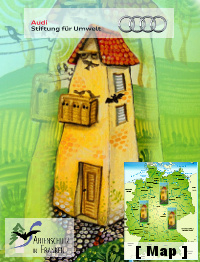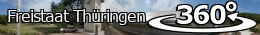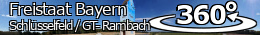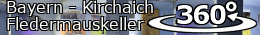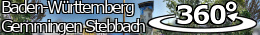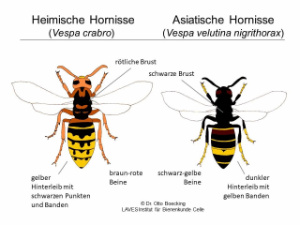BREAKING NEWS
| AiF | 07:27
Immer auf der richtigen Fährte ...
Artenschutz in Franken®
Artenschutz in Franken®
Der Kernbeißer - Ein faszinierender Vogel mit einzigartigen Eigenschaften ...

Der Kernbeißer (Coccothraustes coccothraustes): Ein faszinierender Vogel mit einzigartigen Eigenschaften
29/30.05.2025
Diese kräftigen Vögel zeichnen sich durch ihr auffälliges Erscheinungsbild und ihre spezialisierte Ernährungsweise aus, die sie zu wichtigen Akteuren in ihren Lebensräumen macht.
29/30.05.2025
- Der Kernbeißer, wissenschaftlich bekannt als Coccothraustes coccothraustes, ist eine bemerkenswerte Vogelart, die in den gemäßigten Regionen Eurasiens beheimatet ist.
Diese kräftigen Vögel zeichnen sich durch ihr auffälliges Erscheinungsbild und ihre spezialisierte Ernährungsweise aus, die sie zu wichtigen Akteuren in ihren Lebensräumen macht.
Morphologie und äußere Merkmale
Der Kernbeißer ist durch sein beeindruckendes Erscheinungsbild leicht zu erkennen. Er ist etwa so groß wie eine Amsel, jedoch viel gedrungener und mit einem kräftigen, kegelförmigen Schnabel ausgestattet. Dieser Schnabel ist besonders robust und ermöglicht es dem Kernbeißer, selbst die härtesten Samen zu knacken, was zu seinem Namen "Kernbeißer" geführt hat. Das Federkleid ist überwiegend gelblich mit schwarzen Flügeln und einem markanten schwarzen Gesicht.
Verbreitung und Lebensraum
Der Lebensraum des Kernbeißers erstreckt sich über weite Teile Eurasiens, von den Wäldern Skandinaviens bis zu den gemäßigten Regionen Asiens. Sie bevorzugen Laub- und Mischwälder sowie Parks und Gärten mit ausreichendem Baumbestand. Besonders im Winter sind sie oft in größeren Schwärmen anzutreffen, wenn sie auf der Suche nach Nahrung sind.
Ernährung und spezialisierte Anpassungen
Die Ernährung des Kernbeißers ist hochspezialisiert auf Samen und Früchte, insbesondere auf harte Nahrung wie die Kerne von Bucheckern und anderen Baumfrüchten. Ihr kräftiger Schnabel ermöglicht es ihnen, diese harten Schalen zu durchdringen und an die darin enthaltenen Nährstoffe zu gelangen. Diese Anpassung hat sie zu wichtigen Verbreitern von Baumsamen gemacht und spielt eine Rolle in der Regeneration und Verbreitung von Wäldern.
Verhalten und Fortpflanzung
Während der Fortpflanzungszeit im Frühling zeigt der Kernbeißer ein auffälliges Balzverhalten. Männchen und Weibchen bilden stabile Paarbindungen und bauen gemeinsam ein Nest aus Zweigen, das in der Regel hoch in einem Baum platziert wird. Die Weibchen legen eine kleine Anzahl von Eiern, aus denen nach etwa zwei Wochen die Jungen schlüpfen. Beide Eltern kümmern sich um die Aufzucht der Nestlinge.
Ökologische Bedeutung und Schutzstatus
Obwohl der Kernbeißer nicht als gefährdet gilt, steht er dennoch unter Beobachtung aufgrund der Veränderungen in seinen Lebensräumen durch menschliche Eingriffe. Ihre Rolle als Samenverbreiter und ihre Abhängigkeit von intakten Waldökosystemen machen sie zu Indikatoren für die Gesundheit dieser Lebensräume.
Fazit
Der Kernbeißer ist ein faszinierendes Beispiel für die Anpassungsfähigkeit und die spezialisierten Eigenschaften von Vögeln in gemäßigten Wäldern. Sein kräftiger Schnabel und sein soziales Verhalten machen ihn nicht nur zu einem interessanten Objekt der Forschung, sondern auch zu einem wichtigen Bestandteil der ökologischen Vielfalt in Eurasien. Der Schutz ihrer Lebensräume ist entscheidend für ihr langfristiges Überleben und trägt zur Erhaltung der Biodiversität bei.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
Der Kernbeißer ist durch sein beeindruckendes Erscheinungsbild leicht zu erkennen. Er ist etwa so groß wie eine Amsel, jedoch viel gedrungener und mit einem kräftigen, kegelförmigen Schnabel ausgestattet. Dieser Schnabel ist besonders robust und ermöglicht es dem Kernbeißer, selbst die härtesten Samen zu knacken, was zu seinem Namen "Kernbeißer" geführt hat. Das Federkleid ist überwiegend gelblich mit schwarzen Flügeln und einem markanten schwarzen Gesicht.
Verbreitung und Lebensraum
Der Lebensraum des Kernbeißers erstreckt sich über weite Teile Eurasiens, von den Wäldern Skandinaviens bis zu den gemäßigten Regionen Asiens. Sie bevorzugen Laub- und Mischwälder sowie Parks und Gärten mit ausreichendem Baumbestand. Besonders im Winter sind sie oft in größeren Schwärmen anzutreffen, wenn sie auf der Suche nach Nahrung sind.
Ernährung und spezialisierte Anpassungen
Die Ernährung des Kernbeißers ist hochspezialisiert auf Samen und Früchte, insbesondere auf harte Nahrung wie die Kerne von Bucheckern und anderen Baumfrüchten. Ihr kräftiger Schnabel ermöglicht es ihnen, diese harten Schalen zu durchdringen und an die darin enthaltenen Nährstoffe zu gelangen. Diese Anpassung hat sie zu wichtigen Verbreitern von Baumsamen gemacht und spielt eine Rolle in der Regeneration und Verbreitung von Wäldern.
Verhalten und Fortpflanzung
Während der Fortpflanzungszeit im Frühling zeigt der Kernbeißer ein auffälliges Balzverhalten. Männchen und Weibchen bilden stabile Paarbindungen und bauen gemeinsam ein Nest aus Zweigen, das in der Regel hoch in einem Baum platziert wird. Die Weibchen legen eine kleine Anzahl von Eiern, aus denen nach etwa zwei Wochen die Jungen schlüpfen. Beide Eltern kümmern sich um die Aufzucht der Nestlinge.
Ökologische Bedeutung und Schutzstatus
Obwohl der Kernbeißer nicht als gefährdet gilt, steht er dennoch unter Beobachtung aufgrund der Veränderungen in seinen Lebensräumen durch menschliche Eingriffe. Ihre Rolle als Samenverbreiter und ihre Abhängigkeit von intakten Waldökosystemen machen sie zu Indikatoren für die Gesundheit dieser Lebensräume.
Fazit
Der Kernbeißer ist ein faszinierendes Beispiel für die Anpassungsfähigkeit und die spezialisierten Eigenschaften von Vögeln in gemäßigten Wäldern. Sein kräftiger Schnabel und sein soziales Verhalten machen ihn nicht nur zu einem interessanten Objekt der Forschung, sondern auch zu einem wichtigen Bestandteil der ökologischen Vielfalt in Eurasien. Der Schutz ihrer Lebensräume ist entscheidend für ihr langfristiges Überleben und trägt zur Erhaltung der Biodiversität bei.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
- Kernbeißer im Portrait
Artenschutz in Franken®
Maiglöckchen (Convallaria majalis) - Ein Maiglöckchen-Märchen

Ein Maiglöckchen-Märchen
28/29.05.2025
Diese Blume war nicht nur schön anzusehen, sondern trug auch eine geheimnisvolle Kraft in sich, die das Leben im Wald beeinflusste.
28/29.05.2025
- Es war einmal, tief verborgen im Herzen eines dichten Waldes, ein besonderes Maiglöckchen.
Diese Blume war nicht nur schön anzusehen, sondern trug auch eine geheimnisvolle Kraft in sich, die das Leben im Wald beeinflusste.
Die Legende besagt, dass jedes Maiglöckchen im Morgentau erblühte, wenn die ersten Sonnenstrahlen des Frühlings den Boden berührten. Seine weißen, glockenförmigen Blütenblätter öffneten sich langsam, als ob sie die Energie der Sonne einfingen, um sie in den Wald zu strahlen. Die Tiere des Waldes wussten um diese magische Zeit und versammelten sich jedes Jahr voller Erwartung um das erste Maiglöckchen, das blühte.
In den Tiefen des Waldes lebte eine alte Eule namens Hespera, die über die Geheimnisse der Pflanzen und Blumen wachte. Sie kannte die Legenden und Geschichten, die von Generation zu Generation weitergegeben wurden. Eines Tages, als der Frühling sich in voller Pracht entfaltete, kam eine junge Füchsin namens Lysandra zu ihr. Sie war neugierig auf die Legende des Maiglöckchens und bat Hespera, ihr mehr darüber zu erzählen.
Hespera, die weise Eule, begann zu erzählen: "Das Maiglöckchen symbolisiert die Reinheit und die Wiedergeburt des Frühlings. Seine Blüten sind nicht nur schön anzusehen, sondern haben auch eine heilende Kraft. In vergangenen Zeiten wurden die Blätter und Blüten des Maiglöckchens verwendet, um Tränke herzustellen, die Krankheiten heilen und böse Geister vertreiben sollten."
Lysandra lauschte gespannt und fragte: "Aber warum blüht das Maiglöckchen nur im Frühling?"
Hespera antwortete: "Das Maiglöckchen ist eine Pflanze, die das Erwachen der Natur symbolisiert. Seine Blüten sind so zart und rein wie der erste Hauch des Frühlingswindes. Es ist ein Zeichen der Hoffnung und des Neubeginns für alle Lebewesen im Wald."
Während die Tage wärmer wurden und die Blumenpracht im Wald zunahm, begannen die Tiere, das Maiglöckchen als Symbol der Einheit und des Zusammenhalts zu betrachten. Es war nicht nur eine Blume, sondern ein Verbindungsglied zwischen den Jahreszeiten und den Geschöpfen des Waldes.
So lebte das Maiglöckchen weiter in den Geschichten und Herzen der Waldbewohner, jedes Jahr erblühend, um die Magie des Frühlings und die Wunder der Natur zu feiern. Und die Legende des Maiglöckchens wurde weitererzählt, von Generation zu Generation, als Erinnerung an die Schönheit und die Geheimnisse der Natur.
In der Aufnahme
In den Tiefen des Waldes lebte eine alte Eule namens Hespera, die über die Geheimnisse der Pflanzen und Blumen wachte. Sie kannte die Legenden und Geschichten, die von Generation zu Generation weitergegeben wurden. Eines Tages, als der Frühling sich in voller Pracht entfaltete, kam eine junge Füchsin namens Lysandra zu ihr. Sie war neugierig auf die Legende des Maiglöckchens und bat Hespera, ihr mehr darüber zu erzählen.
Hespera, die weise Eule, begann zu erzählen: "Das Maiglöckchen symbolisiert die Reinheit und die Wiedergeburt des Frühlings. Seine Blüten sind nicht nur schön anzusehen, sondern haben auch eine heilende Kraft. In vergangenen Zeiten wurden die Blätter und Blüten des Maiglöckchens verwendet, um Tränke herzustellen, die Krankheiten heilen und böse Geister vertreiben sollten."
Lysandra lauschte gespannt und fragte: "Aber warum blüht das Maiglöckchen nur im Frühling?"
Hespera antwortete: "Das Maiglöckchen ist eine Pflanze, die das Erwachen der Natur symbolisiert. Seine Blüten sind so zart und rein wie der erste Hauch des Frühlingswindes. Es ist ein Zeichen der Hoffnung und des Neubeginns für alle Lebewesen im Wald."
Während die Tage wärmer wurden und die Blumenpracht im Wald zunahm, begannen die Tiere, das Maiglöckchen als Symbol der Einheit und des Zusammenhalts zu betrachten. Es war nicht nur eine Blume, sondern ein Verbindungsglied zwischen den Jahreszeiten und den Geschöpfen des Waldes.
So lebte das Maiglöckchen weiter in den Geschichten und Herzen der Waldbewohner, jedes Jahr erblühend, um die Magie des Frühlings und die Wunder der Natur zu feiern. Und die Legende des Maiglöckchens wurde weitererzählt, von Generation zu Generation, als Erinnerung an die Schönheit und die Geheimnisse der Natur.
In der Aufnahme
- So schön das Maiglöckchen auch sein mag, so giftig ist es auch und deshalb: "Finger und sonstige Körperteile inkl. unserer Haustiere" weg. Darüber hinaus untreliegt diese Pflanze auch strengen Regelungen des Gesetzgebers!
Artenschutz in Franken®
Die leise Reise der Blindschleiche

Die (letzte) leise Reise der Blindschleiche
27/28.05.2025
Nennen wir sie einfach Lina und war – wie alle ihrer Art – eine Meisterin der Tarnung. Ihr bronzefarben schimmernder Körper glänzte sanft in der Morgensonne, während sie auf der Suche nach Nahrung vorsichtig aus ihrem Versteck kroch.
27/28.05.2025
- Im (kühlen) Schatten eines Buchenforstes schlängelte sich eine kleine Blindschleiche durch das Laub.
Nennen wir sie einfach Lina und war – wie alle ihrer Art – eine Meisterin der Tarnung. Ihr bronzefarben schimmernder Körper glänzte sanft in der Morgensonne, während sie auf der Suche nach Nahrung vorsichtig aus ihrem Versteck kroch.
Lina war keine Schlange, obwohl sie oft dafür gehalten wurde. Nein, sie war eine Eidechse ohne Beine – eine Blindschleiche, genauer gesagt eine Westliche Blindschleiche. Ihre Welt bestand aus weichem Waldboden, Laubhaufen, altem Totholz und sonnigen Lichtungen.
Doch auf ihrem Weg lag heute eine breite, graue Schneise: die Forststraße.
Die Straße war kein natürlicher Teil ihres Lebensraums. Sie war hart, heiß in der Sonne – und gefährlich. Denn hier rollten schwere Maschinen, wenn Bäume geerntet wurden, und auch Wanderer und Radfahrer überquerten sie täglich. Lina spürte die Wärme des Asphalts – verlockend für ein wechselwarmes Tier wie sie, das Sonne zum Aufwärmen braucht.
Doch die Straße war trügerisch: Kaum sichtbar, bewegt sie sich langsam, und oft wird sie einfach übersehen. Viele ihrer Verwandten waren hier schon ums Leben gekommen, von Reifen zerdrückt oder durch Unachtsamkeit verletzt. Zum Glück blieb Lina nicht unbeobachtet. In diesem Wald hatte man erkannt, wie empfindlich das Gleichgewicht war. Aufmerksame Menschen arbeiteten zusammen, um Tiere wie Lina zu schützen.
Doch dort wo es vornehmlich um die Einnahmen aus dem Holzverkauf geht finden wir ein solches Engagement nur sehr begrenzt. Nötig wären flächige Kartierungen von Wanderwegen, die Installation sogenannter gefährdungsreduzierter Wärmeinseln, die Montage von Infoschildern und nicht zuletzt auch das Sperren von markanten Forststraßen, während sensibler Zeitspannen.
Die Blindschleiche, noch immer kaum beachtet, sollte mehr Aufmerksamkeit entgegengebracht werden, Aufmerksamkeit die sie gerade auch in Wirtschaftsforsten benötigt um hier überdauern zu können.
Als die Sonne langsam unterging, verschwand Lina auf der anderen Seite im Dickicht. Dort wartete feuchter Moosboden und ein alter Asthaufen – genau der richtige Ort für eine Blindschleiche, um sicher zu ruhen.
Und so war Linas leise Reise ein kleiner Sieg – nicht nur für sie, sondern für alle, die daran arbeiteten, unsere Natur zu bewahren.
In der Aufnahme
Doch auf ihrem Weg lag heute eine breite, graue Schneise: die Forststraße.
Die Straße war kein natürlicher Teil ihres Lebensraums. Sie war hart, heiß in der Sonne – und gefährlich. Denn hier rollten schwere Maschinen, wenn Bäume geerntet wurden, und auch Wanderer und Radfahrer überquerten sie täglich. Lina spürte die Wärme des Asphalts – verlockend für ein wechselwarmes Tier wie sie, das Sonne zum Aufwärmen braucht.
Doch die Straße war trügerisch: Kaum sichtbar, bewegt sie sich langsam, und oft wird sie einfach übersehen. Viele ihrer Verwandten waren hier schon ums Leben gekommen, von Reifen zerdrückt oder durch Unachtsamkeit verletzt. Zum Glück blieb Lina nicht unbeobachtet. In diesem Wald hatte man erkannt, wie empfindlich das Gleichgewicht war. Aufmerksame Menschen arbeiteten zusammen, um Tiere wie Lina zu schützen.
Doch dort wo es vornehmlich um die Einnahmen aus dem Holzverkauf geht finden wir ein solches Engagement nur sehr begrenzt. Nötig wären flächige Kartierungen von Wanderwegen, die Installation sogenannter gefährdungsreduzierter Wärmeinseln, die Montage von Infoschildern und nicht zuletzt auch das Sperren von markanten Forststraßen, während sensibler Zeitspannen.
Die Blindschleiche, noch immer kaum beachtet, sollte mehr Aufmerksamkeit entgegengebracht werden, Aufmerksamkeit die sie gerade auch in Wirtschaftsforsten benötigt um hier überdauern zu können.
Als die Sonne langsam unterging, verschwand Lina auf der anderen Seite im Dickicht. Dort wartete feuchter Moosboden und ein alter Asthaufen – genau der richtige Ort für eine Blindschleiche, um sicher zu ruhen.
Und so war Linas leise Reise ein kleiner Sieg – nicht nur für sie, sondern für alle, die daran arbeiteten, unsere Natur zu bewahren.
In der Aufnahme
- Westliche Blindschleiche auf einem ungesicherten Forstweg
Artenschutz in Franken®
Unserer Spezies eine Schlangenlänge voraus ...

Unserer Spezies eine Schlangenlänge voraus ...
26/27.05.2025
Ihr schuppiges, grünbraunes Muster lag reglos auf dem Asphalt, umgeben von der Hektik des morgendlichen Verkehrs. Ein Symbol für die stille Tragödie, die sich unaufhaltsam vor unseren Augen entfaltet.
26/27.05.2025
- Es war ein stiller Morgen auf der Landstraße, als das Leben einer Ringelnatter plötzlich in einem Augenblick der Unachtsamkeit erlosch.
Ihr schuppiges, grünbraunes Muster lag reglos auf dem Asphalt, umgeben von der Hektik des morgendlichen Verkehrs. Ein Symbol für die stille Tragödie, die sich unaufhaltsam vor unseren Augen entfaltet.
Die Ringelnatter, ein unscheinbarer Bewohner unserer Natur, der sanft durch Wiesen und Bäche glitt, fand ihr Ende durch die Räder der Menschheit. Ihre Überfahrt war nicht nur ein Verlust für ihre Art, sondern auch ein Zeichen für das größere Drama, das sich abspielt: das rasante Verschwinden der Biodiversität, das unsere Welt umgibt.
In einer Zeit, in der unsere Straßen breiter werden und unsere Städte wachsen, verlieren wir stetig die Verbindung zu den "wilden Orten" und den Kreaturen, die sie bewohnen. Die Ringelnatter war nur eine von vielen, die in der stillen Krise des Artensterbens ihren Platz verliert. Ihre Vergänglichkeit mahnt uns, dass wir als Menschen eine Verantwortung tragen, die über unser unmittelbares Umfeld hinausgeht.
Wir sind Zeugen einer Ära, in der unsere Entscheidungen über Leben und Tod auf den Straßen und in den Wäldern gleichermaßen fallen. Jede überfahrene Kreatur ist ein Stich in das Gewebe der Natur, das uns alle zusammenhält. Unsere Handlungen bestimmen das Schicksal der Ringelnatter und unzähliger anderer Spezies, deren Existenz durch unsere Entwicklung bedroht ist.
Am Ende bleibt die Frage: Welche Spuren hinterlassen wir in den Herzen derer, die nach uns kommen? Möge die Ringelnatter uns daran erinnern, dass wir nicht nur die Bewahrer unserer eigenen Welt sind, sondern auch die Wächter einer Vielfalt, die einst den Reichtum unseres Planeten ausmachte.
"Die Natur spricht eine Sprache, die jeder verstehen sollte. Ihre Stille ist lauter als jedes Wort, das wir je gesprochen haben."
Doch warum legen sich Ringelnattern eigentlich auf Straßen ab?
Erklären lässt sich das Verhalten der Ringelnatter (Natrix natrix), sich auf Straßen oder anderen asphaltierten Flächen abzulegen, durch ihre thermophile Lebensweise erklären. Als poikilotherme (wechselwarme) Tiere sind Ringelnattern auf externe Wärmequellen angewiesen, um ihre Körpertemperatur zu regulieren. Diese Thermoregulation ist entscheidend für ihre Aktivität, ihre Verdauung, ihre Beweglichkeit und ihre Fortpflanzungsfähigkeit.
Hauptgründe im Detail:
Thermoregulation durch Wärmeaufnahme
Morgen- und Frühjahrsaktivität
Energieeffizienz
Verhaltensökologische Fehlanpassung
Fazit:
Das Ablegen auf Straßen durch die Ringelnatter ist ein thermoregulatorisches Verhalten, das durch ihre ektotherme Physiologie bedingt ist. Straßen fungieren als künstliche Wärmeinseln, werden von den Tieren aber nicht als Gefahrenquelle erkannt. Dieses Verhalten ist damit ein Beispiel für eine anthropogene ökologische Falle.
In der Aufnahme
In einer Zeit, in der unsere Straßen breiter werden und unsere Städte wachsen, verlieren wir stetig die Verbindung zu den "wilden Orten" und den Kreaturen, die sie bewohnen. Die Ringelnatter war nur eine von vielen, die in der stillen Krise des Artensterbens ihren Platz verliert. Ihre Vergänglichkeit mahnt uns, dass wir als Menschen eine Verantwortung tragen, die über unser unmittelbares Umfeld hinausgeht.
Wir sind Zeugen einer Ära, in der unsere Entscheidungen über Leben und Tod auf den Straßen und in den Wäldern gleichermaßen fallen. Jede überfahrene Kreatur ist ein Stich in das Gewebe der Natur, das uns alle zusammenhält. Unsere Handlungen bestimmen das Schicksal der Ringelnatter und unzähliger anderer Spezies, deren Existenz durch unsere Entwicklung bedroht ist.
Am Ende bleibt die Frage: Welche Spuren hinterlassen wir in den Herzen derer, die nach uns kommen? Möge die Ringelnatter uns daran erinnern, dass wir nicht nur die Bewahrer unserer eigenen Welt sind, sondern auch die Wächter einer Vielfalt, die einst den Reichtum unseres Planeten ausmachte.
"Die Natur spricht eine Sprache, die jeder verstehen sollte. Ihre Stille ist lauter als jedes Wort, das wir je gesprochen haben."
Doch warum legen sich Ringelnattern eigentlich auf Straßen ab?
Erklären lässt sich das Verhalten der Ringelnatter (Natrix natrix), sich auf Straßen oder anderen asphaltierten Flächen abzulegen, durch ihre thermophile Lebensweise erklären. Als poikilotherme (wechselwarme) Tiere sind Ringelnattern auf externe Wärmequellen angewiesen, um ihre Körpertemperatur zu regulieren. Diese Thermoregulation ist entscheidend für ihre Aktivität, ihre Verdauung, ihre Beweglichkeit und ihre Fortpflanzungsfähigkeit.
Hauptgründe im Detail:
Thermoregulation durch Wärmeaufnahme
- Ringelnattern nutzen sonnenexponierte Straßen, weil sich diese Oberflächen (insbesondere Asphalt oder Beton) schneller und stärker erwärmen als die umgebende Vegetation oder der Boden. Durch das Ablegen auf der warmen Fläche können die Tiere in kurzer Zeit Wärme aufnehmen und ihre Körpertemperatur effizient steigern.
Morgen- und Frühjahrsaktivität
- Besonders häufig ist dieses Verhalten in den kühlen Morgenstunden oder im Frühjahr zu beobachten, wenn die Umgebungstemperaturen niedrig sind. Straßen bieten dann eine der wenigen ausreichend warmen Flächen zur schnellen Aktivierung des Stoffwechsels.
Energieeffizienz
- Durch die Nutzung künstlich erhitzter Flächen sparen die Tiere Energie, da sie ihre Körpertemperatur schneller und mit geringerem Risiko erreichen können, als z. B. durch langes Sonnenbaden auf unsicheren Freiflächen.
Verhaltensökologische Fehlanpassung
- Aus verhaltensökologischer Sicht ist dieses Verhalten eine evolutionär konservierte Strategie, die ursprünglich auf sonnenbeschienene Felsen oder Böschungen ausgelegt war. Straßen ähneln diesen Strukturen in ihren thermischen Eigenschaften – jedoch mit dem Nachteil, dass sie heute stark vom Menschen genutzt werden. Die Tiere erkennen den Unterschied nicht und fallen häufig dem Straßenverkehr zum Opfer.
Fazit:
Das Ablegen auf Straßen durch die Ringelnatter ist ein thermoregulatorisches Verhalten, das durch ihre ektotherme Physiologie bedingt ist. Straßen fungieren als künstliche Wärmeinseln, werden von den Tieren aber nicht als Gefahrenquelle erkannt. Dieses Verhalten ist damit ein Beispiel für eine anthropogene ökologische Falle.
In der Aufnahme
- Nur noch "eine Schlangenlänge voraus" so zeigt sich die Biodiversität ... ein Teil dieser Biodiversität ist auch unsere Spezies ... letztendlich wird auch diese, unsere Spezies jenen Weg beschreiten, den uns die Ringelnatter aufgrund unseres Wirkens vorangegangen ist!
Artenschutz in Franken®
Der Glanz des (Früh) - Sommers ...

Ich bin der Glanz des Sommers – ein Goldglänzender Rosenkäfer
25/26.05.2025
Ich bin Cetonia aurata, doch die meisten kennen mich als den Goldglänzenden Rosenkäfer.
Wenn die Sonne über den Gärten tanzt und das Licht in warmen Strahlen durch die Blätter fällt, dann bin ich in meinem Element. Mein Panzer schimmert in metallischem Grün, manchmal mit einem Hauch von Gold, Kupfer oder Blau – als hätte jemand mich aus Edelstein geformt.
25/26.05.2025
Ich bin Cetonia aurata, doch die meisten kennen mich als den Goldglänzenden Rosenkäfer.
Wenn die Sonne über den Gärten tanzt und das Licht in warmen Strahlen durch die Blätter fällt, dann bin ich in meinem Element. Mein Panzer schimmert in metallischem Grün, manchmal mit einem Hauch von Gold, Kupfer oder Blau – als hätte jemand mich aus Edelstein geformt.
Ich liebe den Duft der Blüten, besonders den von Rosen, Holunder und Wildblumen. In ihren duftenden Herzen finde ich Nahrung – süßen Blütenstaub und Nektar, der mich stärkt und meine Flügel trägt. Viele halten mich für schwerfällig, doch ich fliege flink und zielstrebig – oft mit einem Summen, das wie ein Lied aus der Tiefe des Gartens klingt.
Ich bin kein Schädling, auch wenn man mich manchmal so nennt. Ich bin ein Helfer. Meine Kinder – die Larven – leben verborgen in altem Holz, Kompost und verrottendem Pflanzenmaterial. Dort zersetzen sie, was vergangen ist, und machen Platz für neues Leben. Wir sind kleine Räder im großen Getriebe der Natur.
Manchmal sehe ich, wie Menschen mich entdecken – ein Kind, das staunt, ein Gärtner, der innehält. Dann weiß ich, dass mein Glanz nicht nur mir Freude bringt, sondern auch euch. Vielleicht bin ich klein, doch in meinem goldenen Panzer trage ich ein Stück Sommer in die Welt hinaus.
Wenn du mich das nächste Mal siehst, wie ich auf einer Blüte ruhe oder durch die Luft schwirre, dann denke daran: Ich bin mehr als nur ein Käfer. Ich bin ein Bote des Lichts, ein kleiner Gärtner der Natur – und ein lebendiger Schatz der warmen Tage.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
Ich bin kein Schädling, auch wenn man mich manchmal so nennt. Ich bin ein Helfer. Meine Kinder – die Larven – leben verborgen in altem Holz, Kompost und verrottendem Pflanzenmaterial. Dort zersetzen sie, was vergangen ist, und machen Platz für neues Leben. Wir sind kleine Räder im großen Getriebe der Natur.
Manchmal sehe ich, wie Menschen mich entdecken – ein Kind, das staunt, ein Gärtner, der innehält. Dann weiß ich, dass mein Glanz nicht nur mir Freude bringt, sondern auch euch. Vielleicht bin ich klein, doch in meinem goldenen Panzer trage ich ein Stück Sommer in die Welt hinaus.
Wenn du mich das nächste Mal siehst, wie ich auf einer Blüte ruhe oder durch die Luft schwirre, dann denke daran: Ich bin mehr als nur ein Käfer. Ich bin ein Bote des Lichts, ein kleiner Gärtner der Natur – und ein lebendiger Schatz der warmen Tage.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- Gemeiner Rosenkäfer (Cetonia aurata)
Artenschutz in Franken®
„Grünfinken in Not: Ein stilles Sterben im heimischen Garten“

„Grünfinken in Not: Ein stilles Sterben im heimischen Garten“
24/25.05.2025
Der Grünfink (Chloris chloris), ein charakteristischer Singvogel mit seinem gelbgrünen Gefieder und dem markanten Gesang, ist bedauerlicherweise häufig Opfer der Krankheit Trichomonas gallinae. Diese parasitäre Infektion betrifft nicht nur Grünfinken, sondern auch andere Vogelarten, insbesondere in urbanen und ländlichen Regionen Europas.
24/25.05.2025
- Die heimtückische Krankheit Trichomonas gallinae rafft seit Jahren massenhaft Grünfinken dahin – ein Alarmzeichen für unser Ökosystem.
Der Grünfink (Chloris chloris), ein charakteristischer Singvogel mit seinem gelbgrünen Gefieder und dem markanten Gesang, ist bedauerlicherweise häufig Opfer der Krankheit Trichomonas gallinae. Diese parasitäre Infektion betrifft nicht nur Grünfinken, sondern auch andere Vogelarten, insbesondere in urbanen und ländlichen Regionen Europas.
Krankheitsverlauf und Auswirkungen auf den Grünfinken
Trichomonas gallinae ist ein einzelliger Parasit, der im Verdauungstrakt von Vögeln lebt und zu schweren Entzündungen und Geschwüren führt, besonders im Rachen und in der Speiseröhre. Infizierte Vögel zeigen Symptome wie Müdigkeit, Apathie, Schwierigkeiten beim Schlucken und Atembeschwerden. Diese Symptome können zu einem schnellen Verlust an Gewicht und Energie führen, was letztendlich zum Tod durch Dehydrierung und Erschöpfung führt, wenn die Infektion nicht behandelt wird.
Verbreitung und Ursachen
Trichomonas gallinae verbreitet sich hauptsächlich durch direkten Kontakt zwischen Vögeln, insbesondere beim Füttern der Jungen, und durch kontaminierte Wasser- und Futterquellen. Die Krankheit kann saisonale Ausbrüche haben, besonders während der Brutzeit, wenn Vögel anfälliger sind.
Auswirkungen auf die Population
Der Grünfink, der oft in Schwärmen und in der Nähe menschlicher Siedlungen lebt, ist anfällig für Massenausbrüche von Trichomonose. Diese Krankheit hat in den letzten Jahren in einigen Regionen Europas zu signifikanten Rückgängen der Grünfinkenpopulation geführt. Besonders betroffen sind Gebiete mit intensiver Vogelfütterung, wo die Krankheit leichter von einem Vogel zum nächsten übertragen werden kann.
Bekämpfungsmaßnahmen und Forschung
Der Schutz und die Erhaltung des Grünfinken erfordern eine umfassende Überwachung der Krankheitsprävalenz und effektive Bekämpfungsmaßnahmen. Veterinäre und ornithologische Organisationen setzen sich aktiv für die Entwicklung von Impfstoffen und die Aufklärung der Öffentlichkeit über hygienische Praktiken bei der Vogelfütterung ein, um die Verbreitung von Trichomonas gallinae einzudämmen.
Schlussfolgerung
Das Sterben von Grünfinken aufgrund der Trichomonas gallinae-Infektion ist ein bedauerliches Phänomen, das die fragile Balance der Vogelpopulationen in Europa gefährdet. Eine kontinuierliche Überwachung, Forschung und Zusammenarbeit auf internationaler Ebene sind entscheidend, um diese Krankheit zu bekämpfen und die Zukunft dieser ikonischen Singvögel zu sichern.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- Hier ist gut zu sehen, dass das Gefieder gesträubt ist, besonders im Kopfbereich durch die vergeblichen Fressversuche etwas verklebt. Schnabel schmutzig, später fängt er noch an zu sabbern. Versucht auch zu fressen, würgt, bekommt nix herunter. Tag später ist er meist tot. So ist im Allgemeinen der Verlauf.
Artenschutz in Franken®
Die Kreuzotter (Vipera berus) ...

Die Kreuzotter (Vipera berus) – Eine faszinierende und schützenswerte Giftschlange Europas
23/24.05.2025
Als einzige heimische Giftschlange in vielen Regionen Mitteleuropas spielt sie eine wichtige Rolle im ökologischen Gleichgewicht und steht gleichzeitig unter zunehmendem Schutzbedarf. In diesem Aufsatz werden Lebensweise, Merkmale, Verbreitung sowie Gefährdung und Schutz der Kreuzotter näher beleuchtet.
23/24.05.2025
- Die Kreuzotter (Vipera berus) ist eine der bekanntesten und zugleich am meisten missverstandenen Schlangenarten Europas.
Als einzige heimische Giftschlange in vielen Regionen Mitteleuropas spielt sie eine wichtige Rolle im ökologischen Gleichgewicht und steht gleichzeitig unter zunehmendem Schutzbedarf. In diesem Aufsatz werden Lebensweise, Merkmale, Verbreitung sowie Gefährdung und Schutz der Kreuzotter näher beleuchtet.
Aussehen und Merkmale
Die Kreuzotter ist leicht an ihrem markanten Zickzackband auf dem Rücken zu erkennen, das sich deutlich vom restlichen Körper abhebt. Die Grundfärbung variiert je nach Individuum und Geschlecht: Männchen sind oft grau mit schwarzem Muster, Weibchen eher bräunlich. Es gibt aber auch komplett schwarze (melanistische) Exemplare. Die Kreuzotter erreicht eine Länge von etwa 50 bis 90 Zentimetern. Trotz ihrer geringen Größe verfügt sie über ein wirksames Gift, das sie zur Jagd auf Beutetiere einsetzt.
Lebensraum und Verbreitung
Die Kreuzotter ist in großen Teilen Europas verbreitet – von Nordspanien über Großbritannien bis weit in den Osten Russlands. Sie bewohnt vor allem strukturreiche Landschaften wie Moore, Heidegebiete, lichte Wälder, Waldränder sowie alpine Lagen. Wichtig für ihr Überleben sind Rückzugsorte wie Steinhaufen, dichtes Gestrüpp oder verlassene Tierbauten, die ihr Schutz vor Fressfeinden und klimatischen Extrembedingungen bieten.
Lebensweise und Ernährung
Als dämmerungs- und tagaktive Jägerin ernährt sich die Kreuzotter hauptsächlich von Kleinsäugern wie Mäusen, Eidechsen, Fröschen und gelegentlich auch von jungen Vögeln. Sie lauert ihrer Beute auf und tötet sie durch einen gezielten Giftbiss. Menschen gegenüber verhält sich die Kreuzotter zurückhaltend und flüchtet meist bei Annäherung. Bisse sind selten und verlaufen in der Regel nicht lebensbedrohlich, können jedoch ärztliche Behandlung erfordern.
Fortpflanzung
Kreuzottern sind lebendgebärend – eine Besonderheit unter Schlangen. Die Weibchen bringen im Spätsommer etwa 5 bis 15 Jungtiere zur Welt. Die Jungen sind von Anfang an selbstständig und giftig. Die Paarungszeit findet im Frühjahr statt, wobei es unter den Männchen oft zu beeindruckenden Kommentkämpfen um die Weibchen kommt.
Gefährdung und Schutz
Trotz ihrer weiten Verbreitung gilt die Kreuzotter in vielen Regionen als gefährdet. Hauptursachen sind der Verlust geeigneter Lebensräume durch Landwirtschaft, Urbanisierung und Straßenbau. Auch Klimaveränderungen wirken sich negativ aus, da sie die Fortpflanzung und Überwinterung erschweren. Zudem werden Kreuzottern aufgrund ihrer Giftigkeit oft grundlos getötet. In Deutschland und vielen anderen Ländern steht die Kreuzotter unter Naturschutz. Schutzmaßnahmen umfassen die Renaturierung von Moor- und Heidelandschaften, die Einrichtung von Schutzzonen sowie Aufklärungsarbeit in der Bevölkerung.
Fazit
Die Kreuzotter ist eine faszinierende und ökologisch wertvolle Reptilienart, die Respekt, aber keine Angst verdient. Als Teil unserer heimischen Fauna trägt sie zum Gleichgewicht der Natur bei und ist ein wichtiger Indikator für den Zustand unserer Ökosysteme. Ihr Schutz erfordert ein verantwortungsbewusstes Miteinander von Mensch und Natur sowie den Erhalt ihrer Lebensräume. Nur so kann ihr Fortbestand langfristig gesichert werden.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
Die Kreuzotter ist leicht an ihrem markanten Zickzackband auf dem Rücken zu erkennen, das sich deutlich vom restlichen Körper abhebt. Die Grundfärbung variiert je nach Individuum und Geschlecht: Männchen sind oft grau mit schwarzem Muster, Weibchen eher bräunlich. Es gibt aber auch komplett schwarze (melanistische) Exemplare. Die Kreuzotter erreicht eine Länge von etwa 50 bis 90 Zentimetern. Trotz ihrer geringen Größe verfügt sie über ein wirksames Gift, das sie zur Jagd auf Beutetiere einsetzt.
Lebensraum und Verbreitung
Die Kreuzotter ist in großen Teilen Europas verbreitet – von Nordspanien über Großbritannien bis weit in den Osten Russlands. Sie bewohnt vor allem strukturreiche Landschaften wie Moore, Heidegebiete, lichte Wälder, Waldränder sowie alpine Lagen. Wichtig für ihr Überleben sind Rückzugsorte wie Steinhaufen, dichtes Gestrüpp oder verlassene Tierbauten, die ihr Schutz vor Fressfeinden und klimatischen Extrembedingungen bieten.
Lebensweise und Ernährung
Als dämmerungs- und tagaktive Jägerin ernährt sich die Kreuzotter hauptsächlich von Kleinsäugern wie Mäusen, Eidechsen, Fröschen und gelegentlich auch von jungen Vögeln. Sie lauert ihrer Beute auf und tötet sie durch einen gezielten Giftbiss. Menschen gegenüber verhält sich die Kreuzotter zurückhaltend und flüchtet meist bei Annäherung. Bisse sind selten und verlaufen in der Regel nicht lebensbedrohlich, können jedoch ärztliche Behandlung erfordern.
Fortpflanzung
Kreuzottern sind lebendgebärend – eine Besonderheit unter Schlangen. Die Weibchen bringen im Spätsommer etwa 5 bis 15 Jungtiere zur Welt. Die Jungen sind von Anfang an selbstständig und giftig. Die Paarungszeit findet im Frühjahr statt, wobei es unter den Männchen oft zu beeindruckenden Kommentkämpfen um die Weibchen kommt.
Gefährdung und Schutz
Trotz ihrer weiten Verbreitung gilt die Kreuzotter in vielen Regionen als gefährdet. Hauptursachen sind der Verlust geeigneter Lebensräume durch Landwirtschaft, Urbanisierung und Straßenbau. Auch Klimaveränderungen wirken sich negativ aus, da sie die Fortpflanzung und Überwinterung erschweren. Zudem werden Kreuzottern aufgrund ihrer Giftigkeit oft grundlos getötet. In Deutschland und vielen anderen Ländern steht die Kreuzotter unter Naturschutz. Schutzmaßnahmen umfassen die Renaturierung von Moor- und Heidelandschaften, die Einrichtung von Schutzzonen sowie Aufklärungsarbeit in der Bevölkerung.
Fazit
Die Kreuzotter ist eine faszinierende und ökologisch wertvolle Reptilienart, die Respekt, aber keine Angst verdient. Als Teil unserer heimischen Fauna trägt sie zum Gleichgewicht der Natur bei und ist ein wichtiger Indikator für den Zustand unserer Ökosysteme. Ihr Schutz erfordert ein verantwortungsbewusstes Miteinander von Mensch und Natur sowie den Erhalt ihrer Lebensräume. Nur so kann ihr Fortbestand langfristig gesichert werden.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
- Kreuzottern
Artenschutz in Franken®
Der Tod lauert auf den Forststraßen ... Blindschleiche in Gefahr

Der Tod lauert auf den Forststraßen ... Blindschleiche in Gefahr
22/23.05.2025
Hier ist ein weiterführendeer Bericht über sie und ihre Gefährdung, insbesondere wenn sie sich zum Aufwärmen auf Waldwege niederlässt:
22/23.05.2025
- Die Westliche Blindschleiche (Anguis fragilis) ist eine faszinierende Echsenart, die oft mit Schlangen verwechselt wird, aber tatsächlich zur Familie der Schleichen gehört.
Hier ist ein weiterführendeer Bericht über sie und ihre Gefährdung, insbesondere wenn sie sich zum Aufwärmen auf Waldwege niederlässt:
Beschreibung und Lebensweise der Westlichen Blindschleiche
Die Westliche Blindschleiche ist in Europa heimisch und zeichnet sich durch einen langgestreckten, schlangenähnlichen Körper aus, der jedoch keine Extremitäten aufweist. Sie kann eine Länge von bis zu 40 cm erreichen und hat eine glatte, glänzende Haut in verschiedenen Brauntönen. Anders als Schlangen besitzt sie bewegliche Augenlider und eine Zunge, die nicht gespalten ist. Diese Echse ist tagaktiv und lebt bevorzugt in feuchten Habitaten wie Laubwäldern, Gärten und Hecken. Ihre Nahrung besteht hauptsächlich aus Insekten, Spinnen und Würmern, die sie mit ihrer schnellen Zungenbewegung einfängt.
Gefährdung der Westlichen Blindschleiche
Obwohl die Westliche Blindschleiche keine direkte Bedrohung durch Prädation hat, ist sie in ihrem Bestand stark gefährdet. Ein bedeutender Grund dafür ist ihr Verhalten, sich zum Aufwärmen auf Forstwege niederzulassen. Dieses Verhalten ist besonders problematisch aus mehreren Gründen:
Schutzmaßnahmen und Erhaltungsanstrengungen
Um den Rückgang der Westlichen Blindschleiche zu verlangsamen und ihre Lebensräume zu schützen, sind folgende Maßnahmen wichtig:
Insgesamt ist die Westliche Blindschleiche ein Beispiel dafür, wie menschliche Aktivitäten und der Verlust von Lebensräumen eine ansonsten robuste Art gefährden können. Durch gezielte Schutzmaßnahmen und bewusstes Handeln können wir dazu beitragen, ihre Zukunft zu sichern.
In der Aufnahme
Die Westliche Blindschleiche ist in Europa heimisch und zeichnet sich durch einen langgestreckten, schlangenähnlichen Körper aus, der jedoch keine Extremitäten aufweist. Sie kann eine Länge von bis zu 40 cm erreichen und hat eine glatte, glänzende Haut in verschiedenen Brauntönen. Anders als Schlangen besitzt sie bewegliche Augenlider und eine Zunge, die nicht gespalten ist. Diese Echse ist tagaktiv und lebt bevorzugt in feuchten Habitaten wie Laubwäldern, Gärten und Hecken. Ihre Nahrung besteht hauptsächlich aus Insekten, Spinnen und Würmern, die sie mit ihrer schnellen Zungenbewegung einfängt.
Gefährdung der Westlichen Blindschleiche
Obwohl die Westliche Blindschleiche keine direkte Bedrohung durch Prädation hat, ist sie in ihrem Bestand stark gefährdet. Ein bedeutender Grund dafür ist ihr Verhalten, sich zum Aufwärmen auf Forstwege niederzulassen. Dieses Verhalten ist besonders problematisch aus mehreren Gründen:
- Prädation durch Haustiere und Wildtiere: Wenn die Blindschleichen sich auf offenen Wegen aufwärmen, werden sie leicht zur leichten Beute für Haustiere wie Hunde und Katzen sowie für verschiedene Wildtiere wie Raubvögel und Füchse.
- Menschliche Aktivitäten: Forstwege werden häufig von Menschen frequentiert, sei es für Spaziergänge, Fahrradfahren oder Forstarbeiten. Diese Aktivitäten können direkt zur Zerstörung von Lebensräumen führen oder die Blindschleichen stören, vertreiben und vielfach töten.
- Verlust von Lebensraum: Die zunehmende Fragmentierung und Zerstörung ihrer Lebensräume durch menschliche Entwicklung wie Urbanisierung und Landwirtschaft tragen ebenfalls zur Bedrohung der Populationen bei.
Schutzmaßnahmen und Erhaltungsanstrengungen
Um den Rückgang der Westlichen Blindschleiche zu verlangsamen und ihre Lebensräume zu schützen, sind folgende Maßnahmen wichtig:
- Naturschutzgebiete und Schutzgebiete: Einrichtung von Schutzgebieten, die speziell auf die Bedürfnisse der Blindschleichen zugeschnitten sind und in denen ihre Lebensräume erhalten bleiben.
- Bewusstseinsbildung: Aufklärung der Öffentlichkeit über die Bedeutung des Schutzes dieser Art und über die negativen Auswirkungen menschlicher Aktivitäten auf ihre Lebensräume.
- Habitatmanagement: Pflege und Wiederherstellung von Lebensräumen, einschließlich der Schaffung von Verbindungskorridoren zwischen bestehenden Habitaten, um die Populationen zu stabilisieren.
Insgesamt ist die Westliche Blindschleiche ein Beispiel dafür, wie menschliche Aktivitäten und der Verlust von Lebensräumen eine ansonsten robuste Art gefährden können. Durch gezielte Schutzmaßnahmen und bewusstes Handeln können wir dazu beitragen, ihre Zukunft zu sichern.
- Mehr zur Westlichen Blindschleiche (Anguis fragilis) hier auf unseren Seiten
- Mehr zum Thema: Der Tod lauert auf den Forstwegen
- Noch mehr zum Thema: Der Tod lauert auf den Forstwegen
In der Aufnahme
- In höchster Gefahr befand sich diese Blindschleiche ... jährlich finden wir unzählige Tiere, gerade auf den Forststraßen wo sie von Fahrzeugen aller Art überrolt werden! Dieses Tier hatte Glück, wir nahmen diese vom Fahrweg und brachte sie in Sicherheit.
Artenschutz in Franken®
Kaulquappen der Erdkröte (Bufo bufo) ..

Kaulquappen der Erdkröte (Bufo bufo) – Entwicklung, Merkmale und ökologische Bedeutung
21/22.05.2025
Ihr Fortpflanzungszyklus umfasst eine aquatische Larvalphase, in der sich aus Eiern die sogenannten Kaulquappen entwickeln. Diese Entwicklungsphase ist nicht nur biologisch faszinierend, sondern auch ökologisch relevant, da Kaulquappen eine zentrale Rolle im Nahrungsnetz und in der ökologischen Dynamik von Kleingewässern spielen.
21/22.05.2025
- Die Erdkröte (Bufo bufo) ist eine der häufigsten Amphibienarten Europas und ein bedeutender Bestandteil mitteleuropäischer Gewässer- und Landökosysteme.
Ihr Fortpflanzungszyklus umfasst eine aquatische Larvalphase, in der sich aus Eiern die sogenannten Kaulquappen entwickeln. Diese Entwicklungsphase ist nicht nur biologisch faszinierend, sondern auch ökologisch relevant, da Kaulquappen eine zentrale Rolle im Nahrungsnetz und in der ökologischen Dynamik von Kleingewässern spielen.
Eiablage und Schlupf
Die Fortpflanzung der Erdkröte beginnt früh im Jahr – meist zwischen März und April –, sobald die Temperaturen steigen und die Laichgewässer eisfrei sind. Die Weibchen legen während der Paarung Laichschnüre mit bis zu 6.000–8.000 Eiern ab, die in langen Doppelschnüren um Wasserpflanzen oder Äste gewickelt werden. Jedes Ei ist in eine gallertartige Schutzhülle eingebettet, die es vor Austrocknung und mechanischen Schäden schützt. Nach etwa 8–14 Tagen (temperaturabhängig) schlüpfen die Kaulquappen. Diese erste Entwicklungsphase ist stark an die Wassertemperatur und die Sauerstoffverhältnisse im Gewässer gekoppelt.
Morphologie und Entwicklung
Die Kaulquappen der Erdkröte sind einheitlich schwarz gefärbt, was sie von anderen Amphibienlarven – etwa denen des Grasfroschs – unterscheidet. Die dunkle Pigmentierung bietet Schutz vor UV-Strahlung und dient der Tarnung am Gewässergrund.
Wichtige Merkmale:
Die Entwicklung durchläuft mehrere Stadien:
Der gesamte Prozess dauert etwa 8–12 Wochen, abhängig von Umweltfaktoren wie Temperatur, Sauerstoffgehalt, Nahrungsangebot und Populationsdichte.
Ernährung und ökologische Funktion
Kaulquappen der Erdkröte sind im Gegensatz zu den räuberischeren Larven anderer Arten überwiegend herbivor oder detritivor. Sie ernähren sich vornehmlich von Algenaufwuchs, abgestorbenem Pflanzenmaterial und Mikroorganismen. Dadurch tragen sie maßgeblich zur Kontrolle von Algenblüten bei und fördern die Wasserqualität in ihren Laichgewässern.
Sie stellen selbst eine wichtige Nahrungsquelle für verschiedene aquatische Prädatoren dar, z. B. Wasserkäferlarven, Libellenlarven, Fische und Vögel. Auch Kannibalismus kann unter Nahrungsmangelbedingungen vorkommen.
Gefährdungen und Mortalität
Die Sterblichkeitsrate von Kaulquappen ist natürlicherweise sehr hoch, was durch die große Eizahl kompensiert wird. Zu den wichtigsten Mortalitätsfaktoren zählen:
Besonders problematisch ist die Fragmentierung der Lebensräume durch Verkehrsinfrastruktur, da sie den Zugang zu Laichgewässern erschwert oder verhindert. Dies kann die Populationen auf lange Sicht destabilisieren.
Schutzaspekte
Die Erdkröte einschließlich ihrer Larvenstadien ist nach Anhang IV der FFH-Richtlinie (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie) als streng zu schützende Art gelistet. In Deutschland unterliegt sie darüber hinaus dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Schutzmaßnahmen umfassen:
Fazit
Die Kaulquappen der Erdkröte sind ein bedeutender Bestandteil aquatischer Ökosysteme und übernehmen dort zentrale Funktionen als Pflanzenfresser, Algenregulatoren und Beuteorganismen. Ihre Entwicklung ist ein empfindlicher biologischer Prozess, der durch zahlreiche Umweltfaktoren beeinflusst wird. Die Kenntnis ihrer Ökologie ist essenziell für den wirksamen Amphibienschutz. Ihr Vorkommen kann als Hinweis auf die Funktionalität von Kleingewässern und die ökologische Qualität von Feuchtlebensräumen dienen.
In der Aufnahme
Die Fortpflanzung der Erdkröte beginnt früh im Jahr – meist zwischen März und April –, sobald die Temperaturen steigen und die Laichgewässer eisfrei sind. Die Weibchen legen während der Paarung Laichschnüre mit bis zu 6.000–8.000 Eiern ab, die in langen Doppelschnüren um Wasserpflanzen oder Äste gewickelt werden. Jedes Ei ist in eine gallertartige Schutzhülle eingebettet, die es vor Austrocknung und mechanischen Schäden schützt. Nach etwa 8–14 Tagen (temperaturabhängig) schlüpfen die Kaulquappen. Diese erste Entwicklungsphase ist stark an die Wassertemperatur und die Sauerstoffverhältnisse im Gewässer gekoppelt.
Morphologie und Entwicklung
Die Kaulquappen der Erdkröte sind einheitlich schwarz gefärbt, was sie von anderen Amphibienlarven – etwa denen des Grasfroschs – unterscheidet. Die dunkle Pigmentierung bietet Schutz vor UV-Strahlung und dient der Tarnung am Gewässergrund.
Wichtige Merkmale:
- Kopfform: Rundlich mit einem relativ breiten Maulfeld
- Schwanz: Länglich, mit abgerundeter Schwanzspitze und einem gut entwickelten Flossensaum
- Größe: Bis zum Abschluss der Larvalphase etwa 2,5–3 cm lang
- Atemorgane: Zunächst Kiemenatmung, später Umstellung auf Lungenatmung im Zuge der Metamorphose
Die Entwicklung durchläuft mehrere Stadien:
- Frühstadium: Aufnahme von Mikroalgen und Detritus
- Mittleres Larvenstadium: Entwicklung von Hinterbeinen, Umstellung der Nahrungsaufnahme
- Spätstadium: Ausbildung der Vorderbeine, Rückbildung des Darms (in Vorbereitung auf den karnivoren Lebensstil der adulten Kröte), Beginn der Lungenatmung
- Metamorphose: Vollständige Rückbildung des Schwanzes, Umstellung auf das Landleben
Der gesamte Prozess dauert etwa 8–12 Wochen, abhängig von Umweltfaktoren wie Temperatur, Sauerstoffgehalt, Nahrungsangebot und Populationsdichte.
Ernährung und ökologische Funktion
Kaulquappen der Erdkröte sind im Gegensatz zu den räuberischeren Larven anderer Arten überwiegend herbivor oder detritivor. Sie ernähren sich vornehmlich von Algenaufwuchs, abgestorbenem Pflanzenmaterial und Mikroorganismen. Dadurch tragen sie maßgeblich zur Kontrolle von Algenblüten bei und fördern die Wasserqualität in ihren Laichgewässern.
Sie stellen selbst eine wichtige Nahrungsquelle für verschiedene aquatische Prädatoren dar, z. B. Wasserkäferlarven, Libellenlarven, Fische und Vögel. Auch Kannibalismus kann unter Nahrungsmangelbedingungen vorkommen.
Gefährdungen und Mortalität
Die Sterblichkeitsrate von Kaulquappen ist natürlicherweise sehr hoch, was durch die große Eizahl kompensiert wird. Zu den wichtigsten Mortalitätsfaktoren zählen:
- Fressfeinde
- Trockenfallen temporärer Gewässer
- Sauerstoffmangel und Überdüngung
- Krankheiten wie Chytridpilze (Batrachochytrium dendrobatidis)
- Anthropogene Einflüsse: Eintrag von Pestiziden, Straßenbau, Habitatfragmentierung
Besonders problematisch ist die Fragmentierung der Lebensräume durch Verkehrsinfrastruktur, da sie den Zugang zu Laichgewässern erschwert oder verhindert. Dies kann die Populationen auf lange Sicht destabilisieren.
Schutzaspekte
Die Erdkröte einschließlich ihrer Larvenstadien ist nach Anhang IV der FFH-Richtlinie (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie) als streng zu schützende Art gelistet. In Deutschland unterliegt sie darüber hinaus dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Schutzmaßnahmen umfassen:
- Erhalt und Wiederherstellung naturnaher Laichgewässer
- Anlage von Amphibiendurchlässen an Straßen
- Schaffung von Rückzugsräumen im Umland (z. B. strukturreiche Waldränder, Feuchtwiesen)
- Verzicht auf den Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln in Gewässernähe
Fazit
Die Kaulquappen der Erdkröte sind ein bedeutender Bestandteil aquatischer Ökosysteme und übernehmen dort zentrale Funktionen als Pflanzenfresser, Algenregulatoren und Beuteorganismen. Ihre Entwicklung ist ein empfindlicher biologischer Prozess, der durch zahlreiche Umweltfaktoren beeinflusst wird. Die Kenntnis ihrer Ökologie ist essenziell für den wirksamen Amphibienschutz. Ihr Vorkommen kann als Hinweis auf die Funktionalität von Kleingewässern und die ökologische Qualität von Feuchtlebensräumen dienen.
In der Aufnahme
- Kaulquappen der Erdkröte (Bufo bufo)
Artenschutz in Franken®
Verein zur Erforschung der Flora des Regnitzgebietes - Exkursionen 2025
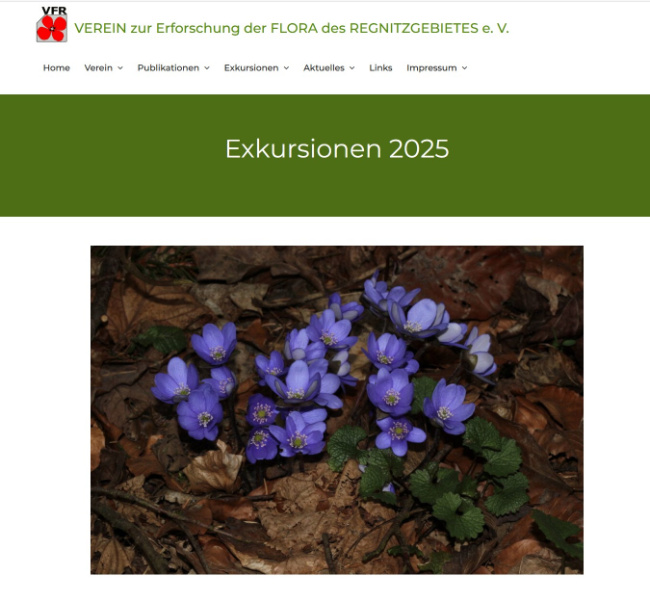
Verein zur Erforschung der Flora des Regnitzgebietes - Exkursionen 2025
20/21.05.2025
Die Arbeit geht weiter!
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde des VFR,
letztes Jahr ist nach langer Vorbereitung die Flora von Bayern erschienen. In dieses fundamentale Werk ist auch ein erheblicher Teil der Arbeit des Vereins zur Erforschung der Flora des Regnitzgebiets (VFR) eingegangen, dessen Ziel es unter anderem ist, Bestand und Veränderung der Flora im Regnitzgebiet zu erfassen und zu kartieren.
Auch wenn mit dem Erscheinen der Flora von Bayern ein gewaltiges Projekt sein Ende gefunden hat, die Natur setzt sich damit nicht zur Ruhe und für uns heißt das: Die Arbeit geht weiter!
Die Veranstaltungen sind offen und kostenlos für alle, richten sich allerdings an Fachpublikum oder Interessierte mit Vorkenntnissen, die sich systematischer mit Botanik auseinandersetzen wollen. Sie dienen neben der Erfassung der Bestände auch der Vernetzung, der Wissensvermittlung sowie dem fachlichen Austausch.
Wir würden uns sehr freuen, wenn wir die eine oder den anderen von Ihnen bei einer Exkursion begrüßen könnten!
20/21.05.2025
Die Arbeit geht weiter!
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde des VFR,
letztes Jahr ist nach langer Vorbereitung die Flora von Bayern erschienen. In dieses fundamentale Werk ist auch ein erheblicher Teil der Arbeit des Vereins zur Erforschung der Flora des Regnitzgebiets (VFR) eingegangen, dessen Ziel es unter anderem ist, Bestand und Veränderung der Flora im Regnitzgebiet zu erfassen und zu kartieren.
Auch wenn mit dem Erscheinen der Flora von Bayern ein gewaltiges Projekt sein Ende gefunden hat, die Natur setzt sich damit nicht zur Ruhe und für uns heißt das: Die Arbeit geht weiter!
Die Veranstaltungen sind offen und kostenlos für alle, richten sich allerdings an Fachpublikum oder Interessierte mit Vorkenntnissen, die sich systematischer mit Botanik auseinandersetzen wollen. Sie dienen neben der Erfassung der Bestände auch der Vernetzung, der Wissensvermittlung sowie dem fachlichen Austausch.
Wir würden uns sehr freuen, wenn wir die eine oder den anderen von Ihnen bei einer Exkursion begrüßen könnten!
Verein zur Erforschung der Flora des Regnitzgebietes
Exkursionen 2025
Abkürzungen: TK = Topographische Karte 1:25 000; TP = Treffpunkt
1.) Sa 31. Mai, TK 6532/4 Nürnberg, TP Langwasser-Süd, Endhaltestelle U 1 (49,39854°N/11,14072°E) Achtung: der TP liegt außerhalb des Ziel-TK), Flora einer Trabantensiedlung: Scherrasen und urbane Gehölzbestände im Bereich Liegnitzer-, Gleiwitzer- und Breslauer Str., Schwerpunkt Lysichiton americanus, Leitung Georg Hetzel und Gerhard Schillai, Naturraum 113.6 – Nürnberger Becken
2.) Sa 7. Juni, TK 6231/1 Adelsdorf, TP Zentbechhofen Keller (49,75924°N/10,90031°E), Schwerpunkt Äcker auf Kalk und Sand, Leitung Harald Schott, Naturraum 113. 7 – Aischtal und Aischgrund.
3.) Sa 14. Juni, TK 6428/1 Bad Windsheim, TP Humprechtsau Kirche (49,55764°N/10,391°E), Schwerpunkt Mittelwald, Leitung Hans Seitz, Naturraum 131 – Windsheimer Bucht
4.) Sa 12. Juli, TK 6435/1 Pommelsbrunn, TP Hartenstein Kirche (49,59627°N/11,52337°E), Submontane Flora, Leitung Bernhard Lang, Naturraum 080.2 – Gräfenberger Flächenalb
5.) Sa 2. August, TK 6331/1 Röttenbach, TP SW-Ortsende Röttenbach, Wegkreuzung am Ende der Hannberger-Str. (49,66443°N/10,91559°E), Schwerpunkt Sandflora, Leitung Harald Schott, Naturraum 113.7 – Aischtal und Aischgrund
6.) Sa 6. September, TK 6929/4 Wassertrüdingen, TP Herrenweiher NE Auhausen, (49,01347°N/10,62759°E), Gemeinschaftsexkursion mit der Arge Flora Nordschwaben, Leitung Günther Kunzmann, Naturraum 110.1 – Hesselberg-Liasplatten
7.) Sa 13. September, TK 5934/2 Thurnau, TP Rohr (an der B 85) Ortsmitte (50,05677°N/11,47835°E), Aue Roter Main (Cirsium canum), örtliche Ruderalflora (Bryonia alba), Leitung Georg Hetzel und Gerhard Schillai, Naturraum 117.3 – Lichtenfelser Maintal
Es liegt im berechtigten Interesse des Vereins, Mitglieder und Öffentlichkeit über seine Mitgliederversammlungen und Exkursionen zu informieren. Zu diesem Zweck werden Bildaufnahmen gemacht und in der Vereinszeitschrift veröffentlicht (print/online). Wer nicht abgebildet sein möchte, muss dies vor der Veranstaltung der Versammlungs-/Exkursionsleitung mitteilen.
Wir bitten unsere Mitglieder um rege Teilnahme an den Exkursionen. Sie finden grundsätzlich bei jeder Witterung statt.
Handy J. Wagenknecht 0160 95912693
G. Schillai 0159 08484951
Mit besten Grüßen
Dr. Rudolf Kötter und Annika Lange
(1. Vorsitzender) (Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit)
Quelle / Abbildungen
VEREIN zur Erforschung der FLORA des REGNITZGEBIETES e.V.
Schwalbenweg 15
91056 Erlangen
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung. Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Exkursionen 2025
Abkürzungen: TK = Topographische Karte 1:25 000; TP = Treffpunkt
1.) Sa 31. Mai, TK 6532/4 Nürnberg, TP Langwasser-Süd, Endhaltestelle U 1 (49,39854°N/11,14072°E) Achtung: der TP liegt außerhalb des Ziel-TK), Flora einer Trabantensiedlung: Scherrasen und urbane Gehölzbestände im Bereich Liegnitzer-, Gleiwitzer- und Breslauer Str., Schwerpunkt Lysichiton americanus, Leitung Georg Hetzel und Gerhard Schillai, Naturraum 113.6 – Nürnberger Becken
2.) Sa 7. Juni, TK 6231/1 Adelsdorf, TP Zentbechhofen Keller (49,75924°N/10,90031°E), Schwerpunkt Äcker auf Kalk und Sand, Leitung Harald Schott, Naturraum 113. 7 – Aischtal und Aischgrund.
3.) Sa 14. Juni, TK 6428/1 Bad Windsheim, TP Humprechtsau Kirche (49,55764°N/10,391°E), Schwerpunkt Mittelwald, Leitung Hans Seitz, Naturraum 131 – Windsheimer Bucht
4.) Sa 12. Juli, TK 6435/1 Pommelsbrunn, TP Hartenstein Kirche (49,59627°N/11,52337°E), Submontane Flora, Leitung Bernhard Lang, Naturraum 080.2 – Gräfenberger Flächenalb
5.) Sa 2. August, TK 6331/1 Röttenbach, TP SW-Ortsende Röttenbach, Wegkreuzung am Ende der Hannberger-Str. (49,66443°N/10,91559°E), Schwerpunkt Sandflora, Leitung Harald Schott, Naturraum 113.7 – Aischtal und Aischgrund
6.) Sa 6. September, TK 6929/4 Wassertrüdingen, TP Herrenweiher NE Auhausen, (49,01347°N/10,62759°E), Gemeinschaftsexkursion mit der Arge Flora Nordschwaben, Leitung Günther Kunzmann, Naturraum 110.1 – Hesselberg-Liasplatten
7.) Sa 13. September, TK 5934/2 Thurnau, TP Rohr (an der B 85) Ortsmitte (50,05677°N/11,47835°E), Aue Roter Main (Cirsium canum), örtliche Ruderalflora (Bryonia alba), Leitung Georg Hetzel und Gerhard Schillai, Naturraum 117.3 – Lichtenfelser Maintal
Es liegt im berechtigten Interesse des Vereins, Mitglieder und Öffentlichkeit über seine Mitgliederversammlungen und Exkursionen zu informieren. Zu diesem Zweck werden Bildaufnahmen gemacht und in der Vereinszeitschrift veröffentlicht (print/online). Wer nicht abgebildet sein möchte, muss dies vor der Veranstaltung der Versammlungs-/Exkursionsleitung mitteilen.
- Beginn der Exkursionen jeweils 10.00 Uhr
Wir bitten unsere Mitglieder um rege Teilnahme an den Exkursionen. Sie finden grundsätzlich bei jeder Witterung statt.
- Gäste sind stets sehr herzlich willkommen.
Handy J. Wagenknecht 0160 95912693
G. Schillai 0159 08484951
Mit besten Grüßen
Dr. Rudolf Kötter und Annika Lange
(1. Vorsitzender) (Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit)
Quelle / Abbildungen
VEREIN zur Erforschung der FLORA des REGNITZGEBIETES e.V.
Schwalbenweg 15
91056 Erlangen
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung. Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Artenschutz in Franken®
Der Schwarze Schnegel (Limax cinereoniger)

Der Schwarze Schnegel (Limax cinereoniger) – Ein ökologisch bedeutsamer Bewohner naturnaher Wälder
20/21.05.2025
Mit einer Körperlänge von bis zu 20 cm – in Ausnahmefällen auch darüber hinaus – ist er die größte heimische Landschnecke und fällt durch seine Größe sowie durch das meist dunkelgraue bis schwärzliche, manchmal auch marmorierte oder gefleckte Erscheinungsbild auf. Sein Vorkommen gilt als Indikator für naturnahe, alte Laub- und Mischwälder mit hoher Habitatkontinuität.
20/21.05.2025
- Der Schwarze Schnegel (Limax cinereoniger) ist eine der größten in Europa vorkommenden Nacktschneckenarten und zählt zur Familie der Schnegel (Limacidae).
Mit einer Körperlänge von bis zu 20 cm – in Ausnahmefällen auch darüber hinaus – ist er die größte heimische Landschnecke und fällt durch seine Größe sowie durch das meist dunkelgraue bis schwärzliche, manchmal auch marmorierte oder gefleckte Erscheinungsbild auf. Sein Vorkommen gilt als Indikator für naturnahe, alte Laub- und Mischwälder mit hoher Habitatkontinuität.
Verbreitung und Lebensraum
Limax cinereoniger ist in weiten Teilen Europas verbreitet, wobei der Verbreitungsschwerpunkt in Mitteleuropa liegt. Die Art bevorzugt kühle, feuchte und strukturreiche Wälder mit einem hohen Anteil an Totholz und dauerhaft schattigen Mikroklimaten. Besonders häufig findet man den Schwarzen Schnegel in alten Buchenwäldern, Schluchtwäldern sowie in moosreichen, humusreichen Bodengesellschaften. Aufgrund seiner hohen Habitatansprüche ist sein Vorkommen stark an ökologische Stabilität gebunden und er gilt als empfindlich gegenüber forstwirtschaftlichen Eingriffen, Habitatfragmentierung und Bodenversauerung.
Lebensweise und Ernährung
Der Schwarze Schnegel ist vorwiegend nachtaktiv und versteckt sich tagsüber unter Rinde, in Totholz, unter Steinen oder im Laub. Seine Fortbewegung ist – trotz seiner Größe – relativ elegant und gleichmäßig. Anders als viele Nacktschnecken ernährt sich Limax cinereoniger nicht von lebenden Pflanzen, sondern bevorzugt abgestorbenes pflanzliches Material, Pilze und Detritus. Auch andere tote Tiere oder Eier von Schnecken werden nicht verschmäht. Damit erfüllt der Schnegel eine wichtige ökologische Rolle im Nährstoffkreislauf des Waldes, indem er organische Substanz abbaut und dem Bodenleben wieder zuführt.
Fortpflanzung und Entwicklung
Die Art ist zwittrig (hermaphroditisch) und zeigt ein bemerkenswertes Paarungsverhalten, bei dem die Tiere an einem Schleimfaden hängend kopulieren können – ein für Schnegel typisches Verhalten. Die Eiablage erfolgt meist im Spätsommer bis Herbst. Die Jungtiere schlüpfen im darauffolgenden Frühjahr. Aufgrund ihrer langsamen Entwicklung und der Langlebigkeit der Tiere (bis zu 3 Jahre) ist der Schwarze Schnegel besonders empfindlich gegenüber Störungen des Lebensraumes.
Naturschutzfachliche Bedeutung
Als typischer Bewohner alter, strukturreicher Waldstandorte mit hoher Feuchtigkeit stellt Limax cinereoniger einen bedeutenden Zeiger für habitatgereifte, weitgehend ungestörte Waldökosysteme dar. Sein Vorhandensein kann in der naturschutzfachlichen Bewertung von Waldflächen als Hinweis auf ein günstiges mikroklimatisches und strukturelles Milieu gewertet werden. Die Art ist in vielen Regionen rückläufig und steht in mehreren Bundesländern auf den Roten Listen gefährdeter Tierarten. Hauptgefährdungsursachen sind die Intensivierung der Forstwirtschaft, der Rückgang von Alt- und Totholzbeständen, Bodenverdichtung sowie klimabedingte Austrocknung von Lebensräumen.
Fazit
Der Schwarze Schnegel ist weit mehr als eine unscheinbare Waldbewohnerin. Durch seine ökologische Funktion als Zersetzer, seine besondere Habitatbindung und seine Bedeutung als Indikatorart für naturnahe, biodiverse Wälder kommt ihm eine hohe Bedeutung im Rahmen des Waldschutzes und der Biodiversitätsforschung zu. Der Schutz und die Förderung seiner Lebensräume – insbesondere durch die Erhaltung von Alt- und Totholz, die Förderung von Strukturreichtum sowie die Vermeidung großflächiger Eingriffe – sind entscheidend für den Fortbestand dieser bemerkenswerten Art.
In der Aufnahme
Limax cinereoniger ist in weiten Teilen Europas verbreitet, wobei der Verbreitungsschwerpunkt in Mitteleuropa liegt. Die Art bevorzugt kühle, feuchte und strukturreiche Wälder mit einem hohen Anteil an Totholz und dauerhaft schattigen Mikroklimaten. Besonders häufig findet man den Schwarzen Schnegel in alten Buchenwäldern, Schluchtwäldern sowie in moosreichen, humusreichen Bodengesellschaften. Aufgrund seiner hohen Habitatansprüche ist sein Vorkommen stark an ökologische Stabilität gebunden und er gilt als empfindlich gegenüber forstwirtschaftlichen Eingriffen, Habitatfragmentierung und Bodenversauerung.
Lebensweise und Ernährung
Der Schwarze Schnegel ist vorwiegend nachtaktiv und versteckt sich tagsüber unter Rinde, in Totholz, unter Steinen oder im Laub. Seine Fortbewegung ist – trotz seiner Größe – relativ elegant und gleichmäßig. Anders als viele Nacktschnecken ernährt sich Limax cinereoniger nicht von lebenden Pflanzen, sondern bevorzugt abgestorbenes pflanzliches Material, Pilze und Detritus. Auch andere tote Tiere oder Eier von Schnecken werden nicht verschmäht. Damit erfüllt der Schnegel eine wichtige ökologische Rolle im Nährstoffkreislauf des Waldes, indem er organische Substanz abbaut und dem Bodenleben wieder zuführt.
Fortpflanzung und Entwicklung
Die Art ist zwittrig (hermaphroditisch) und zeigt ein bemerkenswertes Paarungsverhalten, bei dem die Tiere an einem Schleimfaden hängend kopulieren können – ein für Schnegel typisches Verhalten. Die Eiablage erfolgt meist im Spätsommer bis Herbst. Die Jungtiere schlüpfen im darauffolgenden Frühjahr. Aufgrund ihrer langsamen Entwicklung und der Langlebigkeit der Tiere (bis zu 3 Jahre) ist der Schwarze Schnegel besonders empfindlich gegenüber Störungen des Lebensraumes.
Naturschutzfachliche Bedeutung
Als typischer Bewohner alter, strukturreicher Waldstandorte mit hoher Feuchtigkeit stellt Limax cinereoniger einen bedeutenden Zeiger für habitatgereifte, weitgehend ungestörte Waldökosysteme dar. Sein Vorhandensein kann in der naturschutzfachlichen Bewertung von Waldflächen als Hinweis auf ein günstiges mikroklimatisches und strukturelles Milieu gewertet werden. Die Art ist in vielen Regionen rückläufig und steht in mehreren Bundesländern auf den Roten Listen gefährdeter Tierarten. Hauptgefährdungsursachen sind die Intensivierung der Forstwirtschaft, der Rückgang von Alt- und Totholzbeständen, Bodenverdichtung sowie klimabedingte Austrocknung von Lebensräumen.
Fazit
Der Schwarze Schnegel ist weit mehr als eine unscheinbare Waldbewohnerin. Durch seine ökologische Funktion als Zersetzer, seine besondere Habitatbindung und seine Bedeutung als Indikatorart für naturnahe, biodiverse Wälder kommt ihm eine hohe Bedeutung im Rahmen des Waldschutzes und der Biodiversitätsforschung zu. Der Schutz und die Förderung seiner Lebensräume – insbesondere durch die Erhaltung von Alt- und Totholz, die Förderung von Strukturreichtum sowie die Vermeidung großflächiger Eingriffe – sind entscheidend für den Fortbestand dieser bemerkenswerten Art.
In der Aufnahme
- Schwarzer Schnegel an Totholz
Artenschutz in Franken®
Artenschutz in Franken®

Artenschutz in Franken®
Artenschutz als Zeichen einer ethisch-moralischen Verpflichtung, diesem Anspruch gegenüber uns begleitenden Mitgeschöpfen und deren Lebens-räume, stellen wir uns seit nunmehr fast 30 Jahren mit zahlreichen Partnern tagtäglich auf vielfältiger Art aufs Neue.
In vollkommen ehrenamtlicher, wirtschaftlich- und politisch sowie konfessionell unabhängiger Form engagieren wir uns hier mit unseren vielen Mitgliedern in abertausenden von Stunden.
Trotz der auf Franken ausgerichteten Namensgebung bundesweit für die Erhaltung der Biodiversität, sowie für eine lebendige, pädagogisch hochwertige Umweltbildung.
Artenschutz als Zeichen einer ethisch-moralischen Verpflichtung, diesem Anspruch gegenüber uns begleitenden Mitgeschöpfen und deren Lebens-räume, stellen wir uns seit nunmehr fast 30 Jahren mit zahlreichen Partnern tagtäglich auf vielfältiger Art aufs Neue.
In vollkommen ehrenamtlicher, wirtschaftlich- und politisch sowie konfessionell unabhängiger Form engagieren wir uns hier mit unseren vielen Mitgliedern in abertausenden von Stunden.
Trotz der auf Franken ausgerichteten Namensgebung bundesweit für die Erhaltung der Biodiversität, sowie für eine lebendige, pädagogisch hochwertige Umweltbildung.
In einer Dekade in der zunehmend Veränderungen, auch klimatischer Weise erkennbar werden, kommt nach unserem Dafürhalten der effektiven Erhaltung heimischer Artenvielfalt auch und gerade im Sinne einer auf-geklärten Gesellschaft eine heraus-ragende Bedeutung zu.
Der Artenschwund hat er-schreckende Ausmaße ange-nommen, welche den Eindruck der zunehmenden Leere für den aufmerksamen Betrachter deutlich erkennbar werden lässt. Eine ausge-storbene Art ist für nahezu alle Zeit verloren. Mit ihr verlieren wir eine hochwertige, einzigartige Ressource die sich den Umweltbedingungen seit meist Millionen von Jahren anpassen konnte.
Wir sollten uns den Luxus nicht leisten dieser Artenreduktion untätig zuzusehen. Nur eine möglichst hohe genetische Artenvielfalt kann die Entstehung neuer Arten effektiv ansteuern.
Im Sinne uns nachfolgender Generationen, also unserer Kinder und unserer Enkelkinder, sollten wir uns gemeinsam dazu durchringen dem galoppierenden Artenschwund Paroli zu bieten.
Nur gemeinsam wird und kann es uns gelingen diesem sicherlich nicht leichtem Unterfangen erfolgreich zu begegnen. Ohne dies jedoch jemals versucht zu haben, werden wir nie erkennen ob wir dazu in der Lage sind oder waren.
Durchdachter Artenschutz ist in unseren Augen mehr als eine Ideologie.
Er beweist in eindrucksvoller Art die Verbundenheit mit einer einzigartigen Heimat und deren sich darin befindlichen Lebensformen. Schöpfung lebendig bewahren, für uns ge-meinsam mehr als „nur“ ein Lippenbekenntnis.
Artenschutz ist für uns gleichfalls Lebensraumsicherung für den modernen Menschen.
Nur in einer intakten, vielfältigen Umwelt wird auch der Mensch die Chance erhalten nachhaltig zu überdauern. Hierfür setzten wir uns täglich vollkommen ehrenamtlich und unabhängig im Sinne unserer Mit-geschöpfe, jedoch auch ganz bewusst im Sinne unserer Mitbürger und vor allem der uns nachfolgenden Generation von ganzem Herzen ein.
Artenschutz in Franken®
Der Artenschwund hat er-schreckende Ausmaße ange-nommen, welche den Eindruck der zunehmenden Leere für den aufmerksamen Betrachter deutlich erkennbar werden lässt. Eine ausge-storbene Art ist für nahezu alle Zeit verloren. Mit ihr verlieren wir eine hochwertige, einzigartige Ressource die sich den Umweltbedingungen seit meist Millionen von Jahren anpassen konnte.
Wir sollten uns den Luxus nicht leisten dieser Artenreduktion untätig zuzusehen. Nur eine möglichst hohe genetische Artenvielfalt kann die Entstehung neuer Arten effektiv ansteuern.
Im Sinne uns nachfolgender Generationen, also unserer Kinder und unserer Enkelkinder, sollten wir uns gemeinsam dazu durchringen dem galoppierenden Artenschwund Paroli zu bieten.
Nur gemeinsam wird und kann es uns gelingen diesem sicherlich nicht leichtem Unterfangen erfolgreich zu begegnen. Ohne dies jedoch jemals versucht zu haben, werden wir nie erkennen ob wir dazu in der Lage sind oder waren.
Durchdachter Artenschutz ist in unseren Augen mehr als eine Ideologie.
Er beweist in eindrucksvoller Art die Verbundenheit mit einer einzigartigen Heimat und deren sich darin befindlichen Lebensformen. Schöpfung lebendig bewahren, für uns ge-meinsam mehr als „nur“ ein Lippenbekenntnis.
Artenschutz ist für uns gleichfalls Lebensraumsicherung für den modernen Menschen.
Nur in einer intakten, vielfältigen Umwelt wird auch der Mensch die Chance erhalten nachhaltig zu überdauern. Hierfür setzten wir uns täglich vollkommen ehrenamtlich und unabhängig im Sinne unserer Mit-geschöpfe, jedoch auch ganz bewusst im Sinne unserer Mitbürger und vor allem der uns nachfolgenden Generation von ganzem Herzen ein.
Artenschutz in Franken®
25. Jahre Artenschutz in Franken®

25. Jahre Artenschutz in Franken®
Am 01.03.2021 feierte unsere Organisation ein Vierteljahrhundert ehrenamlichen und vollkommen unabhängigen Artenschutz und erlebbare Umweltbildung.
Am 01.03.2021 feierte unsere Organisation ein Vierteljahrhundert ehrenamlichen und vollkommen unabhängigen Artenschutz und erlebbare Umweltbildung.
Und auch nach 25 Jahren zeigt sich unser Engagement keineswegs als "überholt". Im Gegenteil es wird dringender gebraucht denn je.
Denn die immensen Herausforderungen gerade auf diesem Themenfeld werden unsere Gesellschaft zukünftig intensiv fordern!
Hinweis zum 15.jährigen Bestehen.
Aus besonderem Anlass und zum 15.jährigen Bestehen unserer Organisation ergänzten wir unsere namensgebende Bezeichnung.
Der Zusatz Artenschutz in Franken® wird den Ansprüchen eines modernen und zunehmend auch überregional agierenden Verbandes gerecht.
Vormals auf die Region des Steiger-waldes beschränkt setzt sich Artenschutz in Franken® nun vermehrt in ganz Deutschland und darüber hinaus ein.
Die Bezeichnung ändert sich, was Bestand haben wird ist weiterhin das ehrenamliche und unabhängige Engagement das wir für die Belange des konkreten Artenschutzes, sowie einer lebendigen Umweltbildung in einbringen.
Im Sinne uns nachfolgender Generationen!
Auf unserer Internetpräsenz möchten wir unser ehrenamtliches Engagement näher vorstellen.
Artenschutz in Franken®
Denn die immensen Herausforderungen gerade auf diesem Themenfeld werden unsere Gesellschaft zukünftig intensiv fordern!
Hinweis zum 15.jährigen Bestehen.
Aus besonderem Anlass und zum 15.jährigen Bestehen unserer Organisation ergänzten wir unsere namensgebende Bezeichnung.
Der Zusatz Artenschutz in Franken® wird den Ansprüchen eines modernen und zunehmend auch überregional agierenden Verbandes gerecht.
Vormals auf die Region des Steiger-waldes beschränkt setzt sich Artenschutz in Franken® nun vermehrt in ganz Deutschland und darüber hinaus ein.
Die Bezeichnung ändert sich, was Bestand haben wird ist weiterhin das ehrenamliche und unabhängige Engagement das wir für die Belange des konkreten Artenschutzes, sowie einer lebendigen Umweltbildung in einbringen.
Im Sinne uns nachfolgender Generationen!
Auf unserer Internetpräsenz möchten wir unser ehrenamtliches Engagement näher vorstellen.
Artenschutz in Franken®
Kleinvogel gefunden - und jetzt?

Kleinvogel gefunden - und jetzt?
Wie verhalte ich mich beim Fund eines noch nicht flugfähigen Kleinvogels richtig?
Regelmäßig erreichen uns Anfragen die sich auf den korrekten Umgang des Tieres beim „Fund“ eines noch nicht flugfähigen Kleinvogels beziehen.
Wir vom Artenschutz in Franken® haben hier einige Informationen für Sie zusammengestellt.
Wir erklären dir das Vorgehen und die in unseren Augen wichtigsten Dos und Don'ts bei einem Fund eines kleinen, noch nicht flugfähigen Vogels in Form eines einfachen, einprägsamen Mnemonics, den du leicht merken kannst: "VOGEL"
Wie verhalte ich mich beim Fund eines noch nicht flugfähigen Kleinvogels richtig?
Regelmäßig erreichen uns Anfragen die sich auf den korrekten Umgang des Tieres beim „Fund“ eines noch nicht flugfähigen Kleinvogels beziehen.
Wir vom Artenschutz in Franken® haben hier einige Informationen für Sie zusammengestellt.
Wir erklären dir das Vorgehen und die in unseren Augen wichtigsten Dos und Don'ts bei einem Fund eines kleinen, noch nicht flugfähigen Vogels in Form eines einfachen, einprägsamen Mnemonics, den du leicht merken kannst: "VOGEL"
Jeder Buchstabe im Wort "VOGEL" steht dabei für einen wichtigen Schritt oder Hinweis:
V - Verhalten beobachten:
• Dos: Bevor du irgendetwas tust, beobachte den Vogel aus der Ferne. Manchmal (Meistens) sind die Eltern in der Nähe und kümmern sich um ihn.
• Don'ts: Den Vogel sofort anfassen oder wegtragen, ohne die Situation zu analysieren.
O - Ort sichern:
• Dos: Sicherstellen, dass der Vogel nicht durch Menschen, Hunde oder Katzen gefährdet ist.
• Don'ts: Den Vogel in gefährliche Bereiche lassen, wo er leicht verletzt werden kann.
G - Gesundheit prüfen:
• Dos: Prüfe vorsichtig, ob der Vogel verletzt ist. Wenn er offensichtlich verletzt ist, kontaktiere eine Wildtierauffangstation oder einen Tierarzt. Wende dich auch an die für die Örtlichkeit zuständige fachliche Einrichtung wie Naturschutzfachbehörde oder Umweltämter.
• Don'ts: Keine medizinische Erstversorgung versuchen, wenn du keine Erfahrung damit hast.
E - Eltern suchen:
• Dos: Versuche herauszufinden, ob die Eltern in der Nähe sind. Elternvögel kehren oft zurück, um ihre Jungen zu füttern.
• Don'ts: Den Vogel nicht sofort mitnehmen, da die Eltern ihn weiterhin versorgen könnten.
L - Letzte Entscheidung:
• Dos: Wenn der Vogel in Gefahr ist oder die Eltern nicht zurückkehren, kontaktiere eine Wildtierstation oder einen Experten für Rat und weitere Schritte.
• Don'ts: Den Vogel nicht ohne fachkundigen Rat mit nach Hause nehmen oder füttern, da falsche Pflege oft mehr schadet als hilft.
Zusammenfassung
• Verhalten beobachten: Erst schauen, nicht gleich handeln.
• Ort sichern: Gefahrenquelle ausschalten.
• Gesundheit prüfen: Verletzungen erkennen.
• Eltern suchen: Eltern in der Nähe?
• Letzte Entscheidung: Bei Gefahr oder verlassener Brut Wildtierstation kontaktieren.
Mit diesem Mnemonic kannst du dir so finden wir vom Artenschutz in Franken® recht leicht merken, wie du dich verhalten sollst, wenn du einen kleinen, noch nicht flugfähigen Vogel findest.
Wichtig!
- Bitte beachte jedoch dabei immer den Eigenschutz, denn die Tier können Krankheiten übertragen die auch für den Menschen gefährlich werden können. Deshalb raten wir vornehmlich ... immer Finger weg - Fachleute kontaktieren!
Wir vom Artenschutz in Franken® sind keine und unterhalten auch kein Tierpflegestelle da wir uns in erster Linie mit der Lebensraumsicherung und Lebensraumschaffung befassen.
Artenschutz in Franken®
Rechtliches §

Immer wieder werden wir gefragt welche rechtlichen Grundlagen es innerhalb der Naturschutz- und Tierschutzgesetze es gibt.
Wir haben einige Infos zu diesem Thema hier verlinkt:
Wir haben einige Infos zu diesem Thema hier verlinkt:
Bayerisches Naturschutzgesetz – BayNatSchG
http://www.gesetze-bayern.de/(X(1)S(fhnsotp2iqyyotymmjumqonn))/Content/Document/BayNatSchG?AspxAutoDetectCookieSupport=1
Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege
https://www.gesetze-im-internet.de/bnatschg_2009/
Tierschutzgesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/tierschg/BJNR012770972.html
http://www.gesetze-bayern.de/(X(1)S(fhnsotp2iqyyotymmjumqonn))/Content/Document/BayNatSchG?AspxAutoDetectCookieSupport=1
Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege
https://www.gesetze-im-internet.de/bnatschg_2009/
Tierschutzgesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/tierschg/BJNR012770972.html
Unser Engagement

Mehr über unser Engagement finden Sie hier:
Die Artenschutz im Steigerwald/Artenschutz in Franken®- Nachhaltigkeits-vereinbarung
www.artenschutz-steigerwald.de/de/Ueber-Uns/1001349/AiF_-_Nachhaltigkeitsvereinbarung/
Über uns
www.artenschutz-steigerwald.de/de/Ueber-Uns/
Impressum/Satzung
www.artenschutz-steigerwald.de/de/Impressum/
www.artenschutz-steigerwald.de/de/Ueber-Uns/1001349/AiF_-_Nachhaltigkeitsvereinbarung/
Über uns
www.artenschutz-steigerwald.de/de/Ueber-Uns/
Impressum/Satzung
www.artenschutz-steigerwald.de/de/Impressum/
Nachgedacht

Ein Gedicht zum Verlust der Biodiversität in unserem Land.
Artenschwund
In allen Medien tun sie es kund, bedenklich ist der Artenschwund.
Begonnen hat es schon sehr bald, durch Abholzung im Regenwald. Nicht nur um edle Hölzer zu gewinnen, man fing schließlich an zu „spinnen“. Durch Brandrodung ließ man es qualmen, und pflanzte dort dann nur noch Palmen.
Das fand die Industrie ganz prima, doch heute bejammern wir das Klima. Aber es betrifft nicht nur ferne Lande, auch bei uns ist es `ne Schande. Dass Wälder dem Profit zum Opfer fallen, dies schadet schließlich doch uns Allen.
Artenschwund
In allen Medien tun sie es kund, bedenklich ist der Artenschwund.
Begonnen hat es schon sehr bald, durch Abholzung im Regenwald. Nicht nur um edle Hölzer zu gewinnen, man fing schließlich an zu „spinnen“. Durch Brandrodung ließ man es qualmen, und pflanzte dort dann nur noch Palmen.
Das fand die Industrie ganz prima, doch heute bejammern wir das Klima. Aber es betrifft nicht nur ferne Lande, auch bei uns ist es `ne Schande. Dass Wälder dem Profit zum Opfer fallen, dies schadet schließlich doch uns Allen.
Ob Kahlschlag in Skandinavien, oder hier, die Dummen, das sind immer wir. Was unser Klima wirklich erhält, wurde zum großen Teil gefällt.
Es beginnt doch schon im Kleinen, an Straßen- und an Wegesrainen. Dort wird gemäht, ganz ohne Not, dies ist vieler Tiere Tod. Moderne Maschinen zu unserem Schrecken, lassen Schmetterlingsraupen
kläglich verrecken. Weil von den Raupen niemand profitiert, dies dann auch kaum Jemand interes-siert. Doch der Jammer ist schon groß; wo bleiben die Schmetterlinge bloß?
Auch unser Obst ist in Gefahr, denn die Bienen werden rar. Wir uns deshalb ernsthaft fragen, wer wird in Zukunft die Pollen übertragen. Eine
eingeschleppte Milbe ist der Bienen Tod und die Imker leiden Not. Dazu spritzt man noch Neonikotinoide und Glyphosat, damit man reiche Ernte hat. Das vergiftet nicht nur Tiere, sondern jetzt auch viele Biere. Glyphosat soll krebserregend sein, doch das kümmert hier kein Schwein.
Hauptsache es rollt weiterhin der Kiesel, denn man hat ja noch den Diesel. Der ist jetzt an Allem schuld und man gönnt ihm keine Huld. Elektrofahrzeuge sind die neue Devise, doch verhindern diese wirklich unsere Krise? Braunkohle und Atom, erzeugen zumeist unseren Strom. Wie nun jeder Bürger weiß, ist auch dieses Thema
heiß.
Gäbe es immerzu Sonnenschein, wäre Solarenergie fein. Aber da sind ja noch die Windanlagen, die hoch in den Himmel ragen. Wo sie dann an manchen Tagen, Vögel in der Luft erschlagen. Diese zogen erst von Süden fort, entkamen knapp dem Vogelmord. Nun hat es sie doch noch erwischt, nur werden sie hier nicht aufgetischt.
Wie haben die Ortolane schön ge-sungen, nun liegen auf dem Teller ihre Zungen. War das schön, als sie noch lebten, bevor sie auf `ner Rute klebten. Immer weniger wird ihr Gesang, uns wird es langsam angst und bang .Gesetze wurden
zwar gemacht, sie werden jedoch zumeist belacht. Wenn Vögel brutzeln in Pfanne und Schüssel, wen interessiert da das „Geschwätz“ aus Brüssel.
Es gibt ein paar Leute, die sind vor Ort und stellen sich gegen den Vogelmord. Die wenigen, die es wagen, riskieren dabei Kopf und Kragen. Wenn sie beseitigen Ruten und Fallen, oder hindern Jäger, Vögel abzuknallen. Riesige Netze, so stellen wir fest, geben den Vögeln nun noch den Rest. Wir sollten dies schnellstens verhindern, sonst werden wir mit unseren Kindern, bald keinen Vogelsang mehr hören. So manchen würde das kaum stören, doch mit diesem Artenschwund, schlägt irgendwann auch unsere Stund`.
Quelle
Hubertus Zinnecker
Es beginnt doch schon im Kleinen, an Straßen- und an Wegesrainen. Dort wird gemäht, ganz ohne Not, dies ist vieler Tiere Tod. Moderne Maschinen zu unserem Schrecken, lassen Schmetterlingsraupen
kläglich verrecken. Weil von den Raupen niemand profitiert, dies dann auch kaum Jemand interes-siert. Doch der Jammer ist schon groß; wo bleiben die Schmetterlinge bloß?
Auch unser Obst ist in Gefahr, denn die Bienen werden rar. Wir uns deshalb ernsthaft fragen, wer wird in Zukunft die Pollen übertragen. Eine
eingeschleppte Milbe ist der Bienen Tod und die Imker leiden Not. Dazu spritzt man noch Neonikotinoide und Glyphosat, damit man reiche Ernte hat. Das vergiftet nicht nur Tiere, sondern jetzt auch viele Biere. Glyphosat soll krebserregend sein, doch das kümmert hier kein Schwein.
Hauptsache es rollt weiterhin der Kiesel, denn man hat ja noch den Diesel. Der ist jetzt an Allem schuld und man gönnt ihm keine Huld. Elektrofahrzeuge sind die neue Devise, doch verhindern diese wirklich unsere Krise? Braunkohle und Atom, erzeugen zumeist unseren Strom. Wie nun jeder Bürger weiß, ist auch dieses Thema
heiß.
Gäbe es immerzu Sonnenschein, wäre Solarenergie fein. Aber da sind ja noch die Windanlagen, die hoch in den Himmel ragen. Wo sie dann an manchen Tagen, Vögel in der Luft erschlagen. Diese zogen erst von Süden fort, entkamen knapp dem Vogelmord. Nun hat es sie doch noch erwischt, nur werden sie hier nicht aufgetischt.
Wie haben die Ortolane schön ge-sungen, nun liegen auf dem Teller ihre Zungen. War das schön, als sie noch lebten, bevor sie auf `ner Rute klebten. Immer weniger wird ihr Gesang, uns wird es langsam angst und bang .Gesetze wurden
zwar gemacht, sie werden jedoch zumeist belacht. Wenn Vögel brutzeln in Pfanne und Schüssel, wen interessiert da das „Geschwätz“ aus Brüssel.
Es gibt ein paar Leute, die sind vor Ort und stellen sich gegen den Vogelmord. Die wenigen, die es wagen, riskieren dabei Kopf und Kragen. Wenn sie beseitigen Ruten und Fallen, oder hindern Jäger, Vögel abzuknallen. Riesige Netze, so stellen wir fest, geben den Vögeln nun noch den Rest. Wir sollten dies schnellstens verhindern, sonst werden wir mit unseren Kindern, bald keinen Vogelsang mehr hören. So manchen würde das kaum stören, doch mit diesem Artenschwund, schlägt irgendwann auch unsere Stund`.
Quelle
Hubertus Zinnecker
Ein Frühsommer-Bild aus Schleswig-Holstein

Ein Frühsommer-Bild aus Schleswig-Holstein ...da wir jedoch im ganzen Land wiederfinden!
Eine weite Grünlandniederung, vier riesige Mähmaschinen fahren nebeneinander mit rasanter Geschwindigkeit über ein Areal von einigen hundert Hektar Wiesen.
Wo gestern noch zahlreiche Feldvögel sangen und ihre Jungen fütterten, Wiesen- und Rohrweihen jagten, ein Sumpfohreulenpaar balzte und offensichtlich einen Brutplatz hatte, bietet sich heute ein Bild der Zerstörung. Kiebitze und Brachvögel rufen verzweifelt und haben ihre Gelege verloren.
Eine weite Grünlandniederung, vier riesige Mähmaschinen fahren nebeneinander mit rasanter Geschwindigkeit über ein Areal von einigen hundert Hektar Wiesen.
Wo gestern noch zahlreiche Feldvögel sangen und ihre Jungen fütterten, Wiesen- und Rohrweihen jagten, ein Sumpfohreulenpaar balzte und offensichtlich einen Brutplatz hatte, bietet sich heute ein Bild der Zerstörung. Kiebitze und Brachvögel rufen verzweifelt und haben ihre Gelege verloren.
Schafstelzen, Wiesenpieper und Feldlerchen hüpfen mit Würmern im Schnabel auf der Suche nach ihren längst zerstückelten Jungvögeln verzweifelt über den Boden.
Alles nichts Neues.
Das kennen wir ja. Das BNatSchG §44 erlaubt es ja schließlich gemäß der „guten fachliche Praxis“, streng geschützte Vogelarten zu töten - denn verboten ist es ja nur „ohne sinnvollen Grund“.
Aber was ist an dieser uns allen bekannten Situation anders als noch vor 10, 20 Jahren?
Die Mähmaschinen sind größer und stärker denn je, schneller denn je, mähen tiefer denn je, mähen in immer kürzeren Intervallen, mähen die Gräben bis tief in jede Grabenböschung mit ab.
Wie zum Hohn kommt nun noch ein weiterer Trecker und mäht alle Stauden der Wegesränder ab, scheinbar um das letzte verbliebene Wiesenpieper- oder Blaukehlchennnest dann auch noch zu erwischen.
23.00h: Es wird dunkel, es wird weiter gemäht. Ich denke an die Wiesenweihen, den gerade erschienenen Artikel aus der Zeitschrift dem Falken: " bei nächtlicher Mahd bleiben die adulten Weihen auf dem Nest sitzen und werden mit getötet“.
Wo ist unsere Landwirtschaft hingekommen, dass jetzt hier 4 Maschinen der neusten Generation parallel nebeneinander in rasendem Tempo mähen, dahinter wird schon gewendet und das Gras abtransportiert.
Nicht ein junger Vogel, nicht ein junger Hase hat hier die geringste Chance, noch zu entkommen.
Früher habe ich nach der Mahd noch junge Kiebitze und junge Hasen gesehen, die überlebt haben. Früher hat ein Bauer noch das Mähwerk angehoben, wenn er von oben ein Kiebitznest gesehen hat.
Hier ist nun nichts mehr, nur hunderte von Krähen und Möwen, die sich über das „Fastfood“ freuen (und nebenbei bemerkt damit einen äußerst wichtigen Beitrag zur Beseitigung von Clostridien leisten, welche die Silage verunreinigen und damit den Rinderbestand gefährden könnten - gedankt wird es den Krähen aber natürlich nicht)
Diese Entwicklung der Grünlandbewirtschaftung ist sehr besorgniserregend, nicht nur für den Vogel des Jahres, die Feldlerche. Das Wettrüsten der Landwirte ist verständlich aus deren wirtschaftlicher Sicht, aber eine ökologische Vollkatastrophe und das Ergebnis einer verfehlten Agrarpolitik.
Was ist denn der „sinnvolle Grund“, der diese Entwicklung überhaupt zulässt?
Dass die Milch und das Fleisch immer noch billiger werden, und dafür das letzte Stück Natur geschreddert wird? Ist das wirklich im Sinne der Allgemeinheit, denn es sind doch nicht nur wir Naturschützer*innen und Vogelkundler*innen, die sich über blühende Wiesen und singende Lerchen freuen.
Dieser massenhafte Vogelmord auf unserem Grünland (und natürlich Amphibien, Reptilien, Säugetiere, Insekten) wird immer aggressiver und ist vielen Menschen gar nicht bewusst.
Es müssen dringend Maßnahmen ergriffen werden, wie z.B. gesetzlich vorgeschriebene Randstreifen zu Gräben und Wegesrändern, Verbot nächtlicher Mahd, Begrenzung der Mahdhöhe- und Mahdgeschwindigkeit usw.
Ansonsten brauchen wir uns auch nicht über vogeljagende Mittelmeerländer aufzuregen - denn das was hier stattfindet ist letztendlich genauso zerstörerisch wie zum Spaß zur Flinte zu greifen.
Juni 2019
Autorin
Natascha Gaedecke
Alles nichts Neues.
Das kennen wir ja. Das BNatSchG §44 erlaubt es ja schließlich gemäß der „guten fachliche Praxis“, streng geschützte Vogelarten zu töten - denn verboten ist es ja nur „ohne sinnvollen Grund“.
Aber was ist an dieser uns allen bekannten Situation anders als noch vor 10, 20 Jahren?
Die Mähmaschinen sind größer und stärker denn je, schneller denn je, mähen tiefer denn je, mähen in immer kürzeren Intervallen, mähen die Gräben bis tief in jede Grabenböschung mit ab.
Wie zum Hohn kommt nun noch ein weiterer Trecker und mäht alle Stauden der Wegesränder ab, scheinbar um das letzte verbliebene Wiesenpieper- oder Blaukehlchennnest dann auch noch zu erwischen.
23.00h: Es wird dunkel, es wird weiter gemäht. Ich denke an die Wiesenweihen, den gerade erschienenen Artikel aus der Zeitschrift dem Falken: " bei nächtlicher Mahd bleiben die adulten Weihen auf dem Nest sitzen und werden mit getötet“.
Wo ist unsere Landwirtschaft hingekommen, dass jetzt hier 4 Maschinen der neusten Generation parallel nebeneinander in rasendem Tempo mähen, dahinter wird schon gewendet und das Gras abtransportiert.
Nicht ein junger Vogel, nicht ein junger Hase hat hier die geringste Chance, noch zu entkommen.
Früher habe ich nach der Mahd noch junge Kiebitze und junge Hasen gesehen, die überlebt haben. Früher hat ein Bauer noch das Mähwerk angehoben, wenn er von oben ein Kiebitznest gesehen hat.
Hier ist nun nichts mehr, nur hunderte von Krähen und Möwen, die sich über das „Fastfood“ freuen (und nebenbei bemerkt damit einen äußerst wichtigen Beitrag zur Beseitigung von Clostridien leisten, welche die Silage verunreinigen und damit den Rinderbestand gefährden könnten - gedankt wird es den Krähen aber natürlich nicht)
Diese Entwicklung der Grünlandbewirtschaftung ist sehr besorgniserregend, nicht nur für den Vogel des Jahres, die Feldlerche. Das Wettrüsten der Landwirte ist verständlich aus deren wirtschaftlicher Sicht, aber eine ökologische Vollkatastrophe und das Ergebnis einer verfehlten Agrarpolitik.
Was ist denn der „sinnvolle Grund“, der diese Entwicklung überhaupt zulässt?
Dass die Milch und das Fleisch immer noch billiger werden, und dafür das letzte Stück Natur geschreddert wird? Ist das wirklich im Sinne der Allgemeinheit, denn es sind doch nicht nur wir Naturschützer*innen und Vogelkundler*innen, die sich über blühende Wiesen und singende Lerchen freuen.
Dieser massenhafte Vogelmord auf unserem Grünland (und natürlich Amphibien, Reptilien, Säugetiere, Insekten) wird immer aggressiver und ist vielen Menschen gar nicht bewusst.
Es müssen dringend Maßnahmen ergriffen werden, wie z.B. gesetzlich vorgeschriebene Randstreifen zu Gräben und Wegesrändern, Verbot nächtlicher Mahd, Begrenzung der Mahdhöhe- und Mahdgeschwindigkeit usw.
Ansonsten brauchen wir uns auch nicht über vogeljagende Mittelmeerländer aufzuregen - denn das was hier stattfindet ist letztendlich genauso zerstörerisch wie zum Spaß zur Flinte zu greifen.
Juni 2019
Autorin
Natascha Gaedecke
Waldsterben 2.0 – Nein eine Chance zur Gestaltung naturnaher Wälder!

Waldsterben 2.0 – Nein eine Chance zur Gestaltung naturnaher Wälder!
Artenschutz in Franken® verfolgt seit geraumer Zeit die Diskussionen um den propagierten Niedergang des deutschen Waldes.
Als Ursache dieses Niedergangs wurde der/die Schuldige/n bereits ausgemacht. Der Klimawandel der die Bäume verdursten lässt und hie und da auch noch einige Großsäuger die unseren Wald „auffressen“. Diesen wird es vielerorts zugeschrieben, dass wir in wenigen Jahren wohl unseren Wald verlieren werden?!
Artenschutz in Franken® verfolgt seit geraumer Zeit die Diskussionen um den propagierten Niedergang des deutschen Waldes.
Als Ursache dieses Niedergangs wurde der/die Schuldige/n bereits ausgemacht. Der Klimawandel der die Bäume verdursten lässt und hie und da auch noch einige Großsäuger die unseren Wald „auffressen“. Diesen wird es vielerorts zugeschrieben, dass wir in wenigen Jahren wohl unseren Wald verlieren werden?!
Als Ursache für das infolge des Klimawandels erkennbare „Absterben“ unserer Wirtschaftswälder liegt jedoch vielmehr auch darin, dass wir unsere Wälder in den vergangenen Jahrhunderten ständig waldbaulich manipulierten und dieses auch heute noch sehr ausgeprägt und vielfach intensiver den je tun.
In dieser Zeitspanne haben wir in unserem Land nahezu alle unsere ursprünglich geformten Wälder verloren. Wir haben diesen Systemen seither ständig unsere menschliche Handschrift auferlegt um aufzuzeigen wie wir uns einen nachhaltig geformten Wirtschaftswald vorstellen. Und diesen selbstverständlich auch intensiv nutzen können.
Ohne große Rücksicht auf Pflanzen und Tiere welche in diesem Ökosystem leben.Wir haben somit keinen Wald mehr vor Augen wie dieser von Natur aus gedacht war – wir haben einen Wald vor unseren Augen wie wir uns Menschen einen Wald vorstellen.
Somit „stirbt“ nun auch nicht der Wald, sondern lediglich der vom Menschen fehlgeformte Wald.
Nun wird also fleißig darüber nachgedacht mit einem Millionenaufwand unseren Wald mit Aufforstungsprogrammen zu retten. Doch dieser Ansatz ist in unseren Augen eine weitere Verfehlung menschlichen Wirkens. Denn was hier zusammengepflanzt wird ist wieder kein sich natürlich entwickelter Wald der seine Dynamik sichtbar werden lassen kann. Nein es wird wieder ein vom Menschen manipulierter Wirtschaftswald entstehen der nur die Lebensformen in sich duldet die wir dieser Holzproduktionsfläche zugestehen.
Die Vielfalt der Arten wird hier auf immens großen Flächen abermals keine Rolle spielen.
Doch warum lassen wir es nicht einfach mal zu das wir dem Wald die Chance eröffnen uns zu zeigen wie Waldbau funktioniert und wie ein robuster Wald aussieht. „Dieser Wald“ wird uns in 50 – 70 Jahren zeigen welche Artenzusammensetzung für den jeweiligen Standort die richtige Mischung ist.
Es ist uns schon klar das bis dahin viele vom Menschen geschaffenen Wälder nicht mehr stehen werden denn sie werden tatsächlich „aufgefressen“.
Doch nicht vom Reh, welches Luchs und Wolf als Nahrungsgrundlage dringlich benötigen, wollen wir verhindern das diese sich an unseren Schafen & Co. bedienen, sondern von ganz kleinen Tieren. Der Borkenkäfer wird die Fläche für die nachfolgenden Naturwälder vorbereiten so wie wir es an mancher Stelle in Bayern sehr gut erkennen können.
Es bedarf somit in unseren Augen einem gesellschaftlichen Umdenken das endlich greifen muss.
Gerade im Sinne unserer Kinder und Enkelkinder welchen wir eine an Arten reiche Welt hinterlassen sollten.
AiF
12.08.2019
Ein sehr interessanter Bericht zu diesem Thema findet sich hier
In dieser Zeitspanne haben wir in unserem Land nahezu alle unsere ursprünglich geformten Wälder verloren. Wir haben diesen Systemen seither ständig unsere menschliche Handschrift auferlegt um aufzuzeigen wie wir uns einen nachhaltig geformten Wirtschaftswald vorstellen. Und diesen selbstverständlich auch intensiv nutzen können.
Ohne große Rücksicht auf Pflanzen und Tiere welche in diesem Ökosystem leben.Wir haben somit keinen Wald mehr vor Augen wie dieser von Natur aus gedacht war – wir haben einen Wald vor unseren Augen wie wir uns Menschen einen Wald vorstellen.
Somit „stirbt“ nun auch nicht der Wald, sondern lediglich der vom Menschen fehlgeformte Wald.
Nun wird also fleißig darüber nachgedacht mit einem Millionenaufwand unseren Wald mit Aufforstungsprogrammen zu retten. Doch dieser Ansatz ist in unseren Augen eine weitere Verfehlung menschlichen Wirkens. Denn was hier zusammengepflanzt wird ist wieder kein sich natürlich entwickelter Wald der seine Dynamik sichtbar werden lassen kann. Nein es wird wieder ein vom Menschen manipulierter Wirtschaftswald entstehen der nur die Lebensformen in sich duldet die wir dieser Holzproduktionsfläche zugestehen.
Die Vielfalt der Arten wird hier auf immens großen Flächen abermals keine Rolle spielen.
Doch warum lassen wir es nicht einfach mal zu das wir dem Wald die Chance eröffnen uns zu zeigen wie Waldbau funktioniert und wie ein robuster Wald aussieht. „Dieser Wald“ wird uns in 50 – 70 Jahren zeigen welche Artenzusammensetzung für den jeweiligen Standort die richtige Mischung ist.
Es ist uns schon klar das bis dahin viele vom Menschen geschaffenen Wälder nicht mehr stehen werden denn sie werden tatsächlich „aufgefressen“.
Doch nicht vom Reh, welches Luchs und Wolf als Nahrungsgrundlage dringlich benötigen, wollen wir verhindern das diese sich an unseren Schafen & Co. bedienen, sondern von ganz kleinen Tieren. Der Borkenkäfer wird die Fläche für die nachfolgenden Naturwälder vorbereiten so wie wir es an mancher Stelle in Bayern sehr gut erkennen können.
Es bedarf somit in unseren Augen einem gesellschaftlichen Umdenken das endlich greifen muss.
Gerade im Sinne unserer Kinder und Enkelkinder welchen wir eine an Arten reiche Welt hinterlassen sollten.
AiF
12.08.2019
Ein sehr interessanter Bericht zu diesem Thema findet sich hier