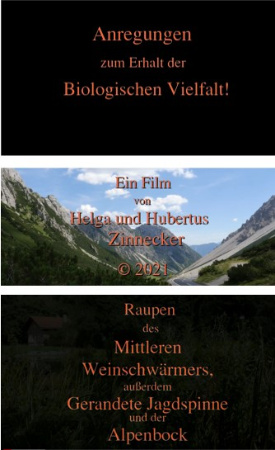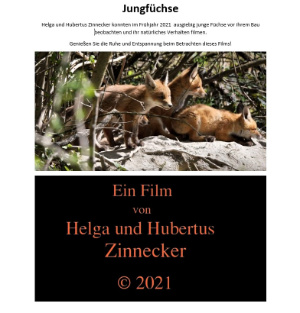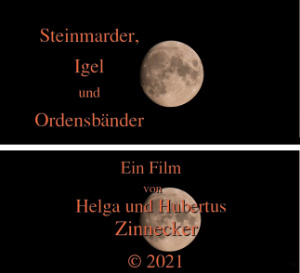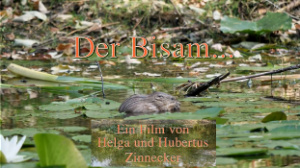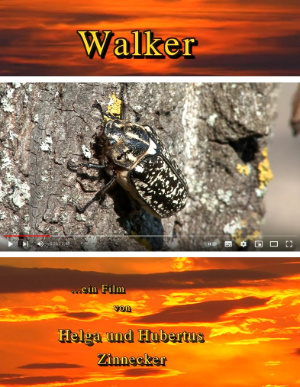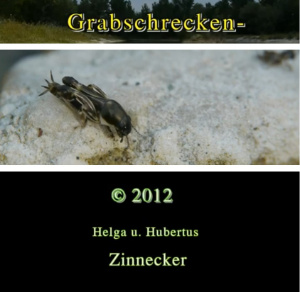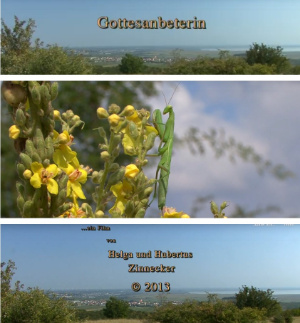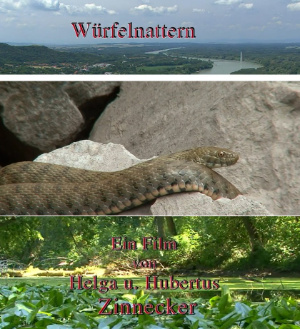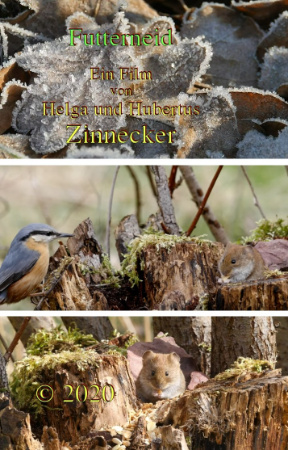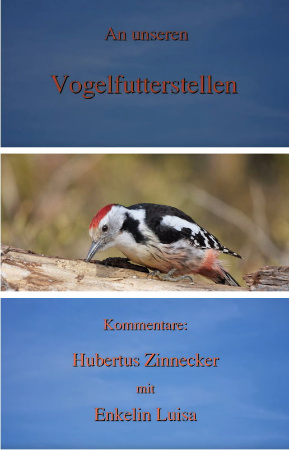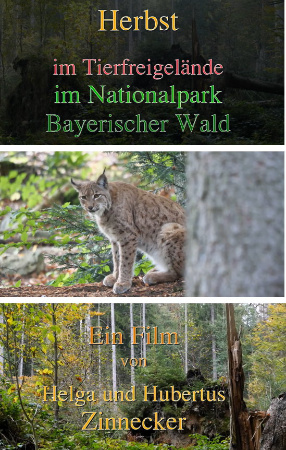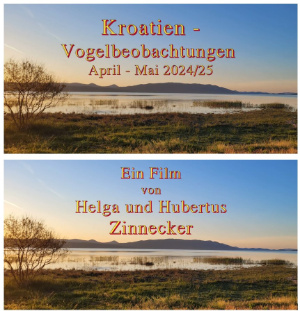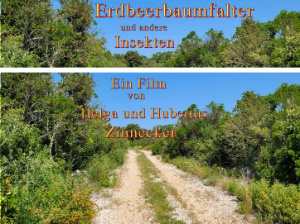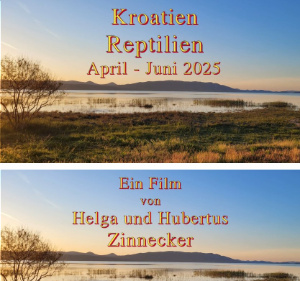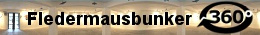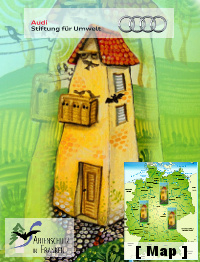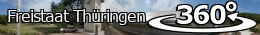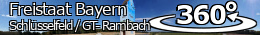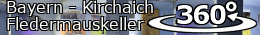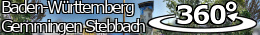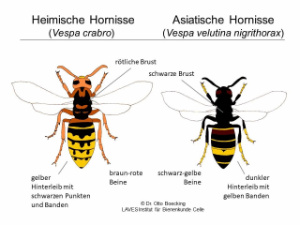BREAKING NEWS
| AiF | 02:30
Immer auf der richtigen Fährte ...
Artenschutz in Franken®
Artenschutz in Franken®
Eis und Wasser – Der stille Kreislauf des Lebens

Eis und Wasser – Der stille Kreislauf des Lebens
31.01/01.02.2026
In ihnen spiegeln sich die großen Zusammenhänge unseres Planeten: Klima, Zeit und Leben. Diese Diashow eröffnet einen Raum, in dem die leisen Prozesse der Natur sichtbar werden – Prozesse, die oft im Verborgenen wirken und doch über das Schicksal ganzer Ökosysteme entscheiden.
31.01/01.02.2026
- Eis und Wasser sind weit mehr als bloße Naturstoffe. Sie sind Gedächtnis und Bewegung, Ursprung und Zukunft zugleich.
In ihnen spiegeln sich die großen Zusammenhänge unseres Planeten: Klima, Zeit und Leben. Diese Diashow eröffnet einen Raum, in dem die leisen Prozesse der Natur sichtbar werden – Prozesse, die oft im Verborgenen wirken und doch über das Schicksal ganzer Ökosysteme entscheiden.
Eis steht für Dauer und Erinnerung.
In Gletschern, Eiskappen und Schneefeldern lagern Informationen aus vergangenen Jahrhunderten und Jahrtausenden. Luftblasen im Eis bewahren die Atmosphäre früherer Zeiten, Schichten erzählen von warmen und kalten Phasen, von Stabilität und Umbruch. Gleichzeitig ist Eis kein starres Element. Gletscher bewegen sich langsam talwärts, knirschen, brechen und passen sich ihrer Umgebung an. Sie formen Landschaften, schleifen Gestein und schaffen Lebensräume, lange bevor der Mensch sie betritt.
Wasser ist das Element des Wandels.
Es findet seinen Weg durch jede noch so kleine Öffnung, verbindet Höhen und Tiefen, überwindet Grenzen und Distanzen. Als Quelle schenkt es Leben, als Fluss transportiert es Nährstoffe, als See speichert es Wärme, als Meer reguliert es das globale Klima. Ohne Wasser gäbe es keine Wälder, keine Tiere, keine Kulturen – und keine Zukunft.
Eis und Wasser stehen in einem engen Wechselspiel. Schnee speist Flüsse, Gletscher sichern die Wasserversorgung ganzer Regionen, Polareis beeinflusst Meeresströmungen und Wetterlagen auf der ganzen Erde. Wenn dieses Gleichgewicht ins Wanken gerät, bleiben die Folgen nicht lokal begrenzt. Das Abschmelzen von Eis verändert den Meeresspiegel, verschiebt Klimazonen und verstärkt extreme Wetterereignisse. Was fern erscheint, wirkt nah.
Die Bilder dieser Diashow machen diese Zusammenhänge erfahrbar.
Sie zeigen die stille Erhabenheit gefrorener Strukturen ebenso wie die fließende Dynamik des Wassers. Licht, Farbe und Struktur lassen erkennen, wie sensibel diese Systeme sind – und wie eng Schönheit und Verletzlichkeit miteinander verbunden sind. Jeder Tropfen, jede Eisschicht ist Teil eines globalen Gefüges.
Besonders eindrucksvoll wird sichtbar, wie schnell sich natürliche Prozesse verändern können. Rückzugsgebiete des Eises werden kleiner, Übergangszonen größer. Dort, wo einst dauerhaft Frost herrschte, entstehen neue Landschaften – oft ohne die Zeit, stabile Ökosysteme auszubilden. Wasser verliert seine Rolle als verlässlicher Speicher und wird zunehmend zum unberechenbaren Faktor.
Doch diese Diashow zeigt nicht nur Verlust, sondern auch Verantwortung.
Sie lädt dazu ein, genauer hinzusehen und die Bedeutung von Eis und Wasser neu zu begreifen. Naturschutz beginnt mit Wahrnehmung. Wer versteht, wie grundlegend diese Elemente für das Leben auf der Erde sind, erkennt auch die Dringlichkeit ihres Schutzes.
Eis und Wasser erinnern uns daran, dass die Natur keine entfernte Kulisse ist. Sie ist ein lebendiges System, in das wir eingebunden sind. Ihr Zustand spiegelt unsere Entscheidungen wider. Diese visuelle Reise ist deshalb mehr als eine Sammlung von Bildern – sie ist ein stiller Appell, das Gleichgewicht zu bewahren, bevor das Schmelzen unumkehrbar wird.
In der Aufnahme von Dieter Zinßer
In Gletschern, Eiskappen und Schneefeldern lagern Informationen aus vergangenen Jahrhunderten und Jahrtausenden. Luftblasen im Eis bewahren die Atmosphäre früherer Zeiten, Schichten erzählen von warmen und kalten Phasen, von Stabilität und Umbruch. Gleichzeitig ist Eis kein starres Element. Gletscher bewegen sich langsam talwärts, knirschen, brechen und passen sich ihrer Umgebung an. Sie formen Landschaften, schleifen Gestein und schaffen Lebensräume, lange bevor der Mensch sie betritt.
Wasser ist das Element des Wandels.
Es findet seinen Weg durch jede noch so kleine Öffnung, verbindet Höhen und Tiefen, überwindet Grenzen und Distanzen. Als Quelle schenkt es Leben, als Fluss transportiert es Nährstoffe, als See speichert es Wärme, als Meer reguliert es das globale Klima. Ohne Wasser gäbe es keine Wälder, keine Tiere, keine Kulturen – und keine Zukunft.
Eis und Wasser stehen in einem engen Wechselspiel. Schnee speist Flüsse, Gletscher sichern die Wasserversorgung ganzer Regionen, Polareis beeinflusst Meeresströmungen und Wetterlagen auf der ganzen Erde. Wenn dieses Gleichgewicht ins Wanken gerät, bleiben die Folgen nicht lokal begrenzt. Das Abschmelzen von Eis verändert den Meeresspiegel, verschiebt Klimazonen und verstärkt extreme Wetterereignisse. Was fern erscheint, wirkt nah.
Die Bilder dieser Diashow machen diese Zusammenhänge erfahrbar.
Sie zeigen die stille Erhabenheit gefrorener Strukturen ebenso wie die fließende Dynamik des Wassers. Licht, Farbe und Struktur lassen erkennen, wie sensibel diese Systeme sind – und wie eng Schönheit und Verletzlichkeit miteinander verbunden sind. Jeder Tropfen, jede Eisschicht ist Teil eines globalen Gefüges.
Besonders eindrucksvoll wird sichtbar, wie schnell sich natürliche Prozesse verändern können. Rückzugsgebiete des Eises werden kleiner, Übergangszonen größer. Dort, wo einst dauerhaft Frost herrschte, entstehen neue Landschaften – oft ohne die Zeit, stabile Ökosysteme auszubilden. Wasser verliert seine Rolle als verlässlicher Speicher und wird zunehmend zum unberechenbaren Faktor.
Doch diese Diashow zeigt nicht nur Verlust, sondern auch Verantwortung.
Sie lädt dazu ein, genauer hinzusehen und die Bedeutung von Eis und Wasser neu zu begreifen. Naturschutz beginnt mit Wahrnehmung. Wer versteht, wie grundlegend diese Elemente für das Leben auf der Erde sind, erkennt auch die Dringlichkeit ihres Schutzes.
Eis und Wasser erinnern uns daran, dass die Natur keine entfernte Kulisse ist. Sie ist ein lebendiges System, in das wir eingebunden sind. Ihr Zustand spiegelt unsere Entscheidungen wider. Diese visuelle Reise ist deshalb mehr als eine Sammlung von Bildern – sie ist ein stiller Appell, das Gleichgewicht zu bewahren, bevor das Schmelzen unumkehrbar wird.
In der Aufnahme von Dieter Zinßer
- Eis und Wasser – Der stille Kreislauf des Lebens
Artenschutz in Franken®
Hausratte (Rattus rattus)

Die Hausratte (Rattus rattus)
30/31.01.2026
Lautlos verschwindet er zwischen Kisten und Mauerspalten. Die Hausratte kennt diesen Ort seit Generationen. Sie lebt im Verborgenen, aufmerksam, anpassungsfähig und stets auf der Suche nach Nahrung und Schutz. Kaum jemand bemerkt sie bewusst – und doch ist sie seit Jahrhunderten ein stiller Begleiter des Menschen.
30/31.01.2026
- In der Dämmerung eines alten Hafens, dort wo Holzbohlen knarren und Seile leise im Wind schwingen, huscht ein dunkler Schatten über den Boden.
Lautlos verschwindet er zwischen Kisten und Mauerspalten. Die Hausratte kennt diesen Ort seit Generationen. Sie lebt im Verborgenen, aufmerksam, anpassungsfähig und stets auf der Suche nach Nahrung und Schutz. Kaum jemand bemerkt sie bewusst – und doch ist sie seit Jahrhunderten ein stiller Begleiter des Menschen.
Artbeschreibung: Hausratte (Rattus rattus)
Die Hausratte (Rattus rattus), auch als Schwarze Ratte oder Dachratte bekannt, gehört zur Familie der Langschwanzmäuse (Muridae). Sie ist schlanker und leichter gebaut als die Wanderratte und erreicht eine Kopf-Rumpf-Länge von etwa 16 bis 22 Zentimetern. Auffällig ist ihr langer, meist unbehaarter Schwanz, der länger als der Körper sein kann, sowie ihre großen Ohren und spitze Schnauze.
Das Fell ist variabel gefärbt und reicht von schwarz über dunkelbraun bis graubraun. Hausratten sind ausgezeichnete Kletterer und halten sich bevorzugt in höheren Gebäudeteilen auf, etwa auf Dachböden, in Zwischendecken oder Lagerhäusern. Ursprünglich stammt die Art aus den tropischen Regionen Süd- und Südostasiens, verbreitete sich jedoch durch den Seehandel weltweit.
Als Allesfresser ernährt sich die Hausratte von pflanzlicher und tierischer Nahrung, wobei sie oft Vorräte nutzt, die in menschlicher Nähe verfügbar sind. Sie ist überwiegend nachtaktiv, sehr lernfähig und zeigt ein ausgeprägtes Sozialverhalten.
Perspektive im Wandel von Lebensraum und Klima
Die Lebensbedingungen der Hausratte verändern sich spürbar. Moderne Bauweisen, verbesserte Hygienestandards und gezielte Schädlingskontrolle haben dazu geführt, dass die Art in vielen Regionen Europas stark zurückgegangen ist. Besonders die Konkurrenz durch die robustere Wanderratte hat ihren Bestand weiter verdrängt.
Der Klimawandel könnte diese Entwicklung jedoch teilweise umkehren. Mildere Winter und steigende Durchschnittstemperaturen begünstigen wärmeliebende Arten wie die Hausratte. Hafenstädte, Industriegebiete und dicht bebaute urbane Räume bieten weiterhin geeignete Rückzugsorte, vor allem dort, wo alte Bausubstanz erhalten bleibt.
Gleichzeitig verändern sich Handelswege, Stadtstrukturen und Nahrungsangebote, was neue Ausbreitungsmöglichkeiten schaffen kann. Ob die Hausratte künftig wieder häufiger anzutreffen sein wird, hängt stark vom Zusammenspiel aus Klimaveränderung, menschlicher Infrastruktur und gezieltem Management ab. Sicher ist: Ihre Anpassungsfähigkeit bleibt ein entscheidender Faktor für ihr Überleben.
In der Aufnahme von Helga Zinnecker
Die Hausratte (Rattus rattus), auch als Schwarze Ratte oder Dachratte bekannt, gehört zur Familie der Langschwanzmäuse (Muridae). Sie ist schlanker und leichter gebaut als die Wanderratte und erreicht eine Kopf-Rumpf-Länge von etwa 16 bis 22 Zentimetern. Auffällig ist ihr langer, meist unbehaarter Schwanz, der länger als der Körper sein kann, sowie ihre großen Ohren und spitze Schnauze.
Das Fell ist variabel gefärbt und reicht von schwarz über dunkelbraun bis graubraun. Hausratten sind ausgezeichnete Kletterer und halten sich bevorzugt in höheren Gebäudeteilen auf, etwa auf Dachböden, in Zwischendecken oder Lagerhäusern. Ursprünglich stammt die Art aus den tropischen Regionen Süd- und Südostasiens, verbreitete sich jedoch durch den Seehandel weltweit.
Als Allesfresser ernährt sich die Hausratte von pflanzlicher und tierischer Nahrung, wobei sie oft Vorräte nutzt, die in menschlicher Nähe verfügbar sind. Sie ist überwiegend nachtaktiv, sehr lernfähig und zeigt ein ausgeprägtes Sozialverhalten.
Perspektive im Wandel von Lebensraum und Klima
Die Lebensbedingungen der Hausratte verändern sich spürbar. Moderne Bauweisen, verbesserte Hygienestandards und gezielte Schädlingskontrolle haben dazu geführt, dass die Art in vielen Regionen Europas stark zurückgegangen ist. Besonders die Konkurrenz durch die robustere Wanderratte hat ihren Bestand weiter verdrängt.
Der Klimawandel könnte diese Entwicklung jedoch teilweise umkehren. Mildere Winter und steigende Durchschnittstemperaturen begünstigen wärmeliebende Arten wie die Hausratte. Hafenstädte, Industriegebiete und dicht bebaute urbane Räume bieten weiterhin geeignete Rückzugsorte, vor allem dort, wo alte Bausubstanz erhalten bleibt.
Gleichzeitig verändern sich Handelswege, Stadtstrukturen und Nahrungsangebote, was neue Ausbreitungsmöglichkeiten schaffen kann. Ob die Hausratte künftig wieder häufiger anzutreffen sein wird, hängt stark vom Zusammenspiel aus Klimaveränderung, menschlicher Infrastruktur und gezieltem Management ab. Sicher ist: Ihre Anpassungsfähigkeit bleibt ein entscheidender Faktor für ihr Überleben.
In der Aufnahme von Helga Zinnecker
- Junge Hausratte blickt aus dem Bau
Artenschutz in Franken®
Die Breitblättrige Lichtnelke (Silene latifolia)

Die Breitblättrige Lichtnelke (Silene latifolia)
30/31.01.2026
Nachtfalter finden nun ihren Weg zu ihr, angelockt von Duft und Helligkeit. Die Breitblättrige Lichtnelke ist keine Pflanze, die um Aufmerksamkeit buhlt. Und doch erzählt sie, wenn man innehält, eine Geschichte von Anpassung, Durchhaltevermögen und stiller Präsenz in einer sich wandelnden Landschaft.
30/31.01.2026
- In der Dämmerung eines warmen Sommerabends steht sie unscheinbar am Rand einer Wiese. Während das Licht langsam schwindet, beginnen ihre weißen Blüten zu leuchten – nicht grell, sondern sanft, fast zurückhaltend.
Nachtfalter finden nun ihren Weg zu ihr, angelockt von Duft und Helligkeit. Die Breitblättrige Lichtnelke ist keine Pflanze, die um Aufmerksamkeit buhlt. Und doch erzählt sie, wenn man innehält, eine Geschichte von Anpassung, Durchhaltevermögen und stiller Präsenz in einer sich wandelnden Landschaft.
Artbeschreibung
Die Breitblättrige Lichtnelke (Silene latifolia) gehört zur Familie der Nelkengewächse (Caryophyllaceae). Sie ist eine ausdauernde, krautige Pflanze, die Wuchshöhen von etwa 30 bis 80 Zentimetern erreichen kann. Charakteristisch sind ihre gegenständig angeordneten, eiförmig bis breit-lanzettlichen Blätter, die der Art ihren deutschen Namen verleihen.
Besonders auffällig sind die weißen, meist nachts geöffneten Blüten. Sie sind fünfzählig aufgebaut und besitzen eine leicht eingeschnittene Kronblattstruktur. Die Pflanze ist zweihäusig, das heißt, männliche und weibliche Blüten wachsen auf getrennten Individuen – ein eher seltenes Merkmal unter heimischen Wildpflanzen. Die Blütezeit erstreckt sich in der Regel von Mai bis September.
Die Breitblättrige Lichtnelke besiedelt bevorzugt nährstoffreiche Standorte wie Wegränder, Böschungen, Feldraine, Brachen und extensiv genutzte Wiesen. Sie ist in weiten Teilen Europas verbreitet und wurde auch in andere Regionen eingeführt.
Perspektive im Zeichen von Lebensraumveränderung und Klimawandel
Die Zukunft der Breitblättrigen Lichtnelke ist eng mit der Entwicklung unserer Kulturlandschaften verknüpft. Intensivierung der Landwirtschaft, häufige Mahd, der Verlust von Feldrainen sowie zunehmende Versiegelung reduzieren vielerorts geeignete Lebensräume. Gleichzeitig verändern steigende Temperaturen und veränderte Niederschlagsmuster die Standortbedingungen.
Als vergleichsweise anpassungsfähige Art kann Silene latifolia zwar kurzfristig von wärmeren Bedingungen profitieren und neue Gebiete erschließen. Langfristig jedoch hängt ihr Fortbestand davon ab, ob strukturreiche Landschaften mit offenen, wenig gestörten Bereichen erhalten bleiben. Besonders die Abhängigkeit von nachtaktiven Bestäubern macht sie sensibel gegenüber Lichtverschmutzung und dem Rückgang von Insektenpopulationen.
Die Breitblättrige Lichtnelke steht damit exemplarisch für viele unscheinbare Wildpflanzen: Sie ist noch verbreitet, aber nicht selbstverständlich. Ihr Erhalt ist ein stiller Indikator dafür, wie vielfältig und lebendig unsere Landschaften auch in Zukunft sein können.
In der Aufnahme von Dieter Zinßer
Die Breitblättrige Lichtnelke (Silene latifolia) gehört zur Familie der Nelkengewächse (Caryophyllaceae). Sie ist eine ausdauernde, krautige Pflanze, die Wuchshöhen von etwa 30 bis 80 Zentimetern erreichen kann. Charakteristisch sind ihre gegenständig angeordneten, eiförmig bis breit-lanzettlichen Blätter, die der Art ihren deutschen Namen verleihen.
Besonders auffällig sind die weißen, meist nachts geöffneten Blüten. Sie sind fünfzählig aufgebaut und besitzen eine leicht eingeschnittene Kronblattstruktur. Die Pflanze ist zweihäusig, das heißt, männliche und weibliche Blüten wachsen auf getrennten Individuen – ein eher seltenes Merkmal unter heimischen Wildpflanzen. Die Blütezeit erstreckt sich in der Regel von Mai bis September.
Die Breitblättrige Lichtnelke besiedelt bevorzugt nährstoffreiche Standorte wie Wegränder, Böschungen, Feldraine, Brachen und extensiv genutzte Wiesen. Sie ist in weiten Teilen Europas verbreitet und wurde auch in andere Regionen eingeführt.
Perspektive im Zeichen von Lebensraumveränderung und Klimawandel
Die Zukunft der Breitblättrigen Lichtnelke ist eng mit der Entwicklung unserer Kulturlandschaften verknüpft. Intensivierung der Landwirtschaft, häufige Mahd, der Verlust von Feldrainen sowie zunehmende Versiegelung reduzieren vielerorts geeignete Lebensräume. Gleichzeitig verändern steigende Temperaturen und veränderte Niederschlagsmuster die Standortbedingungen.
Als vergleichsweise anpassungsfähige Art kann Silene latifolia zwar kurzfristig von wärmeren Bedingungen profitieren und neue Gebiete erschließen. Langfristig jedoch hängt ihr Fortbestand davon ab, ob strukturreiche Landschaften mit offenen, wenig gestörten Bereichen erhalten bleiben. Besonders die Abhängigkeit von nachtaktiven Bestäubern macht sie sensibel gegenüber Lichtverschmutzung und dem Rückgang von Insektenpopulationen.
Die Breitblättrige Lichtnelke steht damit exemplarisch für viele unscheinbare Wildpflanzen: Sie ist noch verbreitet, aber nicht selbstverständlich. Ihr Erhalt ist ein stiller Indikator dafür, wie vielfältig und lebendig unsere Landschaften auch in Zukunft sein können.
In der Aufnahme von Dieter Zinßer
- Weiß leuchtende Blüten der Breitblättrigen Lichtnelke in der Abenddämmerung
Artenschutz in Franken®
Pilze – faszinierende Vielfalt im Verborgenen

Pilze – faszinierende Vielfalt im Verborgenen
30/31.01.2026
Dabei steht nicht die Vollständigkeit, sondern das Staunen und das Bewusstsein für ihre ökologische Bedeutung im Vordergrund. Gleichzeitig weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass eine zuverlässige Bestimmung von Pilzen allein anhand von Bildern – insbesondere für Laien – kaum möglich ist.
Viele Arten ähneln sich äußerlich stark, während entscheidende Unterscheidungsmerkmale oft nur im Detail, im Standort oder unter dem Mikroskop erkennbar sind. Als Organisation empfehlen wir daher dringend, Pilzbestimmungen stets durch ausgewiesene Fachkennerinnen und Fachkenner vornehmen zu lassen.
30/31.01.2026
- Pilze sind ein oft übersehener, aber unverzichtbarer Bestandteil unserer Ökosysteme. In dieser Diashow möchten wir die große Vielfalt heimischer Pilzarten zeigen und einen Einblick in ihre Formen, Farben und Lebensweisen geben.
Dabei steht nicht die Vollständigkeit, sondern das Staunen und das Bewusstsein für ihre ökologische Bedeutung im Vordergrund. Gleichzeitig weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass eine zuverlässige Bestimmung von Pilzen allein anhand von Bildern – insbesondere für Laien – kaum möglich ist.
Viele Arten ähneln sich äußerlich stark, während entscheidende Unterscheidungsmerkmale oft nur im Detail, im Standort oder unter dem Mikroskop erkennbar sind. Als Organisation empfehlen wir daher dringend, Pilzbestimmungen stets durch ausgewiesene Fachkennerinnen und Fachkenner vornehmen zu lassen.
Zunehmend geraten Pilzarten auch durch klimatische Veränderungen unter Druck.
Längere Trockenperioden, steigende Temperaturen und veränderte Niederschlagsmuster beeinflussen das empfindliche Zusammenspiel zwischen Pilzen, Böden und ihren Symbiosepartnern wie Bäumen und Pflanzen. Einige Arten reagieren darauf besonders sensibel und gehen in ihrem Vorkommen deutlich zurück.
Ein weiterer Aspekt ist die Entnahme von Fruchtkörpern.
Auch wenn der Fruchtkörper nur einen Teil des Pilzorganismus darstellt, kann häufiges oder unsachgemäßes Sammeln – insbesondere bei seltenen Arten – zu einer Schwächung der Bestände beitragen. In Kombination mit Lebensraumveränderungen, Zerstörung von Wäldern, Bodenverdichtung und Flächenversiegelung verstärken sich diese negativen Effekte erheblich.
Mit dieser Diashow möchten wir dazu beitragen, das Verständnis für Pilze zu vertiefen und für einen respektvollen, verantwortungsvollen Umgang mit ihnen zu sensibilisieren. Der Schutz ihrer Lebensräume ist zugleich ein wichtiger Beitrag zum Erhalt der biologischen Vielfalt insgesamt.
In der Aufnahme von Dieter Zinßer
Längere Trockenperioden, steigende Temperaturen und veränderte Niederschlagsmuster beeinflussen das empfindliche Zusammenspiel zwischen Pilzen, Böden und ihren Symbiosepartnern wie Bäumen und Pflanzen. Einige Arten reagieren darauf besonders sensibel und gehen in ihrem Vorkommen deutlich zurück.
Ein weiterer Aspekt ist die Entnahme von Fruchtkörpern.
Auch wenn der Fruchtkörper nur einen Teil des Pilzorganismus darstellt, kann häufiges oder unsachgemäßes Sammeln – insbesondere bei seltenen Arten – zu einer Schwächung der Bestände beitragen. In Kombination mit Lebensraumveränderungen, Zerstörung von Wäldern, Bodenverdichtung und Flächenversiegelung verstärken sich diese negativen Effekte erheblich.
Mit dieser Diashow möchten wir dazu beitragen, das Verständnis für Pilze zu vertiefen und für einen respektvollen, verantwortungsvollen Umgang mit ihnen zu sensibilisieren. Der Schutz ihrer Lebensräume ist zugleich ein wichtiger Beitrag zum Erhalt der biologischen Vielfalt insgesamt.
In der Aufnahme von Dieter Zinßer
- Helmlinge auf Moos
Artenschutz in Franken®
Birkhuhn (Lyrurus tetrix)

Das Birkhuhn (Lyrurus tetrix) – Zwischen Morgendunst und stillem Rückzug
29/30.01.2026
Mit den ersten Lichtstreifen des Morgens tritt ein dunkler Umriss aus dem Dunst. Federn glänzen matt, Flügel werden gespreizt, der leierförmige Schwanz hebt sich. Für einen kurzen Moment gehört dieser Platz allein dem Birkhuhn. Seit Generationen kehrt es hierher zurück – an denselben Balzplatz, zur selben Jahreszeit, im Rhythmus der Natur. Doch der Raum um es herum ist kleiner geworden, stiller, verletzlicher.
Diese Szene, einst typisch für viele Hochlagen, Moore und offene Waldlandschaften Mitteleuropas, ist heute selten geworden.
29/30.01.2026
- Noch liegt Nebel über der offenen Moorfläche. Die Luft ist kühl, fast reglos. Aus der Ferne erklingt ein leises Blubbern, ein Zischen, dann wieder Stille.
Mit den ersten Lichtstreifen des Morgens tritt ein dunkler Umriss aus dem Dunst. Federn glänzen matt, Flügel werden gespreizt, der leierförmige Schwanz hebt sich. Für einen kurzen Moment gehört dieser Platz allein dem Birkhuhn. Seit Generationen kehrt es hierher zurück – an denselben Balzplatz, zur selben Jahreszeit, im Rhythmus der Natur. Doch der Raum um es herum ist kleiner geworden, stiller, verletzlicher.
Diese Szene, einst typisch für viele Hochlagen, Moore und offene Waldlandschaften Mitteleuropas, ist heute selten geworden.
Artbeschreibung
Das Birkhuhn (Lyrurus tetrix) ist eine charakteristische Vogelart der offenen und halboffenen Landschaften Europas und Asiens. Es gehört zur Familie der Raufußhühner und ist besonders an kühle, strukturreiche Lebensräume angepasst.
Männliche Birkhühner sind unverwechselbar: Ihr schwarzes, metallisch schimmerndes Gefieder, die weißen Flügelbinden und der namensgebende, lyraförmig gebogene Schwanz machen sie vor allem während der Balz auffällig. Über den Augen erinnern leuchtend rote Hautwülste an kleine Signallichter. Weibchen, auch Birkhennen genannt, sind deutlich unauffälliger gefärbt. Ihr braun gesprenkeltes Gefieder bietet eine hervorragende Tarnung im Bodenbewuchs – ein wichtiger Schutz während der Brutzeit.
Birkhühner leben überwiegend am Boden. Ihre Nahrung besteht aus Knospen, Blättern, Beeren, Samen und im Sommer auch aus Insekten. Besonders im Winter sind sie auf bestimmte Pflanzen wie Birken, Weiden oder Zwergsträucher angewiesen. Ihre Lebensräume sind Moore, Heiden, alpine Matten, lichte Wälder und Übergangszonen zwischen Wald und Offenland.
Ein zentrales Element ihres Lebenszyklus ist die Balz. Auf traditionellen Balzplätzen treffen sich die Männchen im Frühjahr, um mit Lauten, Körperhaltung und Bewegung um die Aufmerksamkeit der Weibchen zu werben. Diese Plätze werden über viele Jahre genutzt und sind von entscheidender Bedeutung für den Fortbestand der Art.
Perspektive des Birkhuhns im Wandel von Lebensraum und Klima
Das Birkhuhn ist ein sensibler Indikator für den Zustand seiner Umwelt. Dort, wo es verschwindet, haben sich Landschaften grundlegend verändert. Die Ursachen liegen vor allem im Verlust geeigneter Lebensräume. Moore wurden entwässert, offene Flächen verbuscht oder intensiv genutzt, lichte Wälder wurden dichter, homogener und artenärmer.
Hinzu kommen zunehmende Störungen durch Freizeitaktivitäten. Wintersport, Wanderwege, Tourismus und ganzjährige Nutzung ehemals ruhiger Gebiete führen dazu, dass Rückzugsräume schrumpfen. Besonders im Winter, wenn Energie lebenswichtig ist, können Störungen für Birkhühner existenzbedrohend sein.
Der Klimawandel verstärkt diese Entwicklungen. Steigende Temperaturen verändern die Vegetation in Hochlagen, die Schneezeiten werden kürzer, Übergänge zwischen Jahreszeiten verschieben sich. Das Birkhuhn ist an kalte Winter und strukturreiche Landschaften angepasst. Wenn diese Bedingungen verschwinden, gerät sein fein abgestimmter Lebensrhythmus aus dem Gleichgewicht.
Langfristig steht das Birkhuhn vor der Herausforderung, sich in einer Landschaft zu behaupten, die immer weniger Platz für spezialisierte Arten bietet. Sein Überleben hängt davon ab, ob es gelingt, Lebensräume zu vernetzen, Störungen zu reduzieren und natürliche Prozesse wieder zuzulassen. Der Schutz des Birkhuhns ist damit immer auch ein Schutz für Moore, Berglandschaften und offene Waldstrukturen – und für die biologische Vielfalt insgesamt.
In der Aufnahme von Werner Oppermann
Das Birkhuhn (Lyrurus tetrix) ist eine charakteristische Vogelart der offenen und halboffenen Landschaften Europas und Asiens. Es gehört zur Familie der Raufußhühner und ist besonders an kühle, strukturreiche Lebensräume angepasst.
Männliche Birkhühner sind unverwechselbar: Ihr schwarzes, metallisch schimmerndes Gefieder, die weißen Flügelbinden und der namensgebende, lyraförmig gebogene Schwanz machen sie vor allem während der Balz auffällig. Über den Augen erinnern leuchtend rote Hautwülste an kleine Signallichter. Weibchen, auch Birkhennen genannt, sind deutlich unauffälliger gefärbt. Ihr braun gesprenkeltes Gefieder bietet eine hervorragende Tarnung im Bodenbewuchs – ein wichtiger Schutz während der Brutzeit.
Birkhühner leben überwiegend am Boden. Ihre Nahrung besteht aus Knospen, Blättern, Beeren, Samen und im Sommer auch aus Insekten. Besonders im Winter sind sie auf bestimmte Pflanzen wie Birken, Weiden oder Zwergsträucher angewiesen. Ihre Lebensräume sind Moore, Heiden, alpine Matten, lichte Wälder und Übergangszonen zwischen Wald und Offenland.
Ein zentrales Element ihres Lebenszyklus ist die Balz. Auf traditionellen Balzplätzen treffen sich die Männchen im Frühjahr, um mit Lauten, Körperhaltung und Bewegung um die Aufmerksamkeit der Weibchen zu werben. Diese Plätze werden über viele Jahre genutzt und sind von entscheidender Bedeutung für den Fortbestand der Art.
Perspektive des Birkhuhns im Wandel von Lebensraum und Klima
Das Birkhuhn ist ein sensibler Indikator für den Zustand seiner Umwelt. Dort, wo es verschwindet, haben sich Landschaften grundlegend verändert. Die Ursachen liegen vor allem im Verlust geeigneter Lebensräume. Moore wurden entwässert, offene Flächen verbuscht oder intensiv genutzt, lichte Wälder wurden dichter, homogener und artenärmer.
Hinzu kommen zunehmende Störungen durch Freizeitaktivitäten. Wintersport, Wanderwege, Tourismus und ganzjährige Nutzung ehemals ruhiger Gebiete führen dazu, dass Rückzugsräume schrumpfen. Besonders im Winter, wenn Energie lebenswichtig ist, können Störungen für Birkhühner existenzbedrohend sein.
Der Klimawandel verstärkt diese Entwicklungen. Steigende Temperaturen verändern die Vegetation in Hochlagen, die Schneezeiten werden kürzer, Übergänge zwischen Jahreszeiten verschieben sich. Das Birkhuhn ist an kalte Winter und strukturreiche Landschaften angepasst. Wenn diese Bedingungen verschwinden, gerät sein fein abgestimmter Lebensrhythmus aus dem Gleichgewicht.
Langfristig steht das Birkhuhn vor der Herausforderung, sich in einer Landschaft zu behaupten, die immer weniger Platz für spezialisierte Arten bietet. Sein Überleben hängt davon ab, ob es gelingt, Lebensräume zu vernetzen, Störungen zu reduzieren und natürliche Prozesse wieder zuzulassen. Der Schutz des Birkhuhns ist damit immer auch ein Schutz für Moore, Berglandschaften und offene Waldstrukturen – und für die biologische Vielfalt insgesamt.
In der Aufnahme von Werner Oppermann
- Birkhühner
Artenschutz in Franken®
Westliche Honigbiene (Apis mellifera)

Die Westliche Honigbiene (Apis mellifera)
29/30.01.2026
Die Morgensonne liegt noch flach über der Wiese, als sich eine einzelne Honigbiene aus dem Dunkel des Bienenstocks löst. Zum ersten Mal verlässt sie den schützenden Raum, in dem sie geschlüpft ist. Zögernd, dann immer sicherer, zieht sie ihre Kreise in der Luft. Der Duft von Blüten weist ihr den Weg. Was für sie ein alltäglicher Flug ist, steht sinnbildlich für ein fein abgestimmtes Zusammenspiel zwischen Insekt, Pflanze und Landschaft – ein Zusammenspiel, das zunehmend aus dem Gleichgewicht gerät.
29/30.01.2026
- Eine kurze Geschichte vom ersten Flug
Die Morgensonne liegt noch flach über der Wiese, als sich eine einzelne Honigbiene aus dem Dunkel des Bienenstocks löst. Zum ersten Mal verlässt sie den schützenden Raum, in dem sie geschlüpft ist. Zögernd, dann immer sicherer, zieht sie ihre Kreise in der Luft. Der Duft von Blüten weist ihr den Weg. Was für sie ein alltäglicher Flug ist, steht sinnbildlich für ein fein abgestimmtes Zusammenspiel zwischen Insekt, Pflanze und Landschaft – ein Zusammenspiel, das zunehmend aus dem Gleichgewicht gerät.
Artbeschreibung
Die Westliche Honigbiene (Apis mellifera) gehört zur Ordnung der Hautflügler (Hymenoptera) und zur Familie der Echten Bienen (Apidae). Sie ist eine staatenbildende Insektenart und lebt in komplex organisierten Völkern, die aus einer Königin, mehreren tausend Arbeiterinnen und – je nach Jahreszeit – Drohnen bestehen.
Honigbienen zeichnen sich durch ihren behaarten Körper, die deutlich ausgeprägten Sammelstrukturen an den Hinterbeinen und ihre ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit aus. Über den sogenannten Schwänzeltanz teilen sie ihren Artgenossinnen Informationen über Nahrungsquellen mit. Ihre Ernährung besteht überwiegend aus Nektar und Pollen, aus denen sie Honig herstellen – eine wichtige Energiequelle für das Volk.
Apis mellifera ist ursprünglich in Europa, Afrika und Teilen Westasiens heimisch und wurde durch den Menschen weltweit verbreitet. Neben ihrer Bedeutung als Honiglieferant ist sie vor allem als Bestäuberin von zentraler ökologischer und wirtschaftlicher Relevanz.
Lebensraumveränderung und Klimawandel – eine unsichere Zukunft
Die Lebensbedingungen der Westlichen Honigbiene haben sich in den vergangenen Jahrzehnten deutlich verändert. Strukturreiche Landschaften, vielfältige Blühangebote und kontinuierliche Nahrungsquellen sind vielerorts zurückgegangen. Intensiv genutzte Agrarflächen, der Verlust von Wiesen, Hecken und Feldrainen sowie monotone Anbauformen schränken das Nahrungsangebot stark ein.
Der Klimawandel verstärkt diese Problematik zusätzlich. Frühere Blühzeiten, längere Trockenphasen und extreme Wetterereignisse bringen den fein abgestimmten Jahresrhythmus der Honigbienen durcheinander. Wenn Pflanzen bereits verblüht sind, bevor ein Volk seine volle Sammelstärke erreicht, entstehen Versorgungslücken. Hitzeperioden belasten die Völker, während milde Winter den natürlichen Ruhephasen entgegenwirken.
Hinzu kommen Krankheiten, Parasiten und ein insgesamt steigender Stresslevel für die Tiere. Auch wenn die Westliche Honigbiene durch menschliche Betreuung vergleichsweise präsent ist, gilt sie zunehmend als Indikatorart für den Zustand unserer Kulturlandschaft. Ihre Entwicklung spiegelt wider, wie stark ökologische Zusammenhänge unter Druck geraten sind.
Der langfristige Erhalt der Art ist daher untrennbar mit einer vielfältigen, klimaresilienten und naturnahen Landschaft verbunden. Der Schutz von Blühflächen, eine angepasste Landnutzung und ein bewusster Umgang mit natürlichen Ressourcen kommen nicht nur der Honigbiene zugute, sondern dem gesamten Ökosystem.
In der Aufnahme von Dieter Zinßer
Die Westliche Honigbiene (Apis mellifera) gehört zur Ordnung der Hautflügler (Hymenoptera) und zur Familie der Echten Bienen (Apidae). Sie ist eine staatenbildende Insektenart und lebt in komplex organisierten Völkern, die aus einer Königin, mehreren tausend Arbeiterinnen und – je nach Jahreszeit – Drohnen bestehen.
Honigbienen zeichnen sich durch ihren behaarten Körper, die deutlich ausgeprägten Sammelstrukturen an den Hinterbeinen und ihre ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit aus. Über den sogenannten Schwänzeltanz teilen sie ihren Artgenossinnen Informationen über Nahrungsquellen mit. Ihre Ernährung besteht überwiegend aus Nektar und Pollen, aus denen sie Honig herstellen – eine wichtige Energiequelle für das Volk.
Apis mellifera ist ursprünglich in Europa, Afrika und Teilen Westasiens heimisch und wurde durch den Menschen weltweit verbreitet. Neben ihrer Bedeutung als Honiglieferant ist sie vor allem als Bestäuberin von zentraler ökologischer und wirtschaftlicher Relevanz.
Lebensraumveränderung und Klimawandel – eine unsichere Zukunft
Die Lebensbedingungen der Westlichen Honigbiene haben sich in den vergangenen Jahrzehnten deutlich verändert. Strukturreiche Landschaften, vielfältige Blühangebote und kontinuierliche Nahrungsquellen sind vielerorts zurückgegangen. Intensiv genutzte Agrarflächen, der Verlust von Wiesen, Hecken und Feldrainen sowie monotone Anbauformen schränken das Nahrungsangebot stark ein.
Der Klimawandel verstärkt diese Problematik zusätzlich. Frühere Blühzeiten, längere Trockenphasen und extreme Wetterereignisse bringen den fein abgestimmten Jahresrhythmus der Honigbienen durcheinander. Wenn Pflanzen bereits verblüht sind, bevor ein Volk seine volle Sammelstärke erreicht, entstehen Versorgungslücken. Hitzeperioden belasten die Völker, während milde Winter den natürlichen Ruhephasen entgegenwirken.
Hinzu kommen Krankheiten, Parasiten und ein insgesamt steigender Stresslevel für die Tiere. Auch wenn die Westliche Honigbiene durch menschliche Betreuung vergleichsweise präsent ist, gilt sie zunehmend als Indikatorart für den Zustand unserer Kulturlandschaft. Ihre Entwicklung spiegelt wider, wie stark ökologische Zusammenhänge unter Druck geraten sind.
Der langfristige Erhalt der Art ist daher untrennbar mit einer vielfältigen, klimaresilienten und naturnahen Landschaft verbunden. Der Schutz von Blühflächen, eine angepasste Landnutzung und ein bewusster Umgang mit natürlichen Ressourcen kommen nicht nur der Honigbiene zugute, sondern dem gesamten Ökosystem.
In der Aufnahme von Dieter Zinßer
- Biene auf violetter Aster
Artenschutz in Franken®
Bäume – Facetten einer stillen Präsenz

Bäume – Facetten einer stillen Präsenz
29/30.01.2026
Bäume begleiten den Menschen seit jeher. Sie prägen Landschaften, strukturieren Räume und verändern sich mit den Jahreszeiten. In dieser Diashow rücken Bäume in ihren unterschiedlichen Facetten in den Mittelpunkt – als Einzelerscheinung, als Teil eines Waldes und als prägendes Element in natürlichen wie auch gestalteten Umgebungen.
Die gezeigten Bilder widmen sich der Vielfalt der Formen und Strukturen. Mächtige Stämme, feine Zweige, ausladende Kronen und detailreiche Rinden erzählen von Wachstum, Anpassung und Zeit. Licht und Schatten verändern die Wirkung der Bäume immer wieder neu und lassen bekannte Motive in unterschiedlichen Stimmungen erscheinen.
29/30.01.2026
- Eine Diashow über Vielfalt, Form und Zeit
Bäume begleiten den Menschen seit jeher. Sie prägen Landschaften, strukturieren Räume und verändern sich mit den Jahreszeiten. In dieser Diashow rücken Bäume in ihren unterschiedlichen Facetten in den Mittelpunkt – als Einzelerscheinung, als Teil eines Waldes und als prägendes Element in natürlichen wie auch gestalteten Umgebungen.
Die gezeigten Bilder widmen sich der Vielfalt der Formen und Strukturen. Mächtige Stämme, feine Zweige, ausladende Kronen und detailreiche Rinden erzählen von Wachstum, Anpassung und Zeit. Licht und Schatten verändern die Wirkung der Bäume immer wieder neu und lassen bekannte Motive in unterschiedlichen Stimmungen erscheinen.
Ein weiterer Fokus liegt auf den jahreszeitlichen Veränderungen. Knospen, frisches Laub, volle Kronen und kahle Äste zeigen den Kreislauf des Werdens und Vergehens. Jede Phase hat ihren eigenen Charakter und macht deutlich, wie wandelbar und zugleich beständig Bäume sind.
Die Diashow betrachtet Bäume aus verschiedenen Perspektiven.
Nahaufnahmen lenken den Blick auf Details, während weite Einstellungen ihre Bedeutung im Raum sichtbar machen. So entsteht ein vielschichtiges Bild, das sowohl Ruhe als auch Dynamik vermittelt.
Ziel der Bilderserie ist es, die Aufmerksamkeit auf die oft selbstverständliche Präsenz von Bäumen zu lenken. Sie lädt dazu ein, genauer hinzusehen und die Vielfalt wahrzunehmen, die in jedem einzelnen Baum steckt. Die Diashow versteht sich als visuelle Annäherung an ein Thema, das Natur, Zeit und Umgebung miteinander verbindet.
In der Aufnahme von Dieter Zinßer
Die Diashow betrachtet Bäume aus verschiedenen Perspektiven.
Nahaufnahmen lenken den Blick auf Details, während weite Einstellungen ihre Bedeutung im Raum sichtbar machen. So entsteht ein vielschichtiges Bild, das sowohl Ruhe als auch Dynamik vermittelt.
Ziel der Bilderserie ist es, die Aufmerksamkeit auf die oft selbstverständliche Präsenz von Bäumen zu lenken. Sie lädt dazu ein, genauer hinzusehen und die Vielfalt wahrzunehmen, die in jedem einzelnen Baum steckt. Die Diashow versteht sich als visuelle Annäherung an ein Thema, das Natur, Zeit und Umgebung miteinander verbindet.
In der Aufnahme von Dieter Zinßer
- Baum Impressionen
Artenschutz in Franken®
Hecken und Feldgehölze – grüne Lebensadern unserer Landschaft

Hecken und Feldgehölze – grüne Lebensadern unserer Landschaft
28/29.01.2026
Als verbindende Elemente zwischen verschiedenen Lebensräumen sind sie unverzichtbar für den Erhalt der biologischen Vielfalt.
Hotspots der Artenvielfalt
In Hecken und Feldgehölzen finden zahlreiche Tier- und Pflanzenarten Nahrung, Schutz und Fortpflanzungsmöglichkeiten. Vögel nutzen sie als Brut- und Rastplätze, Säugetiere wie Igel oder Haselmäuse als Rückzugsraum, während Insekten – darunter Wildbienen, Schmetterlinge und Käfer – auf das vielfältige Blüten- und Strukturangebot angewiesen sind. Auch viele Pflanzenarten, Moose und Flechten profitieren von den unterschiedlichen Licht-, Feuchte- und Bodenverhältnissen.
28/29.01.2026
- Hecken und Feldgehölze gehören zu den artenreichsten Strukturen unserer Kulturlandschaft. Sie prägen seit Jahrhunderten Felder, Wiesen und Wege und erfüllen dabei eine Vielzahl ökologischer Funktionen.
Als verbindende Elemente zwischen verschiedenen Lebensräumen sind sie unverzichtbar für den Erhalt der biologischen Vielfalt.
Hotspots der Artenvielfalt
In Hecken und Feldgehölzen finden zahlreiche Tier- und Pflanzenarten Nahrung, Schutz und Fortpflanzungsmöglichkeiten. Vögel nutzen sie als Brut- und Rastplätze, Säugetiere wie Igel oder Haselmäuse als Rückzugsraum, während Insekten – darunter Wildbienen, Schmetterlinge und Käfer – auf das vielfältige Blüten- und Strukturangebot angewiesen sind. Auch viele Pflanzenarten, Moose und Flechten profitieren von den unterschiedlichen Licht-, Feuchte- und Bodenverhältnissen.
Darüber hinaus wirken Hecken als Wanderkorridore, die es Arten ermöglichen, zwischen einzelnen Lebensräumen zu wechseln. Gerade in einer zunehmend zerschnittenen Landschaft sind diese Verbindungen von entscheidender Bedeutung.
Akute Gefährdung wertvoller Strukturen
Trotz ihres hohen ökologischen Wertes sind Hecken und Feldgehölze heute stark gefährdet. In den vergangenen Jahrzehnten gingen große Teile dieser Strukturen verloren oder wurden stark beeinträchtigt. Ursachen dafür sind vor allem die Intensivierung der Landwirtschaft, Flurbereinigung, Flächenversiegelung sowie der Ausbau von Verkehrs- und Siedlungsflächen.
Auch eine unsachgemäße oder zu häufige Pflege stellt ein Problem dar. Radikale Rückschnitte, das Entfernen von Alt- und Totholz oder das Schneiden während der Brutzeit zerstören wichtige Lebensräume. Hinzu kommt der Eintrag von Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln aus angrenzenden Flächen, der die Artenzusammensetzung nachhaltig verändert.
Auswirkungen des Klimawandels
Der Klimawandel stellt Hecken und Feldgehölze vor zusätzliche Herausforderungen. Längere Trockenperioden, steigende Temperaturen und zunehmende Wetterextreme setzen vor allem jungen Gehölzen und flach wurzelnden Arten zu. Die Artenzusammensetzung kann sich verschieben, während empfindliche Strauch- und Baumarten zurückgedrängt werden.
Gleichzeitig verlieren Hecken ihre wichtige Funktion als Klimapuffer, wenn sie geschwächt oder ausgedünnt werden. Intakte Gehölzstrukturen tragen zur Kühlung der Landschaft bei, speichern Kohlenstoff, schützen Böden vor Erosion und mindern die Auswirkungen von Starkregen.
Wie Hecken und Feldgehölze nachhaltig gesichert werden können
Der langfristige Erhalt dieser wertvollen Lebensräume erfordert gemeinsames Handeln. Wichtig sind der Schutz bestehender Hecken, eine fachgerechte und zeitlich angepasste Pflege sowie die Neuanlage strukturreicher Gehölze mit standortheimischen Arten. Breite Hecken mit unterschiedlichen Höhen, Alt- und Totholzanteilen sowie Krautsäumen bieten besonders vielen Arten einen Lebensraum.
Auch jede und jeder Einzelne kann einen Beitrag leisten: durch die Unterstützung von Naturschutzprojekten, das Anlegen heimischer Hecken im eigenen Umfeld, eine naturnahe Gartengestaltung oder durch Bewusstsein und Rücksicht im Umgang mit der Landschaft.
Hecken und Feldgehölze sind weit mehr als landschaftliche Elemente – sie sind lebenswichtige Rückzugsräume, Klimaschützer und Vernetzer der Natur. Ihr Schutz ist ein zentraler Baustein für den Erhalt der Artenvielfalt und eine lebenswerte Landschaft für kommende Generationen.
In der Aufnahme von Johannes Rother
Akute Gefährdung wertvoller Strukturen
Trotz ihres hohen ökologischen Wertes sind Hecken und Feldgehölze heute stark gefährdet. In den vergangenen Jahrzehnten gingen große Teile dieser Strukturen verloren oder wurden stark beeinträchtigt. Ursachen dafür sind vor allem die Intensivierung der Landwirtschaft, Flurbereinigung, Flächenversiegelung sowie der Ausbau von Verkehrs- und Siedlungsflächen.
Auch eine unsachgemäße oder zu häufige Pflege stellt ein Problem dar. Radikale Rückschnitte, das Entfernen von Alt- und Totholz oder das Schneiden während der Brutzeit zerstören wichtige Lebensräume. Hinzu kommt der Eintrag von Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln aus angrenzenden Flächen, der die Artenzusammensetzung nachhaltig verändert.
Auswirkungen des Klimawandels
Der Klimawandel stellt Hecken und Feldgehölze vor zusätzliche Herausforderungen. Längere Trockenperioden, steigende Temperaturen und zunehmende Wetterextreme setzen vor allem jungen Gehölzen und flach wurzelnden Arten zu. Die Artenzusammensetzung kann sich verschieben, während empfindliche Strauch- und Baumarten zurückgedrängt werden.
Gleichzeitig verlieren Hecken ihre wichtige Funktion als Klimapuffer, wenn sie geschwächt oder ausgedünnt werden. Intakte Gehölzstrukturen tragen zur Kühlung der Landschaft bei, speichern Kohlenstoff, schützen Böden vor Erosion und mindern die Auswirkungen von Starkregen.
Wie Hecken und Feldgehölze nachhaltig gesichert werden können
Der langfristige Erhalt dieser wertvollen Lebensräume erfordert gemeinsames Handeln. Wichtig sind der Schutz bestehender Hecken, eine fachgerechte und zeitlich angepasste Pflege sowie die Neuanlage strukturreicher Gehölze mit standortheimischen Arten. Breite Hecken mit unterschiedlichen Höhen, Alt- und Totholzanteilen sowie Krautsäumen bieten besonders vielen Arten einen Lebensraum.
Auch jede und jeder Einzelne kann einen Beitrag leisten: durch die Unterstützung von Naturschutzprojekten, das Anlegen heimischer Hecken im eigenen Umfeld, eine naturnahe Gartengestaltung oder durch Bewusstsein und Rücksicht im Umgang mit der Landschaft.
Hecken und Feldgehölze sind weit mehr als landschaftliche Elemente – sie sind lebenswichtige Rückzugsräume, Klimaschützer und Vernetzer der Natur. Ihr Schutz ist ein zentraler Baustein für den Erhalt der Artenvielfalt und eine lebenswerte Landschaft für kommende Generationen.
In der Aufnahme von Johannes Rother
- Neuntöter im Regen
Artenschutz in Franken®
Blätter – Zweige – Regentropfen

Blätter – Zweige – Regentropfen
28/29.01.2026
Manchmal sind es die kleinen Dinge, die eine besondere Wirkung entfalten. Ein einzelnes Blatt, ein feiner Zweig, ein Regentropfen, der kurz innehält, bevor er fällt. In dieser Diashow rücken solche unscheinbaren Details in den Mittelpunkt und machen sichtbar, was im Alltag leicht übersehen wird.
Die gezeigten Bilder fangen Momentaufnahmen aus der Natur ein, in denen Formen, Strukturen und Licht eine zentrale Rolle spielen. Blätter zeigen ihre Maserungen, Zweige zeichnen feine Linien in den Raum, und Regentropfen verbinden beide zu flüchtigen Augenblicken. Dabei entsteht ein Wechselspiel aus Ruhe und Bewegung, aus Nähe und Distanz.
28/29.01.2026
- Eine Diashow stiller Naturmomente
Manchmal sind es die kleinen Dinge, die eine besondere Wirkung entfalten. Ein einzelnes Blatt, ein feiner Zweig, ein Regentropfen, der kurz innehält, bevor er fällt. In dieser Diashow rücken solche unscheinbaren Details in den Mittelpunkt und machen sichtbar, was im Alltag leicht übersehen wird.
Die gezeigten Bilder fangen Momentaufnahmen aus der Natur ein, in denen Formen, Strukturen und Licht eine zentrale Rolle spielen. Blätter zeigen ihre Maserungen, Zweige zeichnen feine Linien in den Raum, und Regentropfen verbinden beide zu flüchtigen Augenblicken. Dabei entsteht ein Wechselspiel aus Ruhe und Bewegung, aus Nähe und Distanz.
Regentropfen verändern die Wahrnehmung der Umgebung.
Sie legen sich auf Oberflächen, bündeln Licht und lassen Farben intensiver erscheinen. Auf Blättern sammeln sie sich in kleinen Perlen, an Zweigen folgen sie natürlichen Linien. Jeder Tropfen erzählt von Vergänglichkeit und von dem ständigen Wandel in der Natur.
Die Diashow versteht sich als Einladung zum bewussten Hinschauen. Sie zeigt keine spektakulären Szenen, sondern konzentriert sich auf einfache Motive, die durch ihre Reduktion wirken. Durch die Abfolge der Bilder entsteht ein ruhiger Rhythmus, der Zeit lässt für Beobachtung und eigene Gedanken.
Blätter, Zweige und Regentropfen bilden dabei ein gemeinsames Thema: Sie stehen für Verbindung, Wachstum und Veränderung. In ihrer Kombination zeigen sie, wie eng einzelne Elemente der Natur miteinander verknüpft sind. Die Diashow macht diese Zusammenhänge sichtbar und eröffnet neue Perspektiven auf vertraute Motive.
Ob als kurze Auszeit oder als bewusster Rundgang durch natürliche Details – diese Bilderserie lädt dazu ein, den Blick zu verlangsamen und die leisen Eindrücke der Natur wahrzunehmen.
In der Aufnahme von Dieter Zinßer
Sie legen sich auf Oberflächen, bündeln Licht und lassen Farben intensiver erscheinen. Auf Blättern sammeln sie sich in kleinen Perlen, an Zweigen folgen sie natürlichen Linien. Jeder Tropfen erzählt von Vergänglichkeit und von dem ständigen Wandel in der Natur.
Die Diashow versteht sich als Einladung zum bewussten Hinschauen. Sie zeigt keine spektakulären Szenen, sondern konzentriert sich auf einfache Motive, die durch ihre Reduktion wirken. Durch die Abfolge der Bilder entsteht ein ruhiger Rhythmus, der Zeit lässt für Beobachtung und eigene Gedanken.
Blätter, Zweige und Regentropfen bilden dabei ein gemeinsames Thema: Sie stehen für Verbindung, Wachstum und Veränderung. In ihrer Kombination zeigen sie, wie eng einzelne Elemente der Natur miteinander verknüpft sind. Die Diashow macht diese Zusammenhänge sichtbar und eröffnet neue Perspektiven auf vertraute Motive.
Ob als kurze Auszeit oder als bewusster Rundgang durch natürliche Details – diese Bilderserie lädt dazu ein, den Blick zu verlangsamen und die leisen Eindrücke der Natur wahrzunehmen.
In der Aufnahme von Dieter Zinßer
- Grünes Blatt im Sonnenlicht mit vielen Wasserperlen
Artenschutz in Franken®
Aurorafalter (Anthocharis cardamines)

Der Aurorafalter (Anthocharis cardamines)
28/29.01.2026
An einem kühlen Frühlingsmorgen, wenn der Tau noch auf den Wiesen liegt und die Sonne vorsichtig über den Horizont steigt, flattert ein kleiner Schmetterling über die ersten blühenden Pflanzen. Seine weißen Flügel leuchten im Licht, durchzogen von auffälligen orangefarbenen Spitzen.
Für einen kurzen Augenblick scheint er stillzustehen, als wolle er prüfen, ob der Winter wirklich vorbei ist. Es ist der Aurorafalter – ein Bote des Frühlings, der jedes Jahr neu zeigt, dass das Leben zurückkehrt.
28/29.01.2026
- Ein Frühlingsmoment
An einem kühlen Frühlingsmorgen, wenn der Tau noch auf den Wiesen liegt und die Sonne vorsichtig über den Horizont steigt, flattert ein kleiner Schmetterling über die ersten blühenden Pflanzen. Seine weißen Flügel leuchten im Licht, durchzogen von auffälligen orangefarbenen Spitzen.
Für einen kurzen Augenblick scheint er stillzustehen, als wolle er prüfen, ob der Winter wirklich vorbei ist. Es ist der Aurorafalter – ein Bote des Frühlings, der jedes Jahr neu zeigt, dass das Leben zurückkehrt.
Artbeschreibung
Der Aurorafalter (Anthocharis cardamines) gehört zur Familie der Weißlinge (Pieridae) und ist in weiten Teilen Europas verbreitet. Besonders auffällig sind die Männchen mit ihren leuchtend orange gefärbten Flügelspitzen, die an einen Sonnenaufgang erinnern. Die Weibchen sind schlichter gefärbt und besitzen überwiegend weiße Flügel mit dunklen Zeichnungen. Beide Geschlechter zeigen auf der Flügelunterseite ein marmoriertes Grün-Weiß-Muster, das ihnen eine hervorragende Tarnung in der Vegetation bietet.
Der Aurorafalter bevorzugt halboffene Landschaften wie feuchte Wiesen, Waldränder, Bachufer und naturnahe Gärten. Seine Raupen ernähren sich hauptsächlich von Kreuzblütlern wie Wiesenschaumkraut oder Knoblauchsrauke. Die Art bildet in der Regel nur eine Generation pro Jahr aus und überwintert als Puppe, gut verborgen in der Vegetation.
Perspektive im Wandel von Lebensraum und Klima
Die Zukunft des Aurorafalters ist eng mit dem Zustand seiner Lebensräume verknüpft. Durch intensive Landwirtschaft, den Rückgang artenreicher Wiesen und die zunehmende Versiegelung von Flächen gehen wichtige Nahrungs- und Entwicklungsräume verloren. Besonders problematisch ist das Verschwinden der spezifischen Futterpflanzen, auf die die Raupen angewiesen sind.
Der Klimawandel stellt eine zusätzliche Herausforderung dar. Frühere Frühlinge können dazu führen, dass Falter schlüpfen, bevor ausreichend Nahrungspflanzen verfügbar sind. Gleichzeitig können extreme Wetterereignisse wie lange Trockenperioden oder Starkregen die empfindlichen Entwicklungsstadien beeinträchtigen. Dennoch zeigt der Aurorafalter auch eine gewisse Anpassungsfähigkeit, indem er neue Lebensräume erschließt, wenn geeignete Bedingungen vorhanden sind.
Der Schutz strukturreicher Landschaften, der Erhalt heimischer Blühpflanzen und eine naturnahe Gestaltung von Grünflächen können dazu beitragen, dem Aurorafalter auch in Zukunft einen Platz in unserer Umwelt zu sichern. So bleibt er weiterhin ein leuchtendes Zeichen des Frühlings und ein Indikator für die Gesundheit unserer Landschaften.
In der Aufnahme von Dieter Zinßer
Der Aurorafalter (Anthocharis cardamines) gehört zur Familie der Weißlinge (Pieridae) und ist in weiten Teilen Europas verbreitet. Besonders auffällig sind die Männchen mit ihren leuchtend orange gefärbten Flügelspitzen, die an einen Sonnenaufgang erinnern. Die Weibchen sind schlichter gefärbt und besitzen überwiegend weiße Flügel mit dunklen Zeichnungen. Beide Geschlechter zeigen auf der Flügelunterseite ein marmoriertes Grün-Weiß-Muster, das ihnen eine hervorragende Tarnung in der Vegetation bietet.
Der Aurorafalter bevorzugt halboffene Landschaften wie feuchte Wiesen, Waldränder, Bachufer und naturnahe Gärten. Seine Raupen ernähren sich hauptsächlich von Kreuzblütlern wie Wiesenschaumkraut oder Knoblauchsrauke. Die Art bildet in der Regel nur eine Generation pro Jahr aus und überwintert als Puppe, gut verborgen in der Vegetation.
Perspektive im Wandel von Lebensraum und Klima
Die Zukunft des Aurorafalters ist eng mit dem Zustand seiner Lebensräume verknüpft. Durch intensive Landwirtschaft, den Rückgang artenreicher Wiesen und die zunehmende Versiegelung von Flächen gehen wichtige Nahrungs- und Entwicklungsräume verloren. Besonders problematisch ist das Verschwinden der spezifischen Futterpflanzen, auf die die Raupen angewiesen sind.
Der Klimawandel stellt eine zusätzliche Herausforderung dar. Frühere Frühlinge können dazu führen, dass Falter schlüpfen, bevor ausreichend Nahrungspflanzen verfügbar sind. Gleichzeitig können extreme Wetterereignisse wie lange Trockenperioden oder Starkregen die empfindlichen Entwicklungsstadien beeinträchtigen. Dennoch zeigt der Aurorafalter auch eine gewisse Anpassungsfähigkeit, indem er neue Lebensräume erschließt, wenn geeignete Bedingungen vorhanden sind.
Der Schutz strukturreicher Landschaften, der Erhalt heimischer Blühpflanzen und eine naturnahe Gestaltung von Grünflächen können dazu beitragen, dem Aurorafalter auch in Zukunft einen Platz in unserer Umwelt zu sichern. So bleibt er weiterhin ein leuchtendes Zeichen des Frühlings und ein Indikator für die Gesundheit unserer Landschaften.
In der Aufnahme von Dieter Zinßer
- Männlicher Aurorafalter mit leuchtend orangefarbenen Flügelspitzen auf einer Frühlingsblüte
Artenschutz in Franken®
Amphibienwanderung – eine lebenswichtige und gefährliche Reise

Amphibienwanderung – eine lebenswichtige und gefährliche Reise
27/28.01.2026
Frösche, Kröten und Molche verlassen ihre Winterquartiere und machen sich – oft bei Einbruch der Dunkelheit und bei feuchtem Wetter – auf den Weg zu den Gewässern, in denen sie selbst geboren wurden. Diese meist unscheinbare Wanderung ist für den Fortbestand vieler Arten unverzichtbar, stellt die Tiere jedoch vor enorme Herausforderungen.
27/28.01.2026
- In den kommenden Wochen beginnt erneut eines der bedeutendsten Naturereignisse des Jahres: die Massenwanderung heimischer Amphibien zu ihren Laichplätzen.
Frösche, Kröten und Molche verlassen ihre Winterquartiere und machen sich – oft bei Einbruch der Dunkelheit und bei feuchtem Wetter – auf den Weg zu den Gewässern, in denen sie selbst geboren wurden. Diese meist unscheinbare Wanderung ist für den Fortbestand vieler Arten unverzichtbar, stellt die Tiere jedoch vor enorme Herausforderungen.
Gefahren auf dem Weg zu den Laichgewässern
Während ihrer Wanderung sind Amphibien zahlreichen Gefahren ausgesetzt. Eine der größten Bedrohungen ist der Straßenverkehr. Straßen und Wege schneiden traditionelle Wanderrouten und führen jedes Jahr zum Tod unzähliger Tiere. Besonders in warmen, regnerischen Nächten kommt es zu hohen Verlusten, wenn ganze Populationen gleichzeitig unterwegs sind.
Weitere Risiken ergeben sich durch die Zerschneidung und Verarmung der Landschaft. Versiegelte Flächen, Bebauung, intensive Landwirtschaft sowie Entwässerungsgräben oder Bordsteine erschweren oder verhindern das Erreichen der Laichgewässer. Viele Tiere bleiben in ungeeigneten Lebensräumen zurück oder sterben an Erschöpfung und Austrocknung.
Amphibien unter Druck: Klimawandel und Lebensraumverlust
Die ohnehin angespannte Situation wird durch den Klimawandel weiter verschärft. Veränderte Niederschlagsmuster, zunehmende Trockenperioden und steigende Temperaturen wirken sich direkt auf Amphibien aus, die auf feuchte Lebensräume angewiesen sind. Laichgewässer trocknen früher aus oder entstehen gar nicht mehr, während extreme Wetterereignisse die empfindlichen Entwicklungsstadien von Eiern und Kaulquappen gefährden.
Gleichzeitig geht der Verlust geeigneter Lebensräume ungebremst weiter. Naturnahe Feuchtgebiete, Tümpel, Gräben und Auenlandschaften verschwinden oder werden stark verändert. Auch der Rückgang strukturreicher Landschaften mit Hecken, Wiesen und kleinen Waldflächen nimmt Amphibien wichtige Rückzugs-, Nahrungs- und Überwinterungsräume. Viele Populationen werden dadurch isoliert und langfristig geschwächt.
Die große Bedeutung von Amphibien für das Ökosystem
Amphibien erfüllen eine zentrale Rolle in unseren Ökosystemen. Als Bindeglied zwischen Wasser- und Landlebensräumen sind sie wichtige Bestandteile beider Lebensräume. Sie regulieren Insektenbestände, indem sie große Mengen an Mücken, Fliegen und anderen Wirbellosen fressen, und tragen so zu einem natürlichen Gleichgewicht bei.
Gleichzeitig dienen Amphibien selbst als Nahrungsquelle für zahlreiche Tierarten, darunter Vögel, Säugetiere, Reptilien und Fische. Ihr Rückgang wirkt sich daher auf ganze Nahrungsketten aus. Zudem gelten Amphibien als wichtige Bioindikatoren: Aufgrund ihrer durchlässigen Haut und ihrer komplexen Lebensweise reagieren sie besonders sensibel auf Umweltveränderungen. Ihr Zustand liefert wertvolle Hinweise auf die Qualität von Lebensräumen und den allgemeinen Zustand der Umwelt.
Schutz und Verantwortung
Der Schutz wandernder Amphibien ist daher nicht nur Artenschutz, sondern auch aktiver Naturschutz für ganze Ökosysteme. Temporäre Schutzzäune, Amphibientunnel, die Pflege von Laichgewässern sowie Rücksichtnahme im Straßenverkehr können dazu beitragen, Verluste deutlich zu reduzieren. Ebenso wichtig ist der langfristige Erhalt und die Wiederherstellung geeigneter Lebensräume.
Die Amphibienwanderung macht jedes Jahr aufs Neue sichtbar, wie eng Natur und menschliche Nutzung miteinander verwoben sind – und wie wichtig verantwortungsvolles Handeln ist, um diese faszinierenden und unverzichtbaren Tiere auch für kommende Generationen zu bewahren.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
Während ihrer Wanderung sind Amphibien zahlreichen Gefahren ausgesetzt. Eine der größten Bedrohungen ist der Straßenverkehr. Straßen und Wege schneiden traditionelle Wanderrouten und führen jedes Jahr zum Tod unzähliger Tiere. Besonders in warmen, regnerischen Nächten kommt es zu hohen Verlusten, wenn ganze Populationen gleichzeitig unterwegs sind.
Weitere Risiken ergeben sich durch die Zerschneidung und Verarmung der Landschaft. Versiegelte Flächen, Bebauung, intensive Landwirtschaft sowie Entwässerungsgräben oder Bordsteine erschweren oder verhindern das Erreichen der Laichgewässer. Viele Tiere bleiben in ungeeigneten Lebensräumen zurück oder sterben an Erschöpfung und Austrocknung.
Amphibien unter Druck: Klimawandel und Lebensraumverlust
Die ohnehin angespannte Situation wird durch den Klimawandel weiter verschärft. Veränderte Niederschlagsmuster, zunehmende Trockenperioden und steigende Temperaturen wirken sich direkt auf Amphibien aus, die auf feuchte Lebensräume angewiesen sind. Laichgewässer trocknen früher aus oder entstehen gar nicht mehr, während extreme Wetterereignisse die empfindlichen Entwicklungsstadien von Eiern und Kaulquappen gefährden.
Gleichzeitig geht der Verlust geeigneter Lebensräume ungebremst weiter. Naturnahe Feuchtgebiete, Tümpel, Gräben und Auenlandschaften verschwinden oder werden stark verändert. Auch der Rückgang strukturreicher Landschaften mit Hecken, Wiesen und kleinen Waldflächen nimmt Amphibien wichtige Rückzugs-, Nahrungs- und Überwinterungsräume. Viele Populationen werden dadurch isoliert und langfristig geschwächt.
Die große Bedeutung von Amphibien für das Ökosystem
Amphibien erfüllen eine zentrale Rolle in unseren Ökosystemen. Als Bindeglied zwischen Wasser- und Landlebensräumen sind sie wichtige Bestandteile beider Lebensräume. Sie regulieren Insektenbestände, indem sie große Mengen an Mücken, Fliegen und anderen Wirbellosen fressen, und tragen so zu einem natürlichen Gleichgewicht bei.
Gleichzeitig dienen Amphibien selbst als Nahrungsquelle für zahlreiche Tierarten, darunter Vögel, Säugetiere, Reptilien und Fische. Ihr Rückgang wirkt sich daher auf ganze Nahrungsketten aus. Zudem gelten Amphibien als wichtige Bioindikatoren: Aufgrund ihrer durchlässigen Haut und ihrer komplexen Lebensweise reagieren sie besonders sensibel auf Umweltveränderungen. Ihr Zustand liefert wertvolle Hinweise auf die Qualität von Lebensräumen und den allgemeinen Zustand der Umwelt.
Schutz und Verantwortung
Der Schutz wandernder Amphibien ist daher nicht nur Artenschutz, sondern auch aktiver Naturschutz für ganze Ökosysteme. Temporäre Schutzzäune, Amphibientunnel, die Pflege von Laichgewässern sowie Rücksichtnahme im Straßenverkehr können dazu beitragen, Verluste deutlich zu reduzieren. Ebenso wichtig ist der langfristige Erhalt und die Wiederherstellung geeigneter Lebensräume.
Die Amphibienwanderung macht jedes Jahr aufs Neue sichtbar, wie eng Natur und menschliche Nutzung miteinander verwoben sind – und wie wichtig verantwortungsvolles Handeln ist, um diese faszinierenden und unverzichtbaren Tiere auch für kommende Generationen zu bewahren.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
- Erdkrötenpaar auf dem Weg zum Laichgewässer
Artenschutz in Franken®
Gemeiner Efeu (Hedera helix)

Der Gemeine Efeu (Hedera helix)
27/28.01.2026
Zunächst unscheinbar, kaum beachtet, tastete er sich vorsichtig über den rauen Untergrund. Jahr für Jahr kam ein weiteres Blatt hinzu, dann noch eines. Während um ihn herum Menschen kamen und gingen, Häuser renoviert und Wege neu gepflastert wurden, blieb der Efeu. Er wuchs langsam, aber stetig, passte sich an, fand Halt in kleinsten Ritzen und verband schließlich Mauer, Boden und Baum zu einem grünen Geflecht. So erzählt der Efeu nicht von Eile, sondern von Beständigkeit.
27/28.01.2026
- An einer alten Steinmauer, die schon viele Winter und Sommer gesehen hat, begann vor langer Zeit ein einzelner Trieb zu wachsen.
Zunächst unscheinbar, kaum beachtet, tastete er sich vorsichtig über den rauen Untergrund. Jahr für Jahr kam ein weiteres Blatt hinzu, dann noch eines. Während um ihn herum Menschen kamen und gingen, Häuser renoviert und Wege neu gepflastert wurden, blieb der Efeu. Er wuchs langsam, aber stetig, passte sich an, fand Halt in kleinsten Ritzen und verband schließlich Mauer, Boden und Baum zu einem grünen Geflecht. So erzählt der Efeu nicht von Eile, sondern von Beständigkeit.
Artbeschreibung
Der Gemeine Efeu, auch Gewöhnlicher Efeu oder kurz Efeu genannt (Hedera helix), ist eine immergrüne Kletterpflanze aus der Familie der Araliengewächse. Er ist in weiten Teilen Europas heimisch und gehört zu den bekanntesten Wildpflanzen unserer Kulturlandschaft. Seine Fähigkeit, Mauern, Bäume und Felsen zu erklimmen, macht ihn unverwechselbar.
Charakteristisch sind seine ledrigen, dunkelgrünen Blätter, die je nach Entwicklungsphase unterschiedlich geformt sind. Während die Jugendform meist gelappte Blätter zeigt, entwickeln ältere, blühfähige Triebe eher ungelappte, eiförmige Blätter. Diese Besonderheit ist ein typisches Merkmal des Efeus.
Der Efeu haftet sich mithilfe kleiner Haftwurzeln an Oberflächen, ohne dabei aktiv in das Material einzudringen. Er ist eine langlebige Pflanze, die mehrere Jahrzehnte alt werden kann. Besonders bemerkenswert ist seine Blütezeit: Der Efeu blüht spät im Jahr, meist im Herbst, und bietet damit eine wichtige Nahrungsquelle für Insekten, wenn andere Pflanzen bereits verblüht sind. Die dunklen Beeren reifen im Frühjahr und dienen verschiedenen Vogelarten als Nahrung.
Lebensraum und ökologische Bedeutung
Der Gemeine Efeu ist äußerst anpassungsfähig. Er wächst in Wäldern, Parks, Gärten, an Gebäuden und auf Friedhöfen. Er bevorzugt schattige bis halbschattige Standorte, kommt jedoch auch mit sonnigeren Lagen zurecht, sofern ausreichend Feuchtigkeit vorhanden ist.
Ökologisch spielt der Efeu eine wichtige Rolle. Er bietet Schutz, Nahrung und Lebensraum für zahlreiche Tierarten. Insekten nutzen seine Blüten, Vögel finden Nistplätze im dichten Blattwerk, und Kleinsäuger profitieren von der Struktur und dem Mikroklima, das der Efeu schafft.
Perspektive im Wandel von Lebensraum und Klima
Durch Veränderungen der Lebensräume und den fortschreitenden Klimawandel steht auch der Gemeine Efeu vor neuen Herausforderungen. Steigende Temperaturen und mildere Winter können seine Ausbreitung begünstigen, insbesondere in städtischen Räumen. Gleichzeitig führen längere Trockenperioden und Extremwetterereignisse dazu, dass der Wasserstress für die Pflanze zunimmt, vor allem an exponierten Standorten.
In Städten könnte der Efeu künftig eine noch größere Rolle spielen. Als immergrüne Pflanze trägt er zur Verbesserung des Mikroklimas bei, bindet Staub und kann Fassaden beschatten. In naturnahen Lebensräumen hingegen hängt seine Zukunft stark davon ab, wie Wälder bewirtschaftet und Grünflächen erhalten werden.
Langfristig zeigt der Gemeine Efeu, wie anpassungsfähig manche Pflanzenarten sind. Seine Fähigkeit, sich neuen Bedingungen anzupassen, macht ihn zu einem stillen Begleiter des Wandels. Gleichzeitig erinnert er daran, wie wichtig vielfältige und stabile Lebensräume sind, damit auch robuste Arten dauerhaft bestehen können.
In der Aufnahme von Dieter Zinßer
Der Gemeine Efeu, auch Gewöhnlicher Efeu oder kurz Efeu genannt (Hedera helix), ist eine immergrüne Kletterpflanze aus der Familie der Araliengewächse. Er ist in weiten Teilen Europas heimisch und gehört zu den bekanntesten Wildpflanzen unserer Kulturlandschaft. Seine Fähigkeit, Mauern, Bäume und Felsen zu erklimmen, macht ihn unverwechselbar.
Charakteristisch sind seine ledrigen, dunkelgrünen Blätter, die je nach Entwicklungsphase unterschiedlich geformt sind. Während die Jugendform meist gelappte Blätter zeigt, entwickeln ältere, blühfähige Triebe eher ungelappte, eiförmige Blätter. Diese Besonderheit ist ein typisches Merkmal des Efeus.
Der Efeu haftet sich mithilfe kleiner Haftwurzeln an Oberflächen, ohne dabei aktiv in das Material einzudringen. Er ist eine langlebige Pflanze, die mehrere Jahrzehnte alt werden kann. Besonders bemerkenswert ist seine Blütezeit: Der Efeu blüht spät im Jahr, meist im Herbst, und bietet damit eine wichtige Nahrungsquelle für Insekten, wenn andere Pflanzen bereits verblüht sind. Die dunklen Beeren reifen im Frühjahr und dienen verschiedenen Vogelarten als Nahrung.
Lebensraum und ökologische Bedeutung
Der Gemeine Efeu ist äußerst anpassungsfähig. Er wächst in Wäldern, Parks, Gärten, an Gebäuden und auf Friedhöfen. Er bevorzugt schattige bis halbschattige Standorte, kommt jedoch auch mit sonnigeren Lagen zurecht, sofern ausreichend Feuchtigkeit vorhanden ist.
Ökologisch spielt der Efeu eine wichtige Rolle. Er bietet Schutz, Nahrung und Lebensraum für zahlreiche Tierarten. Insekten nutzen seine Blüten, Vögel finden Nistplätze im dichten Blattwerk, und Kleinsäuger profitieren von der Struktur und dem Mikroklima, das der Efeu schafft.
Perspektive im Wandel von Lebensraum und Klima
Durch Veränderungen der Lebensräume und den fortschreitenden Klimawandel steht auch der Gemeine Efeu vor neuen Herausforderungen. Steigende Temperaturen und mildere Winter können seine Ausbreitung begünstigen, insbesondere in städtischen Räumen. Gleichzeitig führen längere Trockenperioden und Extremwetterereignisse dazu, dass der Wasserstress für die Pflanze zunimmt, vor allem an exponierten Standorten.
In Städten könnte der Efeu künftig eine noch größere Rolle spielen. Als immergrüne Pflanze trägt er zur Verbesserung des Mikroklimas bei, bindet Staub und kann Fassaden beschatten. In naturnahen Lebensräumen hingegen hängt seine Zukunft stark davon ab, wie Wälder bewirtschaftet und Grünflächen erhalten werden.
Langfristig zeigt der Gemeine Efeu, wie anpassungsfähig manche Pflanzenarten sind. Seine Fähigkeit, sich neuen Bedingungen anzupassen, macht ihn zu einem stillen Begleiter des Wandels. Gleichzeitig erinnert er daran, wie wichtig vielfältige und stabile Lebensräume sind, damit auch robuste Arten dauerhaft bestehen können.
In der Aufnahme von Dieter Zinßer
- Junger Efeu mit alter Kastanie
Artenschutz in Franken®
Acker-Witwenblume (Knautia arvensis)

Die Acker-Witwenblume (Knautia arvensis)
27/28.01.2026
An einem warmen Sommertag, wenn die Felder in der Ferne flimmern und das Gras am Wegesrand leise raschelt, steht sie oft unauffällig zwischen Gräsern und Kräutern: die Acker-Witwenblume. Während Bienen und Schmetterlinge von Blüte zu Blüte ziehen, bietet sie ihnen verlässlich Nahrung.
Generationen von Insekten haben hier Rast gemacht, ohne dass viele Menschen Notiz davon nahmen. Doch gerade diese stille Beständigkeit macht die Acker-Witwenblume zu einem besonderen Bestandteil unserer Kulturlandschaft.
27/28.01.2026
- Eine kleine Geschichte vom Feldrand
An einem warmen Sommertag, wenn die Felder in der Ferne flimmern und das Gras am Wegesrand leise raschelt, steht sie oft unauffällig zwischen Gräsern und Kräutern: die Acker-Witwenblume. Während Bienen und Schmetterlinge von Blüte zu Blüte ziehen, bietet sie ihnen verlässlich Nahrung.
Generationen von Insekten haben hier Rast gemacht, ohne dass viele Menschen Notiz davon nahmen. Doch gerade diese stille Beständigkeit macht die Acker-Witwenblume zu einem besonderen Bestandteil unserer Kulturlandschaft.
Artbeschreibung
Die Acker-Witwenblume (Knautia arvensis) ist eine ausdauernde, krautige Pflanze aus der Familie der Geißblattgewächse. Sie erreicht meist Wuchshöhen zwischen 30 und 80 Zentimetern. Charakteristisch sind ihre hellvioletten bis bläulich-violetten Blütenköpfe, die aus vielen kleinen Einzelblüten bestehen und auf langen, schlanken Stängeln sitzen.
Die Blütezeit erstreckt sich in der Regel von Juni bis in den Herbst. Die tief eingeschnittenen Grundblätter bilden eine Rosette, während die Stängelblätter schmaler und weniger stark gelappt sind. Die Acker-Witwenblume bevorzugt sonnige Standorte mit nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen Böden und ist typisch für Wiesen, Feldraine, Wegränder und extensiv genutztes Grünland.
Ökologisch ist die Art von großer Bedeutung: Sie dient zahlreichen Wildbienen, Schmetterlingen und anderen Insekten als wichtige Nahrungsquelle und trägt damit wesentlich zur Förderung der Artenvielfalt bei.
Perspektiven im Wandel von Lebensraum und Klima
In den letzten Jahrzehnten hat sich der Lebensraum der Acker-Witwenblume deutlich verändert. Intensive Landwirtschaft, häufige Mahd, der Verlust von Feldrainen sowie der steigende Nährstoffeintrag in Böden führen dazu, dass konkurrenzstarke Pflanzen zunehmen und lichtliebende Arten wie die Acker-Witwenblume zunehmend verdrängt werden.
Der Klimawandel bringt zusätzliche Herausforderungen mit sich. Längere Trockenperioden, veränderte Niederschlagsmuster und Extremwetterereignisse beeinflussen Wachstum und Blütezeit. Gleichzeitig besitzt die Acker-Witwenblume eine gewisse Anpassungsfähigkeit: Ihre tiefer reichenden Wurzeln helfen ihr, auch trockene Phasen zu überstehen, sofern geeignete Standorte erhalten bleiben.
Die Zukunft der Acker-Witwenblume hängt daher maßgeblich vom Erhalt und der Förderung strukturreicher, extensiv genutzter Lebensräume ab. Blühstreifen, artenreiche Wiesen und naturnahe Randbereiche können wichtige Rückzugsorte darstellen. Wo ihr Raum gegeben wird, bleibt die Acker-Witwenblume ein fester Bestandteil unserer Landschaft – und ein stiller Verbündeter im Kampf gegen den Rückgang der Insektenvielfalt.
In der Aufnahme von Dieter Zinßer
Die Acker-Witwenblume (Knautia arvensis) ist eine ausdauernde, krautige Pflanze aus der Familie der Geißblattgewächse. Sie erreicht meist Wuchshöhen zwischen 30 und 80 Zentimetern. Charakteristisch sind ihre hellvioletten bis bläulich-violetten Blütenköpfe, die aus vielen kleinen Einzelblüten bestehen und auf langen, schlanken Stängeln sitzen.
Die Blütezeit erstreckt sich in der Regel von Juni bis in den Herbst. Die tief eingeschnittenen Grundblätter bilden eine Rosette, während die Stängelblätter schmaler und weniger stark gelappt sind. Die Acker-Witwenblume bevorzugt sonnige Standorte mit nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen Böden und ist typisch für Wiesen, Feldraine, Wegränder und extensiv genutztes Grünland.
Ökologisch ist die Art von großer Bedeutung: Sie dient zahlreichen Wildbienen, Schmetterlingen und anderen Insekten als wichtige Nahrungsquelle und trägt damit wesentlich zur Förderung der Artenvielfalt bei.
Perspektiven im Wandel von Lebensraum und Klima
In den letzten Jahrzehnten hat sich der Lebensraum der Acker-Witwenblume deutlich verändert. Intensive Landwirtschaft, häufige Mahd, der Verlust von Feldrainen sowie der steigende Nährstoffeintrag in Böden führen dazu, dass konkurrenzstarke Pflanzen zunehmen und lichtliebende Arten wie die Acker-Witwenblume zunehmend verdrängt werden.
Der Klimawandel bringt zusätzliche Herausforderungen mit sich. Längere Trockenperioden, veränderte Niederschlagsmuster und Extremwetterereignisse beeinflussen Wachstum und Blütezeit. Gleichzeitig besitzt die Acker-Witwenblume eine gewisse Anpassungsfähigkeit: Ihre tiefer reichenden Wurzeln helfen ihr, auch trockene Phasen zu überstehen, sofern geeignete Standorte erhalten bleiben.
Die Zukunft der Acker-Witwenblume hängt daher maßgeblich vom Erhalt und der Förderung strukturreicher, extensiv genutzter Lebensräume ab. Blühstreifen, artenreiche Wiesen und naturnahe Randbereiche können wichtige Rückzugsorte darstellen. Wo ihr Raum gegeben wird, bleibt die Acker-Witwenblume ein fester Bestandteil unserer Landschaft – und ein stiller Verbündeter im Kampf gegen den Rückgang der Insektenvielfalt.
In der Aufnahme von Dieter Zinßer
- Blühende Acker-Witwenblume
Artenschutz in Franken®
Impressionen Winter 2026

Impressionen Winter 2026
Der Winter 2026 steht für eine Jahreszeit voller Gegensätze und besonderer Stimmungen.
Wenn die Temperaturen sinken und die Landschaft zur Ruhe kommt, entstehen Momente, die im Alltag oft nur flüchtig wahrgenommen werden. Diese Diashow lädt dazu ein, genau diese Augenblicke festzuhalten und aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten.
- 26/27.01.2026
Der Winter 2026 steht für eine Jahreszeit voller Gegensätze und besonderer Stimmungen.
Wenn die Temperaturen sinken und die Landschaft zur Ruhe kommt, entstehen Momente, die im Alltag oft nur flüchtig wahrgenommen werden. Diese Diashow lädt dazu ein, genau diese Augenblicke festzuhalten und aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten.
Winterliche Szenen zeichnen sich durch ihre Klarheit und Schlichtheit aus.
Schneebedeckte Flächen, vereiste Details und das gedämpfte Licht der kurzen Tage verleihen der Umgebung eine besondere Atmosphäre. Farben wirken zurückhaltender, Formen treten deutlicher hervor und die Natur zeigt sich reduziert, aber zugleich ausdrucksstark. In dieser Reduktion liegt eine eigene Schönheit, die Raum für Ruhe und Konzentration schafft.
Die hier gezeigten Impressionen spiegeln unterschiedliche Facetten des Winters 2026 wider. Mal sind es weite Landschaften, die durch ihre Stille beeindrucken, mal kleine Details, die erst auf den zweiten Blick ihre Wirkung entfalten. Spuren im Schnee, Lichtreflexionen auf Eisflächen oder der Kontrast zwischen Himmel und Boden erzählen von Bewegung, Vergänglichkeit und Beständigkeit zugleich.
Der Winter verändert nicht nur die Natur, sondern auch die Wahrnehmung.
Geräusche werden gedämpft, Abläufe verlangsamen sich, und der Blick richtet sich stärker auf das Wesentliche. Genau diese Wirkung greift die Diashow auf. Sie versteht sich nicht als vollständige Darstellung, sondern als Sammlung von Eindrücken, die Raum für eigene Gedanken und Interpretationen lassen.
Jedes Bild steht für einen Moment, der den Charakter der kalten Jahreszeit widerspiegelt. Zusammen ergeben sie ein Gesamtbild, das den Winter 2026 nicht festlegt, sondern erlebbar macht.
Ob als kurze Pause im Alltag oder als gezielter Rundgang durch winterliche Szenen – die Impressionen bieten unterschiedliche Zugänge und laden dazu ein, den Winter aus neuen Blickwinkeln zu entdecken.
In der Aufnahme von Dieter Zinßer
Schneebedeckte Flächen, vereiste Details und das gedämpfte Licht der kurzen Tage verleihen der Umgebung eine besondere Atmosphäre. Farben wirken zurückhaltender, Formen treten deutlicher hervor und die Natur zeigt sich reduziert, aber zugleich ausdrucksstark. In dieser Reduktion liegt eine eigene Schönheit, die Raum für Ruhe und Konzentration schafft.
Die hier gezeigten Impressionen spiegeln unterschiedliche Facetten des Winters 2026 wider. Mal sind es weite Landschaften, die durch ihre Stille beeindrucken, mal kleine Details, die erst auf den zweiten Blick ihre Wirkung entfalten. Spuren im Schnee, Lichtreflexionen auf Eisflächen oder der Kontrast zwischen Himmel und Boden erzählen von Bewegung, Vergänglichkeit und Beständigkeit zugleich.
Der Winter verändert nicht nur die Natur, sondern auch die Wahrnehmung.
Geräusche werden gedämpft, Abläufe verlangsamen sich, und der Blick richtet sich stärker auf das Wesentliche. Genau diese Wirkung greift die Diashow auf. Sie versteht sich nicht als vollständige Darstellung, sondern als Sammlung von Eindrücken, die Raum für eigene Gedanken und Interpretationen lassen.
Jedes Bild steht für einen Moment, der den Charakter der kalten Jahreszeit widerspiegelt. Zusammen ergeben sie ein Gesamtbild, das den Winter 2026 nicht festlegt, sondern erlebbar macht.
Ob als kurze Pause im Alltag oder als gezielter Rundgang durch winterliche Szenen – die Impressionen bieten unterschiedliche Zugänge und laden dazu ein, den Winter aus neuen Blickwinkeln zu entdecken.
In der Aufnahme von Dieter Zinßer
- Winterimpressionen
Artenschutz in Franken®
Marderhund (Nyctereutes procyonoides)

Der Marderhund (Nyctereutes procyonoides)
26/27.01.2026
Der Nebel liegt tief über der feuchten Wiese, als sich am Rand des Waldes eine gedrungene Gestalt bewegt. Vorsichtig setzt sie Pfote vor Pfote, die Nase dicht über dem Boden. Für einen Moment hält das Tier inne, lauscht, dann verschwindet es lautlos im Unterholz.
Wer dieses nächtliche Schauspiel beobachtet, begegnet einem der unauffälligsten Wildtiere unserer Landschaft: dem Marderhund. Meist bleibt er unbemerkt, doch seine Spuren erzählen von einer stillen Präsenz in Wäldern, Auen und Feldfluren.
26/27.01.2026
- Eine nächtliche Begegnung am Waldrand
Der Nebel liegt tief über der feuchten Wiese, als sich am Rand des Waldes eine gedrungene Gestalt bewegt. Vorsichtig setzt sie Pfote vor Pfote, die Nase dicht über dem Boden. Für einen Moment hält das Tier inne, lauscht, dann verschwindet es lautlos im Unterholz.
Wer dieses nächtliche Schauspiel beobachtet, begegnet einem der unauffälligsten Wildtiere unserer Landschaft: dem Marderhund. Meist bleibt er unbemerkt, doch seine Spuren erzählen von einer stillen Präsenz in Wäldern, Auen und Feldfluren.
Artbeschreibung: Der Marderhund (Nyctereutes procyonoides)
Der Marderhund (Nyctereutes procyonoides) gehört zur Familie der Hunde (Canidae) und ist damit näher mit Fuchs und Wolf verwandt als mit Mardern. Sein Name leitet sich von seinem gedrungenen Körperbau und der maskenartigen Gesichtszeichnung ab, die an einen Waschbären erinnert.
Er erreicht eine Kopf-Rumpf-Länge von etwa 50 bis 70 Zentimetern und besitzt einen buschigen Schwanz. Das Fell ist dicht und meist graubraun gefärbt, was ihn gut tarnt. Charakteristisch sind die kurzen Beine und die dunklen Augenflecken.
Marderhunde sind überwiegend dämmerungs- und nachtaktiv. Sie gelten als opportunistische Allesfresser und nehmen je nach Jahreszeit Kleinsäuger, Amphibien, Insekten, Aas sowie pflanzliche Nahrung wie Beeren oder Früchte auf. Bevorzugt leben sie in feuchten, strukturreichen Lebensräumen wie Auen, Bruchwäldern, Mooren und Gewässernähe, nutzen aber auch landwirtschaftlich geprägte Landschaften.
Perspektive im Wandel von Lebensraum und Klima
Infolge von Lebensraumveränderungen hat sich der Marderhund in den letzten Jahrzehnten in vielen Regionen Europas etabliert. Die Umgestaltung von Landschaften, Entwässerung von Feuchtgebieten und zunehmende Fragmentierung natürlicher Lebensräume verändern jedoch seine Lebensbedingungen. Gleichzeitig profitiert die Art teilweise von strukturreichen Kulturlandschaften und milden Wintern.
Der Klimawandel beeinflusst den Marderhund auf unterschiedliche Weise. Mildere Winter begünstigen seine Überlebenschancen, da er in kalten Regionen normalerweise eine Winterruhe hält. Gleichzeitig können veränderte Niederschlagsmuster und der Rückgang feuchter Lebensräume seine bevorzugten Habitate einschränken.
Langfristig wird die Zukunft des Marderhundes davon abhängen, wie Landschaften genutzt und vernetzt werden. Naturnahe Gewässerräume, Rückzugsflächen und eine vielfältige Umgebung tragen dazu bei, ökologische Gleichgewichte zu erhalten. Der Marderhund bleibt damit ein Beispiel für die Anpassungsfähigkeit von Wildtieren – aber auch für die komplexen Folgen menschlicher Eingriffe in natürliche Systeme.
In der Aufnahme von Johannes Rother
Der Marderhund (Nyctereutes procyonoides) gehört zur Familie der Hunde (Canidae) und ist damit näher mit Fuchs und Wolf verwandt als mit Mardern. Sein Name leitet sich von seinem gedrungenen Körperbau und der maskenartigen Gesichtszeichnung ab, die an einen Waschbären erinnert.
Er erreicht eine Kopf-Rumpf-Länge von etwa 50 bis 70 Zentimetern und besitzt einen buschigen Schwanz. Das Fell ist dicht und meist graubraun gefärbt, was ihn gut tarnt. Charakteristisch sind die kurzen Beine und die dunklen Augenflecken.
Marderhunde sind überwiegend dämmerungs- und nachtaktiv. Sie gelten als opportunistische Allesfresser und nehmen je nach Jahreszeit Kleinsäuger, Amphibien, Insekten, Aas sowie pflanzliche Nahrung wie Beeren oder Früchte auf. Bevorzugt leben sie in feuchten, strukturreichen Lebensräumen wie Auen, Bruchwäldern, Mooren und Gewässernähe, nutzen aber auch landwirtschaftlich geprägte Landschaften.
Perspektive im Wandel von Lebensraum und Klima
Infolge von Lebensraumveränderungen hat sich der Marderhund in den letzten Jahrzehnten in vielen Regionen Europas etabliert. Die Umgestaltung von Landschaften, Entwässerung von Feuchtgebieten und zunehmende Fragmentierung natürlicher Lebensräume verändern jedoch seine Lebensbedingungen. Gleichzeitig profitiert die Art teilweise von strukturreichen Kulturlandschaften und milden Wintern.
Der Klimawandel beeinflusst den Marderhund auf unterschiedliche Weise. Mildere Winter begünstigen seine Überlebenschancen, da er in kalten Regionen normalerweise eine Winterruhe hält. Gleichzeitig können veränderte Niederschlagsmuster und der Rückgang feuchter Lebensräume seine bevorzugten Habitate einschränken.
Langfristig wird die Zukunft des Marderhundes davon abhängen, wie Landschaften genutzt und vernetzt werden. Naturnahe Gewässerräume, Rückzugsflächen und eine vielfältige Umgebung tragen dazu bei, ökologische Gleichgewichte zu erhalten. Der Marderhund bleibt damit ein Beispiel für die Anpassungsfähigkeit von Wildtieren – aber auch für die komplexen Folgen menschlicher Eingriffe in natürliche Systeme.
In der Aufnahme von Johannes Rother
- Marderhund - Einwanderer mit Ausbreitungstendenzen
Artenschutz in Franken®
Innovative Naturschutzprojekte zum Schutz von Wasseramsel und Gebirgsstelze

Innovative Naturschutzprojekte zum Schutz von Wasseramsel und Gebirgsstelze
26/27.01.2026
Als Verein engagieren wir uns aktiv für den Schutz gefährdeter und spezialisierter Vogelarten. Ein besonderer Schwerpunkt unserer Arbeit liegt auf der Wasseramsel (Cinclus cinclus) und der Gebirgsstelze (Motacilla cinerea) – zwei charakteristischen Vogelarten naturnaher Fließgewässer.
26/27.01.2026
- Der Erhalt artenreicher und naturnaher Lebensräume ist eine der zentralen Aufgaben des modernen Naturschutzes.
Als Verein engagieren wir uns aktiv für den Schutz gefährdeter und spezialisierter Vogelarten. Ein besonderer Schwerpunkt unserer Arbeit liegt auf der Wasseramsel (Cinclus cinclus) und der Gebirgsstelze (Motacilla cinerea) – zwei charakteristischen Vogelarten naturnaher Fließgewässer.
Bedeutung der Arten und ihrer Lebensräume
Wasseramsel und Gebirgsstelze sind eng an saubere, strukturreiche Bäche und Flüsse gebunden. Sie benötigen klare Gewässer mit einem guten Nahrungsangebot, naturnahe Uferstrukturen sowie geeignete Brutplätze in unmittelbarer Wassernähe. Durch Gewässerausbau, Uferbefestigungen, intensive Landnutzung und zunehmende Störungen gehen solche Lebensräume vielerorts verloren oder werden stark beeinträchtigt.
Als sogenannte Zeigerarten geben Wasseramsel und Gebirgsstelze wichtige Hinweise auf den ökologischen Zustand eines Gewässers. Ihr Schutz trägt daher nicht nur zum Erhalt einzelner Arten bei, sondern verbessert zugleich die ökologische Qualität ganzer Bach- und Flusssysteme.
Unsere Zielsetzung
Auf unseren vereinseigenen Flächen bringen wir gezielt innovative und langfristig angelegte Projekte auf den Weg, um geeignete Lebensräume für Wasseramsel und Gebirgsstelze zu sichern, aufzuwerten und neu zu schaffen. Unser Ziel ist es, stabile Populationen zu fördern und die natürlichen Bestände nachhaltig zu stärken.
Dabei verfolgen wir einen ganzheitlichen Ansatz, der den Schutz der Arten mit der Entwicklung naturnaher Landschaften verbindet.
Maßnahmen und Projektansätze
Unsere Projekte umfassen unter anderem:
Ein besonderer Fokus liegt auf der Erprobung neuer, praxisnaher Lösungen, die auch auf andere Flächen übertragbar sind und als Vorbild für zukünftige Naturschutzprojekte dienen können.
Zusammenarbeit und Engagement
Unsere Arbeit basiert auf der Kombination von fachlicher Kompetenz, ehrenamtlichem Engagement und regionaler Vernetzung. In enger Zusammenarbeit mit Naturschutzfachleuten, Behörden und weiteren Akteuren setzen wir unsere Projekte verantwortungsvoll und fachlich fundiert um.
Beitrag zum Erhalt der biologischen Vielfalt
Mit unseren Maßnahmen leisten wir einen aktiven Beitrag zum Schutz der biologischen Vielfalt und zur Förderung naturnaher Gewässerlandschaften. Der gezielte Einsatz auf vereinseigenen Flächen zeigt, wie Naturschutz konkret, wirksam und nachhaltig umgesetzt werden kann – zum Nutzen von Wasseramsel, Gebirgsstelze und vieler weiterer Tier- und Pflanzenarten.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
Wasseramsel und Gebirgsstelze sind eng an saubere, strukturreiche Bäche und Flüsse gebunden. Sie benötigen klare Gewässer mit einem guten Nahrungsangebot, naturnahe Uferstrukturen sowie geeignete Brutplätze in unmittelbarer Wassernähe. Durch Gewässerausbau, Uferbefestigungen, intensive Landnutzung und zunehmende Störungen gehen solche Lebensräume vielerorts verloren oder werden stark beeinträchtigt.
Als sogenannte Zeigerarten geben Wasseramsel und Gebirgsstelze wichtige Hinweise auf den ökologischen Zustand eines Gewässers. Ihr Schutz trägt daher nicht nur zum Erhalt einzelner Arten bei, sondern verbessert zugleich die ökologische Qualität ganzer Bach- und Flusssysteme.
Unsere Zielsetzung
Auf unseren vereinseigenen Flächen bringen wir gezielt innovative und langfristig angelegte Projekte auf den Weg, um geeignete Lebensräume für Wasseramsel und Gebirgsstelze zu sichern, aufzuwerten und neu zu schaffen. Unser Ziel ist es, stabile Populationen zu fördern und die natürlichen Bestände nachhaltig zu stärken.
Dabei verfolgen wir einen ganzheitlichen Ansatz, der den Schutz der Arten mit der Entwicklung naturnaher Landschaften verbindet.
Maßnahmen und Projektansätze
Unsere Projekte umfassen unter anderem:
- Ökologische Aufwertung von Fließgewässern, z. B. durch die Förderung natürlicher Bachstrukturen, das Einbringen von Totholz und Steinen sowie die Verbesserung der Strömungsvielfalt
- Entwicklung strukturreicher Uferzonen, die Schutz, Nahrung und Ruhe bieten
- Schaffung und Erhalt geeigneter Brutplätze, sowohl durch natürliche Strukturen als auch durch gezielte, artgerechte Nisthilfen
- Pflege und Sicherung angrenzender Lebensräume, etwa durch extensive Bewirtschaftung und den Erhalt naturnaher Vegetation
- Beobachtung und Monitoring, um den Erfolg der Maßnahmen langfristig zu bewerten und weiterzuentwickeln
Ein besonderer Fokus liegt auf der Erprobung neuer, praxisnaher Lösungen, die auch auf andere Flächen übertragbar sind und als Vorbild für zukünftige Naturschutzprojekte dienen können.
Zusammenarbeit und Engagement
Unsere Arbeit basiert auf der Kombination von fachlicher Kompetenz, ehrenamtlichem Engagement und regionaler Vernetzung. In enger Zusammenarbeit mit Naturschutzfachleuten, Behörden und weiteren Akteuren setzen wir unsere Projekte verantwortungsvoll und fachlich fundiert um.
Beitrag zum Erhalt der biologischen Vielfalt
Mit unseren Maßnahmen leisten wir einen aktiven Beitrag zum Schutz der biologischen Vielfalt und zur Förderung naturnaher Gewässerlandschaften. Der gezielte Einsatz auf vereinseigenen Flächen zeigt, wie Naturschutz konkret, wirksam und nachhaltig umgesetzt werden kann – zum Nutzen von Wasseramsel, Gebirgsstelze und vieler weiterer Tier- und Pflanzenarten.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
- Gebirgsstelze
Artenschutz in Franken®
Gewöhnlicher Natternkopf (Echium vulgare)

Der Gewöhnliche Natternkopf (Echium vulgare)
25/26.01.2026
Eine Wildbiene landet kurz, verschwindet wieder, und schon die nächste folgt. Der Gewöhnliche Natternkopf steht unbeirrt da – scheinbar unscheinbar, und doch ein stiller Treffpunkt für das Leben. Während viele Pflanzen unter der Hitze leiden, trotzt er der Sonne und erzählt von Anpassung, Ausdauer und Wandel.
25/26.01.2026
- An einem warmen Sommertag summt es leise am Wegesrand. Zwischen Kies und trockenem Boden ragt eine Pflanze mit leuchtend blauen Blüten empor.
Eine Wildbiene landet kurz, verschwindet wieder, und schon die nächste folgt. Der Gewöhnliche Natternkopf steht unbeirrt da – scheinbar unscheinbar, und doch ein stiller Treffpunkt für das Leben. Während viele Pflanzen unter der Hitze leiden, trotzt er der Sonne und erzählt von Anpassung, Ausdauer und Wandel.
Artbeschreibung: Gewöhnlicher Natternkopf (Echium vulgare)
Der Gewöhnliche Natternkopf gehört zur Familie der Raublattgewächse (Boraginaceae) und ist eine zweijährige, krautige Pflanze. Er erreicht Wuchshöhen von etwa 30 bis 100 Zentimetern. Charakteristisch sind seine schmalen, rau behaarten Blätter und der aufrechte, meist unverzweigte Stängel.
Besonders auffällig sind die Blüten: Sie erscheinen zunächst rosafarben und färben sich im Verlauf der Blütezeit intensiv blau bis violett. Diese Farbveränderung dient als Signal für bestäubende Insekten und macht den Natternkopf zu einer wertvollen Nahrungsquelle für Bienen, Hummeln und Schmetterlinge. Die Blütezeit reicht in der Regel von Mai bis September.
Der Gewöhnliche Natternkopf bevorzugt trockene, sonnige Standorte wie Wegränder, Böschungen, Schotterflächen oder Magerrasen. Er ist anspruchslos, tiefwurzelnd und gut an nährstoffarme Böden angepasst.
Perspektive im Wandel: Lebensraumveränderung und Klimawandel
Lebensraumveränderungen durch intensive Landwirtschaft, Flächenversiegelung und den Rückgang extensiv genutzter Offenlandschaften setzen dem Gewöhnlichen Natternkopf zunehmend zu. Gleichzeitig eröffnen ihm klimatische Veränderungen neue Chancen: Seine Trockenheitsresistenz und Vorliebe für Wärme machen ihn vergleichsweise widerstandsfähig gegenüber steigenden Temperaturen.
In Regionen mit zunehmender Sommerdürre könnte der Natternkopf künftig sogar an Bedeutung gewinnen – insbesondere als Nahrungsquelle für Insekten, wenn andere Blühpflanzen ausfallen. Entscheidend für seine Zukunft wird jedoch sein, ob ausreichend offene, ungedüngte und sonnige Standorte erhalten oder neu geschaffen werden. Naturnahe Flächenpflege und der Verzicht auf übermäßige Bodenbearbeitung können dazu beitragen, diese robuste und ökologisch wertvolle Art langfristig zu fördern.
In der Aufnahme von Dieter Zinßer
Der Gewöhnliche Natternkopf gehört zur Familie der Raublattgewächse (Boraginaceae) und ist eine zweijährige, krautige Pflanze. Er erreicht Wuchshöhen von etwa 30 bis 100 Zentimetern. Charakteristisch sind seine schmalen, rau behaarten Blätter und der aufrechte, meist unverzweigte Stängel.
Besonders auffällig sind die Blüten: Sie erscheinen zunächst rosafarben und färben sich im Verlauf der Blütezeit intensiv blau bis violett. Diese Farbveränderung dient als Signal für bestäubende Insekten und macht den Natternkopf zu einer wertvollen Nahrungsquelle für Bienen, Hummeln und Schmetterlinge. Die Blütezeit reicht in der Regel von Mai bis September.
Der Gewöhnliche Natternkopf bevorzugt trockene, sonnige Standorte wie Wegränder, Böschungen, Schotterflächen oder Magerrasen. Er ist anspruchslos, tiefwurzelnd und gut an nährstoffarme Böden angepasst.
Perspektive im Wandel: Lebensraumveränderung und Klimawandel
Lebensraumveränderungen durch intensive Landwirtschaft, Flächenversiegelung und den Rückgang extensiv genutzter Offenlandschaften setzen dem Gewöhnlichen Natternkopf zunehmend zu. Gleichzeitig eröffnen ihm klimatische Veränderungen neue Chancen: Seine Trockenheitsresistenz und Vorliebe für Wärme machen ihn vergleichsweise widerstandsfähig gegenüber steigenden Temperaturen.
In Regionen mit zunehmender Sommerdürre könnte der Natternkopf künftig sogar an Bedeutung gewinnen – insbesondere als Nahrungsquelle für Insekten, wenn andere Blühpflanzen ausfallen. Entscheidend für seine Zukunft wird jedoch sein, ob ausreichend offene, ungedüngte und sonnige Standorte erhalten oder neu geschaffen werden. Naturnahe Flächenpflege und der Verzicht auf übermäßige Bodenbearbeitung können dazu beitragen, diese robuste und ökologisch wertvolle Art langfristig zu fördern.
In der Aufnahme von Dieter Zinßer
- Blühender Gewöhnlicher Natternkopf am sonnigen Wegesrand
Artenschutz in Franken®
Gartenspitzmaus (Crocidura suaveolens)
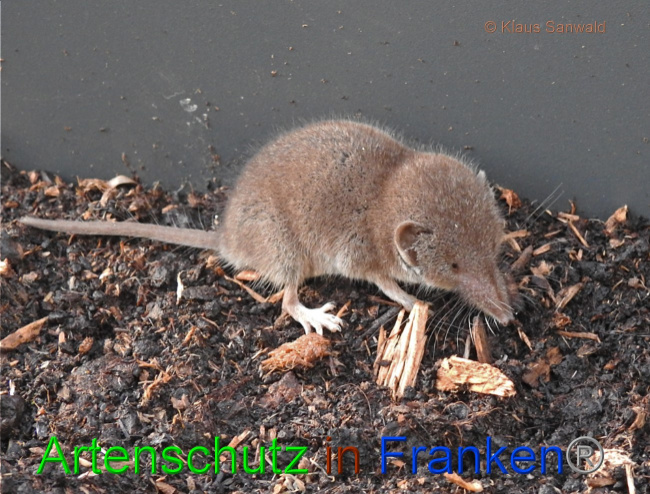
Die Gartenspitzmaus (Crocidura suaveolens)
25/26.01.2026
Es ist früher Abend, und der Garten wirkt still. Zwischen feuchten Laubschichten raschelt es kaum hörbar. Für einen kurzen Moment huscht ein kleines, graubraunes Wesen aus dem Schatten einer Steinmauer hervor. Mit schneller, ruckartiger Bewegung schnuppert es den Boden ab, verschwindet wieder unter den Blättern und hinterlässt kaum eine Spur. Wer genau hinsieht, erkennt die Gartenspitzmaus – ein Tier, das meist verborgen lebt und dennoch ein fester Bestandteil naturnaher Gärten ist.
25/26.01.2026
- Eine leise Begegnung im Garten
Es ist früher Abend, und der Garten wirkt still. Zwischen feuchten Laubschichten raschelt es kaum hörbar. Für einen kurzen Moment huscht ein kleines, graubraunes Wesen aus dem Schatten einer Steinmauer hervor. Mit schneller, ruckartiger Bewegung schnuppert es den Boden ab, verschwindet wieder unter den Blättern und hinterlässt kaum eine Spur. Wer genau hinsieht, erkennt die Gartenspitzmaus – ein Tier, das meist verborgen lebt und dennoch ein fester Bestandteil naturnaher Gärten ist.
Artbeschreibung: Die Gartenspitzmaus (Crocidura suaveolens)
Die Gartenspitzmaus (Crocidura suaveolens) gehört zur Familie der Spitzmäuse und zählt zu den kleineren Vertretern dieser Gruppe. Ihr Körper erreicht eine Länge von etwa 6 bis 8 Zentimetern, hinzu kommt ein relativ kurzer Schwanz. Das Fell ist meist graubraun gefärbt, die Unterseite etwas heller. Charakteristisch sind die spitze Schnauze, die kleinen Augen und die gut entwickelten Tasthaare.
Im Gegensatz zu Mäusen gehört die Gartenspitzmaus nicht zu den Nagetieren, sondern zu den Insektenfressern. Sie ernährt sich vor allem von Insekten, Spinnen, Würmern und anderen kleinen wirbellosen Tieren. Aufgrund ihres hohen Energiebedarfs ist sie fast ständig auf Nahrungssuche, sowohl tagsüber als auch nachts.
Als Lebensraum bevorzugt die Gartenspitzmaus strukturreiche Bereiche: Gärten, Hecken, Wiesenränder, Komposthaufen und lichte Gehölze. Verstecke aus Laub, Steinen oder Totholz sind für sie besonders wichtig, da sie Schutz vor Fressfeinden und Witterung bieten.
Perspektive im Wandel von Lebensraum und Klima
Die Gartenspitzmaus ist zwar anpassungsfähig, doch Lebensraumveränderungen wirken sich zunehmend auf ihre Bestände aus. Aufgeräumte Gärten, versiegelte Flächen und der Verlust von Hecken und Saumstrukturen reduzieren Rückzugsorte und Nahrungsangebote. Auch der Einsatz von Pestiziden kann die Verfügbarkeit von Insekten stark einschränken.
Der Klimawandel bringt zusätzliche Herausforderungen mit sich. Längere Trockenperioden können die Zahl bodenlebender Wirbelloser verringern, während milde Winter den Energiehaushalt der Gartenspitzmaus beeinflussen. Gleichzeitig können extreme Wetterereignisse wie Starkregen ihre Verstecke zerstören.
Eine positive Perspektive ergibt sich dort, wo Gärten und Grünflächen naturnah gestaltet werden. Strukturvielfalt, Laubhaufen, Totholz und ein Verzicht auf chemische Mittel schaffen Lebensräume, in denen die Gartenspitzmaus auch in Zukunft bestehen kann. Sie bleibt damit ein stiller Indikator für die ökologische Qualität unserer unmittelbaren Umgebung.
Aufnahme von Klaus Sanwald
Die Gartenspitzmaus (Crocidura suaveolens) gehört zur Familie der Spitzmäuse und zählt zu den kleineren Vertretern dieser Gruppe. Ihr Körper erreicht eine Länge von etwa 6 bis 8 Zentimetern, hinzu kommt ein relativ kurzer Schwanz. Das Fell ist meist graubraun gefärbt, die Unterseite etwas heller. Charakteristisch sind die spitze Schnauze, die kleinen Augen und die gut entwickelten Tasthaare.
Im Gegensatz zu Mäusen gehört die Gartenspitzmaus nicht zu den Nagetieren, sondern zu den Insektenfressern. Sie ernährt sich vor allem von Insekten, Spinnen, Würmern und anderen kleinen wirbellosen Tieren. Aufgrund ihres hohen Energiebedarfs ist sie fast ständig auf Nahrungssuche, sowohl tagsüber als auch nachts.
Als Lebensraum bevorzugt die Gartenspitzmaus strukturreiche Bereiche: Gärten, Hecken, Wiesenränder, Komposthaufen und lichte Gehölze. Verstecke aus Laub, Steinen oder Totholz sind für sie besonders wichtig, da sie Schutz vor Fressfeinden und Witterung bieten.
Perspektive im Wandel von Lebensraum und Klima
Die Gartenspitzmaus ist zwar anpassungsfähig, doch Lebensraumveränderungen wirken sich zunehmend auf ihre Bestände aus. Aufgeräumte Gärten, versiegelte Flächen und der Verlust von Hecken und Saumstrukturen reduzieren Rückzugsorte und Nahrungsangebote. Auch der Einsatz von Pestiziden kann die Verfügbarkeit von Insekten stark einschränken.
Der Klimawandel bringt zusätzliche Herausforderungen mit sich. Längere Trockenperioden können die Zahl bodenlebender Wirbelloser verringern, während milde Winter den Energiehaushalt der Gartenspitzmaus beeinflussen. Gleichzeitig können extreme Wetterereignisse wie Starkregen ihre Verstecke zerstören.
Eine positive Perspektive ergibt sich dort, wo Gärten und Grünflächen naturnah gestaltet werden. Strukturvielfalt, Laubhaufen, Totholz und ein Verzicht auf chemische Mittel schaffen Lebensräume, in denen die Gartenspitzmaus auch in Zukunft bestehen kann. Sie bleibt damit ein stiller Indikator für die ökologische Qualität unserer unmittelbaren Umgebung.
Aufnahme von Klaus Sanwald
- Gartenspitzmaus als heimlicher Bewohner naturnaher Gärten
Artenschutz in Franken®
Dornige Hauhechel (Ononis spinosa)

Die Dornige Hauhechel (Ononis spinosa)
25/26.01.2026
An einem warmen Sommertag bleibt der Blick an einer unscheinbaren Pflanze hängen, die sich zwischen kiesigem Boden und spärlichem Gras behauptet. Ihre rosafarbenen Blüten leuchten im Sonnenlicht, während dornige Triebe den Boden fest umklammern.
Wo landwirtschaftliche Maschinen einst Halt machten und Weidetiere vorsichtig auswichen, steht sie noch immer: die Dornige Hauhechel. Über Jahrzehnte war sie ein stiller Begleiter der offenen Kulturlandschaft – robust, widerständig und doch zunehmend selten geworden.
25/26.01.2026
- Eine kurze Geschichte aus der Kulturlandschaft
An einem warmen Sommertag bleibt der Blick an einer unscheinbaren Pflanze hängen, die sich zwischen kiesigem Boden und spärlichem Gras behauptet. Ihre rosafarbenen Blüten leuchten im Sonnenlicht, während dornige Triebe den Boden fest umklammern.
Wo landwirtschaftliche Maschinen einst Halt machten und Weidetiere vorsichtig auswichen, steht sie noch immer: die Dornige Hauhechel. Über Jahrzehnte war sie ein stiller Begleiter der offenen Kulturlandschaft – robust, widerständig und doch zunehmend selten geworden.
Artbeschreibung
Die Dornige Hauhechel (Ononis spinosa) ist eine ausdauernde, krautige Pflanze aus der Familie der Fabaceae (Schmetterlingsblütler). Sie erreicht Wuchshöhen von etwa 20 bis 60 Zentimetern und zeichnet sich durch ihren kräftigen, tiefreichenden Wurzelstock aus. Charakteristisch sind die verholzten, dornigen Seitentriebe, die der Art ihren deutschen Namen verleihen.
Die wechselständig angeordneten Blätter sind meist dreiteilig und fein behaart. Die auffälligen, rosafarbenen bis purpurfarbenen Blüten erscheinen zwischen Juni und September und werden bevorzugt von Wildbienen, Hummeln und anderen Insekten besucht. Als Leguminose geht die Dornige Hauhechel eine Symbiose mit stickstoffbindenden Bakterien ein und trägt so zur Nährstoffanreicherung magerer Standorte bei.
Typische Lebensräume sind trockene bis mäßig trockene, nährstoffarme Böden, darunter Magerrasen, Halbtrockenrasen, Wegränder, Böschungen und lichte Weiden. Die Art bevorzugt sonnige Lagen und kalkhaltige Substrate.
Perspektiven unter Lebensraumveränderung und Klimawandel
Die Dornige Hauhechel gilt als Charakterart traditionell genutzter Offenlandschaften. Durch die Intensivierung der Landwirtschaft, den Rückgang extensiver Beweidung sowie den Verlust von Magerrasenflächen sind ihre Lebensräume vielerorts stark fragmentiert oder verschwunden. Gleichzeitig führen Verbuschung und Flächenstilllegung zu einer zunehmenden Beschattung, die für diese lichtliebende Art ungünstig ist.
Der Klimawandel bringt zusätzliche Herausforderungen, eröffnet aber auch neue Dynamiken. Einerseits können längere Trockenperioden und Extremwetterereignisse die Etablierung junger Pflanzen erschweren. Andererseits besitzt die Dornige Hauhechel eine vergleichsweise hohe Trockenheitstoleranz, die ihr auf wärmer werdenden Standorten einen gewissen Wettbewerbsvorteil gegenüber weniger angepassten Arten verschaffen kann.
Langfristig hängt die Zukunft der Dornigen Hauhechel maßgeblich von der Erhaltung und Wiederherstellung extensiv genutzter Offenlandbiotope ab. Maßnahmen wie angepasste Beweidung, schonende Mahd und der Schutz magerer Standorte können dazu beitragen, diese widerstandsfähige, aber spezialisierte Art auch künftig in der Landschaft zu bewahren.
In der Aufnahme von Dieter Zinßer
Die Dornige Hauhechel (Ononis spinosa) ist eine ausdauernde, krautige Pflanze aus der Familie der Fabaceae (Schmetterlingsblütler). Sie erreicht Wuchshöhen von etwa 20 bis 60 Zentimetern und zeichnet sich durch ihren kräftigen, tiefreichenden Wurzelstock aus. Charakteristisch sind die verholzten, dornigen Seitentriebe, die der Art ihren deutschen Namen verleihen.
Die wechselständig angeordneten Blätter sind meist dreiteilig und fein behaart. Die auffälligen, rosafarbenen bis purpurfarbenen Blüten erscheinen zwischen Juni und September und werden bevorzugt von Wildbienen, Hummeln und anderen Insekten besucht. Als Leguminose geht die Dornige Hauhechel eine Symbiose mit stickstoffbindenden Bakterien ein und trägt so zur Nährstoffanreicherung magerer Standorte bei.
Typische Lebensräume sind trockene bis mäßig trockene, nährstoffarme Böden, darunter Magerrasen, Halbtrockenrasen, Wegränder, Böschungen und lichte Weiden. Die Art bevorzugt sonnige Lagen und kalkhaltige Substrate.
Perspektiven unter Lebensraumveränderung und Klimawandel
Die Dornige Hauhechel gilt als Charakterart traditionell genutzter Offenlandschaften. Durch die Intensivierung der Landwirtschaft, den Rückgang extensiver Beweidung sowie den Verlust von Magerrasenflächen sind ihre Lebensräume vielerorts stark fragmentiert oder verschwunden. Gleichzeitig führen Verbuschung und Flächenstilllegung zu einer zunehmenden Beschattung, die für diese lichtliebende Art ungünstig ist.
Der Klimawandel bringt zusätzliche Herausforderungen, eröffnet aber auch neue Dynamiken. Einerseits können längere Trockenperioden und Extremwetterereignisse die Etablierung junger Pflanzen erschweren. Andererseits besitzt die Dornige Hauhechel eine vergleichsweise hohe Trockenheitstoleranz, die ihr auf wärmer werdenden Standorten einen gewissen Wettbewerbsvorteil gegenüber weniger angepassten Arten verschaffen kann.
Langfristig hängt die Zukunft der Dornigen Hauhechel maßgeblich von der Erhaltung und Wiederherstellung extensiv genutzter Offenlandbiotope ab. Maßnahmen wie angepasste Beweidung, schonende Mahd und der Schutz magerer Standorte können dazu beitragen, diese widerstandsfähige, aber spezialisierte Art auch künftig in der Landschaft zu bewahren.
- Mehr zur Dornigen Hauhechel hier auf unseren Seiten
In der Aufnahme von Dieter Zinßer
- Blüte im Gegenlicht
Artenschutz in Franken®
Bienenweide / Bienenfreund / Büschelschön (Phacelia tanacetifolia)

Bienenweide / Bienenfreund / Büschelschön (Phacelia tanacetifolia)
24/25.01.2026
An einem warmen Frühsommertag liegt ein leises Summen über dem Feld. Die Sonne steht noch nicht hoch, doch zwischen zartvioletten Blüten herrscht bereits reges Treiben. Eine Honigbiene landet vorsichtig auf einer geschwungenen Blüte, taucht tief ein und verschwindet beinahe im Blütenkelch.
Neben ihr schwirren Hummeln und Wildbienen, scheinbar schwerelos, von Blüte zu Blüte. Was für den Menschen wie ein ruhiges, farbenfrohes Stück Landschaft wirkt, ist für die Insekten ein gedeckter Tisch – die Büschelschön, auch Bienenfreund genannt, hat ihre Blüten geöffnet.
24/25.01.2026
- Eine kleine Geschichte vom Summen am Feldrand
An einem warmen Frühsommertag liegt ein leises Summen über dem Feld. Die Sonne steht noch nicht hoch, doch zwischen zartvioletten Blüten herrscht bereits reges Treiben. Eine Honigbiene landet vorsichtig auf einer geschwungenen Blüte, taucht tief ein und verschwindet beinahe im Blütenkelch.
Neben ihr schwirren Hummeln und Wildbienen, scheinbar schwerelos, von Blüte zu Blüte. Was für den Menschen wie ein ruhiges, farbenfrohes Stück Landschaft wirkt, ist für die Insekten ein gedeckter Tisch – die Büschelschön, auch Bienenfreund genannt, hat ihre Blüten geöffnet.
Artbeschreibung: Bienenweide mit besonderem Wert
Die Bienenweide Bienenfreund, botanisch Phacelia tanacetifolia, ist eine einjährige Pflanze aus der Familie der Raublattgewächse. Sie erreicht je nach Standort eine Höhe von etwa 50 bis 90 Zentimetern und zeichnet sich durch ihre fein gefiederten Blätter sowie ihre auffälligen, blau-violetten Blüten aus.
Typisch für die Büschelschön sind die eingerollten Blütenstände, die sich nach und nach entfalten. Dadurch verlängert sich die Blütezeit deutlich, was sie zu einer besonders wertvollen Nahrungsquelle für Bienen, Hummeln, Schwebfliegen und andere Bestäuber macht.
Der hohe Nektar- und Pollenertrag, die schnelle Keimung sowie ihre Anspruchslosigkeit gegenüber Boden und Standort haben dazu geführt, dass Phacelia sowohl in der Landwirtschaft als auch in Gärten und auf Ausgleichsflächen weit verbreitet ist. Zusätzlich verbessert sie durch ihre Durchwurzelung die Bodenstruktur und wird häufig als Gründüngung eingesetzt.
Perspektive im Wandel von Lebensraum und Klima
Durch Lebensraumveränderungen, intensive Landnutzung und den Klimawandel stehen viele bestäubende Insekten unter Druck. Blütenreiche Landschaften werden seltener, Blühzeiten verschieben sich und extreme Wetterereignisse nehmen zu.
Hier gewinnt die Büschelschön zunehmend an Bedeutung. Ihre kurze Entwicklungszeit erlaubt flexible Aussaaten, auch als Zwischenfrucht. Selbst in trockeneren Phasen kann sie – bei geeigneter Pflege – noch wertvolle Blüten liefern. In Zeiten steigender Temperaturen und unregelmäßiger Niederschläge bietet sie eine vergleichsweise stabile Nahrungsquelle.
Langfristig wird die gezielte Förderung von Bienenweiden wie dem Bienenfreund ein wichtiger Baustein sein, um ökologische Netzwerke zu stärken. Sie ersetzt zwar keine vielfältigen, naturnahen Lebensräume, kann diese jedoch sinnvoll ergänzen und Übergänge schaffen – besonders in Agrarlandschaften und urbanen Räumen.
In der Aufnahme von Dieter Zinßer
Die Bienenweide Bienenfreund, botanisch Phacelia tanacetifolia, ist eine einjährige Pflanze aus der Familie der Raublattgewächse. Sie erreicht je nach Standort eine Höhe von etwa 50 bis 90 Zentimetern und zeichnet sich durch ihre fein gefiederten Blätter sowie ihre auffälligen, blau-violetten Blüten aus.
Typisch für die Büschelschön sind die eingerollten Blütenstände, die sich nach und nach entfalten. Dadurch verlängert sich die Blütezeit deutlich, was sie zu einer besonders wertvollen Nahrungsquelle für Bienen, Hummeln, Schwebfliegen und andere Bestäuber macht.
Der hohe Nektar- und Pollenertrag, die schnelle Keimung sowie ihre Anspruchslosigkeit gegenüber Boden und Standort haben dazu geführt, dass Phacelia sowohl in der Landwirtschaft als auch in Gärten und auf Ausgleichsflächen weit verbreitet ist. Zusätzlich verbessert sie durch ihre Durchwurzelung die Bodenstruktur und wird häufig als Gründüngung eingesetzt.
Perspektive im Wandel von Lebensraum und Klima
Durch Lebensraumveränderungen, intensive Landnutzung und den Klimawandel stehen viele bestäubende Insekten unter Druck. Blütenreiche Landschaften werden seltener, Blühzeiten verschieben sich und extreme Wetterereignisse nehmen zu.
Hier gewinnt die Büschelschön zunehmend an Bedeutung. Ihre kurze Entwicklungszeit erlaubt flexible Aussaaten, auch als Zwischenfrucht. Selbst in trockeneren Phasen kann sie – bei geeigneter Pflege – noch wertvolle Blüten liefern. In Zeiten steigender Temperaturen und unregelmäßiger Niederschläge bietet sie eine vergleichsweise stabile Nahrungsquelle.
Langfristig wird die gezielte Förderung von Bienenweiden wie dem Bienenfreund ein wichtiger Baustein sein, um ökologische Netzwerke zu stärken. Sie ersetzt zwar keine vielfältigen, naturnahen Lebensräume, kann diese jedoch sinnvoll ergänzen und Übergänge schaffen – besonders in Agrarlandschaften und urbanen Räumen.
In der Aufnahme von Dieter Zinßer
- Bienenfreund, Büschelschön mit Biene.
Artenschutz in Franken®
Gämse (Rupicapra rupicapra)
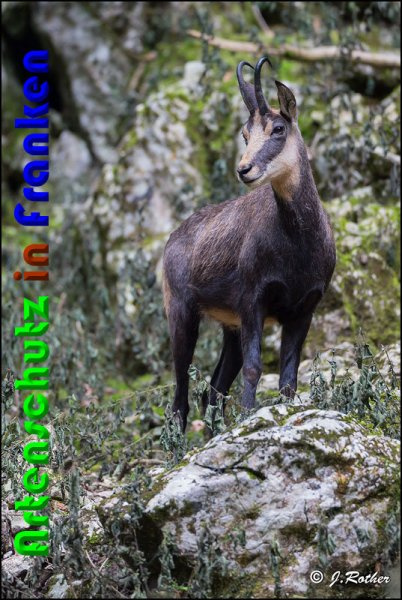
Die Gämse – Meisterin der steilen Wege
24/25.01.2026
Vorsichtig setzt die Gämse einen Huf vor den anderen, prüft den Untergrund, bevor sie weiter aufsteigt. Ein kurzer Blick talwärts, dann verschwindet sie mit wenigen kraftvollen Sprüngen in steilerem Gelände. Für einen flüchtigen Moment wirkt es, als gehöre sie selbst zum Berg – so selbstverständlich bewegt sie sich zwischen Fels, Gras und Himmel.
24/25.01.2026
- Der Morgennebel liegt noch schwer über den Felsen, als sich lautlos eine dunkle Silhouette aus dem Grau löst.
Vorsichtig setzt die Gämse einen Huf vor den anderen, prüft den Untergrund, bevor sie weiter aufsteigt. Ein kurzer Blick talwärts, dann verschwindet sie mit wenigen kraftvollen Sprüngen in steilerem Gelände. Für einen flüchtigen Moment wirkt es, als gehöre sie selbst zum Berg – so selbstverständlich bewegt sie sich zwischen Fels, Gras und Himmel.
Artbeschreibung der Gämse (Rupicapra rupicapra)
Die Gämse (Rupicapra rupicapra) ist eine mittelgroße Paarhuferart aus der Familie der Hornträger (Bovidae). Sie ist vor allem in den Gebirgsregionen Europas verbreitet, darunter die Alpen, die Karpaten sowie Teile des Balkans. Ihr Körperbau ist kompakt und kräftig, optimal angepasst an das Leben im steilen, felsigen Gelände.
Typisch für die Gämse sind die schwarzen, nach hinten gebogenen Hakenhörner, die sowohl Männchen als auch Weibchen tragen. Das Fell wechselt je nach Jahreszeit: Im Sommer ist es kurz und eher hellbraun, im Winter dicht, länger und deutlich dunkler, um vor Kälte zu schützen. Charakteristisch sind zudem der helle Kehlfleck und die dunklen Gesichtszeichnungen, die der Gämse ein markantes Aussehen verleihen.
Gämsen sind ausgezeichnete Kletterer. Ihre schmalen, beweglichen Hufe mit rauer Sohle ermöglichen sicheren Halt selbst auf kleinsten Felssimsen. Sie ernähren sich überwiegend von Gräsern, Kräutern, Blättern und jungen Trieben und passen ihre Nahrung flexibel an das saisonale Angebot an.
Perspektiven der Gämse im Wandel von Lebensraum und Klima
Der Lebensraum der Gämse verändert sich zunehmend. Steigende Temperaturen führen dazu, dass sich die Vegetationszonen in den Bergen nach oben verschieben. Wälder dringen in ehemalige Offenflächen vor, während alpine Rasenflächen kleiner werden. Für die Gämse bedeutet dies eine schrittweise Verlagerung ihres bevorzugten Lebensraums in höhere Lagen.
Gleichzeitig nehmen extreme Wetterereignisse zu: Längere Hitzeperioden, veränderte Schneeverhältnisse und häufigere Starkniederschläge beeinflussen sowohl die Nahrungsverfügbarkeit als auch die Sicherheit des Geländes. Besonders problematisch sind milde Winter mit häufigem Wechsel zwischen Frost und Tauwetter, da sich harte Eisschichten bilden können, die das Erreichen von Futter erschweren.
Dennoch gilt die Gämse als anpassungsfähig. Ihre flexible Nahrungsauswahl, ihr ausgeprägtes Sozialverhalten und ihre Fähigkeit, unterschiedlichste Geländeformen zu nutzen, verschaffen ihr gewisse Vorteile. Langfristig wird jedoch entscheidend sein, wie stark menschliche Nutzung, Lebensraumzerschneidung und Klimaveränderungen voranschreiten. Schutz ruhiger Rückzugsräume und ein verantwortungsvoller Umgang mit alpinen Lebensräumen sind daher zentrale Faktoren für die Zukunft der Gämse.
In der Aufnahme von Johannes Rother
Die Gämse (Rupicapra rupicapra) ist eine mittelgroße Paarhuferart aus der Familie der Hornträger (Bovidae). Sie ist vor allem in den Gebirgsregionen Europas verbreitet, darunter die Alpen, die Karpaten sowie Teile des Balkans. Ihr Körperbau ist kompakt und kräftig, optimal angepasst an das Leben im steilen, felsigen Gelände.
Typisch für die Gämse sind die schwarzen, nach hinten gebogenen Hakenhörner, die sowohl Männchen als auch Weibchen tragen. Das Fell wechselt je nach Jahreszeit: Im Sommer ist es kurz und eher hellbraun, im Winter dicht, länger und deutlich dunkler, um vor Kälte zu schützen. Charakteristisch sind zudem der helle Kehlfleck und die dunklen Gesichtszeichnungen, die der Gämse ein markantes Aussehen verleihen.
Gämsen sind ausgezeichnete Kletterer. Ihre schmalen, beweglichen Hufe mit rauer Sohle ermöglichen sicheren Halt selbst auf kleinsten Felssimsen. Sie ernähren sich überwiegend von Gräsern, Kräutern, Blättern und jungen Trieben und passen ihre Nahrung flexibel an das saisonale Angebot an.
Perspektiven der Gämse im Wandel von Lebensraum und Klima
Der Lebensraum der Gämse verändert sich zunehmend. Steigende Temperaturen führen dazu, dass sich die Vegetationszonen in den Bergen nach oben verschieben. Wälder dringen in ehemalige Offenflächen vor, während alpine Rasenflächen kleiner werden. Für die Gämse bedeutet dies eine schrittweise Verlagerung ihres bevorzugten Lebensraums in höhere Lagen.
Gleichzeitig nehmen extreme Wetterereignisse zu: Längere Hitzeperioden, veränderte Schneeverhältnisse und häufigere Starkniederschläge beeinflussen sowohl die Nahrungsverfügbarkeit als auch die Sicherheit des Geländes. Besonders problematisch sind milde Winter mit häufigem Wechsel zwischen Frost und Tauwetter, da sich harte Eisschichten bilden können, die das Erreichen von Futter erschweren.
Dennoch gilt die Gämse als anpassungsfähig. Ihre flexible Nahrungsauswahl, ihr ausgeprägtes Sozialverhalten und ihre Fähigkeit, unterschiedlichste Geländeformen zu nutzen, verschaffen ihr gewisse Vorteile. Langfristig wird jedoch entscheidend sein, wie stark menschliche Nutzung, Lebensraumzerschneidung und Klimaveränderungen voranschreiten. Schutz ruhiger Rückzugsräume und ein verantwortungsvoller Umgang mit alpinen Lebensräumen sind daher zentrale Faktoren für die Zukunft der Gämse.
In der Aufnahme von Johannes Rother
- Gämsen sind in unseren Breiten Bewohner der alpinen Regionen.Jedoch konnten zwischenzeitlich auch Tiere unter anderem im Schwarzwald und dem Elbsandsteingebirge ausgewildert werden.Gämsen frequentieren wo immer möglich Biotopfenster die sich im Winter fast in Talnähe, in den Sommermonaten bis fast in die Kammlagen der Bergregionen erstrecken.
Artenschutz in Franken®
Unser 2026er Engagement für den Turmfalken

Turmfalken-Projekte 2026 – Geplante Maßnahmen im Überblick
24/25.01.2026
Um seine Bestände langfristig zu sichern, setzen wir im Jahr 2026 mehrere aufeinander abgestimmte Projekte um, die gezielt auf den Schutz der Art und ihres Lebensraums ausgerichtet sind.
24/25.01.2026
- Der Turmfalke (Falco tinnunculus) ist ein fester Bestandteil unserer Kulturlandschaft und zugleich ein wichtiger Indikator für naturnahe Lebensräume.
Um seine Bestände langfristig zu sichern, setzen wir im Jahr 2026 mehrere aufeinander abgestimmte Projekte um, die gezielt auf den Schutz der Art und ihres Lebensraums ausgerichtet sind.
Sicherung und Ausbau von Brutplätzen
Ein Schwerpunkt unserer Arbeit liegt auf der Bereitstellung geeigneter Brutmöglichkeiten. Bestehende Nisthilfen werden überprüft, gereinigt und instand gesetzt. Zusätzlich ist die Installation neuer Nistkästen an geeigneten Gebäuden, Türmen und anderen Strukturen geplant. Ziel ist es, das Angebot an sicheren und störungsarmen Brutplätzen dauerhaft zu erhöhen.
Bestandskontrolle und Bruterfolgsmonitoring
Um die Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen bewerten zu können, wird ein systematisches Monitoring durchgeführt. Dabei werden Brutstandorte regelmäßig kontrolliert und Bruterfolge dokumentiert. Die gewonnenen Daten dienen als Grundlage für die Weiterentwicklung der Projekte und fließen in die regionale Naturschutzarbeit ein.
Verbesserung von Jagd- und Lebensräumen
Neben sicheren Brutplätzen benötigt der Turmfalke strukturreiche Offenflächen als Jagdgebiet. Im Rahmen dieses Projekts sollen lebensraumverbessernde Maßnahmen gefördert werden, etwa durch den Erhalt extensiv genutzter Flächen, Feldränder und anderer landschaftlicher Strukturen, die ein ausreichendes Nahrungsangebot gewährleisten.
Öffentlichkeitsarbeit und Sensibilisierung
Ein weiterer wichtiger Baustein ist die Informations- und Bildungsarbeit. Durch Veröffentlichungen auf der Internetseite, Projektberichte und begleitende Öffentlichkeitsarbeit möchten wir über die Lebensweise des Turmfalken informieren und für seinen Schutz sensibilisieren. Ziel ist es, Verständnis zu schaffen und Unterstützung aus der Bevölkerung zu gewinnen.
Projektziel 2026
Mit den geplanten Turmfalken-Projekten verfolgen wir das Ziel, die Lebensbedingungen dieser Greifvogelart nachhaltig zu verbessern, bestehende Bestände zu stabilisieren und neue Brutstandorte zu fördern. Gleichzeitig soll das Engagement für den Artenschutz sichtbar gemacht und langfristig gestärkt werden.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
Ein Schwerpunkt unserer Arbeit liegt auf der Bereitstellung geeigneter Brutmöglichkeiten. Bestehende Nisthilfen werden überprüft, gereinigt und instand gesetzt. Zusätzlich ist die Installation neuer Nistkästen an geeigneten Gebäuden, Türmen und anderen Strukturen geplant. Ziel ist es, das Angebot an sicheren und störungsarmen Brutplätzen dauerhaft zu erhöhen.
Bestandskontrolle und Bruterfolgsmonitoring
Um die Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen bewerten zu können, wird ein systematisches Monitoring durchgeführt. Dabei werden Brutstandorte regelmäßig kontrolliert und Bruterfolge dokumentiert. Die gewonnenen Daten dienen als Grundlage für die Weiterentwicklung der Projekte und fließen in die regionale Naturschutzarbeit ein.
Verbesserung von Jagd- und Lebensräumen
Neben sicheren Brutplätzen benötigt der Turmfalke strukturreiche Offenflächen als Jagdgebiet. Im Rahmen dieses Projekts sollen lebensraumverbessernde Maßnahmen gefördert werden, etwa durch den Erhalt extensiv genutzter Flächen, Feldränder und anderer landschaftlicher Strukturen, die ein ausreichendes Nahrungsangebot gewährleisten.
Öffentlichkeitsarbeit und Sensibilisierung
Ein weiterer wichtiger Baustein ist die Informations- und Bildungsarbeit. Durch Veröffentlichungen auf der Internetseite, Projektberichte und begleitende Öffentlichkeitsarbeit möchten wir über die Lebensweise des Turmfalken informieren und für seinen Schutz sensibilisieren. Ziel ist es, Verständnis zu schaffen und Unterstützung aus der Bevölkerung zu gewinnen.
Projektziel 2026
Mit den geplanten Turmfalken-Projekten verfolgen wir das Ziel, die Lebensbedingungen dieser Greifvogelart nachhaltig zu verbessern, bestehende Bestände zu stabilisieren und neue Brutstandorte zu fördern. Gleichzeitig soll das Engagement für den Artenschutz sichtbar gemacht und langfristig gestärkt werden.
- Mehr zum Turmfalken hier auf unseren Seiten
- Mehr zu unseren Bemühungen zum Schutz des Turmfalken hier auf unsren Seiten
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- Turmfalkenpaar am Nistplatz bei der Futterübergabe
Artenschutz in Franken®
Feldmaus (Microtus arvalis)

Die Feldmaus (Microtus arvalis)
23/24.01.2026
Ein leises Rascheln, kaum wahrnehmbar, dann ist es wieder still. Unter der Oberfläche der Wiese, verborgen vor Blicken, lebt die Feldmaus. Ihr Alltag spielt sich größtenteils im Verborgenen ab – und doch prägt sie die Landschaft stärker, als man auf den ersten Blick vermuten würde. Wo sie lebt, wird Boden bewegt, Samen verteilt und Nahrungsketten erhalten.
23/24.01.2026
- Noch bevor die Sonne ganz über dem Feldrand steht, bewegt sich etwas im dichten Gras.
Ein leises Rascheln, kaum wahrnehmbar, dann ist es wieder still. Unter der Oberfläche der Wiese, verborgen vor Blicken, lebt die Feldmaus. Ihr Alltag spielt sich größtenteils im Verborgenen ab – und doch prägt sie die Landschaft stärker, als man auf den ersten Blick vermuten würde. Wo sie lebt, wird Boden bewegt, Samen verteilt und Nahrungsketten erhalten.
Artbeschreibung: Feldmaus (Microtus arvalis)
Die Feldmaus ist ein kleines Nagetier aus der Familie der Wühler (Arvicolinae) und zählt zu den häufigsten Säugetieren der offenen Kulturlandschaft. Sie erreicht eine Körperlänge von etwa 9 bis 12 Zentimetern, hinzu kommt ein relativ kurzer Schwanz. Ihr Fell ist meist graubraun gefärbt, dicht und unauffällig – ideal für ein Leben im Gras.
Typisch für die Feldmaus sind ihre weit verzweigten Gangsysteme knapp unter der Bodenoberfläche. Diese dienen als Schutz vor Fressfeinden, zur Nahrungssuche und zur Fortpflanzung. Feldmäuse ernähren sich überwiegend von Gräsern, Kräutern, Wurzeln und Samen.
Die Art ist bekannt für ihre hohe Fortpflanzungsrate. Unter günstigen Bedingungen können sich Populationen stark vermehren, was sie zu einem wichtigen, wenn auch nicht immer geschätzten Bestandteil landwirtschaftlich genutzter Flächen macht. Gleichzeitig ist die Feldmaus eine zentrale Nahrungsgrundlage für zahlreiche Beutegreifer wie Greifvögel, Eulen, Füchse und Schlangen.
Perspektive im Wandel von Lebensraum und Klima
Die Feldmaus ist eng an offene, strukturreiche Lebensräume gebunden. Traditionell boten extensiv genutzte Wiesen, Weiden und Feldraine ideale Bedingungen. Durch zunehmende Intensivierung der Landwirtschaft, häufige Mahd, den Verlust von Randstrukturen und den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln werden diese Lebensräume jedoch zunehmend eingeschränkt.
Der Klimawandel wirkt sich zusätzlich auf die Bestandsentwicklung aus. Mildere Winter können die Überlebensrate erhöhen und zu früheren Fortpflanzungsphasen führen. Gleichzeitig stellen lange Trockenperioden, extreme Niederschläge oder häufige Störungen der Vegetation neue Herausforderungen dar, da sie das Nahrungsangebot und die Stabilität der Gangsysteme beeinflussen.
Langfristig wird die Feldmaus dort stabile Populationen aufrechterhalten können, wo vielfältige Landschaftsstrukturen erhalten bleiben. Extensiv bewirtschaftete Flächen, Blühstreifen und ungemähte Rückzugsräume tragen nicht nur zum Schutz der Feldmaus bei, sondern fördern zugleich die gesamte Artenvielfalt der Agrarlandschaft.
In der Aufnahme von Helga Zinnecker
Die Feldmaus ist ein kleines Nagetier aus der Familie der Wühler (Arvicolinae) und zählt zu den häufigsten Säugetieren der offenen Kulturlandschaft. Sie erreicht eine Körperlänge von etwa 9 bis 12 Zentimetern, hinzu kommt ein relativ kurzer Schwanz. Ihr Fell ist meist graubraun gefärbt, dicht und unauffällig – ideal für ein Leben im Gras.
Typisch für die Feldmaus sind ihre weit verzweigten Gangsysteme knapp unter der Bodenoberfläche. Diese dienen als Schutz vor Fressfeinden, zur Nahrungssuche und zur Fortpflanzung. Feldmäuse ernähren sich überwiegend von Gräsern, Kräutern, Wurzeln und Samen.
Die Art ist bekannt für ihre hohe Fortpflanzungsrate. Unter günstigen Bedingungen können sich Populationen stark vermehren, was sie zu einem wichtigen, wenn auch nicht immer geschätzten Bestandteil landwirtschaftlich genutzter Flächen macht. Gleichzeitig ist die Feldmaus eine zentrale Nahrungsgrundlage für zahlreiche Beutegreifer wie Greifvögel, Eulen, Füchse und Schlangen.
Perspektive im Wandel von Lebensraum und Klima
Die Feldmaus ist eng an offene, strukturreiche Lebensräume gebunden. Traditionell boten extensiv genutzte Wiesen, Weiden und Feldraine ideale Bedingungen. Durch zunehmende Intensivierung der Landwirtschaft, häufige Mahd, den Verlust von Randstrukturen und den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln werden diese Lebensräume jedoch zunehmend eingeschränkt.
Der Klimawandel wirkt sich zusätzlich auf die Bestandsentwicklung aus. Mildere Winter können die Überlebensrate erhöhen und zu früheren Fortpflanzungsphasen führen. Gleichzeitig stellen lange Trockenperioden, extreme Niederschläge oder häufige Störungen der Vegetation neue Herausforderungen dar, da sie das Nahrungsangebot und die Stabilität der Gangsysteme beeinflussen.
Langfristig wird die Feldmaus dort stabile Populationen aufrechterhalten können, wo vielfältige Landschaftsstrukturen erhalten bleiben. Extensiv bewirtschaftete Flächen, Blühstreifen und ungemähte Rückzugsräume tragen nicht nur zum Schutz der Feldmaus bei, sondern fördern zugleich die gesamte Artenvielfalt der Agrarlandschaft.
In der Aufnahme von Helga Zinnecker
- Feldmaus am Eingang eines unterirdischen Gangsystems
Artenschutz in Franken®
Schwebfliegen – unterschätzte Vielfalt in der Luft

Schwebfliegen – unterschätzte Vielfalt in der Luft
23/24.01.2026
Obwohl sie häufig mit Wespen oder Bienen verwechselt werden, sind sie vollkommen harmlos – und zugleich von großer Bedeutung für funktionierende Ökosysteme.
23/24.01.2026
- Sie stehen scheinbar reglos in der Luft, wechseln abrupt die Richtung und verschwinden lautlos zwischen Blüten und Gräsern: Schwebfliegen gehören zu den faszinierendsten Insekten unserer Landschaften.
Obwohl sie häufig mit Wespen oder Bienen verwechselt werden, sind sie vollkommen harmlos – und zugleich von großer Bedeutung für funktionierende Ökosysteme.
Unsere Diashow lädt dazu ein, genauer hinzusehen. Die gezeigten Aufnahmen zeigen die Vielfalt an Formen, Farben und Lebensweisen, die Schwebfliegen auszeichnen. Von kleinen, unscheinbaren Arten bis hin zu auffälligen, hummelähnlichen Vertretern wird sichtbar, wie anpassungsfähig und vielseitig diese Insektengruppe ist.
Wichtige Bestäuber und ökologische Helfer
Schwebfliegen zählen zu den bedeutenden Bestäubern heimischer Pflanzen. Viele Arten besuchen regelmäßig Blüten, um Nektar und Pollen aufzunehmen, und leisten dabei einen wichtigen Beitrag zur Vermehrung von Wild- und Kulturpflanzen – oft schon früh im Jahr, wenn andere Insekten noch kaum aktiv sind.
Auch ihre Larven erfüllen wichtige Aufgaben. Je nach Art leben sie in unterschiedlichen Lebensräumen: Einige ernähren sich von Blattläusen und helfen so, deren Populationen auf natürliche Weise zu regulieren. Andere zersetzen abgestorbenes Pflanzenmaterial oder entwickeln sich in speziellen Mikrohabitaten. Diese Vielfalt macht Schwebfliegen zu zentralen Bausteinen im ökologischen Gefüge.
Lebensräume und ihre Bedeutung
Schwebfliegen sind in nahezu allen Landschaftstypen zu finden: auf artenreichen Wiesen, an Waldrändern, in Auen, Mooren, Gärten und selbst in städtischen Grünflächen. Entscheidend ist das Vorhandensein von Blütenangebot, Strukturvielfalt und geeigneten Entwicklungsräumen für die Larven.
Der Rückgang naturnaher Lebensräume, intensive Landnutzung und der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln führen jedoch dazu, dass viele Arten seltener werden. Die Bilder dieser Diashow dokumentieren daher nicht nur Schönheit, sondern auch das, was es zu bewahren gilt.
Schwebfliegen im Wandel von Klima und Landschaft
Der Klimawandel beeinflusst das Leben von Schwebfliegen spürbar. Mildere Winter und frühere Frühjahre können zu einer längeren Aktivitätsphase führen. Gleichzeitig bringen Trockenperioden, Hitzeextreme und veränderte Blühzeiten neue Herausforderungen mit sich.
Ob Schwebfliegen von diesen Veränderungen profitieren oder darunter leiden, hängt stark von der Struktur und Vielfalt der Landschaft ab. Naturnahe Flächen, heimische Blühpflanzen, extensiv gepflegte Wiesen und vielfältige Gärten können als Rückzugsräume dienen und ihre Widerstandsfähigkeit stärken.
Sehen, verstehen, schützen
Unsere Diashow zusammengeführten Aufnahmen zeigen Schwebfliegen in unterschiedlichen Lebensräumen und Momenten ihres Lebenszyklus. Sie machen sichtbar, wie eng Schönheit, Nutzen und Schutz miteinander verbunden sind.
Wer Schwebfliegen schützt, schützt weit mehr als nur eine Insektengruppe: Es geht um lebendige Landschaften, funktionierende Bestäubung und den Erhalt biologischer Vielfalt. Aufmerksamkeit ist dabei der erste Schritt – und genau dazu möchten diese Bilder und Texte beitragen.
In der Aufnahme von Dieter Zinßer
Wichtige Bestäuber und ökologische Helfer
Schwebfliegen zählen zu den bedeutenden Bestäubern heimischer Pflanzen. Viele Arten besuchen regelmäßig Blüten, um Nektar und Pollen aufzunehmen, und leisten dabei einen wichtigen Beitrag zur Vermehrung von Wild- und Kulturpflanzen – oft schon früh im Jahr, wenn andere Insekten noch kaum aktiv sind.
Auch ihre Larven erfüllen wichtige Aufgaben. Je nach Art leben sie in unterschiedlichen Lebensräumen: Einige ernähren sich von Blattläusen und helfen so, deren Populationen auf natürliche Weise zu regulieren. Andere zersetzen abgestorbenes Pflanzenmaterial oder entwickeln sich in speziellen Mikrohabitaten. Diese Vielfalt macht Schwebfliegen zu zentralen Bausteinen im ökologischen Gefüge.
Lebensräume und ihre Bedeutung
Schwebfliegen sind in nahezu allen Landschaftstypen zu finden: auf artenreichen Wiesen, an Waldrändern, in Auen, Mooren, Gärten und selbst in städtischen Grünflächen. Entscheidend ist das Vorhandensein von Blütenangebot, Strukturvielfalt und geeigneten Entwicklungsräumen für die Larven.
Der Rückgang naturnaher Lebensräume, intensive Landnutzung und der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln führen jedoch dazu, dass viele Arten seltener werden. Die Bilder dieser Diashow dokumentieren daher nicht nur Schönheit, sondern auch das, was es zu bewahren gilt.
Schwebfliegen im Wandel von Klima und Landschaft
Der Klimawandel beeinflusst das Leben von Schwebfliegen spürbar. Mildere Winter und frühere Frühjahre können zu einer längeren Aktivitätsphase führen. Gleichzeitig bringen Trockenperioden, Hitzeextreme und veränderte Blühzeiten neue Herausforderungen mit sich.
Ob Schwebfliegen von diesen Veränderungen profitieren oder darunter leiden, hängt stark von der Struktur und Vielfalt der Landschaft ab. Naturnahe Flächen, heimische Blühpflanzen, extensiv gepflegte Wiesen und vielfältige Gärten können als Rückzugsräume dienen und ihre Widerstandsfähigkeit stärken.
Sehen, verstehen, schützen
Unsere Diashow zusammengeführten Aufnahmen zeigen Schwebfliegen in unterschiedlichen Lebensräumen und Momenten ihres Lebenszyklus. Sie machen sichtbar, wie eng Schönheit, Nutzen und Schutz miteinander verbunden sind.
Wer Schwebfliegen schützt, schützt weit mehr als nur eine Insektengruppe: Es geht um lebendige Landschaften, funktionierende Bestäubung und den Erhalt biologischer Vielfalt. Aufmerksamkeit ist dabei der erste Schritt – und genau dazu möchten diese Bilder und Texte beitragen.
In der Aufnahme von Dieter Zinßer
- Gelbes Sonnenröschen mit Schwebfliege
Artenschutz in Franken®
Taubenschwänzchen (Macroglossum stellatarum)

Das Taubenschwänzchen (Macroglossum stellatarum)
23/24.01.2026
Es ist ein warmer Nachmittag, die Luft flimmert über dem Lavendel. Ein leises Summen liegt in der Luft, fast wie das Geräusch eines winzigen Motors. Für einen Moment scheint ein Kolibri durch den Garten zu fliegen – doch beim zweiten Hinsehen entpuppt sich der Besucher als etwas anderes.
Mit rasant schlagenden Flügeln steht er regungslos vor der Blüte, saugt Nektar und verschwindet so schnell, wie er gekommen ist. Das Taubenschwänzchen hat seinen kurzen Auftritt gehabt – unauffällig, präzise und faszinierend.
23/24.01.2026
- Ein Sommertag in der Schwebe
Es ist ein warmer Nachmittag, die Luft flimmert über dem Lavendel. Ein leises Summen liegt in der Luft, fast wie das Geräusch eines winzigen Motors. Für einen Moment scheint ein Kolibri durch den Garten zu fliegen – doch beim zweiten Hinsehen entpuppt sich der Besucher als etwas anderes.
Mit rasant schlagenden Flügeln steht er regungslos vor der Blüte, saugt Nektar und verschwindet so schnell, wie er gekommen ist. Das Taubenschwänzchen hat seinen kurzen Auftritt gehabt – unauffällig, präzise und faszinierend.
Artbeschreibung: Das Taubenschwänzchen (Macroglossum stellatarum)
Das Taubenschwänzchen gehört zur Familie der Schwärmer (Sphingidae) und ist einer der bekanntesten tagaktiven Nachtfalter Europas. Charakteristisch sind seine graubraunen Vorderflügel, die orangefarbenen Hinterflügel sowie der namensgebende, fächerförmige „Schwanz“ am Hinterleib, der an das Schwanzgefieder einer Taube erinnert.
Mit einer Flügelspannweite von etwa 4 bis 5 Zentimetern und einer extrem hohen Flügelschlagfrequenz ist das Taubenschwänzchen ein Meister des Schwirrflugs. Ähnlich wie Kolibris kann es im Flug vor Blüten stehen bleiben, während es mit seinem langen Saugrüssel Nektar aufnimmt. Bevorzugte Nektarpflanzen sind unter anderem Lavendel, Phlox, Sommerflieder und Petunien.
Die Raupen ernähren sich vor allem von Labkraut-Arten. Das Taubenschwänzchen ist ein ausgeprägter Wanderfalter: Viele Individuen überqueren jedes Jahr große Distanzen zwischen dem Mittelmeerraum und Mitteleuropa.
Perspektive: Lebensraumveränderung und Klimawandel
Die Zukunft des Taubenschwänzchens ist eng mit den Veränderungen unserer Umwelt verknüpft. Der Klimawandel führt dazu, dass mildere Winter und längere Vegetationsperioden die Ausbreitung der Art nach Norden begünstigen. In vielen Regionen Mitteleuropas ist das Taubenschwänzchen heute häufiger zu beobachten als noch vor einigen Jahrzehnten.
Gleichzeitig stellen Lebensraumverluste, intensive Landwirtschaft und der Rückgang von Wildpflanzen eine Herausforderung dar. Das Verschwinden von Labkraut und nektarreichen Blühpflanzen kann lokal zu Nahrungsengpässen führen. Auch der Einsatz von Pestiziden wirkt sich negativ auf Raupen und Falter aus.
Eine naturnahe Gartengestaltung, Blühflächen und der Schutz vielfältiger Lebensräume können dazu beitragen, dem Taubenschwänzchen auch in Zukunft einen Platz in unserer Landschaft zu sichern. Als anpassungsfähige Art zeigt es zwar eine gewisse Resilienz, bleibt aber dennoch ein sensibler Indikator für ökologische Veränderungen.
In der Aufnahme von Dieter Zinßer
Das Taubenschwänzchen gehört zur Familie der Schwärmer (Sphingidae) und ist einer der bekanntesten tagaktiven Nachtfalter Europas. Charakteristisch sind seine graubraunen Vorderflügel, die orangefarbenen Hinterflügel sowie der namensgebende, fächerförmige „Schwanz“ am Hinterleib, der an das Schwanzgefieder einer Taube erinnert.
Mit einer Flügelspannweite von etwa 4 bis 5 Zentimetern und einer extrem hohen Flügelschlagfrequenz ist das Taubenschwänzchen ein Meister des Schwirrflugs. Ähnlich wie Kolibris kann es im Flug vor Blüten stehen bleiben, während es mit seinem langen Saugrüssel Nektar aufnimmt. Bevorzugte Nektarpflanzen sind unter anderem Lavendel, Phlox, Sommerflieder und Petunien.
Die Raupen ernähren sich vor allem von Labkraut-Arten. Das Taubenschwänzchen ist ein ausgeprägter Wanderfalter: Viele Individuen überqueren jedes Jahr große Distanzen zwischen dem Mittelmeerraum und Mitteleuropa.
Perspektive: Lebensraumveränderung und Klimawandel
Die Zukunft des Taubenschwänzchens ist eng mit den Veränderungen unserer Umwelt verknüpft. Der Klimawandel führt dazu, dass mildere Winter und längere Vegetationsperioden die Ausbreitung der Art nach Norden begünstigen. In vielen Regionen Mitteleuropas ist das Taubenschwänzchen heute häufiger zu beobachten als noch vor einigen Jahrzehnten.
Gleichzeitig stellen Lebensraumverluste, intensive Landwirtschaft und der Rückgang von Wildpflanzen eine Herausforderung dar. Das Verschwinden von Labkraut und nektarreichen Blühpflanzen kann lokal zu Nahrungsengpässen führen. Auch der Einsatz von Pestiziden wirkt sich negativ auf Raupen und Falter aus.
Eine naturnahe Gartengestaltung, Blühflächen und der Schutz vielfältiger Lebensräume können dazu beitragen, dem Taubenschwänzchen auch in Zukunft einen Platz in unserer Landschaft zu sichern. Als anpassungsfähige Art zeigt es zwar eine gewisse Resilienz, bleibt aber dennoch ein sensibler Indikator für ökologische Veränderungen.
In der Aufnahme von Dieter Zinßer
- Taubenschwänzchen im Schwirrflug
Artenschutz in Franken®
Wolf in Deutschland – ökologischer Wert, rechtlicher Schutz und aktuelle Entwicklung

Wolf in Deutschland – ökologischer Wert, rechtlicher Schutz und aktuelle Entwicklung
22/23.01.2026
Heute gilt er als ein natürlicher Bestandteil unserer heimischen Fauna und übernimmt als Spitzenprädator zentrale ökologische Funktionen, etwa die Regulation von Wildtierbeständen und die Förderung naturnaher Abläufe in Wäldern und offenen Landschaften.
22/23.01.2026
- Der Wolf (Canis lupus) ist über Jahrhunderte aus großen Teilen Europas verschwunden und dank konsequenter Schutzmaßnahmen in den letzten zwei Jahrzehnten wieder in weite Bereiche Deutschlands zurückgekehrt.
Heute gilt er als ein natürlicher Bestandteil unserer heimischen Fauna und übernimmt als Spitzenprädator zentrale ökologische Funktionen, etwa die Regulation von Wildtierbeständen und die Förderung naturnaher Abläufe in Wäldern und offenen Landschaften.
Aktuelle rechtliche Situation
Rechtlich ist der Wolf in Deutschland und der Europäischen Union durch eine komplexe Schutzarchitektur eingebettet:
EU-Recht und Schutzstatus:
Der Wolf war bislang als „streng geschützt“ in Anhang IV der europäischen Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie) geführt. Im Jahr 2025 wurde dieser Schutzstatus europaweit auf „geschützt“ abgesenkt, nachdem zuvor die Berner Konvention den Schutzstatus reduziert hatte. Diese Änderung eröffnet den EU-Mitgliedstaaten grundsätzlich mehr Spielraum bei der nationalen Behandlung des Wolfs, bleibt aber an Bedingungen geknüpft: Die EU-Gerichtsbarkeit hat klargestellt, dass Wolfsjagd nur unter strengen Voraussetzungen zulässig ist, nämlich wenn der günstige Erhaltungszustand der Art nachweislich gesichert bleibt.
Nationales Recht:
In Deutschland ist der Wolf aktuell im Bundesnaturschutzgesetz als besonders geschützte Art verankert und unterliegt damit einem hohen Schutzstandard. Das Fangen, Verletzen oder Töten eines Wolfes ist verboten und kann straf- und ordnungswidrig verfolgt werden. Lediglich in engen Ausnahmefällen – etwa bei erheblicher Gefährdung von Menschen oder mehrfachen, trotz vorsorglicher Schutzmaßnahmen erfolgten Rissen von Nutztieren – besteht unter geltendem Recht die Möglichkeit einer behördlich genehmigten Entnahme.
Rechtliche Neuausrichtung:
Der aktuelle Koalitionsvertrag der Bundesregierung sieht vor, den Wolf entsprechend der EU-Anpassung stärker ins Jagdrecht zu integrieren und das Bundesnaturschutzgesetz sowie das Bundesjagdgesetz entsprechend zu novellieren, um eine „rechtssichere Entnahme“ von Wölfen zu ermöglichen. Diese Änderungen sollen nationale Handlungsspielräume im Umgang mit Problemfällen erweitern. Zudem wird im Bundestag aktuell über entsprechende Gesetzesänderungen debattiert, die u. a. lokale Jagdzeiten und erweiterte Entnahmemöglichkeiten vorsehen.
Warum wir die Aufnahme des Wolfs ins Jagdrecht kritisch sehen
Als Naturschutzorganisation betrachten wir Schutz, Management und gesellschaftliche Akzeptanz wildlebender Arten immer in einem integrativen, wissenschaftlich fundierten Rahmen:
Schutzrahmen und wissenschaftliche Grundlagen:
Die Herabstufung des Schutzstatus’ und eine Einbeziehung in das Jagdrecht basieren bislang nicht auf einem breiten wissenschaftlichen Konsens, sondern vor allem auf politischen Erwägungen, die vor allem Reaktionen auf gesellschaftliche Konflikte adressieren. Zahlreiche Naturschutzverbände bemängeln, dass die bisherigen Bestandsdaten nicht ausreichend die regional unterschiedlichen Erhaltungszustände widerspiegeln und dass pauschale Jagdoptionen ohne eindeutige wissenschaftliche Grundlage geschaffen werden könnten.
Ökologische Risiken:
Wölfe leben in komplexen Sozialstrukturen. Pauschale Entnahmen oder saisonale Jagdzeiten können Rudelstrukturen destabilisieren, was Probleme wie erhöhte Wildtierrisse nicht unbedingt reduziert und ökologisch kontraproduktiv sein kann. Der Wolf ist kein Wildtier wie andere jagdbare Arten, sondern eine Art mit speziellen Verhaltensweisen und Lebensraumansprüchen, deren Bestandsregulierung differenziert und regionalspezifisch erfolgen sollte.
Konfliktbearbeitung statt Regulierung:
Konflikte zwischen Wolf und Landwirtschaft sind real und müssen ernst genommen werden. Erfahrungen aus verschiedenen Regionen zeigen jedoch, dass effektive Herdenschutzmaßnahmen (z. B. Zäune, Herdenschutzhunde), Entschädigungssysteme und Beratungsangebote wirksamer sind als breit angelegte Entnahmen aus Beständen. Dies wird auch von Fachverbänden betont, die betonen, dass nicht-tödliche Präventionsmaßnahmen langfristig tragfähigere Lösungen darstellen.
Schutz statt Jagd:
Die traditionelle Einordnung einer Art in das Jagdrecht verändert nicht nur rechtlich den Umgang mit ihr, sondern beeinflusst auch die Wahrnehmung in Gesellschaft, Verwaltung und Politik. Wir sehen darin die Gefahr, dass der Wolf zunehmend primär als „regulierbare Belastung“ wahrgenommen wird, statt als ökologisch wichtiger Bestandteil unserer natürlichen Lebensräume.
Fazit
Unsere Position ist nicht grundsätzlich gegen Konfliktlösung gerichtet – im Gegenteil: Wir setzen uns für pragmatische, sachorientierte und wissenschaftlich fundierte Wege ein, die sowohl den Schutz der biologischen Vielfalt als auch die berechtigten Interessen von Nutztierhalter*innen berücksichtigen.
Die derzeitigen rechtlichen Entwicklungen im Wolf-Management sollten aus unserer Sicht weiterhin eng an internationale und europäische Artenschutzstandards, solide wissenschaftliche Daten und konkrete ökologische Ziele gebunden bleiben. Wildtiermanagement muss verantwortungsvoll, transparent und anwendungsorientiert gestaltet werden – nicht über das Heurisieren pauschaler Jagdregelungen. Dabei gilt es, langfristige Perspektiven der Koexistenz, Prävention und Artenvielfalt in den Mittelpunkt zu stellen.
In der Aufnahme von Andreas Gehrig
Artenschutz in Franken®
Rechtlich ist der Wolf in Deutschland und der Europäischen Union durch eine komplexe Schutzarchitektur eingebettet:
EU-Recht und Schutzstatus:
Der Wolf war bislang als „streng geschützt“ in Anhang IV der europäischen Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie) geführt. Im Jahr 2025 wurde dieser Schutzstatus europaweit auf „geschützt“ abgesenkt, nachdem zuvor die Berner Konvention den Schutzstatus reduziert hatte. Diese Änderung eröffnet den EU-Mitgliedstaaten grundsätzlich mehr Spielraum bei der nationalen Behandlung des Wolfs, bleibt aber an Bedingungen geknüpft: Die EU-Gerichtsbarkeit hat klargestellt, dass Wolfsjagd nur unter strengen Voraussetzungen zulässig ist, nämlich wenn der günstige Erhaltungszustand der Art nachweislich gesichert bleibt.
Nationales Recht:
In Deutschland ist der Wolf aktuell im Bundesnaturschutzgesetz als besonders geschützte Art verankert und unterliegt damit einem hohen Schutzstandard. Das Fangen, Verletzen oder Töten eines Wolfes ist verboten und kann straf- und ordnungswidrig verfolgt werden. Lediglich in engen Ausnahmefällen – etwa bei erheblicher Gefährdung von Menschen oder mehrfachen, trotz vorsorglicher Schutzmaßnahmen erfolgten Rissen von Nutztieren – besteht unter geltendem Recht die Möglichkeit einer behördlich genehmigten Entnahme.
Rechtliche Neuausrichtung:
Der aktuelle Koalitionsvertrag der Bundesregierung sieht vor, den Wolf entsprechend der EU-Anpassung stärker ins Jagdrecht zu integrieren und das Bundesnaturschutzgesetz sowie das Bundesjagdgesetz entsprechend zu novellieren, um eine „rechtssichere Entnahme“ von Wölfen zu ermöglichen. Diese Änderungen sollen nationale Handlungsspielräume im Umgang mit Problemfällen erweitern. Zudem wird im Bundestag aktuell über entsprechende Gesetzesänderungen debattiert, die u. a. lokale Jagdzeiten und erweiterte Entnahmemöglichkeiten vorsehen.
Warum wir die Aufnahme des Wolfs ins Jagdrecht kritisch sehen
Als Naturschutzorganisation betrachten wir Schutz, Management und gesellschaftliche Akzeptanz wildlebender Arten immer in einem integrativen, wissenschaftlich fundierten Rahmen:
Schutzrahmen und wissenschaftliche Grundlagen:
Die Herabstufung des Schutzstatus’ und eine Einbeziehung in das Jagdrecht basieren bislang nicht auf einem breiten wissenschaftlichen Konsens, sondern vor allem auf politischen Erwägungen, die vor allem Reaktionen auf gesellschaftliche Konflikte adressieren. Zahlreiche Naturschutzverbände bemängeln, dass die bisherigen Bestandsdaten nicht ausreichend die regional unterschiedlichen Erhaltungszustände widerspiegeln und dass pauschale Jagdoptionen ohne eindeutige wissenschaftliche Grundlage geschaffen werden könnten.
Ökologische Risiken:
Wölfe leben in komplexen Sozialstrukturen. Pauschale Entnahmen oder saisonale Jagdzeiten können Rudelstrukturen destabilisieren, was Probleme wie erhöhte Wildtierrisse nicht unbedingt reduziert und ökologisch kontraproduktiv sein kann. Der Wolf ist kein Wildtier wie andere jagdbare Arten, sondern eine Art mit speziellen Verhaltensweisen und Lebensraumansprüchen, deren Bestandsregulierung differenziert und regionalspezifisch erfolgen sollte.
Konfliktbearbeitung statt Regulierung:
Konflikte zwischen Wolf und Landwirtschaft sind real und müssen ernst genommen werden. Erfahrungen aus verschiedenen Regionen zeigen jedoch, dass effektive Herdenschutzmaßnahmen (z. B. Zäune, Herdenschutzhunde), Entschädigungssysteme und Beratungsangebote wirksamer sind als breit angelegte Entnahmen aus Beständen. Dies wird auch von Fachverbänden betont, die betonen, dass nicht-tödliche Präventionsmaßnahmen langfristig tragfähigere Lösungen darstellen.
Schutz statt Jagd:
Die traditionelle Einordnung einer Art in das Jagdrecht verändert nicht nur rechtlich den Umgang mit ihr, sondern beeinflusst auch die Wahrnehmung in Gesellschaft, Verwaltung und Politik. Wir sehen darin die Gefahr, dass der Wolf zunehmend primär als „regulierbare Belastung“ wahrgenommen wird, statt als ökologisch wichtiger Bestandteil unserer natürlichen Lebensräume.
Fazit
Unsere Position ist nicht grundsätzlich gegen Konfliktlösung gerichtet – im Gegenteil: Wir setzen uns für pragmatische, sachorientierte und wissenschaftlich fundierte Wege ein, die sowohl den Schutz der biologischen Vielfalt als auch die berechtigten Interessen von Nutztierhalter*innen berücksichtigen.
Die derzeitigen rechtlichen Entwicklungen im Wolf-Management sollten aus unserer Sicht weiterhin eng an internationale und europäische Artenschutzstandards, solide wissenschaftliche Daten und konkrete ökologische Ziele gebunden bleiben. Wildtiermanagement muss verantwortungsvoll, transparent und anwendungsorientiert gestaltet werden – nicht über das Heurisieren pauschaler Jagdregelungen. Dabei gilt es, langfristige Perspektiven der Koexistenz, Prävention und Artenvielfalt in den Mittelpunkt zu stellen.
In der Aufnahme von Andreas Gehrig
- Wold im Portrait - Wenn eine Art als Sündenbock für eine in unseren Augen unzureichend aufgestellte Projektion Verwendung findet lehnen wir das vehement ab!
Artenschutz in Franken®
Artenschutz in Franken®
Gemeine Waldschwebfliege (Volucella pellucens)

Die Gemeine Waldschwebfliege / Gemeine Hummel-Schwebfliege (Volucella pellucens)
22/23.01.2026
Plötzlich zieht ein scheinbar schwerfälliges Insekt vorbei, sein tiefes Brummen erinnert an eine Hummel. Doch beim zweiten Blick wird klar: Es ist eine Täuschung. Mit überraschender Eleganz schwebt die Gemeine Waldschwebfliege von Blüte zu Blüte und verschwindet lautlos zwischen Lichtflecken und Baumstämmen.
22/23.01.2026
- Im Halbschatten eines alten Buchenwaldes liegt ein warmer Sommertag in der Luft. Zwischen Moos, Farnen und blühenden Waldsäumen brummt es leise.
Plötzlich zieht ein scheinbar schwerfälliges Insekt vorbei, sein tiefes Brummen erinnert an eine Hummel. Doch beim zweiten Blick wird klar: Es ist eine Täuschung. Mit überraschender Eleganz schwebt die Gemeine Waldschwebfliege von Blüte zu Blüte und verschwindet lautlos zwischen Lichtflecken und Baumstämmen.
Artbeschreibung: Gemeine Waldschwebfliege / Gemeine Hummel-Schwebfliege (Volucella pellucens)
Die Gemeine Waldschwebfliege ist eine der größten heimischen Schwebfliegenarten und fällt sofort durch ihr hummelähnliches Erscheinungsbild auf. Ihr Körper ist kräftig gebaut, überwiegend schwarz gefärbt und besitzt eine auffällige helle Querbinde am Hinterleib. Die Flügel sind leicht bräunlich getönt und verleihen ihr im Flug ein markantes Erscheinungsbild.Diese Art nutzt gezielt Mimikry: Sie ahmt Hummeln nach, um potenzielle Fressfeinde abzuschrecken, ist selbst jedoch völlig wehrlos. Trotz ihrer Größe ist sie eine hervorragende Fliegerin und kann präzise in der Luft stehen.
Erwachsene Tiere ernähren sich von Nektar und Pollen und sind wichtige Bestäuber zahlreicher Pflanzenarten. Die Larven haben eine besondere Lebensweise: Sie entwickeln sich in Nestern sozialer Faltenwespen und ernähren sich dort von organischem Material, ohne das Wespennest ernsthaft zu schädigen. Bevorzugt werden strukturreiche Lebensräume wie Laub- und Mischwälder, Waldlichtungen, Parks, alte Gärten und naturnahe Siedlungsbereiche.
Perspektive im Wandel von Lebensraum und Klima
Die Gemeine Waldschwebfliege profitiert grundsätzlich von warmen Sommern, doch ihre Zukunft hängt stark von der Qualität ihrer Lebensräume ab. Der Verlust alter Bäume, das Aufräumen von Totholz und die Vereinheitlichung von Grünflächen verringern sowohl Nahrungsquellen als auch geeignete Entwicklungsräume für ihre Larven.Der Klimawandel kann ihre Aktivitätsphase verlängern und eine frühere Entwicklung ermöglichen. Gleichzeitig stellen häufigere Hitzeperioden, Trockenstress und extreme Wetterereignisse neue Herausforderungen dar – sowohl für die Schwebfliege selbst als auch für die Pflanzen und Wirtsinsekten, von denen sie abhängig ist.
Eine positive Perspektive ergibt sich dort, wo naturnahe Wälder, strukturreiche Parks und vielfältige Gärten erhalten bleiben oder gefördert werden. Der Schutz von Altholz, die Förderung heimischer Blühpflanzen und ein bewusster Umgang mit Insekten tragen dazu bei, dass die Gemeine Waldschwebfliege auch künftig ein vertrauter Anblick in unseren Landschaften bleibt.
In der Aufnahme von Dieter Zinßer
Die Gemeine Waldschwebfliege ist eine der größten heimischen Schwebfliegenarten und fällt sofort durch ihr hummelähnliches Erscheinungsbild auf. Ihr Körper ist kräftig gebaut, überwiegend schwarz gefärbt und besitzt eine auffällige helle Querbinde am Hinterleib. Die Flügel sind leicht bräunlich getönt und verleihen ihr im Flug ein markantes Erscheinungsbild.Diese Art nutzt gezielt Mimikry: Sie ahmt Hummeln nach, um potenzielle Fressfeinde abzuschrecken, ist selbst jedoch völlig wehrlos. Trotz ihrer Größe ist sie eine hervorragende Fliegerin und kann präzise in der Luft stehen.
Erwachsene Tiere ernähren sich von Nektar und Pollen und sind wichtige Bestäuber zahlreicher Pflanzenarten. Die Larven haben eine besondere Lebensweise: Sie entwickeln sich in Nestern sozialer Faltenwespen und ernähren sich dort von organischem Material, ohne das Wespennest ernsthaft zu schädigen. Bevorzugt werden strukturreiche Lebensräume wie Laub- und Mischwälder, Waldlichtungen, Parks, alte Gärten und naturnahe Siedlungsbereiche.
Perspektive im Wandel von Lebensraum und Klima
Die Gemeine Waldschwebfliege profitiert grundsätzlich von warmen Sommern, doch ihre Zukunft hängt stark von der Qualität ihrer Lebensräume ab. Der Verlust alter Bäume, das Aufräumen von Totholz und die Vereinheitlichung von Grünflächen verringern sowohl Nahrungsquellen als auch geeignete Entwicklungsräume für ihre Larven.Der Klimawandel kann ihre Aktivitätsphase verlängern und eine frühere Entwicklung ermöglichen. Gleichzeitig stellen häufigere Hitzeperioden, Trockenstress und extreme Wetterereignisse neue Herausforderungen dar – sowohl für die Schwebfliege selbst als auch für die Pflanzen und Wirtsinsekten, von denen sie abhängig ist.
Eine positive Perspektive ergibt sich dort, wo naturnahe Wälder, strukturreiche Parks und vielfältige Gärten erhalten bleiben oder gefördert werden. Der Schutz von Altholz, die Förderung heimischer Blühpflanzen und ein bewusster Umgang mit Insekten tragen dazu bei, dass die Gemeine Waldschwebfliege auch künftig ein vertrauter Anblick in unseren Landschaften bleibt.
In der Aufnahme von Dieter Zinßer
- Gemeine Waldschwebfliege auf einer Wildblume
Artenschutz in Franken®
Fliegengitter an Fenstern – eine unterschätzte Gefahr für Fledermäuse

Fliegengitter an Fenstern – eine unterschätzte Gefahr für Fledermäuse
22/23.01.2026
Was jedoch kaum bekannt ist: Für Fledermäuse können diese Netze zu einer ernsthaften Gefahr werden – in manchen Fällen sogar zur tödlichen Falle.
22/23.01.2026
- Fliegengitter an Fenstern und Türen sind für viele Menschen eine praktische Lösung, um Insekten aus Wohnräumen fernzuhalten.
Was jedoch kaum bekannt ist: Für Fledermäuse können diese Netze zu einer ernsthaften Gefahr werden – in manchen Fällen sogar zur tödlichen Falle.
Fledermäuse orientieren sich mithilfe von Ultraschall. Sehr feine Netze, wie sie bei Fliegengittern verwendet werden, können von den Tieren oft nicht oder nur unzureichend wahrgenommen werden. Besonders bei der Jagd nach Insekten oder bei der Suche nach einem Ruheplatz fliegen Fledermäuse gezielt auf Fensterflächen zu und verfangen sich dabei in den Maschen.
Gelingt es den Tieren nicht, sich selbst zu befreien, drohen Erschöpfung, Verletzungen oder Unterkühlung. Vor allem Jungtiere und geschwächte Tiere sind gefährdet. Auch Hauskatzen oder andere Fressfeinde können eine zusätzliche Bedrohung darstellen, wenn eine Fledermaus im Netz festhängt.
Um Fledermäuse zu schützen, sollten Fliegengitter möglichst straff und faltenfrei angebracht werden, da lose Netze ein höheres Risiko darstellen. Alternativ können grobmaschigere oder gut sichtbare Gitter verwendet werden. Wer eine Fledermaus in einem Fliegengitter entdeckt, sollte Ruhe bewahren, das Tier nicht mit bloßen Händen anfassen und umgehend eine Fledermaus-Pflegestelle oder Naturschutzorganisation kontaktieren.
Mit einfachen Maßnahmen lässt sich das Risiko deutlich reduzieren – und ein wichtiger Beitrag zum Schutz dieser streng geschützten und ökologisch wertvollen Tiere leisten.
In der Aufnahme von S. Bertelmann
Gelingt es den Tieren nicht, sich selbst zu befreien, drohen Erschöpfung, Verletzungen oder Unterkühlung. Vor allem Jungtiere und geschwächte Tiere sind gefährdet. Auch Hauskatzen oder andere Fressfeinde können eine zusätzliche Bedrohung darstellen, wenn eine Fledermaus im Netz festhängt.
Um Fledermäuse zu schützen, sollten Fliegengitter möglichst straff und faltenfrei angebracht werden, da lose Netze ein höheres Risiko darstellen. Alternativ können grobmaschigere oder gut sichtbare Gitter verwendet werden. Wer eine Fledermaus in einem Fliegengitter entdeckt, sollte Ruhe bewahren, das Tier nicht mit bloßen Händen anfassen und umgehend eine Fledermaus-Pflegestelle oder Naturschutzorganisation kontaktieren.
Mit einfachen Maßnahmen lässt sich das Risiko deutlich reduzieren – und ein wichtiger Beitrag zum Schutz dieser streng geschützten und ökologisch wertvollen Tiere leisten.
In der Aufnahme von S. Bertelmann
- Eine Zwergfledermaus die sich in einem Fliegengitter verfangen hatte
Artenschutz in Franken®
Tränendes Herz (Lamprocapnos spectabilis)

Das Tränende Herz (Lamprocapnos spectabilis)
21/22.01.2026
Wer an ihnen vorbeigeht, bleibt oft unwillkürlich stehen. Das Tränende Herz erzählt keine laute Geschichte – es flüstert von Vergänglichkeit, Neubeginn und der besonderen Ruhe des frühen Jahres.
21/22.01.2026
- Im stillen Schatten eines alten Gartens neigen sich im Frühling zarte Blüten dem Boden entgegen. Wie kleine Herzen hängen sie an gebogenen Stielen und scheinen einen Moment innezuhalten, bevor sie sich dem Licht wieder zuwenden.
Wer an ihnen vorbeigeht, bleibt oft unwillkürlich stehen. Das Tränende Herz erzählt keine laute Geschichte – es flüstert von Vergänglichkeit, Neubeginn und der besonderen Ruhe des frühen Jahres.
Artbeschreibung: Tränendes Herz (Lamprocapnos spectabilis)
Das Tränende Herz ist eine ausdauernde, krautige Pflanze mit unverwechselbaren, herzförmigen Blüten. Diese erscheinen im Frühjahr in leuchtendem Rosa mit weißen Spitzen und hängen in eleganten Reihen an bogig überhängenden Stängeln. Die fein gefiederten, blaugrünen Blätter bilden einen weichen Kontrast zu den klar gezeichneten Blüten.
Ursprünglich stammt die Art aus Ostasien, ist jedoch seit langer Zeit als Zierpflanze in Gärten und Parks Europas verbreitet. Sie bevorzugt halbschattige Standorte mit humusreichen, gleichmäßig feuchten Böden. Nach der Blüte zieht sich die Pflanze im Sommer vollständig zurück und überdauert als Rhizom im Boden.
Das Tränende Herz ist giftig, wird aber wegen seiner außergewöhnlichen Blütenform und seiner frühen Blütezeit besonders geschätzt.
Perspektive im Wandel von Lebensraum und Klima
Als Kultur- und Zierpflanze ist das Tränende Herz weniger von direktem Lebensraumverlust betroffen als viele heimische Wildarten. Dennoch wirken sich Veränderungen des Klimas spürbar auf sein Wachstum aus. Längere Trockenperioden, hohe Sommertemperaturen und milde Winter können den natürlichen Jahresrhythmus der Pflanze beeinflussen.
Frühere Austriebe erhöhen das Risiko von Spätfrostschäden, während heiße, trockene Sommer die Regenerationsphase im Boden erschweren. Gleichzeitig zeigen sich Chancen: In geeigneten, geschützten Lagen kann das Tränende Herz auch unter veränderten klimatischen Bedingungen gedeihen, wenn Bodenfeuchte und Beschattung erhalten bleiben.
Eine naturnahe Gartenpflege, die auf Mulch, humusreiche Böden und standortgerechte Pflanzung setzt, wird künftig entscheidend sein, um diese besondere Pflanze langfristig zu bewahren.
In der Aufnahme von Dieter Zinßer
Das Tränende Herz ist eine ausdauernde, krautige Pflanze mit unverwechselbaren, herzförmigen Blüten. Diese erscheinen im Frühjahr in leuchtendem Rosa mit weißen Spitzen und hängen in eleganten Reihen an bogig überhängenden Stängeln. Die fein gefiederten, blaugrünen Blätter bilden einen weichen Kontrast zu den klar gezeichneten Blüten.
Ursprünglich stammt die Art aus Ostasien, ist jedoch seit langer Zeit als Zierpflanze in Gärten und Parks Europas verbreitet. Sie bevorzugt halbschattige Standorte mit humusreichen, gleichmäßig feuchten Böden. Nach der Blüte zieht sich die Pflanze im Sommer vollständig zurück und überdauert als Rhizom im Boden.
Das Tränende Herz ist giftig, wird aber wegen seiner außergewöhnlichen Blütenform und seiner frühen Blütezeit besonders geschätzt.
Perspektive im Wandel von Lebensraum und Klima
Als Kultur- und Zierpflanze ist das Tränende Herz weniger von direktem Lebensraumverlust betroffen als viele heimische Wildarten. Dennoch wirken sich Veränderungen des Klimas spürbar auf sein Wachstum aus. Längere Trockenperioden, hohe Sommertemperaturen und milde Winter können den natürlichen Jahresrhythmus der Pflanze beeinflussen.
Frühere Austriebe erhöhen das Risiko von Spätfrostschäden, während heiße, trockene Sommer die Regenerationsphase im Boden erschweren. Gleichzeitig zeigen sich Chancen: In geeigneten, geschützten Lagen kann das Tränende Herz auch unter veränderten klimatischen Bedingungen gedeihen, wenn Bodenfeuchte und Beschattung erhalten bleiben.
Eine naturnahe Gartenpflege, die auf Mulch, humusreiche Böden und standortgerechte Pflanzung setzt, wird künftig entscheidend sein, um diese besondere Pflanze langfristig zu bewahren.
In der Aufnahme von Dieter Zinßer
- Charakteristische herzförmige Blüten des Tränenden Herzens
Artenschutz in Franken®
Frühe Gelbrandschwebfliege

Die Frühe Gelbrandschwebfliege
21/22.01.2026
Mit ruhigen, präzisen Bewegungen steht sie plötzlich reglos in der Luft, als hätte jemand die Zeit angehalten. Dann setzt sie sich auf eine Blüte, sammelt Pollen und verschwindet wieder zwischen Licht und Schatten. Die Frühe Gelbrandschwebfliege ist kein lauter Frühlingsbote – aber eine verlässliche Begleiterin der ersten warmen Tage.
21/22.01.2026
- An einem warmen Frühlingstag, wenn der Tau noch auf den Gräsern glitzert und die ersten Wildblumen ihre Knospen öffnen, schwebt sie fast unbemerkt durch die Landschaft.
Mit ruhigen, präzisen Bewegungen steht sie plötzlich reglos in der Luft, als hätte jemand die Zeit angehalten. Dann setzt sie sich auf eine Blüte, sammelt Pollen und verschwindet wieder zwischen Licht und Schatten. Die Frühe Gelbrandschwebfliege ist kein lauter Frühlingsbote – aber eine verlässliche Begleiterin der ersten warmen Tage.
Artbeschreibung: Die Frühe Gelbrandschwebfliege (Xanthogramma citrofasciatum)
Die Frühe Gelbrandschwebfliege gehört zur Familie der Schwebfliegen (Syrphidae) und ist eine vergleichsweise kleine, aber auffällig gezeichnete Art. Ihr Körper ist schlank, überwiegend schwarz gefärbt und trägt mehrere leuchtend gelbe Querbinden auf dem Hinterleib. Diese Färbung erinnert an Wespen, dient jedoch ausschließlich der Abschreckung – die Art ist vollkommen harmlos.
Charakteristisch ist ihr ruhiger, kontrollierter Flug, bei dem sie häufig in der Luft „steht“. Erwachsene Tiere ernähren sich von Nektar und Pollen und sind damit wichtige Bestäuber früh blühender Pflanzen. Die Larven leben bodennah und ernähren sich überwiegend von Blattläusen, wodurch sie auch eine ökologische Rolle in der natürlichen Schädlingsregulation spielen.
Die Art bevorzugt offene, sonnige Lebensräume wie extensiv genutzte Wiesen, Waldränder, Böschungen und strukturreiche Feldraine. Ihr Auftreten beginnt bereits im zeitigen Frühjahr, was ihr den deutschen Namen eingebracht hat.
Perspektive im Wandel von Lebensraum und Klima
Die Zukunft der Frühen Gelbrandschwebfliege ist eng mit der Entwicklung unserer Landschaft verknüpft. Der Verlust artenreicher Wiesen, eine zunehmende Versiegelung von Flächen und der Rückgang von Wildpflanzen schränken geeignete Lebensräume zunehmend ein. Besonders problematisch ist der Mangel an früh blühenden Pflanzen, auf die die Art zu Beginn des Jahres angewiesen ist.
Der Klimawandel bringt zusätzliche Herausforderungen, aber auch neue Dynamiken. Mildere Winter und frühere Frühjahre können den Aktivitätszeitraum der Art verlängern. Gleichzeitig bergen extreme Wetterereignisse wie Spätfröste, Trockenperioden oder Starkregen Risiken für Larven und Nahrungsangebot.
Langfristig wird die Frühe Gelbrandschwebfliege davon profitieren, wenn strukturreiche, vielfältige Landschaften erhalten oder neu geschaffen werden. Naturnahe Gärten, extensiv gepflegte Grünflächen und der bewusste Umgang mit Pestiziden können dazu beitragen, dieser unauffälligen, aber ökologisch wertvollen Art auch in Zukunft einen Platz zu sichern.
In der Aufnahme von Dieter Zinßer
Die Frühe Gelbrandschwebfliege gehört zur Familie der Schwebfliegen (Syrphidae) und ist eine vergleichsweise kleine, aber auffällig gezeichnete Art. Ihr Körper ist schlank, überwiegend schwarz gefärbt und trägt mehrere leuchtend gelbe Querbinden auf dem Hinterleib. Diese Färbung erinnert an Wespen, dient jedoch ausschließlich der Abschreckung – die Art ist vollkommen harmlos.
Charakteristisch ist ihr ruhiger, kontrollierter Flug, bei dem sie häufig in der Luft „steht“. Erwachsene Tiere ernähren sich von Nektar und Pollen und sind damit wichtige Bestäuber früh blühender Pflanzen. Die Larven leben bodennah und ernähren sich überwiegend von Blattläusen, wodurch sie auch eine ökologische Rolle in der natürlichen Schädlingsregulation spielen.
Die Art bevorzugt offene, sonnige Lebensräume wie extensiv genutzte Wiesen, Waldränder, Böschungen und strukturreiche Feldraine. Ihr Auftreten beginnt bereits im zeitigen Frühjahr, was ihr den deutschen Namen eingebracht hat.
Perspektive im Wandel von Lebensraum und Klima
Die Zukunft der Frühen Gelbrandschwebfliege ist eng mit der Entwicklung unserer Landschaft verknüpft. Der Verlust artenreicher Wiesen, eine zunehmende Versiegelung von Flächen und der Rückgang von Wildpflanzen schränken geeignete Lebensräume zunehmend ein. Besonders problematisch ist der Mangel an früh blühenden Pflanzen, auf die die Art zu Beginn des Jahres angewiesen ist.
Der Klimawandel bringt zusätzliche Herausforderungen, aber auch neue Dynamiken. Mildere Winter und frühere Frühjahre können den Aktivitätszeitraum der Art verlängern. Gleichzeitig bergen extreme Wetterereignisse wie Spätfröste, Trockenperioden oder Starkregen Risiken für Larven und Nahrungsangebot.
Langfristig wird die Frühe Gelbrandschwebfliege davon profitieren, wenn strukturreiche, vielfältige Landschaften erhalten oder neu geschaffen werden. Naturnahe Gärten, extensiv gepflegte Grünflächen und der bewusste Umgang mit Pestiziden können dazu beitragen, dieser unauffälligen, aber ökologisch wertvollen Art auch in Zukunft einen Platz zu sichern.
In der Aufnahme von Dieter Zinßer
- Typische gelbe Querbinden auf dem Hinterleib von Xanthogramma citrofasciatum
Artenschutz in Franken®
Artenschutz in Franken®

Artenschutz in Franken®
Artenschutz als Zeichen einer ethisch-moralischen Verpflichtung, diesem Anspruch gegenüber uns begleitenden Mitgeschöpfen und deren Lebens-räume, stellen wir uns seit nunmehr fast 30 Jahren mit zahlreichen Partnern tagtäglich auf vielfältiger Art aufs Neue.
In vollkommen ehrenamtlicher, wirtschaftlich- und politisch sowie konfessionell unabhängiger Form engagieren wir uns hier mit unseren vielen Mitgliedern in abertausenden von Stunden.
Trotz der auf Franken ausgerichteten Namensgebung bundesweit für die Erhaltung der Biodiversität, sowie für eine lebendige, pädagogisch hochwertige Umweltbildung.
Auf unserer Internetpräsenz, die monatlich durchschnittlich von weit über 100.000 Besucher*innen besucht wird, berichten wir transparent auch über unser Engagement.
Artenschutz als Zeichen einer ethisch-moralischen Verpflichtung, diesem Anspruch gegenüber uns begleitenden Mitgeschöpfen und deren Lebens-räume, stellen wir uns seit nunmehr fast 30 Jahren mit zahlreichen Partnern tagtäglich auf vielfältiger Art aufs Neue.
In vollkommen ehrenamtlicher, wirtschaftlich- und politisch sowie konfessionell unabhängiger Form engagieren wir uns hier mit unseren vielen Mitgliedern in abertausenden von Stunden.
Trotz der auf Franken ausgerichteten Namensgebung bundesweit für die Erhaltung der Biodiversität, sowie für eine lebendige, pädagogisch hochwertige Umweltbildung.
Auf unserer Internetpräsenz, die monatlich durchschnittlich von weit über 100.000 Besucher*innen besucht wird, berichten wir transparent auch über unser Engagement.
In einer Dekade in der zunehmend Veränderungen, auch klimatischer Weise erkennbar werden, kommt nach unserem Dafürhalten der effektiven Erhaltung heimischer Artenvielfalt auch und gerade im Sinne einer auf-geklärten Gesellschaft eine heraus-ragende Bedeutung zu.
Der Artenschwund hat er-schreckende Ausmaße ange-nommen, welche den Eindruck der zunehmenden Leere für den aufmerksamen Betrachter deutlich erkennbar werden lässt. Eine ausge-storbene Art ist für nahezu alle Zeit verloren. Mit ihr verlieren wir eine hochwertige, einzigartige Ressource die sich den Umweltbedingungen seit meist Millionen von Jahren anpassen konnte.
Wir sollten uns den Luxus nicht leisten dieser Artenreduktion untätig zuzusehen. Nur eine möglichst hohe genetische Artenvielfalt kann die Entstehung neuer Arten effektiv ansteuern.
Im Sinne uns nachfolgender Generationen, also unserer Kinder und unserer Enkelkinder, sollten wir uns gemeinsam dazu durchringen dem galoppierenden Artenschwund Paroli zu bieten.
Nur gemeinsam wird und kann es uns gelingen diesem sicherlich nicht leichtem Unterfangen erfolgreich zu begegnen. Ohne dies jedoch jemals versucht zu haben, werden wir nie erkennen ob wir dazu in der Lage sind oder waren.
Durchdachter Artenschutz ist in unseren Augen mehr als eine Ideologie.
Er beweist in eindrucksvoller Art die Verbundenheit mit einer einzigartigen Heimat und deren sich darin befindlichen Lebensformen. Schöpfung lebendig bewahren, für uns ge-meinsam mehr als „nur“ ein Lippenbekenntnis.
Artenschutz ist für uns gleichfalls Lebensraumsicherung für den modernen Menschen.
Nur in einer intakten, vielfältigen Umwelt wird auch der Mensch die Chance erhalten nachhaltig zu überdauern. Hierfür setzten wir uns täglich vollkommen ehrenamtlich und unabhängig im Sinne unserer Mit-geschöpfe, jedoch auch ganz bewusst im Sinne unserer Mitbürger und vor allem der uns nachfolgenden Generation von ganzem Herzen ein.
Artenschutz in Franken®
Der Artenschwund hat er-schreckende Ausmaße ange-nommen, welche den Eindruck der zunehmenden Leere für den aufmerksamen Betrachter deutlich erkennbar werden lässt. Eine ausge-storbene Art ist für nahezu alle Zeit verloren. Mit ihr verlieren wir eine hochwertige, einzigartige Ressource die sich den Umweltbedingungen seit meist Millionen von Jahren anpassen konnte.
Wir sollten uns den Luxus nicht leisten dieser Artenreduktion untätig zuzusehen. Nur eine möglichst hohe genetische Artenvielfalt kann die Entstehung neuer Arten effektiv ansteuern.
Im Sinne uns nachfolgender Generationen, also unserer Kinder und unserer Enkelkinder, sollten wir uns gemeinsam dazu durchringen dem galoppierenden Artenschwund Paroli zu bieten.
Nur gemeinsam wird und kann es uns gelingen diesem sicherlich nicht leichtem Unterfangen erfolgreich zu begegnen. Ohne dies jedoch jemals versucht zu haben, werden wir nie erkennen ob wir dazu in der Lage sind oder waren.
Durchdachter Artenschutz ist in unseren Augen mehr als eine Ideologie.
Er beweist in eindrucksvoller Art die Verbundenheit mit einer einzigartigen Heimat und deren sich darin befindlichen Lebensformen. Schöpfung lebendig bewahren, für uns ge-meinsam mehr als „nur“ ein Lippenbekenntnis.
Artenschutz ist für uns gleichfalls Lebensraumsicherung für den modernen Menschen.
Nur in einer intakten, vielfältigen Umwelt wird auch der Mensch die Chance erhalten nachhaltig zu überdauern. Hierfür setzten wir uns täglich vollkommen ehrenamtlich und unabhängig im Sinne unserer Mit-geschöpfe, jedoch auch ganz bewusst im Sinne unserer Mitbürger und vor allem der uns nachfolgenden Generation von ganzem Herzen ein.
Artenschutz in Franken®
25. Jahre Artenschutz in Franken®

25. Jahre Artenschutz in Franken®
Am 01.03.2021 feierte unsere Organisation ein Vierteljahrhundert ehrenamlichen und vollkommen unabhängigen Artenschutz und erlebbare Umweltbildung.
Am 01.03.2021 feierte unsere Organisation ein Vierteljahrhundert ehrenamlichen und vollkommen unabhängigen Artenschutz und erlebbare Umweltbildung.
Und auch nach 25 Jahren zeigt sich unser Engagement keineswegs als "überholt". Im Gegenteil es wird dringender gebraucht denn je.
Denn die immensen Herausforderungen gerade auf diesem Themenfeld werden unsere Gesellschaft zukünftig intensiv fordern!
Hinweis zum 15.jährigen Bestehen.
Aus besonderem Anlass und zum 15.jährigen Bestehen unserer Organisation ergänzten wir unsere namensgebende Bezeichnung.
Der Zusatz Artenschutz in Franken® wird den Ansprüchen eines modernen und zunehmend auch überregional agierenden Verbandes gerecht.
Vormals auf die Region des Steiger-waldes beschränkt setzt sich Artenschutz in Franken® nun vermehrt in ganz Deutschland und darüber hinaus ein.
Die Bezeichnung ändert sich, was Bestand haben wird ist weiterhin das ehrenamliche und unabhängige Engagement das wir für die Belange des konkreten Artenschutzes, sowie einer lebendigen Umweltbildung in einbringen.
Im Sinne uns nachfolgender Generationen!
Auf unserer Internetpräsenz möchten wir unser ehrenamtliches Engagement näher vorstellen.
Artenschutz in Franken®
Denn die immensen Herausforderungen gerade auf diesem Themenfeld werden unsere Gesellschaft zukünftig intensiv fordern!
Hinweis zum 15.jährigen Bestehen.
Aus besonderem Anlass und zum 15.jährigen Bestehen unserer Organisation ergänzten wir unsere namensgebende Bezeichnung.
Der Zusatz Artenschutz in Franken® wird den Ansprüchen eines modernen und zunehmend auch überregional agierenden Verbandes gerecht.
Vormals auf die Region des Steiger-waldes beschränkt setzt sich Artenschutz in Franken® nun vermehrt in ganz Deutschland und darüber hinaus ein.
Die Bezeichnung ändert sich, was Bestand haben wird ist weiterhin das ehrenamliche und unabhängige Engagement das wir für die Belange des konkreten Artenschutzes, sowie einer lebendigen Umweltbildung in einbringen.
Im Sinne uns nachfolgender Generationen!
Auf unserer Internetpräsenz möchten wir unser ehrenamtliches Engagement näher vorstellen.
Artenschutz in Franken®
Kleinvogel gefunden - und jetzt?

Kleinvogel gefunden - und jetzt?
Wie verhalte ich mich beim Fund eines noch nicht flugfähigen Kleinvogels richtig?
Regelmäßig erreichen uns Anfragen die sich auf den korrekten Umgang des Tieres beim „Fund“ eines noch nicht flugfähigen Kleinvogels beziehen.
Wir vom Artenschutz in Franken® haben hier einige Informationen für Sie zusammengestellt.
Wir erklären dir das Vorgehen und die in unseren Augen wichtigsten Dos und Don'ts bei einem Fund eines kleinen, noch nicht flugfähigen Vogels in Form eines einfachen, einprägsamen Mnemonics, den du leicht merken kannst: "VOGEL"
Wie verhalte ich mich beim Fund eines noch nicht flugfähigen Kleinvogels richtig?
Regelmäßig erreichen uns Anfragen die sich auf den korrekten Umgang des Tieres beim „Fund“ eines noch nicht flugfähigen Kleinvogels beziehen.
Wir vom Artenschutz in Franken® haben hier einige Informationen für Sie zusammengestellt.
Wir erklären dir das Vorgehen und die in unseren Augen wichtigsten Dos und Don'ts bei einem Fund eines kleinen, noch nicht flugfähigen Vogels in Form eines einfachen, einprägsamen Mnemonics, den du leicht merken kannst: "VOGEL"
Jeder Buchstabe im Wort "VOGEL" steht dabei für einen wichtigen Schritt oder Hinweis:
V - Verhalten beobachten:
• Dos: Bevor du irgendetwas tust, beobachte den Vogel aus der Ferne. Manchmal (Meistens) sind die Eltern in der Nähe und kümmern sich um ihn.
• Don'ts: Den Vogel sofort anfassen oder wegtragen, ohne die Situation zu analysieren.
O - Ort sichern:
• Dos: Sicherstellen, dass der Vogel nicht durch Menschen, Hunde oder Katzen gefährdet ist.
• Don'ts: Den Vogel in gefährliche Bereiche lassen, wo er leicht verletzt werden kann.
G - Gesundheit prüfen:
• Dos: Prüfe vorsichtig, ob der Vogel verletzt ist. Wenn er offensichtlich verletzt ist, kontaktiere eine Wildtierauffangstation oder einen Tierarzt. Wende dich auch an die für die Örtlichkeit zuständige fachliche Einrichtung wie Naturschutzfachbehörde oder Umweltämter.
• Don'ts: Keine medizinische Erstversorgung versuchen, wenn du keine Erfahrung damit hast.
E - Eltern suchen:
• Dos: Versuche herauszufinden, ob die Eltern in der Nähe sind. Elternvögel kehren oft zurück, um ihre Jungen zu füttern.
• Don'ts: Den Vogel nicht sofort mitnehmen, da die Eltern ihn weiterhin versorgen könnten.
L - Letzte Entscheidung:
• Dos: Wenn der Vogel in Gefahr ist oder die Eltern nicht zurückkehren, kontaktiere eine Wildtierstation oder einen Experten für Rat und weitere Schritte.
• Don'ts: Den Vogel nicht ohne fachkundigen Rat mit nach Hause nehmen oder füttern, da falsche Pflege oft mehr schadet als hilft.
Zusammenfassung
• Verhalten beobachten: Erst schauen, nicht gleich handeln.
• Ort sichern: Gefahrenquelle ausschalten.
• Gesundheit prüfen: Verletzungen erkennen.
• Eltern suchen: Eltern in der Nähe?
• Letzte Entscheidung: Bei Gefahr oder verlassener Brut Wildtierstation kontaktieren.
Mit diesem Mnemonic kannst du dir so finden wir vom Artenschutz in Franken® recht leicht merken, wie du dich verhalten sollst, wenn du einen kleinen, noch nicht flugfähigen Vogel findest.
Wichtig!
- Bitte beachte jedoch dabei immer den Eigenschutz, denn die Tier können Krankheiten übertragen die auch für den Menschen gefährlich werden können. Deshalb raten wir vornehmlich ... immer Finger weg - Fachleute kontaktieren!
Wir vom Artenschutz in Franken® sind keine und unterhalten auch kein Tierpflegestelle da wir uns in erster Linie mit der Lebensraumsicherung und Lebensraumschaffung befassen.
Artenschutz in Franken®
Rechtliches §

Immer wieder werden wir gefragt welche rechtlichen Grundlagen es innerhalb der Naturschutz- und Tierschutzgesetze es gibt.
Wir haben einige Infos zu diesem Thema hier verlinkt:
Wir haben einige Infos zu diesem Thema hier verlinkt:
Bayerisches Naturschutzgesetz – BayNatSchG
http://www.gesetze-bayern.de/(X(1)S(fhnsotp2iqyyotymmjumqonn))/Content/Document/BayNatSchG?AspxAutoDetectCookieSupport=1
Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege
https://www.gesetze-im-internet.de/bnatschg_2009/
Tierschutzgesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/tierschg/BJNR012770972.html
http://www.gesetze-bayern.de/(X(1)S(fhnsotp2iqyyotymmjumqonn))/Content/Document/BayNatSchG?AspxAutoDetectCookieSupport=1
Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege
https://www.gesetze-im-internet.de/bnatschg_2009/
Tierschutzgesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/tierschg/BJNR012770972.html
Unser Engagement

Mehr über unser Engagement finden Sie hier:
Die Artenschutz im Steigerwald/Artenschutz in Franken®- Nachhaltigkeits-vereinbarung
www.artenschutz-steigerwald.de/de/Ueber-Uns/1001349/AiF_-_Nachhaltigkeitsvereinbarung/
Über uns
www.artenschutz-steigerwald.de/de/Ueber-Uns/
Impressum/Satzung
www.artenschutz-steigerwald.de/de/Impressum/
www.artenschutz-steigerwald.de/de/Ueber-Uns/1001349/AiF_-_Nachhaltigkeitsvereinbarung/
Über uns
www.artenschutz-steigerwald.de/de/Ueber-Uns/
Impressum/Satzung
www.artenschutz-steigerwald.de/de/Impressum/
Nachgedacht

Ein Gedicht zum Verlust der Biodiversität in unserem Land.
Artenschwund
In allen Medien tun sie es kund, bedenklich ist der Artenschwund.
Begonnen hat es schon sehr bald, durch Abholzung im Regenwald. Nicht nur um edle Hölzer zu gewinnen, man fing schließlich an zu „spinnen“. Durch Brandrodung ließ man es qualmen, und pflanzte dort dann nur noch Palmen.
Das fand die Industrie ganz prima, doch heute bejammern wir das Klima. Aber es betrifft nicht nur ferne Lande, auch bei uns ist es `ne Schande. Dass Wälder dem Profit zum Opfer fallen, dies schadet schließlich doch uns Allen.
Artenschwund
In allen Medien tun sie es kund, bedenklich ist der Artenschwund.
Begonnen hat es schon sehr bald, durch Abholzung im Regenwald. Nicht nur um edle Hölzer zu gewinnen, man fing schließlich an zu „spinnen“. Durch Brandrodung ließ man es qualmen, und pflanzte dort dann nur noch Palmen.
Das fand die Industrie ganz prima, doch heute bejammern wir das Klima. Aber es betrifft nicht nur ferne Lande, auch bei uns ist es `ne Schande. Dass Wälder dem Profit zum Opfer fallen, dies schadet schließlich doch uns Allen.
Ob Kahlschlag in Skandinavien, oder hier, die Dummen, das sind immer wir. Was unser Klima wirklich erhält, wurde zum großen Teil gefällt.
Es beginnt doch schon im Kleinen, an Straßen- und an Wegesrainen. Dort wird gemäht, ganz ohne Not, dies ist vieler Tiere Tod. Moderne Maschinen zu unserem Schrecken, lassen Schmetterlingsraupen
kläglich verrecken. Weil von den Raupen niemand profitiert, dies dann auch kaum Jemand interes-siert. Doch der Jammer ist schon groß; wo bleiben die Schmetterlinge bloß?
Auch unser Obst ist in Gefahr, denn die Bienen werden rar. Wir uns deshalb ernsthaft fragen, wer wird in Zukunft die Pollen übertragen. Eine
eingeschleppte Milbe ist der Bienen Tod und die Imker leiden Not. Dazu spritzt man noch Neonikotinoide und Glyphosat, damit man reiche Ernte hat. Das vergiftet nicht nur Tiere, sondern jetzt auch viele Biere. Glyphosat soll krebserregend sein, doch das kümmert hier kein Schwein.
Hauptsache es rollt weiterhin der Kiesel, denn man hat ja noch den Diesel. Der ist jetzt an Allem schuld und man gönnt ihm keine Huld. Elektrofahrzeuge sind die neue Devise, doch verhindern diese wirklich unsere Krise? Braunkohle und Atom, erzeugen zumeist unseren Strom. Wie nun jeder Bürger weiß, ist auch dieses Thema
heiß.
Gäbe es immerzu Sonnenschein, wäre Solarenergie fein. Aber da sind ja noch die Windanlagen, die hoch in den Himmel ragen. Wo sie dann an manchen Tagen, Vögel in der Luft erschlagen. Diese zogen erst von Süden fort, entkamen knapp dem Vogelmord. Nun hat es sie doch noch erwischt, nur werden sie hier nicht aufgetischt.
Wie haben die Ortolane schön ge-sungen, nun liegen auf dem Teller ihre Zungen. War das schön, als sie noch lebten, bevor sie auf `ner Rute klebten. Immer weniger wird ihr Gesang, uns wird es langsam angst und bang .Gesetze wurden
zwar gemacht, sie werden jedoch zumeist belacht. Wenn Vögel brutzeln in Pfanne und Schüssel, wen interessiert da das „Geschwätz“ aus Brüssel.
Es gibt ein paar Leute, die sind vor Ort und stellen sich gegen den Vogelmord. Die wenigen, die es wagen, riskieren dabei Kopf und Kragen. Wenn sie beseitigen Ruten und Fallen, oder hindern Jäger, Vögel abzuknallen. Riesige Netze, so stellen wir fest, geben den Vögeln nun noch den Rest. Wir sollten dies schnellstens verhindern, sonst werden wir mit unseren Kindern, bald keinen Vogelsang mehr hören. So manchen würde das kaum stören, doch mit diesem Artenschwund, schlägt irgendwann auch unsere Stund`.
Quelle
Hubertus Zinnecker
Es beginnt doch schon im Kleinen, an Straßen- und an Wegesrainen. Dort wird gemäht, ganz ohne Not, dies ist vieler Tiere Tod. Moderne Maschinen zu unserem Schrecken, lassen Schmetterlingsraupen
kläglich verrecken. Weil von den Raupen niemand profitiert, dies dann auch kaum Jemand interes-siert. Doch der Jammer ist schon groß; wo bleiben die Schmetterlinge bloß?
Auch unser Obst ist in Gefahr, denn die Bienen werden rar. Wir uns deshalb ernsthaft fragen, wer wird in Zukunft die Pollen übertragen. Eine
eingeschleppte Milbe ist der Bienen Tod und die Imker leiden Not. Dazu spritzt man noch Neonikotinoide und Glyphosat, damit man reiche Ernte hat. Das vergiftet nicht nur Tiere, sondern jetzt auch viele Biere. Glyphosat soll krebserregend sein, doch das kümmert hier kein Schwein.
Hauptsache es rollt weiterhin der Kiesel, denn man hat ja noch den Diesel. Der ist jetzt an Allem schuld und man gönnt ihm keine Huld. Elektrofahrzeuge sind die neue Devise, doch verhindern diese wirklich unsere Krise? Braunkohle und Atom, erzeugen zumeist unseren Strom. Wie nun jeder Bürger weiß, ist auch dieses Thema
heiß.
Gäbe es immerzu Sonnenschein, wäre Solarenergie fein. Aber da sind ja noch die Windanlagen, die hoch in den Himmel ragen. Wo sie dann an manchen Tagen, Vögel in der Luft erschlagen. Diese zogen erst von Süden fort, entkamen knapp dem Vogelmord. Nun hat es sie doch noch erwischt, nur werden sie hier nicht aufgetischt.
Wie haben die Ortolane schön ge-sungen, nun liegen auf dem Teller ihre Zungen. War das schön, als sie noch lebten, bevor sie auf `ner Rute klebten. Immer weniger wird ihr Gesang, uns wird es langsam angst und bang .Gesetze wurden
zwar gemacht, sie werden jedoch zumeist belacht. Wenn Vögel brutzeln in Pfanne und Schüssel, wen interessiert da das „Geschwätz“ aus Brüssel.
Es gibt ein paar Leute, die sind vor Ort und stellen sich gegen den Vogelmord. Die wenigen, die es wagen, riskieren dabei Kopf und Kragen. Wenn sie beseitigen Ruten und Fallen, oder hindern Jäger, Vögel abzuknallen. Riesige Netze, so stellen wir fest, geben den Vögeln nun noch den Rest. Wir sollten dies schnellstens verhindern, sonst werden wir mit unseren Kindern, bald keinen Vogelsang mehr hören. So manchen würde das kaum stören, doch mit diesem Artenschwund, schlägt irgendwann auch unsere Stund`.
Quelle
Hubertus Zinnecker
Ein Frühsommer-Bild aus Schleswig-Holstein

Ein Frühsommer-Bild aus Schleswig-Holstein ...da wir jedoch im ganzen Land wiederfinden!
Eine weite Grünlandniederung, vier riesige Mähmaschinen fahren nebeneinander mit rasanter Geschwindigkeit über ein Areal von einigen hundert Hektar Wiesen.
Wo gestern noch zahlreiche Feldvögel sangen und ihre Jungen fütterten, Wiesen- und Rohrweihen jagten, ein Sumpfohreulenpaar balzte und offensichtlich einen Brutplatz hatte, bietet sich heute ein Bild der Zerstörung. Kiebitze und Brachvögel rufen verzweifelt und haben ihre Gelege verloren.
Eine weite Grünlandniederung, vier riesige Mähmaschinen fahren nebeneinander mit rasanter Geschwindigkeit über ein Areal von einigen hundert Hektar Wiesen.
Wo gestern noch zahlreiche Feldvögel sangen und ihre Jungen fütterten, Wiesen- und Rohrweihen jagten, ein Sumpfohreulenpaar balzte und offensichtlich einen Brutplatz hatte, bietet sich heute ein Bild der Zerstörung. Kiebitze und Brachvögel rufen verzweifelt und haben ihre Gelege verloren.
Schafstelzen, Wiesenpieper und Feldlerchen hüpfen mit Würmern im Schnabel auf der Suche nach ihren längst zerstückelten Jungvögeln verzweifelt über den Boden.
Alles nichts Neues.
Das kennen wir ja. Das BNatSchG §44 erlaubt es ja schließlich gemäß der „guten fachliche Praxis“, streng geschützte Vogelarten zu töten - denn verboten ist es ja nur „ohne sinnvollen Grund“.
Aber was ist an dieser uns allen bekannten Situation anders als noch vor 10, 20 Jahren?
Die Mähmaschinen sind größer und stärker denn je, schneller denn je, mähen tiefer denn je, mähen in immer kürzeren Intervallen, mähen die Gräben bis tief in jede Grabenböschung mit ab.
Wie zum Hohn kommt nun noch ein weiterer Trecker und mäht alle Stauden der Wegesränder ab, scheinbar um das letzte verbliebene Wiesenpieper- oder Blaukehlchennnest dann auch noch zu erwischen.
23.00h: Es wird dunkel, es wird weiter gemäht. Ich denke an die Wiesenweihen, den gerade erschienenen Artikel aus der Zeitschrift dem Falken: " bei nächtlicher Mahd bleiben die adulten Weihen auf dem Nest sitzen und werden mit getötet“.
Wo ist unsere Landwirtschaft hingekommen, dass jetzt hier 4 Maschinen der neusten Generation parallel nebeneinander in rasendem Tempo mähen, dahinter wird schon gewendet und das Gras abtransportiert.
Nicht ein junger Vogel, nicht ein junger Hase hat hier die geringste Chance, noch zu entkommen.
Früher habe ich nach der Mahd noch junge Kiebitze und junge Hasen gesehen, die überlebt haben. Früher hat ein Bauer noch das Mähwerk angehoben, wenn er von oben ein Kiebitznest gesehen hat.
Hier ist nun nichts mehr, nur hunderte von Krähen und Möwen, die sich über das „Fastfood“ freuen (und nebenbei bemerkt damit einen äußerst wichtigen Beitrag zur Beseitigung von Clostridien leisten, welche die Silage verunreinigen und damit den Rinderbestand gefährden könnten - gedankt wird es den Krähen aber natürlich nicht)
Diese Entwicklung der Grünlandbewirtschaftung ist sehr besorgniserregend, nicht nur für den Vogel des Jahres, die Feldlerche. Das Wettrüsten der Landwirte ist verständlich aus deren wirtschaftlicher Sicht, aber eine ökologische Vollkatastrophe und das Ergebnis einer verfehlten Agrarpolitik.
Was ist denn der „sinnvolle Grund“, der diese Entwicklung überhaupt zulässt?
Dass die Milch und das Fleisch immer noch billiger werden, und dafür das letzte Stück Natur geschreddert wird? Ist das wirklich im Sinne der Allgemeinheit, denn es sind doch nicht nur wir Naturschützer*innen und Vogelkundler*innen, die sich über blühende Wiesen und singende Lerchen freuen.
Dieser massenhafte Vogelmord auf unserem Grünland (und natürlich Amphibien, Reptilien, Säugetiere, Insekten) wird immer aggressiver und ist vielen Menschen gar nicht bewusst.
Es müssen dringend Maßnahmen ergriffen werden, wie z.B. gesetzlich vorgeschriebene Randstreifen zu Gräben und Wegesrändern, Verbot nächtlicher Mahd, Begrenzung der Mahdhöhe- und Mahdgeschwindigkeit usw.
Ansonsten brauchen wir uns auch nicht über vogeljagende Mittelmeerländer aufzuregen - denn das was hier stattfindet ist letztendlich genauso zerstörerisch wie zum Spaß zur Flinte zu greifen.
Juni 2019
Autorin
Natascha Gaedecke
Alles nichts Neues.
Das kennen wir ja. Das BNatSchG §44 erlaubt es ja schließlich gemäß der „guten fachliche Praxis“, streng geschützte Vogelarten zu töten - denn verboten ist es ja nur „ohne sinnvollen Grund“.
Aber was ist an dieser uns allen bekannten Situation anders als noch vor 10, 20 Jahren?
Die Mähmaschinen sind größer und stärker denn je, schneller denn je, mähen tiefer denn je, mähen in immer kürzeren Intervallen, mähen die Gräben bis tief in jede Grabenböschung mit ab.
Wie zum Hohn kommt nun noch ein weiterer Trecker und mäht alle Stauden der Wegesränder ab, scheinbar um das letzte verbliebene Wiesenpieper- oder Blaukehlchennnest dann auch noch zu erwischen.
23.00h: Es wird dunkel, es wird weiter gemäht. Ich denke an die Wiesenweihen, den gerade erschienenen Artikel aus der Zeitschrift dem Falken: " bei nächtlicher Mahd bleiben die adulten Weihen auf dem Nest sitzen und werden mit getötet“.
Wo ist unsere Landwirtschaft hingekommen, dass jetzt hier 4 Maschinen der neusten Generation parallel nebeneinander in rasendem Tempo mähen, dahinter wird schon gewendet und das Gras abtransportiert.
Nicht ein junger Vogel, nicht ein junger Hase hat hier die geringste Chance, noch zu entkommen.
Früher habe ich nach der Mahd noch junge Kiebitze und junge Hasen gesehen, die überlebt haben. Früher hat ein Bauer noch das Mähwerk angehoben, wenn er von oben ein Kiebitznest gesehen hat.
Hier ist nun nichts mehr, nur hunderte von Krähen und Möwen, die sich über das „Fastfood“ freuen (und nebenbei bemerkt damit einen äußerst wichtigen Beitrag zur Beseitigung von Clostridien leisten, welche die Silage verunreinigen und damit den Rinderbestand gefährden könnten - gedankt wird es den Krähen aber natürlich nicht)
Diese Entwicklung der Grünlandbewirtschaftung ist sehr besorgniserregend, nicht nur für den Vogel des Jahres, die Feldlerche. Das Wettrüsten der Landwirte ist verständlich aus deren wirtschaftlicher Sicht, aber eine ökologische Vollkatastrophe und das Ergebnis einer verfehlten Agrarpolitik.
Was ist denn der „sinnvolle Grund“, der diese Entwicklung überhaupt zulässt?
Dass die Milch und das Fleisch immer noch billiger werden, und dafür das letzte Stück Natur geschreddert wird? Ist das wirklich im Sinne der Allgemeinheit, denn es sind doch nicht nur wir Naturschützer*innen und Vogelkundler*innen, die sich über blühende Wiesen und singende Lerchen freuen.
Dieser massenhafte Vogelmord auf unserem Grünland (und natürlich Amphibien, Reptilien, Säugetiere, Insekten) wird immer aggressiver und ist vielen Menschen gar nicht bewusst.
Es müssen dringend Maßnahmen ergriffen werden, wie z.B. gesetzlich vorgeschriebene Randstreifen zu Gräben und Wegesrändern, Verbot nächtlicher Mahd, Begrenzung der Mahdhöhe- und Mahdgeschwindigkeit usw.
Ansonsten brauchen wir uns auch nicht über vogeljagende Mittelmeerländer aufzuregen - denn das was hier stattfindet ist letztendlich genauso zerstörerisch wie zum Spaß zur Flinte zu greifen.
Juni 2019
Autorin
Natascha Gaedecke
Waldsterben 2.0 – Nein eine Chance zur Gestaltung naturnaher Wälder!

Waldsterben 2.0 – Nein eine Chance zur Gestaltung naturnaher Wälder!
Artenschutz in Franken® verfolgt seit geraumer Zeit die Diskussionen um den propagierten Niedergang des deutschen Waldes.
Als Ursache dieses Niedergangs wurde der/die Schuldige/n bereits ausgemacht. Der Klimawandel der die Bäume verdursten lässt und hie und da auch noch einige Großsäuger die unseren Wald „auffressen“. Diesen wird es vielerorts zugeschrieben, dass wir in wenigen Jahren wohl unseren Wald verlieren werden?!
Artenschutz in Franken® verfolgt seit geraumer Zeit die Diskussionen um den propagierten Niedergang des deutschen Waldes.
Als Ursache dieses Niedergangs wurde der/die Schuldige/n bereits ausgemacht. Der Klimawandel der die Bäume verdursten lässt und hie und da auch noch einige Großsäuger die unseren Wald „auffressen“. Diesen wird es vielerorts zugeschrieben, dass wir in wenigen Jahren wohl unseren Wald verlieren werden?!
Als Ursache für das infolge des Klimawandels erkennbare „Absterben“ unserer Wirtschaftswälder liegt jedoch vielmehr auch darin, dass wir unsere Wälder in den vergangenen Jahrhunderten ständig waldbaulich manipulierten und dieses auch heute noch sehr ausgeprägt und vielfach intensiver den je tun.
In dieser Zeitspanne haben wir in unserem Land nahezu alle unsere ursprünglich geformten Wälder verloren. Wir haben diesen Systemen seither ständig unsere menschliche Handschrift auferlegt um aufzuzeigen wie wir uns einen nachhaltig geformten Wirtschaftswald vorstellen. Und diesen selbstverständlich auch intensiv nutzen können.
Ohne große Rücksicht auf Pflanzen und Tiere welche in diesem Ökosystem leben.Wir haben somit keinen Wald mehr vor Augen wie dieser von Natur aus gedacht war – wir haben einen Wald vor unseren Augen wie wir uns Menschen einen Wald vorstellen.
Somit „stirbt“ nun auch nicht der Wald, sondern lediglich der vom Menschen fehlgeformte Wald.
Nun wird also fleißig darüber nachgedacht mit einem Millionenaufwand unseren Wald mit Aufforstungsprogrammen zu retten. Doch dieser Ansatz ist in unseren Augen eine weitere Verfehlung menschlichen Wirkens. Denn was hier zusammengepflanzt wird ist wieder kein sich natürlich entwickelter Wald der seine Dynamik sichtbar werden lassen kann. Nein es wird wieder ein vom Menschen manipulierter Wirtschaftswald entstehen der nur die Lebensformen in sich duldet die wir dieser Holzproduktionsfläche zugestehen.
Die Vielfalt der Arten wird hier auf immens großen Flächen abermals keine Rolle spielen.
Doch warum lassen wir es nicht einfach mal zu das wir dem Wald die Chance eröffnen uns zu zeigen wie Waldbau funktioniert und wie ein robuster Wald aussieht. „Dieser Wald“ wird uns in 50 – 70 Jahren zeigen welche Artenzusammensetzung für den jeweiligen Standort die richtige Mischung ist.
Es ist uns schon klar das bis dahin viele vom Menschen geschaffenen Wälder nicht mehr stehen werden denn sie werden tatsächlich „aufgefressen“.
Doch nicht vom Reh, welches Luchs und Wolf als Nahrungsgrundlage dringlich benötigen, wollen wir verhindern das diese sich an unseren Schafen & Co. bedienen, sondern von ganz kleinen Tieren. Der Borkenkäfer wird die Fläche für die nachfolgenden Naturwälder vorbereiten so wie wir es an mancher Stelle in Bayern sehr gut erkennen können.
Es bedarf somit in unseren Augen einem gesellschaftlichen Umdenken das endlich greifen muss.
Gerade im Sinne unserer Kinder und Enkelkinder welchen wir eine an Arten reiche Welt hinterlassen sollten.
AiF
12.08.2019
Ein sehr interessanter Bericht zu diesem Thema findet sich hier
In dieser Zeitspanne haben wir in unserem Land nahezu alle unsere ursprünglich geformten Wälder verloren. Wir haben diesen Systemen seither ständig unsere menschliche Handschrift auferlegt um aufzuzeigen wie wir uns einen nachhaltig geformten Wirtschaftswald vorstellen. Und diesen selbstverständlich auch intensiv nutzen können.
Ohne große Rücksicht auf Pflanzen und Tiere welche in diesem Ökosystem leben.Wir haben somit keinen Wald mehr vor Augen wie dieser von Natur aus gedacht war – wir haben einen Wald vor unseren Augen wie wir uns Menschen einen Wald vorstellen.
Somit „stirbt“ nun auch nicht der Wald, sondern lediglich der vom Menschen fehlgeformte Wald.
Nun wird also fleißig darüber nachgedacht mit einem Millionenaufwand unseren Wald mit Aufforstungsprogrammen zu retten. Doch dieser Ansatz ist in unseren Augen eine weitere Verfehlung menschlichen Wirkens. Denn was hier zusammengepflanzt wird ist wieder kein sich natürlich entwickelter Wald der seine Dynamik sichtbar werden lassen kann. Nein es wird wieder ein vom Menschen manipulierter Wirtschaftswald entstehen der nur die Lebensformen in sich duldet die wir dieser Holzproduktionsfläche zugestehen.
Die Vielfalt der Arten wird hier auf immens großen Flächen abermals keine Rolle spielen.
Doch warum lassen wir es nicht einfach mal zu das wir dem Wald die Chance eröffnen uns zu zeigen wie Waldbau funktioniert und wie ein robuster Wald aussieht. „Dieser Wald“ wird uns in 50 – 70 Jahren zeigen welche Artenzusammensetzung für den jeweiligen Standort die richtige Mischung ist.
Es ist uns schon klar das bis dahin viele vom Menschen geschaffenen Wälder nicht mehr stehen werden denn sie werden tatsächlich „aufgefressen“.
Doch nicht vom Reh, welches Luchs und Wolf als Nahrungsgrundlage dringlich benötigen, wollen wir verhindern das diese sich an unseren Schafen & Co. bedienen, sondern von ganz kleinen Tieren. Der Borkenkäfer wird die Fläche für die nachfolgenden Naturwälder vorbereiten so wie wir es an mancher Stelle in Bayern sehr gut erkennen können.
Es bedarf somit in unseren Augen einem gesellschaftlichen Umdenken das endlich greifen muss.
Gerade im Sinne unserer Kinder und Enkelkinder welchen wir eine an Arten reiche Welt hinterlassen sollten.
AiF
12.08.2019
Ein sehr interessanter Bericht zu diesem Thema findet sich hier