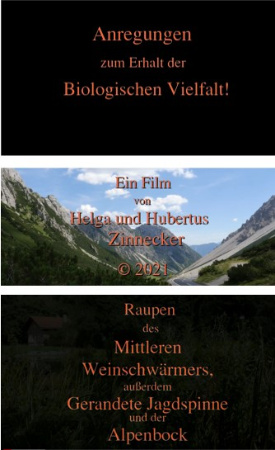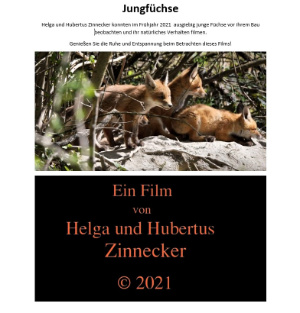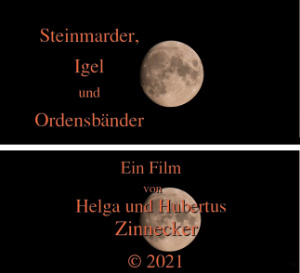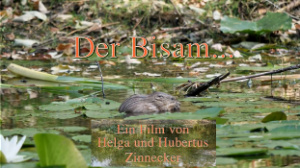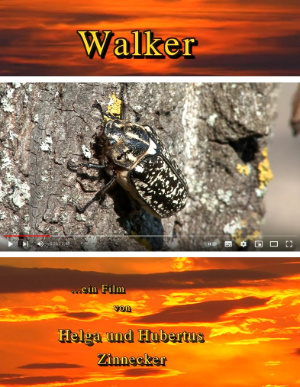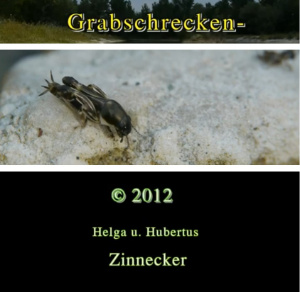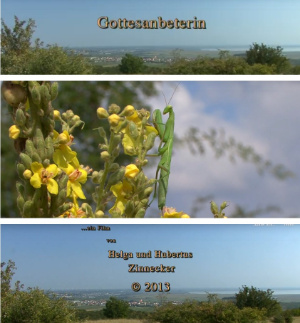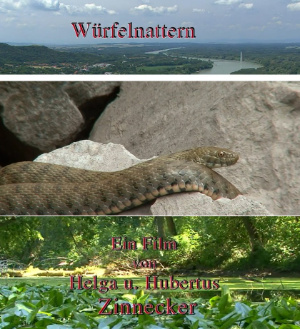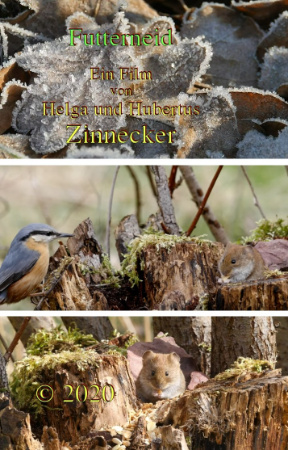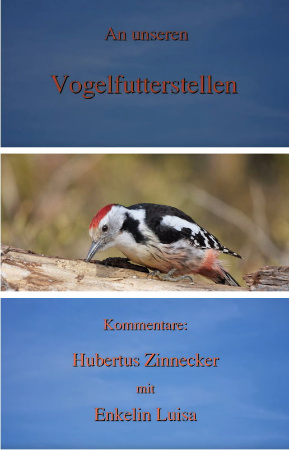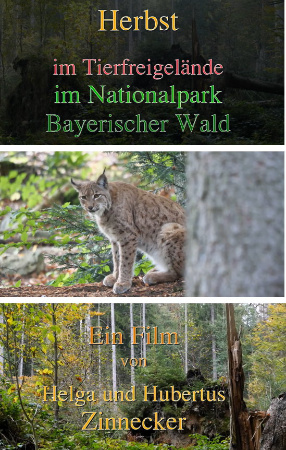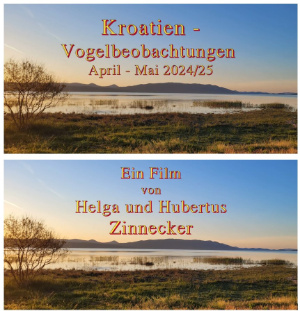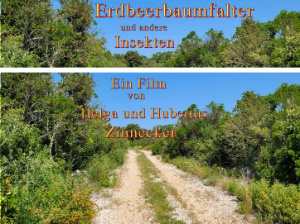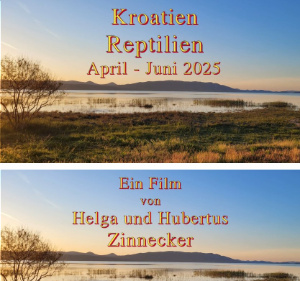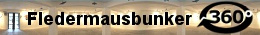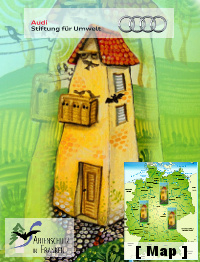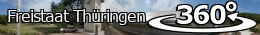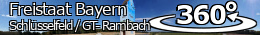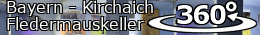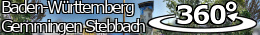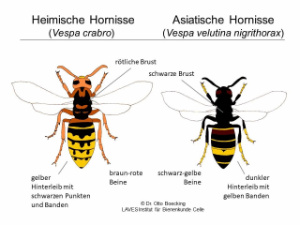BREAKING NEWS
| AiF | 06:03
Immer auf der richtigen Fährte ...
Artenschutz in Franken®
Artenschutz in Franken®
Wo der Fuchs gräbt, lebt das Gleichgewicht

Der Rotfuchs – Hüter des Gleichgewichts
05/06.02.2026
Ein rotes Fell, das im letzten Licht schimmert, aufmerksame Augen, die jede Bewegung wahrnehmen. Der Rotfuchs ist kein Eindringling in unsere Welt – er ist ein Teil von ihr. Seit Jahrtausenden begleitet er unsere Landschaften, Wälder, Felder und inzwischen auch die Ränder unserer Städte. Und doch wird kaum ein wildlebendes Tier so missverstanden wie er.
05/06.02.2026
- In der Dämmerung, wenn der Tag langsam zur Ruhe kommt und die Landschaft leiser wird, erscheint er oft wie ein Schatten am Rand unseres Blickfeldes.
Ein rotes Fell, das im letzten Licht schimmert, aufmerksame Augen, die jede Bewegung wahrnehmen. Der Rotfuchs ist kein Eindringling in unsere Welt – er ist ein Teil von ihr. Seit Jahrtausenden begleitet er unsere Landschaften, Wälder, Felder und inzwischen auch die Ränder unserer Städte. Und doch wird kaum ein wildlebendes Tier so missverstanden wie er.
Der Rotfuchs (Vulpes vulpes) ist ein hochangepasster, intelligenter Beutegreifer mit einer enormen ökologischen Bedeutung. Seine Rolle im Ökosystem ist vielfältig und unverzichtbar. Als Allesfresser reguliert er Bestände von Mäusen, Ratten und anderen Kleinsäugern, die sich ohne natürliche Feinde massenhaft vermehren würden. Gerade in landwirtschaftlich geprägten Regionen leistet der Fuchs damit einen unsichtbaren, aber enorm wichtigen Beitrag zum natürlichen Gleichgewicht.
Darüber hinaus wirkt der Rotfuchs als „Gesundheitspolizei“ der Natur. Er erbeutet bevorzugt geschwächte, kranke oder junge Tiere und trägt so dazu bei, Populationen stabil und widerstandsfähig zu halten. Krankheiten breiten sich langsamer aus, natürliche Selektionsprozesse bleiben erhalten. Ein intaktes Ökosystem braucht genau diese Mechanismen – leise, effizient und ohne menschliches Eingreifen.
Trotz dieser Leistungen wird der Fuchs bis heute häufig als „Schädling“ bezeichnet.
Dieses Bild ist nicht nur überholt, sondern schlicht falsch. Probleme entstehen nicht durch den Fuchs selbst, sondern durch vom Menschen veränderte Lebensräume: ausgeräumte Landschaften, fehlende Rückzugsorte, intensive Landwirtschaft und die Zerschneidung von Lebensräumen. Der Fuchs passt sich an, weil er es muss – nicht, weil er Schaden anrichten will.
Die Jagd auf den Rotfuchs wird oft mit Bestandsregulierung oder Artenschutz anderer Tiere begründet. Wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen jedoch, dass diese Argumente nicht tragen. Intensive Bejagung führt nicht zu einer nachhaltigen Reduktion der Fuchspopulation. Im Gegenteil: Sie kann soziale Strukturen zerstören und sogar zu einer höheren Fortpflanzungsrate führen. Ein stabiles Ökosystem reguliert sich selbst – vorausgesetzt, man lässt ihm die Chance dazu.
Wir lehnen die Jagd auf den Rotfuchs daher klar ab. Nicht aus romantischer Verklärung, sondern aus ökologischer Überzeugung. Der Fuchs gehört zu einer gesunden Landschaft genauso dazu wie Bäume, Insekten oder Vögel. Seine Anwesenheit ist ein Zeichen von Anpassungsfähigkeit, Überlebenskunst und natürlicher Balance.
Ein Ökosystem, das nur dann akzeptiert wird, wenn es unseren Vorstellungen entspricht, ist kein intaktes Ökosystem.
Natur ist nicht ordentlich, nicht kontrollierbar und nicht immer bequem. Aber sie funktioniert – wenn wir ihr Raum lassen. Der Rotfuchs erinnert uns daran, dass Vielfalt, auch die der Beutegreifer, kein Problem ist, sondern eine Voraussetzung für Stabilität.
Dieses wunderschöne Tier verdient keinen Kampf, sondern Respekt. Keinen Abschuss, sondern Schutz. Wer den Rotfuchs schützt, schützt nicht nur eine Art – sondern das fein abgestimmte Netzwerk des Lebens, von dem auch wir selbst abhängen.
In der Aufnahme von Johannes Rother
Darüber hinaus wirkt der Rotfuchs als „Gesundheitspolizei“ der Natur. Er erbeutet bevorzugt geschwächte, kranke oder junge Tiere und trägt so dazu bei, Populationen stabil und widerstandsfähig zu halten. Krankheiten breiten sich langsamer aus, natürliche Selektionsprozesse bleiben erhalten. Ein intaktes Ökosystem braucht genau diese Mechanismen – leise, effizient und ohne menschliches Eingreifen.
Trotz dieser Leistungen wird der Fuchs bis heute häufig als „Schädling“ bezeichnet.
Dieses Bild ist nicht nur überholt, sondern schlicht falsch. Probleme entstehen nicht durch den Fuchs selbst, sondern durch vom Menschen veränderte Lebensräume: ausgeräumte Landschaften, fehlende Rückzugsorte, intensive Landwirtschaft und die Zerschneidung von Lebensräumen. Der Fuchs passt sich an, weil er es muss – nicht, weil er Schaden anrichten will.
Die Jagd auf den Rotfuchs wird oft mit Bestandsregulierung oder Artenschutz anderer Tiere begründet. Wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen jedoch, dass diese Argumente nicht tragen. Intensive Bejagung führt nicht zu einer nachhaltigen Reduktion der Fuchspopulation. Im Gegenteil: Sie kann soziale Strukturen zerstören und sogar zu einer höheren Fortpflanzungsrate führen. Ein stabiles Ökosystem reguliert sich selbst – vorausgesetzt, man lässt ihm die Chance dazu.
Wir lehnen die Jagd auf den Rotfuchs daher klar ab. Nicht aus romantischer Verklärung, sondern aus ökologischer Überzeugung. Der Fuchs gehört zu einer gesunden Landschaft genauso dazu wie Bäume, Insekten oder Vögel. Seine Anwesenheit ist ein Zeichen von Anpassungsfähigkeit, Überlebenskunst und natürlicher Balance.
Ein Ökosystem, das nur dann akzeptiert wird, wenn es unseren Vorstellungen entspricht, ist kein intaktes Ökosystem.
Natur ist nicht ordentlich, nicht kontrollierbar und nicht immer bequem. Aber sie funktioniert – wenn wir ihr Raum lassen. Der Rotfuchs erinnert uns daran, dass Vielfalt, auch die der Beutegreifer, kein Problem ist, sondern eine Voraussetzung für Stabilität.
Dieses wunderschöne Tier verdient keinen Kampf, sondern Respekt. Keinen Abschuss, sondern Schutz. Wer den Rotfuchs schützt, schützt nicht nur eine Art – sondern das fein abgestimmte Netzwerk des Lebens, von dem auch wir selbst abhängen.
In der Aufnahme von Johannes Rother
- Rotfuchs – auf der Suche nach Feldmäusen
Artenschutz in Franken®
Noki und Luma – Zwei Abendsegler lernen fliegen

Noki und Luma – Zwei Abendsegler lernen fliegen
04/05.02.2026
Sie waren Große Abendsegler, noch klein und flauschig, mit viel zu großen Flügeln, die sie sich nachts neugierig anschauten. Ihre Mama erzählte ihnen jeden Abend Geschichten vom Fliegen, von Käfern im Mondlicht und vom weiten Himmel.
04/05.02.2026
- Hoch oben in einer alten Buche, dort wo der Wind leise durch die Blätter flüsterte, lebten die Geschwister Noki und Luma.
Sie waren Große Abendsegler, noch klein und flauschig, mit viel zu großen Flügeln, die sie sich nachts neugierig anschauten. Ihre Mama erzählte ihnen jeden Abend Geschichten vom Fliegen, von Käfern im Mondlicht und vom weiten Himmel.
Noki und Luma – Zwei Abendsegler lernen fliegen
Hoch oben in einer alten Buche, dort wo der Wind leise durch die Blätter flüsterte, lebten die Geschwister Noki und Luma. Sie waren Große Abendsegler, noch klein und flauschig, mit viel zu großen Flügeln, die sie sich nachts neugierig anschauten. Ihre Mama erzählte ihnen jeden Abend Geschichten vom Fliegen, von Käfern im Mondlicht und vom weiten Himmel.
Doch eines Tages war alles anders.
Der Baum, in dem ihr Zuhause war, wurde laut. Es brummte und ratterte, und plötzlich wackelte ihre Höhle. Die Buche war alt und sollte gefällt werden. Noki und Luma hatten große Angst. Ihre Mama versuchte, sie in Sicherheit zu bringen, doch im Durcheinander verloren sie sich aus den Augen. Die beiden kleinen Abendsegler rutschten aus ihrer Höhle und landeten erschöpft im Gras.
Sie piepsten leise. Die Nacht war kalt.
Am nächsten Morgen wurden Noki und Luma von einer Frau gefunden, die ganz vorsichtig war und leise sprach. Sie wusste, dass die beiden Hilfe brauchten. Behutsam brachte sie die Geschwister an einen warmen Ort – zu einer Pflegestelle für Fledermäuse.
Dort gab es weiche Tücher, Ruhe und Menschen, die sich gut auskannten. Noki und Luma bekamen Milch, wurden gewogen und durften schlafen, so viel sie wollten. Jeden Abend hörten sie andere Fledermäuse flattern und träumten davon, eines Tages selbst wieder durch die Luft zu sausen.
Die Menschen erklärten leise, warum Noki und Luma hier waren:
Viele alte Bäume verschwinden, weil Wälder sich verändern und Platz für Straßen oder Häuser gemacht wird. Für Fledermäuse wird es dadurch immer schwerer, sichere Schlafplätze zu finden.
Mit jedem Tag wurden die Geschwister stärker. Sie übten Flügelstrecken, Klettern und kleine Sprünge. Bald durften sie in einem großen Raum flattern – erst vorsichtig, dann mutiger.
Eines Abends war es so weit.
Die Sonne ging unter, und der Himmel färbte sich orange. Noki und Luma wurden nach draußen getragen. Die Luft roch nach Sommer, und irgendwo summten Insekten. Als sie losflogen, war es, als hätten sie nie etwas anderes getan.
Sie drehten ihre ersten Kreise über den Bäumen. Frei. Stark. Zusammen.
Und auch wenn sie ihre alte Buche nie vergessen würden, wussten sie jetzt:
In der Aufnahme von Jana Stepanek
Hoch oben in einer alten Buche, dort wo der Wind leise durch die Blätter flüsterte, lebten die Geschwister Noki und Luma. Sie waren Große Abendsegler, noch klein und flauschig, mit viel zu großen Flügeln, die sie sich nachts neugierig anschauten. Ihre Mama erzählte ihnen jeden Abend Geschichten vom Fliegen, von Käfern im Mondlicht und vom weiten Himmel.
Doch eines Tages war alles anders.
Der Baum, in dem ihr Zuhause war, wurde laut. Es brummte und ratterte, und plötzlich wackelte ihre Höhle. Die Buche war alt und sollte gefällt werden. Noki und Luma hatten große Angst. Ihre Mama versuchte, sie in Sicherheit zu bringen, doch im Durcheinander verloren sie sich aus den Augen. Die beiden kleinen Abendsegler rutschten aus ihrer Höhle und landeten erschöpft im Gras.
Sie piepsten leise. Die Nacht war kalt.
Am nächsten Morgen wurden Noki und Luma von einer Frau gefunden, die ganz vorsichtig war und leise sprach. Sie wusste, dass die beiden Hilfe brauchten. Behutsam brachte sie die Geschwister an einen warmen Ort – zu einer Pflegestelle für Fledermäuse.
Dort gab es weiche Tücher, Ruhe und Menschen, die sich gut auskannten. Noki und Luma bekamen Milch, wurden gewogen und durften schlafen, so viel sie wollten. Jeden Abend hörten sie andere Fledermäuse flattern und träumten davon, eines Tages selbst wieder durch die Luft zu sausen.
Die Menschen erklärten leise, warum Noki und Luma hier waren:
Viele alte Bäume verschwinden, weil Wälder sich verändern und Platz für Straßen oder Häuser gemacht wird. Für Fledermäuse wird es dadurch immer schwerer, sichere Schlafplätze zu finden.
Mit jedem Tag wurden die Geschwister stärker. Sie übten Flügelstrecken, Klettern und kleine Sprünge. Bald durften sie in einem großen Raum flattern – erst vorsichtig, dann mutiger.
Eines Abends war es so weit.
Die Sonne ging unter, und der Himmel färbte sich orange. Noki und Luma wurden nach draußen getragen. Die Luft roch nach Sommer, und irgendwo summten Insekten. Als sie losflogen, war es, als hätten sie nie etwas anderes getan.
Sie drehten ihre ersten Kreise über den Bäumen. Frei. Stark. Zusammen.
Und auch wenn sie ihre alte Buche nie vergessen würden, wussten sie jetzt:
- Es gibt Menschen, die aufpassen. Und es gibt Hoffnung – für Abendsegler, für Wälder und für den Himmel der Nacht.
In der Aufnahme von Jana Stepanek
- Großer Abendsegler - Pfleglinge
Artenschutz in Franken®
Alpenskorpion ( Alpiscorpius germanus)

Der Alpenskorpion
04/05.02.2026
… was ein Skorpion in den Alpen, davon haben die wenigsten von uns gehört.
Und schon entstehen Bilder in den Köpfen von Wanderern und Touristen die Angst haben von diesem Tier gestochen zu werden. Zum einen soll benannt werden, dass wir in Deutschland (auszuschließen ist das jedoch nicht da Verschleppungen durch Menschen und Tieren möglich sind) wohl dieses Tier nicht sehen werden, da es „in den Alpen vor unserer Haustür“ wohl auf die Schweiz und Österreich konzentriert ist.
04/05.02.2026
… was ein Skorpion in den Alpen, davon haben die wenigsten von uns gehört.
Und schon entstehen Bilder in den Köpfen von Wanderern und Touristen die Angst haben von diesem Tier gestochen zu werden. Zum einen soll benannt werden, dass wir in Deutschland (auszuschließen ist das jedoch nicht da Verschleppungen durch Menschen und Tieren möglich sind) wohl dieses Tier nicht sehen werden, da es „in den Alpen vor unserer Haustür“ wohl auf die Schweiz und Österreich konzentriert ist.
Zum anderen ist das Tier nachtaktiv. Am Tag begibt sich der Alpenskorpion in Deckung und sucht sich Rückzugsbereiche unter Steinen und sonstigen Hohlräumen. In der Nacht krabbelt er dann hervor und macht sich auf Nahrungssuche. Diese besteht aus Insekten und anderen kleinen „Krabblern“ die er mit dem Gift in seinem Stachel tötet, oder mit seinen zwei kräftigen Fußzangen packt.
Als „Lebendgebärer“ und „Brutpfleger“ zeichnet sich der Alpenskorpion markant aus und wird hoffentlich noch lange Zeit unter uns leben. Denn 400 Millionen haben diese Hauptzuordnungsarten es bereits geschafft. Doch ist es nicht sicher ob nicht auch hier der Mensch erneut zuschlägt und mit seinem unsäglichen Wirken erneut eine Art auslöscht ...
In der Aufnahme von Helga Zinnecker
Als „Lebendgebärer“ und „Brutpfleger“ zeichnet sich der Alpenskorpion markant aus und wird hoffentlich noch lange Zeit unter uns leben. Denn 400 Millionen haben diese Hauptzuordnungsarten es bereits geschafft. Doch ist es nicht sicher ob nicht auch hier der Mensch erneut zuschlägt und mit seinem unsäglichen Wirken erneut eine Art auslöscht ...
In der Aufnahme von Helga Zinnecker
- Alpenskorpion
Artenschutz in Franken®
Streuobst am Wegesrand – eine stille Überlebensversicherung im Winter

Streuobst am Wegesrand – eine stille Überlebensversicherung im Winter
04/05.02.2026
Was im Frühling und Sommer reichlich vorhanden ist, wird plötzlich knapp: Nahrung, Schutz und Orientierung verschwinden unter Eis und Schnee. Gerade in dieser lebensfeindlichen Zeit entfalten Streuobstbestände entlang von Flurwegen ihre oft unterschätzte Bedeutung. Sie werden zu stillen Rückzugsorten und zu einer echten Überlebensversicherung für zahlreiche Tierarten.
04/05.02.2026
- Wenn der Winter das Land unter eine geschlossene Schneedecke legt, verändert sich die Welt für viele Tiere radikal.
Was im Frühling und Sommer reichlich vorhanden ist, wird plötzlich knapp: Nahrung, Schutz und Orientierung verschwinden unter Eis und Schnee. Gerade in dieser lebensfeindlichen Zeit entfalten Streuobstbestände entlang von Flurwegen ihre oft unterschätzte Bedeutung. Sie werden zu stillen Rückzugsorten und zu einer echten Überlebensversicherung für zahlreiche Tierarten.
Streuobstwiesen und Obstbaumreihen entlang von Wegen sind kein Zufallsprodukt, sondern das Ergebnis jahrhundertelanger, extensiver Landnutzung. Hochstämmige Apfel-, Birnen-, Kirsch- oder Zwetschgenbäume prägen nicht nur das Landschaftsbild, sondern schaffen eine einzigartige Verbindung aus Offenland und Gehölzstruktur. Besonders im Winter, wenn Äcker kahl und Wiesen verschneit sind, bleiben diese Bereiche vergleichsweise reich an Leben.
Ein entscheidender Vorteil der Streuobstbestände ist ihr Nahrungsangebot über die kalte Jahreszeit hinweg. Viele Früchte verbleiben nach der Ernte an den Bäumen oder fallen auf den Boden. Äpfel, Birnen und anderes Fallobst frieren nur langsam durch und bleiben für Tiere oft wochen- oder monatelang nutzbar. Vögel wie Amseln, Drosseln oder Stare finden hier energiereiche Nahrung, während Säugetiere wie Rehe, Dachse, Füchse oder Mäuse vom Fallobst profitieren. Selbst Insektenlarven und Mikroorganismen im verrottenden Obst bilden die Grundlage weiterer Nahrungsketten.
Neben dem Futter spielen Strukturen und Verstecke eine zentrale Rolle. Die alten, knorrigen Obstbäume besitzen häufig Höhlen, Rindenspalten und Totholzanteile. Diese bieten Unterschlupf vor Kälte, Wind und Fressfeinden. Fledermäuse nutzen Baumhöhlen als Winterquartiere, Siebenschläfer und Haselmäuse ziehen sich in geschützte Hohlräume zurück, während Vögel geschlossene Kronen als Schlafplätze nutzen. Hecken, Grasstreifen und ungeräumte Wegsäume unter den Bäumen ergänzen dieses Mosaik aus Rückzugsräumen.
Flurwege mit begleitenden Streuobstbeständen wirken zudem als ökologische Korridore. In einer zunehmend intensiv genutzten Landschaft ermöglichen sie Tieren sichere Wanderbewegungen zwischen Lebensräumen. Gerade im Winter, wenn weite Flächen kaum Deckung bieten, sind diese linearen Strukturen von unschätzbarem Wert. Sie verbinden Wälder, Wiesen und Siedlungsränder und sichern so den genetischen Austausch zwischen Populationen.
Auch für seltene und spezialisierte Arten sind Streuobstbestände von Bedeutung. Misteln, Moose und Flechten finden auf alten Obstbäumen geeignete Standorte. Spechte nutzen morsches Holz zur Nahrungssuche, während Eulen und Greifvögel die offenen Bereiche entlang der Wege als Jagdhabitate schätzen. Der Wechsel aus freien Flächen und Bäumen schafft optimale Bedingungen, um Beute zu entdecken und gleichzeitig Deckung zu finden.
Nicht zuletzt erfüllen diese Bestände eine klimatische Schutzfunktion. Die Baumkronen brechen den Wind, reduzieren die Auskühlung des Bodens und sorgen für kleinräumig mildere Bedingungen. Unter den Bäumen taut der Schnee oft schneller, sodass Tiere dort leichter an Nahrung gelangen können. Was für den Menschen kaum wahrnehmbar ist, kann für ein Wildtier über Leben und Tod entscheiden.
Der Schutz und die Pflege von Streuobstbeständen entlang von Flurwegen sind daher aktiver Naturschutz. Jeder erhaltene Baum, jede nachgepflanzte Obstreihe trägt dazu bei, die biologische Vielfalt zu sichern – nicht nur im Sommer, sondern gerade dann, wenn die Natur zur Ruhe kommt. In einer Zeit, in der Winter zunehmend unberechenbar werden, bleiben diese traditionellen Landschaftselemente verlässliche Anker für das Überleben vieler Arten.
In der Aufnahme
Ein entscheidender Vorteil der Streuobstbestände ist ihr Nahrungsangebot über die kalte Jahreszeit hinweg. Viele Früchte verbleiben nach der Ernte an den Bäumen oder fallen auf den Boden. Äpfel, Birnen und anderes Fallobst frieren nur langsam durch und bleiben für Tiere oft wochen- oder monatelang nutzbar. Vögel wie Amseln, Drosseln oder Stare finden hier energiereiche Nahrung, während Säugetiere wie Rehe, Dachse, Füchse oder Mäuse vom Fallobst profitieren. Selbst Insektenlarven und Mikroorganismen im verrottenden Obst bilden die Grundlage weiterer Nahrungsketten.
Neben dem Futter spielen Strukturen und Verstecke eine zentrale Rolle. Die alten, knorrigen Obstbäume besitzen häufig Höhlen, Rindenspalten und Totholzanteile. Diese bieten Unterschlupf vor Kälte, Wind und Fressfeinden. Fledermäuse nutzen Baumhöhlen als Winterquartiere, Siebenschläfer und Haselmäuse ziehen sich in geschützte Hohlräume zurück, während Vögel geschlossene Kronen als Schlafplätze nutzen. Hecken, Grasstreifen und ungeräumte Wegsäume unter den Bäumen ergänzen dieses Mosaik aus Rückzugsräumen.
Flurwege mit begleitenden Streuobstbeständen wirken zudem als ökologische Korridore. In einer zunehmend intensiv genutzten Landschaft ermöglichen sie Tieren sichere Wanderbewegungen zwischen Lebensräumen. Gerade im Winter, wenn weite Flächen kaum Deckung bieten, sind diese linearen Strukturen von unschätzbarem Wert. Sie verbinden Wälder, Wiesen und Siedlungsränder und sichern so den genetischen Austausch zwischen Populationen.
Auch für seltene und spezialisierte Arten sind Streuobstbestände von Bedeutung. Misteln, Moose und Flechten finden auf alten Obstbäumen geeignete Standorte. Spechte nutzen morsches Holz zur Nahrungssuche, während Eulen und Greifvögel die offenen Bereiche entlang der Wege als Jagdhabitate schätzen. Der Wechsel aus freien Flächen und Bäumen schafft optimale Bedingungen, um Beute zu entdecken und gleichzeitig Deckung zu finden.
Nicht zuletzt erfüllen diese Bestände eine klimatische Schutzfunktion. Die Baumkronen brechen den Wind, reduzieren die Auskühlung des Bodens und sorgen für kleinräumig mildere Bedingungen. Unter den Bäumen taut der Schnee oft schneller, sodass Tiere dort leichter an Nahrung gelangen können. Was für den Menschen kaum wahrnehmbar ist, kann für ein Wildtier über Leben und Tod entscheiden.
Der Schutz und die Pflege von Streuobstbeständen entlang von Flurwegen sind daher aktiver Naturschutz. Jeder erhaltene Baum, jede nachgepflanzte Obstreihe trägt dazu bei, die biologische Vielfalt zu sichern – nicht nur im Sommer, sondern gerade dann, wenn die Natur zur Ruhe kommt. In einer Zeit, in der Winter zunehmend unberechenbar werden, bleiben diese traditionellen Landschaftselemente verlässliche Anker für das Überleben vieler Arten.
In der Aufnahme
- Fallobst unter Schnee und Frost – eine wichtige Energiequelle für Wildtiere.
Artenschutz in Franken®
Blaue Federlibelle (Platycnemis pennipes)

Die Blaue Federlibelle (Platycnemis pennipes)
03/04.02.2026
Die Sonne steht noch tief, und feiner Dunst liegt über dem Wasser. Am Rand eines langsam fließenden Baches ragt ein einzelner Halm aus dem Ufergras. Darauf sitzt reglos eine zarte Gestalt, fast wie aus Licht gezeichnet.
Ihre Flügel glitzern, als hätte der Morgen Tau darauf gemalt. Für einen Augenblick scheint alles stillzustehen. Dann öffnet sie ihre Flügel leicht, richtet sich neu aus – und bleibt doch. Es ist die Blaue Federlibelle, ein leiser Bewohner unserer Gewässer, dessen Leben sich meist im Verborgenen abspielt.
03/04.02.2026
- Ein stiller Moment am Bachufer
Die Sonne steht noch tief, und feiner Dunst liegt über dem Wasser. Am Rand eines langsam fließenden Baches ragt ein einzelner Halm aus dem Ufergras. Darauf sitzt reglos eine zarte Gestalt, fast wie aus Licht gezeichnet.
Ihre Flügel glitzern, als hätte der Morgen Tau darauf gemalt. Für einen Augenblick scheint alles stillzustehen. Dann öffnet sie ihre Flügel leicht, richtet sich neu aus – und bleibt doch. Es ist die Blaue Federlibelle, ein leiser Bewohner unserer Gewässer, dessen Leben sich meist im Verborgenen abspielt.
Artbeschreibung: Die Blaue Federlibelle (Platycnemis pennipes)
Die Blaue Federlibelle (Platycnemis pennipes) gehört zur Familie der Federlibellen (Platycnemididae) und zählt zu den auffälligeren Kleinlibellen Mitteleuropas. Ihren Namen verdankt sie den verbreiterten, federartig wirkenden Schienen an den Beinen, die bei den Männchen besonders deutlich ausgeprägt sind. Diese Strukturen spielen eine Rolle bei der Balz und dienen zugleich als visuelles Erkennungsmerkmal.
Männliche Tiere zeigen meist eine zartblaue bis weißlich-blaue Färbung, während Weibchen überwiegend grünlich oder bräunlich gefärbt sind. Mit einer Körperlänge von etwa 35 bis 45 Millimetern wirkt die Art schlank und elegant. Die Flügel sind durchsichtig und werden in Ruhestellung leicht schräg vom Körper abgespreizt – ein typisches Merkmal dieser Art.
Die Blaue Federlibelle besiedelt bevorzugt langsam fließende oder stehende Gewässer wie Bäche, Gräben, Altarme und Kanäle mit reicher Ufervegetation. Entscheidend sind sonnige Bereiche mit Pflanzen, die als Sitzwarten, Paarungsplätze und Eiablageorte dienen. Die Larven leben im Gewässergrund, wo sie sich über mehrere Monate entwickeln, bevor sie sich zur erwachsenen Libelle häuten.
Als räuberische Art ernährt sich die Blaue Federlibelle von kleinen Insekten, die sie im Flug erbeutet. Damit ist sie ein wichtiger Bestandteil des ökologischen Gleichgewichts an Gewässern und trägt zur Regulation von Insektenpopulationen bei.
Lebensraumveränderung und Klimawandel – eine Perspektive für die Art
Die Blaue Federlibelle reagiert sensibel auf Veränderungen ihres Lebensraumes. Der Ausbau und die Begradigung von Fließgewässern, das Entfernen von Ufervegetation sowie die Verschmutzung durch Nährstoffe und Schadstoffe führen zu einem Verlust geeigneter Habitate. Wo Ufer befestigt und Gewässer technisch überformt werden, fehlen Rückzugsräume für Larven und Sitzplätze für adulte Tiere.
Der Klimawandel wirkt dabei als zusätzlicher Einflussfaktor. Steigende Temperaturen können einerseits die Entwicklungszeit der Larven verkürzen und zu früherem Auftreten der erwachsenen Libellen führen. Andererseits erhöhen längere Trockenperioden das Risiko des Austrocknens kleiner Gewässer, was besonders für die Larven eine existenzielle Bedrohung darstellt. Starkregenereignisse können wiederum Sedimente eintragen und die Gewässerstruktur verändern.
In einigen Regionen profitiert die Blaue Federlibelle kurzfristig von wärmeren Sommern, da sich ihr Aktivitätszeitraum verlängert. Langfristig jedoch hängt ihre Zukunft stark von der Qualität und Stabilität der Gewässer ab. Naturnahe Ufer, strukturreiche Bachläufe und eine vielfältige Wasserpflanzenwelt sind entscheidend, um der Art auch unter veränderten klimatischen Bedingungen Lebensraum zu bieten.
Die Blaue Federlibelle steht damit exemplarisch für viele an Gewässer gebundene Insektenarten. Ihr Vorkommen zeigt an, wo Wasserlebensräume noch funktionstüchtig sind – und wo Schutzmaßnahmen notwendig werden, um diese stillen Zeugen intakter Natur zu erhalten.
In der Aufnahme von Dieter Zinßer
Die Blaue Federlibelle (Platycnemis pennipes) gehört zur Familie der Federlibellen (Platycnemididae) und zählt zu den auffälligeren Kleinlibellen Mitteleuropas. Ihren Namen verdankt sie den verbreiterten, federartig wirkenden Schienen an den Beinen, die bei den Männchen besonders deutlich ausgeprägt sind. Diese Strukturen spielen eine Rolle bei der Balz und dienen zugleich als visuelles Erkennungsmerkmal.
Männliche Tiere zeigen meist eine zartblaue bis weißlich-blaue Färbung, während Weibchen überwiegend grünlich oder bräunlich gefärbt sind. Mit einer Körperlänge von etwa 35 bis 45 Millimetern wirkt die Art schlank und elegant. Die Flügel sind durchsichtig und werden in Ruhestellung leicht schräg vom Körper abgespreizt – ein typisches Merkmal dieser Art.
Die Blaue Federlibelle besiedelt bevorzugt langsam fließende oder stehende Gewässer wie Bäche, Gräben, Altarme und Kanäle mit reicher Ufervegetation. Entscheidend sind sonnige Bereiche mit Pflanzen, die als Sitzwarten, Paarungsplätze und Eiablageorte dienen. Die Larven leben im Gewässergrund, wo sie sich über mehrere Monate entwickeln, bevor sie sich zur erwachsenen Libelle häuten.
Als räuberische Art ernährt sich die Blaue Federlibelle von kleinen Insekten, die sie im Flug erbeutet. Damit ist sie ein wichtiger Bestandteil des ökologischen Gleichgewichts an Gewässern und trägt zur Regulation von Insektenpopulationen bei.
Lebensraumveränderung und Klimawandel – eine Perspektive für die Art
Die Blaue Federlibelle reagiert sensibel auf Veränderungen ihres Lebensraumes. Der Ausbau und die Begradigung von Fließgewässern, das Entfernen von Ufervegetation sowie die Verschmutzung durch Nährstoffe und Schadstoffe führen zu einem Verlust geeigneter Habitate. Wo Ufer befestigt und Gewässer technisch überformt werden, fehlen Rückzugsräume für Larven und Sitzplätze für adulte Tiere.
Der Klimawandel wirkt dabei als zusätzlicher Einflussfaktor. Steigende Temperaturen können einerseits die Entwicklungszeit der Larven verkürzen und zu früherem Auftreten der erwachsenen Libellen führen. Andererseits erhöhen längere Trockenperioden das Risiko des Austrocknens kleiner Gewässer, was besonders für die Larven eine existenzielle Bedrohung darstellt. Starkregenereignisse können wiederum Sedimente eintragen und die Gewässerstruktur verändern.
In einigen Regionen profitiert die Blaue Federlibelle kurzfristig von wärmeren Sommern, da sich ihr Aktivitätszeitraum verlängert. Langfristig jedoch hängt ihre Zukunft stark von der Qualität und Stabilität der Gewässer ab. Naturnahe Ufer, strukturreiche Bachläufe und eine vielfältige Wasserpflanzenwelt sind entscheidend, um der Art auch unter veränderten klimatischen Bedingungen Lebensraum zu bieten.
Die Blaue Federlibelle steht damit exemplarisch für viele an Gewässer gebundene Insektenarten. Ihr Vorkommen zeigt an, wo Wasserlebensräume noch funktionstüchtig sind – und wo Schutzmaßnahmen notwendig werden, um diese stillen Zeugen intakter Natur zu erhalten.
In der Aufnahme von Dieter Zinßer
- Blaue Federlibelle - Weibchen - von vorne - auf Kamille
Artenschutz in Franken®
Eine kleine Geschichte am Rand des Gartens

Eine kleine Geschichte am Rand des Gartens
03/04.02.2026
Ein winziges Wesen sitzt reglos auf einem Blatt, als würde es die Sonne genießen. Plötzlich ein kurzer Sprung – und es ist verschwunden, nur um wenige Zentimeter weiter erneut zu erscheinen. Für die meisten Menschen bleibt dieser flüchtige Moment unbemerkt. Doch genau hier beginnt das Leben der Rhododendronzikade, unauffällig und doch eng verwoben mit den Veränderungen unserer Umwelt.
03/04.02.2026
- Es ist ein warmer Frühsommertag. Zwischen den glänzenden, dunkelgrünen Blättern eines Rhododendrons bewegt sich etwas Farbenfrohes, fast Unwirkliches.
Ein winziges Wesen sitzt reglos auf einem Blatt, als würde es die Sonne genießen. Plötzlich ein kurzer Sprung – und es ist verschwunden, nur um wenige Zentimeter weiter erneut zu erscheinen. Für die meisten Menschen bleibt dieser flüchtige Moment unbemerkt. Doch genau hier beginnt das Leben der Rhododendronzikade, unauffällig und doch eng verwoben mit den Veränderungen unserer Umwelt.
Artbeschreibung: Die Rhododendronzikade (Graphocephala fennahi)
Die Rhododendronzikade (Graphocephala fennahi) gehört zur Familie der Blatthüpfer (Cicadellidae) und fällt durch ihr auffälliges Erscheinungsbild sofort ins Auge. Mit ihrer leuchtend grünen Grundfarbe, den roten Streifen und bläulichen Akzenten wirkt sie fast exotisch. Erwachsene Tiere erreichen eine Länge von etwa acht bis neun Millimetern und sind damit zwar klein, aber kaum zu übersehen.
Ursprünglich stammt die Art aus Nordamerika. In Europa wurde sie erstmals im 20. Jahrhundert nachgewiesen und hat sich seitdem in vielen Regionen etabliert. Besonders häufig ist sie dort zu finden, wo Rhododendren wachsen – sowohl in Gärten als auch in Parks und botanischen Anlagen. Die Zikade ist stark an diese Pflanzengattung gebunden, da sie ihre Eier bevorzugt in die Knospen des Rhododendrons ablegt.
Die erwachsenen Tiere ernähren sich vom Pflanzensaft, indem sie mit ihrem stechend-saugenden Mundwerkzeug die Blattadern anzapfen. Dieser Saugvorgang verursacht meist nur geringe direkte Schäden. Bedeutung erlangt die Rhododendronzikade vor allem durch ihre Rolle bei der Übertragung von Pilzsporen, die das Absterben von Knospen begünstigen können.
Ihr Lebenszyklus ist klar strukturiert: Die Eiablage erfolgt im Spätsommer, die Eier überwintern in den Knospen, und im Frühjahr schlüpfen die Larven. Nach mehreren Entwicklungsstadien erscheinen ab Frühsommer die adulten Tiere, die bis in den Herbst hinein aktiv sind.
Lebensraumveränderung und Klimawandel – eine neue Perspektive
Die Ausbreitung der Rhododendronzikade steht exemplarisch für die Auswirkungen menschlicher Eingriffe in Ökosysteme. Die zunehmende Nutzung von Zierpflanzen aus anderen Kontinenten hat neue Lebensräume geschaffen, in denen sich spezialisierte Arten erfolgreich etablieren können. Rhododendren sind heute in vielen Regionen weit verbreitet – und mit ihnen auch die Rhododendronzikade.
Der Klimawandel verstärkt diese Entwicklung zusätzlich. Mildere Winter erhöhen die Überlebensrate der überwinternden Eier, während längere Vegetationsperioden den Entwicklungszyklus begünstigen. In wärmeren Jahren kann es zu höheren Populationsdichten kommen, da günstige Bedingungen über einen längeren Zeitraum bestehen bleiben.
Gleichzeitig verändern sich ökologische Gleichgewichte. Natürliche Gegenspieler sind oft nur eingeschränkt vorhanden oder reagieren langsamer auf neue Arten. Dadurch kann die Rhododendronzikade lokal stärker in Erscheinung treten als in ihrem ursprünglichen Verbreitungsgebiet.
Langfristig zeigt die Art, wie flexibel und anpassungsfähig viele Insekten auf Umweltveränderungen reagieren. Sie ist kein isoliertes Phänomen, sondern Teil eines größeren Bildes: der Verschiebung von Artengrenzen, ausgelöst durch Klimawandel, globale Pflanzenverwendung und veränderte Landschaftsstrukturen. Die Rhododendronzikade wird damit zu einem stillen Zeugen ökologischer Veränderungen, die weit über den Gartenzaun hinausreichen.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
Die Rhododendronzikade (Graphocephala fennahi) gehört zur Familie der Blatthüpfer (Cicadellidae) und fällt durch ihr auffälliges Erscheinungsbild sofort ins Auge. Mit ihrer leuchtend grünen Grundfarbe, den roten Streifen und bläulichen Akzenten wirkt sie fast exotisch. Erwachsene Tiere erreichen eine Länge von etwa acht bis neun Millimetern und sind damit zwar klein, aber kaum zu übersehen.
Ursprünglich stammt die Art aus Nordamerika. In Europa wurde sie erstmals im 20. Jahrhundert nachgewiesen und hat sich seitdem in vielen Regionen etabliert. Besonders häufig ist sie dort zu finden, wo Rhododendren wachsen – sowohl in Gärten als auch in Parks und botanischen Anlagen. Die Zikade ist stark an diese Pflanzengattung gebunden, da sie ihre Eier bevorzugt in die Knospen des Rhododendrons ablegt.
Die erwachsenen Tiere ernähren sich vom Pflanzensaft, indem sie mit ihrem stechend-saugenden Mundwerkzeug die Blattadern anzapfen. Dieser Saugvorgang verursacht meist nur geringe direkte Schäden. Bedeutung erlangt die Rhododendronzikade vor allem durch ihre Rolle bei der Übertragung von Pilzsporen, die das Absterben von Knospen begünstigen können.
Ihr Lebenszyklus ist klar strukturiert: Die Eiablage erfolgt im Spätsommer, die Eier überwintern in den Knospen, und im Frühjahr schlüpfen die Larven. Nach mehreren Entwicklungsstadien erscheinen ab Frühsommer die adulten Tiere, die bis in den Herbst hinein aktiv sind.
Lebensraumveränderung und Klimawandel – eine neue Perspektive
Die Ausbreitung der Rhododendronzikade steht exemplarisch für die Auswirkungen menschlicher Eingriffe in Ökosysteme. Die zunehmende Nutzung von Zierpflanzen aus anderen Kontinenten hat neue Lebensräume geschaffen, in denen sich spezialisierte Arten erfolgreich etablieren können. Rhododendren sind heute in vielen Regionen weit verbreitet – und mit ihnen auch die Rhododendronzikade.
Der Klimawandel verstärkt diese Entwicklung zusätzlich. Mildere Winter erhöhen die Überlebensrate der überwinternden Eier, während längere Vegetationsperioden den Entwicklungszyklus begünstigen. In wärmeren Jahren kann es zu höheren Populationsdichten kommen, da günstige Bedingungen über einen längeren Zeitraum bestehen bleiben.
Gleichzeitig verändern sich ökologische Gleichgewichte. Natürliche Gegenspieler sind oft nur eingeschränkt vorhanden oder reagieren langsamer auf neue Arten. Dadurch kann die Rhododendronzikade lokal stärker in Erscheinung treten als in ihrem ursprünglichen Verbreitungsgebiet.
Langfristig zeigt die Art, wie flexibel und anpassungsfähig viele Insekten auf Umweltveränderungen reagieren. Sie ist kein isoliertes Phänomen, sondern Teil eines größeren Bildes: der Verschiebung von Artengrenzen, ausgelöst durch Klimawandel, globale Pflanzenverwendung und veränderte Landschaftsstrukturen. Die Rhododendronzikade wird damit zu einem stillen Zeugen ökologischer Veränderungen, die weit über den Gartenzaun hinausreichen.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
- Typisches Erscheinungsbild einer ausgewachsenen Rhododendronzikade
Artenschutz in Franken®
Wenn der Winter alles fordert

Wenn der Winter alles fordert
03/04.02.2026
Mit der aktuellen, sehr winterlichen Witterung beginnt für sie ein täglicher Kampf – nicht gegen Feinde, sondern gegen Hunger, Kälte und Erschöpfung.
03/04.02.2026
- Der Winter hat die Landschaft fest im Griff. Schnee liegt schwer auf Feldern und Wäldern, Kälte kriecht in jede Mulde, und selbst am Tag bleibt die Sonne oft blass. Was für uns Menschen eine stille, fast magische Zeit sein kann, ist für viele Wildtiere eine der härtesten Prüfungen ihres Lebens.
Mit der aktuellen, sehr winterlichen Witterung beginnt für sie ein täglicher Kampf – nicht gegen Feinde, sondern gegen Hunger, Kälte und Erschöpfung.
Wo im Sommer und Herbst noch Nahrung im Überfluss vorhanden war, ist jetzt alles verborgen. Gräser, Kräuter und junge Triebe liegen unter einer dicken Schneeschicht. Samen sind unerreichbar, Knospen gefroren. Jeder Schritt durch den Schnee kostet Kraft, jede Bewegung verbraucht wertvolle Energie, die kaum ersetzt werden kann.
Besonders deutlich zeigt sich das Schicksal des Rehwildes. Leise zieht es durch die weiße Landschaft, den Kopf gesenkt, die Ohren aufmerksam. Mit den Läufen scharrt es den Schnee beiseite, immer wieder, immer weiter, auf der Suche nach etwas Essbarem. Oft bleibt nur wenig zurück: ein paar Halme, Rinde, trockene Blätter. Nahrung, die kaum ausreicht, um die eisigen Nächte zu überstehen.
Der Schnee ist tief, die Kälte unerbittlich. Flucht kostet Kraft – Kraft, die im Winter über Leben und Tod entscheidet. Jede Störung, jeder aufgescheuchte Sprint durch den Schnee zehrt an den Reserven. Was für uns nur ein kurzer Moment ist, kann für ein Wildtier den Unterschied zwischen Durchhalten und Zusammenbrechen bedeuten.
Auch kleinere Tiere kämpfen. Feldhasen verharren reglos in ihren Sassen, Mäuse graben verzweifelt Gänge unter der Schneedecke, Vögel suchen in kahlen Sträuchern nach den letzten Samen. Viele von ihnen erreichen den Frühling nur, wenn sie jetzt genug Ruhe finden.
Doch unsere Landschaften machen es ihnen immer schwerer. Hecken, Brachen und strukturreiche Randbereiche fehlen vielerorts. Offene, intensiv genutzte Flächen bieten weder Schutz noch Nahrung. Der Winter trifft Wildtiere heute oft härter als früher – nicht nur wegen der Kälte, sondern weil es immer weniger Orte gibt, an denen sie ihm ausweichen können.
Gerade jetzt zeigt sich, wie wichtig Rücksicht ist. Wer draußen unterwegs ist, sollte sich bewusst machen: Jede Störung zwingt Tiere zur Flucht. Jeder unnötige Energieverlust kann später fehlen. Auf den Wegen bleiben, Hunde anleinen, Rückzugsräume respektieren – kleine Gesten mit großer Wirkung.
Der Winter gehört zur Natur. Wildtiere sind an ihn angepasst. Doch wie gut sie ihn überstehen, hängt auch von uns ab. Wenn wir ihnen Raum lassen, Ruhe gewähren und ihre Lebensräume schützen, geben wir ihnen die Chance, diese schwere Zeit zu überleben.
Damit sie, wenn der Schnee schmilzt und das erste Grün erscheint, noch da sind.
Still, vorsichtig – aber lebendig.
In der Aufnahme von A. Brehm
Besonders deutlich zeigt sich das Schicksal des Rehwildes. Leise zieht es durch die weiße Landschaft, den Kopf gesenkt, die Ohren aufmerksam. Mit den Läufen scharrt es den Schnee beiseite, immer wieder, immer weiter, auf der Suche nach etwas Essbarem. Oft bleibt nur wenig zurück: ein paar Halme, Rinde, trockene Blätter. Nahrung, die kaum ausreicht, um die eisigen Nächte zu überstehen.
Der Schnee ist tief, die Kälte unerbittlich. Flucht kostet Kraft – Kraft, die im Winter über Leben und Tod entscheidet. Jede Störung, jeder aufgescheuchte Sprint durch den Schnee zehrt an den Reserven. Was für uns nur ein kurzer Moment ist, kann für ein Wildtier den Unterschied zwischen Durchhalten und Zusammenbrechen bedeuten.
Auch kleinere Tiere kämpfen. Feldhasen verharren reglos in ihren Sassen, Mäuse graben verzweifelt Gänge unter der Schneedecke, Vögel suchen in kahlen Sträuchern nach den letzten Samen. Viele von ihnen erreichen den Frühling nur, wenn sie jetzt genug Ruhe finden.
Doch unsere Landschaften machen es ihnen immer schwerer. Hecken, Brachen und strukturreiche Randbereiche fehlen vielerorts. Offene, intensiv genutzte Flächen bieten weder Schutz noch Nahrung. Der Winter trifft Wildtiere heute oft härter als früher – nicht nur wegen der Kälte, sondern weil es immer weniger Orte gibt, an denen sie ihm ausweichen können.
Gerade jetzt zeigt sich, wie wichtig Rücksicht ist. Wer draußen unterwegs ist, sollte sich bewusst machen: Jede Störung zwingt Tiere zur Flucht. Jeder unnötige Energieverlust kann später fehlen. Auf den Wegen bleiben, Hunde anleinen, Rückzugsräume respektieren – kleine Gesten mit großer Wirkung.
Der Winter gehört zur Natur. Wildtiere sind an ihn angepasst. Doch wie gut sie ihn überstehen, hängt auch von uns ab. Wenn wir ihnen Raum lassen, Ruhe gewähren und ihre Lebensräume schützen, geben wir ihnen die Chance, diese schwere Zeit zu überleben.
Damit sie, wenn der Schnee schmilzt und das erste Grün erscheint, noch da sind.
Still, vorsichtig – aber lebendig.
In der Aufnahme von A. Brehm
- Tief muss sich das Rehwild durch den hohen Schnee bis zu einigen Gräsern graben, die eine gewisse Perspektive geben, überleben zu können
Artenschutz in Franken®
Wenn das Blau fliegen lernt

Wenn das Blau fliegen lernt
02/03.02.2026
Es ist früher Morgen, als der Bach noch leise spricht. Das Wasser gluckst zwischen Kieseln, feiner Nebel liegt über dem Ufer, und die Welt scheint den Atem anzuhalten. Genau hier, an einem unscheinbaren Halm im flachen Wasser, beginnt ein kleines Wunder.
02/03.02.2026
- Die Geschichte einer Blauen Federlibelle am Bach
Es ist früher Morgen, als der Bach noch leise spricht. Das Wasser gluckst zwischen Kieseln, feiner Nebel liegt über dem Ufer, und die Welt scheint den Atem anzuhalten. Genau hier, an einem unscheinbaren Halm im flachen Wasser, beginnt ein kleines Wunder.
Seit vielen Monaten lebt die Larve der Blauen Federlibelle (Platycnemis pennipes) verborgen unter der Oberfläche. Zwischen Wasserpflanzen und Steinen hat sie gejagt, ist gewachsen und hat den Winter überstanden. Nun ist die Zeit gekommen. Langsam klettert sie aus dem Wasser, hinauf ins Licht. Ihre Larvenhaut platzt auf, und aus dem engen Panzer schiebt sich ein neues Wesen – zerbrechlich, blass und doch voller Leben.
Der Schlupf ist ein Moment größter Anstrengung. Nichts darf schiefgehen. Die junge Libelle hängt kopfüber, zieht Bein um Bein aus der alten Hülle, während ihre Flügel sich entfalten wie feines Glas. Noch kann sie nicht fliegen. Noch ist sie schutzlos.
Und Gefahren gibt es viele.
Ein falscher Schritt, und sie fällt ins Wasser zurück – wo Fische auf leichte Beute warten. Am Ufer krabbeln Ameisen, die keinen Unterschied machen zwischen Wunder und Mahlzeit. Ein Vogel entdeckt die Bewegung im Schilf. Selbst der Mensch kann zur Bedrohung werden, wenn Ufer gemäht, Pflanzen entfernt oder Steine bewegt werden, genau dort, wo Libellen ihren Neubeginn wagen.
Die Sonne steigt höher. Wärme durchströmt den kleinen Körper. Die Flügel härten aus, das zarte Blau gewinnt an Farbe. Stunde um Stunde vergeht, bis der große Augenblick kommt: Ein erstes Zittern, ein Sprung – und dann trägt die Luft die Blaue Federlibelle davon.
Nun beginnt ihr kurzes, freies Leben über dem Wasser. Sie jagt kleine Insekten, ruht auf Gräsern und tanzt in der Luft mit Artgenossen. Ihre breiten, hell gefärbten Beine machen sie unverwechselbar. Doch auch jetzt ist ihr Leben kein leichtes. Regen, Wind, Hunger und neue Feinde begleiten jeden Tag.
Vor allem aber braucht sie eines: einen intakten Lebensraum.
Saubere, langsam fließende Gewässer, naturnahe Ufer, Pflanzenvielfalt und Ruhe sind die Grundlage für ihr Dasein. Doch genau diese Orte werden seltener. Bäche werden begradigt, Uferstreifen zu oft gemäht, Feuchtgebiete entwässert. Freizeitnutzung bringt Unruhe an Gewässer, die eigentlich Rückzugsräume sein sollten.
Der Klimawandel verschärft die Lage zusätzlich. Längere Trockenperioden lassen Gewässer austrocknen, bevor Larven sich entwickeln können. Plötzliche Hochwasser spülen sie fort. Steigende Temperaturen verändern das empfindliche Gleichgewicht von Wasser, Pflanzen und Insekten.
Die Blaue Federlibelle ist damit mehr als nur ein schönes Insekt. Sie ist ein Zeichen. Wo sie lebt, ist das Wasser meist sauber, das Ufer lebendig. Wo sie verschwindet, stimmt etwas nicht.
Vielleicht sieht ein Kind sie eines Tages am Bach sitzen, staunt über ihr leuchtendes Blau und fragt, woher sie kommt. Die Antwort liegt im Schutz unserer Landschaften. Jede naturnahe Uferzone, jeder ungemähte Randstreifen und jeder renaturierte Bach schenkt ihr eine Chance.
Damit auch morgen noch irgendwo am frühen Morgen eine kleine Libelle aus ihrer Hülle schlüpft – und das Blau wieder fliegen lernt.
In der Aufnahme von Dieter Zinßer
Der Schlupf ist ein Moment größter Anstrengung. Nichts darf schiefgehen. Die junge Libelle hängt kopfüber, zieht Bein um Bein aus der alten Hülle, während ihre Flügel sich entfalten wie feines Glas. Noch kann sie nicht fliegen. Noch ist sie schutzlos.
Und Gefahren gibt es viele.
Ein falscher Schritt, und sie fällt ins Wasser zurück – wo Fische auf leichte Beute warten. Am Ufer krabbeln Ameisen, die keinen Unterschied machen zwischen Wunder und Mahlzeit. Ein Vogel entdeckt die Bewegung im Schilf. Selbst der Mensch kann zur Bedrohung werden, wenn Ufer gemäht, Pflanzen entfernt oder Steine bewegt werden, genau dort, wo Libellen ihren Neubeginn wagen.
Die Sonne steigt höher. Wärme durchströmt den kleinen Körper. Die Flügel härten aus, das zarte Blau gewinnt an Farbe. Stunde um Stunde vergeht, bis der große Augenblick kommt: Ein erstes Zittern, ein Sprung – und dann trägt die Luft die Blaue Federlibelle davon.
Nun beginnt ihr kurzes, freies Leben über dem Wasser. Sie jagt kleine Insekten, ruht auf Gräsern und tanzt in der Luft mit Artgenossen. Ihre breiten, hell gefärbten Beine machen sie unverwechselbar. Doch auch jetzt ist ihr Leben kein leichtes. Regen, Wind, Hunger und neue Feinde begleiten jeden Tag.
Vor allem aber braucht sie eines: einen intakten Lebensraum.
Saubere, langsam fließende Gewässer, naturnahe Ufer, Pflanzenvielfalt und Ruhe sind die Grundlage für ihr Dasein. Doch genau diese Orte werden seltener. Bäche werden begradigt, Uferstreifen zu oft gemäht, Feuchtgebiete entwässert. Freizeitnutzung bringt Unruhe an Gewässer, die eigentlich Rückzugsräume sein sollten.
Der Klimawandel verschärft die Lage zusätzlich. Längere Trockenperioden lassen Gewässer austrocknen, bevor Larven sich entwickeln können. Plötzliche Hochwasser spülen sie fort. Steigende Temperaturen verändern das empfindliche Gleichgewicht von Wasser, Pflanzen und Insekten.
Die Blaue Federlibelle ist damit mehr als nur ein schönes Insekt. Sie ist ein Zeichen. Wo sie lebt, ist das Wasser meist sauber, das Ufer lebendig. Wo sie verschwindet, stimmt etwas nicht.
Vielleicht sieht ein Kind sie eines Tages am Bach sitzen, staunt über ihr leuchtendes Blau und fragt, woher sie kommt. Die Antwort liegt im Schutz unserer Landschaften. Jede naturnahe Uferzone, jeder ungemähte Randstreifen und jeder renaturierte Bach schenkt ihr eine Chance.
Damit auch morgen noch irgendwo am frühen Morgen eine kleine Libelle aus ihrer Hülle schlüpft – und das Blau wieder fliegen lernt.
In der Aufnahme von Dieter Zinßer
- Federlibelle - schlüpfende Federlibelle - an grünem Halm
Artenschutz in Franken®
Rotwangen-Schmuckschildkröte (Trachemys scripta elegans)

Die Rotwangen-Schmuckschildkröte (Trachemys scripta elegans)
02/03.02.2026
Regungslos liegt die Schildkröte auf einem alten Baumstamm und genießt die Wärme. Was auf den ersten Blick wie ein heimisches Tier wirkt, stammt ursprünglich aus einem anderen Teil der Welt. Die Rotwangen-Schmuckschildkröte hat ihren Weg in viele europäische Gewässer gefunden – meist nicht aus eigener Kraft, sondern durch menschliches Zutun.
02/03.02.2026
- An einem sonnigen Nachmittag ragt ein dunkler Panzer aus dem Schilfgürtel eines ruhigen Teiches.
Regungslos liegt die Schildkröte auf einem alten Baumstamm und genießt die Wärme. Was auf den ersten Blick wie ein heimisches Tier wirkt, stammt ursprünglich aus einem anderen Teil der Welt. Die Rotwangen-Schmuckschildkröte hat ihren Weg in viele europäische Gewässer gefunden – meist nicht aus eigener Kraft, sondern durch menschliches Zutun.
Artbeschreibung
Die Rotwangen-Schmuckschildkröte (Trachemys scripta elegans) gehört zur Familie der Neuwelt-Sumpfschildkröten. Ihr auffälligstes Merkmal sind die roten, halbmondförmigen Streifen hinter den Augen, denen sie ihren Namen verdankt. Der Panzer ist meist olivgrün bis dunkelbraun gefärbt und zeigt gelbliche Musterungen. Erwachsene Tiere erreichen Panzerlängen von bis zu 30 Zentimetern, wobei Weibchen in der Regel größer werden als Männchen.
Die Art ist überwiegend tagaktiv und verbringt viel Zeit mit Sonnenbaden. Sie ist anpassungsfähig, ernährt sich sowohl von pflanzlicher als auch tierischer Nahrung und besiedelt stehende oder langsam fließende Gewässer mit reicher Ufervegetation. Ursprünglich stammt die Rotwangen-Schmuckschildkröte aus dem Südosten der USA.
Perspektiven im Wandel von Lebensraum, Klima und Artenvielfalt
Durch den jahrzehntelangen Handel als Haustier gelangte die Rotwangen-Schmuckschildkröte in großer Zahl nach Europa. Viele Tiere wurden ausgesetzt, als sie für private Halter zu groß oder pflegeintensiv wurden. Inzwischen gilt die Art als etablierter Neozoon in zahlreichen Regionen.
Lebensraumveränderungen wie die Schaffung künstlicher Gewässer, renaturierte Kiesgruben oder urbane Teiche bieten der Art geeignete Bedingungen. Der Klimawandel verstärkt diese Entwicklung zusätzlich: Mildere Winter und längere warme Perioden erhöhen die Überlebens- und Fortpflanzungschancen. In einigen Gebieten gelingt mittlerweile sogar die erfolgreiche Reproduktion.
Als Neozoon stellt die Rotwangen-Schmuckschildkröte eine Herausforderung für die heimische Artenvielfalt dar. Sie konkurriert mit einheimischen Arten, insbesondere mit der Europäischen Sumpfschildkröte (Emys orbicularis), um Sonnenplätze, Nahrung und geeignete Lebensräume. Zudem kann sie lokale Nahrungsnetze verändern und Druck auf Amphibien, Fische und wirbellose Tiere ausüben.
Langfristig erfordert der Umgang mit der Rotwangen-Schmuckschildkröte ein gezieltes Management. Aufklärung, verantwortungsvolle Tierhaltung und der Schutz heimischer Arten sind zentrale Bausteine, um negative Auswirkungen auf die Biodiversität zu begrenzen und gleichzeitig einen sachlichen Umgang mit bereits etablierten Populationen zu fördern.
In der Aufnahme von Albert Meier
Die Rotwangen-Schmuckschildkröte (Trachemys scripta elegans) gehört zur Familie der Neuwelt-Sumpfschildkröten. Ihr auffälligstes Merkmal sind die roten, halbmondförmigen Streifen hinter den Augen, denen sie ihren Namen verdankt. Der Panzer ist meist olivgrün bis dunkelbraun gefärbt und zeigt gelbliche Musterungen. Erwachsene Tiere erreichen Panzerlängen von bis zu 30 Zentimetern, wobei Weibchen in der Regel größer werden als Männchen.
Die Art ist überwiegend tagaktiv und verbringt viel Zeit mit Sonnenbaden. Sie ist anpassungsfähig, ernährt sich sowohl von pflanzlicher als auch tierischer Nahrung und besiedelt stehende oder langsam fließende Gewässer mit reicher Ufervegetation. Ursprünglich stammt die Rotwangen-Schmuckschildkröte aus dem Südosten der USA.
Perspektiven im Wandel von Lebensraum, Klima und Artenvielfalt
Durch den jahrzehntelangen Handel als Haustier gelangte die Rotwangen-Schmuckschildkröte in großer Zahl nach Europa. Viele Tiere wurden ausgesetzt, als sie für private Halter zu groß oder pflegeintensiv wurden. Inzwischen gilt die Art als etablierter Neozoon in zahlreichen Regionen.
Lebensraumveränderungen wie die Schaffung künstlicher Gewässer, renaturierte Kiesgruben oder urbane Teiche bieten der Art geeignete Bedingungen. Der Klimawandel verstärkt diese Entwicklung zusätzlich: Mildere Winter und längere warme Perioden erhöhen die Überlebens- und Fortpflanzungschancen. In einigen Gebieten gelingt mittlerweile sogar die erfolgreiche Reproduktion.
Als Neozoon stellt die Rotwangen-Schmuckschildkröte eine Herausforderung für die heimische Artenvielfalt dar. Sie konkurriert mit einheimischen Arten, insbesondere mit der Europäischen Sumpfschildkröte (Emys orbicularis), um Sonnenplätze, Nahrung und geeignete Lebensräume. Zudem kann sie lokale Nahrungsnetze verändern und Druck auf Amphibien, Fische und wirbellose Tiere ausüben.
Langfristig erfordert der Umgang mit der Rotwangen-Schmuckschildkröte ein gezieltes Management. Aufklärung, verantwortungsvolle Tierhaltung und der Schutz heimischer Arten sind zentrale Bausteine, um negative Auswirkungen auf die Biodiversität zu begrenzen und gleichzeitig einen sachlichen Umgang mit bereits etablierten Populationen zu fördern.
In der Aufnahme von Albert Meier
- Rotwangen-Schmuckschildkröte beim Sonnenbaden auf einem Baumstamm
Artenschutz in Franken®
Feuerlibelle (Crocothemis erythraea)

Die Feuerlibelle (Crocothemis erythraea)
02/03.02.2026
Das Wasser unter ihr liegt ruhig, nur gelegentlich ziehen kleine Wellen über die Oberfläche. Plötzlich startet sie, fliegt ein kurzes Reviermanöver und kehrt an denselben Platz zurück. Die Feuerlibelle ist angekommen – auffällig, selbstbewusst und unübersehbar in der sommerlichen Landschaft.
02/03.02.2026
- In der flimmernden Hitze eines Sommertages sitzt eine leuchtend rote Libelle auf einem sonnenwarmen Schilfhalm.
Das Wasser unter ihr liegt ruhig, nur gelegentlich ziehen kleine Wellen über die Oberfläche. Plötzlich startet sie, fliegt ein kurzes Reviermanöver und kehrt an denselben Platz zurück. Die Feuerlibelle ist angekommen – auffällig, selbstbewusst und unübersehbar in der sommerlichen Landschaft.
Artbeschreibung
Die Feuerlibelle (Crocothemis erythraea) gehört zur Familie der Segellibellen (Libellulidae) und zählt zu den auffälligsten Libellenarten Europas. Ausgewachsene Männchen sind intensiv rot gefärbt, einschließlich Augen und Hinterleib. Weibchen und junge Tiere zeigen eine eher gelblich-braune bis olivfarbene Färbung. Die Flügel sind klar, der Körper kräftig gebaut und auf kurze, schnelle Flüge spezialisiert.
Die Art besiedelt bevorzugt stehende oder langsam fließende Gewässer mit offenen, sonnigen Uferbereichen. Typische Lebensräume sind Teiche, Seen, Kiesgruben, Altarme und künstlich angelegte Gewässer. Die Feuerlibelle ist ein ausgeprägter Ansitzjäger und nutzt exponierte Sitzwarten, von denen aus sie Insekten im Flug erbeutet.
Perspektiven im Wandel von Lebensraum und Klima
In den letzten Jahrzehnten hat sich das Verbreitungsgebiet der Feuerlibelle deutlich nach Norden ausgeweitet. Ursprünglich war sie vor allem im Mittelmeerraum verbreitet, doch steigende Temperaturen begünstigen ihre Ausbreitung in Mitteleuropa. Der Klimawandel wirkt sich für diese wärmeliebende Art bislang überwiegend positiv aus, da längere Vegetationsperioden und höhere Wassertemperaturen die Entwicklung der Larven beschleunigen.
Gleichzeitig beeinflussen Lebensraumveränderungen die Zukunft der Feuerlibelle. Der Verlust naturnaher Gewässer, Uferverbauungen und eine zunehmende Beschattung durch fehlende Pflege können geeignete Lebensräume einschränken. Andererseits bieten neu entstandene Gewässer, etwa durch Renaturierungsmaßnahmen oder Abgrabungen, neue Besiedlungsmöglichkeiten.
Langfristig hängt die Entwicklung der Feuerlibelle von einem ausgewogenen Zusammenspiel aus Klimafaktoren und Lebensraumqualität ab. Der Erhalt offener, strukturreicher Gewässer mit flachen Uferzonen ist entscheidend, damit diese markante Libellenart auch künftig ein fester Bestandteil der heimischen Insektenfauna bleibt.
In der Aufnahme von Dieter Zinßer
Die Feuerlibelle (Crocothemis erythraea) gehört zur Familie der Segellibellen (Libellulidae) und zählt zu den auffälligsten Libellenarten Europas. Ausgewachsene Männchen sind intensiv rot gefärbt, einschließlich Augen und Hinterleib. Weibchen und junge Tiere zeigen eine eher gelblich-braune bis olivfarbene Färbung. Die Flügel sind klar, der Körper kräftig gebaut und auf kurze, schnelle Flüge spezialisiert.
Die Art besiedelt bevorzugt stehende oder langsam fließende Gewässer mit offenen, sonnigen Uferbereichen. Typische Lebensräume sind Teiche, Seen, Kiesgruben, Altarme und künstlich angelegte Gewässer. Die Feuerlibelle ist ein ausgeprägter Ansitzjäger und nutzt exponierte Sitzwarten, von denen aus sie Insekten im Flug erbeutet.
Perspektiven im Wandel von Lebensraum und Klima
In den letzten Jahrzehnten hat sich das Verbreitungsgebiet der Feuerlibelle deutlich nach Norden ausgeweitet. Ursprünglich war sie vor allem im Mittelmeerraum verbreitet, doch steigende Temperaturen begünstigen ihre Ausbreitung in Mitteleuropa. Der Klimawandel wirkt sich für diese wärmeliebende Art bislang überwiegend positiv aus, da längere Vegetationsperioden und höhere Wassertemperaturen die Entwicklung der Larven beschleunigen.
Gleichzeitig beeinflussen Lebensraumveränderungen die Zukunft der Feuerlibelle. Der Verlust naturnaher Gewässer, Uferverbauungen und eine zunehmende Beschattung durch fehlende Pflege können geeignete Lebensräume einschränken. Andererseits bieten neu entstandene Gewässer, etwa durch Renaturierungsmaßnahmen oder Abgrabungen, neue Besiedlungsmöglichkeiten.
Langfristig hängt die Entwicklung der Feuerlibelle von einem ausgewogenen Zusammenspiel aus Klimafaktoren und Lebensraumqualität ab. Der Erhalt offener, strukturreicher Gewässer mit flachen Uferzonen ist entscheidend, damit diese markante Libellenart auch künftig ein fester Bestandteil der heimischen Insektenfauna bleibt.
In der Aufnahme von Dieter Zinßer
- Im Portrait - Männchen der Feuerlibelle
Artenschutz in Franken®
Vierstreifennatter (Elaphe quatuorlineata)

Die Vierstreifennatter (Elaphe quatuorlineata)
01/02.02.2026
Die Sonne hat den Boden bereits erwärmt, und zwischen Steinen und Wurzeln findet sie ideale Verstecke. Für einen Moment verharrt sie reglos, hebt leicht den Kopf und prüft die Umgebung. Es ist die Vierstreifennatter – ein scheuer Bewohner strukturreicher Kulturlandschaften, der seit Jahrhunderten unbemerkt neben dem Menschen lebt.
01/02.02.2026
- An einem warmen Frühlingsmorgen gleitet eine große Schlange lautlos durch das kniehohe Gras am Rand eines alten Olivenhains.
Die Sonne hat den Boden bereits erwärmt, und zwischen Steinen und Wurzeln findet sie ideale Verstecke. Für einen Moment verharrt sie reglos, hebt leicht den Kopf und prüft die Umgebung. Es ist die Vierstreifennatter – ein scheuer Bewohner strukturreicher Kulturlandschaften, der seit Jahrhunderten unbemerkt neben dem Menschen lebt.
Artbeschreibung
Die Vierstreifennatter (Elaphe quatuorlineata) ist die größte in Europa vorkommende Natternart. Ausgewachsene Tiere können Längen von über zwei Metern erreichen. Charakteristisch sind die vier dunklen Längsstreifen, die sich über den hellen, meist gelblich bis olivbraunen Körper ziehen. Jungtiere zeigen dagegen oft ein auffälliges Fleckenmuster, das sich erst mit zunehmendem Alter in die typische Streifenzeichnung verwandelt.
Die Art ist ungiftig und für den Menschen vollkommen ungefährlich. Sie ernährt sich überwiegend von Kleinsäugern, Vögeln und gelegentlich von Reptilien. Als guter Kletterer nutzt sie nicht nur den Boden, sondern auch Büsche, Trockenmauern und Bäume. Die Vierstreifennatter bevorzugt warme, strukturreiche Lebensräume wie lichte Wälder, Buschlandschaften, traditionelle Agrarflächen, Olivenhaine und steinige Hänge.
Perspektiven im Wandel von Lebensraum und Klima
Die Zukunft der Vierstreifennatter ist eng mit der Entwicklung ihrer Lebensräume verknüpft. Intensivierung der Landwirtschaft, der Verlust von Trockenmauern, Flurbereinigung und zunehmende Zersiedelung führen vielerorts zu einer Verarmung der Landschaft. Versteckmöglichkeiten, Jagdgebiete und Eiablageplätze gehen verloren, was lokale Populationen schwächen kann.
Gleichzeitig wirkt sich der Klimawandel ambivalent auf die Art aus. Steigende Temperaturen könnten die Ausbreitung der Vierstreifennatter in höhere Lagen oder nördlichere Gebiete begünstigen. Längere Trockenperioden, häufigere Extremereignisse und der Rückgang geeigneter Beutetiere stellen jedoch neue Herausforderungen dar. Besonders problematisch ist die Kombination aus Lebensraumverlust und klimatischen Veränderungen, die die Anpassungsfähigkeit der Art auf die Probe stellt.
Langfristig wird der Erhalt strukturreicher, naturnaher Landschaften entscheidend sein. Der Schutz traditioneller Kulturlandschaften, der Erhalt von Steinstrukturen sowie eine naturverträgliche Landnutzung können einen wichtigen Beitrag dazu leisten, der Vierstreifennatter auch in Zukunft geeignete Lebensbedingungen zu sichern.
Aufnahme von Helga Zinnecker
Die Vierstreifennatter (Elaphe quatuorlineata) ist die größte in Europa vorkommende Natternart. Ausgewachsene Tiere können Längen von über zwei Metern erreichen. Charakteristisch sind die vier dunklen Längsstreifen, die sich über den hellen, meist gelblich bis olivbraunen Körper ziehen. Jungtiere zeigen dagegen oft ein auffälliges Fleckenmuster, das sich erst mit zunehmendem Alter in die typische Streifenzeichnung verwandelt.
Die Art ist ungiftig und für den Menschen vollkommen ungefährlich. Sie ernährt sich überwiegend von Kleinsäugern, Vögeln und gelegentlich von Reptilien. Als guter Kletterer nutzt sie nicht nur den Boden, sondern auch Büsche, Trockenmauern und Bäume. Die Vierstreifennatter bevorzugt warme, strukturreiche Lebensräume wie lichte Wälder, Buschlandschaften, traditionelle Agrarflächen, Olivenhaine und steinige Hänge.
Perspektiven im Wandel von Lebensraum und Klima
Die Zukunft der Vierstreifennatter ist eng mit der Entwicklung ihrer Lebensräume verknüpft. Intensivierung der Landwirtschaft, der Verlust von Trockenmauern, Flurbereinigung und zunehmende Zersiedelung führen vielerorts zu einer Verarmung der Landschaft. Versteckmöglichkeiten, Jagdgebiete und Eiablageplätze gehen verloren, was lokale Populationen schwächen kann.
Gleichzeitig wirkt sich der Klimawandel ambivalent auf die Art aus. Steigende Temperaturen könnten die Ausbreitung der Vierstreifennatter in höhere Lagen oder nördlichere Gebiete begünstigen. Längere Trockenperioden, häufigere Extremereignisse und der Rückgang geeigneter Beutetiere stellen jedoch neue Herausforderungen dar. Besonders problematisch ist die Kombination aus Lebensraumverlust und klimatischen Veränderungen, die die Anpassungsfähigkeit der Art auf die Probe stellt.
Langfristig wird der Erhalt strukturreicher, naturnaher Landschaften entscheidend sein. Der Schutz traditioneller Kulturlandschaften, der Erhalt von Steinstrukturen sowie eine naturverträgliche Landnutzung können einen wichtigen Beitrag dazu leisten, der Vierstreifennatter auch in Zukunft geeignete Lebensbedingungen zu sichern.
Aufnahme von Helga Zinnecker
- Auch diese Tiere leiden unter menschlicher Lebensraumzerstörung ... hier erkennen wir Kunststoffbestandteile welche das Tier das an einem Gewässer liegt umgeben.
Artenschutz in Franken®
Platterbsen (Lathyrus) – Formen, Farben, Lebensräume

Platterbsen (Lathyrus) - eine Diashow eröffnet Einblicke
01/02.02.2026
Weltweit sind zahlreiche Arten bekannt, die sowohl als Wildpflanzen als auch als Zier- oder Nutzpflanzen vorkommen. Charakteristisch für Platterbsen sind ihre meist kletternden oder rankenden Wuchsformen sowie die typischen schmetterlingsförmigen Blüten.
Die Blüten der Platterbsen erscheinen je nach Art in unterschiedlichen Farben, darunter Weiß, Rosa, Violett, Blau oder Gelb. Sie wachsen häufig in lockeren Trauben und sind nicht nur optisch auffällig, sondern auch eine wichtige Nahrungsquelle für Insekten wie Bienen und Schmetterlinge.
01/02.02.2026
- Platterbsen gehören zur Gattung Lathyrus innerhalb der Familie der Hülsenfrüchtler (Fabaceae).
Weltweit sind zahlreiche Arten bekannt, die sowohl als Wildpflanzen als auch als Zier- oder Nutzpflanzen vorkommen. Charakteristisch für Platterbsen sind ihre meist kletternden oder rankenden Wuchsformen sowie die typischen schmetterlingsförmigen Blüten.
Die Blüten der Platterbsen erscheinen je nach Art in unterschiedlichen Farben, darunter Weiß, Rosa, Violett, Blau oder Gelb. Sie wachsen häufig in lockeren Trauben und sind nicht nur optisch auffällig, sondern auch eine wichtige Nahrungsquelle für Insekten wie Bienen und Schmetterlinge.
Platterbsen sind vor allem in gemäßigten Klimazonen verbreitet.
Man findet sie auf Wiesen, an Waldrändern, Böschungen oder in lichten Gebüschen. Viele Arten bevorzugen sonnige Standorte und durchlässige Böden, kommen aber auch mit nährstoffärmeren Bedingungen gut zurecht.
Einige Lathyrus-Arten werden gezielt im Garten angebaut, etwa wegen ihres dekorativen Erscheinungsbildes oder ihrer Eignung zur Begrünung von Zäunen und Rankhilfen. Andere Arten spielen eine Rolle in naturnahen Lebensräumen und tragen zur biologischen Vielfalt bei.
In der Aufnahme von Dieter Zinßer
Man findet sie auf Wiesen, an Waldrändern, Böschungen oder in lichten Gebüschen. Viele Arten bevorzugen sonnige Standorte und durchlässige Böden, kommen aber auch mit nährstoffärmeren Bedingungen gut zurecht.
Einige Lathyrus-Arten werden gezielt im Garten angebaut, etwa wegen ihres dekorativen Erscheinungsbildes oder ihrer Eignung zur Begrünung von Zäunen und Rankhilfen. Andere Arten spielen eine Rolle in naturnahen Lebensräumen und tragen zur biologischen Vielfalt bei.
- In einer Diashow lassen sich die Platterbsen besonders gut darstellen: von der Vielfalt der Blütenformen über die feinen Ranken bis hin zu ihrem natürlichen Lebensraum. So wird die besondere Schönheit und ökologische Bedeutung dieser Pflanzengattung anschaulich vermittelt.
In der Aufnahme von Dieter Zinßer
- Duftende Platterbse
Artenschutz in Franken®
Frühlings-Platterbse (Lathyrus vernus)

Die Frühlings-Platterbse (Lathyrus vernus)
01/02.02.2026
Zwischen welken Blättern regte sich leises Leben: Zarte Triebe schoben sich entschlossen ans Licht. Noch bevor die Bäume ihr Blätterdach schlossen, öffnete die Frühlings-Platterbse ihre violett-blauen Blüten. Für Insekten, die nach der langen kalten Zeit erste Nahrung suchten, wurde sie zu einem stillen Versprechen – ein Zeichen dafür, dass der Frühling wirklich begonnen hatte.
01/02.02.2026
- Als der Winter sich langsam aus dem lichten Laubwald zurückzog, war der Boden noch kühl und feucht.
Zwischen welken Blättern regte sich leises Leben: Zarte Triebe schoben sich entschlossen ans Licht. Noch bevor die Bäume ihr Blätterdach schlossen, öffnete die Frühlings-Platterbse ihre violett-blauen Blüten. Für Insekten, die nach der langen kalten Zeit erste Nahrung suchten, wurde sie zu einem stillen Versprechen – ein Zeichen dafür, dass der Frühling wirklich begonnen hatte.
Artbeschreibung: Frühlings-Platterbse (Lathyrus vernus)
Die Frühlings-Platterbse (Lathyrus vernus) ist eine ausdauernde, krautige Pflanze aus der Familie der Hülsenfrüchtler (Fabaceae). Sie erreicht meist eine Wuchshöhe von etwa 20 bis 40 Zentimetern und wächst aufrecht, ohne zu klettern – im Gegensatz zu vielen anderen Platterbsenarten.
Charakteristisch sind ihre gefiederten Blätter mit zwei bis drei Paaren eiförmiger Fiederblättchen. Die auffälligen Blüten erscheinen früh im Jahr, meist zwischen März und Mai. Sie zeigen ein interessantes Farbspiel: Zu Beginn oft rötlich-violett, wechseln sie im Laufe der Blütezeit zu Blau- und Grüntönen. Bestäubt wird die Pflanze vor allem von Hummeln und anderen früh aktiven Insekten.
Die Frühlings-Platterbse bevorzugt nährstoffreiche, humose Böden in lichten Laub- und Mischwäldern, an Waldrändern sowie in Gebüschen. Als Stickstoffsammler trägt sie – wie viele Leguminosen – zur Bodenfruchtbarkeit bei und ist ein wichtiger Bestandteil naturnaher Waldökosysteme.
Perspektive im Wandel von Lebensraum und Klima
Die Zukunft der Frühlings-Platterbse ist eng mit der Entwicklung ihrer Lebensräume verknüpft. Durch intensive Forstwirtschaft, Flächenversiegelung und den Rückgang strukturreicher Wälder gehen geeignete Standorte zunehmend verloren. Besonders problematisch ist die Beschattung durch dichter werdende Baumkronen, da die Art auf das frühe Frühlingslicht angewiesen ist.
Der Klimawandel wirkt ambivalent: Mildere Winter können den früheren Austrieb begünstigen, gleichzeitig erhöhen Spätfröste, Trockenperioden und veränderte Niederschlagsmuster das Risiko für Blüten- und Samenverluste. Verschiebt sich zudem der Aktivitätszeitraum der Bestäuber, kann dies die erfolgreiche Fortpflanzung beeinträchtigen.
Langfristig hängt der Erhalt der Frühlings-Platterbse von naturnahen Waldstrukturen, angepasster Bewirtschaftung und dem Schutz vielfältiger Übergangsbereiche ab. Wo ihr Lebensraum bewahrt wird, bleibt sie auch künftig ein stiller, aber verlässlicher Frühlingsbote.
In der Aufnahme von Dieter Zinßer
Die Frühlings-Platterbse (Lathyrus vernus) ist eine ausdauernde, krautige Pflanze aus der Familie der Hülsenfrüchtler (Fabaceae). Sie erreicht meist eine Wuchshöhe von etwa 20 bis 40 Zentimetern und wächst aufrecht, ohne zu klettern – im Gegensatz zu vielen anderen Platterbsenarten.
Charakteristisch sind ihre gefiederten Blätter mit zwei bis drei Paaren eiförmiger Fiederblättchen. Die auffälligen Blüten erscheinen früh im Jahr, meist zwischen März und Mai. Sie zeigen ein interessantes Farbspiel: Zu Beginn oft rötlich-violett, wechseln sie im Laufe der Blütezeit zu Blau- und Grüntönen. Bestäubt wird die Pflanze vor allem von Hummeln und anderen früh aktiven Insekten.
Die Frühlings-Platterbse bevorzugt nährstoffreiche, humose Böden in lichten Laub- und Mischwäldern, an Waldrändern sowie in Gebüschen. Als Stickstoffsammler trägt sie – wie viele Leguminosen – zur Bodenfruchtbarkeit bei und ist ein wichtiger Bestandteil naturnaher Waldökosysteme.
Perspektive im Wandel von Lebensraum und Klima
Die Zukunft der Frühlings-Platterbse ist eng mit der Entwicklung ihrer Lebensräume verknüpft. Durch intensive Forstwirtschaft, Flächenversiegelung und den Rückgang strukturreicher Wälder gehen geeignete Standorte zunehmend verloren. Besonders problematisch ist die Beschattung durch dichter werdende Baumkronen, da die Art auf das frühe Frühlingslicht angewiesen ist.
Der Klimawandel wirkt ambivalent: Mildere Winter können den früheren Austrieb begünstigen, gleichzeitig erhöhen Spätfröste, Trockenperioden und veränderte Niederschlagsmuster das Risiko für Blüten- und Samenverluste. Verschiebt sich zudem der Aktivitätszeitraum der Bestäuber, kann dies die erfolgreiche Fortpflanzung beeinträchtigen.
Langfristig hängt der Erhalt der Frühlings-Platterbse von naturnahen Waldstrukturen, angepasster Bewirtschaftung und dem Schutz vielfältiger Übergangsbereiche ab. Wo ihr Lebensraum bewahrt wird, bleibt sie auch künftig ein stiller, aber verlässlicher Frühlingsbote.
In der Aufnahme von Dieter Zinßer
- Erste Blüten der Frühlings-Platterbse im zeitigen Frühjahr
Artenschutz in Franken®
Bergsingzikade (Cicadetta montana)

Die Bergsingzikade (Cicadetta montana)
31.01/01.02.2026
Der Klang scheint aus dem Nichts zu kommen, ist aber das Lebenszeichen einer gut getarnten Bewohnerin: der Bergsingzikade. Wer sie hört, aber nicht sieht, erlebt einen der leisen Momente der Natur, in denen Aufmerksamkeit belohnt wird.
31.01/01.02.2026
- An einem warmen Nachmittag liegt Stille über einem lichten Hangwald. Erst nach genauerem Hinhören wird sie durchbrochen – von einem feinen, hochfrequenten Surren, das fast mit dem Wind verschmilzt.
Der Klang scheint aus dem Nichts zu kommen, ist aber das Lebenszeichen einer gut getarnten Bewohnerin: der Bergsingzikade. Wer sie hört, aber nicht sieht, erlebt einen der leisen Momente der Natur, in denen Aufmerksamkeit belohnt wird.
Artbeschreibung
Die Bergsingzikade (Cicadetta montana) ist eine kleine bis mittelgroße Singzikade aus der Familie der Cicadidae. Sie zeichnet sich durch ihre unauffällige Färbung in Grau- und Brauntönen aus, die ihr eine ausgezeichnete Tarnung auf Baumrinden und in der Vegetation ermöglicht. Auffällig ist weniger ihr Aussehen als ihr Gesang, der aus hohen, gleichmäßigen Lautfolgen besteht und für das menschliche Ohr teils nur schwer wahrnehmbar ist.
Die Art lebt bevorzugt in warmen, sonnigen Lebensräumen wie lichten Laubwäldern, Waldrändern, Trockenhängen oder strukturreichen Wiesen mit Gehölzanteil. Die Larven entwickeln sich mehrere Jahre im Boden und ernähren sich dort von Pflanzensäften aus den Wurzeln. Erst nach dieser langen Entwicklungszeit schlüpfen die erwachsenen Zikaden, deren Lebensspanne vergleichsweise kurz ist und sich auf Fortpflanzung und Gesang konzentriert.
Perspektive im Wandel von Lebensraum und Klima
Die Bergsingzikade ist stark an bestimmte Lebensraumstrukturen gebunden. Veränderungen wie Aufforstung, intensive Landnutzung, Bebauung oder der Verlust von offenen, sonnigen Flächen wirken sich direkt auf ihre Bestände aus. Da ihre Larven viele Jahre im Boden verbringen, reagiert die Art besonders empfindlich auf Bodenverdichtung und -störungen.
Der Klimawandel bringt sowohl Chancen als auch Risiken mit sich. Steigende Temperaturen können grundsätzlich geeignete Lebensräume ausweiten, gleichzeitig führen häufigere Extremereignisse wie Trockenperioden oder Starkregen zu einer zusätzlichen Belastung. Veränderungen im Wasserhaushalt des Bodens können die langfristige Entwicklung der Larven beeinträchtigen.
Die Zukunft der Bergsingzikade hängt daher eng mit dem Erhalt vielfältiger, strukturreicher Landschaften zusammen. Der Schutz sonniger Waldränder, extensiv genutzter Flächen und naturnaher Übergangszonen kann dazu beitragen, ihren charakteristischen Gesang auch künftig in der Landschaft hörbar zu machen.
In der Aufnahme von Albert Meier
Die Bergsingzikade (Cicadetta montana) ist eine kleine bis mittelgroße Singzikade aus der Familie der Cicadidae. Sie zeichnet sich durch ihre unauffällige Färbung in Grau- und Brauntönen aus, die ihr eine ausgezeichnete Tarnung auf Baumrinden und in der Vegetation ermöglicht. Auffällig ist weniger ihr Aussehen als ihr Gesang, der aus hohen, gleichmäßigen Lautfolgen besteht und für das menschliche Ohr teils nur schwer wahrnehmbar ist.
Die Art lebt bevorzugt in warmen, sonnigen Lebensräumen wie lichten Laubwäldern, Waldrändern, Trockenhängen oder strukturreichen Wiesen mit Gehölzanteil. Die Larven entwickeln sich mehrere Jahre im Boden und ernähren sich dort von Pflanzensäften aus den Wurzeln. Erst nach dieser langen Entwicklungszeit schlüpfen die erwachsenen Zikaden, deren Lebensspanne vergleichsweise kurz ist und sich auf Fortpflanzung und Gesang konzentriert.
Perspektive im Wandel von Lebensraum und Klima
Die Bergsingzikade ist stark an bestimmte Lebensraumstrukturen gebunden. Veränderungen wie Aufforstung, intensive Landnutzung, Bebauung oder der Verlust von offenen, sonnigen Flächen wirken sich direkt auf ihre Bestände aus. Da ihre Larven viele Jahre im Boden verbringen, reagiert die Art besonders empfindlich auf Bodenverdichtung und -störungen.
Der Klimawandel bringt sowohl Chancen als auch Risiken mit sich. Steigende Temperaturen können grundsätzlich geeignete Lebensräume ausweiten, gleichzeitig führen häufigere Extremereignisse wie Trockenperioden oder Starkregen zu einer zusätzlichen Belastung. Veränderungen im Wasserhaushalt des Bodens können die langfristige Entwicklung der Larven beeinträchtigen.
Die Zukunft der Bergsingzikade hängt daher eng mit dem Erhalt vielfältiger, strukturreicher Landschaften zusammen. Der Schutz sonniger Waldränder, extensiv genutzter Flächen und naturnaher Übergangszonen kann dazu beitragen, ihren charakteristischen Gesang auch künftig in der Landschaft hörbar zu machen.
In der Aufnahme von Albert Meier
- Bergzikade, so der Name für eine sehr scheue Zikadenart die wir bei uns an sonnig warmen und vor allem offenen Flächen, meist in der Nähe zu Hecken, Großsträuchern oder Gebüschen finden.
Artenschutz in Franken®
Kronen-Lichtnelke (Lychnis coronaria)

Die Kronen-Lichtnelke (Lychnis coronaria)
31.01/01.02.2026
Ihre leuchtend purpurfarbenen Blüten stehen im starken Kontrast zu den silbrig schimmernden Blättern. Während andere Pflanzen unter der Hitze des Sommers leiden, scheint die Kronen-Lichtnelke genau hier ihren Platz gefunden zu haben. Sie wirkt wie ein Überbleibsel aus vergangenen Zeiten – standhaft, eigenwillig und mit einer Präsenz, die selbst in kargen Landschaften nicht zu übersehen ist.
31.01/01.02.2026
- Zwischen alten Natursteinmauern, wo sich Wärme sammelt und der Boden trocken bleibt, fällt sie sofort ins Auge.
Ihre leuchtend purpurfarbenen Blüten stehen im starken Kontrast zu den silbrig schimmernden Blättern. Während andere Pflanzen unter der Hitze des Sommers leiden, scheint die Kronen-Lichtnelke genau hier ihren Platz gefunden zu haben. Sie wirkt wie ein Überbleibsel aus vergangenen Zeiten – standhaft, eigenwillig und mit einer Präsenz, die selbst in kargen Landschaften nicht zu übersehen ist.
Artbeschreibung
Die Kronen-Lichtnelke (Lychnis coronaria) ist eine mehrjährige, krautige Pflanze aus der Familie der Nelkengewächse (Caryophyllaceae). Sie erreicht meist Wuchshöhen von 40 bis 90 Zentimetern. Besonders charakteristisch sind die dicht behaarten, graugrünen bis silbrigen Blätter, die der Pflanze ein fast samtiges Erscheinungsbild verleihen.
Die auffälligen Blüten sind meist kräftig purpur- bis karminrot gefärbt, seltener auch rosa oder weiß. Sie bestehen aus fünf leicht eingekerbten Kronblättern und erscheinen in lockeren Blütenständen von Juni bis August. Die Kronen-Lichtnelke bevorzugt sonnige, warme Standorte mit durchlässigen, eher trockenen Böden. Ursprünglich stammt sie aus dem südöstlichen Europa, ist heute jedoch in vielen Regionen als Zier- und Verwilderungspflanze anzutreffen.
Dank ihrer Trockenheitsverträglichkeit und Anspruchslosigkeit wird Lychnis coronaria häufig in naturnahen Gärten, an Böschungen oder auf ruderalen Flächen beobachtet.
Perspektive im Zeichen von Lebensraumveränderung und Klimawandel
Die Kronen-Lichtnelke gehört zu den Arten, die von bestimmten Aspekten des Klimawandels profitieren könnten. Steigende Temperaturen, längere Trockenperioden und vermehrt offene, wärmebegünstigte Standorte kommen ihren ökologischen Ansprüchen entgegen. In urbanen Räumen, auf Brachflächen oder entlang von Wegrändern findet sie zunehmend geeignete Lebensbedingungen.
Gleichzeitig verändern sich jedoch auch ihre Lebensräume. Versiegelung, intensive Pflege von Grünflächen und der Rückgang strukturreicher Übergangszonen können ihre Ausbreitung begrenzen. Als licht- und wärmeliebende Art ist sie auf offene Flächen angewiesen, die nicht dauerhaft beschattet oder stark gedüngt werden.
In einer sich wandelnden Umwelt steht die Kronen-Lichtnelke sinnbildlich für robuste Pflanzenarten, die neue Nischen besetzen können – vorausgesetzt, es bleibt Raum für naturnahe, wenig regulierte Lebensräume. Ihr Vorkommen kann damit als Zeichen für eine vielfältige, dynamische Landschaft gelesen werden, in der auch ungewöhnliche und farbenfrohe Arten ihren Platz finden.
In der Aufnahne von Dieter Zinßer
Die Kronen-Lichtnelke (Lychnis coronaria) ist eine mehrjährige, krautige Pflanze aus der Familie der Nelkengewächse (Caryophyllaceae). Sie erreicht meist Wuchshöhen von 40 bis 90 Zentimetern. Besonders charakteristisch sind die dicht behaarten, graugrünen bis silbrigen Blätter, die der Pflanze ein fast samtiges Erscheinungsbild verleihen.
Die auffälligen Blüten sind meist kräftig purpur- bis karminrot gefärbt, seltener auch rosa oder weiß. Sie bestehen aus fünf leicht eingekerbten Kronblättern und erscheinen in lockeren Blütenständen von Juni bis August. Die Kronen-Lichtnelke bevorzugt sonnige, warme Standorte mit durchlässigen, eher trockenen Böden. Ursprünglich stammt sie aus dem südöstlichen Europa, ist heute jedoch in vielen Regionen als Zier- und Verwilderungspflanze anzutreffen.
Dank ihrer Trockenheitsverträglichkeit und Anspruchslosigkeit wird Lychnis coronaria häufig in naturnahen Gärten, an Böschungen oder auf ruderalen Flächen beobachtet.
Perspektive im Zeichen von Lebensraumveränderung und Klimawandel
Die Kronen-Lichtnelke gehört zu den Arten, die von bestimmten Aspekten des Klimawandels profitieren könnten. Steigende Temperaturen, längere Trockenperioden und vermehrt offene, wärmebegünstigte Standorte kommen ihren ökologischen Ansprüchen entgegen. In urbanen Räumen, auf Brachflächen oder entlang von Wegrändern findet sie zunehmend geeignete Lebensbedingungen.
Gleichzeitig verändern sich jedoch auch ihre Lebensräume. Versiegelung, intensive Pflege von Grünflächen und der Rückgang strukturreicher Übergangszonen können ihre Ausbreitung begrenzen. Als licht- und wärmeliebende Art ist sie auf offene Flächen angewiesen, die nicht dauerhaft beschattet oder stark gedüngt werden.
In einer sich wandelnden Umwelt steht die Kronen-Lichtnelke sinnbildlich für robuste Pflanzenarten, die neue Nischen besetzen können – vorausgesetzt, es bleibt Raum für naturnahe, wenig regulierte Lebensräume. Ihr Vorkommen kann damit als Zeichen für eine vielfältige, dynamische Landschaft gelesen werden, in der auch ungewöhnliche und farbenfrohe Arten ihren Platz finden.
In der Aufnahne von Dieter Zinßer
- Lychnis coronaria in voller Sommerblüte
Artenschutz in Franken®
Eis und Wasser – Der stille Kreislauf des Lebens

Eis und Wasser – Der stille Kreislauf des Lebens
31.01/01.02.2026
In ihnen spiegeln sich die großen Zusammenhänge unseres Planeten: Klima, Zeit und Leben. Diese Diashow eröffnet einen Raum, in dem die leisen Prozesse der Natur sichtbar werden – Prozesse, die oft im Verborgenen wirken und doch über das Schicksal ganzer Ökosysteme entscheiden.
31.01/01.02.2026
- Eis und Wasser sind weit mehr als bloße Naturstoffe. Sie sind Gedächtnis und Bewegung, Ursprung und Zukunft zugleich.
In ihnen spiegeln sich die großen Zusammenhänge unseres Planeten: Klima, Zeit und Leben. Diese Diashow eröffnet einen Raum, in dem die leisen Prozesse der Natur sichtbar werden – Prozesse, die oft im Verborgenen wirken und doch über das Schicksal ganzer Ökosysteme entscheiden.
Eis steht für Dauer und Erinnerung.
In Gletschern, Eiskappen und Schneefeldern lagern Informationen aus vergangenen Jahrhunderten und Jahrtausenden. Luftblasen im Eis bewahren die Atmosphäre früherer Zeiten, Schichten erzählen von warmen und kalten Phasen, von Stabilität und Umbruch. Gleichzeitig ist Eis kein starres Element. Gletscher bewegen sich langsam talwärts, knirschen, brechen und passen sich ihrer Umgebung an. Sie formen Landschaften, schleifen Gestein und schaffen Lebensräume, lange bevor der Mensch sie betritt.
Wasser ist das Element des Wandels.
Es findet seinen Weg durch jede noch so kleine Öffnung, verbindet Höhen und Tiefen, überwindet Grenzen und Distanzen. Als Quelle schenkt es Leben, als Fluss transportiert es Nährstoffe, als See speichert es Wärme, als Meer reguliert es das globale Klima. Ohne Wasser gäbe es keine Wälder, keine Tiere, keine Kulturen – und keine Zukunft.
Eis und Wasser stehen in einem engen Wechselspiel. Schnee speist Flüsse, Gletscher sichern die Wasserversorgung ganzer Regionen, Polareis beeinflusst Meeresströmungen und Wetterlagen auf der ganzen Erde. Wenn dieses Gleichgewicht ins Wanken gerät, bleiben die Folgen nicht lokal begrenzt. Das Abschmelzen von Eis verändert den Meeresspiegel, verschiebt Klimazonen und verstärkt extreme Wetterereignisse. Was fern erscheint, wirkt nah.
Die Bilder dieser Diashow machen diese Zusammenhänge erfahrbar.
Sie zeigen die stille Erhabenheit gefrorener Strukturen ebenso wie die fließende Dynamik des Wassers. Licht, Farbe und Struktur lassen erkennen, wie sensibel diese Systeme sind – und wie eng Schönheit und Verletzlichkeit miteinander verbunden sind. Jeder Tropfen, jede Eisschicht ist Teil eines globalen Gefüges.
Besonders eindrucksvoll wird sichtbar, wie schnell sich natürliche Prozesse verändern können. Rückzugsgebiete des Eises werden kleiner, Übergangszonen größer. Dort, wo einst dauerhaft Frost herrschte, entstehen neue Landschaften – oft ohne die Zeit, stabile Ökosysteme auszubilden. Wasser verliert seine Rolle als verlässlicher Speicher und wird zunehmend zum unberechenbaren Faktor.
Doch diese Diashow zeigt nicht nur Verlust, sondern auch Verantwortung.
Sie lädt dazu ein, genauer hinzusehen und die Bedeutung von Eis und Wasser neu zu begreifen. Naturschutz beginnt mit Wahrnehmung. Wer versteht, wie grundlegend diese Elemente für das Leben auf der Erde sind, erkennt auch die Dringlichkeit ihres Schutzes.
Eis und Wasser erinnern uns daran, dass die Natur keine entfernte Kulisse ist. Sie ist ein lebendiges System, in das wir eingebunden sind. Ihr Zustand spiegelt unsere Entscheidungen wider. Diese visuelle Reise ist deshalb mehr als eine Sammlung von Bildern – sie ist ein stiller Appell, das Gleichgewicht zu bewahren, bevor das Schmelzen unumkehrbar wird.
In der Aufnahme von Dieter Zinßer
In Gletschern, Eiskappen und Schneefeldern lagern Informationen aus vergangenen Jahrhunderten und Jahrtausenden. Luftblasen im Eis bewahren die Atmosphäre früherer Zeiten, Schichten erzählen von warmen und kalten Phasen, von Stabilität und Umbruch. Gleichzeitig ist Eis kein starres Element. Gletscher bewegen sich langsam talwärts, knirschen, brechen und passen sich ihrer Umgebung an. Sie formen Landschaften, schleifen Gestein und schaffen Lebensräume, lange bevor der Mensch sie betritt.
Wasser ist das Element des Wandels.
Es findet seinen Weg durch jede noch so kleine Öffnung, verbindet Höhen und Tiefen, überwindet Grenzen und Distanzen. Als Quelle schenkt es Leben, als Fluss transportiert es Nährstoffe, als See speichert es Wärme, als Meer reguliert es das globale Klima. Ohne Wasser gäbe es keine Wälder, keine Tiere, keine Kulturen – und keine Zukunft.
Eis und Wasser stehen in einem engen Wechselspiel. Schnee speist Flüsse, Gletscher sichern die Wasserversorgung ganzer Regionen, Polareis beeinflusst Meeresströmungen und Wetterlagen auf der ganzen Erde. Wenn dieses Gleichgewicht ins Wanken gerät, bleiben die Folgen nicht lokal begrenzt. Das Abschmelzen von Eis verändert den Meeresspiegel, verschiebt Klimazonen und verstärkt extreme Wetterereignisse. Was fern erscheint, wirkt nah.
Die Bilder dieser Diashow machen diese Zusammenhänge erfahrbar.
Sie zeigen die stille Erhabenheit gefrorener Strukturen ebenso wie die fließende Dynamik des Wassers. Licht, Farbe und Struktur lassen erkennen, wie sensibel diese Systeme sind – und wie eng Schönheit und Verletzlichkeit miteinander verbunden sind. Jeder Tropfen, jede Eisschicht ist Teil eines globalen Gefüges.
Besonders eindrucksvoll wird sichtbar, wie schnell sich natürliche Prozesse verändern können. Rückzugsgebiete des Eises werden kleiner, Übergangszonen größer. Dort, wo einst dauerhaft Frost herrschte, entstehen neue Landschaften – oft ohne die Zeit, stabile Ökosysteme auszubilden. Wasser verliert seine Rolle als verlässlicher Speicher und wird zunehmend zum unberechenbaren Faktor.
Doch diese Diashow zeigt nicht nur Verlust, sondern auch Verantwortung.
Sie lädt dazu ein, genauer hinzusehen und die Bedeutung von Eis und Wasser neu zu begreifen. Naturschutz beginnt mit Wahrnehmung. Wer versteht, wie grundlegend diese Elemente für das Leben auf der Erde sind, erkennt auch die Dringlichkeit ihres Schutzes.
Eis und Wasser erinnern uns daran, dass die Natur keine entfernte Kulisse ist. Sie ist ein lebendiges System, in das wir eingebunden sind. Ihr Zustand spiegelt unsere Entscheidungen wider. Diese visuelle Reise ist deshalb mehr als eine Sammlung von Bildern – sie ist ein stiller Appell, das Gleichgewicht zu bewahren, bevor das Schmelzen unumkehrbar wird.
In der Aufnahme von Dieter Zinßer
- Eis und Wasser – Der stille Kreislauf des Lebens
Artenschutz in Franken®
Hausratte (Rattus rattus)

Die Hausratte (Rattus rattus)
30/31.01.2026
Lautlos verschwindet er zwischen Kisten und Mauerspalten. Die Hausratte kennt diesen Ort seit Generationen. Sie lebt im Verborgenen, aufmerksam, anpassungsfähig und stets auf der Suche nach Nahrung und Schutz. Kaum jemand bemerkt sie bewusst – und doch ist sie seit Jahrhunderten ein stiller Begleiter des Menschen.
30/31.01.2026
- In der Dämmerung eines alten Hafens, dort wo Holzbohlen knarren und Seile leise im Wind schwingen, huscht ein dunkler Schatten über den Boden.
Lautlos verschwindet er zwischen Kisten und Mauerspalten. Die Hausratte kennt diesen Ort seit Generationen. Sie lebt im Verborgenen, aufmerksam, anpassungsfähig und stets auf der Suche nach Nahrung und Schutz. Kaum jemand bemerkt sie bewusst – und doch ist sie seit Jahrhunderten ein stiller Begleiter des Menschen.
Artbeschreibung: Hausratte (Rattus rattus)
Die Hausratte (Rattus rattus), auch als Schwarze Ratte oder Dachratte bekannt, gehört zur Familie der Langschwanzmäuse (Muridae). Sie ist schlanker und leichter gebaut als die Wanderratte und erreicht eine Kopf-Rumpf-Länge von etwa 16 bis 22 Zentimetern. Auffällig ist ihr langer, meist unbehaarter Schwanz, der länger als der Körper sein kann, sowie ihre großen Ohren und spitze Schnauze.
Das Fell ist variabel gefärbt und reicht von schwarz über dunkelbraun bis graubraun. Hausratten sind ausgezeichnete Kletterer und halten sich bevorzugt in höheren Gebäudeteilen auf, etwa auf Dachböden, in Zwischendecken oder Lagerhäusern. Ursprünglich stammt die Art aus den tropischen Regionen Süd- und Südostasiens, verbreitete sich jedoch durch den Seehandel weltweit.
Als Allesfresser ernährt sich die Hausratte von pflanzlicher und tierischer Nahrung, wobei sie oft Vorräte nutzt, die in menschlicher Nähe verfügbar sind. Sie ist überwiegend nachtaktiv, sehr lernfähig und zeigt ein ausgeprägtes Sozialverhalten.
Perspektive im Wandel von Lebensraum und Klima
Die Lebensbedingungen der Hausratte verändern sich spürbar. Moderne Bauweisen, verbesserte Hygienestandards und gezielte Schädlingskontrolle haben dazu geführt, dass die Art in vielen Regionen Europas stark zurückgegangen ist. Besonders die Konkurrenz durch die robustere Wanderratte hat ihren Bestand weiter verdrängt.
Der Klimawandel könnte diese Entwicklung jedoch teilweise umkehren. Mildere Winter und steigende Durchschnittstemperaturen begünstigen wärmeliebende Arten wie die Hausratte. Hafenstädte, Industriegebiete und dicht bebaute urbane Räume bieten weiterhin geeignete Rückzugsorte, vor allem dort, wo alte Bausubstanz erhalten bleibt.
Gleichzeitig verändern sich Handelswege, Stadtstrukturen und Nahrungsangebote, was neue Ausbreitungsmöglichkeiten schaffen kann. Ob die Hausratte künftig wieder häufiger anzutreffen sein wird, hängt stark vom Zusammenspiel aus Klimaveränderung, menschlicher Infrastruktur und gezieltem Management ab. Sicher ist: Ihre Anpassungsfähigkeit bleibt ein entscheidender Faktor für ihr Überleben.
In der Aufnahme von Helga Zinnecker
Die Hausratte (Rattus rattus), auch als Schwarze Ratte oder Dachratte bekannt, gehört zur Familie der Langschwanzmäuse (Muridae). Sie ist schlanker und leichter gebaut als die Wanderratte und erreicht eine Kopf-Rumpf-Länge von etwa 16 bis 22 Zentimetern. Auffällig ist ihr langer, meist unbehaarter Schwanz, der länger als der Körper sein kann, sowie ihre großen Ohren und spitze Schnauze.
Das Fell ist variabel gefärbt und reicht von schwarz über dunkelbraun bis graubraun. Hausratten sind ausgezeichnete Kletterer und halten sich bevorzugt in höheren Gebäudeteilen auf, etwa auf Dachböden, in Zwischendecken oder Lagerhäusern. Ursprünglich stammt die Art aus den tropischen Regionen Süd- und Südostasiens, verbreitete sich jedoch durch den Seehandel weltweit.
Als Allesfresser ernährt sich die Hausratte von pflanzlicher und tierischer Nahrung, wobei sie oft Vorräte nutzt, die in menschlicher Nähe verfügbar sind. Sie ist überwiegend nachtaktiv, sehr lernfähig und zeigt ein ausgeprägtes Sozialverhalten.
Perspektive im Wandel von Lebensraum und Klima
Die Lebensbedingungen der Hausratte verändern sich spürbar. Moderne Bauweisen, verbesserte Hygienestandards und gezielte Schädlingskontrolle haben dazu geführt, dass die Art in vielen Regionen Europas stark zurückgegangen ist. Besonders die Konkurrenz durch die robustere Wanderratte hat ihren Bestand weiter verdrängt.
Der Klimawandel könnte diese Entwicklung jedoch teilweise umkehren. Mildere Winter und steigende Durchschnittstemperaturen begünstigen wärmeliebende Arten wie die Hausratte. Hafenstädte, Industriegebiete und dicht bebaute urbane Räume bieten weiterhin geeignete Rückzugsorte, vor allem dort, wo alte Bausubstanz erhalten bleibt.
Gleichzeitig verändern sich Handelswege, Stadtstrukturen und Nahrungsangebote, was neue Ausbreitungsmöglichkeiten schaffen kann. Ob die Hausratte künftig wieder häufiger anzutreffen sein wird, hängt stark vom Zusammenspiel aus Klimaveränderung, menschlicher Infrastruktur und gezieltem Management ab. Sicher ist: Ihre Anpassungsfähigkeit bleibt ein entscheidender Faktor für ihr Überleben.
In der Aufnahme von Helga Zinnecker
- Junge Hausratte blickt aus dem Bau
Artenschutz in Franken®
Die Breitblättrige Lichtnelke (Silene latifolia)

Die Breitblättrige Lichtnelke (Silene latifolia)
30/31.01.2026
Nachtfalter finden nun ihren Weg zu ihr, angelockt von Duft und Helligkeit. Die Breitblättrige Lichtnelke ist keine Pflanze, die um Aufmerksamkeit buhlt. Und doch erzählt sie, wenn man innehält, eine Geschichte von Anpassung, Durchhaltevermögen und stiller Präsenz in einer sich wandelnden Landschaft.
30/31.01.2026
- In der Dämmerung eines warmen Sommerabends steht sie unscheinbar am Rand einer Wiese. Während das Licht langsam schwindet, beginnen ihre weißen Blüten zu leuchten – nicht grell, sondern sanft, fast zurückhaltend.
Nachtfalter finden nun ihren Weg zu ihr, angelockt von Duft und Helligkeit. Die Breitblättrige Lichtnelke ist keine Pflanze, die um Aufmerksamkeit buhlt. Und doch erzählt sie, wenn man innehält, eine Geschichte von Anpassung, Durchhaltevermögen und stiller Präsenz in einer sich wandelnden Landschaft.
Artbeschreibung
Die Breitblättrige Lichtnelke (Silene latifolia) gehört zur Familie der Nelkengewächse (Caryophyllaceae). Sie ist eine ausdauernde, krautige Pflanze, die Wuchshöhen von etwa 30 bis 80 Zentimetern erreichen kann. Charakteristisch sind ihre gegenständig angeordneten, eiförmig bis breit-lanzettlichen Blätter, die der Art ihren deutschen Namen verleihen.
Besonders auffällig sind die weißen, meist nachts geöffneten Blüten. Sie sind fünfzählig aufgebaut und besitzen eine leicht eingeschnittene Kronblattstruktur. Die Pflanze ist zweihäusig, das heißt, männliche und weibliche Blüten wachsen auf getrennten Individuen – ein eher seltenes Merkmal unter heimischen Wildpflanzen. Die Blütezeit erstreckt sich in der Regel von Mai bis September.
Die Breitblättrige Lichtnelke besiedelt bevorzugt nährstoffreiche Standorte wie Wegränder, Böschungen, Feldraine, Brachen und extensiv genutzte Wiesen. Sie ist in weiten Teilen Europas verbreitet und wurde auch in andere Regionen eingeführt.
Perspektive im Zeichen von Lebensraumveränderung und Klimawandel
Die Zukunft der Breitblättrigen Lichtnelke ist eng mit der Entwicklung unserer Kulturlandschaften verknüpft. Intensivierung der Landwirtschaft, häufige Mahd, der Verlust von Feldrainen sowie zunehmende Versiegelung reduzieren vielerorts geeignete Lebensräume. Gleichzeitig verändern steigende Temperaturen und veränderte Niederschlagsmuster die Standortbedingungen.
Als vergleichsweise anpassungsfähige Art kann Silene latifolia zwar kurzfristig von wärmeren Bedingungen profitieren und neue Gebiete erschließen. Langfristig jedoch hängt ihr Fortbestand davon ab, ob strukturreiche Landschaften mit offenen, wenig gestörten Bereichen erhalten bleiben. Besonders die Abhängigkeit von nachtaktiven Bestäubern macht sie sensibel gegenüber Lichtverschmutzung und dem Rückgang von Insektenpopulationen.
Die Breitblättrige Lichtnelke steht damit exemplarisch für viele unscheinbare Wildpflanzen: Sie ist noch verbreitet, aber nicht selbstverständlich. Ihr Erhalt ist ein stiller Indikator dafür, wie vielfältig und lebendig unsere Landschaften auch in Zukunft sein können.
In der Aufnahme von Dieter Zinßer
Die Breitblättrige Lichtnelke (Silene latifolia) gehört zur Familie der Nelkengewächse (Caryophyllaceae). Sie ist eine ausdauernde, krautige Pflanze, die Wuchshöhen von etwa 30 bis 80 Zentimetern erreichen kann. Charakteristisch sind ihre gegenständig angeordneten, eiförmig bis breit-lanzettlichen Blätter, die der Art ihren deutschen Namen verleihen.
Besonders auffällig sind die weißen, meist nachts geöffneten Blüten. Sie sind fünfzählig aufgebaut und besitzen eine leicht eingeschnittene Kronblattstruktur. Die Pflanze ist zweihäusig, das heißt, männliche und weibliche Blüten wachsen auf getrennten Individuen – ein eher seltenes Merkmal unter heimischen Wildpflanzen. Die Blütezeit erstreckt sich in der Regel von Mai bis September.
Die Breitblättrige Lichtnelke besiedelt bevorzugt nährstoffreiche Standorte wie Wegränder, Böschungen, Feldraine, Brachen und extensiv genutzte Wiesen. Sie ist in weiten Teilen Europas verbreitet und wurde auch in andere Regionen eingeführt.
Perspektive im Zeichen von Lebensraumveränderung und Klimawandel
Die Zukunft der Breitblättrigen Lichtnelke ist eng mit der Entwicklung unserer Kulturlandschaften verknüpft. Intensivierung der Landwirtschaft, häufige Mahd, der Verlust von Feldrainen sowie zunehmende Versiegelung reduzieren vielerorts geeignete Lebensräume. Gleichzeitig verändern steigende Temperaturen und veränderte Niederschlagsmuster die Standortbedingungen.
Als vergleichsweise anpassungsfähige Art kann Silene latifolia zwar kurzfristig von wärmeren Bedingungen profitieren und neue Gebiete erschließen. Langfristig jedoch hängt ihr Fortbestand davon ab, ob strukturreiche Landschaften mit offenen, wenig gestörten Bereichen erhalten bleiben. Besonders die Abhängigkeit von nachtaktiven Bestäubern macht sie sensibel gegenüber Lichtverschmutzung und dem Rückgang von Insektenpopulationen.
Die Breitblättrige Lichtnelke steht damit exemplarisch für viele unscheinbare Wildpflanzen: Sie ist noch verbreitet, aber nicht selbstverständlich. Ihr Erhalt ist ein stiller Indikator dafür, wie vielfältig und lebendig unsere Landschaften auch in Zukunft sein können.
In der Aufnahme von Dieter Zinßer
- Weiß leuchtende Blüten der Breitblättrigen Lichtnelke in der Abenddämmerung
Artenschutz in Franken®
Pilze – faszinierende Vielfalt im Verborgenen

Pilze – faszinierende Vielfalt im Verborgenen
30/31.01.2026
Dabei steht nicht die Vollständigkeit, sondern das Staunen und das Bewusstsein für ihre ökologische Bedeutung im Vordergrund. Gleichzeitig weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass eine zuverlässige Bestimmung von Pilzen allein anhand von Bildern – insbesondere für Laien – kaum möglich ist.
Viele Arten ähneln sich äußerlich stark, während entscheidende Unterscheidungsmerkmale oft nur im Detail, im Standort oder unter dem Mikroskop erkennbar sind. Als Organisation empfehlen wir daher dringend, Pilzbestimmungen stets durch ausgewiesene Fachkennerinnen und Fachkenner vornehmen zu lassen.
30/31.01.2026
- Pilze sind ein oft übersehener, aber unverzichtbarer Bestandteil unserer Ökosysteme. In dieser Diashow möchten wir die große Vielfalt heimischer Pilzarten zeigen und einen Einblick in ihre Formen, Farben und Lebensweisen geben.
Dabei steht nicht die Vollständigkeit, sondern das Staunen und das Bewusstsein für ihre ökologische Bedeutung im Vordergrund. Gleichzeitig weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass eine zuverlässige Bestimmung von Pilzen allein anhand von Bildern – insbesondere für Laien – kaum möglich ist.
Viele Arten ähneln sich äußerlich stark, während entscheidende Unterscheidungsmerkmale oft nur im Detail, im Standort oder unter dem Mikroskop erkennbar sind. Als Organisation empfehlen wir daher dringend, Pilzbestimmungen stets durch ausgewiesene Fachkennerinnen und Fachkenner vornehmen zu lassen.
Zunehmend geraten Pilzarten auch durch klimatische Veränderungen unter Druck.
Längere Trockenperioden, steigende Temperaturen und veränderte Niederschlagsmuster beeinflussen das empfindliche Zusammenspiel zwischen Pilzen, Böden und ihren Symbiosepartnern wie Bäumen und Pflanzen. Einige Arten reagieren darauf besonders sensibel und gehen in ihrem Vorkommen deutlich zurück.
Ein weiterer Aspekt ist die Entnahme von Fruchtkörpern.
Auch wenn der Fruchtkörper nur einen Teil des Pilzorganismus darstellt, kann häufiges oder unsachgemäßes Sammeln – insbesondere bei seltenen Arten – zu einer Schwächung der Bestände beitragen. In Kombination mit Lebensraumveränderungen, Zerstörung von Wäldern, Bodenverdichtung und Flächenversiegelung verstärken sich diese negativen Effekte erheblich.
Mit dieser Diashow möchten wir dazu beitragen, das Verständnis für Pilze zu vertiefen und für einen respektvollen, verantwortungsvollen Umgang mit ihnen zu sensibilisieren. Der Schutz ihrer Lebensräume ist zugleich ein wichtiger Beitrag zum Erhalt der biologischen Vielfalt insgesamt.
In der Aufnahme von Dieter Zinßer
Längere Trockenperioden, steigende Temperaturen und veränderte Niederschlagsmuster beeinflussen das empfindliche Zusammenspiel zwischen Pilzen, Böden und ihren Symbiosepartnern wie Bäumen und Pflanzen. Einige Arten reagieren darauf besonders sensibel und gehen in ihrem Vorkommen deutlich zurück.
Ein weiterer Aspekt ist die Entnahme von Fruchtkörpern.
Auch wenn der Fruchtkörper nur einen Teil des Pilzorganismus darstellt, kann häufiges oder unsachgemäßes Sammeln – insbesondere bei seltenen Arten – zu einer Schwächung der Bestände beitragen. In Kombination mit Lebensraumveränderungen, Zerstörung von Wäldern, Bodenverdichtung und Flächenversiegelung verstärken sich diese negativen Effekte erheblich.
Mit dieser Diashow möchten wir dazu beitragen, das Verständnis für Pilze zu vertiefen und für einen respektvollen, verantwortungsvollen Umgang mit ihnen zu sensibilisieren. Der Schutz ihrer Lebensräume ist zugleich ein wichtiger Beitrag zum Erhalt der biologischen Vielfalt insgesamt.
In der Aufnahme von Dieter Zinßer
- Helmlinge auf Moos
Artenschutz in Franken®
Birkhuhn (Lyrurus tetrix)

Das Birkhuhn (Lyrurus tetrix) – Zwischen Morgendunst und stillem Rückzug
29/30.01.2026
Mit den ersten Lichtstreifen des Morgens tritt ein dunkler Umriss aus dem Dunst. Federn glänzen matt, Flügel werden gespreizt, der leierförmige Schwanz hebt sich. Für einen kurzen Moment gehört dieser Platz allein dem Birkhuhn. Seit Generationen kehrt es hierher zurück – an denselben Balzplatz, zur selben Jahreszeit, im Rhythmus der Natur. Doch der Raum um es herum ist kleiner geworden, stiller, verletzlicher.
Diese Szene, einst typisch für viele Hochlagen, Moore und offene Waldlandschaften Mitteleuropas, ist heute selten geworden.
29/30.01.2026
- Noch liegt Nebel über der offenen Moorfläche. Die Luft ist kühl, fast reglos. Aus der Ferne erklingt ein leises Blubbern, ein Zischen, dann wieder Stille.
Mit den ersten Lichtstreifen des Morgens tritt ein dunkler Umriss aus dem Dunst. Federn glänzen matt, Flügel werden gespreizt, der leierförmige Schwanz hebt sich. Für einen kurzen Moment gehört dieser Platz allein dem Birkhuhn. Seit Generationen kehrt es hierher zurück – an denselben Balzplatz, zur selben Jahreszeit, im Rhythmus der Natur. Doch der Raum um es herum ist kleiner geworden, stiller, verletzlicher.
Diese Szene, einst typisch für viele Hochlagen, Moore und offene Waldlandschaften Mitteleuropas, ist heute selten geworden.
Artbeschreibung
Das Birkhuhn (Lyrurus tetrix) ist eine charakteristische Vogelart der offenen und halboffenen Landschaften Europas und Asiens. Es gehört zur Familie der Raufußhühner und ist besonders an kühle, strukturreiche Lebensräume angepasst.
Männliche Birkhühner sind unverwechselbar: Ihr schwarzes, metallisch schimmerndes Gefieder, die weißen Flügelbinden und der namensgebende, lyraförmig gebogene Schwanz machen sie vor allem während der Balz auffällig. Über den Augen erinnern leuchtend rote Hautwülste an kleine Signallichter. Weibchen, auch Birkhennen genannt, sind deutlich unauffälliger gefärbt. Ihr braun gesprenkeltes Gefieder bietet eine hervorragende Tarnung im Bodenbewuchs – ein wichtiger Schutz während der Brutzeit.
Birkhühner leben überwiegend am Boden. Ihre Nahrung besteht aus Knospen, Blättern, Beeren, Samen und im Sommer auch aus Insekten. Besonders im Winter sind sie auf bestimmte Pflanzen wie Birken, Weiden oder Zwergsträucher angewiesen. Ihre Lebensräume sind Moore, Heiden, alpine Matten, lichte Wälder und Übergangszonen zwischen Wald und Offenland.
Ein zentrales Element ihres Lebenszyklus ist die Balz. Auf traditionellen Balzplätzen treffen sich die Männchen im Frühjahr, um mit Lauten, Körperhaltung und Bewegung um die Aufmerksamkeit der Weibchen zu werben. Diese Plätze werden über viele Jahre genutzt und sind von entscheidender Bedeutung für den Fortbestand der Art.
Perspektive des Birkhuhns im Wandel von Lebensraum und Klima
Das Birkhuhn ist ein sensibler Indikator für den Zustand seiner Umwelt. Dort, wo es verschwindet, haben sich Landschaften grundlegend verändert. Die Ursachen liegen vor allem im Verlust geeigneter Lebensräume. Moore wurden entwässert, offene Flächen verbuscht oder intensiv genutzt, lichte Wälder wurden dichter, homogener und artenärmer.
Hinzu kommen zunehmende Störungen durch Freizeitaktivitäten. Wintersport, Wanderwege, Tourismus und ganzjährige Nutzung ehemals ruhiger Gebiete führen dazu, dass Rückzugsräume schrumpfen. Besonders im Winter, wenn Energie lebenswichtig ist, können Störungen für Birkhühner existenzbedrohend sein.
Der Klimawandel verstärkt diese Entwicklungen. Steigende Temperaturen verändern die Vegetation in Hochlagen, die Schneezeiten werden kürzer, Übergänge zwischen Jahreszeiten verschieben sich. Das Birkhuhn ist an kalte Winter und strukturreiche Landschaften angepasst. Wenn diese Bedingungen verschwinden, gerät sein fein abgestimmter Lebensrhythmus aus dem Gleichgewicht.
Langfristig steht das Birkhuhn vor der Herausforderung, sich in einer Landschaft zu behaupten, die immer weniger Platz für spezialisierte Arten bietet. Sein Überleben hängt davon ab, ob es gelingt, Lebensräume zu vernetzen, Störungen zu reduzieren und natürliche Prozesse wieder zuzulassen. Der Schutz des Birkhuhns ist damit immer auch ein Schutz für Moore, Berglandschaften und offene Waldstrukturen – und für die biologische Vielfalt insgesamt.
In der Aufnahme von Werner Oppermann
Das Birkhuhn (Lyrurus tetrix) ist eine charakteristische Vogelart der offenen und halboffenen Landschaften Europas und Asiens. Es gehört zur Familie der Raufußhühner und ist besonders an kühle, strukturreiche Lebensräume angepasst.
Männliche Birkhühner sind unverwechselbar: Ihr schwarzes, metallisch schimmerndes Gefieder, die weißen Flügelbinden und der namensgebende, lyraförmig gebogene Schwanz machen sie vor allem während der Balz auffällig. Über den Augen erinnern leuchtend rote Hautwülste an kleine Signallichter. Weibchen, auch Birkhennen genannt, sind deutlich unauffälliger gefärbt. Ihr braun gesprenkeltes Gefieder bietet eine hervorragende Tarnung im Bodenbewuchs – ein wichtiger Schutz während der Brutzeit.
Birkhühner leben überwiegend am Boden. Ihre Nahrung besteht aus Knospen, Blättern, Beeren, Samen und im Sommer auch aus Insekten. Besonders im Winter sind sie auf bestimmte Pflanzen wie Birken, Weiden oder Zwergsträucher angewiesen. Ihre Lebensräume sind Moore, Heiden, alpine Matten, lichte Wälder und Übergangszonen zwischen Wald und Offenland.
Ein zentrales Element ihres Lebenszyklus ist die Balz. Auf traditionellen Balzplätzen treffen sich die Männchen im Frühjahr, um mit Lauten, Körperhaltung und Bewegung um die Aufmerksamkeit der Weibchen zu werben. Diese Plätze werden über viele Jahre genutzt und sind von entscheidender Bedeutung für den Fortbestand der Art.
Perspektive des Birkhuhns im Wandel von Lebensraum und Klima
Das Birkhuhn ist ein sensibler Indikator für den Zustand seiner Umwelt. Dort, wo es verschwindet, haben sich Landschaften grundlegend verändert. Die Ursachen liegen vor allem im Verlust geeigneter Lebensräume. Moore wurden entwässert, offene Flächen verbuscht oder intensiv genutzt, lichte Wälder wurden dichter, homogener und artenärmer.
Hinzu kommen zunehmende Störungen durch Freizeitaktivitäten. Wintersport, Wanderwege, Tourismus und ganzjährige Nutzung ehemals ruhiger Gebiete führen dazu, dass Rückzugsräume schrumpfen. Besonders im Winter, wenn Energie lebenswichtig ist, können Störungen für Birkhühner existenzbedrohend sein.
Der Klimawandel verstärkt diese Entwicklungen. Steigende Temperaturen verändern die Vegetation in Hochlagen, die Schneezeiten werden kürzer, Übergänge zwischen Jahreszeiten verschieben sich. Das Birkhuhn ist an kalte Winter und strukturreiche Landschaften angepasst. Wenn diese Bedingungen verschwinden, gerät sein fein abgestimmter Lebensrhythmus aus dem Gleichgewicht.
Langfristig steht das Birkhuhn vor der Herausforderung, sich in einer Landschaft zu behaupten, die immer weniger Platz für spezialisierte Arten bietet. Sein Überleben hängt davon ab, ob es gelingt, Lebensräume zu vernetzen, Störungen zu reduzieren und natürliche Prozesse wieder zuzulassen. Der Schutz des Birkhuhns ist damit immer auch ein Schutz für Moore, Berglandschaften und offene Waldstrukturen – und für die biologische Vielfalt insgesamt.
In der Aufnahme von Werner Oppermann
- Birkhühner
Artenschutz in Franken®
Westliche Honigbiene (Apis mellifera)

Die Westliche Honigbiene (Apis mellifera)
29/30.01.2026
Die Morgensonne liegt noch flach über der Wiese, als sich eine einzelne Honigbiene aus dem Dunkel des Bienenstocks löst. Zum ersten Mal verlässt sie den schützenden Raum, in dem sie geschlüpft ist. Zögernd, dann immer sicherer, zieht sie ihre Kreise in der Luft. Der Duft von Blüten weist ihr den Weg. Was für sie ein alltäglicher Flug ist, steht sinnbildlich für ein fein abgestimmtes Zusammenspiel zwischen Insekt, Pflanze und Landschaft – ein Zusammenspiel, das zunehmend aus dem Gleichgewicht gerät.
29/30.01.2026
- Eine kurze Geschichte vom ersten Flug
Die Morgensonne liegt noch flach über der Wiese, als sich eine einzelne Honigbiene aus dem Dunkel des Bienenstocks löst. Zum ersten Mal verlässt sie den schützenden Raum, in dem sie geschlüpft ist. Zögernd, dann immer sicherer, zieht sie ihre Kreise in der Luft. Der Duft von Blüten weist ihr den Weg. Was für sie ein alltäglicher Flug ist, steht sinnbildlich für ein fein abgestimmtes Zusammenspiel zwischen Insekt, Pflanze und Landschaft – ein Zusammenspiel, das zunehmend aus dem Gleichgewicht gerät.
Artbeschreibung
Die Westliche Honigbiene (Apis mellifera) gehört zur Ordnung der Hautflügler (Hymenoptera) und zur Familie der Echten Bienen (Apidae). Sie ist eine staatenbildende Insektenart und lebt in komplex organisierten Völkern, die aus einer Königin, mehreren tausend Arbeiterinnen und – je nach Jahreszeit – Drohnen bestehen.
Honigbienen zeichnen sich durch ihren behaarten Körper, die deutlich ausgeprägten Sammelstrukturen an den Hinterbeinen und ihre ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit aus. Über den sogenannten Schwänzeltanz teilen sie ihren Artgenossinnen Informationen über Nahrungsquellen mit. Ihre Ernährung besteht überwiegend aus Nektar und Pollen, aus denen sie Honig herstellen – eine wichtige Energiequelle für das Volk.
Apis mellifera ist ursprünglich in Europa, Afrika und Teilen Westasiens heimisch und wurde durch den Menschen weltweit verbreitet. Neben ihrer Bedeutung als Honiglieferant ist sie vor allem als Bestäuberin von zentraler ökologischer und wirtschaftlicher Relevanz.
Lebensraumveränderung und Klimawandel – eine unsichere Zukunft
Die Lebensbedingungen der Westlichen Honigbiene haben sich in den vergangenen Jahrzehnten deutlich verändert. Strukturreiche Landschaften, vielfältige Blühangebote und kontinuierliche Nahrungsquellen sind vielerorts zurückgegangen. Intensiv genutzte Agrarflächen, der Verlust von Wiesen, Hecken und Feldrainen sowie monotone Anbauformen schränken das Nahrungsangebot stark ein.
Der Klimawandel verstärkt diese Problematik zusätzlich. Frühere Blühzeiten, längere Trockenphasen und extreme Wetterereignisse bringen den fein abgestimmten Jahresrhythmus der Honigbienen durcheinander. Wenn Pflanzen bereits verblüht sind, bevor ein Volk seine volle Sammelstärke erreicht, entstehen Versorgungslücken. Hitzeperioden belasten die Völker, während milde Winter den natürlichen Ruhephasen entgegenwirken.
Hinzu kommen Krankheiten, Parasiten und ein insgesamt steigender Stresslevel für die Tiere. Auch wenn die Westliche Honigbiene durch menschliche Betreuung vergleichsweise präsent ist, gilt sie zunehmend als Indikatorart für den Zustand unserer Kulturlandschaft. Ihre Entwicklung spiegelt wider, wie stark ökologische Zusammenhänge unter Druck geraten sind.
Der langfristige Erhalt der Art ist daher untrennbar mit einer vielfältigen, klimaresilienten und naturnahen Landschaft verbunden. Der Schutz von Blühflächen, eine angepasste Landnutzung und ein bewusster Umgang mit natürlichen Ressourcen kommen nicht nur der Honigbiene zugute, sondern dem gesamten Ökosystem.
In der Aufnahme von Dieter Zinßer
Die Westliche Honigbiene (Apis mellifera) gehört zur Ordnung der Hautflügler (Hymenoptera) und zur Familie der Echten Bienen (Apidae). Sie ist eine staatenbildende Insektenart und lebt in komplex organisierten Völkern, die aus einer Königin, mehreren tausend Arbeiterinnen und – je nach Jahreszeit – Drohnen bestehen.
Honigbienen zeichnen sich durch ihren behaarten Körper, die deutlich ausgeprägten Sammelstrukturen an den Hinterbeinen und ihre ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit aus. Über den sogenannten Schwänzeltanz teilen sie ihren Artgenossinnen Informationen über Nahrungsquellen mit. Ihre Ernährung besteht überwiegend aus Nektar und Pollen, aus denen sie Honig herstellen – eine wichtige Energiequelle für das Volk.
Apis mellifera ist ursprünglich in Europa, Afrika und Teilen Westasiens heimisch und wurde durch den Menschen weltweit verbreitet. Neben ihrer Bedeutung als Honiglieferant ist sie vor allem als Bestäuberin von zentraler ökologischer und wirtschaftlicher Relevanz.
Lebensraumveränderung und Klimawandel – eine unsichere Zukunft
Die Lebensbedingungen der Westlichen Honigbiene haben sich in den vergangenen Jahrzehnten deutlich verändert. Strukturreiche Landschaften, vielfältige Blühangebote und kontinuierliche Nahrungsquellen sind vielerorts zurückgegangen. Intensiv genutzte Agrarflächen, der Verlust von Wiesen, Hecken und Feldrainen sowie monotone Anbauformen schränken das Nahrungsangebot stark ein.
Der Klimawandel verstärkt diese Problematik zusätzlich. Frühere Blühzeiten, längere Trockenphasen und extreme Wetterereignisse bringen den fein abgestimmten Jahresrhythmus der Honigbienen durcheinander. Wenn Pflanzen bereits verblüht sind, bevor ein Volk seine volle Sammelstärke erreicht, entstehen Versorgungslücken. Hitzeperioden belasten die Völker, während milde Winter den natürlichen Ruhephasen entgegenwirken.
Hinzu kommen Krankheiten, Parasiten und ein insgesamt steigender Stresslevel für die Tiere. Auch wenn die Westliche Honigbiene durch menschliche Betreuung vergleichsweise präsent ist, gilt sie zunehmend als Indikatorart für den Zustand unserer Kulturlandschaft. Ihre Entwicklung spiegelt wider, wie stark ökologische Zusammenhänge unter Druck geraten sind.
Der langfristige Erhalt der Art ist daher untrennbar mit einer vielfältigen, klimaresilienten und naturnahen Landschaft verbunden. Der Schutz von Blühflächen, eine angepasste Landnutzung und ein bewusster Umgang mit natürlichen Ressourcen kommen nicht nur der Honigbiene zugute, sondern dem gesamten Ökosystem.
In der Aufnahme von Dieter Zinßer
- Biene auf violetter Aster
Artenschutz in Franken®
Bäume – Facetten einer stillen Präsenz

Bäume – Facetten einer stillen Präsenz
29/30.01.2026
Bäume begleiten den Menschen seit jeher. Sie prägen Landschaften, strukturieren Räume und verändern sich mit den Jahreszeiten. In dieser Diashow rücken Bäume in ihren unterschiedlichen Facetten in den Mittelpunkt – als Einzelerscheinung, als Teil eines Waldes und als prägendes Element in natürlichen wie auch gestalteten Umgebungen.
Die gezeigten Bilder widmen sich der Vielfalt der Formen und Strukturen. Mächtige Stämme, feine Zweige, ausladende Kronen und detailreiche Rinden erzählen von Wachstum, Anpassung und Zeit. Licht und Schatten verändern die Wirkung der Bäume immer wieder neu und lassen bekannte Motive in unterschiedlichen Stimmungen erscheinen.
29/30.01.2026
- Eine Diashow über Vielfalt, Form und Zeit
Bäume begleiten den Menschen seit jeher. Sie prägen Landschaften, strukturieren Räume und verändern sich mit den Jahreszeiten. In dieser Diashow rücken Bäume in ihren unterschiedlichen Facetten in den Mittelpunkt – als Einzelerscheinung, als Teil eines Waldes und als prägendes Element in natürlichen wie auch gestalteten Umgebungen.
Die gezeigten Bilder widmen sich der Vielfalt der Formen und Strukturen. Mächtige Stämme, feine Zweige, ausladende Kronen und detailreiche Rinden erzählen von Wachstum, Anpassung und Zeit. Licht und Schatten verändern die Wirkung der Bäume immer wieder neu und lassen bekannte Motive in unterschiedlichen Stimmungen erscheinen.
Ein weiterer Fokus liegt auf den jahreszeitlichen Veränderungen. Knospen, frisches Laub, volle Kronen und kahle Äste zeigen den Kreislauf des Werdens und Vergehens. Jede Phase hat ihren eigenen Charakter und macht deutlich, wie wandelbar und zugleich beständig Bäume sind.
Die Diashow betrachtet Bäume aus verschiedenen Perspektiven.
Nahaufnahmen lenken den Blick auf Details, während weite Einstellungen ihre Bedeutung im Raum sichtbar machen. So entsteht ein vielschichtiges Bild, das sowohl Ruhe als auch Dynamik vermittelt.
Ziel der Bilderserie ist es, die Aufmerksamkeit auf die oft selbstverständliche Präsenz von Bäumen zu lenken. Sie lädt dazu ein, genauer hinzusehen und die Vielfalt wahrzunehmen, die in jedem einzelnen Baum steckt. Die Diashow versteht sich als visuelle Annäherung an ein Thema, das Natur, Zeit und Umgebung miteinander verbindet.
In der Aufnahme von Dieter Zinßer
Die Diashow betrachtet Bäume aus verschiedenen Perspektiven.
Nahaufnahmen lenken den Blick auf Details, während weite Einstellungen ihre Bedeutung im Raum sichtbar machen. So entsteht ein vielschichtiges Bild, das sowohl Ruhe als auch Dynamik vermittelt.
Ziel der Bilderserie ist es, die Aufmerksamkeit auf die oft selbstverständliche Präsenz von Bäumen zu lenken. Sie lädt dazu ein, genauer hinzusehen und die Vielfalt wahrzunehmen, die in jedem einzelnen Baum steckt. Die Diashow versteht sich als visuelle Annäherung an ein Thema, das Natur, Zeit und Umgebung miteinander verbindet.
In der Aufnahme von Dieter Zinßer
- Baum Impressionen
Artenschutz in Franken®
Hecken und Feldgehölze – grüne Lebensadern unserer Landschaft

Hecken und Feldgehölze – grüne Lebensadern unserer Landschaft
28/29.01.2026
Als verbindende Elemente zwischen verschiedenen Lebensräumen sind sie unverzichtbar für den Erhalt der biologischen Vielfalt.
Hotspots der Artenvielfalt
In Hecken und Feldgehölzen finden zahlreiche Tier- und Pflanzenarten Nahrung, Schutz und Fortpflanzungsmöglichkeiten. Vögel nutzen sie als Brut- und Rastplätze, Säugetiere wie Igel oder Haselmäuse als Rückzugsraum, während Insekten – darunter Wildbienen, Schmetterlinge und Käfer – auf das vielfältige Blüten- und Strukturangebot angewiesen sind. Auch viele Pflanzenarten, Moose und Flechten profitieren von den unterschiedlichen Licht-, Feuchte- und Bodenverhältnissen.
28/29.01.2026
- Hecken und Feldgehölze gehören zu den artenreichsten Strukturen unserer Kulturlandschaft. Sie prägen seit Jahrhunderten Felder, Wiesen und Wege und erfüllen dabei eine Vielzahl ökologischer Funktionen.
Als verbindende Elemente zwischen verschiedenen Lebensräumen sind sie unverzichtbar für den Erhalt der biologischen Vielfalt.
Hotspots der Artenvielfalt
In Hecken und Feldgehölzen finden zahlreiche Tier- und Pflanzenarten Nahrung, Schutz und Fortpflanzungsmöglichkeiten. Vögel nutzen sie als Brut- und Rastplätze, Säugetiere wie Igel oder Haselmäuse als Rückzugsraum, während Insekten – darunter Wildbienen, Schmetterlinge und Käfer – auf das vielfältige Blüten- und Strukturangebot angewiesen sind. Auch viele Pflanzenarten, Moose und Flechten profitieren von den unterschiedlichen Licht-, Feuchte- und Bodenverhältnissen.
Darüber hinaus wirken Hecken als Wanderkorridore, die es Arten ermöglichen, zwischen einzelnen Lebensräumen zu wechseln. Gerade in einer zunehmend zerschnittenen Landschaft sind diese Verbindungen von entscheidender Bedeutung.
Akute Gefährdung wertvoller Strukturen
Trotz ihres hohen ökologischen Wertes sind Hecken und Feldgehölze heute stark gefährdet. In den vergangenen Jahrzehnten gingen große Teile dieser Strukturen verloren oder wurden stark beeinträchtigt. Ursachen dafür sind vor allem die Intensivierung der Landwirtschaft, Flurbereinigung, Flächenversiegelung sowie der Ausbau von Verkehrs- und Siedlungsflächen.
Auch eine unsachgemäße oder zu häufige Pflege stellt ein Problem dar. Radikale Rückschnitte, das Entfernen von Alt- und Totholz oder das Schneiden während der Brutzeit zerstören wichtige Lebensräume. Hinzu kommt der Eintrag von Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln aus angrenzenden Flächen, der die Artenzusammensetzung nachhaltig verändert.
Auswirkungen des Klimawandels
Der Klimawandel stellt Hecken und Feldgehölze vor zusätzliche Herausforderungen. Längere Trockenperioden, steigende Temperaturen und zunehmende Wetterextreme setzen vor allem jungen Gehölzen und flach wurzelnden Arten zu. Die Artenzusammensetzung kann sich verschieben, während empfindliche Strauch- und Baumarten zurückgedrängt werden.
Gleichzeitig verlieren Hecken ihre wichtige Funktion als Klimapuffer, wenn sie geschwächt oder ausgedünnt werden. Intakte Gehölzstrukturen tragen zur Kühlung der Landschaft bei, speichern Kohlenstoff, schützen Böden vor Erosion und mindern die Auswirkungen von Starkregen.
Wie Hecken und Feldgehölze nachhaltig gesichert werden können
Der langfristige Erhalt dieser wertvollen Lebensräume erfordert gemeinsames Handeln. Wichtig sind der Schutz bestehender Hecken, eine fachgerechte und zeitlich angepasste Pflege sowie die Neuanlage strukturreicher Gehölze mit standortheimischen Arten. Breite Hecken mit unterschiedlichen Höhen, Alt- und Totholzanteilen sowie Krautsäumen bieten besonders vielen Arten einen Lebensraum.
Auch jede und jeder Einzelne kann einen Beitrag leisten: durch die Unterstützung von Naturschutzprojekten, das Anlegen heimischer Hecken im eigenen Umfeld, eine naturnahe Gartengestaltung oder durch Bewusstsein und Rücksicht im Umgang mit der Landschaft.
Hecken und Feldgehölze sind weit mehr als landschaftliche Elemente – sie sind lebenswichtige Rückzugsräume, Klimaschützer und Vernetzer der Natur. Ihr Schutz ist ein zentraler Baustein für den Erhalt der Artenvielfalt und eine lebenswerte Landschaft für kommende Generationen.
In der Aufnahme von Johannes Rother
Akute Gefährdung wertvoller Strukturen
Trotz ihres hohen ökologischen Wertes sind Hecken und Feldgehölze heute stark gefährdet. In den vergangenen Jahrzehnten gingen große Teile dieser Strukturen verloren oder wurden stark beeinträchtigt. Ursachen dafür sind vor allem die Intensivierung der Landwirtschaft, Flurbereinigung, Flächenversiegelung sowie der Ausbau von Verkehrs- und Siedlungsflächen.
Auch eine unsachgemäße oder zu häufige Pflege stellt ein Problem dar. Radikale Rückschnitte, das Entfernen von Alt- und Totholz oder das Schneiden während der Brutzeit zerstören wichtige Lebensräume. Hinzu kommt der Eintrag von Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln aus angrenzenden Flächen, der die Artenzusammensetzung nachhaltig verändert.
Auswirkungen des Klimawandels
Der Klimawandel stellt Hecken und Feldgehölze vor zusätzliche Herausforderungen. Längere Trockenperioden, steigende Temperaturen und zunehmende Wetterextreme setzen vor allem jungen Gehölzen und flach wurzelnden Arten zu. Die Artenzusammensetzung kann sich verschieben, während empfindliche Strauch- und Baumarten zurückgedrängt werden.
Gleichzeitig verlieren Hecken ihre wichtige Funktion als Klimapuffer, wenn sie geschwächt oder ausgedünnt werden. Intakte Gehölzstrukturen tragen zur Kühlung der Landschaft bei, speichern Kohlenstoff, schützen Böden vor Erosion und mindern die Auswirkungen von Starkregen.
Wie Hecken und Feldgehölze nachhaltig gesichert werden können
Der langfristige Erhalt dieser wertvollen Lebensräume erfordert gemeinsames Handeln. Wichtig sind der Schutz bestehender Hecken, eine fachgerechte und zeitlich angepasste Pflege sowie die Neuanlage strukturreicher Gehölze mit standortheimischen Arten. Breite Hecken mit unterschiedlichen Höhen, Alt- und Totholzanteilen sowie Krautsäumen bieten besonders vielen Arten einen Lebensraum.
Auch jede und jeder Einzelne kann einen Beitrag leisten: durch die Unterstützung von Naturschutzprojekten, das Anlegen heimischer Hecken im eigenen Umfeld, eine naturnahe Gartengestaltung oder durch Bewusstsein und Rücksicht im Umgang mit der Landschaft.
Hecken und Feldgehölze sind weit mehr als landschaftliche Elemente – sie sind lebenswichtige Rückzugsräume, Klimaschützer und Vernetzer der Natur. Ihr Schutz ist ein zentraler Baustein für den Erhalt der Artenvielfalt und eine lebenswerte Landschaft für kommende Generationen.
In der Aufnahme von Johannes Rother
- Neuntöter im Regen
Artenschutz in Franken®
Blätter – Zweige – Regentropfen

Blätter – Zweige – Regentropfen
28/29.01.2026
Manchmal sind es die kleinen Dinge, die eine besondere Wirkung entfalten. Ein einzelnes Blatt, ein feiner Zweig, ein Regentropfen, der kurz innehält, bevor er fällt. In dieser Diashow rücken solche unscheinbaren Details in den Mittelpunkt und machen sichtbar, was im Alltag leicht übersehen wird.
Die gezeigten Bilder fangen Momentaufnahmen aus der Natur ein, in denen Formen, Strukturen und Licht eine zentrale Rolle spielen. Blätter zeigen ihre Maserungen, Zweige zeichnen feine Linien in den Raum, und Regentropfen verbinden beide zu flüchtigen Augenblicken. Dabei entsteht ein Wechselspiel aus Ruhe und Bewegung, aus Nähe und Distanz.
28/29.01.2026
- Eine Diashow stiller Naturmomente
Manchmal sind es die kleinen Dinge, die eine besondere Wirkung entfalten. Ein einzelnes Blatt, ein feiner Zweig, ein Regentropfen, der kurz innehält, bevor er fällt. In dieser Diashow rücken solche unscheinbaren Details in den Mittelpunkt und machen sichtbar, was im Alltag leicht übersehen wird.
Die gezeigten Bilder fangen Momentaufnahmen aus der Natur ein, in denen Formen, Strukturen und Licht eine zentrale Rolle spielen. Blätter zeigen ihre Maserungen, Zweige zeichnen feine Linien in den Raum, und Regentropfen verbinden beide zu flüchtigen Augenblicken. Dabei entsteht ein Wechselspiel aus Ruhe und Bewegung, aus Nähe und Distanz.
Regentropfen verändern die Wahrnehmung der Umgebung.
Sie legen sich auf Oberflächen, bündeln Licht und lassen Farben intensiver erscheinen. Auf Blättern sammeln sie sich in kleinen Perlen, an Zweigen folgen sie natürlichen Linien. Jeder Tropfen erzählt von Vergänglichkeit und von dem ständigen Wandel in der Natur.
Die Diashow versteht sich als Einladung zum bewussten Hinschauen. Sie zeigt keine spektakulären Szenen, sondern konzentriert sich auf einfache Motive, die durch ihre Reduktion wirken. Durch die Abfolge der Bilder entsteht ein ruhiger Rhythmus, der Zeit lässt für Beobachtung und eigene Gedanken.
Blätter, Zweige und Regentropfen bilden dabei ein gemeinsames Thema: Sie stehen für Verbindung, Wachstum und Veränderung. In ihrer Kombination zeigen sie, wie eng einzelne Elemente der Natur miteinander verknüpft sind. Die Diashow macht diese Zusammenhänge sichtbar und eröffnet neue Perspektiven auf vertraute Motive.
Ob als kurze Auszeit oder als bewusster Rundgang durch natürliche Details – diese Bilderserie lädt dazu ein, den Blick zu verlangsamen und die leisen Eindrücke der Natur wahrzunehmen.
In der Aufnahme von Dieter Zinßer
Sie legen sich auf Oberflächen, bündeln Licht und lassen Farben intensiver erscheinen. Auf Blättern sammeln sie sich in kleinen Perlen, an Zweigen folgen sie natürlichen Linien. Jeder Tropfen erzählt von Vergänglichkeit und von dem ständigen Wandel in der Natur.
Die Diashow versteht sich als Einladung zum bewussten Hinschauen. Sie zeigt keine spektakulären Szenen, sondern konzentriert sich auf einfache Motive, die durch ihre Reduktion wirken. Durch die Abfolge der Bilder entsteht ein ruhiger Rhythmus, der Zeit lässt für Beobachtung und eigene Gedanken.
Blätter, Zweige und Regentropfen bilden dabei ein gemeinsames Thema: Sie stehen für Verbindung, Wachstum und Veränderung. In ihrer Kombination zeigen sie, wie eng einzelne Elemente der Natur miteinander verknüpft sind. Die Diashow macht diese Zusammenhänge sichtbar und eröffnet neue Perspektiven auf vertraute Motive.
Ob als kurze Auszeit oder als bewusster Rundgang durch natürliche Details – diese Bilderserie lädt dazu ein, den Blick zu verlangsamen und die leisen Eindrücke der Natur wahrzunehmen.
In der Aufnahme von Dieter Zinßer
- Grünes Blatt im Sonnenlicht mit vielen Wasserperlen
Artenschutz in Franken®
Aurorafalter (Anthocharis cardamines)

Der Aurorafalter (Anthocharis cardamines)
28/29.01.2026
An einem kühlen Frühlingsmorgen, wenn der Tau noch auf den Wiesen liegt und die Sonne vorsichtig über den Horizont steigt, flattert ein kleiner Schmetterling über die ersten blühenden Pflanzen. Seine weißen Flügel leuchten im Licht, durchzogen von auffälligen orangefarbenen Spitzen.
Für einen kurzen Augenblick scheint er stillzustehen, als wolle er prüfen, ob der Winter wirklich vorbei ist. Es ist der Aurorafalter – ein Bote des Frühlings, der jedes Jahr neu zeigt, dass das Leben zurückkehrt.
28/29.01.2026
- Ein Frühlingsmoment
An einem kühlen Frühlingsmorgen, wenn der Tau noch auf den Wiesen liegt und die Sonne vorsichtig über den Horizont steigt, flattert ein kleiner Schmetterling über die ersten blühenden Pflanzen. Seine weißen Flügel leuchten im Licht, durchzogen von auffälligen orangefarbenen Spitzen.
Für einen kurzen Augenblick scheint er stillzustehen, als wolle er prüfen, ob der Winter wirklich vorbei ist. Es ist der Aurorafalter – ein Bote des Frühlings, der jedes Jahr neu zeigt, dass das Leben zurückkehrt.
Artbeschreibung
Der Aurorafalter (Anthocharis cardamines) gehört zur Familie der Weißlinge (Pieridae) und ist in weiten Teilen Europas verbreitet. Besonders auffällig sind die Männchen mit ihren leuchtend orange gefärbten Flügelspitzen, die an einen Sonnenaufgang erinnern. Die Weibchen sind schlichter gefärbt und besitzen überwiegend weiße Flügel mit dunklen Zeichnungen. Beide Geschlechter zeigen auf der Flügelunterseite ein marmoriertes Grün-Weiß-Muster, das ihnen eine hervorragende Tarnung in der Vegetation bietet.
Der Aurorafalter bevorzugt halboffene Landschaften wie feuchte Wiesen, Waldränder, Bachufer und naturnahe Gärten. Seine Raupen ernähren sich hauptsächlich von Kreuzblütlern wie Wiesenschaumkraut oder Knoblauchsrauke. Die Art bildet in der Regel nur eine Generation pro Jahr aus und überwintert als Puppe, gut verborgen in der Vegetation.
Perspektive im Wandel von Lebensraum und Klima
Die Zukunft des Aurorafalters ist eng mit dem Zustand seiner Lebensräume verknüpft. Durch intensive Landwirtschaft, den Rückgang artenreicher Wiesen und die zunehmende Versiegelung von Flächen gehen wichtige Nahrungs- und Entwicklungsräume verloren. Besonders problematisch ist das Verschwinden der spezifischen Futterpflanzen, auf die die Raupen angewiesen sind.
Der Klimawandel stellt eine zusätzliche Herausforderung dar. Frühere Frühlinge können dazu führen, dass Falter schlüpfen, bevor ausreichend Nahrungspflanzen verfügbar sind. Gleichzeitig können extreme Wetterereignisse wie lange Trockenperioden oder Starkregen die empfindlichen Entwicklungsstadien beeinträchtigen. Dennoch zeigt der Aurorafalter auch eine gewisse Anpassungsfähigkeit, indem er neue Lebensräume erschließt, wenn geeignete Bedingungen vorhanden sind.
Der Schutz strukturreicher Landschaften, der Erhalt heimischer Blühpflanzen und eine naturnahe Gestaltung von Grünflächen können dazu beitragen, dem Aurorafalter auch in Zukunft einen Platz in unserer Umwelt zu sichern. So bleibt er weiterhin ein leuchtendes Zeichen des Frühlings und ein Indikator für die Gesundheit unserer Landschaften.
In der Aufnahme von Dieter Zinßer
Der Aurorafalter (Anthocharis cardamines) gehört zur Familie der Weißlinge (Pieridae) und ist in weiten Teilen Europas verbreitet. Besonders auffällig sind die Männchen mit ihren leuchtend orange gefärbten Flügelspitzen, die an einen Sonnenaufgang erinnern. Die Weibchen sind schlichter gefärbt und besitzen überwiegend weiße Flügel mit dunklen Zeichnungen. Beide Geschlechter zeigen auf der Flügelunterseite ein marmoriertes Grün-Weiß-Muster, das ihnen eine hervorragende Tarnung in der Vegetation bietet.
Der Aurorafalter bevorzugt halboffene Landschaften wie feuchte Wiesen, Waldränder, Bachufer und naturnahe Gärten. Seine Raupen ernähren sich hauptsächlich von Kreuzblütlern wie Wiesenschaumkraut oder Knoblauchsrauke. Die Art bildet in der Regel nur eine Generation pro Jahr aus und überwintert als Puppe, gut verborgen in der Vegetation.
Perspektive im Wandel von Lebensraum und Klima
Die Zukunft des Aurorafalters ist eng mit dem Zustand seiner Lebensräume verknüpft. Durch intensive Landwirtschaft, den Rückgang artenreicher Wiesen und die zunehmende Versiegelung von Flächen gehen wichtige Nahrungs- und Entwicklungsräume verloren. Besonders problematisch ist das Verschwinden der spezifischen Futterpflanzen, auf die die Raupen angewiesen sind.
Der Klimawandel stellt eine zusätzliche Herausforderung dar. Frühere Frühlinge können dazu führen, dass Falter schlüpfen, bevor ausreichend Nahrungspflanzen verfügbar sind. Gleichzeitig können extreme Wetterereignisse wie lange Trockenperioden oder Starkregen die empfindlichen Entwicklungsstadien beeinträchtigen. Dennoch zeigt der Aurorafalter auch eine gewisse Anpassungsfähigkeit, indem er neue Lebensräume erschließt, wenn geeignete Bedingungen vorhanden sind.
Der Schutz strukturreicher Landschaften, der Erhalt heimischer Blühpflanzen und eine naturnahe Gestaltung von Grünflächen können dazu beitragen, dem Aurorafalter auch in Zukunft einen Platz in unserer Umwelt zu sichern. So bleibt er weiterhin ein leuchtendes Zeichen des Frühlings und ein Indikator für die Gesundheit unserer Landschaften.
In der Aufnahme von Dieter Zinßer
- Männlicher Aurorafalter mit leuchtend orangefarbenen Flügelspitzen auf einer Frühlingsblüte
Artenschutz in Franken®
Amphibienwanderung – eine lebenswichtige und gefährliche Reise

Amphibienwanderung – eine lebenswichtige und gefährliche Reise
27/28.01.2026
Frösche, Kröten und Molche verlassen ihre Winterquartiere und machen sich – oft bei Einbruch der Dunkelheit und bei feuchtem Wetter – auf den Weg zu den Gewässern, in denen sie selbst geboren wurden. Diese meist unscheinbare Wanderung ist für den Fortbestand vieler Arten unverzichtbar, stellt die Tiere jedoch vor enorme Herausforderungen.
27/28.01.2026
- In den kommenden Wochen beginnt erneut eines der bedeutendsten Naturereignisse des Jahres: die Massenwanderung heimischer Amphibien zu ihren Laichplätzen.
Frösche, Kröten und Molche verlassen ihre Winterquartiere und machen sich – oft bei Einbruch der Dunkelheit und bei feuchtem Wetter – auf den Weg zu den Gewässern, in denen sie selbst geboren wurden. Diese meist unscheinbare Wanderung ist für den Fortbestand vieler Arten unverzichtbar, stellt die Tiere jedoch vor enorme Herausforderungen.
Gefahren auf dem Weg zu den Laichgewässern
Während ihrer Wanderung sind Amphibien zahlreichen Gefahren ausgesetzt. Eine der größten Bedrohungen ist der Straßenverkehr. Straßen und Wege schneiden traditionelle Wanderrouten und führen jedes Jahr zum Tod unzähliger Tiere. Besonders in warmen, regnerischen Nächten kommt es zu hohen Verlusten, wenn ganze Populationen gleichzeitig unterwegs sind.
Weitere Risiken ergeben sich durch die Zerschneidung und Verarmung der Landschaft. Versiegelte Flächen, Bebauung, intensive Landwirtschaft sowie Entwässerungsgräben oder Bordsteine erschweren oder verhindern das Erreichen der Laichgewässer. Viele Tiere bleiben in ungeeigneten Lebensräumen zurück oder sterben an Erschöpfung und Austrocknung.
Amphibien unter Druck: Klimawandel und Lebensraumverlust
Die ohnehin angespannte Situation wird durch den Klimawandel weiter verschärft. Veränderte Niederschlagsmuster, zunehmende Trockenperioden und steigende Temperaturen wirken sich direkt auf Amphibien aus, die auf feuchte Lebensräume angewiesen sind. Laichgewässer trocknen früher aus oder entstehen gar nicht mehr, während extreme Wetterereignisse die empfindlichen Entwicklungsstadien von Eiern und Kaulquappen gefährden.
Gleichzeitig geht der Verlust geeigneter Lebensräume ungebremst weiter. Naturnahe Feuchtgebiete, Tümpel, Gräben und Auenlandschaften verschwinden oder werden stark verändert. Auch der Rückgang strukturreicher Landschaften mit Hecken, Wiesen und kleinen Waldflächen nimmt Amphibien wichtige Rückzugs-, Nahrungs- und Überwinterungsräume. Viele Populationen werden dadurch isoliert und langfristig geschwächt.
Die große Bedeutung von Amphibien für das Ökosystem
Amphibien erfüllen eine zentrale Rolle in unseren Ökosystemen. Als Bindeglied zwischen Wasser- und Landlebensräumen sind sie wichtige Bestandteile beider Lebensräume. Sie regulieren Insektenbestände, indem sie große Mengen an Mücken, Fliegen und anderen Wirbellosen fressen, und tragen so zu einem natürlichen Gleichgewicht bei.
Gleichzeitig dienen Amphibien selbst als Nahrungsquelle für zahlreiche Tierarten, darunter Vögel, Säugetiere, Reptilien und Fische. Ihr Rückgang wirkt sich daher auf ganze Nahrungsketten aus. Zudem gelten Amphibien als wichtige Bioindikatoren: Aufgrund ihrer durchlässigen Haut und ihrer komplexen Lebensweise reagieren sie besonders sensibel auf Umweltveränderungen. Ihr Zustand liefert wertvolle Hinweise auf die Qualität von Lebensräumen und den allgemeinen Zustand der Umwelt.
Schutz und Verantwortung
Der Schutz wandernder Amphibien ist daher nicht nur Artenschutz, sondern auch aktiver Naturschutz für ganze Ökosysteme. Temporäre Schutzzäune, Amphibientunnel, die Pflege von Laichgewässern sowie Rücksichtnahme im Straßenverkehr können dazu beitragen, Verluste deutlich zu reduzieren. Ebenso wichtig ist der langfristige Erhalt und die Wiederherstellung geeigneter Lebensräume.
Die Amphibienwanderung macht jedes Jahr aufs Neue sichtbar, wie eng Natur und menschliche Nutzung miteinander verwoben sind – und wie wichtig verantwortungsvolles Handeln ist, um diese faszinierenden und unverzichtbaren Tiere auch für kommende Generationen zu bewahren.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
Während ihrer Wanderung sind Amphibien zahlreichen Gefahren ausgesetzt. Eine der größten Bedrohungen ist der Straßenverkehr. Straßen und Wege schneiden traditionelle Wanderrouten und führen jedes Jahr zum Tod unzähliger Tiere. Besonders in warmen, regnerischen Nächten kommt es zu hohen Verlusten, wenn ganze Populationen gleichzeitig unterwegs sind.
Weitere Risiken ergeben sich durch die Zerschneidung und Verarmung der Landschaft. Versiegelte Flächen, Bebauung, intensive Landwirtschaft sowie Entwässerungsgräben oder Bordsteine erschweren oder verhindern das Erreichen der Laichgewässer. Viele Tiere bleiben in ungeeigneten Lebensräumen zurück oder sterben an Erschöpfung und Austrocknung.
Amphibien unter Druck: Klimawandel und Lebensraumverlust
Die ohnehin angespannte Situation wird durch den Klimawandel weiter verschärft. Veränderte Niederschlagsmuster, zunehmende Trockenperioden und steigende Temperaturen wirken sich direkt auf Amphibien aus, die auf feuchte Lebensräume angewiesen sind. Laichgewässer trocknen früher aus oder entstehen gar nicht mehr, während extreme Wetterereignisse die empfindlichen Entwicklungsstadien von Eiern und Kaulquappen gefährden.
Gleichzeitig geht der Verlust geeigneter Lebensräume ungebremst weiter. Naturnahe Feuchtgebiete, Tümpel, Gräben und Auenlandschaften verschwinden oder werden stark verändert. Auch der Rückgang strukturreicher Landschaften mit Hecken, Wiesen und kleinen Waldflächen nimmt Amphibien wichtige Rückzugs-, Nahrungs- und Überwinterungsräume. Viele Populationen werden dadurch isoliert und langfristig geschwächt.
Die große Bedeutung von Amphibien für das Ökosystem
Amphibien erfüllen eine zentrale Rolle in unseren Ökosystemen. Als Bindeglied zwischen Wasser- und Landlebensräumen sind sie wichtige Bestandteile beider Lebensräume. Sie regulieren Insektenbestände, indem sie große Mengen an Mücken, Fliegen und anderen Wirbellosen fressen, und tragen so zu einem natürlichen Gleichgewicht bei.
Gleichzeitig dienen Amphibien selbst als Nahrungsquelle für zahlreiche Tierarten, darunter Vögel, Säugetiere, Reptilien und Fische. Ihr Rückgang wirkt sich daher auf ganze Nahrungsketten aus. Zudem gelten Amphibien als wichtige Bioindikatoren: Aufgrund ihrer durchlässigen Haut und ihrer komplexen Lebensweise reagieren sie besonders sensibel auf Umweltveränderungen. Ihr Zustand liefert wertvolle Hinweise auf die Qualität von Lebensräumen und den allgemeinen Zustand der Umwelt.
Schutz und Verantwortung
Der Schutz wandernder Amphibien ist daher nicht nur Artenschutz, sondern auch aktiver Naturschutz für ganze Ökosysteme. Temporäre Schutzzäune, Amphibientunnel, die Pflege von Laichgewässern sowie Rücksichtnahme im Straßenverkehr können dazu beitragen, Verluste deutlich zu reduzieren. Ebenso wichtig ist der langfristige Erhalt und die Wiederherstellung geeigneter Lebensräume.
Die Amphibienwanderung macht jedes Jahr aufs Neue sichtbar, wie eng Natur und menschliche Nutzung miteinander verwoben sind – und wie wichtig verantwortungsvolles Handeln ist, um diese faszinierenden und unverzichtbaren Tiere auch für kommende Generationen zu bewahren.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
- Erdkrötenpaar auf dem Weg zum Laichgewässer
Artenschutz in Franken®
Gemeiner Efeu (Hedera helix)

Der Gemeine Efeu (Hedera helix)
27/28.01.2026
Zunächst unscheinbar, kaum beachtet, tastete er sich vorsichtig über den rauen Untergrund. Jahr für Jahr kam ein weiteres Blatt hinzu, dann noch eines. Während um ihn herum Menschen kamen und gingen, Häuser renoviert und Wege neu gepflastert wurden, blieb der Efeu. Er wuchs langsam, aber stetig, passte sich an, fand Halt in kleinsten Ritzen und verband schließlich Mauer, Boden und Baum zu einem grünen Geflecht. So erzählt der Efeu nicht von Eile, sondern von Beständigkeit.
27/28.01.2026
- An einer alten Steinmauer, die schon viele Winter und Sommer gesehen hat, begann vor langer Zeit ein einzelner Trieb zu wachsen.
Zunächst unscheinbar, kaum beachtet, tastete er sich vorsichtig über den rauen Untergrund. Jahr für Jahr kam ein weiteres Blatt hinzu, dann noch eines. Während um ihn herum Menschen kamen und gingen, Häuser renoviert und Wege neu gepflastert wurden, blieb der Efeu. Er wuchs langsam, aber stetig, passte sich an, fand Halt in kleinsten Ritzen und verband schließlich Mauer, Boden und Baum zu einem grünen Geflecht. So erzählt der Efeu nicht von Eile, sondern von Beständigkeit.
Artbeschreibung
Der Gemeine Efeu, auch Gewöhnlicher Efeu oder kurz Efeu genannt (Hedera helix), ist eine immergrüne Kletterpflanze aus der Familie der Araliengewächse. Er ist in weiten Teilen Europas heimisch und gehört zu den bekanntesten Wildpflanzen unserer Kulturlandschaft. Seine Fähigkeit, Mauern, Bäume und Felsen zu erklimmen, macht ihn unverwechselbar.
Charakteristisch sind seine ledrigen, dunkelgrünen Blätter, die je nach Entwicklungsphase unterschiedlich geformt sind. Während die Jugendform meist gelappte Blätter zeigt, entwickeln ältere, blühfähige Triebe eher ungelappte, eiförmige Blätter. Diese Besonderheit ist ein typisches Merkmal des Efeus.
Der Efeu haftet sich mithilfe kleiner Haftwurzeln an Oberflächen, ohne dabei aktiv in das Material einzudringen. Er ist eine langlebige Pflanze, die mehrere Jahrzehnte alt werden kann. Besonders bemerkenswert ist seine Blütezeit: Der Efeu blüht spät im Jahr, meist im Herbst, und bietet damit eine wichtige Nahrungsquelle für Insekten, wenn andere Pflanzen bereits verblüht sind. Die dunklen Beeren reifen im Frühjahr und dienen verschiedenen Vogelarten als Nahrung.
Lebensraum und ökologische Bedeutung
Der Gemeine Efeu ist äußerst anpassungsfähig. Er wächst in Wäldern, Parks, Gärten, an Gebäuden und auf Friedhöfen. Er bevorzugt schattige bis halbschattige Standorte, kommt jedoch auch mit sonnigeren Lagen zurecht, sofern ausreichend Feuchtigkeit vorhanden ist.
Ökologisch spielt der Efeu eine wichtige Rolle. Er bietet Schutz, Nahrung und Lebensraum für zahlreiche Tierarten. Insekten nutzen seine Blüten, Vögel finden Nistplätze im dichten Blattwerk, und Kleinsäuger profitieren von der Struktur und dem Mikroklima, das der Efeu schafft.
Perspektive im Wandel von Lebensraum und Klima
Durch Veränderungen der Lebensräume und den fortschreitenden Klimawandel steht auch der Gemeine Efeu vor neuen Herausforderungen. Steigende Temperaturen und mildere Winter können seine Ausbreitung begünstigen, insbesondere in städtischen Räumen. Gleichzeitig führen längere Trockenperioden und Extremwetterereignisse dazu, dass der Wasserstress für die Pflanze zunimmt, vor allem an exponierten Standorten.
In Städten könnte der Efeu künftig eine noch größere Rolle spielen. Als immergrüne Pflanze trägt er zur Verbesserung des Mikroklimas bei, bindet Staub und kann Fassaden beschatten. In naturnahen Lebensräumen hingegen hängt seine Zukunft stark davon ab, wie Wälder bewirtschaftet und Grünflächen erhalten werden.
Langfristig zeigt der Gemeine Efeu, wie anpassungsfähig manche Pflanzenarten sind. Seine Fähigkeit, sich neuen Bedingungen anzupassen, macht ihn zu einem stillen Begleiter des Wandels. Gleichzeitig erinnert er daran, wie wichtig vielfältige und stabile Lebensräume sind, damit auch robuste Arten dauerhaft bestehen können.
In der Aufnahme von Dieter Zinßer
Der Gemeine Efeu, auch Gewöhnlicher Efeu oder kurz Efeu genannt (Hedera helix), ist eine immergrüne Kletterpflanze aus der Familie der Araliengewächse. Er ist in weiten Teilen Europas heimisch und gehört zu den bekanntesten Wildpflanzen unserer Kulturlandschaft. Seine Fähigkeit, Mauern, Bäume und Felsen zu erklimmen, macht ihn unverwechselbar.
Charakteristisch sind seine ledrigen, dunkelgrünen Blätter, die je nach Entwicklungsphase unterschiedlich geformt sind. Während die Jugendform meist gelappte Blätter zeigt, entwickeln ältere, blühfähige Triebe eher ungelappte, eiförmige Blätter. Diese Besonderheit ist ein typisches Merkmal des Efeus.
Der Efeu haftet sich mithilfe kleiner Haftwurzeln an Oberflächen, ohne dabei aktiv in das Material einzudringen. Er ist eine langlebige Pflanze, die mehrere Jahrzehnte alt werden kann. Besonders bemerkenswert ist seine Blütezeit: Der Efeu blüht spät im Jahr, meist im Herbst, und bietet damit eine wichtige Nahrungsquelle für Insekten, wenn andere Pflanzen bereits verblüht sind. Die dunklen Beeren reifen im Frühjahr und dienen verschiedenen Vogelarten als Nahrung.
Lebensraum und ökologische Bedeutung
Der Gemeine Efeu ist äußerst anpassungsfähig. Er wächst in Wäldern, Parks, Gärten, an Gebäuden und auf Friedhöfen. Er bevorzugt schattige bis halbschattige Standorte, kommt jedoch auch mit sonnigeren Lagen zurecht, sofern ausreichend Feuchtigkeit vorhanden ist.
Ökologisch spielt der Efeu eine wichtige Rolle. Er bietet Schutz, Nahrung und Lebensraum für zahlreiche Tierarten. Insekten nutzen seine Blüten, Vögel finden Nistplätze im dichten Blattwerk, und Kleinsäuger profitieren von der Struktur und dem Mikroklima, das der Efeu schafft.
Perspektive im Wandel von Lebensraum und Klima
Durch Veränderungen der Lebensräume und den fortschreitenden Klimawandel steht auch der Gemeine Efeu vor neuen Herausforderungen. Steigende Temperaturen und mildere Winter können seine Ausbreitung begünstigen, insbesondere in städtischen Räumen. Gleichzeitig führen längere Trockenperioden und Extremwetterereignisse dazu, dass der Wasserstress für die Pflanze zunimmt, vor allem an exponierten Standorten.
In Städten könnte der Efeu künftig eine noch größere Rolle spielen. Als immergrüne Pflanze trägt er zur Verbesserung des Mikroklimas bei, bindet Staub und kann Fassaden beschatten. In naturnahen Lebensräumen hingegen hängt seine Zukunft stark davon ab, wie Wälder bewirtschaftet und Grünflächen erhalten werden.
Langfristig zeigt der Gemeine Efeu, wie anpassungsfähig manche Pflanzenarten sind. Seine Fähigkeit, sich neuen Bedingungen anzupassen, macht ihn zu einem stillen Begleiter des Wandels. Gleichzeitig erinnert er daran, wie wichtig vielfältige und stabile Lebensräume sind, damit auch robuste Arten dauerhaft bestehen können.
In der Aufnahme von Dieter Zinßer
- Junger Efeu mit alter Kastanie
Artenschutz in Franken®
Acker-Witwenblume (Knautia arvensis)

Die Acker-Witwenblume (Knautia arvensis)
27/28.01.2026
An einem warmen Sommertag, wenn die Felder in der Ferne flimmern und das Gras am Wegesrand leise raschelt, steht sie oft unauffällig zwischen Gräsern und Kräutern: die Acker-Witwenblume. Während Bienen und Schmetterlinge von Blüte zu Blüte ziehen, bietet sie ihnen verlässlich Nahrung.
Generationen von Insekten haben hier Rast gemacht, ohne dass viele Menschen Notiz davon nahmen. Doch gerade diese stille Beständigkeit macht die Acker-Witwenblume zu einem besonderen Bestandteil unserer Kulturlandschaft.
27/28.01.2026
- Eine kleine Geschichte vom Feldrand
An einem warmen Sommertag, wenn die Felder in der Ferne flimmern und das Gras am Wegesrand leise raschelt, steht sie oft unauffällig zwischen Gräsern und Kräutern: die Acker-Witwenblume. Während Bienen und Schmetterlinge von Blüte zu Blüte ziehen, bietet sie ihnen verlässlich Nahrung.
Generationen von Insekten haben hier Rast gemacht, ohne dass viele Menschen Notiz davon nahmen. Doch gerade diese stille Beständigkeit macht die Acker-Witwenblume zu einem besonderen Bestandteil unserer Kulturlandschaft.
Artbeschreibung
Die Acker-Witwenblume (Knautia arvensis) ist eine ausdauernde, krautige Pflanze aus der Familie der Geißblattgewächse. Sie erreicht meist Wuchshöhen zwischen 30 und 80 Zentimetern. Charakteristisch sind ihre hellvioletten bis bläulich-violetten Blütenköpfe, die aus vielen kleinen Einzelblüten bestehen und auf langen, schlanken Stängeln sitzen.
Die Blütezeit erstreckt sich in der Regel von Juni bis in den Herbst. Die tief eingeschnittenen Grundblätter bilden eine Rosette, während die Stängelblätter schmaler und weniger stark gelappt sind. Die Acker-Witwenblume bevorzugt sonnige Standorte mit nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen Böden und ist typisch für Wiesen, Feldraine, Wegränder und extensiv genutztes Grünland.
Ökologisch ist die Art von großer Bedeutung: Sie dient zahlreichen Wildbienen, Schmetterlingen und anderen Insekten als wichtige Nahrungsquelle und trägt damit wesentlich zur Förderung der Artenvielfalt bei.
Perspektiven im Wandel von Lebensraum und Klima
In den letzten Jahrzehnten hat sich der Lebensraum der Acker-Witwenblume deutlich verändert. Intensive Landwirtschaft, häufige Mahd, der Verlust von Feldrainen sowie der steigende Nährstoffeintrag in Böden führen dazu, dass konkurrenzstarke Pflanzen zunehmen und lichtliebende Arten wie die Acker-Witwenblume zunehmend verdrängt werden.
Der Klimawandel bringt zusätzliche Herausforderungen mit sich. Längere Trockenperioden, veränderte Niederschlagsmuster und Extremwetterereignisse beeinflussen Wachstum und Blütezeit. Gleichzeitig besitzt die Acker-Witwenblume eine gewisse Anpassungsfähigkeit: Ihre tiefer reichenden Wurzeln helfen ihr, auch trockene Phasen zu überstehen, sofern geeignete Standorte erhalten bleiben.
Die Zukunft der Acker-Witwenblume hängt daher maßgeblich vom Erhalt und der Förderung strukturreicher, extensiv genutzter Lebensräume ab. Blühstreifen, artenreiche Wiesen und naturnahe Randbereiche können wichtige Rückzugsorte darstellen. Wo ihr Raum gegeben wird, bleibt die Acker-Witwenblume ein fester Bestandteil unserer Landschaft – und ein stiller Verbündeter im Kampf gegen den Rückgang der Insektenvielfalt.
In der Aufnahme von Dieter Zinßer
Die Acker-Witwenblume (Knautia arvensis) ist eine ausdauernde, krautige Pflanze aus der Familie der Geißblattgewächse. Sie erreicht meist Wuchshöhen zwischen 30 und 80 Zentimetern. Charakteristisch sind ihre hellvioletten bis bläulich-violetten Blütenköpfe, die aus vielen kleinen Einzelblüten bestehen und auf langen, schlanken Stängeln sitzen.
Die Blütezeit erstreckt sich in der Regel von Juni bis in den Herbst. Die tief eingeschnittenen Grundblätter bilden eine Rosette, während die Stängelblätter schmaler und weniger stark gelappt sind. Die Acker-Witwenblume bevorzugt sonnige Standorte mit nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen Böden und ist typisch für Wiesen, Feldraine, Wegränder und extensiv genutztes Grünland.
Ökologisch ist die Art von großer Bedeutung: Sie dient zahlreichen Wildbienen, Schmetterlingen und anderen Insekten als wichtige Nahrungsquelle und trägt damit wesentlich zur Förderung der Artenvielfalt bei.
Perspektiven im Wandel von Lebensraum und Klima
In den letzten Jahrzehnten hat sich der Lebensraum der Acker-Witwenblume deutlich verändert. Intensive Landwirtschaft, häufige Mahd, der Verlust von Feldrainen sowie der steigende Nährstoffeintrag in Böden führen dazu, dass konkurrenzstarke Pflanzen zunehmen und lichtliebende Arten wie die Acker-Witwenblume zunehmend verdrängt werden.
Der Klimawandel bringt zusätzliche Herausforderungen mit sich. Längere Trockenperioden, veränderte Niederschlagsmuster und Extremwetterereignisse beeinflussen Wachstum und Blütezeit. Gleichzeitig besitzt die Acker-Witwenblume eine gewisse Anpassungsfähigkeit: Ihre tiefer reichenden Wurzeln helfen ihr, auch trockene Phasen zu überstehen, sofern geeignete Standorte erhalten bleiben.
Die Zukunft der Acker-Witwenblume hängt daher maßgeblich vom Erhalt und der Förderung strukturreicher, extensiv genutzter Lebensräume ab. Blühstreifen, artenreiche Wiesen und naturnahe Randbereiche können wichtige Rückzugsorte darstellen. Wo ihr Raum gegeben wird, bleibt die Acker-Witwenblume ein fester Bestandteil unserer Landschaft – und ein stiller Verbündeter im Kampf gegen den Rückgang der Insektenvielfalt.
In der Aufnahme von Dieter Zinßer
- Blühende Acker-Witwenblume
Artenschutz in Franken®
Impressionen Winter 2026

Impressionen Winter 2026
Der Winter 2026 steht für eine Jahreszeit voller Gegensätze und besonderer Stimmungen.
Wenn die Temperaturen sinken und die Landschaft zur Ruhe kommt, entstehen Momente, die im Alltag oft nur flüchtig wahrgenommen werden. Diese Diashow lädt dazu ein, genau diese Augenblicke festzuhalten und aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten.
- 26/27.01.2026
Der Winter 2026 steht für eine Jahreszeit voller Gegensätze und besonderer Stimmungen.
Wenn die Temperaturen sinken und die Landschaft zur Ruhe kommt, entstehen Momente, die im Alltag oft nur flüchtig wahrgenommen werden. Diese Diashow lädt dazu ein, genau diese Augenblicke festzuhalten und aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten.
Winterliche Szenen zeichnen sich durch ihre Klarheit und Schlichtheit aus.
Schneebedeckte Flächen, vereiste Details und das gedämpfte Licht der kurzen Tage verleihen der Umgebung eine besondere Atmosphäre. Farben wirken zurückhaltender, Formen treten deutlicher hervor und die Natur zeigt sich reduziert, aber zugleich ausdrucksstark. In dieser Reduktion liegt eine eigene Schönheit, die Raum für Ruhe und Konzentration schafft.
Die hier gezeigten Impressionen spiegeln unterschiedliche Facetten des Winters 2026 wider. Mal sind es weite Landschaften, die durch ihre Stille beeindrucken, mal kleine Details, die erst auf den zweiten Blick ihre Wirkung entfalten. Spuren im Schnee, Lichtreflexionen auf Eisflächen oder der Kontrast zwischen Himmel und Boden erzählen von Bewegung, Vergänglichkeit und Beständigkeit zugleich.
Der Winter verändert nicht nur die Natur, sondern auch die Wahrnehmung.
Geräusche werden gedämpft, Abläufe verlangsamen sich, und der Blick richtet sich stärker auf das Wesentliche. Genau diese Wirkung greift die Diashow auf. Sie versteht sich nicht als vollständige Darstellung, sondern als Sammlung von Eindrücken, die Raum für eigene Gedanken und Interpretationen lassen.
Jedes Bild steht für einen Moment, der den Charakter der kalten Jahreszeit widerspiegelt. Zusammen ergeben sie ein Gesamtbild, das den Winter 2026 nicht festlegt, sondern erlebbar macht.
Ob als kurze Pause im Alltag oder als gezielter Rundgang durch winterliche Szenen – die Impressionen bieten unterschiedliche Zugänge und laden dazu ein, den Winter aus neuen Blickwinkeln zu entdecken.
In der Aufnahme von Dieter Zinßer
Schneebedeckte Flächen, vereiste Details und das gedämpfte Licht der kurzen Tage verleihen der Umgebung eine besondere Atmosphäre. Farben wirken zurückhaltender, Formen treten deutlicher hervor und die Natur zeigt sich reduziert, aber zugleich ausdrucksstark. In dieser Reduktion liegt eine eigene Schönheit, die Raum für Ruhe und Konzentration schafft.
Die hier gezeigten Impressionen spiegeln unterschiedliche Facetten des Winters 2026 wider. Mal sind es weite Landschaften, die durch ihre Stille beeindrucken, mal kleine Details, die erst auf den zweiten Blick ihre Wirkung entfalten. Spuren im Schnee, Lichtreflexionen auf Eisflächen oder der Kontrast zwischen Himmel und Boden erzählen von Bewegung, Vergänglichkeit und Beständigkeit zugleich.
Der Winter verändert nicht nur die Natur, sondern auch die Wahrnehmung.
Geräusche werden gedämpft, Abläufe verlangsamen sich, und der Blick richtet sich stärker auf das Wesentliche. Genau diese Wirkung greift die Diashow auf. Sie versteht sich nicht als vollständige Darstellung, sondern als Sammlung von Eindrücken, die Raum für eigene Gedanken und Interpretationen lassen.
Jedes Bild steht für einen Moment, der den Charakter der kalten Jahreszeit widerspiegelt. Zusammen ergeben sie ein Gesamtbild, das den Winter 2026 nicht festlegt, sondern erlebbar macht.
Ob als kurze Pause im Alltag oder als gezielter Rundgang durch winterliche Szenen – die Impressionen bieten unterschiedliche Zugänge und laden dazu ein, den Winter aus neuen Blickwinkeln zu entdecken.
In der Aufnahme von Dieter Zinßer
- Winterimpressionen
Artenschutz in Franken®
Marderhund (Nyctereutes procyonoides)

Der Marderhund (Nyctereutes procyonoides)
26/27.01.2026
Der Nebel liegt tief über der feuchten Wiese, als sich am Rand des Waldes eine gedrungene Gestalt bewegt. Vorsichtig setzt sie Pfote vor Pfote, die Nase dicht über dem Boden. Für einen Moment hält das Tier inne, lauscht, dann verschwindet es lautlos im Unterholz.
Wer dieses nächtliche Schauspiel beobachtet, begegnet einem der unauffälligsten Wildtiere unserer Landschaft: dem Marderhund. Meist bleibt er unbemerkt, doch seine Spuren erzählen von einer stillen Präsenz in Wäldern, Auen und Feldfluren.
26/27.01.2026
- Eine nächtliche Begegnung am Waldrand
Der Nebel liegt tief über der feuchten Wiese, als sich am Rand des Waldes eine gedrungene Gestalt bewegt. Vorsichtig setzt sie Pfote vor Pfote, die Nase dicht über dem Boden. Für einen Moment hält das Tier inne, lauscht, dann verschwindet es lautlos im Unterholz.
Wer dieses nächtliche Schauspiel beobachtet, begegnet einem der unauffälligsten Wildtiere unserer Landschaft: dem Marderhund. Meist bleibt er unbemerkt, doch seine Spuren erzählen von einer stillen Präsenz in Wäldern, Auen und Feldfluren.
Artbeschreibung: Der Marderhund (Nyctereutes procyonoides)
Der Marderhund (Nyctereutes procyonoides) gehört zur Familie der Hunde (Canidae) und ist damit näher mit Fuchs und Wolf verwandt als mit Mardern. Sein Name leitet sich von seinem gedrungenen Körperbau und der maskenartigen Gesichtszeichnung ab, die an einen Waschbären erinnert.
Er erreicht eine Kopf-Rumpf-Länge von etwa 50 bis 70 Zentimetern und besitzt einen buschigen Schwanz. Das Fell ist dicht und meist graubraun gefärbt, was ihn gut tarnt. Charakteristisch sind die kurzen Beine und die dunklen Augenflecken.
Marderhunde sind überwiegend dämmerungs- und nachtaktiv. Sie gelten als opportunistische Allesfresser und nehmen je nach Jahreszeit Kleinsäuger, Amphibien, Insekten, Aas sowie pflanzliche Nahrung wie Beeren oder Früchte auf. Bevorzugt leben sie in feuchten, strukturreichen Lebensräumen wie Auen, Bruchwäldern, Mooren und Gewässernähe, nutzen aber auch landwirtschaftlich geprägte Landschaften.
Perspektive im Wandel von Lebensraum und Klima
Infolge von Lebensraumveränderungen hat sich der Marderhund in den letzten Jahrzehnten in vielen Regionen Europas etabliert. Die Umgestaltung von Landschaften, Entwässerung von Feuchtgebieten und zunehmende Fragmentierung natürlicher Lebensräume verändern jedoch seine Lebensbedingungen. Gleichzeitig profitiert die Art teilweise von strukturreichen Kulturlandschaften und milden Wintern.
Der Klimawandel beeinflusst den Marderhund auf unterschiedliche Weise. Mildere Winter begünstigen seine Überlebenschancen, da er in kalten Regionen normalerweise eine Winterruhe hält. Gleichzeitig können veränderte Niederschlagsmuster und der Rückgang feuchter Lebensräume seine bevorzugten Habitate einschränken.
Langfristig wird die Zukunft des Marderhundes davon abhängen, wie Landschaften genutzt und vernetzt werden. Naturnahe Gewässerräume, Rückzugsflächen und eine vielfältige Umgebung tragen dazu bei, ökologische Gleichgewichte zu erhalten. Der Marderhund bleibt damit ein Beispiel für die Anpassungsfähigkeit von Wildtieren – aber auch für die komplexen Folgen menschlicher Eingriffe in natürliche Systeme.
In der Aufnahme von Johannes Rother
Der Marderhund (Nyctereutes procyonoides) gehört zur Familie der Hunde (Canidae) und ist damit näher mit Fuchs und Wolf verwandt als mit Mardern. Sein Name leitet sich von seinem gedrungenen Körperbau und der maskenartigen Gesichtszeichnung ab, die an einen Waschbären erinnert.
Er erreicht eine Kopf-Rumpf-Länge von etwa 50 bis 70 Zentimetern und besitzt einen buschigen Schwanz. Das Fell ist dicht und meist graubraun gefärbt, was ihn gut tarnt. Charakteristisch sind die kurzen Beine und die dunklen Augenflecken.
Marderhunde sind überwiegend dämmerungs- und nachtaktiv. Sie gelten als opportunistische Allesfresser und nehmen je nach Jahreszeit Kleinsäuger, Amphibien, Insekten, Aas sowie pflanzliche Nahrung wie Beeren oder Früchte auf. Bevorzugt leben sie in feuchten, strukturreichen Lebensräumen wie Auen, Bruchwäldern, Mooren und Gewässernähe, nutzen aber auch landwirtschaftlich geprägte Landschaften.
Perspektive im Wandel von Lebensraum und Klima
Infolge von Lebensraumveränderungen hat sich der Marderhund in den letzten Jahrzehnten in vielen Regionen Europas etabliert. Die Umgestaltung von Landschaften, Entwässerung von Feuchtgebieten und zunehmende Fragmentierung natürlicher Lebensräume verändern jedoch seine Lebensbedingungen. Gleichzeitig profitiert die Art teilweise von strukturreichen Kulturlandschaften und milden Wintern.
Der Klimawandel beeinflusst den Marderhund auf unterschiedliche Weise. Mildere Winter begünstigen seine Überlebenschancen, da er in kalten Regionen normalerweise eine Winterruhe hält. Gleichzeitig können veränderte Niederschlagsmuster und der Rückgang feuchter Lebensräume seine bevorzugten Habitate einschränken.
Langfristig wird die Zukunft des Marderhundes davon abhängen, wie Landschaften genutzt und vernetzt werden. Naturnahe Gewässerräume, Rückzugsflächen und eine vielfältige Umgebung tragen dazu bei, ökologische Gleichgewichte zu erhalten. Der Marderhund bleibt damit ein Beispiel für die Anpassungsfähigkeit von Wildtieren – aber auch für die komplexen Folgen menschlicher Eingriffe in natürliche Systeme.
In der Aufnahme von Johannes Rother
- Marderhund - Einwanderer mit Ausbreitungstendenzen
Artenschutz in Franken®
Artenschutz in Franken®

Artenschutz in Franken®
Artenschutz als Zeichen einer ethisch-moralischen Verpflichtung, diesem Anspruch gegenüber uns begleitenden Mitgeschöpfen und deren Lebens-räume, stellen wir uns seit nunmehr fast 30 Jahren mit zahlreichen Partnern tagtäglich auf vielfältiger Art aufs Neue.
In vollkommen ehrenamtlicher, wirtschaftlich- und politisch sowie konfessionell unabhängiger Form engagieren wir uns hier mit unseren vielen Mitgliedern in abertausenden von Stunden.
Trotz der auf Franken ausgerichteten Namensgebung bundesweit für die Erhaltung der Biodiversität, sowie für eine lebendige, pädagogisch hochwertige Umweltbildung.
Auf unserer Internetpräsenz, die monatlich durchschnittlich von weit über 100.000 Besucher*innen besucht wird, berichten wir transparent auch über unser Engagement.
Artenschutz als Zeichen einer ethisch-moralischen Verpflichtung, diesem Anspruch gegenüber uns begleitenden Mitgeschöpfen und deren Lebens-räume, stellen wir uns seit nunmehr fast 30 Jahren mit zahlreichen Partnern tagtäglich auf vielfältiger Art aufs Neue.
In vollkommen ehrenamtlicher, wirtschaftlich- und politisch sowie konfessionell unabhängiger Form engagieren wir uns hier mit unseren vielen Mitgliedern in abertausenden von Stunden.
Trotz der auf Franken ausgerichteten Namensgebung bundesweit für die Erhaltung der Biodiversität, sowie für eine lebendige, pädagogisch hochwertige Umweltbildung.
Auf unserer Internetpräsenz, die monatlich durchschnittlich von weit über 100.000 Besucher*innen besucht wird, berichten wir transparent auch über unser Engagement.
In einer Dekade in der zunehmend Veränderungen, auch klimatischer Weise erkennbar werden, kommt nach unserem Dafürhalten der effektiven Erhaltung heimischer Artenvielfalt auch und gerade im Sinne einer auf-geklärten Gesellschaft eine heraus-ragende Bedeutung zu.
Der Artenschwund hat er-schreckende Ausmaße ange-nommen, welche den Eindruck der zunehmenden Leere für den aufmerksamen Betrachter deutlich erkennbar werden lässt. Eine ausge-storbene Art ist für nahezu alle Zeit verloren. Mit ihr verlieren wir eine hochwertige, einzigartige Ressource die sich den Umweltbedingungen seit meist Millionen von Jahren anpassen konnte.
Wir sollten uns den Luxus nicht leisten dieser Artenreduktion untätig zuzusehen. Nur eine möglichst hohe genetische Artenvielfalt kann die Entstehung neuer Arten effektiv ansteuern.
Im Sinne uns nachfolgender Generationen, also unserer Kinder und unserer Enkelkinder, sollten wir uns gemeinsam dazu durchringen dem galoppierenden Artenschwund Paroli zu bieten.
Nur gemeinsam wird und kann es uns gelingen diesem sicherlich nicht leichtem Unterfangen erfolgreich zu begegnen. Ohne dies jedoch jemals versucht zu haben, werden wir nie erkennen ob wir dazu in der Lage sind oder waren.
Durchdachter Artenschutz ist in unseren Augen mehr als eine Ideologie.
Er beweist in eindrucksvoller Art die Verbundenheit mit einer einzigartigen Heimat und deren sich darin befindlichen Lebensformen. Schöpfung lebendig bewahren, für uns ge-meinsam mehr als „nur“ ein Lippenbekenntnis.
Artenschutz ist für uns gleichfalls Lebensraumsicherung für den modernen Menschen.
Nur in einer intakten, vielfältigen Umwelt wird auch der Mensch die Chance erhalten nachhaltig zu überdauern. Hierfür setzten wir uns täglich vollkommen ehrenamtlich und unabhängig im Sinne unserer Mit-geschöpfe, jedoch auch ganz bewusst im Sinne unserer Mitbürger und vor allem der uns nachfolgenden Generation von ganzem Herzen ein.
Artenschutz in Franken®
Der Artenschwund hat er-schreckende Ausmaße ange-nommen, welche den Eindruck der zunehmenden Leere für den aufmerksamen Betrachter deutlich erkennbar werden lässt. Eine ausge-storbene Art ist für nahezu alle Zeit verloren. Mit ihr verlieren wir eine hochwertige, einzigartige Ressource die sich den Umweltbedingungen seit meist Millionen von Jahren anpassen konnte.
Wir sollten uns den Luxus nicht leisten dieser Artenreduktion untätig zuzusehen. Nur eine möglichst hohe genetische Artenvielfalt kann die Entstehung neuer Arten effektiv ansteuern.
Im Sinne uns nachfolgender Generationen, also unserer Kinder und unserer Enkelkinder, sollten wir uns gemeinsam dazu durchringen dem galoppierenden Artenschwund Paroli zu bieten.
Nur gemeinsam wird und kann es uns gelingen diesem sicherlich nicht leichtem Unterfangen erfolgreich zu begegnen. Ohne dies jedoch jemals versucht zu haben, werden wir nie erkennen ob wir dazu in der Lage sind oder waren.
Durchdachter Artenschutz ist in unseren Augen mehr als eine Ideologie.
Er beweist in eindrucksvoller Art die Verbundenheit mit einer einzigartigen Heimat und deren sich darin befindlichen Lebensformen. Schöpfung lebendig bewahren, für uns ge-meinsam mehr als „nur“ ein Lippenbekenntnis.
Artenschutz ist für uns gleichfalls Lebensraumsicherung für den modernen Menschen.
Nur in einer intakten, vielfältigen Umwelt wird auch der Mensch die Chance erhalten nachhaltig zu überdauern. Hierfür setzten wir uns täglich vollkommen ehrenamtlich und unabhängig im Sinne unserer Mit-geschöpfe, jedoch auch ganz bewusst im Sinne unserer Mitbürger und vor allem der uns nachfolgenden Generation von ganzem Herzen ein.
Artenschutz in Franken®
25. Jahre Artenschutz in Franken®

25. Jahre Artenschutz in Franken®
Am 01.03.2021 feierte unsere Organisation ein Vierteljahrhundert ehrenamlichen und vollkommen unabhängigen Artenschutz und erlebbare Umweltbildung.
Am 01.03.2021 feierte unsere Organisation ein Vierteljahrhundert ehrenamlichen und vollkommen unabhängigen Artenschutz und erlebbare Umweltbildung.
Und auch nach 25 Jahren zeigt sich unser Engagement keineswegs als "überholt". Im Gegenteil es wird dringender gebraucht denn je.
Denn die immensen Herausforderungen gerade auf diesem Themenfeld werden unsere Gesellschaft zukünftig intensiv fordern!
Hinweis zum 15.jährigen Bestehen.
Aus besonderem Anlass und zum 15.jährigen Bestehen unserer Organisation ergänzten wir unsere namensgebende Bezeichnung.
Der Zusatz Artenschutz in Franken® wird den Ansprüchen eines modernen und zunehmend auch überregional agierenden Verbandes gerecht.
Vormals auf die Region des Steiger-waldes beschränkt setzt sich Artenschutz in Franken® nun vermehrt in ganz Deutschland und darüber hinaus ein.
Die Bezeichnung ändert sich, was Bestand haben wird ist weiterhin das ehrenamliche und unabhängige Engagement das wir für die Belange des konkreten Artenschutzes, sowie einer lebendigen Umweltbildung in einbringen.
Im Sinne uns nachfolgender Generationen!
Auf unserer Internetpräsenz möchten wir unser ehrenamtliches Engagement näher vorstellen.
Artenschutz in Franken®
Denn die immensen Herausforderungen gerade auf diesem Themenfeld werden unsere Gesellschaft zukünftig intensiv fordern!
Hinweis zum 15.jährigen Bestehen.
Aus besonderem Anlass und zum 15.jährigen Bestehen unserer Organisation ergänzten wir unsere namensgebende Bezeichnung.
Der Zusatz Artenschutz in Franken® wird den Ansprüchen eines modernen und zunehmend auch überregional agierenden Verbandes gerecht.
Vormals auf die Region des Steiger-waldes beschränkt setzt sich Artenschutz in Franken® nun vermehrt in ganz Deutschland und darüber hinaus ein.
Die Bezeichnung ändert sich, was Bestand haben wird ist weiterhin das ehrenamliche und unabhängige Engagement das wir für die Belange des konkreten Artenschutzes, sowie einer lebendigen Umweltbildung in einbringen.
Im Sinne uns nachfolgender Generationen!
Auf unserer Internetpräsenz möchten wir unser ehrenamtliches Engagement näher vorstellen.
Artenschutz in Franken®
Kleinvogel gefunden - und jetzt?

Kleinvogel gefunden - und jetzt?
Wie verhalte ich mich beim Fund eines noch nicht flugfähigen Kleinvogels richtig?
Regelmäßig erreichen uns Anfragen die sich auf den korrekten Umgang des Tieres beim „Fund“ eines noch nicht flugfähigen Kleinvogels beziehen.
Wir vom Artenschutz in Franken® haben hier einige Informationen für Sie zusammengestellt.
Wir erklären dir das Vorgehen und die in unseren Augen wichtigsten Dos und Don'ts bei einem Fund eines kleinen, noch nicht flugfähigen Vogels in Form eines einfachen, einprägsamen Mnemonics, den du leicht merken kannst: "VOGEL"
Wie verhalte ich mich beim Fund eines noch nicht flugfähigen Kleinvogels richtig?
Regelmäßig erreichen uns Anfragen die sich auf den korrekten Umgang des Tieres beim „Fund“ eines noch nicht flugfähigen Kleinvogels beziehen.
Wir vom Artenschutz in Franken® haben hier einige Informationen für Sie zusammengestellt.
Wir erklären dir das Vorgehen und die in unseren Augen wichtigsten Dos und Don'ts bei einem Fund eines kleinen, noch nicht flugfähigen Vogels in Form eines einfachen, einprägsamen Mnemonics, den du leicht merken kannst: "VOGEL"
Jeder Buchstabe im Wort "VOGEL" steht dabei für einen wichtigen Schritt oder Hinweis:
V - Verhalten beobachten:
• Dos: Bevor du irgendetwas tust, beobachte den Vogel aus der Ferne. Manchmal (Meistens) sind die Eltern in der Nähe und kümmern sich um ihn.
• Don'ts: Den Vogel sofort anfassen oder wegtragen, ohne die Situation zu analysieren.
O - Ort sichern:
• Dos: Sicherstellen, dass der Vogel nicht durch Menschen, Hunde oder Katzen gefährdet ist.
• Don'ts: Den Vogel in gefährliche Bereiche lassen, wo er leicht verletzt werden kann.
G - Gesundheit prüfen:
• Dos: Prüfe vorsichtig, ob der Vogel verletzt ist. Wenn er offensichtlich verletzt ist, kontaktiere eine Wildtierauffangstation oder einen Tierarzt. Wende dich auch an die für die Örtlichkeit zuständige fachliche Einrichtung wie Naturschutzfachbehörde oder Umweltämter.
• Don'ts: Keine medizinische Erstversorgung versuchen, wenn du keine Erfahrung damit hast.
E - Eltern suchen:
• Dos: Versuche herauszufinden, ob die Eltern in der Nähe sind. Elternvögel kehren oft zurück, um ihre Jungen zu füttern.
• Don'ts: Den Vogel nicht sofort mitnehmen, da die Eltern ihn weiterhin versorgen könnten.
L - Letzte Entscheidung:
• Dos: Wenn der Vogel in Gefahr ist oder die Eltern nicht zurückkehren, kontaktiere eine Wildtierstation oder einen Experten für Rat und weitere Schritte.
• Don'ts: Den Vogel nicht ohne fachkundigen Rat mit nach Hause nehmen oder füttern, da falsche Pflege oft mehr schadet als hilft.
Zusammenfassung
• Verhalten beobachten: Erst schauen, nicht gleich handeln.
• Ort sichern: Gefahrenquelle ausschalten.
• Gesundheit prüfen: Verletzungen erkennen.
• Eltern suchen: Eltern in der Nähe?
• Letzte Entscheidung: Bei Gefahr oder verlassener Brut Wildtierstation kontaktieren.
Mit diesem Mnemonic kannst du dir so finden wir vom Artenschutz in Franken® recht leicht merken, wie du dich verhalten sollst, wenn du einen kleinen, noch nicht flugfähigen Vogel findest.
Wichtig!
- Bitte beachte jedoch dabei immer den Eigenschutz, denn die Tier können Krankheiten übertragen die auch für den Menschen gefährlich werden können. Deshalb raten wir vornehmlich ... immer Finger weg - Fachleute kontaktieren!
Wir vom Artenschutz in Franken® sind keine und unterhalten auch kein Tierpflegestelle da wir uns in erster Linie mit der Lebensraumsicherung und Lebensraumschaffung befassen.
Artenschutz in Franken®
Rechtliches §

Immer wieder werden wir gefragt welche rechtlichen Grundlagen es innerhalb der Naturschutz- und Tierschutzgesetze es gibt.
Wir haben einige Infos zu diesem Thema hier verlinkt:
Wir haben einige Infos zu diesem Thema hier verlinkt:
Bayerisches Naturschutzgesetz – BayNatSchG
http://www.gesetze-bayern.de/(X(1)S(fhnsotp2iqyyotymmjumqonn))/Content/Document/BayNatSchG?AspxAutoDetectCookieSupport=1
Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege
https://www.gesetze-im-internet.de/bnatschg_2009/
Tierschutzgesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/tierschg/BJNR012770972.html
http://www.gesetze-bayern.de/(X(1)S(fhnsotp2iqyyotymmjumqonn))/Content/Document/BayNatSchG?AspxAutoDetectCookieSupport=1
Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege
https://www.gesetze-im-internet.de/bnatschg_2009/
Tierschutzgesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/tierschg/BJNR012770972.html
Unser Engagement

Mehr über unser Engagement finden Sie hier:
Die Artenschutz im Steigerwald/Artenschutz in Franken®- Nachhaltigkeits-vereinbarung
www.artenschutz-steigerwald.de/de/Ueber-Uns/1001349/AiF_-_Nachhaltigkeitsvereinbarung/
Über uns
www.artenschutz-steigerwald.de/de/Ueber-Uns/
Impressum/Satzung
www.artenschutz-steigerwald.de/de/Impressum/
www.artenschutz-steigerwald.de/de/Ueber-Uns/1001349/AiF_-_Nachhaltigkeitsvereinbarung/
Über uns
www.artenschutz-steigerwald.de/de/Ueber-Uns/
Impressum/Satzung
www.artenschutz-steigerwald.de/de/Impressum/
Nachgedacht

Ein Gedicht zum Verlust der Biodiversität in unserem Land.
Artenschwund
In allen Medien tun sie es kund, bedenklich ist der Artenschwund.
Begonnen hat es schon sehr bald, durch Abholzung im Regenwald. Nicht nur um edle Hölzer zu gewinnen, man fing schließlich an zu „spinnen“. Durch Brandrodung ließ man es qualmen, und pflanzte dort dann nur noch Palmen.
Das fand die Industrie ganz prima, doch heute bejammern wir das Klima. Aber es betrifft nicht nur ferne Lande, auch bei uns ist es `ne Schande. Dass Wälder dem Profit zum Opfer fallen, dies schadet schließlich doch uns Allen.
Artenschwund
In allen Medien tun sie es kund, bedenklich ist der Artenschwund.
Begonnen hat es schon sehr bald, durch Abholzung im Regenwald. Nicht nur um edle Hölzer zu gewinnen, man fing schließlich an zu „spinnen“. Durch Brandrodung ließ man es qualmen, und pflanzte dort dann nur noch Palmen.
Das fand die Industrie ganz prima, doch heute bejammern wir das Klima. Aber es betrifft nicht nur ferne Lande, auch bei uns ist es `ne Schande. Dass Wälder dem Profit zum Opfer fallen, dies schadet schließlich doch uns Allen.
Ob Kahlschlag in Skandinavien, oder hier, die Dummen, das sind immer wir. Was unser Klima wirklich erhält, wurde zum großen Teil gefällt.
Es beginnt doch schon im Kleinen, an Straßen- und an Wegesrainen. Dort wird gemäht, ganz ohne Not, dies ist vieler Tiere Tod. Moderne Maschinen zu unserem Schrecken, lassen Schmetterlingsraupen
kläglich verrecken. Weil von den Raupen niemand profitiert, dies dann auch kaum Jemand interes-siert. Doch der Jammer ist schon groß; wo bleiben die Schmetterlinge bloß?
Auch unser Obst ist in Gefahr, denn die Bienen werden rar. Wir uns deshalb ernsthaft fragen, wer wird in Zukunft die Pollen übertragen. Eine
eingeschleppte Milbe ist der Bienen Tod und die Imker leiden Not. Dazu spritzt man noch Neonikotinoide und Glyphosat, damit man reiche Ernte hat. Das vergiftet nicht nur Tiere, sondern jetzt auch viele Biere. Glyphosat soll krebserregend sein, doch das kümmert hier kein Schwein.
Hauptsache es rollt weiterhin der Kiesel, denn man hat ja noch den Diesel. Der ist jetzt an Allem schuld und man gönnt ihm keine Huld. Elektrofahrzeuge sind die neue Devise, doch verhindern diese wirklich unsere Krise? Braunkohle und Atom, erzeugen zumeist unseren Strom. Wie nun jeder Bürger weiß, ist auch dieses Thema
heiß.
Gäbe es immerzu Sonnenschein, wäre Solarenergie fein. Aber da sind ja noch die Windanlagen, die hoch in den Himmel ragen. Wo sie dann an manchen Tagen, Vögel in der Luft erschlagen. Diese zogen erst von Süden fort, entkamen knapp dem Vogelmord. Nun hat es sie doch noch erwischt, nur werden sie hier nicht aufgetischt.
Wie haben die Ortolane schön ge-sungen, nun liegen auf dem Teller ihre Zungen. War das schön, als sie noch lebten, bevor sie auf `ner Rute klebten. Immer weniger wird ihr Gesang, uns wird es langsam angst und bang .Gesetze wurden
zwar gemacht, sie werden jedoch zumeist belacht. Wenn Vögel brutzeln in Pfanne und Schüssel, wen interessiert da das „Geschwätz“ aus Brüssel.
Es gibt ein paar Leute, die sind vor Ort und stellen sich gegen den Vogelmord. Die wenigen, die es wagen, riskieren dabei Kopf und Kragen. Wenn sie beseitigen Ruten und Fallen, oder hindern Jäger, Vögel abzuknallen. Riesige Netze, so stellen wir fest, geben den Vögeln nun noch den Rest. Wir sollten dies schnellstens verhindern, sonst werden wir mit unseren Kindern, bald keinen Vogelsang mehr hören. So manchen würde das kaum stören, doch mit diesem Artenschwund, schlägt irgendwann auch unsere Stund`.
Quelle
Hubertus Zinnecker
Es beginnt doch schon im Kleinen, an Straßen- und an Wegesrainen. Dort wird gemäht, ganz ohne Not, dies ist vieler Tiere Tod. Moderne Maschinen zu unserem Schrecken, lassen Schmetterlingsraupen
kläglich verrecken. Weil von den Raupen niemand profitiert, dies dann auch kaum Jemand interes-siert. Doch der Jammer ist schon groß; wo bleiben die Schmetterlinge bloß?
Auch unser Obst ist in Gefahr, denn die Bienen werden rar. Wir uns deshalb ernsthaft fragen, wer wird in Zukunft die Pollen übertragen. Eine
eingeschleppte Milbe ist der Bienen Tod und die Imker leiden Not. Dazu spritzt man noch Neonikotinoide und Glyphosat, damit man reiche Ernte hat. Das vergiftet nicht nur Tiere, sondern jetzt auch viele Biere. Glyphosat soll krebserregend sein, doch das kümmert hier kein Schwein.
Hauptsache es rollt weiterhin der Kiesel, denn man hat ja noch den Diesel. Der ist jetzt an Allem schuld und man gönnt ihm keine Huld. Elektrofahrzeuge sind die neue Devise, doch verhindern diese wirklich unsere Krise? Braunkohle und Atom, erzeugen zumeist unseren Strom. Wie nun jeder Bürger weiß, ist auch dieses Thema
heiß.
Gäbe es immerzu Sonnenschein, wäre Solarenergie fein. Aber da sind ja noch die Windanlagen, die hoch in den Himmel ragen. Wo sie dann an manchen Tagen, Vögel in der Luft erschlagen. Diese zogen erst von Süden fort, entkamen knapp dem Vogelmord. Nun hat es sie doch noch erwischt, nur werden sie hier nicht aufgetischt.
Wie haben die Ortolane schön ge-sungen, nun liegen auf dem Teller ihre Zungen. War das schön, als sie noch lebten, bevor sie auf `ner Rute klebten. Immer weniger wird ihr Gesang, uns wird es langsam angst und bang .Gesetze wurden
zwar gemacht, sie werden jedoch zumeist belacht. Wenn Vögel brutzeln in Pfanne und Schüssel, wen interessiert da das „Geschwätz“ aus Brüssel.
Es gibt ein paar Leute, die sind vor Ort und stellen sich gegen den Vogelmord. Die wenigen, die es wagen, riskieren dabei Kopf und Kragen. Wenn sie beseitigen Ruten und Fallen, oder hindern Jäger, Vögel abzuknallen. Riesige Netze, so stellen wir fest, geben den Vögeln nun noch den Rest. Wir sollten dies schnellstens verhindern, sonst werden wir mit unseren Kindern, bald keinen Vogelsang mehr hören. So manchen würde das kaum stören, doch mit diesem Artenschwund, schlägt irgendwann auch unsere Stund`.
Quelle
Hubertus Zinnecker
Ein Frühsommer-Bild aus Schleswig-Holstein

Ein Frühsommer-Bild aus Schleswig-Holstein ...da wir jedoch im ganzen Land wiederfinden!
Eine weite Grünlandniederung, vier riesige Mähmaschinen fahren nebeneinander mit rasanter Geschwindigkeit über ein Areal von einigen hundert Hektar Wiesen.
Wo gestern noch zahlreiche Feldvögel sangen und ihre Jungen fütterten, Wiesen- und Rohrweihen jagten, ein Sumpfohreulenpaar balzte und offensichtlich einen Brutplatz hatte, bietet sich heute ein Bild der Zerstörung. Kiebitze und Brachvögel rufen verzweifelt und haben ihre Gelege verloren.
Eine weite Grünlandniederung, vier riesige Mähmaschinen fahren nebeneinander mit rasanter Geschwindigkeit über ein Areal von einigen hundert Hektar Wiesen.
Wo gestern noch zahlreiche Feldvögel sangen und ihre Jungen fütterten, Wiesen- und Rohrweihen jagten, ein Sumpfohreulenpaar balzte und offensichtlich einen Brutplatz hatte, bietet sich heute ein Bild der Zerstörung. Kiebitze und Brachvögel rufen verzweifelt und haben ihre Gelege verloren.
Schafstelzen, Wiesenpieper und Feldlerchen hüpfen mit Würmern im Schnabel auf der Suche nach ihren längst zerstückelten Jungvögeln verzweifelt über den Boden.
Alles nichts Neues.
Das kennen wir ja. Das BNatSchG §44 erlaubt es ja schließlich gemäß der „guten fachliche Praxis“, streng geschützte Vogelarten zu töten - denn verboten ist es ja nur „ohne sinnvollen Grund“.
Aber was ist an dieser uns allen bekannten Situation anders als noch vor 10, 20 Jahren?
Die Mähmaschinen sind größer und stärker denn je, schneller denn je, mähen tiefer denn je, mähen in immer kürzeren Intervallen, mähen die Gräben bis tief in jede Grabenböschung mit ab.
Wie zum Hohn kommt nun noch ein weiterer Trecker und mäht alle Stauden der Wegesränder ab, scheinbar um das letzte verbliebene Wiesenpieper- oder Blaukehlchennnest dann auch noch zu erwischen.
23.00h: Es wird dunkel, es wird weiter gemäht. Ich denke an die Wiesenweihen, den gerade erschienenen Artikel aus der Zeitschrift dem Falken: " bei nächtlicher Mahd bleiben die adulten Weihen auf dem Nest sitzen und werden mit getötet“.
Wo ist unsere Landwirtschaft hingekommen, dass jetzt hier 4 Maschinen der neusten Generation parallel nebeneinander in rasendem Tempo mähen, dahinter wird schon gewendet und das Gras abtransportiert.
Nicht ein junger Vogel, nicht ein junger Hase hat hier die geringste Chance, noch zu entkommen.
Früher habe ich nach der Mahd noch junge Kiebitze und junge Hasen gesehen, die überlebt haben. Früher hat ein Bauer noch das Mähwerk angehoben, wenn er von oben ein Kiebitznest gesehen hat.
Hier ist nun nichts mehr, nur hunderte von Krähen und Möwen, die sich über das „Fastfood“ freuen (und nebenbei bemerkt damit einen äußerst wichtigen Beitrag zur Beseitigung von Clostridien leisten, welche die Silage verunreinigen und damit den Rinderbestand gefährden könnten - gedankt wird es den Krähen aber natürlich nicht)
Diese Entwicklung der Grünlandbewirtschaftung ist sehr besorgniserregend, nicht nur für den Vogel des Jahres, die Feldlerche. Das Wettrüsten der Landwirte ist verständlich aus deren wirtschaftlicher Sicht, aber eine ökologische Vollkatastrophe und das Ergebnis einer verfehlten Agrarpolitik.
Was ist denn der „sinnvolle Grund“, der diese Entwicklung überhaupt zulässt?
Dass die Milch und das Fleisch immer noch billiger werden, und dafür das letzte Stück Natur geschreddert wird? Ist das wirklich im Sinne der Allgemeinheit, denn es sind doch nicht nur wir Naturschützer*innen und Vogelkundler*innen, die sich über blühende Wiesen und singende Lerchen freuen.
Dieser massenhafte Vogelmord auf unserem Grünland (und natürlich Amphibien, Reptilien, Säugetiere, Insekten) wird immer aggressiver und ist vielen Menschen gar nicht bewusst.
Es müssen dringend Maßnahmen ergriffen werden, wie z.B. gesetzlich vorgeschriebene Randstreifen zu Gräben und Wegesrändern, Verbot nächtlicher Mahd, Begrenzung der Mahdhöhe- und Mahdgeschwindigkeit usw.
Ansonsten brauchen wir uns auch nicht über vogeljagende Mittelmeerländer aufzuregen - denn das was hier stattfindet ist letztendlich genauso zerstörerisch wie zum Spaß zur Flinte zu greifen.
Juni 2019
Autorin
Natascha Gaedecke
Alles nichts Neues.
Das kennen wir ja. Das BNatSchG §44 erlaubt es ja schließlich gemäß der „guten fachliche Praxis“, streng geschützte Vogelarten zu töten - denn verboten ist es ja nur „ohne sinnvollen Grund“.
Aber was ist an dieser uns allen bekannten Situation anders als noch vor 10, 20 Jahren?
Die Mähmaschinen sind größer und stärker denn je, schneller denn je, mähen tiefer denn je, mähen in immer kürzeren Intervallen, mähen die Gräben bis tief in jede Grabenböschung mit ab.
Wie zum Hohn kommt nun noch ein weiterer Trecker und mäht alle Stauden der Wegesränder ab, scheinbar um das letzte verbliebene Wiesenpieper- oder Blaukehlchennnest dann auch noch zu erwischen.
23.00h: Es wird dunkel, es wird weiter gemäht. Ich denke an die Wiesenweihen, den gerade erschienenen Artikel aus der Zeitschrift dem Falken: " bei nächtlicher Mahd bleiben die adulten Weihen auf dem Nest sitzen und werden mit getötet“.
Wo ist unsere Landwirtschaft hingekommen, dass jetzt hier 4 Maschinen der neusten Generation parallel nebeneinander in rasendem Tempo mähen, dahinter wird schon gewendet und das Gras abtransportiert.
Nicht ein junger Vogel, nicht ein junger Hase hat hier die geringste Chance, noch zu entkommen.
Früher habe ich nach der Mahd noch junge Kiebitze und junge Hasen gesehen, die überlebt haben. Früher hat ein Bauer noch das Mähwerk angehoben, wenn er von oben ein Kiebitznest gesehen hat.
Hier ist nun nichts mehr, nur hunderte von Krähen und Möwen, die sich über das „Fastfood“ freuen (und nebenbei bemerkt damit einen äußerst wichtigen Beitrag zur Beseitigung von Clostridien leisten, welche die Silage verunreinigen und damit den Rinderbestand gefährden könnten - gedankt wird es den Krähen aber natürlich nicht)
Diese Entwicklung der Grünlandbewirtschaftung ist sehr besorgniserregend, nicht nur für den Vogel des Jahres, die Feldlerche. Das Wettrüsten der Landwirte ist verständlich aus deren wirtschaftlicher Sicht, aber eine ökologische Vollkatastrophe und das Ergebnis einer verfehlten Agrarpolitik.
Was ist denn der „sinnvolle Grund“, der diese Entwicklung überhaupt zulässt?
Dass die Milch und das Fleisch immer noch billiger werden, und dafür das letzte Stück Natur geschreddert wird? Ist das wirklich im Sinne der Allgemeinheit, denn es sind doch nicht nur wir Naturschützer*innen und Vogelkundler*innen, die sich über blühende Wiesen und singende Lerchen freuen.
Dieser massenhafte Vogelmord auf unserem Grünland (und natürlich Amphibien, Reptilien, Säugetiere, Insekten) wird immer aggressiver und ist vielen Menschen gar nicht bewusst.
Es müssen dringend Maßnahmen ergriffen werden, wie z.B. gesetzlich vorgeschriebene Randstreifen zu Gräben und Wegesrändern, Verbot nächtlicher Mahd, Begrenzung der Mahdhöhe- und Mahdgeschwindigkeit usw.
Ansonsten brauchen wir uns auch nicht über vogeljagende Mittelmeerländer aufzuregen - denn das was hier stattfindet ist letztendlich genauso zerstörerisch wie zum Spaß zur Flinte zu greifen.
Juni 2019
Autorin
Natascha Gaedecke
Waldsterben 2.0 – Nein eine Chance zur Gestaltung naturnaher Wälder!

Waldsterben 2.0 – Nein eine Chance zur Gestaltung naturnaher Wälder!
Artenschutz in Franken® verfolgt seit geraumer Zeit die Diskussionen um den propagierten Niedergang des deutschen Waldes.
Als Ursache dieses Niedergangs wurde der/die Schuldige/n bereits ausgemacht. Der Klimawandel der die Bäume verdursten lässt und hie und da auch noch einige Großsäuger die unseren Wald „auffressen“. Diesen wird es vielerorts zugeschrieben, dass wir in wenigen Jahren wohl unseren Wald verlieren werden?!
Artenschutz in Franken® verfolgt seit geraumer Zeit die Diskussionen um den propagierten Niedergang des deutschen Waldes.
Als Ursache dieses Niedergangs wurde der/die Schuldige/n bereits ausgemacht. Der Klimawandel der die Bäume verdursten lässt und hie und da auch noch einige Großsäuger die unseren Wald „auffressen“. Diesen wird es vielerorts zugeschrieben, dass wir in wenigen Jahren wohl unseren Wald verlieren werden?!
Als Ursache für das infolge des Klimawandels erkennbare „Absterben“ unserer Wirtschaftswälder liegt jedoch vielmehr auch darin, dass wir unsere Wälder in den vergangenen Jahrhunderten ständig waldbaulich manipulierten und dieses auch heute noch sehr ausgeprägt und vielfach intensiver den je tun.
In dieser Zeitspanne haben wir in unserem Land nahezu alle unsere ursprünglich geformten Wälder verloren. Wir haben diesen Systemen seither ständig unsere menschliche Handschrift auferlegt um aufzuzeigen wie wir uns einen nachhaltig geformten Wirtschaftswald vorstellen. Und diesen selbstverständlich auch intensiv nutzen können.
Ohne große Rücksicht auf Pflanzen und Tiere welche in diesem Ökosystem leben.Wir haben somit keinen Wald mehr vor Augen wie dieser von Natur aus gedacht war – wir haben einen Wald vor unseren Augen wie wir uns Menschen einen Wald vorstellen.
Somit „stirbt“ nun auch nicht der Wald, sondern lediglich der vom Menschen fehlgeformte Wald.
Nun wird also fleißig darüber nachgedacht mit einem Millionenaufwand unseren Wald mit Aufforstungsprogrammen zu retten. Doch dieser Ansatz ist in unseren Augen eine weitere Verfehlung menschlichen Wirkens. Denn was hier zusammengepflanzt wird ist wieder kein sich natürlich entwickelter Wald der seine Dynamik sichtbar werden lassen kann. Nein es wird wieder ein vom Menschen manipulierter Wirtschaftswald entstehen der nur die Lebensformen in sich duldet die wir dieser Holzproduktionsfläche zugestehen.
Die Vielfalt der Arten wird hier auf immens großen Flächen abermals keine Rolle spielen.
Doch warum lassen wir es nicht einfach mal zu das wir dem Wald die Chance eröffnen uns zu zeigen wie Waldbau funktioniert und wie ein robuster Wald aussieht. „Dieser Wald“ wird uns in 50 – 70 Jahren zeigen welche Artenzusammensetzung für den jeweiligen Standort die richtige Mischung ist.
Es ist uns schon klar das bis dahin viele vom Menschen geschaffenen Wälder nicht mehr stehen werden denn sie werden tatsächlich „aufgefressen“.
Doch nicht vom Reh, welches Luchs und Wolf als Nahrungsgrundlage dringlich benötigen, wollen wir verhindern das diese sich an unseren Schafen & Co. bedienen, sondern von ganz kleinen Tieren. Der Borkenkäfer wird die Fläche für die nachfolgenden Naturwälder vorbereiten so wie wir es an mancher Stelle in Bayern sehr gut erkennen können.
Es bedarf somit in unseren Augen einem gesellschaftlichen Umdenken das endlich greifen muss.
Gerade im Sinne unserer Kinder und Enkelkinder welchen wir eine an Arten reiche Welt hinterlassen sollten.
AiF
12.08.2019
Ein sehr interessanter Bericht zu diesem Thema findet sich hier
In dieser Zeitspanne haben wir in unserem Land nahezu alle unsere ursprünglich geformten Wälder verloren. Wir haben diesen Systemen seither ständig unsere menschliche Handschrift auferlegt um aufzuzeigen wie wir uns einen nachhaltig geformten Wirtschaftswald vorstellen. Und diesen selbstverständlich auch intensiv nutzen können.
Ohne große Rücksicht auf Pflanzen und Tiere welche in diesem Ökosystem leben.Wir haben somit keinen Wald mehr vor Augen wie dieser von Natur aus gedacht war – wir haben einen Wald vor unseren Augen wie wir uns Menschen einen Wald vorstellen.
Somit „stirbt“ nun auch nicht der Wald, sondern lediglich der vom Menschen fehlgeformte Wald.
Nun wird also fleißig darüber nachgedacht mit einem Millionenaufwand unseren Wald mit Aufforstungsprogrammen zu retten. Doch dieser Ansatz ist in unseren Augen eine weitere Verfehlung menschlichen Wirkens. Denn was hier zusammengepflanzt wird ist wieder kein sich natürlich entwickelter Wald der seine Dynamik sichtbar werden lassen kann. Nein es wird wieder ein vom Menschen manipulierter Wirtschaftswald entstehen der nur die Lebensformen in sich duldet die wir dieser Holzproduktionsfläche zugestehen.
Die Vielfalt der Arten wird hier auf immens großen Flächen abermals keine Rolle spielen.
Doch warum lassen wir es nicht einfach mal zu das wir dem Wald die Chance eröffnen uns zu zeigen wie Waldbau funktioniert und wie ein robuster Wald aussieht. „Dieser Wald“ wird uns in 50 – 70 Jahren zeigen welche Artenzusammensetzung für den jeweiligen Standort die richtige Mischung ist.
Es ist uns schon klar das bis dahin viele vom Menschen geschaffenen Wälder nicht mehr stehen werden denn sie werden tatsächlich „aufgefressen“.
Doch nicht vom Reh, welches Luchs und Wolf als Nahrungsgrundlage dringlich benötigen, wollen wir verhindern das diese sich an unseren Schafen & Co. bedienen, sondern von ganz kleinen Tieren. Der Borkenkäfer wird die Fläche für die nachfolgenden Naturwälder vorbereiten so wie wir es an mancher Stelle in Bayern sehr gut erkennen können.
Es bedarf somit in unseren Augen einem gesellschaftlichen Umdenken das endlich greifen muss.
Gerade im Sinne unserer Kinder und Enkelkinder welchen wir eine an Arten reiche Welt hinterlassen sollten.
AiF
12.08.2019
Ein sehr interessanter Bericht zu diesem Thema findet sich hier