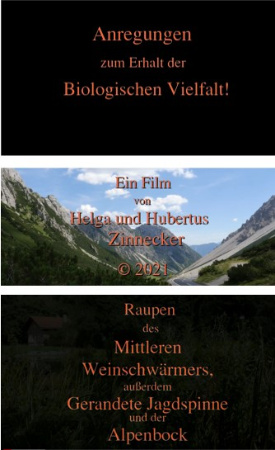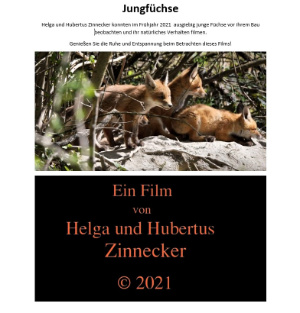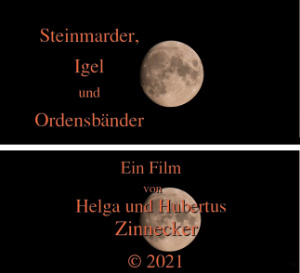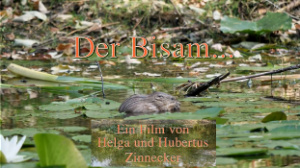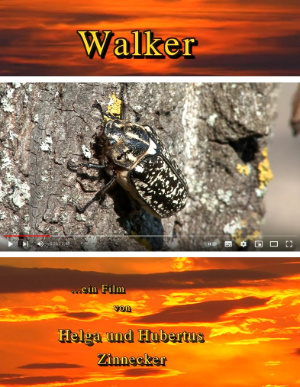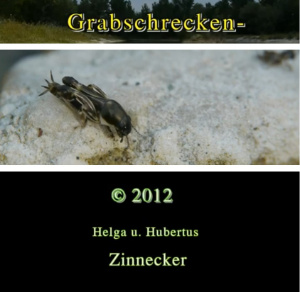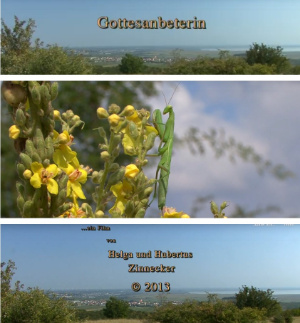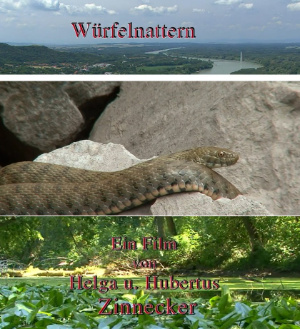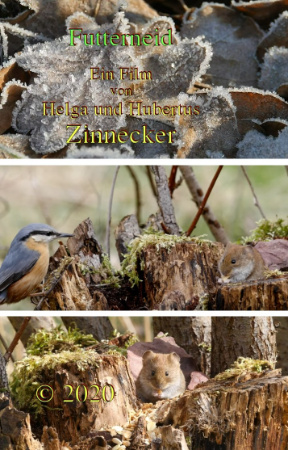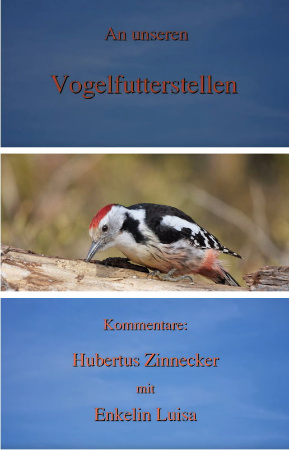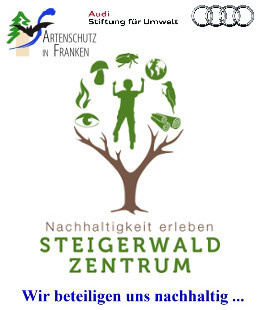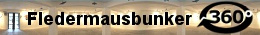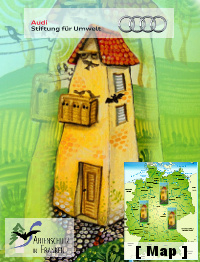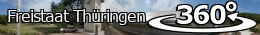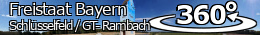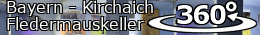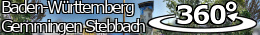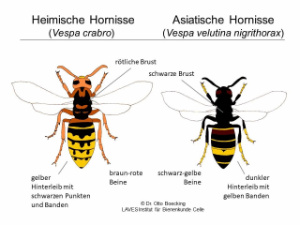BREAKING NEWS
| AiF | 20:08
Immer auf der richtigen Fährte ...
Artenschutz in Franken®
Artenschutz in Franken®
Gewöhnlicher Trauerschweber (Anthrax anthrax)

Hallo, ich bin der Gewöhnliche Trauerschweber, auch bekannt als Anthrax anthrax.
16/17.06.2024
Ich bin ein kleiner, schwarzer Fluginsekt mit einem charakteristischen weißen Fleck auf den Flügeln, der mir meinen Namen gegeben hat. Ihr Menschen würdet mein Erscheinungsbild vielleicht als elegant oder sogar innovativ bezeichnen, da meine Flügelmusterung einzigartig ist und mir hilft, mich zu tarnen und Räuber zu täuschen.
16/17.06.2024
- Gerne erzähle ich euch von meinem Leben und meiner Bedeutung für die Umwelt aus meiner eigenen Perspektive.
Ich bin ein kleiner, schwarzer Fluginsekt mit einem charakteristischen weißen Fleck auf den Flügeln, der mir meinen Namen gegeben hat. Ihr Menschen würdet mein Erscheinungsbild vielleicht als elegant oder sogar innovativ bezeichnen, da meine Flügelmusterung einzigartig ist und mir hilft, mich zu tarnen und Räuber zu täuschen.
Mein Lebenszyklus ist auf eine nachhaltige Weise gestaltet, die sicherstellt, dass sowohl ich als auch die Umwelt im Gleichgewicht bleiben. Als Larve entwickle ich mich in den Nestern von Wildbienen und Hummeln. Dies mag auf den ersten Blick nicht sehr freundlich erscheinen, doch meine Präsenz hilft, das natürliche Gleichgewicht der Populationen aufrechtzuerhalten. Indem ich ein Teil des natürlichen Regulationsmechanismus bin, trage ich dazu bei, dass keine Art überhandnimmt und das Ökosystem destabilisiert.
Meine Methode, die Brut von Wildbienen und Hummeln zu nutzen, ist innovativ und anpassungsfähig. Während andere Insekten ihre Eier vielleicht auf Pflanzen legen, finde ich geschützte Nester, die meinen Nachkommen einen sicheren Ort zum Wachsen bieten. Diese Strategie ist nicht nur effizient, sondern auch im Sinne der nachfolgenden Generationen wichtig, da sie die Fortführung meiner Art sicherstellt und gleichzeitig das ökologische Gleichgewicht erhält.
Ich spiele auch eine Rolle im Bestäubungsprozess, wenn ich als ausgewachsenes Insekt Blüten besuche, um Nektar zu sammeln. Dies trägt zur Gesundheit der Pflanzenwelt bei, von der viele Lebewesen, einschließlich ihr Menschen, abhängig sind. Eine gesunde Pflanzenwelt bedeutet eine reiche und vielfältige Nahrungsquelle, was wiederum im Sinne zukünftiger Generationen ist.
Im Sinne der nachfolgenden Generationen bedeutet meine Lebensweise, dass ich zur Aufrechterhaltung eines gesunden und ausgewogenen Ökosystems beitrage. Mein Dasein und meine Aktivitäten sind Teil eines komplexen Netzwerks von Interaktionen, die sicherstellen, dass das Leben auf unserem Planeten fortbesteht und floriert.
Ich hoffe, dass ihr durch mein Beispiel erkennt, wie wichtig es ist, die Natur zu verstehen und zu respektieren. Jede Art, auch eine scheinbar unscheinbare wie ich, spielt eine wichtige Rolle im großen Ganzen. Nachhaltige Praktiken und innovatives Denken sind entscheidend, um eine lebenswerte Welt für alle Lebewesen und zukünftige Generationen zu schaffen. Schützt und bewahrt die Natur, und ihr werdet die Früchte eurer Bemühungen in einer blühenden und gesunden Umwelt sehen.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
Meine Methode, die Brut von Wildbienen und Hummeln zu nutzen, ist innovativ und anpassungsfähig. Während andere Insekten ihre Eier vielleicht auf Pflanzen legen, finde ich geschützte Nester, die meinen Nachkommen einen sicheren Ort zum Wachsen bieten. Diese Strategie ist nicht nur effizient, sondern auch im Sinne der nachfolgenden Generationen wichtig, da sie die Fortführung meiner Art sicherstellt und gleichzeitig das ökologische Gleichgewicht erhält.
Ich spiele auch eine Rolle im Bestäubungsprozess, wenn ich als ausgewachsenes Insekt Blüten besuche, um Nektar zu sammeln. Dies trägt zur Gesundheit der Pflanzenwelt bei, von der viele Lebewesen, einschließlich ihr Menschen, abhängig sind. Eine gesunde Pflanzenwelt bedeutet eine reiche und vielfältige Nahrungsquelle, was wiederum im Sinne zukünftiger Generationen ist.
Im Sinne der nachfolgenden Generationen bedeutet meine Lebensweise, dass ich zur Aufrechterhaltung eines gesunden und ausgewogenen Ökosystems beitrage. Mein Dasein und meine Aktivitäten sind Teil eines komplexen Netzwerks von Interaktionen, die sicherstellen, dass das Leben auf unserem Planeten fortbesteht und floriert.
Ich hoffe, dass ihr durch mein Beispiel erkennt, wie wichtig es ist, die Natur zu verstehen und zu respektieren. Jede Art, auch eine scheinbar unscheinbare wie ich, spielt eine wichtige Rolle im großen Ganzen. Nachhaltige Praktiken und innovatives Denken sind entscheidend, um eine lebenswerte Welt für alle Lebewesen und zukünftige Generationen zu schaffen. Schützt und bewahrt die Natur, und ihr werdet die Früchte eurer Bemühungen in einer blühenden und gesunden Umwelt sehen.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- Gewöhnlicher Trauerschweber (Anthrax anthrax)
Artenschutz in Franken®
Totholz-Blattschneiderbiene (Megachile willoughbiella.)

Hallo, ich bin die Totholz-Blattschneiderbiene, auch bekannt als Megachile willoughbiella.
16/17.06.2024
Ich bin eine Solitärbiene und unterscheide mich von den Honigbienen, da ich alleine lebe und keine großen Kolonien bilde. Meine Nester baue ich bevorzugt in totem Holz oder in markhaltigen Pflanzenstängeln.
Hier kommt meine innovative Seite ins Spiel: Ich nutze meine kräftigen Kiefer, um präzise kreisrunde Stücke aus Blättern zu schneiden. Diese Blätter verwende ich, um meine Niströhren auszufüttern und zu verschließen, damit meine Nachkommen sicher sind.
16/17.06.2024
- Gerne erzähle ich euch von meinem Leben und meiner Bedeutung für die Umwelt aus meiner eigenen Sichtweise.
Ich bin eine Solitärbiene und unterscheide mich von den Honigbienen, da ich alleine lebe und keine großen Kolonien bilde. Meine Nester baue ich bevorzugt in totem Holz oder in markhaltigen Pflanzenstängeln.
Hier kommt meine innovative Seite ins Spiel: Ich nutze meine kräftigen Kiefer, um präzise kreisrunde Stücke aus Blättern zu schneiden. Diese Blätter verwende ich, um meine Niströhren auszufüttern und zu verschließen, damit meine Nachkommen sicher sind.
Meine Lebensweise ist ein Paradebeispiel für Nachhaltigkeit. Indem ich Totholz und Pflanzenmaterialien nutze, unterstütze ich den natürlichen Kreislauf der Zersetzung und Nährstoffrückführung in den Boden. Ich trage zur Gesundheit der Wälder bei und schaffe gleichzeitig sichere Brutstätten für meine Nachkommen. Diese nachhaltige Nutzung von Ressourcen stellt sicher, dass auch zukünftige Generationen von Totholz-Blattschneiderbienen und anderen Organismen in einer intakten Umwelt leben können.
Meine Rolle im Ökosystem ist auch im Sinne der nachfolgenden Generationen von großer Bedeutung. Als Bestäuberin trage ich wesentlich zur Fortpflanzung vieler Pflanzenarten bei. Dies ist nicht nur für die Pflanzenwelt, sondern auch für die Menschen von großer Bedeutung. Viele eurer Nahrungsmittel hängen von der Bestäubung durch Bienen ab. Indem ich zur Vermehrung von Pflanzen beitrage, unterstütze ich die Biodiversität und die Gesundheit der Ökosysteme, von denen auch ihr Menschen profitiert.
Im Sinne der nachfolgenden Generationen bedeutet meine Arbeit, dass ich zur Erhaltung einer vielfältigen und gesunden Natur beitrage. Meine Bestäubungsdienste sind essentiell für die Nahrungsproduktion und das Überleben vieler Pflanzenarten. Dies zeigt, wie wichtig es ist, innovative und nachhaltige Praktiken zu fördern, um eine lebenswerte Welt für zukünftige Generationen zu schaffen.
Ich hoffe, dass ihr durch mein Beispiel erkennt, wie wichtig es ist, die Natur zu schützen und nachhaltig zu leben. Wenn ihr Maßnahmen ergreift, um Lebensräume wie Wälder und Gärten zu bewahren und zu pflegen, unterstützt ihr nicht nur mich und meine Art, sondern auch die Zukunft aller Lebewesen, einschließlich eurer eigenen Nachkommen. Eine gesunde und vielfältige Natur ist das Erbe, das wir alle weitergeben wollen.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
Meine Rolle im Ökosystem ist auch im Sinne der nachfolgenden Generationen von großer Bedeutung. Als Bestäuberin trage ich wesentlich zur Fortpflanzung vieler Pflanzenarten bei. Dies ist nicht nur für die Pflanzenwelt, sondern auch für die Menschen von großer Bedeutung. Viele eurer Nahrungsmittel hängen von der Bestäubung durch Bienen ab. Indem ich zur Vermehrung von Pflanzen beitrage, unterstütze ich die Biodiversität und die Gesundheit der Ökosysteme, von denen auch ihr Menschen profitiert.
Im Sinne der nachfolgenden Generationen bedeutet meine Arbeit, dass ich zur Erhaltung einer vielfältigen und gesunden Natur beitrage. Meine Bestäubungsdienste sind essentiell für die Nahrungsproduktion und das Überleben vieler Pflanzenarten. Dies zeigt, wie wichtig es ist, innovative und nachhaltige Praktiken zu fördern, um eine lebenswerte Welt für zukünftige Generationen zu schaffen.
Ich hoffe, dass ihr durch mein Beispiel erkennt, wie wichtig es ist, die Natur zu schützen und nachhaltig zu leben. Wenn ihr Maßnahmen ergreift, um Lebensräume wie Wälder und Gärten zu bewahren und zu pflegen, unterstützt ihr nicht nur mich und meine Art, sondern auch die Zukunft aller Lebewesen, einschließlich eurer eigenen Nachkommen. Eine gesunde und vielfältige Natur ist das Erbe, das wir alle weitergeben wollen.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- Totholz - Blattschneiderbiene (Megachile willoughbiella)
Artenschutz in Franken®
2008 bis 2024 ... die Rückkehr der Reckendorfer Weißstörche

2008 bis 2024 ... die Rückkehr der Reckendorfer Weißstörche
16.06.2024
Reckendorf / Landkreis Bamberg in Bayern. Auch in diesem Jahr informiert uns Brigitte Schmitt über die Entwicklung der Reckendorfer Weißstörche.
In wieweit sich durch eine zu erwartende Zunahme der Weißstorchpopulation im Landkreis Bamberg das Verhalten der Tiere hier in Reckendorf ändern wird bleibt abzuwarten.
16.06.2024
Reckendorf / Landkreis Bamberg in Bayern. Auch in diesem Jahr informiert uns Brigitte Schmitt über die Entwicklung der Reckendorfer Weißstörche.
- Zwei Jungvögel sitzen Anfang Juni im Horst.
In wieweit sich durch eine zu erwartende Zunahme der Weißstorchpopulation im Landkreis Bamberg das Verhalten der Tiere hier in Reckendorf ändern wird bleibt abzuwarten.
Auf unserer Internetpräsenz haben wir seit 2008 mit Unterstützung von Brigite Schmitt eine Dokumentation eingestellt:
Aufnahme von Brigitte Schmitt
Aufnahme von Brigitte Schmitt
- In diesem Jahr haben hier 2 Jungstörche das Licht der der Welt erblickt
Artenschutz in Franken®
Braunschwarze Rossameise (Camponotus ligniperda)

Hallo, ich bin eine Braunschwarze Rossameise, auch bekannt als Camponotus ligniperda.
15/16.06.2024
Ich gehöre zu einer der größten Ameisenarten in Europa. Wir sind beeindruckende Baumeister und haben uns innovative Methoden angeeignet, um in der Natur zu überleben und zu gedeihen. Unsere Kolonien bestehen aus Tausenden von Individuen, die zusammenarbeiten, um Nester zu bauen, Nahrung zu sammeln und unsere Königin zu schützen.
15/16.06.2024
- Gerne erzähle ich euch von meinem Leben und meiner Bedeutung für die Umwelt aus meiner eigenen Perspektive.
Ich gehöre zu einer der größten Ameisenarten in Europa. Wir sind beeindruckende Baumeister und haben uns innovative Methoden angeeignet, um in der Natur zu überleben und zu gedeihen. Unsere Kolonien bestehen aus Tausenden von Individuen, die zusammenarbeiten, um Nester zu bauen, Nahrung zu sammeln und unsere Königin zu schützen.
Unsere Nester bauen wir häufig in totem Holz oder unter Steinen. Wir haben innovative Wege gefunden, Holz zu zerkleinern und zu nutzen, um stabile und sichere Strukturen zu schaffen. Diese Bauweise ist nicht nur effizient, sondern auch nachhaltig. Wir tragen zur Zersetzung von totem Holz bei, was den natürlichen Kreislauf der Nährstoffe im Wald unterstützt. Dadurch fördern wir die Gesundheit des Waldes und bieten Lebensraum für viele andere Organismen.
Nachhaltigkeit ist ein zentraler Aspekt unseres Lebens. Unsere Kolonien sind darauf ausgelegt, im Gleichgewicht mit der Natur zu leben. Wir nutzen die Ressourcen unserer Umgebung auf eine Weise, die sicherstellt, dass auch zukünftige Generationen von Ameisen und anderen Waldlebewesen davon profitieren können. Wir sind Teil eines komplexen Ökosystems, in dem jedes Lebewesen eine wichtige Rolle spielt.
Unsere Arbeit ist auch im Sinne menschlicher Generationen von Bedeutung. Indem wir zur Gesundheit und Stabilität der Wälder beitragen, unterstützen wir auch die Umwelt, die ihr Menschen zum Leben braucht. Gesunde Wälder sind entscheidend für die Luftqualität, die Wasserspeicherung und den Erhalt der Artenvielfalt. Unsere Aktivitäten helfen dabei, diese natürlichen Ressourcen zu bewahren, von denen auch ihr Menschen abhängt.
Unsere kollektive Lebensweise ist ein Beispiel dafür, wie Innovation und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen können. Durch unsere effizienten und nachhaltigen Bau- und Lebensstrategien können wir nicht nur überleben, sondern auch gedeihen. Dies zeigt, wie wichtig es ist, im Einklang mit der Natur zu leben und für die Zukunft zu planen.
Ich hoffe, dass ihr durch mein Beispiel erkennt, wie wichtig es ist, innovativ und nachhaltig zu handeln, um eine lebenswerte Welt für alle Lebewesen zu schaffen. Im Sinne menschlicher Generationen bedeutet das, dass ihr Maßnahmen ergreift, um die Natur zu schützen und zu pflegen, damit auch zukünftige Generationen von Menschen und Tieren in einer gesunden und blühenden Umwelt leben können.
Aufnahme von Bernhard Schmalisch
Nachhaltigkeit ist ein zentraler Aspekt unseres Lebens. Unsere Kolonien sind darauf ausgelegt, im Gleichgewicht mit der Natur zu leben. Wir nutzen die Ressourcen unserer Umgebung auf eine Weise, die sicherstellt, dass auch zukünftige Generationen von Ameisen und anderen Waldlebewesen davon profitieren können. Wir sind Teil eines komplexen Ökosystems, in dem jedes Lebewesen eine wichtige Rolle spielt.
Unsere Arbeit ist auch im Sinne menschlicher Generationen von Bedeutung. Indem wir zur Gesundheit und Stabilität der Wälder beitragen, unterstützen wir auch die Umwelt, die ihr Menschen zum Leben braucht. Gesunde Wälder sind entscheidend für die Luftqualität, die Wasserspeicherung und den Erhalt der Artenvielfalt. Unsere Aktivitäten helfen dabei, diese natürlichen Ressourcen zu bewahren, von denen auch ihr Menschen abhängt.
Unsere kollektive Lebensweise ist ein Beispiel dafür, wie Innovation und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen können. Durch unsere effizienten und nachhaltigen Bau- und Lebensstrategien können wir nicht nur überleben, sondern auch gedeihen. Dies zeigt, wie wichtig es ist, im Einklang mit der Natur zu leben und für die Zukunft zu planen.
Ich hoffe, dass ihr durch mein Beispiel erkennt, wie wichtig es ist, innovativ und nachhaltig zu handeln, um eine lebenswerte Welt für alle Lebewesen zu schaffen. Im Sinne menschlicher Generationen bedeutet das, dass ihr Maßnahmen ergreift, um die Natur zu schützen und zu pflegen, damit auch zukünftige Generationen von Menschen und Tieren in einer gesunden und blühenden Umwelt leben können.
Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- Braunschwarze Rossameise (Camponotus ligniperda)
Artenschutz in Franken®
Nierenfleck-Zipfelfalter (Thecla betulae)

Hallo, ich bin der Nierenfleck-Zipfelfalter, auch bekannt als Thecla betulae.
15/16.06.2024
- Ich erzähle euch gerne aus meiner Sichtweise über mein Leben und meine Bedeutung für die Umwelt.
Ich bin ein kleiner, aber faszinierender Schmetterling, der in vielen Teilen Europas und Asiens zu Hause ist. Meine Flügel sind von einem prächtigen Braun mit einem charakteristischen weißen Fleck, der mir meinen Namen gegeben hat. Ihr Menschen würdet das wohl als innovativ bezeichnen, denn dieses Muster ist einzigartig und hilft mir, mich in meinem natürlichen Lebensraum zu tarnen.
In meiner Welt dreht sich alles um Nachhaltigkeit. Als Raupe ernähre ich mich hauptsächlich von den Blättern der Schlehe und anderen Sträuchern. Dadurch spiele ich eine wichtige Rolle im Ökosystem, indem ich dazu beitrage, das natürliche Gleichgewicht zu erhalten. Meine Existenz ist eng mit den Pflanzen und Tieren meiner Umgebung verknüpft. Wir leben in einer symbiotischen Beziehung, die seit Generationen besteht und die auch in Zukunft fortbestehen soll.
Ich lege großen Wert darauf, dass meine Lebensweise im Sinne der nachfolgenden Generationen gestaltet ist. Mein Fortpflanzungszyklus ist darauf ausgelegt, dass meine Nachkommen in einer gesunden Umwelt heranwachsen können. Die Weibchen legen ihre Eier im Spätsommer oder Frühherbst an den Ästen der Nahrungspflanzen ab, wo sie sicher überwintern. Im Frühling schlüpfen dann die Raupen und beginnen ihren Lebenszyklus von neuem. Dies ist unsere Art, nachhaltig zu leben und sicherzustellen, dass zukünftige Generationen von Nierenfleck-Zipfelfaltern weiterhin in einer intakten Natur existieren können.
Unser Überleben hängt stark von der Erhaltung unserer Lebensräume ab. Deswegen sind wir ein Symbol für die Notwendigkeit, natürliche Lebensräume zu schützen und zu pflegen. Wenn ihr Menschen euch für den Erhalt der Natur einsetzt, handelt ihr nicht nur im Sinne meiner Art, sondern auch im Sinne eurer eigenen Nachkommen. Eine intakte Natur ist das Erbe, das wir alle weitergeben wollen.
So hoffe ich, dass ihr mich und meine Lebensweise als Beispiel dafür seht, wie wichtig es ist, innovativ und nachhaltig zu handeln, um eine lebenswerte Welt für alle Lebewesen und zukünftigen Generationen zu schaffen.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
Ich lege großen Wert darauf, dass meine Lebensweise im Sinne der nachfolgenden Generationen gestaltet ist. Mein Fortpflanzungszyklus ist darauf ausgelegt, dass meine Nachkommen in einer gesunden Umwelt heranwachsen können. Die Weibchen legen ihre Eier im Spätsommer oder Frühherbst an den Ästen der Nahrungspflanzen ab, wo sie sicher überwintern. Im Frühling schlüpfen dann die Raupen und beginnen ihren Lebenszyklus von neuem. Dies ist unsere Art, nachhaltig zu leben und sicherzustellen, dass zukünftige Generationen von Nierenfleck-Zipfelfaltern weiterhin in einer intakten Natur existieren können.
Unser Überleben hängt stark von der Erhaltung unserer Lebensräume ab. Deswegen sind wir ein Symbol für die Notwendigkeit, natürliche Lebensräume zu schützen und zu pflegen. Wenn ihr Menschen euch für den Erhalt der Natur einsetzt, handelt ihr nicht nur im Sinne meiner Art, sondern auch im Sinne eurer eigenen Nachkommen. Eine intakte Natur ist das Erbe, das wir alle weitergeben wollen.
So hoffe ich, dass ihr mich und meine Lebensweise als Beispiel dafür seht, wie wichtig es ist, innovativ und nachhaltig zu handeln, um eine lebenswerte Welt für alle Lebewesen und zukünftigen Generationen zu schaffen.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- Nierenfleck-Zipfelfalter (Thecla betulae)
Artenschutz in Franken®
Stele der Biodiversität® - Stegaurach / Dellern

Stele der Biodiversität® - Stegaurach / Dellern
15/16.06.2024
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.
Stegaurach / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
15/16.06.2024
- Installation des Montagegerüstes abgeschlossen
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.
Stegaurach / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
Denn wenn (selbst in noch geeigneten Nahrungsstrukturen) keine geeigneten Reproduktionsräume vorhanden sind, ist die Erhaltung der Artenvielfalt gelichfalls zum Scheitern verurteilt.
Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird., setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.
In der Aufnahme
- am 06.06.2024 wurde die Installation des Montagegerüstes abgeschlossen ...
Artenschutz in Franken®
Gefleckte Habichtsfliege (Dioctria lateralis)

Gefleckte Habichtsfliege (Dioctria lateralis)
14/15.06.2024
Meine Existenz ist geprägt von innovativen Jagdmethoden, nachhaltiger Lebensweise und einem starken Engagement für das Wohl zukünftiger Generationen.
Lass mich dir meine Perspektive näherbringen:
Innovation ist ein wesentlicher Bestandteil meines Lebens. Als geschickte Jägerin nutze ich meine beeindruckenden Flugfähigkeiten und scharfen Sinne, um meine Beute zu fangen.
14/15.06.2024
- Als Gefleckte Habichtsfliege (Dioctria lateralis) betrachte ich die Welt durch die Linse meiner einzigartigen Überlebensstrategien und meines Beitrags zum Ökosystem.
Meine Existenz ist geprägt von innovativen Jagdmethoden, nachhaltiger Lebensweise und einem starken Engagement für das Wohl zukünftiger Generationen.
Lass mich dir meine Perspektive näherbringen:
Innovation ist ein wesentlicher Bestandteil meines Lebens. Als geschickte Jägerin nutze ich meine beeindruckenden Flugfähigkeiten und scharfen Sinne, um meine Beute zu fangen.
Meine Augen sind hervorragend entwickelt, um Bewegungen aus großer Entfernung zu erkennen. Diese Fähigkeit ermöglicht es mir, schnell und präzise zuzuschlagen, was mir einen entscheidenden Vorteil verschafft. Ich jage andere Insekten im Flug, eine Methode, die sowohl effizient als auch effektiv ist. Diese innovative Jagdtechnik stellt sicher, dass ich meine Nahrung effizient erhalte, ohne die Ressourcen in meiner Umgebung zu überbeanspruchen.
Nachhaltigkeit ist für mich von zentraler Bedeutung. Ich sorge dafür, dass ich die Insektenpopulationen, auf die ich angewiesen bin, nicht übermäßig dezimiere. Indem ich nur so viel jage, wie ich für mein Überleben benötige, trage ich zur Aufrechterhaltung des ökologischen Gleichgewichts bei. Mein Verhalten ermöglicht es den Populationen meiner Beutetiere, sich zu erholen und weiterhin Teil des Ökosystems zu bleiben. Dies fördert eine nachhaltige Nahrungsquelle für mich und andere Raubtiere und trägt zur Stabilität und Gesundheit des gesamten Ökosystems bei.
Im Sinne nachfolgender Generationen sorge ich dafür, dass meine Lebensweise die Umwelt nicht negativ beeinflusst. Meine Jagdpraktiken und mein Fortpflanzungsverhalten sind darauf ausgerichtet, die Natur zu bewahren und zu schützen. Ich lege meine Eier an sicheren Orten ab, wo meine Nachkommen in einer stabilen Umgebung schlüpfen und aufwachsen können. Durch meine Rolle im Nahrungskreislauf trage ich zur Regulierung der Insektenpopulationen bei, was die Gesundheit und Vielfalt der Pflanzen- und Tierwelt fördert.
Zusammengefasst ist mein Leben als Gefleckte Habichtsfliege ein Beispiel für die Balance zwischen innovativen Überlebensstrategien, nachhaltigem Verhalten und der Verantwortung für die Zukunft. Jede meiner Handlungen ist darauf ausgerichtet, eine gesunde und stabile Umwelt zu bewahren, die auch kommenden Generationen zugutekommt. Mein Dasein trägt dazu bei, ein harmonisches Gleichgewicht in der Natur zu erhalten und die Lebensgrundlagen für viele andere Lebewesen zu sichern.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch vom Juni 2024
Nachhaltigkeit ist für mich von zentraler Bedeutung. Ich sorge dafür, dass ich die Insektenpopulationen, auf die ich angewiesen bin, nicht übermäßig dezimiere. Indem ich nur so viel jage, wie ich für mein Überleben benötige, trage ich zur Aufrechterhaltung des ökologischen Gleichgewichts bei. Mein Verhalten ermöglicht es den Populationen meiner Beutetiere, sich zu erholen und weiterhin Teil des Ökosystems zu bleiben. Dies fördert eine nachhaltige Nahrungsquelle für mich und andere Raubtiere und trägt zur Stabilität und Gesundheit des gesamten Ökosystems bei.
Im Sinne nachfolgender Generationen sorge ich dafür, dass meine Lebensweise die Umwelt nicht negativ beeinflusst. Meine Jagdpraktiken und mein Fortpflanzungsverhalten sind darauf ausgerichtet, die Natur zu bewahren und zu schützen. Ich lege meine Eier an sicheren Orten ab, wo meine Nachkommen in einer stabilen Umgebung schlüpfen und aufwachsen können. Durch meine Rolle im Nahrungskreislauf trage ich zur Regulierung der Insektenpopulationen bei, was die Gesundheit und Vielfalt der Pflanzen- und Tierwelt fördert.
Zusammengefasst ist mein Leben als Gefleckte Habichtsfliege ein Beispiel für die Balance zwischen innovativen Überlebensstrategien, nachhaltigem Verhalten und der Verantwortung für die Zukunft. Jede meiner Handlungen ist darauf ausgerichtet, eine gesunde und stabile Umwelt zu bewahren, die auch kommenden Generationen zugutekommt. Mein Dasein trägt dazu bei, ein harmonisches Gleichgewicht in der Natur zu erhalten und die Lebensgrundlagen für viele andere Lebewesen zu sichern.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch vom Juni 2024
- Gefleckte Habichtsfliege (Dioctria lateralis)
Artenschutz in Franken®
Kirschfruchtfliege (Rhagoletis cerasi)

Hallo, ich bin die Kirschfruchtfliege, wissenschaftlich bekannt als Rhagoletis cerasi.
14/15.06.2024
Mein innovatives Leben
Als Kirschfruchtfliege bin ich ein echter Überlebenskünstler. Meine Art hat sich über Jahrhunderte hinweg an verschiedene Umweltbedingungen angepasst. Wir haben innovative Strategien entwickelt, um sicherzustellen, dass unsere Nachkommen immer genügend Nahrung und Schutz finden. Unsere Weibchen ...
14/15.06.2024
- Lass mich dir einen Einblick in mein Leben und meine Mission geben, und dabei zeigen, wie ich innovativ, nachhaltig und im Sinne der nachfolgenden Generationen handle.
Mein innovatives Leben
Als Kirschfruchtfliege bin ich ein echter Überlebenskünstler. Meine Art hat sich über Jahrhunderte hinweg an verschiedene Umweltbedingungen angepasst. Wir haben innovative Strategien entwickelt, um sicherzustellen, dass unsere Nachkommen immer genügend Nahrung und Schutz finden. Unsere Weibchen ...
... legen ihre Eier in die reifen Kirschen ab, wo die Larven dann sicher schlüpfen und sich von dem Fruchtfleisch ernähren können. Diese Methode stellt sicher, dass unsere Larven Zugang zu einer reichhaltigen Nahrungsquelle haben, was ihre Überlebenschancen erhöht. Dieses Verhalten zeigt, wie wir ständig neue Wege finden, um unsere Spezies zu erhalten.
Nachhaltigkeit in meinem Leben
Wir Kirschfruchtfliegen leben in einem engen Kreislauf mit der Natur. Indem wir unsere Eier in die Kirschen legen, helfen wir indirekt auch bei der Verbreitung von Kirschbäumen. Zwar mögen Menschen den Schaden an ihren Früchten nicht, aber in der Natur trägt unser Verhalten zur Diversifizierung und Verbreitung von Pflanzen bei. Außerdem sind wir Teil eines größeren ökologischen Netzwerks. Unsere Larven dienen anderen Tieren als Nahrung, und wir selbst spielen eine Rolle in der Regulierung der Populationen von Fruchtbäumen, was langfristig zu einem gesünderen und ausgewogeneren Ökosystem beiträgt.
Im Sinne der nachfolgenden Generationen
Wir Kirschfruchtfliegen denken immer an die Zukunft. Unsere Fortpflanzungsstrategie ist darauf ausgelegt, dass jede Generation die besten Chancen hat, zu überleben und sich fortzupflanzen. Indem wir unsere Eier in die besten Kirschen legen, stellen wir sicher, dass unsere Nachkommen gut ernährt sind und stark genug werden, um die nächste Generation hervorzubringen. Diese Voraussicht sorgt dafür, dass unsere Art weiterhin gedeiht und ihren Platz im Ökosystem behält.
Zusammengefasst kann man sagen, dass mein Leben als Kirschfruchtfliege ein ständiges Streben nach Innovation und Nachhaltigkeit ist. Wir denken immer an die Zukunft und handeln im Sinne der nachfolgenden Generationen, um sicherzustellen, dass unsere Spezies auch weiterhin erfolgreich ist und einen wichtigen Teil des natürlichen Gleichgewichts bildet.
Aufnahme von Bernhard Schmalisch am 04.06.2024
... sie sind unterwegs, die kleinen Fliegen die dafür sorgen, dass in Kirschen so kleine weiße Würmchen sind ... beliebt sind sie eher nicht, als Gartenbesitzer kann ich den Befall mit Gelbtafeln unter Kontrolle halten ... schön sind sie ja, mit ihren grünen Augen, diese Bohrfliegen.
Nachhaltigkeit in meinem Leben
Wir Kirschfruchtfliegen leben in einem engen Kreislauf mit der Natur. Indem wir unsere Eier in die Kirschen legen, helfen wir indirekt auch bei der Verbreitung von Kirschbäumen. Zwar mögen Menschen den Schaden an ihren Früchten nicht, aber in der Natur trägt unser Verhalten zur Diversifizierung und Verbreitung von Pflanzen bei. Außerdem sind wir Teil eines größeren ökologischen Netzwerks. Unsere Larven dienen anderen Tieren als Nahrung, und wir selbst spielen eine Rolle in der Regulierung der Populationen von Fruchtbäumen, was langfristig zu einem gesünderen und ausgewogeneren Ökosystem beiträgt.
Im Sinne der nachfolgenden Generationen
Wir Kirschfruchtfliegen denken immer an die Zukunft. Unsere Fortpflanzungsstrategie ist darauf ausgelegt, dass jede Generation die besten Chancen hat, zu überleben und sich fortzupflanzen. Indem wir unsere Eier in die besten Kirschen legen, stellen wir sicher, dass unsere Nachkommen gut ernährt sind und stark genug werden, um die nächste Generation hervorzubringen. Diese Voraussicht sorgt dafür, dass unsere Art weiterhin gedeiht und ihren Platz im Ökosystem behält.
Zusammengefasst kann man sagen, dass mein Leben als Kirschfruchtfliege ein ständiges Streben nach Innovation und Nachhaltigkeit ist. Wir denken immer an die Zukunft und handeln im Sinne der nachfolgenden Generationen, um sicherzustellen, dass unsere Spezies auch weiterhin erfolgreich ist und einen wichtigen Teil des natürlichen Gleichgewichts bildet.
Aufnahme von Bernhard Schmalisch am 04.06.2024
... sie sind unterwegs, die kleinen Fliegen die dafür sorgen, dass in Kirschen so kleine weiße Würmchen sind ... beliebt sind sie eher nicht, als Gartenbesitzer kann ich den Befall mit Gelbtafeln unter Kontrolle halten ... schön sind sie ja, mit ihren grünen Augen, diese Bohrfliegen.
Artenschutz in Franken®
Stele der Biodiversität® - Rosendahl / GT - Höven

Stele der Biodiversität® - Rosendahl / GT - Höven
14/15.06.2024
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutzes in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das von der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.
Rosendahl / Nordrhein - Westfalen. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen, kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen.
Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
14/15.06.2024
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutzes in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das von der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.
Rosendahl / Nordrhein - Westfalen. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen, kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen.
Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
In der Aufnahme
... Am 05. Juni 2024 erkennen wir das Objekt vom Schutz- Montagegerüst befreit ...
Artenschutz in Franken®
Garten-Wollbiene (Anthidium manicatum)

Als Garten-Wollbiene (Anthidium manicatum) sehe ich die Welt auf ganz besondere Weise.
13/14.06.2024
Ich bin bekannt für meine innovativen Methoden bei der Nestkonstruktion. Während viele meiner Artgenossen einfache Löcher im Boden oder in Holz bevorzugen, nutze ich weiche Pflanzenteile, um meine Nester auszukleiden. Diese innovativen Materialien bieten nicht nur Schutz und Wärme für meine Nachkommen, sondern auch eine komfortable Umgebung, die das Überleben meiner Brut sicherstellt.
13/14.06.2024
- Mein Leben ist geprägt von meinem Streben nach Innovation, Nachhaltigkeit und dem Wohl zukünftiger Generationen. Lass mich dir meine Sichtweise näherbringen:
Ich bin bekannt für meine innovativen Methoden bei der Nestkonstruktion. Während viele meiner Artgenossen einfache Löcher im Boden oder in Holz bevorzugen, nutze ich weiche Pflanzenteile, um meine Nester auszukleiden. Diese innovativen Materialien bieten nicht nur Schutz und Wärme für meine Nachkommen, sondern auch eine komfortable Umgebung, die das Überleben meiner Brut sicherstellt.
Nachhaltigkeit ist für mich nicht nur ein Schlagwort, sondern eine Lebensweise. Ich sammle den Nektar und Pollen von einer Vielzahl von Pflanzen und trage so zur Bestäubung bei. Dies ist nicht nur für die Pflanzenwelt wichtig, sondern sichert auch die Nahrungsgrundlage für viele andere Lebewesen in unserem Ökosystem. Meine Sammelaktivitäten sind so ausgerichtet, dass ich die Ressourcen, die mir die Natur bietet, nicht übernutze. Ich achte darauf, dass die Pflanzen, die ich besuche, weiterhin gedeihen und sich vermehren können, um auch künftigen Generationen von Garten-Wollbienen eine Lebensgrundlage zu bieten.
Im Sinne nachfolgender Generationen baue ich meine Nester an sicheren Orten, fernab von möglichen Bedrohungen. Dies gewährleistet, dass meine Nachkommen in einer geschützten Umgebung aufwachsen können. Meine Wahl der Nistplätze berücksichtigt auch die Bedürfnisse anderer Insekten und Tiere, sodass wir in Harmonie miteinander leben können.
Ich glaube fest daran, dass jede Handlung, die ich heute durchführe, direkte Auswirkungen auf die Welt von morgen hat. Deshalb ist mein Verhalten stets darauf ausgerichtet, positive Spuren zu hinterlassen. Meine Bestäubungsarbeit trägt zur Biodiversität und zur Gesundheit unserer Umwelt bei, was letztlich auch den zukünftigen Generationen zugutekommt.
Zusammengefasst ist mein Leben als Garten-Wollbiene ein Balanceakt zwischen Innovation und Tradition, Nachhaltigkeit und Fortschritt sowie dem ständigen Bestreben, eine lebenswerte Welt für die kommenden Generationen zu schaffen.
Aufnahme / Autor Bernhard Schmalisch
Im Sinne nachfolgender Generationen baue ich meine Nester an sicheren Orten, fernab von möglichen Bedrohungen. Dies gewährleistet, dass meine Nachkommen in einer geschützten Umgebung aufwachsen können. Meine Wahl der Nistplätze berücksichtigt auch die Bedürfnisse anderer Insekten und Tiere, sodass wir in Harmonie miteinander leben können.
Ich glaube fest daran, dass jede Handlung, die ich heute durchführe, direkte Auswirkungen auf die Welt von morgen hat. Deshalb ist mein Verhalten stets darauf ausgerichtet, positive Spuren zu hinterlassen. Meine Bestäubungsarbeit trägt zur Biodiversität und zur Gesundheit unserer Umwelt bei, was letztlich auch den zukünftigen Generationen zugutekommt.
Zusammengefasst ist mein Leben als Garten-Wollbiene ein Balanceakt zwischen Innovation und Tradition, Nachhaltigkeit und Fortschritt sowie dem ständigen Bestreben, eine lebenswerte Welt für die kommenden Generationen zu schaffen.
Aufnahme / Autor Bernhard Schmalisch
- ... sie sind wieder da, die großen Wollbienen ... hier ein Weibchen, Drohnen sind noch nicht zu sehen ... sie haben sehr interessante Verhaltensweisen ... Weibchen sind erheblich kleiner als die Drohnen ... die Bienen schlafen auch zwischendurch auf Blüten ... dadurch heften sie sich mit den kräftigen Mandibeln an den Blütenblättern an u. schaukeln im Wind ohne herab zu fallen.
Artenschutz in Franken®
Die Wilden Bienchen von Windheim

Die Wilden Bienchen von Windheim
13/14.06.2024
Ein Projekt des Artenschutz in Franken®, dem Obst- und Gartenbauverein Windheim, der kath.KiTa St. Nikolaus Windheim und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.
Wildbienen - die unbekannten Bestäuber
Eigentlich haben die meisten von uns in ihrem Leben schon einmal Wildbienen gesehen. Doch bewusst als solche wahrgenommen werden diese Tiere kaum. Vielfach werden sie gar mit Wespen oder Fliegen verwechselt. Und hier zeigt sich auch bereits ein elementares Problem. Aufgrund einer weitverbreiteten Unkenntnis werden „die Wildbiene“ und deren Ansprüche an ihre Lebensräume nicht erkannt.
13/14.06.2024
- Montage der Wildbienenstation abgeschlossen
Ein Projekt des Artenschutz in Franken®, dem Obst- und Gartenbauverein Windheim, der kath.KiTa St. Nikolaus Windheim und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.
Wildbienen - die unbekannten Bestäuber
Eigentlich haben die meisten von uns in ihrem Leben schon einmal Wildbienen gesehen. Doch bewusst als solche wahrgenommen werden diese Tiere kaum. Vielfach werden sie gar mit Wespen oder Fliegen verwechselt. Und hier zeigt sich auch bereits ein elementares Problem. Aufgrund einer weitverbreiteten Unkenntnis werden „die Wildbiene“ und deren Ansprüche an ihre Lebensräume nicht erkannt.
Wildbienen - für uns Menschen ungemein wichtig
Wir Menschen sind darauf angewiesen, dass unsere (Kultur) -Pflanzen bestäubt werden. Wildbienen spielen hierbei eine weitaus größere Rolle als bislang angenommen. Doch Wildbienen sichern nicht nur die Ernteerträge in der Landwirtschaft. Da sie häufig in enger Symbiose mit „ihrer Wildpflanze“ leben, sichern die kleinen Insekten auch das Überleben zahlloser Wildpflanzen.
Wildbienen – häufig im Bestand gefährdet
Doch viele unserer Wildbienenarten in Deutschland sind zwischenzeitlich akut in ihrem Bestand bedroht. Gerade auch durch eine zunehmend industrielle Landbewirtschaftung mit einem immensen Pestizideinsatz sowie der Zerstörung wichtiger Lebensräume haben wir Menschen zahlreiche Wildbienenarten bereits nahe an den Rand des Aussterbens gebracht. Je intensiver die Bewirtschaftungsformen und je umfangreicher Bewirtschaftungs-flächen werden, desto stärker hängt der Ertrag der Landwirtschaft auch von Wildbienen ab. Je mehr Lebensräume wir mit unserem Handeln in unserem Umfeld beeinträchtigen gefährden wir nicht nur eine faszinierende Insektengruppe. Nein mehr noch, wir setzen mit diesem Tun gar eine der (auch und gerade für den Menschen) wichtigsten Ökosysteme aufs Spiel.
Wildbienen – eine (letzte) Chance für unsere „Freunde“
Das innovative Kooperationsprojekt möchte hier auch zum Umdenken anregen. Mit der Installation einer in dieser Form in der ganzen Bundesrepublik Deutschland bislang wohl einzigartigen, modernen und sehr langlebigen Wildbienenwand werden die Jüngsten der Gemeinde in pädagogisch wertvoller Form bewusst an das Thema Wildbienenschutz herangeführt.Da Mauerbienen, also die bevorzugten Besiedler einer solchen Wand, überhaupt nicht aggressiv sind, können sich die Kinder des Kindergartens den Tieren gefahrlos nähern und diese auch in ihrem emsigen Treiben live erleben. Gleichfalls soll das Projekt dafür sorgen, dass die Kinder den Respekt und die Achtung für die uns umgebende Artenvielfalt erlernen und wichtige Zusammenhänge in spielerischer Form erkennen.
Denn nur, wenn es gelingt, die uns nachfolgende Generation mit diesen Tieren wieder vertraut zu machen kann es tatsächlich gelingen effektive Wege zu beschreiten die auch Garant dafür sein können das eine Art Win-Win Prinzip entsteht, das beiden Arten das Überleben ermöglicht.
Wildbienen – ein wertvolles Engagement für unsere Zukunft
Während der Verband Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. die Entwicklung der Wand, sowie die pädagogischen Umweltbildungseinheiten in vollkommen ehrenamtlicher Form übernahmen, wurden die finanziellen Aspekte, welche für den Bau der Wand anfielen und durch autorisierte Fachfirmen umgesetzt wurden, von der Deutschen Postcode Lotterie getragen.
Aussichten – das Wildbienenmonitoring
Dem Obst- und Gartenbauverein Windheim und kath.KiTa St. Nikolaus Windheim ist es gelungen ist eine pädagogisch hochwertige Projektbegleitung auf den Weg zu bringen, wird gemeinsam mit dem Verband Artenschutz in Franken® in den kommenden Jahren die Entwicklung an der Wand intensiv verfolgen und auch dokumentieren. Mit Spannung soll dabei auch verfolgt werden, welche Arten bereits anzutreffen sind und welche nachfolgend erscheinen.
In der Aufnahme
Wir Menschen sind darauf angewiesen, dass unsere (Kultur) -Pflanzen bestäubt werden. Wildbienen spielen hierbei eine weitaus größere Rolle als bislang angenommen. Doch Wildbienen sichern nicht nur die Ernteerträge in der Landwirtschaft. Da sie häufig in enger Symbiose mit „ihrer Wildpflanze“ leben, sichern die kleinen Insekten auch das Überleben zahlloser Wildpflanzen.
Wildbienen – häufig im Bestand gefährdet
Doch viele unserer Wildbienenarten in Deutschland sind zwischenzeitlich akut in ihrem Bestand bedroht. Gerade auch durch eine zunehmend industrielle Landbewirtschaftung mit einem immensen Pestizideinsatz sowie der Zerstörung wichtiger Lebensräume haben wir Menschen zahlreiche Wildbienenarten bereits nahe an den Rand des Aussterbens gebracht. Je intensiver die Bewirtschaftungsformen und je umfangreicher Bewirtschaftungs-flächen werden, desto stärker hängt der Ertrag der Landwirtschaft auch von Wildbienen ab. Je mehr Lebensräume wir mit unserem Handeln in unserem Umfeld beeinträchtigen gefährden wir nicht nur eine faszinierende Insektengruppe. Nein mehr noch, wir setzen mit diesem Tun gar eine der (auch und gerade für den Menschen) wichtigsten Ökosysteme aufs Spiel.
Wildbienen – eine (letzte) Chance für unsere „Freunde“
Das innovative Kooperationsprojekt möchte hier auch zum Umdenken anregen. Mit der Installation einer in dieser Form in der ganzen Bundesrepublik Deutschland bislang wohl einzigartigen, modernen und sehr langlebigen Wildbienenwand werden die Jüngsten der Gemeinde in pädagogisch wertvoller Form bewusst an das Thema Wildbienenschutz herangeführt.Da Mauerbienen, also die bevorzugten Besiedler einer solchen Wand, überhaupt nicht aggressiv sind, können sich die Kinder des Kindergartens den Tieren gefahrlos nähern und diese auch in ihrem emsigen Treiben live erleben. Gleichfalls soll das Projekt dafür sorgen, dass die Kinder den Respekt und die Achtung für die uns umgebende Artenvielfalt erlernen und wichtige Zusammenhänge in spielerischer Form erkennen.
Denn nur, wenn es gelingt, die uns nachfolgende Generation mit diesen Tieren wieder vertraut zu machen kann es tatsächlich gelingen effektive Wege zu beschreiten die auch Garant dafür sein können das eine Art Win-Win Prinzip entsteht, das beiden Arten das Überleben ermöglicht.
Wildbienen – ein wertvolles Engagement für unsere Zukunft
Während der Verband Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. die Entwicklung der Wand, sowie die pädagogischen Umweltbildungseinheiten in vollkommen ehrenamtlicher Form übernahmen, wurden die finanziellen Aspekte, welche für den Bau der Wand anfielen und durch autorisierte Fachfirmen umgesetzt wurden, von der Deutschen Postcode Lotterie getragen.
Aussichten – das Wildbienenmonitoring
Dem Obst- und Gartenbauverein Windheim und kath.KiTa St. Nikolaus Windheim ist es gelungen ist eine pädagogisch hochwertige Projektbegleitung auf den Weg zu bringen, wird gemeinsam mit dem Verband Artenschutz in Franken® in den kommenden Jahren die Entwicklung an der Wand intensiv verfolgen und auch dokumentieren. Mit Spannung soll dabei auch verfolgt werden, welche Arten bereits anzutreffen sind und welche nachfolgend erscheinen.
In der Aufnahme
- am 04.06.2024 wurde die Wildbienenstation installiert
Artenschutz in Franken®
Grüne Langbeinfliege (Poecilobothrus nobilitatus)

Grüne Langbeinfliege (Poecilobothrus nobilitatus)
13/14.06.2024
Mit meinen schimmernden grünen Körpern und auffällig langen Beinen gehöre ich zu den eleganteren Fliegenarten.Lass mich dir erzählen, was mich ausmacht und warum ich für die Umwelt wichtig bin.
13/14.06.2024
- Hallo! Ich bin die Grüne Langbeinfliege, oder wissenschaftlich Poecilobothrus nobilitatus genannt.
Mit meinen schimmernden grünen Körpern und auffällig langen Beinen gehöre ich zu den eleganteren Fliegenarten.Lass mich dir erzählen, was mich ausmacht und warum ich für die Umwelt wichtig bin.
Lebensweise und Merkmale
Ich bin eine relativ kleine Fliege, aber mein schillernd grüner Körper und meine langen, schlanken Beine machen mich leicht erkennbar. Männliche Fliegen meiner Art haben zudem auffällige weiße Flügelspitzen, die sie während ihres beeindruckenden Balztanzes zur Schau stellen, um Weibchen zu beeindrucken.
Lebensraum
Ich bevorzuge feuchte Lebensräume wie Ufer von Teichen, Flüssen und Seen. Hier finde ich nicht nur ausreichend Nahrung, sondern auch geeignete Bedingungen für meine Larven. Diese entwickeln sich meist im Schlamm oder feuchten Boden, wo sie sich von Mikroorganismen und zerfallendem organischen Material ernähren.
Ernährung
Ich bin ein geschickter Jäger und ernähre mich hauptsächlich von kleineren Insekten, die ich im Flug fange. Diese Jagdmethode hilft, die Population von potenziellen Schädlingen in Schach zu halten und trägt somit zur Kontrolle von Insektenbeständen bei.
Rolle im Ökosystem
Meine Rolle im Ökosystem ist vielfältig und wichtig:
Nachhaltigkeit und Innovation
Mein Leben und Verhalten sind perfekt auf Nachhaltigkeit und Innovation ausgelegt:
Zukunftssicherung
Alles, was ich tue, ist im Sinne zukünftiger Generationen. Indem ich das Gleichgewicht in meinem Lebensraum bewahre, sorge ich dafür, dass auch kommende Generationen von Fliegen, Pflanzen und anderen Tieren in einer gesunden Umwelt leben können. Meine Rolle als Jäger und Nahrungsquelle sichert die Fortführung eines stabilen und vielfältigen Ökosystems.
Zusammengefasst bin ich, die Grüne Langbeinfliege, ein kleines, aber wesentliches Element in der Natur. Durch meine nachhaltige Lebensweise, meine innovative Anpassungsfähigkeit und mein Engagement für zukünftige Generationen trage ich dazu bei, ein gesundes und stabiles Ökosystem zu erhalten.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
Ich bin eine relativ kleine Fliege, aber mein schillernd grüner Körper und meine langen, schlanken Beine machen mich leicht erkennbar. Männliche Fliegen meiner Art haben zudem auffällige weiße Flügelspitzen, die sie während ihres beeindruckenden Balztanzes zur Schau stellen, um Weibchen zu beeindrucken.
Lebensraum
Ich bevorzuge feuchte Lebensräume wie Ufer von Teichen, Flüssen und Seen. Hier finde ich nicht nur ausreichend Nahrung, sondern auch geeignete Bedingungen für meine Larven. Diese entwickeln sich meist im Schlamm oder feuchten Boden, wo sie sich von Mikroorganismen und zerfallendem organischen Material ernähren.
Ernährung
Ich bin ein geschickter Jäger und ernähre mich hauptsächlich von kleineren Insekten, die ich im Flug fange. Diese Jagdmethode hilft, die Population von potenziellen Schädlingen in Schach zu halten und trägt somit zur Kontrolle von Insektenbeständen bei.
Rolle im Ökosystem
Meine Rolle im Ökosystem ist vielfältig und wichtig:
- Bestäuber: Während ich von Blüte zu Blüte fliege, trage ich auch zur Bestäubung bei, obwohl dies nicht meine Hauptaufgabe ist.
- Natürliche Schädlingsbekämpfung: Durch das Fangen und Fressen kleinerer Insekten helfe ich, deren Populationen zu regulieren, was besonders in landwirtschaftlichen Gebieten von Bedeutung ist.
- Nahrungskette: Ich bin ein wichtiges Bindeglied in der Nahrungskette, da ich selbst von größeren Insekten, Vögeln und Spinnen gefressen werde. So trage ich zur biologischen Vielfalt bei.
Nachhaltigkeit und Innovation
Mein Leben und Verhalten sind perfekt auf Nachhaltigkeit und Innovation ausgelegt:
- Nachhaltig: Ich lebe in Harmonie mit meiner Umgebung und nutze die Ressourcen, die mir zur Verfügung stehen, ohne sie zu übernutzen. Meine Larven tragen zur Zersetzung organischen Materials bei, was die Bodenqualität verbessert.
- Innovativ: Meine Jagdmethoden und mein Balzverhalten zeigen eine hohe Anpassungsfähigkeit und Kreativität in der Nutzung meiner Umwelt und meiner Fähigkeiten.
Zukunftssicherung
Alles, was ich tue, ist im Sinne zukünftiger Generationen. Indem ich das Gleichgewicht in meinem Lebensraum bewahre, sorge ich dafür, dass auch kommende Generationen von Fliegen, Pflanzen und anderen Tieren in einer gesunden Umwelt leben können. Meine Rolle als Jäger und Nahrungsquelle sichert die Fortführung eines stabilen und vielfältigen Ökosystems.
Zusammengefasst bin ich, die Grüne Langbeinfliege, ein kleines, aber wesentliches Element in der Natur. Durch meine nachhaltige Lebensweise, meine innovative Anpassungsfähigkeit und mein Engagement für zukünftige Generationen trage ich dazu bei, ein gesundes und stabiles Ökosystem zu erhalten.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- Die Grüne Langbeinfliege ... Grüne Langbeinfliegen erreichen eine Körpergröße etwa 6 bis 7 mm. Die Tiere leben in der Nähe von Gewässern oder einem überschwemmten Areal. An dem muskulösen Thorax ist auch zu sehen, dass sie wohl noch kleinere Insekten erbeuten. In der Abbildung ein grün schillerndes Weibchen, mit einem rötlichen Schimmer.
Artenschutz in Franken®
Gemeine Sandwespe (Ammophila sabulosa)

Gemeine Sandwespe (Ammophila sabulosa)
12/13.06.2024
Mein Leben ist geprägt von Innovation, Nachhaltigkeit und einem starken Fokus auf die Zukunft, um eine stabile Basis für nachfolgende Generationen zu schaffen. Lass mich dir meine Perspektive erläutern:
Innovation ist der Schlüssel zu meinem Überleben und dem meiner Nachkommen. Anstatt wie viele andere Wespenarten einfache Nester zu bauen, habe ich eine einzigartige Methode entwickelt, um meine Brut zu schützen. Ich grabe tiefe Löcher im Sand oder lockeren Boden, die als sichere Brutkammern dienen. In diesen Kammern platziere ich paralysierte Raupen, die als Nahrungsvorrat für meine Larven dienen. Diese innovative Technik stellt sicher, dass meine Nachkommen genügend Nahrung haben, um sich zu entwickeln, und gleichzeitig vor Fressfeinden geschützt sind.
12/13.06.2024
- Als Gemeine Sandwespe (Ammophila sabulosa) sehe ich die Welt durch die Linse meiner eigenen Überlebensstrategien und der Sicherstellung des Fortbestands meiner Art.
Mein Leben ist geprägt von Innovation, Nachhaltigkeit und einem starken Fokus auf die Zukunft, um eine stabile Basis für nachfolgende Generationen zu schaffen. Lass mich dir meine Perspektive erläutern:
Innovation ist der Schlüssel zu meinem Überleben und dem meiner Nachkommen. Anstatt wie viele andere Wespenarten einfache Nester zu bauen, habe ich eine einzigartige Methode entwickelt, um meine Brut zu schützen. Ich grabe tiefe Löcher im Sand oder lockeren Boden, die als sichere Brutkammern dienen. In diesen Kammern platziere ich paralysierte Raupen, die als Nahrungsvorrat für meine Larven dienen. Diese innovative Technik stellt sicher, dass meine Nachkommen genügend Nahrung haben, um sich zu entwickeln, und gleichzeitig vor Fressfeinden geschützt sind.
Nachhaltigkeit ist ein zentraler Aspekt meines Lebensstils. Während ich Jagd auf Raupen mache, achte ich darauf, das Gleichgewicht der Natur zu bewahren. Ich nehme nur so viel, wie nötig ist, um meine Brut zu ernähren, und hinterlasse dabei genügend Raupen, damit sie sich weiter vermehren können. Diese nachhaltige Jagdpraxis sorgt dafür, dass auch in den kommenden Jahren genügend Nahrung für meine Nachkommen und andere Raubtiere verfügbar ist.
Im Sinne nachfolgender Generationen ist meine gesamte Lebensweise darauf ausgerichtet, eine sichere und stabile Umgebung zu schaffen. Die sorgfältige Wahl der Nistplätze und die Absicherung der Brutkammern sind Maßnahmen, die sicherstellen, dass meine Nachkommen in einer geschützten Umgebung aufwachsen können. Ich lege großen Wert darauf, dass die Plätze, die ich auswähle, auch in Zukunft bewohnbar und sicher bleiben.
Ich sehe es als meine Aufgabe an, einen positiven Beitrag zur Umwelt zu leisten, indem ich dabei helfe, die Population von Schädlingen zu kontrollieren, was wiederum zur Gesundheit und Vielfalt der Pflanzenwelt beiträgt. Meine Tätigkeiten fördern die Biodiversität und unterstützen die Stabilität der Ökosysteme, was letztlich auch zukünftigen Generationen zugutekommt.
Zusammengefasst ist mein Leben als Gemeine Sandwespe ein Beispiel für die perfekte Balance zwischen innovativen Überlebensstrategien, nachhaltiger Ressourcennutzung und einem klaren Fokus auf die Sicherung einer lebenswerten Zukunft für meine Nachkommen. Jedes meiner Handlungen zielt darauf ab, eine stabile und gesunde Umwelt zu erhalten, die auch den kommenden Generationen eine Lebensgrundlage bietet.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
Im Sinne nachfolgender Generationen ist meine gesamte Lebensweise darauf ausgerichtet, eine sichere und stabile Umgebung zu schaffen. Die sorgfältige Wahl der Nistplätze und die Absicherung der Brutkammern sind Maßnahmen, die sicherstellen, dass meine Nachkommen in einer geschützten Umgebung aufwachsen können. Ich lege großen Wert darauf, dass die Plätze, die ich auswähle, auch in Zukunft bewohnbar und sicher bleiben.
Ich sehe es als meine Aufgabe an, einen positiven Beitrag zur Umwelt zu leisten, indem ich dabei helfe, die Population von Schädlingen zu kontrollieren, was wiederum zur Gesundheit und Vielfalt der Pflanzenwelt beiträgt. Meine Tätigkeiten fördern die Biodiversität und unterstützen die Stabilität der Ökosysteme, was letztlich auch zukünftigen Generationen zugutekommt.
Zusammengefasst ist mein Leben als Gemeine Sandwespe ein Beispiel für die perfekte Balance zwischen innovativen Überlebensstrategien, nachhaltiger Ressourcennutzung und einem klaren Fokus auf die Sicherung einer lebenswerten Zukunft für meine Nachkommen. Jedes meiner Handlungen zielt darauf ab, eine stabile und gesunde Umwelt zu erhalten, die auch den kommenden Generationen eine Lebensgrundlage bietet.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- Gemeine Sandwespe (Ammophila sabulosa)
Artenschutz in Franken®
Gemeine Spargelhähnchen (Crioceris asparagi)

Hallo! Ich bin das Gemeine Spargelhähnchen, wissenschaftlich bekannt als Crioceris asparagi.
12/13.06.2024
Mein innovatives Leben
Als Spargelhähnchen bin ich stolz auf unsere cleveren und innovativen Überlebensstrategien. Wir haben gelernt, uns perfekt an die Lebensbedingungen rund um Spargelpflanzen anzupassen. Unsere Weibchen legen ihre Eier geschickt an den Spargelstängeln ab, ...
12/13.06.2024
- Lass mich dir einen Einblick in mein Leben und meine Mission geben und dabei zeigen, wie ich innovativ, nachhaltig und im Sinne der uns nachfolgenden Generationen handle.
Mein innovatives Leben
Als Spargelhähnchen bin ich stolz auf unsere cleveren und innovativen Überlebensstrategien. Wir haben gelernt, uns perfekt an die Lebensbedingungen rund um Spargelpflanzen anzupassen. Unsere Weibchen legen ihre Eier geschickt an den Spargelstängeln ab, ...
... sodass die schlüpfenden Larven sofort Zugang zu frischem, nahrhaftem Futter haben. Unsere Larven tarnen sich durch eine Mischung aus Kot und Pflanzenresten, um Fressfeinde zu täuschen. Diese Strategie zeigt, wie wir immer wieder neue Wege finden, unsere Art zu schützen und zu erhalten.
Nachhaltigkeit in meinem Leben
Wir Spargelhähnchen leben in einem engen Kreislauf mit den Spargelpflanzen. Unsere Larven ernähren sich vom Spargel, aber wir achten darauf, dass wir nicht alle Pflanzen schädigen. Dies ermöglicht es den Spargelpflanzen, sich zu erholen und weiterhin zu wachsen, was sicherstellt, dass auch zukünftige Generationen von Spargelhähnchen genug Nahrung finden. Diese nachhaltige Nutzung unserer Ressourcen ist essenziell für unser Überleben und das Gleichgewicht des Ökosystems.
Im Sinne der nachfolgenden Generationen
Wir denken immer an die Zukunft und handeln im Sinne der nachfolgenden Generationen. Unsere Fortpflanzungsstrategie stellt sicher, dass jede Generation die besten Chancen hat, zu überleben und sich fortzupflanzen. Indem wir unsere Eier an den Spargelstängeln ablegen, sorgen wir dafür, dass unsere Nachkommen sofort nach dem Schlüpfen Zugang zu Nahrung haben. Diese Voraussicht hilft uns, starke und gesunde Nachkommen zu sichern, die ihrerseits wieder zur nächsten Generation beitragen werden.
Zusammengefasst lässt sich sagen, dass mein Leben als Gemeines Spargelhähnchen ein ständiges Streben nach Innovation und Nachhaltigkeit ist. Wir denken immer an die Zukunft und handeln im Sinne der nachfolgenden Generationen, um sicherzustellen, dass unsere Spezies weiterhin gedeiht und ihren Platz im Ökosystem behält. Unsere ausgeklügelten Überlebensstrategien und unser nachhaltiger Umgang mit Ressourcen machen uns zu einem wichtigen Teil der natürlichen Vielfalt.
In der Aufnahme / Autor von Bernhard Schmalisch
Nachhaltigkeit in meinem Leben
Wir Spargelhähnchen leben in einem engen Kreislauf mit den Spargelpflanzen. Unsere Larven ernähren sich vom Spargel, aber wir achten darauf, dass wir nicht alle Pflanzen schädigen. Dies ermöglicht es den Spargelpflanzen, sich zu erholen und weiterhin zu wachsen, was sicherstellt, dass auch zukünftige Generationen von Spargelhähnchen genug Nahrung finden. Diese nachhaltige Nutzung unserer Ressourcen ist essenziell für unser Überleben und das Gleichgewicht des Ökosystems.
Im Sinne der nachfolgenden Generationen
Wir denken immer an die Zukunft und handeln im Sinne der nachfolgenden Generationen. Unsere Fortpflanzungsstrategie stellt sicher, dass jede Generation die besten Chancen hat, zu überleben und sich fortzupflanzen. Indem wir unsere Eier an den Spargelstängeln ablegen, sorgen wir dafür, dass unsere Nachkommen sofort nach dem Schlüpfen Zugang zu Nahrung haben. Diese Voraussicht hilft uns, starke und gesunde Nachkommen zu sichern, die ihrerseits wieder zur nächsten Generation beitragen werden.
Zusammengefasst lässt sich sagen, dass mein Leben als Gemeines Spargelhähnchen ein ständiges Streben nach Innovation und Nachhaltigkeit ist. Wir denken immer an die Zukunft und handeln im Sinne der nachfolgenden Generationen, um sicherzustellen, dass unsere Spezies weiterhin gedeiht und ihren Platz im Ökosystem behält. Unsere ausgeklügelten Überlebensstrategien und unser nachhaltiger Umgang mit Ressourcen machen uns zu einem wichtigen Teil der natürlichen Vielfalt.
In der Aufnahme / Autor von Bernhard Schmalisch
- das ist ein "Gemeines Spargelhähnchen" ... gemein auch, weil sie sich auf meinem Grünspargel tummeln ... das Weibchen legt wohl eben ein Ei aus der eine Larve schlüpft, die dann meinen Spargel "demoliert" ... na ja so schlimm wird es nicht, soooo viele sind es auch nicht. Außerdem sitzen sie mir Modell. Sie nehmen alle Arten von Spargel, gibt den Asparagus auch wild in der Natur. Aber beim Bernhard auf dem Beet der Grünspargel der ist ja auch was Feines ...
Artenschutz in Franken®
Prachtwickler (Olethreutes arcuella)

Prachtwickler (Olethreutes arcuella)
12/13.06.2024
Mit meinen leuchtend gelben und orange-braunen Flügeln bin ich ein echter Hingucker in der Natur. Lass mich dir aus meiner Perspektive erzählen, wie ich lebe und warum mein Dasein innovativ, nachhaltig und im Sinne zukünftiger Generationen ist.
12/13.06.2024
- Hallo! Ich bin der Prachtwickler, oder wie die Menschen mich nennen, Olethreutes arcuella.
Mit meinen leuchtend gelben und orange-braunen Flügeln bin ich ein echter Hingucker in der Natur. Lass mich dir aus meiner Perspektive erzählen, wie ich lebe und warum mein Dasein innovativ, nachhaltig und im Sinne zukünftiger Generationen ist.
Innovativ:
Ich, der Prachtwickler, habe eine sehr innovative Lebensweise entwickelt, um in verschiedenen Lebensräumen zu überleben. Meine auffälligen Farben dienen nicht nur zur Tarnung im Laub, sondern auch zur Abschreckung von Fressfeinden. Meine Larven spinnen sich in die Blätter von Pflanzen ein und rollen sie kunstvoll zusammen, um sich darin zu verpuppen – eine erstaunlich innovative Methode, die Schutz vor äußeren Gefahren bietet. Diese Fähigkeit, meine Umgebung kreativ zu nutzen, zeigt, wie anpassungsfähig und erfinderisch ich bin.
Nachhaltig:
Mein Lebenszyklus ist vollkommen nachhaltig. Ich lebe in einer engen Symbiose mit den Pflanzen, auf denen ich meine Eier ablege. Meine Larven ernähren sich von den Blättern und fördern durch ihre Aktivitäten die natürliche Erneuerung und das Wachstum der Pflanzen. Dies stellt sicher, dass der Pflanzenbestand gesund bleibt und sich regeneriert. Außerdem helfe ich, die Pflanzenvielfalt in meinem Lebensraum zu erhalten, indem ich als Bestäuber wirke und zur Samenverbreitung beitrage. So unterstütze ich ein ausgewogenes und nachhaltiges Ökosystem.
Im Sinne uns nachfolgender Generationen:
Alles, was ich tue, ist darauf ausgerichtet, eine lebenswerte Welt für die nächste Generation zu hinterlassen. Indem ich die Pflanzenvielfalt fördere und zum ökologischen Gleichgewicht beitrage, sorge ich dafür, dass auch nachfolgende Generationen von Insekten und Pflanzen in einem gesunden Lebensraum aufwachsen können. Meine Rolle im Ökosystem hilft dabei, die Biodiversität zu erhalten und sicherzustellen, dass es genügend Ressourcen für alle gibt. Ich achte darauf, meine Umwelt nicht zu übernutzen, sondern im Einklang mit ihr zu leben, damit auch meine Nachkommen und die vieler anderer Arten eine nachhaltige Zukunft haben.
Zusammengefasst bin ich, der Prachtwickler, ein kleines, aber wichtiges Element in der Natur. Durch meine innovative Anpassungsfähigkeit, meine nachhaltige Lebensweise und mein Engagement für zukünftige Generationen trage ich dazu bei, ein gesundes und stabiles Ökosystem zu erhalten.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
Ich, der Prachtwickler, habe eine sehr innovative Lebensweise entwickelt, um in verschiedenen Lebensräumen zu überleben. Meine auffälligen Farben dienen nicht nur zur Tarnung im Laub, sondern auch zur Abschreckung von Fressfeinden. Meine Larven spinnen sich in die Blätter von Pflanzen ein und rollen sie kunstvoll zusammen, um sich darin zu verpuppen – eine erstaunlich innovative Methode, die Schutz vor äußeren Gefahren bietet. Diese Fähigkeit, meine Umgebung kreativ zu nutzen, zeigt, wie anpassungsfähig und erfinderisch ich bin.
Nachhaltig:
Mein Lebenszyklus ist vollkommen nachhaltig. Ich lebe in einer engen Symbiose mit den Pflanzen, auf denen ich meine Eier ablege. Meine Larven ernähren sich von den Blättern und fördern durch ihre Aktivitäten die natürliche Erneuerung und das Wachstum der Pflanzen. Dies stellt sicher, dass der Pflanzenbestand gesund bleibt und sich regeneriert. Außerdem helfe ich, die Pflanzenvielfalt in meinem Lebensraum zu erhalten, indem ich als Bestäuber wirke und zur Samenverbreitung beitrage. So unterstütze ich ein ausgewogenes und nachhaltiges Ökosystem.
Im Sinne uns nachfolgender Generationen:
Alles, was ich tue, ist darauf ausgerichtet, eine lebenswerte Welt für die nächste Generation zu hinterlassen. Indem ich die Pflanzenvielfalt fördere und zum ökologischen Gleichgewicht beitrage, sorge ich dafür, dass auch nachfolgende Generationen von Insekten und Pflanzen in einem gesunden Lebensraum aufwachsen können. Meine Rolle im Ökosystem hilft dabei, die Biodiversität zu erhalten und sicherzustellen, dass es genügend Ressourcen für alle gibt. Ich achte darauf, meine Umwelt nicht zu übernutzen, sondern im Einklang mit ihr zu leben, damit auch meine Nachkommen und die vieler anderer Arten eine nachhaltige Zukunft haben.
Zusammengefasst bin ich, der Prachtwickler, ein kleines, aber wichtiges Element in der Natur. Durch meine innovative Anpassungsfähigkeit, meine nachhaltige Lebensweise und mein Engagement für zukünftige Generationen trage ich dazu bei, ein gesundes und stabiles Ökosystem zu erhalten.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- Prachtwickler (Olethreutes arcuella)
Artenschutz in Franken®
Neuntöter (Lanius collurio)

Neuntöter (Lanius collurio)
Der Neuntöter (Lanius collurio) ist ein faszinierender Singvogel, der in Europa, Teilen Asiens und Nordafrikas verbreitet ist.
11/12.06.2024
Der Neuntöter gehört zur Familie der Würger (Laniidae) und zur Ordnung der Sperlingsvögel (Passeriformes).Neuntöter sind Zugvögel und verbringen den Winter in Afrika südlich der Sahara. Im Sommer brüten sie in offenen Landschaften wie Heiden, Buschland, Wiesen und Weiden mit isolierten Bäumen oder Büschen.
Der Neuntöter (Lanius collurio) ist ein faszinierender Singvogel, der in Europa, Teilen Asiens und Nordafrikas verbreitet ist.
11/12.06.2024
- Hier sind, so finden wir, einige interessante Fakten über diese Art:
Der Neuntöter gehört zur Familie der Würger (Laniidae) und zur Ordnung der Sperlingsvögel (Passeriformes).Neuntöter sind Zugvögel und verbringen den Winter in Afrika südlich der Sahara. Im Sommer brüten sie in offenen Landschaften wie Heiden, Buschland, Wiesen und Weiden mit isolierten Bäumen oder Büschen.
Männliche Neuntöter haben ein auffälliges Gefieder mit einem grauen Kopf, einem schwarzen Augenstreif und einem rostbraunen Rücken. Die Weibchen sind weniger kontrastreich gefärbt und haben eine braun gestreifte Unterseite. Neuntöter sind Fleischfresser und ernähren sich hauptsächlich von Insekten wie Käfern, Heuschrecken, Schmetterlingen und Spinnen. Sie jagen von Ansitzwarten aus und stoßen dann blitzschnell auf ihre Beute zu.
Während der Brutzeit verteidigen Neuntöter aggressiv ihr Territorium. Sie bauen ihre Nester in dornigen Büschen oder Bäumen und legen gewöhnlich vier bis sechs Eier.Neuntöter sind dafür bekannt, ihre Beute auf Dornen oder Stacheldraht zu spießen. Dieses Verhalten dient dazu, die Nahrung zu lagern, indem sie sie für später verzehren. Sie werden daher auch manchmal als "Fleischräuber" bezeichnet.
In einigen Teilen Europas, insbesondere in Großbritannien, ist der Bestand des Neuntöters rückläufig. Dies ist auf Lebensraumverlust durch intensive Landwirtschaft, Pestizideinsatz und Verlust von Brutplätzen zurückzuführen. In anderen Regionen, wie zum Beispiel in Teilen von Osteuropa, ist der Neuntöter jedoch häufiger anzutreffen.
In der Aufnahme von Rolf Thiemann
Während der Brutzeit verteidigen Neuntöter aggressiv ihr Territorium. Sie bauen ihre Nester in dornigen Büschen oder Bäumen und legen gewöhnlich vier bis sechs Eier.Neuntöter sind dafür bekannt, ihre Beute auf Dornen oder Stacheldraht zu spießen. Dieses Verhalten dient dazu, die Nahrung zu lagern, indem sie sie für später verzehren. Sie werden daher auch manchmal als "Fleischräuber" bezeichnet.
In einigen Teilen Europas, insbesondere in Großbritannien, ist der Bestand des Neuntöters rückläufig. Dies ist auf Lebensraumverlust durch intensive Landwirtschaft, Pestizideinsatz und Verlust von Brutplätzen zurückzuführen. In anderen Regionen, wie zum Beispiel in Teilen von Osteuropa, ist der Neuntöter jedoch häufiger anzutreffen.
In der Aufnahme von Rolf Thiemann
- Neuntöter Paar
Artenschutz in Franken®
Braunbrustigel in Bayern auf dem Rückzug

Braunbrustigel in Bayern auf dem Rückzug
11/12.06.2027
Nehmen wir zum Bespiel den gravierenden Lebensraumverlust: Der Verlust von natürlichen Lebensräumen durch Urbanisierung, Landwirtschaft und Infrastrukturprojekte ist einer der Hauptgründe für deren rückläufige Bestände welche die Spezies in Bayern bereits auf die Vorwarnliste gefährdeter Arten geführt hat.
Igel benötigen abwechslungsreiche Landschaften mit Hecken, Wiesen und Gärten, um Nahrung und Unterschlupf zu finden. Monokulturen und versiegelte Flächen bieten ihnen kaum geeigneten Lebensraum.
11/12.06.2027
- Der teils gravierende Rückgang der Braunbrustigel in Deutschland ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen, die sowohl natürliche als auch menschengemachte Ursachen umfassen.
Nehmen wir zum Bespiel den gravierenden Lebensraumverlust: Der Verlust von natürlichen Lebensräumen durch Urbanisierung, Landwirtschaft und Infrastrukturprojekte ist einer der Hauptgründe für deren rückläufige Bestände welche die Spezies in Bayern bereits auf die Vorwarnliste gefährdeter Arten geführt hat.
Igel benötigen abwechslungsreiche Landschaften mit Hecken, Wiesen und Gärten, um Nahrung und Unterschlupf zu finden. Monokulturen und versiegelte Flächen bieten ihnen kaum geeigneten Lebensraum.
Durch eine in unseren Augen viel zu intensive Landwirtschaft: Der Einsatz von Pestiziden und Herbiziden in der Landwirtschaft reduziert die Verfügbarkeit von Insekten, Würmern und anderen Kleintieren, die wichtige Nahrungsquellen für Igel sind. Zudem können Pestizide direkt toxisch für Igel sein. Auch spielt der Verkehr eine Rolle bei Rückgang der Bestände: Sehr viele Igel werden im Straßenverkehr teils schwer verletzt und getötet. Besonders in dicht besiedelten Gebieten mit vielen Straßen und wenig sicheren Übergängen ist dies ein großes Problem.
Ein Aspekt der immer wieder vergessen wird ist die Gartenpflege: Auch die Art und Weise, wie Gärten gepflegt werden, hat einen Einfluss. Kurz gemähte Rasenflächen, der Einsatz von Laubbläsern und das Entfernen von Hecken und Sträuchern nehmen den Igeln Schutz und Reproduktionsmöglichkeiten. Auch fallen immer mehr Igel sogenannten Mährobotern zum Opfer, denn bei Gefahr rollen sich die Kleinsäuger einfach zusammen anstatt zu fliehen. Dieser, an anderer Stelle effektive Schutzmechanismus, hilft hier den Igeln nichts, er schadet ihnen sogar, denn die Tiere werden häufig überfahren und entweder sofort getötet oder vielfach schwer verletzt und verenden dann kläglich.
Auch und gerade der Klimawandel ist eine Ursache: Veränderungen im Klima können das Nahrungsangebot und die Lebensbedingungen für Igel beeinträchtigen. Milder Winter und unregelmäßige Wetterbedingungen können den Winterschlaf der Igel stören und ihre Überlebenschancen verringern. Krankheiten und Parasiten: Igel sind anfällig für verschiedene Krankheiten und Parasiten, die durch Stress und unzureichende Ernährung begünstigt werden können. Nahrungsmangel: Eine zunehmende Konkurrenz um Nahrung, bedingt durch die oben genannten Faktoren, kann ebenfalls zum Rückgang der Igelpopulation beitragen.
Die Kombination dieser Faktoren führt zu einem drastischen Rückgang der Braunbrustigel in Deutschland. Es gibt jedoch verschiedene Initiativen und Naturschutzprojekte, die darauf abzielen, den Lebensraum der Igel zu schützen und ihre Population zu stabilisieren. Dazu gehören der Erhalt und die Schaffung von igelfreundlichen Gärten, die Verringerung des Pestizideinsatzes und Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit für Wildtiere.
Artenschutz in Franken® engagiert sich seit vielen Jahren in diesem Sinn.
In der Aufnahme von Helga Zinnecker
Ein Aspekt der immer wieder vergessen wird ist die Gartenpflege: Auch die Art und Weise, wie Gärten gepflegt werden, hat einen Einfluss. Kurz gemähte Rasenflächen, der Einsatz von Laubbläsern und das Entfernen von Hecken und Sträuchern nehmen den Igeln Schutz und Reproduktionsmöglichkeiten. Auch fallen immer mehr Igel sogenannten Mährobotern zum Opfer, denn bei Gefahr rollen sich die Kleinsäuger einfach zusammen anstatt zu fliehen. Dieser, an anderer Stelle effektive Schutzmechanismus, hilft hier den Igeln nichts, er schadet ihnen sogar, denn die Tiere werden häufig überfahren und entweder sofort getötet oder vielfach schwer verletzt und verenden dann kläglich.
Auch und gerade der Klimawandel ist eine Ursache: Veränderungen im Klima können das Nahrungsangebot und die Lebensbedingungen für Igel beeinträchtigen. Milder Winter und unregelmäßige Wetterbedingungen können den Winterschlaf der Igel stören und ihre Überlebenschancen verringern. Krankheiten und Parasiten: Igel sind anfällig für verschiedene Krankheiten und Parasiten, die durch Stress und unzureichende Ernährung begünstigt werden können. Nahrungsmangel: Eine zunehmende Konkurrenz um Nahrung, bedingt durch die oben genannten Faktoren, kann ebenfalls zum Rückgang der Igelpopulation beitragen.
Die Kombination dieser Faktoren führt zu einem drastischen Rückgang der Braunbrustigel in Deutschland. Es gibt jedoch verschiedene Initiativen und Naturschutzprojekte, die darauf abzielen, den Lebensraum der Igel zu schützen und ihre Population zu stabilisieren. Dazu gehören der Erhalt und die Schaffung von igelfreundlichen Gärten, die Verringerung des Pestizideinsatzes und Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit für Wildtiere.
Artenschutz in Franken® engagiert sich seit vielen Jahren in diesem Sinn.
In der Aufnahme von Helga Zinnecker
- Zunehmend gefährdet, Jungigel
Artenschutz in Franken®
Wenn Ackerrandstreifen als Lebensraum beeinträchtigt werden

Wenn Ackerrandstreifen als Lebensraum beeinträchtigt werden
11/12.06.2024
In unserem Land wird viel über den Erhalt der Biodiversität gesprochen, auch wie dringlich es scheint den Insektenschutz voranzubringen, zum Wohle auch des Menschen und dann … dieser Anblick … ein Spiegelbild der Situation in nahezu ganz Deutschland … ob viele Verursacher*innen eigentlich wissen das diese Flächen häufig nicht ihnen, sondern der Allgemeinheit gehören?
11/12.06.2024
- Das geht schon etliche Jahre so … vor einer Woche waren A. Schumacher und ich exakt an dieser Stelle um hier noch Tagpfauenaugen zu beobachten und fotografieren. Nun, eine Woche später … alles wurde niedergemacht … keine Raupe mehr weit und breit zu finden.
In unserem Land wird viel über den Erhalt der Biodiversität gesprochen, auch wie dringlich es scheint den Insektenschutz voranzubringen, zum Wohle auch des Menschen und dann … dieser Anblick … ein Spiegelbild der Situation in nahezu ganz Deutschland … ob viele Verursacher*innen eigentlich wissen das diese Flächen häufig nicht ihnen, sondern der Allgemeinheit gehören?
Auf diese vielfach anzutreffenden Eigentumsverhältnisse darf gerne hingewiesen werden, wenn es nicht gelingt ein entsprechend professionelles Management auf den Weg zu bringen. Es ist keine Bagatelle, wenn hier Lebensräume gravierend zerstört werden, um die wohl Gewinnmaximierung Einzelner zu erhören und an den Interessen der breiten Mehrheit vorbei zu agieren!
Auch andere Spezies benötigen ausreichend Lebensraum und hier stellen gerade Feldgehölzstreifen welche Flurwege begleiten einen wertvollen Ansatz dar … hier leben beispielsweise noch Neuntöter die Rückzugs- Nistplatz und in den Blühstreifen ausreichend für die nachfolgende Generation finden.
Wenn ein Miteinander angesprochen wird, dann sollten alle Seiten in der Lage sein über den berühmten „Tellerrand“ hinauszublicken …
In der Aufnahme von Rolf Thiemann
Quelle
Rolf Thiemann
Naturschutzberater
Stand
02.06.2026
Auch andere Spezies benötigen ausreichend Lebensraum und hier stellen gerade Feldgehölzstreifen welche Flurwege begleiten einen wertvollen Ansatz dar … hier leben beispielsweise noch Neuntöter die Rückzugs- Nistplatz und in den Blühstreifen ausreichend für die nachfolgende Generation finden.
Wenn ein Miteinander angesprochen wird, dann sollten alle Seiten in der Lage sein über den berühmten „Tellerrand“ hinauszublicken …
In der Aufnahme von Rolf Thiemann
- "Hygiene am Acker- Seitenstreifen" ... was hat das mit Hygiene zu tun?
Quelle
Rolf Thiemann
Naturschutzberater
Stand
02.06.2026
Artenschutz in Franken®
Goldgrüne Waffenfliege (Chloromyia formosa)

Goldgrüne Waffenfliege (Chloromyia formosa)
10/11.06.2024
Meine schillernden, metallisch grünen und goldenen Farben machen mich zu einer auffälligen Erscheinung in der Natur. Lass mich dir aus meiner Perspektive erzählen, wie ich lebe und warum mein Dasein nachhaltig, innovativ und im Sinne zukünftiger Generationen ist.
10/11.06.2024
- Hallo! Ich bin die Goldgrüne Waffenfliege, oder wie die Menschen mich nennen, Chloromyia formosa.
Meine schillernden, metallisch grünen und goldenen Farben machen mich zu einer auffälligen Erscheinung in der Natur. Lass mich dir aus meiner Perspektive erzählen, wie ich lebe und warum mein Dasein nachhaltig, innovativ und im Sinne zukünftiger Generationen ist.
Nachhaltig:
Mein Lebenszyklus und meine Lebensweise sind vollkommen auf Nachhaltigkeit ausgelegt. Ich lege meine Eier in verrottendes Pflanzenmaterial oder in feuchte, schattige Böden ab. Dadurch helfe ich, den natürlichen Abbauprozess zu beschleunigen und den Boden mit Nährstoffen zu bereichern. Meine Larven ernähren sich von Mikroorganismen und zerfallendem organischen Material, was den Kreislauf der Nährstoffe unterstützt und die Bodenfruchtbarkeit verbessert. So trage ich zur Gesundheit der Umwelt bei, indem ich Teil eines Systems bin, das Abfallstoffe in wertvolle Ressourcen umwandelt.
Innovativ:
Die Art und Weise, wie wir Waffenfliegen uns an verschiedene Lebensräume anpassen, ist äußerst innovativ. Wir sind in der Lage, in verschiedenen Umgebungen zu überleben, sei es in städtischen Gärten oder in ländlichen Wäldern. Diese Flexibilität ermöglicht es uns, in verschiedenen Ökosystemen eine Rolle zu spielen und ihre Gesundheit zu fördern. Außerdem haben wir eine einzigartige Art der Fortbewegung und Nahrungssuche entwickelt, die uns effizient und anpassungsfähig macht. Unser eleganter Flug und die Art, wie wir Nektar und Pollen von Blumen sammeln, sind Beispiele für unsere innovative Anpassungsfähigkeit.
Im Sinne uns nachfolgender Generationen:
Alles, was ich tue, ist darauf ausgerichtet, eine lebenswerte Welt für die nächste Generation zu hinterlassen. Indem ich den Boden fruchtbarer mache und die Pflanzenbestäubung unterstütze, trage ich zur Erhaltung der Artenvielfalt bei. Mein Beitrag zur natürlichen Abfallverwertung und Nährstoffrückführung sichert, dass nachfolgende Generationen von Insekten, Pflanzen und anderen Lebewesen in einem gesunden, stabilen Ökosystem leben können. So sorge ich dafür, dass auch meine Nachkommen und die vieler anderer Arten eine nachhaltige Zukunft haben.
Insgesamt bin ich, die Goldgrüne Waffenfliege, ein kleines, aber wichtiges Rädchen im großen Getriebe der Natur. Durch mein nachhaltiges Handeln, meine innovative Anpassungsfähigkeit und mein Engagement für kommende Generationen spiele ich eine unverzichtbare Rolle im Erhalt unserer Umwelt.
Aufnahme von Bernhard Schmalisch
Mein Lebenszyklus und meine Lebensweise sind vollkommen auf Nachhaltigkeit ausgelegt. Ich lege meine Eier in verrottendes Pflanzenmaterial oder in feuchte, schattige Böden ab. Dadurch helfe ich, den natürlichen Abbauprozess zu beschleunigen und den Boden mit Nährstoffen zu bereichern. Meine Larven ernähren sich von Mikroorganismen und zerfallendem organischen Material, was den Kreislauf der Nährstoffe unterstützt und die Bodenfruchtbarkeit verbessert. So trage ich zur Gesundheit der Umwelt bei, indem ich Teil eines Systems bin, das Abfallstoffe in wertvolle Ressourcen umwandelt.
Innovativ:
Die Art und Weise, wie wir Waffenfliegen uns an verschiedene Lebensräume anpassen, ist äußerst innovativ. Wir sind in der Lage, in verschiedenen Umgebungen zu überleben, sei es in städtischen Gärten oder in ländlichen Wäldern. Diese Flexibilität ermöglicht es uns, in verschiedenen Ökosystemen eine Rolle zu spielen und ihre Gesundheit zu fördern. Außerdem haben wir eine einzigartige Art der Fortbewegung und Nahrungssuche entwickelt, die uns effizient und anpassungsfähig macht. Unser eleganter Flug und die Art, wie wir Nektar und Pollen von Blumen sammeln, sind Beispiele für unsere innovative Anpassungsfähigkeit.
Im Sinne uns nachfolgender Generationen:
Alles, was ich tue, ist darauf ausgerichtet, eine lebenswerte Welt für die nächste Generation zu hinterlassen. Indem ich den Boden fruchtbarer mache und die Pflanzenbestäubung unterstütze, trage ich zur Erhaltung der Artenvielfalt bei. Mein Beitrag zur natürlichen Abfallverwertung und Nährstoffrückführung sichert, dass nachfolgende Generationen von Insekten, Pflanzen und anderen Lebewesen in einem gesunden, stabilen Ökosystem leben können. So sorge ich dafür, dass auch meine Nachkommen und die vieler anderer Arten eine nachhaltige Zukunft haben.
Insgesamt bin ich, die Goldgrüne Waffenfliege, ein kleines, aber wichtiges Rädchen im großen Getriebe der Natur. Durch mein nachhaltiges Handeln, meine innovative Anpassungsfähigkeit und mein Engagement für kommende Generationen spiele ich eine unverzichtbare Rolle im Erhalt unserer Umwelt.
Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- Goldgrüne Waffenfliege (Chloromyia formosa) - Weibchen
Artenschutz in Franken®
Helle Tanzfliege (Empis livida)

Helle Tanzfliege (Empis livida)
10/11.06.2024
Lass mich dir aus meiner Perspektive erzählen, wie ich lebe und wie ich dazu beitrage, die Umwelt zu schützen und nachhaltige Praktiken zu fördern, um die Welt für kommende Generationen zu bewahren.
10/11.06.2024
- Hallo, ich bin eine Helle Tanzfliege, wissenschaftlich bekannt als Empis livida.
Lass mich dir aus meiner Perspektive erzählen, wie ich lebe und wie ich dazu beitrage, die Umwelt zu schützen und nachhaltige Praktiken zu fördern, um die Welt für kommende Generationen zu bewahren.
Ein Tag im Leben einer Hellen Tanzfliege
Ich bin eine kleine, aber wichtige Kreatur in unserem Ökosystem. Mein Leben beginnt, wenn ich aus meiner Puppenhülle schlüpfe. Als erwachsene Fliege habe ich eine wichtige Aufgabe: die Bestäubung von Pflanzen. Während ich auf der Suche nach Nahrung von Blume zu Blume fliege, trage ich Pollen und helfe so, die Pflanzen zu befruchten. Ohne meine unermüdliche Arbeit würden viele Pflanzen nicht die Möglichkeit haben, Früchte und Samen zu produzieren.
Unser Beitrag zur Umwelt
Ich und meine Artgenossen sind wichtige Bestäuber. Durch die Bestäubung helfen wir, die Biodiversität zu erhalten und die Nahrungsketten stabil zu halten. Pflanzen, die von uns bestäubt werden, sind oft Nahrungsquellen für andere Tiere und tragen zur allgemeinen Gesundheit des Ökosystems bei.
Nahrungskette
Als Fliege spiele ich eine Rolle in der Nahrungskette. Meine Larven ernähren sich von totem organischen Material, was zur Zersetzung und Nährstoffrecycling beiträgt. Erwachsene Fliegen wie ich sind eine Nahrungsquelle für Vögel und andere Insektenfresser. Dadurch fördern wir ein ausgewogenes Ökosystem.
Innovativ-nachhaltige Maßnahmen
Förderung naturnaher Lebensräume:
Reduktion von Pestiziden:
Umweltbildung:
Für die nachfolgenden Generationen
Unser Dasein und unsere Funktionen im Ökosystem sind von unschätzbarem Wert für die nachfolgenden Generationen. Indem wir die natürliche Bestäubung unterstützen, tragen wir zur Produktion von Nahrungsmitteln bei, die für die zukünftigen Generationen lebenswichtig sind. Nachhaltige Praktiken, die uns schützen, tragen dazu bei, eine lebenswerte und gesunde Umwelt für alle Lebewesen zu erhalten.
Also, denk an uns, die kleinen Hellen Tanzfliegen, und unterstütze Praktiken, die nicht nur uns, sondern auch zukünftigen Generationen zugutekommen. Gemeinsam können wir eine nachhaltige und blühende Welt schaffen!
Aufnahme von Bernhard Schmalisch
Ich bin eine kleine, aber wichtige Kreatur in unserem Ökosystem. Mein Leben beginnt, wenn ich aus meiner Puppenhülle schlüpfe. Als erwachsene Fliege habe ich eine wichtige Aufgabe: die Bestäubung von Pflanzen. Während ich auf der Suche nach Nahrung von Blume zu Blume fliege, trage ich Pollen und helfe so, die Pflanzen zu befruchten. Ohne meine unermüdliche Arbeit würden viele Pflanzen nicht die Möglichkeit haben, Früchte und Samen zu produzieren.
Unser Beitrag zur Umwelt
Ich und meine Artgenossen sind wichtige Bestäuber. Durch die Bestäubung helfen wir, die Biodiversität zu erhalten und die Nahrungsketten stabil zu halten. Pflanzen, die von uns bestäubt werden, sind oft Nahrungsquellen für andere Tiere und tragen zur allgemeinen Gesundheit des Ökosystems bei.
Nahrungskette
Als Fliege spiele ich eine Rolle in der Nahrungskette. Meine Larven ernähren sich von totem organischen Material, was zur Zersetzung und Nährstoffrecycling beiträgt. Erwachsene Fliegen wie ich sind eine Nahrungsquelle für Vögel und andere Insektenfresser. Dadurch fördern wir ein ausgewogenes Ökosystem.
Innovativ-nachhaltige Maßnahmen
Förderung naturnaher Lebensräume:
- Um die Populationen von Bestäubern wie mir zu unterstützen, können Menschen naturnahe Lebensräume fördern. Das Anlegen von Blühwiesen, Hecken und naturbelassenen Gärten bietet uns Lebensraum und Nahrungsquellen. Solche Maßnahmen sind nachhaltig, da sie die Artenvielfalt fördern und langfristig stabile Ökosysteme schaffen.
Reduktion von Pestiziden:
- Der Einsatz von Pestiziden kann für uns tödlich sein. Eine nachhaltige Praxis ist der Einsatz von biologischen Schädlingsbekämpfungsmethoden und der Verzicht auf chemische Pestizide. Dies schützt nicht nur uns, sondern auch andere nützliche Insekten und die Bodenqualität.
Umweltbildung:
- Bildung spielt eine Schlüsselrolle. Indem Menschen über die Bedeutung von Fliegen wie mir und anderen Bestäubern aufgeklärt werden, können sie bessere Entscheidungen für den Umweltschutz treffen. Programme in Schulen und Gemeinden, die die Wichtigkeit der Biodiversität und nachhaltiger Praktiken lehren, sind entscheidend.
Für die nachfolgenden Generationen
Unser Dasein und unsere Funktionen im Ökosystem sind von unschätzbarem Wert für die nachfolgenden Generationen. Indem wir die natürliche Bestäubung unterstützen, tragen wir zur Produktion von Nahrungsmitteln bei, die für die zukünftigen Generationen lebenswichtig sind. Nachhaltige Praktiken, die uns schützen, tragen dazu bei, eine lebenswerte und gesunde Umwelt für alle Lebewesen zu erhalten.
Also, denk an uns, die kleinen Hellen Tanzfliegen, und unterstütze Praktiken, die nicht nur uns, sondern auch zukünftigen Generationen zugutekommen. Gemeinsam können wir eine nachhaltige und blühende Welt schaffen!
Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- Helle Tanzfliege (Empis livida)
Artenschutz in Franken®
Lebensräume erhalten und optimieren

Lebensräume erhalten und optimieren
10/11.06.2024
Um ein sehr gutes Biotopmanagement gerade in der vielfach ausgeräumten Kulturlandschaft gewährleisten zu können, bedarf es neben einem immensen Fachwissen auch das nötige Fingerspitzengefühl um dieses entsprechend nachhaltig fortführen zu können.
All das findet sich in den Reihen des Artenschutz in Franken® und so war es selbstverständlich, das wir uns auch dieser Herausforderung annahmen.
10/11.06.2024
Um ein sehr gutes Biotopmanagement gerade in der vielfach ausgeräumten Kulturlandschaft gewährleisten zu können, bedarf es neben einem immensen Fachwissen auch das nötige Fingerspitzengefühl um dieses entsprechend nachhaltig fortführen zu können.
All das findet sich in den Reihen des Artenschutz in Franken® und so war es selbstverständlich, das wir uns auch dieser Herausforderung annahmen.
Aber weshalb wurde dieser Eingriff denn überhaupt relevant?
Immer wieder wird doch auch von uns gefordert Natur einmal Natur sein zu lassen und nicht einzugreifen. Für Großschutzgebiete und auch größere Fläche inmitten naturbelassener Strukturen mag das der effektive Weg sein. Doch hier sprechen wir über eine Fläche von wenigen Hundert Quadratmetern, die sich inmitten intensiv bewirtschafteter Feld-Forststrukturen befindet und hier müssen wir einen etwas anderen Ansatz wählen, wenn diese Fläche tatsächlich zu einem Hotspot der Biodiversität werden und diesen Status auch halten soll.
Stürme hatten in der Vergangenheit dazu geführt, dass hier Bäume aus angrenzenden Flächen auf das Biotop stürzten, auch neigten fließgewässerbegleitende Altbäume dazu, sich sehr weit dem Licht der Biotopfreifläche zuzuneigen, und die Neigung führte dazu das einige Altbäume auf die Biotopfläche zu stürzen drohten, was zu einer wesentlichen Lebensraumverschlechterung geführt hätte.
Welche Arten sprechen wir hier vornehmlich an?
In erster Linie sind es Pflanzenstrukturen die sich, als Hochflurstauden abbilden und deren Lebensraum in unserer vornehmlich industriell-landschaftlich geführten Umwelt als zunehmende Rarität abbildet. Auch der Ansatz zur Erhaltung von Kopfweiden spielt hier eine mitentscheidende Rolle. Ein Kleingewässer, welches in den vergangenen Jahren seine ganz eigenen Lebensraumtypus fand, jedoch zunehmend mit Verschattung zu kämpfen.
In den vergangenen Jahren wurde diese Fläche von Jägern als Anfütterungsstelle für Wildschweine verwendet und beeinträchtigt. Dieses Fehlverhalten wurde nach dem entsprechenden Antreffen von unserer Seite unverzüglich korrigiert und die Verantwortlichen darauf aufmerksam gemacht das bei einer Wiederholung mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen ist.
Wir möchten diese Fläche als Rückzugsraum für zahlreiche Insekten und Amphibienarten angesehen wissen, auch für lebensraumtypische Kleinvögel- und Kleinsäuger soll hier ein geeigneter Überlebensraum vorgehalten werden.Das kann jedoch nur gelingen, wenn diese kleine Fläche entsprechend professionell gemanagt wird, um deren Bedeutung entsprechend aufrechterhalten zu können.
In 2024 wurde deshalb ein Pflegeeingriff auf den Weg gebracht, der den angestrebten Biotopcharakter wieder herstellen und festigen wird.
In der Aufnahme
Immer wieder wird doch auch von uns gefordert Natur einmal Natur sein zu lassen und nicht einzugreifen. Für Großschutzgebiete und auch größere Fläche inmitten naturbelassener Strukturen mag das der effektive Weg sein. Doch hier sprechen wir über eine Fläche von wenigen Hundert Quadratmetern, die sich inmitten intensiv bewirtschafteter Feld-Forststrukturen befindet und hier müssen wir einen etwas anderen Ansatz wählen, wenn diese Fläche tatsächlich zu einem Hotspot der Biodiversität werden und diesen Status auch halten soll.
Stürme hatten in der Vergangenheit dazu geführt, dass hier Bäume aus angrenzenden Flächen auf das Biotop stürzten, auch neigten fließgewässerbegleitende Altbäume dazu, sich sehr weit dem Licht der Biotopfreifläche zuzuneigen, und die Neigung führte dazu das einige Altbäume auf die Biotopfläche zu stürzen drohten, was zu einer wesentlichen Lebensraumverschlechterung geführt hätte.
Welche Arten sprechen wir hier vornehmlich an?
In erster Linie sind es Pflanzenstrukturen die sich, als Hochflurstauden abbilden und deren Lebensraum in unserer vornehmlich industriell-landschaftlich geführten Umwelt als zunehmende Rarität abbildet. Auch der Ansatz zur Erhaltung von Kopfweiden spielt hier eine mitentscheidende Rolle. Ein Kleingewässer, welches in den vergangenen Jahren seine ganz eigenen Lebensraumtypus fand, jedoch zunehmend mit Verschattung zu kämpfen.
In den vergangenen Jahren wurde diese Fläche von Jägern als Anfütterungsstelle für Wildschweine verwendet und beeinträchtigt. Dieses Fehlverhalten wurde nach dem entsprechenden Antreffen von unserer Seite unverzüglich korrigiert und die Verantwortlichen darauf aufmerksam gemacht das bei einer Wiederholung mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen ist.
Wir möchten diese Fläche als Rückzugsraum für zahlreiche Insekten und Amphibienarten angesehen wissen, auch für lebensraumtypische Kleinvögel- und Kleinsäuger soll hier ein geeigneter Überlebensraum vorgehalten werden.Das kann jedoch nur gelingen, wenn diese kleine Fläche entsprechend professionell gemanagt wird, um deren Bedeutung entsprechend aufrechterhalten zu können.
In 2024 wurde deshalb ein Pflegeeingriff auf den Weg gebracht, der den angestrebten Biotopcharakter wieder herstellen und festigen wird.
In der Aufnahme
- Ende April 2024 blicken wir auf das vor einigen Jahren neu angelegte Kleingewässer das seine vormals angedachte Funktion als Amphibienlaichgewässer verloren hatte und auch die Insektenvielfalt ging aufgrund der Beschattung sehr stark zurück.
Artenschutz in Franken®
Referenzflächen im Fokus des Artenschutz in Franken®

Referenzflächen im Fokus des Artenschutz in Franken®
09/10.06.2024
Wir haben einfach genug von den standardisierten Wäldern die in unseren Augen schon lange keine Wälder im eigentlichen Sinn mehr sind und zu mehr oder minder einförmigen Forsten mutieren.
09/10.06.2024
- Das Gerede vom Klimawald der Zukunft und dem Verbissdruck der durch Rehwild hervorgerufen wird und den Wald nicht mehr „hochkommen lässt“ können wir einfach nicht mehr hören.
Wir haben einfach genug von den standardisierten Wäldern die in unseren Augen schon lange keine Wälder im eigentlichen Sinn mehr sind und zu mehr oder minder einförmigen Forsten mutieren.
So haben wir 10 Flächen auserkoren und nachhaltig in den Fokus eines internen Monitorings des Artenschutz in Franken® gestellt. Diese Flächen waren in den vergangenen Jahren durch starken Borkenkäferbefall ausgefallen und wurden nahezu Baumfrei gestellt.
Nun dürfen sie sich entwickeln wie sie möchten und wir sind hautnah dabei. Alljährlich werden wir in den kommenden Jahren immer wieder zum gleichen Zeitpunkt einige Aufnahme erstellen und damit deren Entwicklung darstellen.
In der Aufnahme
Nun dürfen sie sich entwickeln wie sie möchten und wir sind hautnah dabei. Alljährlich werden wir in den kommenden Jahren immer wieder zum gleichen Zeitpunkt einige Aufnahme erstellen und damit deren Entwicklung darstellen.
In der Aufnahme
- Eindrücke vom 12.05.2024
Artenschutz in Franken®
Knautien-Sandbiene (Andrena hattorfiana)

Ich bin eine Knautien-Sandbiene (Andrena hattorfiana), und ich möchte euch ein wenig über mein Leben erzählen.
08/09.06.2024
08/09.06.2024
- Vielleicht versteht ihr dann besser, warum wir Wildbienen so wichtig für die Natur sind und wie ihr uns dabei helfen könnt hier weiterhin leben zu dürfen.
Mein Aussehen und Lebensraum
Ich bin eine recht große Wildbiene mit einer Körperlänge von etwa 12 bis 14 Millimetern. Weibchen haben eine schwarze Grundfarbe mit auffällig orangeroter Behaarung am Hinterleib. Männchen sind etwas kleiner und weniger auffällig gefärbt. Ich lebe vorzugsweise in trockenen, blütenreichen Lebensräumen wie Kalkmagerrasen, Trockenrasen und blumenreichen Wiesen, hier fühle ich mich sehr wohl.
Meine Lieblingsblume: Die Wiesen-Witwenblume
Eine ganz besondere Pflanze spielt in meinem Leben eine zentrale Rolle: die Wiesen-Witwenblume (Knautia arvensis). Diese Pflanze ist für mich nicht nur eine wertvolle Nahrungsquelle, sondern auch der Ort, an dem ich meine Eier ablege. Die Weibchen unter uns sammeln ausschließlich Pollen von dieser Pflanze, um damit unsere Larven, also unsere nächste Generation zu versorgen.
Mein Tagesablauf
An einem typischen Tag fliege ich von Blüte zu Blüte der Wiesen-Witwenblume und sammle Pollen. Ich habe spezielle Haarbürsten an meinen Beinen, die mir helfen, den Pollen zu sammeln und zu transportieren. Sobald ich genug Pollen gesammelt habe, fliege ich zurück zu meinem Nest im Boden. Dort forme ich den Pollen zu kleinen Vorräten für meine zukünftigen Nachkommen.
Mein Nest
Mein Nest baue ich in sandigem oder lockerem Boden. Ich grabe kleine Tunnel und Kammern, in die ich den gesammelten Pollen lege und meine Eier darauf absetze. Aus den Eiern schlüpfen bald winzige Larven, die sich von dem Pollen ernähren und zu starken, gesunden Bienen heranwachsen.
Bedrohungen und Herausforderungen
Unser Leben ist jedoch nicht immer einfach. Unsere Lebensräume werden immer knapper, weil Wiesen bebaut, intensiv landwirtschaftlich genutzt oder durch Pestizide, also vom Menschen ausgebrachte Gifte beeinträchtigt werden. Ohne genügend blütenreiche Wiesen und geeignete Nistplätze können wir nicht überleben. Das macht uns und viele andere Wildbienenarten sehr anfällig.
Was ihr tun könnt, um zu helfen --- Es gibt viele Möglichkeiten, wie ihr uns helfen könnt:
Wir Knautien-Sandbienen sind nur eine von vielen Wildbienenarten, die zur Bestäubung von Pflanzen beitragen und somit eine wichtige Rolle im Ökosystem spielen. Indem ihr uns helft, helft ihr auch der Natur und sichert die Vielfalt und Gesundheit unserer Umwelt – für uns und für die kommenden Generationen.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
Ich bin eine recht große Wildbiene mit einer Körperlänge von etwa 12 bis 14 Millimetern. Weibchen haben eine schwarze Grundfarbe mit auffällig orangeroter Behaarung am Hinterleib. Männchen sind etwas kleiner und weniger auffällig gefärbt. Ich lebe vorzugsweise in trockenen, blütenreichen Lebensräumen wie Kalkmagerrasen, Trockenrasen und blumenreichen Wiesen, hier fühle ich mich sehr wohl.
Meine Lieblingsblume: Die Wiesen-Witwenblume
Eine ganz besondere Pflanze spielt in meinem Leben eine zentrale Rolle: die Wiesen-Witwenblume (Knautia arvensis). Diese Pflanze ist für mich nicht nur eine wertvolle Nahrungsquelle, sondern auch der Ort, an dem ich meine Eier ablege. Die Weibchen unter uns sammeln ausschließlich Pollen von dieser Pflanze, um damit unsere Larven, also unsere nächste Generation zu versorgen.
Mein Tagesablauf
An einem typischen Tag fliege ich von Blüte zu Blüte der Wiesen-Witwenblume und sammle Pollen. Ich habe spezielle Haarbürsten an meinen Beinen, die mir helfen, den Pollen zu sammeln und zu transportieren. Sobald ich genug Pollen gesammelt habe, fliege ich zurück zu meinem Nest im Boden. Dort forme ich den Pollen zu kleinen Vorräten für meine zukünftigen Nachkommen.
Mein Nest
Mein Nest baue ich in sandigem oder lockerem Boden. Ich grabe kleine Tunnel und Kammern, in die ich den gesammelten Pollen lege und meine Eier darauf absetze. Aus den Eiern schlüpfen bald winzige Larven, die sich von dem Pollen ernähren und zu starken, gesunden Bienen heranwachsen.
Bedrohungen und Herausforderungen
Unser Leben ist jedoch nicht immer einfach. Unsere Lebensräume werden immer knapper, weil Wiesen bebaut, intensiv landwirtschaftlich genutzt oder durch Pestizide, also vom Menschen ausgebrachte Gifte beeinträchtigt werden. Ohne genügend blütenreiche Wiesen und geeignete Nistplätze können wir nicht überleben. Das macht uns und viele andere Wildbienenarten sehr anfällig.
Was ihr tun könnt, um zu helfen --- Es gibt viele Möglichkeiten, wie ihr uns helfen könnt:
- Blühwiesen anlegen: Schafft mehr Lebensraum für uns, indem ihr blumenreiche Wiesen pflanzt. Besonders wichtig sind Pflanzen wie die Wiesen-Witwenblume.
- Keine Pestizide: Verzichtet auf chemische Pflanzenschutzmittel, die unsere Nahrungsquellen vergiften und uns schaden können.
- Nistplätze bieten: Lasst kleine ungestörte Bereiche in eurem Garten, wo wir unsere Nester bauen können. Sandige und lockere Böden sind ideal für uns.
- Öffentlichkeitsarbeit: Erzählt anderen von unserer wichtigen Rolle in der Natur und wie sie uns unterstützen können.
Wir Knautien-Sandbienen sind nur eine von vielen Wildbienenarten, die zur Bestäubung von Pflanzen beitragen und somit eine wichtige Rolle im Ökosystem spielen. Indem ihr uns helft, helft ihr auch der Natur und sichert die Vielfalt und Gesundheit unserer Umwelt – für uns und für die kommenden Generationen.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
- Knautien-Sandbiene (Andrena hattorfiana)
Artenschutz in Franken®
Eine kleine Erzählung die zum Nachdenken anregen kann ...

Eine Erzählung soll der uns nachfolgenden Generation den Himmelblauen Bläuling etwas näher bringen.
09/10.06.2024
Sie liebten es, die umliegenden Wiesen und Wälder zu erkunden. Eines sonnigen Nachmittags entschieden sie sich, auf die Suche nach dem seltenen Himmelblauen Bläuling zu gehen, einem Schmetterling, der in ihrer Region heimisch war.
"Warum wollen wir diesen Schmetterling eigentlich finden?" fragte Ben, während sie über einen blühenden Pfad wanderten.
09/10.06.2024
- In einem kleinen Dorf am Rande eines weitläufigen Naturschutzgebietes lebten drei Jugendliche: Anna, Ben und Clara.
Sie liebten es, die umliegenden Wiesen und Wälder zu erkunden. Eines sonnigen Nachmittags entschieden sie sich, auf die Suche nach dem seltenen Himmelblauen Bläuling zu gehen, einem Schmetterling, der in ihrer Region heimisch war.
"Warum wollen wir diesen Schmetterling eigentlich finden?" fragte Ben, während sie über einen blühenden Pfad wanderten.
"Der Himmelblaue Bläuling ist nicht nur wunderschön, sondern auch ein Zeichen für eine gesunde und intakte Umwelt," erklärte Anna. "Wenn er hier lebt, bedeutet das, dass unser Ökosystem in einem guten Zustand ist."
"Genau," fügte Clara hinzu. "Es ist wichtig, dass wir uns um unsere Natur kümmern – nicht nur für uns, sondern auch im Sinne der nachfolgenden Generationen. Nachhaltigkeit ist der Schlüssel."
Ben nickte nachdenklich. "Aber wie können wir sicherstellen, dass wir nachhaltig handeln?"
Anna lächelte. "Es gibt viele innovative Wege, wie wir unsere Umwelt schützen können. Zum Beispiel könnten wir ein Projekt starten, um mehr Blühwiesen anzulegen. Diese Wiesen bieten nicht nur Lebensraum für den Himmelblauen Bläuling, sondern auch für viele andere Insektenarten."
"Das klingt großartig!" rief Clara begeistert. "Und es wäre wirklich etwas, das wir an die nächste Generation weitergeben können. Ein Stück Natur, das dank unserer Bemühungen erhalten bleibt."
Die drei Freunde setzten ihre Suche fort und entdeckten schließlich eine kleine Lichtung, die von bunten Wildblumen übersät war. Dort, flatternd im sanften Wind, sahen sie ihn – den Himmelblauen Bläuling. Seine leuchtend blauen Flügel glitzerten in der Sonne.
"Das ist er!" flüsterte Ben ehrfürchtig. "Er ist wirklich wunderschön."
"Das ist das Zeichen, dass unsere Umwelt hier noch gesund ist," sagte Anna zufrieden. "Lasst uns dafür sorgen, dass es so bleibt."
Clara hob eine Handvoll Samen auf, die sie von einer der Blumen gesammelt hatte. "Lasst uns diese Samen pflanzen, wenn wir nach Hause kommen. So können wir sicherstellen, dass der Himmelblaue Bläuling auch in Zukunft hier leben kann."
Und so machten sich die drei Freunde auf den Weg zurück, erfüllt von der Hoffnung, dass ihre innovativen und nachhaltigen Bemühungen die Welt ein kleines bisschen besser machen würden – im Sinne der nachfolgenden Generationen.
Aufnahme von Klaus Sanwald
"Genau," fügte Clara hinzu. "Es ist wichtig, dass wir uns um unsere Natur kümmern – nicht nur für uns, sondern auch im Sinne der nachfolgenden Generationen. Nachhaltigkeit ist der Schlüssel."
Ben nickte nachdenklich. "Aber wie können wir sicherstellen, dass wir nachhaltig handeln?"
Anna lächelte. "Es gibt viele innovative Wege, wie wir unsere Umwelt schützen können. Zum Beispiel könnten wir ein Projekt starten, um mehr Blühwiesen anzulegen. Diese Wiesen bieten nicht nur Lebensraum für den Himmelblauen Bläuling, sondern auch für viele andere Insektenarten."
"Das klingt großartig!" rief Clara begeistert. "Und es wäre wirklich etwas, das wir an die nächste Generation weitergeben können. Ein Stück Natur, das dank unserer Bemühungen erhalten bleibt."
Die drei Freunde setzten ihre Suche fort und entdeckten schließlich eine kleine Lichtung, die von bunten Wildblumen übersät war. Dort, flatternd im sanften Wind, sahen sie ihn – den Himmelblauen Bläuling. Seine leuchtend blauen Flügel glitzerten in der Sonne.
"Das ist er!" flüsterte Ben ehrfürchtig. "Er ist wirklich wunderschön."
"Das ist das Zeichen, dass unsere Umwelt hier noch gesund ist," sagte Anna zufrieden. "Lasst uns dafür sorgen, dass es so bleibt."
Clara hob eine Handvoll Samen auf, die sie von einer der Blumen gesammelt hatte. "Lasst uns diese Samen pflanzen, wenn wir nach Hause kommen. So können wir sicherstellen, dass der Himmelblaue Bläuling auch in Zukunft hier leben kann."
Und so machten sich die drei Freunde auf den Weg zurück, erfüllt von der Hoffnung, dass ihre innovativen und nachhaltigen Bemühungen die Welt ein kleines bisschen besser machen würden – im Sinne der nachfolgenden Generationen.
Aufnahme von Klaus Sanwald
- Himmelblaue Bläulinge bei der Paarung
Artenschutz in Franken®
Die Garten-Bänderschnecke (Cepaea hortensis)

Die Garten-Bänderschnecke (Cepaea hortensis)
08/09.06.2024
Die Garten-Bänderschnecke, wissenschaftlich als Cepaea hortensis bekannt, ist eine so finden wir faszinierende und recht weit verbreitete Schneckenart, die man sehr oft in Gärten, Parks und Wäldern findet.
08/09.06.2024
Die Garten-Bänderschnecke, wissenschaftlich als Cepaea hortensis bekannt, ist eine so finden wir faszinierende und recht weit verbreitete Schneckenart, die man sehr oft in Gärten, Parks und Wäldern findet.
Aussehen und Merkmale
Die Garten-Bänderschnecke ist leicht an ihrem hübschen, spiralförmigen Haus zu erkennen. Ihr Gehäuse ist meist gelb oder cremefarben gehalten (doch nicht immer) und trägt mehrere dunkle Bänder, die ihr den recht prägenden Namen „Bänderschnecke" geben. Das Gehäuse kann etwa 2-3 Zentimeter im Durchmesser betragen, und die Bänder können unterschiedlich stark ausgeprägt sein, was jede Schnecke einzigartig macht.
Lebensraum und Verbreitung
Diese Schneckenart ist (noch) in ganz Europa verbreitet und fühlt sich in feuchten Umgebungen am wohlsten. Man findet sie oft unter Steinen, in Laubhaufen oder auch einfach zwischen Pflanzen im Garten. Sie bevorzugen vornehmlich schattige und feuchte Plätze, da sie sich stingent vor Austrocknung schützen müssen.
Ernährung und Verhalten
Die Garten-Bänderschnecke ist ein Pflanzenfresser und ernährt sich hauptsächlich von Blättern, Blüten und abgestorbenen Pflanzenresten. Manchmal kann sie auch Obst und Gemüse anknabbern, was jedoch Gärtner nicht immer freut. Trotzdem spielt sie eine wichtige Rolle im Ökosystem, da sie hilft, organisches Material zu zersetzen und den Boden zu düngen.
Fortpflanzung
Die Fortpflanzung der Garten-Bänderschnecke ist ebenfalls recht interessant. Diese Schnecken sind Zwitter, was bedeutet, dass sie sowohl männliche als auch weibliche Geschlechtsorgane besitzen. Bei der Paarung tauschen zwei Schnecken Spermatophoren aus, um sich gegenseitig zu befruchten. Einige Wochen später legt jede Schnecke bis zu 100 Eier, die in feuchtem Boden oder auch unter Laub versteckt werden. Nach etwa zwei Wochen schlüpfen die winzigen Jungschnecken, die bereits ein kleines Gehäuse tragen.
Feinde und Gefahren
Obwohl die Garten-Bänderschnecke recht gut geschützt ist, hat sie viele Feinde. Vögel, Igel und Kröten gehören zu ihren natürlichen Fressfeinden. Auch Menschen stellen eine Gefahr dar, besonders wenn Schneckenbekämpfungsmittel im Garten eingesetzt werden. Diese Chemikalien können nicht nur die Schnecken töten, sondern auch andere Tiere und das gesamte Ökosystem schädigen.
Bedeutung für den Garten
Auch wenn sie manchmal als Schädlinge betrachtet werden, haben Garten-Bänderschnecken so finden wir auch positive Auswirkungen auf den Garten. Sie helfen, abgestorbenes Pflanzenmaterial zu zersetzen und fördern so die Bodenqualität. Zudem sind sie ein wichtiger Teil der Nahrungskette und tragen zur Erhaltung der komplexen Biodiversität bei.
AiF - Schlussfolgerung
Die Garten-Bänderschnecke ist ein faszinierendes und wichtiges Lebewesen in unseren Gärten und Wäldern. Sie zeigt uns, wie vielfältig und komplex die Natur ist. Auch wenn sie manchmal als Schädlinge betrachtet werden, sollten wir ihre Rolle im Ökosystem nicht unterschätzen und versuchen, einen natürlichen und umweltfreundlichen Umgang mit ihnen zu finden. Indem wir die Garten-Bänderschnecke und andere Tiere schützen, tragen wir dazu bei, die Natur um uns herum zu bewahren und zu pflegen. Das ist in jedem Fall die Sichtweise des Artenschutz in Franken®
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
Die Garten-Bänderschnecke ist leicht an ihrem hübschen, spiralförmigen Haus zu erkennen. Ihr Gehäuse ist meist gelb oder cremefarben gehalten (doch nicht immer) und trägt mehrere dunkle Bänder, die ihr den recht prägenden Namen „Bänderschnecke" geben. Das Gehäuse kann etwa 2-3 Zentimeter im Durchmesser betragen, und die Bänder können unterschiedlich stark ausgeprägt sein, was jede Schnecke einzigartig macht.
Lebensraum und Verbreitung
Diese Schneckenart ist (noch) in ganz Europa verbreitet und fühlt sich in feuchten Umgebungen am wohlsten. Man findet sie oft unter Steinen, in Laubhaufen oder auch einfach zwischen Pflanzen im Garten. Sie bevorzugen vornehmlich schattige und feuchte Plätze, da sie sich stingent vor Austrocknung schützen müssen.
Ernährung und Verhalten
Die Garten-Bänderschnecke ist ein Pflanzenfresser und ernährt sich hauptsächlich von Blättern, Blüten und abgestorbenen Pflanzenresten. Manchmal kann sie auch Obst und Gemüse anknabbern, was jedoch Gärtner nicht immer freut. Trotzdem spielt sie eine wichtige Rolle im Ökosystem, da sie hilft, organisches Material zu zersetzen und den Boden zu düngen.
Fortpflanzung
Die Fortpflanzung der Garten-Bänderschnecke ist ebenfalls recht interessant. Diese Schnecken sind Zwitter, was bedeutet, dass sie sowohl männliche als auch weibliche Geschlechtsorgane besitzen. Bei der Paarung tauschen zwei Schnecken Spermatophoren aus, um sich gegenseitig zu befruchten. Einige Wochen später legt jede Schnecke bis zu 100 Eier, die in feuchtem Boden oder auch unter Laub versteckt werden. Nach etwa zwei Wochen schlüpfen die winzigen Jungschnecken, die bereits ein kleines Gehäuse tragen.
Feinde und Gefahren
Obwohl die Garten-Bänderschnecke recht gut geschützt ist, hat sie viele Feinde. Vögel, Igel und Kröten gehören zu ihren natürlichen Fressfeinden. Auch Menschen stellen eine Gefahr dar, besonders wenn Schneckenbekämpfungsmittel im Garten eingesetzt werden. Diese Chemikalien können nicht nur die Schnecken töten, sondern auch andere Tiere und das gesamte Ökosystem schädigen.
Bedeutung für den Garten
Auch wenn sie manchmal als Schädlinge betrachtet werden, haben Garten-Bänderschnecken so finden wir auch positive Auswirkungen auf den Garten. Sie helfen, abgestorbenes Pflanzenmaterial zu zersetzen und fördern so die Bodenqualität. Zudem sind sie ein wichtiger Teil der Nahrungskette und tragen zur Erhaltung der komplexen Biodiversität bei.
AiF - Schlussfolgerung
Die Garten-Bänderschnecke ist ein faszinierendes und wichtiges Lebewesen in unseren Gärten und Wäldern. Sie zeigt uns, wie vielfältig und komplex die Natur ist. Auch wenn sie manchmal als Schädlinge betrachtet werden, sollten wir ihre Rolle im Ökosystem nicht unterschätzen und versuchen, einen natürlichen und umweltfreundlichen Umgang mit ihnen zu finden. Indem wir die Garten-Bänderschnecke und andere Tiere schützen, tragen wir dazu bei, die Natur um uns herum zu bewahren und zu pflegen. Das ist in jedem Fall die Sichtweise des Artenschutz in Franken®
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- Garten-Bänderschnecke (Cepaea hortensis)
Artenschutz in Franken®
Artenschutzprojekt - Waldsaum ... 2024 bis 2030

Artenschutzprojekt - Waldsaum ... 2024 bis 2030
08/09.06.2024
Hecken an Waldsäumen sind wichtige Bestandteile vieler Ökosysteme. Sie bieten Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten, schützen den Boden vor Erosion und wirken als Pufferzone zwischen Wald und offener Landschaft. Die Entnahme dieser Hecken hat weitreichende ökologische Auswirkungen, die sich auf die Biodiversität, den Boden und das Mikroklima auswirken.
In diesem Projektbaustein werden die Folgen der Heckenentnahme erläutert und ein Blick in die Zukunft gerichtet, um mögliche Entwicklungen und Schutzmaßnahmen zu beleuchten.
08/09.06.2024
- Gefährdung durch die Entnahme von Hecken an Waldsäumen
- Artenschutzprojekt läuft an
- Weitere Aufnahmen eingestellt
Hecken an Waldsäumen sind wichtige Bestandteile vieler Ökosysteme. Sie bieten Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten, schützen den Boden vor Erosion und wirken als Pufferzone zwischen Wald und offener Landschaft. Die Entnahme dieser Hecken hat weitreichende ökologische Auswirkungen, die sich auf die Biodiversität, den Boden und das Mikroklima auswirken.
In diesem Projektbaustein werden die Folgen der Heckenentnahme erläutert und ein Blick in die Zukunft gerichtet, um mögliche Entwicklungen und Schutzmaßnahmen zu beleuchten.
Ökologische Bedeutung von Hecken an Waldsäumen
Hecken spielen eine entscheidende Rolle in Waldsäumen:
Auswirkungen der Heckenentnahme
Die Entfernung von Hecken an Waldsäumen hat mehrere negative Auswirkungen:
Zukunftsperspektiven und Schutzmaßnahmen
Angesichts der Bedrohungen, die durch die Entfernung von Hecken entstehen, sind folgende Maßnahmen und Entwicklungen für die Zukunft entscheidend:
Fazit
Die Entnahme von Hecken an Waldsäumen stellt eine erhebliche Gefahr für die Biodiversität, den Bodenschutz und das Mikroklima dar. Um diesen negativen Auswirkungen entgegenzuwirken, sind gezielte Schutzmaßnahmen, nachhaltige Landnutzung und umfassende Forschung notwendig. Durch den Erhalt und die Wiederherstellung von Hecken können wir nicht nur die Umwelt schützen, sondern auch die Resilienz von Ökosystemen gegenüber den Herausforderungen des Klimawandels und der menschlichen Einflüsse stärken. Die Zukunft der Hecken und der vielfältigen Lebensräume, die sie unterstützen, hängt von unserem Engagement und unseren Maßnahmen ab.
Und so haben sich neben Artenschutz in Franken® weitere Akteure aufgemacht, um sich am Beispiel einer durch menschliche Eingriffe im Niedergang befindlichen, waldrandbegleitenden Heckenzeile aufzuzeigen, wie es möglich wird, eine konsensgeführte Lösung zu finden, die allen Akteuren gerecht werden kann.
In der Aufnahme
Hecken spielen eine entscheidende Rolle in Waldsäumen:
- Lebensraum und Nahrungsquelle: Hecken bieten Unterschlupf und Nistplätze für Vögel, Insekten und kleine Säugetiere. Sie sind auch eine wichtige Nahrungsquelle, da viele Pflanzen in Hecken Früchte, Nektar und Samen produzieren.
- Biologische Vielfalt: Hecken fördern die Biodiversität, da sie als Korridore für den Austausch von Genen und Arten zwischen verschiedenen Lebensräumen dienen. Sie unterstützen die Verbreitung und das Überleben seltener und gefährdeter Arten.
- Bodenschutz und Erosion: Die Wurzelsysteme von Hecken stabilisieren den Boden und verhindern Erosion. Sie helfen auch dabei, Nährstoffe im Boden zu halten und verbessern die Bodenstruktur.
- Mikroklima: Hecken beeinflussen das Mikroklima, indem sie Wind brechen, Schatten spenden und die Luftfeuchtigkeit regulieren. Dies schafft günstigere Bedingungen für viele Pflanzen- und Tierarten.
Auswirkungen der Heckenentnahme
Die Entfernung von Hecken an Waldsäumen hat mehrere negative Auswirkungen:
- Verlust von Lebensraum: Viele Arten verlieren ihre Lebensräume, was zu einem Rückgang der Biodiversität führt. Besonders betroffen sind Arten, die auf Hecken als Brut- und Nistplätze angewiesen sind.
- Boden- und Wasserprobleme: Ohne die stabilisierende Wirkung der Hecken kommt es häufiger zu Bodenerosion, was die Fruchtbarkeit des Bodens verringert und Sedimente in Gewässer einträgt. Dies kann die Wasserqualität verschlechtern und aquatische Lebensräume beeinträchtigen.
- Klimatische Auswirkungen: Der Verlust von Hecken führt zu einer veränderten Mikroklima-Regulierung. Windgeschwindigkeiten nehmen zu, und es gibt weniger Schutz vor extremen Wetterbedingungen, was die Bedingungen für viele Pflanzen und Tiere verschlechtert.
- Fragmentierung von Lebensräumen: Hecken dienen als ökologische Korridore. Ihre Entfernung führt zur Fragmentierung von Lebensräumen, wodurch Tiere Schwierigkeiten haben, sich zu bewegen und neue Lebensräume zu besiedeln. Dies kann zu genetischer Isolation und einem erhöhten Risiko für das Aussterben lokaler Populationen führen.
Zukunftsperspektiven und Schutzmaßnahmen
Angesichts der Bedrohungen, die durch die Entfernung von Hecken entstehen, sind folgende Maßnahmen und Entwicklungen für die Zukunft entscheidend:
- Wiederherstellung und Schutz von Hecken: Es ist wichtig, bestehende Hecken zu schützen und neue anzupflanzen, um die ökologischen Funktionen wiederherzustellen. Naturschutzprogramme sollten gezielte Maßnahmen zur Heckenpflege und -erweiterung umfassen.
- Nachhaltige Landnutzung: Landwirte und Forstwirte sollten ermutigt werden, nachhaltige Praktiken zu übernehmen, die den Erhalt von Hecken fördern. Förderprogramme und finanzielle Anreize können helfen, diese Praktiken zu unterstützen.
- Ökologische Forschung und Monitoring: Kontinuierliche Forschung und Monitoring sind notwendig, um die Auswirkungen der Heckenentnahme besser zu verstehen und effektive Schutzstrategien zu entwickeln. Wissenschaftliche Studien sollten sich auf die Biodiversität, Bodengesundheit und Wasserqualität konzentrieren.
- Öffentlichkeitsarbeit und Bildung: Die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Bedeutung von Hecken und die ökologischen Konsequenzen ihrer Entfernung ist entscheidend. Bildungsprogramme und Kampagnen können helfen, das Bewusstsein zu schärfen und Gemeinschaften dazu zu bewegen, sich für den Schutz von Hecken einzusetzen.
Fazit
Die Entnahme von Hecken an Waldsäumen stellt eine erhebliche Gefahr für die Biodiversität, den Bodenschutz und das Mikroklima dar. Um diesen negativen Auswirkungen entgegenzuwirken, sind gezielte Schutzmaßnahmen, nachhaltige Landnutzung und umfassende Forschung notwendig. Durch den Erhalt und die Wiederherstellung von Hecken können wir nicht nur die Umwelt schützen, sondern auch die Resilienz von Ökosystemen gegenüber den Herausforderungen des Klimawandels und der menschlichen Einflüsse stärken. Die Zukunft der Hecken und der vielfältigen Lebensräume, die sie unterstützen, hängt von unserem Engagement und unseren Maßnahmen ab.
Und so haben sich neben Artenschutz in Franken® weitere Akteure aufgemacht, um sich am Beispiel einer durch menschliche Eingriffe im Niedergang befindlichen, waldrandbegleitenden Heckenzeile aufzuzeigen, wie es möglich wird, eine konsensgeführte Lösung zu finden, die allen Akteuren gerecht werden kann.
In der Aufnahme
- Unachtsamkeit - Desinteresse und fehlendes Wissen sind vielfach Hauptursachen für den Niedergang wertvoller Biotopstrukturen - ein konsensgeführtes Artenschutzprojekt, das sich über 6 Jahre erstrecken wird setzt hier an.
Artenschutz in Franken®
Ein „Spa-Resort für Weißstörche“

Ein „Spa-Resort für Weißstörche“
08/09.06.2024
Dein Lieblingsplatz auf der Erde? Eine üppige Feuchtwiese, natürlich! Lass uns gemeinsam einen kleinen Ausflug in diesen besonderen Lebensraum machen – mit einer Prise Humor und einem Augenzwinkern.
08/09.06.2024
- Stell dir vor, du bist ein Weißstorch, elegant und anmutig, hoch oben in den Lüften schwebend.
Dein Lieblingsplatz auf der Erde? Eine üppige Feuchtwiese, natürlich! Lass uns gemeinsam einen kleinen Ausflug in diesen besonderen Lebensraum machen – mit einer Prise Humor und einem Augenzwinkern.
Willkommen in der Feuchtwiese ... Die Feuchtwiese ist sozusagen das Spa-Resort für Weißstörche. Hier gibt es alles, was das Storchenherz begehrt: reichlich Wasser, saftiges Grün und eine schier endlose Auswahl an Leckereien. Diese Wiesen sind meist in der Nähe von Flüssen oder Seen zu finden und bieten ideale Bedingungen für Pflanzen und Tiere, die gerne ein bisschen nasse Füße haben.
Das Buffet ist eröffnet! ... Für einen Weißstorch ist die Feuchtwiese wie ein All-you-can-eat-Buffet. Von saftigen Fröschen über knackige Insekten bis hin zu kleinen Fischen – hier gibt es alles, was den Schnabel wässrig macht. Ein Storch könnte sagen: „Warum fliegen, wenn man hier alles auf einem Silbertablett serviert bekommt?“ Und natürlich mit einem eleganten Schnabelstupser aus dem Wasser gezogen wird.
Ein Storchenspa ...Neben der kulinarischen Vielfalt bietet die Feuchtwiese auch perfekte Bedingungen für die Entspannung und Pflege. Das flache Wasser und die weichen Böden sind ideal zum Staksen und Stochern. Hier können die Störche ihre Beine ausstrecken und ihre prächtigen Federn in aller Ruhe putzen. Man könnte fast meinen, sie würden sich in einer Wellness-Oase aufhalten!
Familienparadies ... Auch für den Nachwuchs ist die Feuchtwiese ein wahres Paradies. Hier können kleine Jungstörche ihre weiterführenden Schritte üben und ihre Flugkünste perfektionieren, ohne Angst haben zu müssen, in einen tiefen See zu plumpsen. Und was gibt es Schöneres, als den "Kleinen" beim "Herumwatscheln und Flügelschlagen" zuzusehen? Manchmal sieht es fast so aus, als würden sie eine lustige Tanzchoreografie einstudieren.
Der weiße "Ritter der Feuchtwiese" ... Der Weißstorch ist in vielen Kulturen ein Symbol für Glück und Fruchtbarkeit. Wenn man ihn über eine Feuchtwiese schreiten sieht, mit seinen langen roten Beinen und dem schneeweißen Gefieder, könnte man fast denken, ein edler Ritter patrouilliert durch sein grünes Königreich. Natürlich, ein Ritter mit einem Faible für Frösche und Fische, aber hey – jeder hat seine Vorlieben!
Die Feuchtwiese ist für den Weißstorch nicht nur ein Lebensraum, sondern ein wahres Paradies. Hier findet er alles, was er braucht, um glücklich und gesund zu leben. Mit einem Augenzwinkern und einem Hauch von Humor können wir nur sagen: Wenn wir Menschen es schaffen, diese wunderbaren Feuchtwiesen zu erhalten, dann wird der Weißstorch uns weiterhin mit seiner eleganten Präsenz und seinem fröhlichen Klappern erfreuen – und wer weiß, vielleicht bringt er uns ja auch ein bisschen von seinem Glück.
In der Aufnahme / Autorin Brigitte Schmitt
Das Buffet ist eröffnet! ... Für einen Weißstorch ist die Feuchtwiese wie ein All-you-can-eat-Buffet. Von saftigen Fröschen über knackige Insekten bis hin zu kleinen Fischen – hier gibt es alles, was den Schnabel wässrig macht. Ein Storch könnte sagen: „Warum fliegen, wenn man hier alles auf einem Silbertablett serviert bekommt?“ Und natürlich mit einem eleganten Schnabelstupser aus dem Wasser gezogen wird.
Ein Storchenspa ...Neben der kulinarischen Vielfalt bietet die Feuchtwiese auch perfekte Bedingungen für die Entspannung und Pflege. Das flache Wasser und die weichen Böden sind ideal zum Staksen und Stochern. Hier können die Störche ihre Beine ausstrecken und ihre prächtigen Federn in aller Ruhe putzen. Man könnte fast meinen, sie würden sich in einer Wellness-Oase aufhalten!
Familienparadies ... Auch für den Nachwuchs ist die Feuchtwiese ein wahres Paradies. Hier können kleine Jungstörche ihre weiterführenden Schritte üben und ihre Flugkünste perfektionieren, ohne Angst haben zu müssen, in einen tiefen See zu plumpsen. Und was gibt es Schöneres, als den "Kleinen" beim "Herumwatscheln und Flügelschlagen" zuzusehen? Manchmal sieht es fast so aus, als würden sie eine lustige Tanzchoreografie einstudieren.
Der weiße "Ritter der Feuchtwiese" ... Der Weißstorch ist in vielen Kulturen ein Symbol für Glück und Fruchtbarkeit. Wenn man ihn über eine Feuchtwiese schreiten sieht, mit seinen langen roten Beinen und dem schneeweißen Gefieder, könnte man fast denken, ein edler Ritter patrouilliert durch sein grünes Königreich. Natürlich, ein Ritter mit einem Faible für Frösche und Fische, aber hey – jeder hat seine Vorlieben!
Die Feuchtwiese ist für den Weißstorch nicht nur ein Lebensraum, sondern ein wahres Paradies. Hier findet er alles, was er braucht, um glücklich und gesund zu leben. Mit einem Augenzwinkern und einem Hauch von Humor können wir nur sagen: Wenn wir Menschen es schaffen, diese wunderbaren Feuchtwiesen zu erhalten, dann wird der Weißstorch uns weiterhin mit seiner eleganten Präsenz und seinem fröhlichen Klappern erfreuen – und wer weiß, vielleicht bringt er uns ja auch ein bisschen von seinem Glück.
In der Aufnahme / Autorin Brigitte Schmitt
- Aufgrund vom Hochwasser finden die Weißstörche in diesem Jahr (2024) bislang genug zum Fressen. Diese überflutete Wiese ist ein Paradies und Anlaufstelle für viele Störche aus der Umgebung.
Artenschutz in Franken®
Gold-Dickkopffalter (Carterocephalus silvicola)

Gold-Dickkopffalter (Carterocephalus silvicola) ...
07/08.06.2024
... Impressionen der Natur
Stell dir vor, du bist auf einer sommerlichen Wiese voller bunter Blumen, und plötzlich siehst du einen kleinen, schillernden Schmetterling, der von Blüte zu Blüte tanzt. Das ist der Gold-Dickkopffalter, wissenschaftlich bekannt als Carterocephalus silvicola. Mit seinen goldgelben Flecken auf den Flügeln sieht er fast aus wie ein kleiner, flatternder Schatz.
07/08.06.2024
... Impressionen der Natur
Stell dir vor, du bist auf einer sommerlichen Wiese voller bunter Blumen, und plötzlich siehst du einen kleinen, schillernden Schmetterling, der von Blüte zu Blüte tanzt. Das ist der Gold-Dickkopffalter, wissenschaftlich bekannt als Carterocephalus silvicola. Mit seinen goldgelben Flecken auf den Flügeln sieht er fast aus wie ein kleiner, flatternder Schatz.
- Lass uns auf eine kleine Entdeckungsreise gehen und mehr über diesen zauberhaften Falter erfahren – natürlich auf eine spielerische und spannende Weise!
Ein kleiner Flugkünstler
Der Gold-Dickkopffalter ist ein wahrer Meister der Lüfte. Mit seinen kompakten Flügeln und seinem schnellen, ruckartigen Flugstil erinnert er an einen winzigen Helikopter. Diese innovativen Flugmanöver machen ihn zu einem schwer zu fangenden Insekt und bieten ihm Schutz vor hungrigen Vögeln. Seine Flügelspannweite beträgt nur etwa 2,5 bis 3 Zentimeter – also nicht viel größer als ein kleiner "Gummibär"!
Ein Leben im Einklang mit der Natur
Dieser kleine Falter ist ein Paradebeispiel für nachhaltiges Leben. Seine Raupen ernähren sich hauptsächlich von verschiedenen Süßgräsern, die in vielen natürlichen Wiesen vorkommen. Durch diese ausgewogene Ernährung trägt der Gold-Dickkopffalter zur Gesundheit und Vielfalt der Wiesen bei, indem er dabei hilft, das Gleichgewicht im Ökosystem zu wahren. Es ist, als ob er uns eine wichtige Lektion in Sachen Nachhaltigkeit erteilt: Leben im Einklang mit der Natur ist der Schlüssel zu einem gesunden Planeten.
Eine Reise durch die Jahreszeiten
Im Frühling legt das Gold-Dickkopffalter-Weibchen winzige Eier auf die Gräser. Aus diesen Eiern schlüpfen bald hungrige Raupen, die sich durch das frische Grün fressen. Nach einer ausgiebigen Fressphase verpuppen sich die Raupen und verwandeln sich schließlich in die hübschen, goldgesprenkelten Falter, die wir so bewundern. Diese Verwandlung ist nicht nur ein Wunder der Natur, sondern auch ein Symbol für ständige Erneuerung und Anpassung – ganz im Sinne uns nachfolgender Generationen. So zeigt uns der Falter, dass jede Lebensphase wichtig ist und zum Kreislauf des Lebens beiträgt.
Ein Plädoyer für die Zukunft
Der Gold-Dickkopffalter braucht unsere Hilfe, um auch in Zukunft über blühende Wiesen flattern zu können. Durch den Erhalt und die Pflege von natürlichen Lebensräumen können wir sicherstellen, dass dieser zauberhafte Schmetterling auch von unseren Kindern und Enkelkindern bewundert werden kann. Es ist eine einfache, aber wirkungsvolle Maßnahme, die im Sinne einer nachhaltigen und innovativen Zukunft steht.
Zusammengefasst
Der Gold-Dickkopffalter, Carterocephalus silvicola, ist nicht nur ein wunderschöner Anblick, sondern auch ein Lehrmeister in Sachen Innovation, Nachhaltigkeit und Verantwortung für kommende Generationen. Indem wir seinen Lebensraum schützen und pflegen, tragen wir dazu bei, die Wunder der Natur auch für die Zukunft zu bewahren. So wird jeder kleine Falterflug zu einem Symbol für eine nachhaltige und harmonische Welt.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
Der Gold-Dickkopffalter ist ein wahrer Meister der Lüfte. Mit seinen kompakten Flügeln und seinem schnellen, ruckartigen Flugstil erinnert er an einen winzigen Helikopter. Diese innovativen Flugmanöver machen ihn zu einem schwer zu fangenden Insekt und bieten ihm Schutz vor hungrigen Vögeln. Seine Flügelspannweite beträgt nur etwa 2,5 bis 3 Zentimeter – also nicht viel größer als ein kleiner "Gummibär"!
Ein Leben im Einklang mit der Natur
Dieser kleine Falter ist ein Paradebeispiel für nachhaltiges Leben. Seine Raupen ernähren sich hauptsächlich von verschiedenen Süßgräsern, die in vielen natürlichen Wiesen vorkommen. Durch diese ausgewogene Ernährung trägt der Gold-Dickkopffalter zur Gesundheit und Vielfalt der Wiesen bei, indem er dabei hilft, das Gleichgewicht im Ökosystem zu wahren. Es ist, als ob er uns eine wichtige Lektion in Sachen Nachhaltigkeit erteilt: Leben im Einklang mit der Natur ist der Schlüssel zu einem gesunden Planeten.
Eine Reise durch die Jahreszeiten
Im Frühling legt das Gold-Dickkopffalter-Weibchen winzige Eier auf die Gräser. Aus diesen Eiern schlüpfen bald hungrige Raupen, die sich durch das frische Grün fressen. Nach einer ausgiebigen Fressphase verpuppen sich die Raupen und verwandeln sich schließlich in die hübschen, goldgesprenkelten Falter, die wir so bewundern. Diese Verwandlung ist nicht nur ein Wunder der Natur, sondern auch ein Symbol für ständige Erneuerung und Anpassung – ganz im Sinne uns nachfolgender Generationen. So zeigt uns der Falter, dass jede Lebensphase wichtig ist und zum Kreislauf des Lebens beiträgt.
Ein Plädoyer für die Zukunft
Der Gold-Dickkopffalter braucht unsere Hilfe, um auch in Zukunft über blühende Wiesen flattern zu können. Durch den Erhalt und die Pflege von natürlichen Lebensräumen können wir sicherstellen, dass dieser zauberhafte Schmetterling auch von unseren Kindern und Enkelkindern bewundert werden kann. Es ist eine einfache, aber wirkungsvolle Maßnahme, die im Sinne einer nachhaltigen und innovativen Zukunft steht.
Zusammengefasst
Der Gold-Dickkopffalter, Carterocephalus silvicola, ist nicht nur ein wunderschöner Anblick, sondern auch ein Lehrmeister in Sachen Innovation, Nachhaltigkeit und Verantwortung für kommende Generationen. Indem wir seinen Lebensraum schützen und pflegen, tragen wir dazu bei, die Wunder der Natur auch für die Zukunft zu bewahren. So wird jeder kleine Falterflug zu einem Symbol für eine nachhaltige und harmonische Welt.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
- Gold-Dickkopffalter (Carterocephalus silvicola)
Artenschutz in Franken®
Gerippter Brachkäfer (Amphimallon solstitiale)

Gerippter Brachkäfer (Amphimallon solstitiale)
07/08.06.2024
Dieser Käfer, der hauptsächlich in Europa beheimatet ist, bietet spannende Einblicke in die Welt der nachhaltigen Ökosysteme und der innovativen Ansätze im Naturschutz.
07/08.06.2024
- Der Gerippte Brachkäfer (Amphimallon solstitiale), im Volksmund auch als Johanniskäfer oder Junikäfer bekannt, ist ein faszinierendes Insekt, das nicht nur aufgrund seiner goldbraunen Färbung und seiner markanten Rippenstruktur auf den Flügeldecken auffällt.
Dieser Käfer, der hauptsächlich in Europa beheimatet ist, bietet spannende Einblicke in die Welt der nachhaltigen Ökosysteme und der innovativen Ansätze im Naturschutz.
Ein Vorbild der Nachhaltigkeit
Der Lebenszyklus des Gerippten Brachkäfers steht beispielhaft für nachhaltige Prozesse in der Natur. Die Käferlarven, die im Boden leben, tragen zur Bodenfruchtbarkeit bei, indem sie organisches Material zersetzen. Diese natürliche Kompostierung verbessert die Bodenstruktur und fördert das Wachstum gesunder Pflanzen. Ein gesundes Bodenökosystem, das durch diese Käfer unterstützt wird, ist somit ein wesentlicher Beitrag zur nachhaltigen Landwirtschaft.
Innovative Naturschutzansätze
Im Zuge der modernen Landwirtschaft und des Einsatzes von Pestiziden ist die Population des Gerippten Brachkäfers in vielen Regionen rückläufig. Doch innovative Naturschutzprojekte setzen sich für den Schutz dieses Käfers ein. Durch die Schaffung von Lebensräumen, die den natürlichen Bedürfnissen des Brachkäfers entsprechen, können Landwirte und Naturschützer gemeinsam daran arbeiten, diesen nützlichen Insekten einen sicheren Lebensraum zu bieten. Ein Beispiel ist die Anlage von Blühstreifen und Hecken, die nicht nur den Käfern, sondern auch vielen anderen Insektenarten zugutekommen.
Im Sinne nachfolgender Generationen
Der Schutz des Gerippten Brachkäfers ist auch ein Akt der Verantwortung gegenüber zukünftigen Generationen. Indem wir die Biodiversität erhalten und fördern, schaffen wir eine lebenswerte Umwelt für unsere Kinder und Enkel. Der Käfer steht somit symbolisch für eine bewusste und umsichtige Lebensweise, die den Wert jedes Lebewesens anerkennt und respektiert. Die Sicherung seiner Lebensräume ist ein kleiner, aber wichtiger Schritt in Richtung einer nachhaltigeren Welt.
Fazit
Der Gerippte Brachkäfer ist mehr als nur ein Insekt; er ist in unseren Augen ein Botschafter für nachhaltige Praktiken und innovative Ansätze im Naturschutz. Durch den Schutz und die Förderung dieser Art tragen wir dazu bei, ein gesundes und vielfältiges Ökosystem zu bewahren – im Sinne uns nachfolgender Generationen. Der Erhalt der Biodiversität ist ein Schlüssel zu einer nachhaltigeren Zukunft, und der Gerippte Brachkäfer spielt dabei eine wichtige Rolle.
Aufnahme von Klaus Sanwald
Der Lebenszyklus des Gerippten Brachkäfers steht beispielhaft für nachhaltige Prozesse in der Natur. Die Käferlarven, die im Boden leben, tragen zur Bodenfruchtbarkeit bei, indem sie organisches Material zersetzen. Diese natürliche Kompostierung verbessert die Bodenstruktur und fördert das Wachstum gesunder Pflanzen. Ein gesundes Bodenökosystem, das durch diese Käfer unterstützt wird, ist somit ein wesentlicher Beitrag zur nachhaltigen Landwirtschaft.
Innovative Naturschutzansätze
Im Zuge der modernen Landwirtschaft und des Einsatzes von Pestiziden ist die Population des Gerippten Brachkäfers in vielen Regionen rückläufig. Doch innovative Naturschutzprojekte setzen sich für den Schutz dieses Käfers ein. Durch die Schaffung von Lebensräumen, die den natürlichen Bedürfnissen des Brachkäfers entsprechen, können Landwirte und Naturschützer gemeinsam daran arbeiten, diesen nützlichen Insekten einen sicheren Lebensraum zu bieten. Ein Beispiel ist die Anlage von Blühstreifen und Hecken, die nicht nur den Käfern, sondern auch vielen anderen Insektenarten zugutekommen.
Im Sinne nachfolgender Generationen
Der Schutz des Gerippten Brachkäfers ist auch ein Akt der Verantwortung gegenüber zukünftigen Generationen. Indem wir die Biodiversität erhalten und fördern, schaffen wir eine lebenswerte Umwelt für unsere Kinder und Enkel. Der Käfer steht somit symbolisch für eine bewusste und umsichtige Lebensweise, die den Wert jedes Lebewesens anerkennt und respektiert. Die Sicherung seiner Lebensräume ist ein kleiner, aber wichtiger Schritt in Richtung einer nachhaltigeren Welt.
Fazit
Der Gerippte Brachkäfer ist mehr als nur ein Insekt; er ist in unseren Augen ein Botschafter für nachhaltige Praktiken und innovative Ansätze im Naturschutz. Durch den Schutz und die Förderung dieser Art tragen wir dazu bei, ein gesundes und vielfältiges Ökosystem zu bewahren – im Sinne uns nachfolgender Generationen. Der Erhalt der Biodiversität ist ein Schlüssel zu einer nachhaltigeren Zukunft, und der Gerippte Brachkäfer spielt dabei eine wichtige Rolle.
Aufnahme von Klaus Sanwald
- Gerippter Brachkäfer (Amphimallon solstitiale)
Artenschutz in Franken®
Alte Kräne als Nistplätze für den Weißstorch

Alte Kräne als Nistplätze für den Weißstorch
07/08.06.2024
Sie bauen ihre Nester oft auf Bäumen, Dächern, Schornsteinen oder auch eben speziell errichteten Storchennest-Plattformen. In letzter Zeit sind jedoch auch alte Kräne in den Fokus der Tiere geraten und zu beliebten Nistplätzen für Weißstörche geworden.
Aber warum werden eigentlich diese Strukturen von Weißstörchen angenommen?
07/08.06.2024
- Weißstörche (Ciconia ciconia) sind große, beeindruckende Vögel, die bekanntlich auf hohen Strukturen nisten.
Sie bauen ihre Nester oft auf Bäumen, Dächern, Schornsteinen oder auch eben speziell errichteten Storchennest-Plattformen. In letzter Zeit sind jedoch auch alte Kräne in den Fokus der Tiere geraten und zu beliebten Nistplätzen für Weißstörche geworden.
Aber warum werden eigentlich diese Strukturen von Weißstörchen angenommen?
Hier sind einige mögliche Gründe welche die Vögel anregen dieses zu generieren:
Gründe für das Nisten auf alten Kranen
Mögliche Vorteile für die Umwelt und den Artenschutz
Herausforderungen
Insgesamt zeigt das Nisten von Weißstörchen auf alten Kranen eine beeindruckende Anpassungsfähigkeit dieser kulturfolgenden Vögel und bietet eine interessante und konkrete Möglichkeit, den Artenschutz mit der Wiederverwendung alter Industrieinfrastruktur zu verbinden. Doch es gilt nach unserer Auffassung dabei auch immer darauf zu achten das die Lebensräume entsprechend gestalten werden müssen, denn ein alter Kran allein wird nicht ausreichen um einen, für den Weißstorch interessanten Lebensraum zu kreieren.
In der Aufnahme von Brigitte Schmitt
Gründe für das Nisten auf alten Kranen
- Höhe und Sicherheit: Weißstörche bevorzugen hohe Nistplätze, da diese Schutz vor zahlreichen natürlichen Beutegreifern bieten und eine gute Sicht auf die Umgebung ermöglichen. Alte Kräne bieten die nötige Höhe und (hoffentlich) Stabilität.
- Verfügbarkeit: In vielen industriellen oder ländlichen Gebieten stehen alte Kräne oft ungenutzt herum, was sie zu attraktiven Nistplätzen macht. Diese Strukturen sind oft frei von menschlicher Aktivität, was den Störchen zusätzlichen Schutz bietet.
- Stabilität und Platz: Kräne bieten eine solide Basis und genügend Platz für die großen Nester, die Weißstörche bauen.
Mögliche Vorteile für die Umwelt und den Artenschutz
- Förderung des Artenschutzes: Das Bereitstellen von Nistplätzen auf alten Kränen kann somit und wohl nicht „nur“ in diesem Fall gar zum Erhalt der Weißstorchpopulation beitragen. Es bietet den Störchen sichere Brutplätze in Gebieten, in denen natürliche Nistplätze knapp sind.
- Erhöhung der Sichtbarkeit: Wenn Störche auf weithin sichtbaren Strukturen wie Kranen nisten, steigert das das Bewusstsein der Menschen für diese Vögel und ihre Schutzbedürfnisse.
- Wiederverwendung von Strukturen: Die Nutzung alter, ungenutzter Kräne für die Storchennistplätze ist eine Form des Recyclings und gibt diesen Strukturen einen neuen, artenschutzrelevanten Zweck.
Herausforderungen
- Wartung und Sicherheit: Alte Kräne können und werden irgendwann verfallen und somit unsicher für die hier nistenden Störche werden. Es erfordert somit regelmäßige Inspektionen und manchmal auch Reparaturen, um diese Nistplätze sicher zu halten.
- Koexistenz mit Menschen: In einigen Fällen kann die Nähe von Storchennestern auf alten Kranen zu Konflikten mit menschlichen Aktivitäten führen, besonders wenn diese Kräne in Gebieten stehen, die wieder in Betrieb genommen werden sollen.
Insgesamt zeigt das Nisten von Weißstörchen auf alten Kranen eine beeindruckende Anpassungsfähigkeit dieser kulturfolgenden Vögel und bietet eine interessante und konkrete Möglichkeit, den Artenschutz mit der Wiederverwendung alter Industrieinfrastruktur zu verbinden. Doch es gilt nach unserer Auffassung dabei auch immer darauf zu achten das die Lebensräume entsprechend gestalten werden müssen, denn ein alter Kran allein wird nicht ausreichen um einen, für den Weißstorch interessanten Lebensraum zu kreieren.
In der Aufnahme von Brigitte Schmitt
- Einen alten Kran hat sich ein Paar Weißstörche im Landkreis Bamberg (Bayern) ausgesucht um hier ihren Nistplatz anzulegen ... wie man erkennen kann mit Erfolg.
Artenschutz in Franken®
Klima-Wetter-Kapriolen ... behindern Lebensraumgestaltung

Die Wilden Bienchen von Weeze
06/07.06.2024
Wildbienen - die unbekannten Bestäuber
Eigentlich haben die meisten von uns in ihrem Leben schon einmal Wildbienen gesehen. Doch bewusst als solche wahrgenommen werden diese Tiere kaum. Vielfach werden sie gar mit Wespen oder Fliegen verwechselt. Und hier zeigt sich auch bereits ein elementares Problem. Aufgrund einer weitverbreiteten Unkenntnis werden „die Wildbiene“ und deren Ansprüche an ihre Lebensräume nicht erkannt.
06/07.06.2024
- Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und der Stadt Weeze das von der Deutschen Postcode Lotterie und von LIKK (Landschaftsschutz im Kreis Kleve unterstützt wird.
Wildbienen - die unbekannten Bestäuber
Eigentlich haben die meisten von uns in ihrem Leben schon einmal Wildbienen gesehen. Doch bewusst als solche wahrgenommen werden diese Tiere kaum. Vielfach werden sie gar mit Wespen oder Fliegen verwechselt. Und hier zeigt sich auch bereits ein elementares Problem. Aufgrund einer weitverbreiteten Unkenntnis werden „die Wildbiene“ und deren Ansprüche an ihre Lebensräume nicht erkannt.
Wildbienen - für uns Menschen ungemein wichtig
Wir Menschen sind darauf angewiesen, dass unsere (Kultur) -Pflanzen bestäubt werden. Wildbienen spielen hierbei eine weitaus größere Rolle als bislang angenommen. Doch Wildbienen sichern nicht nur die Ernteerträge in der Landwirtschaft. Da sie häufig in enger Symbiose mit „ihrer Wildpflanze“ leben, sichern die kleinen Insekten auch das Überleben zahlloser Wildpflanzen.
Wildbienen – häufig im Bestand gefährdet
Doch viele unserer Wildbienenarten in Deutschland sind zwischenzeitlich akut in ihrem Bestand bedroht. Gerade auch durch eine zunehmend industrielle Landbewirtschaftung mit einem immensen Pestizideinsatz sowie der Zerstörung wichtiger Lebensräume haben wir Menschen zahlreiche Wildbienenarten bereits nahe an den Rand des Aussterbens gebracht. Je intensiver die Bewirtschaftungsformen und je umfangreicher Bewirtschaftungs-flächen werden, desto stärker hängt der Ertrag der Landwirtschaft auch von Wildbienen ab. Je mehr Lebensräume wir mit unserem Handeln in unserem Umfeld beeinträchtigen gefährden wir nicht nur eine faszinierende Insektengruppe. Nein mehr noch, wir setzen mit diesem Tun gar eine der (auch und gerade für den Menschen) wichtigsten Ökosysteme aufs Spiel.
In der Aufnahme von Ulrich Francken
Wir Menschen sind darauf angewiesen, dass unsere (Kultur) -Pflanzen bestäubt werden. Wildbienen spielen hierbei eine weitaus größere Rolle als bislang angenommen. Doch Wildbienen sichern nicht nur die Ernteerträge in der Landwirtschaft. Da sie häufig in enger Symbiose mit „ihrer Wildpflanze“ leben, sichern die kleinen Insekten auch das Überleben zahlloser Wildpflanzen.
Wildbienen – häufig im Bestand gefährdet
Doch viele unserer Wildbienenarten in Deutschland sind zwischenzeitlich akut in ihrem Bestand bedroht. Gerade auch durch eine zunehmend industrielle Landbewirtschaftung mit einem immensen Pestizideinsatz sowie der Zerstörung wichtiger Lebensräume haben wir Menschen zahlreiche Wildbienenarten bereits nahe an den Rand des Aussterbens gebracht. Je intensiver die Bewirtschaftungsformen und je umfangreicher Bewirtschaftungs-flächen werden, desto stärker hängt der Ertrag der Landwirtschaft auch von Wildbienen ab. Je mehr Lebensräume wir mit unserem Handeln in unserem Umfeld beeinträchtigen gefährden wir nicht nur eine faszinierende Insektengruppe. Nein mehr noch, wir setzen mit diesem Tun gar eine der (auch und gerade für den Menschen) wichtigsten Ökosysteme aufs Spiel.
In der Aufnahme von Ulrich Francken
- 2024er Dauerregen behindert die Entwicklung der Lebensraumgestaltung
Artenschutz in Franken®
Gemeiner Bienenkäfer (Trichodes apiarius)

Der Gemeine Bienenkäfer (Trichodes apiarius): Ein bunter Helfer der Natur
06/07.06.2024
Mit seinen leuchtend roten und schwarzen Streifen auf dem Panzer zieht er nicht nur die Blicke zahlreicher Mitmenschen auf sich, sondern spielt auch eine wichtige Rolle im Ökosystem.
06/07.06.2024
- Der Gemeine Bienenkäfer, wissenschaftlich bekannt als Trichodes apiarius, ist ein doch recht auffälliges und faszinierendes Mitglied der Insektenwelt.
Mit seinen leuchtend roten und schwarzen Streifen auf dem Panzer zieht er nicht nur die Blicke zahlreicher Mitmenschen auf sich, sondern spielt auch eine wichtige Rolle im Ökosystem.
Lebensweise und Lebensraum
Der Gemeine Bienenkäfer ist in weiten Teilen Europas heimisch und bevorzugt warme, sonnige Gebiete, in denen viele Blütenpflanzen vorkommen. Er ist häufig in Gärten, Wiesen und Waldrändern anzutreffen. Die erwachsenen Käfer ernähren sich hauptsächlich von Pollen und Nektar, während die Larven als Parasiten in den Nestern von Wild- und Honigbienen leben. Diese einzigartige Lebensweise macht den Bienenkäfer zu einem in unseren Augen doch recht interessanten Beispiel für die Komplexität natürlicher Interaktionen.
Innovativ und anpassungsfähig
Die Lebensweise des Gemeinen Bienenkäfers ist nach unserer festen Überzeugung ein innovatives Beispiel für Anpassung und Überleben in der Natur. Indem seine Larven in den Bienenstöcken leben und sich von den Bienenlarven ernähren, zeigt der Bienenkäfer eine bemerkenswerte Anpassungsfähigkeit an seine Umwelt. Diese parasitäre Beziehung mag auf den ersten Blick für den oder die Einen / Eine negativ erscheinen, aber sie trägt konkret zur Kontrolle der Bienenpopulationen bei und verhindert Überpopulationen, was langfristig zur Gesundheit / Vitalität des Ökosystems beiträgt.
Nachhaltigkeit im Insektenreich
Der Gemeine Bienenkäfer spielt eine wichtige Rolle im Gleichgewicht der Natur und trägt so zur Nachhaltigkeit des Ökosystems bei. Die Käfer helfen, die Populationen von Wild- und Honigbienen zu regulieren, was wiederum Auswirkungen auf die Bestäubung und die Gesundheit / Vitalität von Pflanzen hat. Durch ihre Tätigkeit unterstützen sie indirekt die Artenvielfalt und das Funktionieren der Nahrungsnetze. Dies zeigt, so finden wir, wie jedes Lebewesen, selbst ein kleiner Käfer, Teil eines größeren, nachhaltigen Systems ist.
Im Sinne nachfolgender Generationen
Der Erhalt des Gemeinen Bienenkäfers und seiner natürlichen Lebensräume ist im Sinne der nachfolgenden Generationen von großer Bedeutung. Indem wir die Biodiversität fördern und schützen, stellen wir sicher, dass zukünftige Generationen eine reiche und vielfältige Natur erleben können. Der Bienenkäfer erinnert uns daran, dass jede Art – ob groß oder klein – ihren Platz im Ökosystem hat und zur Stabilität und Gesundheit unseres Planeten beiträgt.
„Lustige „A.i.F Aspekte“ des Gemeinen Bienenkäfers
Zusammenfassung
Der Gemeine Bienenkäfer, Trichodes apiarius, ist ein in unseren Augen sehr bemerkenswertes Beispiel für die Innovationskraft der Natur und die Bedeutung nachhaltiger ökologischer Beziehungen. Seine Rolle im Ökosystem zeigt, wie wichtig es ist, auch scheinbar kleine und unbedeutende Arten zu schützen. Im Sinne der nachfolgenden Generationen sollten wir die Vielfalt und das Gleichgewicht der Natur bewahren und wertschätzen.
In der spektakulären Aufnahme von Bernhard Schmalisch
Der Gemeine Bienenkäfer ist in weiten Teilen Europas heimisch und bevorzugt warme, sonnige Gebiete, in denen viele Blütenpflanzen vorkommen. Er ist häufig in Gärten, Wiesen und Waldrändern anzutreffen. Die erwachsenen Käfer ernähren sich hauptsächlich von Pollen und Nektar, während die Larven als Parasiten in den Nestern von Wild- und Honigbienen leben. Diese einzigartige Lebensweise macht den Bienenkäfer zu einem in unseren Augen doch recht interessanten Beispiel für die Komplexität natürlicher Interaktionen.
Innovativ und anpassungsfähig
Die Lebensweise des Gemeinen Bienenkäfers ist nach unserer festen Überzeugung ein innovatives Beispiel für Anpassung und Überleben in der Natur. Indem seine Larven in den Bienenstöcken leben und sich von den Bienenlarven ernähren, zeigt der Bienenkäfer eine bemerkenswerte Anpassungsfähigkeit an seine Umwelt. Diese parasitäre Beziehung mag auf den ersten Blick für den oder die Einen / Eine negativ erscheinen, aber sie trägt konkret zur Kontrolle der Bienenpopulationen bei und verhindert Überpopulationen, was langfristig zur Gesundheit / Vitalität des Ökosystems beiträgt.
Nachhaltigkeit im Insektenreich
Der Gemeine Bienenkäfer spielt eine wichtige Rolle im Gleichgewicht der Natur und trägt so zur Nachhaltigkeit des Ökosystems bei. Die Käfer helfen, die Populationen von Wild- und Honigbienen zu regulieren, was wiederum Auswirkungen auf die Bestäubung und die Gesundheit / Vitalität von Pflanzen hat. Durch ihre Tätigkeit unterstützen sie indirekt die Artenvielfalt und das Funktionieren der Nahrungsnetze. Dies zeigt, so finden wir, wie jedes Lebewesen, selbst ein kleiner Käfer, Teil eines größeren, nachhaltigen Systems ist.
Im Sinne nachfolgender Generationen
Der Erhalt des Gemeinen Bienenkäfers und seiner natürlichen Lebensräume ist im Sinne der nachfolgenden Generationen von großer Bedeutung. Indem wir die Biodiversität fördern und schützen, stellen wir sicher, dass zukünftige Generationen eine reiche und vielfältige Natur erleben können. Der Bienenkäfer erinnert uns daran, dass jede Art – ob groß oder klein – ihren Platz im Ökosystem hat und zur Stabilität und Gesundheit unseres Planeten beiträgt.
„Lustige „A.i.F Aspekte“ des Gemeinen Bienenkäfers
- Farbenfroher Panzer: Mit seinem rot-schwarz gestreiften Panzer sieht, so finden wir, der Gemeine Bienenkäfer aus, als hätte er seinen eigenen Designeranzug – ein echter Hingucker in der Insektenwelt!
- Parasitäre Kinderstube: Die Larven des Bienenkäfers wachsen in Bienenstöcken auf, was fast – so unsere Eindruck - wie ein Abenteuerurlaub für kleine Insekten wirkt – inklusive Rundumversorgung!
- Kleine Öko-Helfer: Diese Käfer sind winzige, aber effektive Helfer, die das Gleichgewicht im Bienenreich aufrechterhalten und so zur Gesundheit der Natur beitragen. Davon sind wir fest überzeugt.
Zusammenfassung
Der Gemeine Bienenkäfer, Trichodes apiarius, ist ein in unseren Augen sehr bemerkenswertes Beispiel für die Innovationskraft der Natur und die Bedeutung nachhaltiger ökologischer Beziehungen. Seine Rolle im Ökosystem zeigt, wie wichtig es ist, auch scheinbar kleine und unbedeutende Arten zu schützen. Im Sinne der nachfolgenden Generationen sollten wir die Vielfalt und das Gleichgewicht der Natur bewahren und wertschätzen.
In der spektakulären Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- ... wer hat schon mal die Physiognomie von einem Käfer so gesehen ...
Artenschutz in Franken®
Gefleckte Schüsselschnecke (Discus rotundatus)

Gefleckte Schüsselschnecke (Discus rotundatus)
06/07.06.2024
Diese Schnecke gehört zur Familie der Discidae und ist durch ihr charakteristisches, scheibenförmiges Gehäuse und die deutlichen Flecken auf der Schale recht leicht auch für den/die nicht „Schneckenkenner*in“ zu erkennen. Sie bewohnt bevorzugt und sehr gerne feuchte, schattige Umgebungen wie Laubwälder, wo sie sich vornehmlich von abgestorbenem Pflanzenmaterial ernährt.
06/07.06.2024
- Die Gefleckte Schüsselschnecke, ist eine kleine Landschnecke, die in vielen Teilen Europas heimisch ist.
Diese Schnecke gehört zur Familie der Discidae und ist durch ihr charakteristisches, scheibenförmiges Gehäuse und die deutlichen Flecken auf der Schale recht leicht auch für den/die nicht „Schneckenkenner*in“ zu erkennen. Sie bewohnt bevorzugt und sehr gerne feuchte, schattige Umgebungen wie Laubwälder, wo sie sich vornehmlich von abgestorbenem Pflanzenmaterial ernährt.
Innovativ, nachhaltig und für die nachfolgenden Generationen
Innovativ: Die Gefleckte Schüsselschnecke kann als Symbol für Innovation im ökologischen Sinne betrachtet werden. Trotz ihrer geringen Größe spielt sie nach unserer Auffassung eine wichtige Rolle im Ökosystem, indem sie zur Zersetzung von organischem Material beiträgt und damit den Nährstoffkreislauf in Wäldern mit unterstützt. Dieses einfache, aber effektive System zeigt, wie selbst kleine Organismen große Auswirkungen auf ihre Umwelt haben können – eine innovative Perspektive auf die Bedeutung von Biodiversität hin.
Nachhaltigkeit: Diese Schnecke steht nach unserer Auffassung sicherlich auch für nachhaltig- interessante Praktiken. Sie zeigt, wie wichtig es ist, natürliche Lebensräume zu bewahren und zu schützen, um das Gleichgewicht in der Natur nachhaltig zu erhalten. Indem wir die Lebensräume dieser und anderer Arten schützen, tragen wir als Gesellschaft zur Erhaltung der Biodiversität bei, was wiederum recht positive Auswirkungen auf das gesamte Ökosystem hat. Ein nachhaltiges Management von Wäldern und anderen natürlichen Lebensräumen ist entscheidend, um diese Art und viele andere für die Zukunft zu bewahren.
Für nachfolgende Generationen: Der Schutz und die Pflege der Lebensräume der Gefleckten Schüsselschnecke sind nach unserer festen Überzeugung auch im Sinne der nachfolgenden Generationen wichtig. Diese kleinen Schnecken sind Teil eines größeren Netzwerks von Organismen, das gesund und funktionierend gehalten werden muss, um zukünftigen Generationen eine stabile und vielfältige Umwelt zu hinterlassen. Durch zusätzliche geführte Bildungsprogramme und Naturschutzmaßnahmen können wir n.u.A. sicherstellen, dass zukünftige Generationen die Bedeutung solcher Arten verstehen und ihre Verantwortung für den Schutz der Umwelt erkennen.
„Lustige A.i.F. Aspekte“ der Gefleckten Schüsselschnecke
Zusammenfassung:
Die Gefleckte Schüsselschnecke, Discus rotundatus, ist in unseren Augen viel mehr als nur eine kleine Schnecke im Wald. Sie repräsentiert nach unserer Auffassung innovative ökologische Prozesse, nachhaltige Umweltpraktiken und die Verantwortung, die wir für die nachfolgenden Generationen tragen. Mit einem humorvollen Blick auf ihre Lebensweise können wir gleichzeitig ihre Bedeutung für das Ökosystem würdigen und unsere eigene Rolle im Naturschutz besser verstehen.
Artenschutz muss nicht immer nur „trocken“ sein.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
Innovativ: Die Gefleckte Schüsselschnecke kann als Symbol für Innovation im ökologischen Sinne betrachtet werden. Trotz ihrer geringen Größe spielt sie nach unserer Auffassung eine wichtige Rolle im Ökosystem, indem sie zur Zersetzung von organischem Material beiträgt und damit den Nährstoffkreislauf in Wäldern mit unterstützt. Dieses einfache, aber effektive System zeigt, wie selbst kleine Organismen große Auswirkungen auf ihre Umwelt haben können – eine innovative Perspektive auf die Bedeutung von Biodiversität hin.
Nachhaltigkeit: Diese Schnecke steht nach unserer Auffassung sicherlich auch für nachhaltig- interessante Praktiken. Sie zeigt, wie wichtig es ist, natürliche Lebensräume zu bewahren und zu schützen, um das Gleichgewicht in der Natur nachhaltig zu erhalten. Indem wir die Lebensräume dieser und anderer Arten schützen, tragen wir als Gesellschaft zur Erhaltung der Biodiversität bei, was wiederum recht positive Auswirkungen auf das gesamte Ökosystem hat. Ein nachhaltiges Management von Wäldern und anderen natürlichen Lebensräumen ist entscheidend, um diese Art und viele andere für die Zukunft zu bewahren.
Für nachfolgende Generationen: Der Schutz und die Pflege der Lebensräume der Gefleckten Schüsselschnecke sind nach unserer festen Überzeugung auch im Sinne der nachfolgenden Generationen wichtig. Diese kleinen Schnecken sind Teil eines größeren Netzwerks von Organismen, das gesund und funktionierend gehalten werden muss, um zukünftigen Generationen eine stabile und vielfältige Umwelt zu hinterlassen. Durch zusätzliche geführte Bildungsprogramme und Naturschutzmaßnahmen können wir n.u.A. sicherstellen, dass zukünftige Generationen die Bedeutung solcher Arten verstehen und ihre Verantwortung für den Schutz der Umwelt erkennen.
„Lustige A.i.F. Aspekte“ der Gefleckten Schüsselschnecke
- Winzige Landschaftspfleger: Es ist amüsant, sich vorzustellen, dass diese winzigen Schnecken als Landschaftspfleger fungieren, die unermüdlich den Waldboden säubern und dabei helfen, Blätter und Pflanzenreste zu zersetzen.
- Tragehäuschen: Die Schnecken tragen ihr „Haus“ ständig mit sich herum, was wie ein dauerhaftes Campingabenteuer wirkt. Man könnte sie als die ultimativen minimalistischen Abenteurer betrachten.
- Fleckenmuster: Die markanten Flecken auf ihren Schalen könnten fast als modisches Statement interpretiert werden – vielleicht die Haute Couture der Schneckenwelt!
Zusammenfassung:
Die Gefleckte Schüsselschnecke, Discus rotundatus, ist in unseren Augen viel mehr als nur eine kleine Schnecke im Wald. Sie repräsentiert nach unserer Auffassung innovative ökologische Prozesse, nachhaltige Umweltpraktiken und die Verantwortung, die wir für die nachfolgenden Generationen tragen. Mit einem humorvollen Blick auf ihre Lebensweise können wir gleichzeitig ihre Bedeutung für das Ökosystem würdigen und unsere eigene Rolle im Naturschutz besser verstehen.
Artenschutz muss nicht immer nur „trocken“ sein.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- ... durch den Regen gibts dieses Jahr (2024) mehr Schnecken ... da sind oft wunderschöne Exemplare dabei .. ist ein Kleinteil, so 1 cm Durchmesser etwa und eine interessante Färbung
Artenschutz in Franken®
Artenschutz in Franken®

Artenschutz in Franken®
Artenschutz als Zeichen einer ethisch-moralischen Verpflichtung, diesem Anspruch gegenüber uns begleitenden Mitgeschöpfen und deren Lebens-räume, stellen wir uns seit nunmehr fast 30 Jahren mit zahlreichen Partnern tagtäglich auf vielfältiger Art aufs Neue.
In vollkommen ehrenamtlicher, wirtschaftlich- und politisch sowie konfessionell unabhängiger Form engagieren wir uns hier mit unseren vielen Mitgliedern in abertausenden von Stunden.
Trotz der auf Franken ausgerichteten Namensgebung bundesweit für die Erhaltung der Biodiversität, sowie für eine lebendige, pädagogisch hochwertige Umweltbildung.
Artenschutz als Zeichen einer ethisch-moralischen Verpflichtung, diesem Anspruch gegenüber uns begleitenden Mitgeschöpfen und deren Lebens-räume, stellen wir uns seit nunmehr fast 30 Jahren mit zahlreichen Partnern tagtäglich auf vielfältiger Art aufs Neue.
In vollkommen ehrenamtlicher, wirtschaftlich- und politisch sowie konfessionell unabhängiger Form engagieren wir uns hier mit unseren vielen Mitgliedern in abertausenden von Stunden.
Trotz der auf Franken ausgerichteten Namensgebung bundesweit für die Erhaltung der Biodiversität, sowie für eine lebendige, pädagogisch hochwertige Umweltbildung.
In einer Dekade in der zunehmend Veränderungen, auch klimatischer Weise erkennbar werden, kommt nach unserem Dafürhalten der effektiven Erhaltung heimischer Artenvielfalt auch und gerade im Sinne einer auf-geklärten Gesellschaft eine heraus-ragende Bedeutung zu.
Der Artenschwund hat er-schreckende Ausmaße ange-nommen, welche den Eindruck der zunehmenden Leere für den aufmerksamen Betrachter deutlich erkennbar werden lässt. Eine ausge-storbene Art ist für nahezu alle Zeit verloren. Mit ihr verlieren wir eine hochwertige, einzigartige Ressource die sich den Umweltbedingungen seit meist Millionen von Jahren anpassen konnte.
Wir sollten uns den Luxus nicht leisten dieser Artenreduktion untätig zuzusehen. Nur eine möglichst hohe genetische Artenvielfalt kann die Entstehung neuer Arten effektiv ansteuern.
Im Sinne uns nachfolgender Generationen, also unserer Kinder und unserer Enkelkinder, sollten wir uns gemeinsam dazu durchringen dem galoppierenden Artenschwund Paroli zu bieten.
Nur gemeinsam wird und kann es uns gelingen diesem sicherlich nicht leichtem Unterfangen erfolgreich zu begegnen. Ohne dies jedoch jemals versucht zu haben, werden wir nie erkennen ob wir dazu in der Lage sind oder waren.
Durchdachter Artenschutz ist in unseren Augen mehr als eine Ideologie.
Er beweist in eindrucksvoller Art die Verbundenheit mit einer einzigartigen Heimat und deren sich darin befindlichen Lebensformen. Schöpfung lebendig bewahren, für uns ge-meinsam mehr als „nur“ ein Lippenbekenntnis.
Artenschutz ist für uns gleichfalls Lebensraumsicherung für den modernen Menschen.
Nur in einer intakten, vielfältigen Umwelt wird auch der Mensch die Chance erhalten nachhaltig zu überdauern. Hierfür setzten wir uns täglich vollkommen ehrenamtlich und unabhängig im Sinne unserer Mit-geschöpfe, jedoch auch ganz bewusst im Sinne unserer Mitbürger und vor allem der uns nachfolgenden Generation von ganzem Herzen ein.
Artenschutz in Franken®
Der Artenschwund hat er-schreckende Ausmaße ange-nommen, welche den Eindruck der zunehmenden Leere für den aufmerksamen Betrachter deutlich erkennbar werden lässt. Eine ausge-storbene Art ist für nahezu alle Zeit verloren. Mit ihr verlieren wir eine hochwertige, einzigartige Ressource die sich den Umweltbedingungen seit meist Millionen von Jahren anpassen konnte.
Wir sollten uns den Luxus nicht leisten dieser Artenreduktion untätig zuzusehen. Nur eine möglichst hohe genetische Artenvielfalt kann die Entstehung neuer Arten effektiv ansteuern.
Im Sinne uns nachfolgender Generationen, also unserer Kinder und unserer Enkelkinder, sollten wir uns gemeinsam dazu durchringen dem galoppierenden Artenschwund Paroli zu bieten.
Nur gemeinsam wird und kann es uns gelingen diesem sicherlich nicht leichtem Unterfangen erfolgreich zu begegnen. Ohne dies jedoch jemals versucht zu haben, werden wir nie erkennen ob wir dazu in der Lage sind oder waren.
Durchdachter Artenschutz ist in unseren Augen mehr als eine Ideologie.
Er beweist in eindrucksvoller Art die Verbundenheit mit einer einzigartigen Heimat und deren sich darin befindlichen Lebensformen. Schöpfung lebendig bewahren, für uns ge-meinsam mehr als „nur“ ein Lippenbekenntnis.
Artenschutz ist für uns gleichfalls Lebensraumsicherung für den modernen Menschen.
Nur in einer intakten, vielfältigen Umwelt wird auch der Mensch die Chance erhalten nachhaltig zu überdauern. Hierfür setzten wir uns täglich vollkommen ehrenamtlich und unabhängig im Sinne unserer Mit-geschöpfe, jedoch auch ganz bewusst im Sinne unserer Mitbürger und vor allem der uns nachfolgenden Generation von ganzem Herzen ein.
Artenschutz in Franken®
25. Jahre Artenschutz in Franken®

25. Jahre Artenschutz in Franken®
Am 01.03.2021 feierte unsere Organisation ein Vierteljahrhundert ehrenamlichen und vollkommen unabhängigen Artenschutz und erlebbare Umweltbildung.
Am 01.03.2021 feierte unsere Organisation ein Vierteljahrhundert ehrenamlichen und vollkommen unabhängigen Artenschutz und erlebbare Umweltbildung.
Und auch nach 25 Jahren zeigt sich unser Engagement keineswegs als "überholt". Im Gegenteil es wird dringender gebraucht denn je.
Denn die immensen Herausforderungen gerade auf diesem Themenfeld werden unsere Gesellschaft zukünftig intensiv fordern!
Hinweis zum 15.jährigen Bestehen.
Aus besonderem Anlass und zum 15.jährigen Bestehen unserer Organisation ergänzten wir unsere namensgebende Bezeichnung.
Der Zusatz Artenschutz in Franken® wird den Ansprüchen eines modernen und zunehmend auch überregional agierenden Verbandes gerecht.
Vormals auf die Region des Steiger-waldes beschränkt setzt sich Artenschutz in Franken® nun vermehrt in ganz Deutschland und darüber hinaus ein.
Die Bezeichnung ändert sich, was Bestand haben wird ist weiterhin das ehrenamliche und unabhängige Engagement das wir für die Belange des konkreten Artenschutzes, sowie einer lebendigen Umweltbildung in einbringen.
Im Sinne uns nachfolgender Generationen!
Auf unserer Internetpräsenz möchten wir unser ehrenamtliches Engagement näher vorstellen.
Artenschutz in Franken®
Denn die immensen Herausforderungen gerade auf diesem Themenfeld werden unsere Gesellschaft zukünftig intensiv fordern!
Hinweis zum 15.jährigen Bestehen.
Aus besonderem Anlass und zum 15.jährigen Bestehen unserer Organisation ergänzten wir unsere namensgebende Bezeichnung.
Der Zusatz Artenschutz in Franken® wird den Ansprüchen eines modernen und zunehmend auch überregional agierenden Verbandes gerecht.
Vormals auf die Region des Steiger-waldes beschränkt setzt sich Artenschutz in Franken® nun vermehrt in ganz Deutschland und darüber hinaus ein.
Die Bezeichnung ändert sich, was Bestand haben wird ist weiterhin das ehrenamliche und unabhängige Engagement das wir für die Belange des konkreten Artenschutzes, sowie einer lebendigen Umweltbildung in einbringen.
Im Sinne uns nachfolgender Generationen!
Auf unserer Internetpräsenz möchten wir unser ehrenamtliches Engagement näher vorstellen.
Artenschutz in Franken®
Notrufnummern ✆

Im Aufbau
Rechtliches §

Immer wieder werden wir gefragt welche rechtlichen Grundlagen es innerhalb der Naturschutz- und Tierschutzgesetze es gibt.
Wir haben einige Infos zu diesem Thema hier verlinkt:
Wir haben einige Infos zu diesem Thema hier verlinkt:
Bayerisches Naturschutzgesetz – BayNatSchG
http://www.gesetze-bayern.de/(X(1)S(fhnsotp2iqyyotymmjumqonn))/Content/Document/BayNatSchG?AspxAutoDetectCookieSupport=1
Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege
https://www.gesetze-im-internet.de/bnatschg_2009/
Tierschutzgesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/tierschg/BJNR012770972.html
http://www.gesetze-bayern.de/(X(1)S(fhnsotp2iqyyotymmjumqonn))/Content/Document/BayNatSchG?AspxAutoDetectCookieSupport=1
Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege
https://www.gesetze-im-internet.de/bnatschg_2009/
Tierschutzgesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/tierschg/BJNR012770972.html
Unser Engagement

Mehr über unser Engagement finden Sie hier:
Die Artenschutz im Steigerwald/Artenschutz in Franken®- Nachhaltigkeits-vereinbarung
www.artenschutz-steigerwald.de/de/Ueber-Uns/1001349/AiF_-_Nachhaltigkeitsvereinbarung/
Über uns
www.artenschutz-steigerwald.de/de/Ueber-Uns/
Impressum/Satzung
www.artenschutz-steigerwald.de/de/Impressum/
www.artenschutz-steigerwald.de/de/Ueber-Uns/1001349/AiF_-_Nachhaltigkeitsvereinbarung/
Über uns
www.artenschutz-steigerwald.de/de/Ueber-Uns/
Impressum/Satzung
www.artenschutz-steigerwald.de/de/Impressum/
Nachgedacht

Ein Gedicht zum Verlust der Biodiversität in unserem Land.
Artenschwund
In allen Medien tun sie es kund, bedenklich ist der Artenschwund.
Begonnen hat es schon sehr bald, durch Abholzung im Regenwald. Nicht nur um edle Hölzer zu gewinnen, man fing schließlich an zu „spinnen“. Durch Brandrodung ließ man es qualmen, und pflanzte dort dann nur noch Palmen.
Das fand die Industrie ganz prima, doch heute bejammern wir das Klima. Aber es betrifft nicht nur ferne Lande, auch bei uns ist es `ne Schande. Dass Wälder dem Profit zum Opfer fallen, dies schadet schließlich doch uns Allen.
Artenschwund
In allen Medien tun sie es kund, bedenklich ist der Artenschwund.
Begonnen hat es schon sehr bald, durch Abholzung im Regenwald. Nicht nur um edle Hölzer zu gewinnen, man fing schließlich an zu „spinnen“. Durch Brandrodung ließ man es qualmen, und pflanzte dort dann nur noch Palmen.
Das fand die Industrie ganz prima, doch heute bejammern wir das Klima. Aber es betrifft nicht nur ferne Lande, auch bei uns ist es `ne Schande. Dass Wälder dem Profit zum Opfer fallen, dies schadet schließlich doch uns Allen.
Ob Kahlschlag in Skandinavien, oder hier, die Dummen, das sind immer wir. Was unser Klima wirklich erhält, wurde zum großen Teil gefällt.
Es beginnt doch schon im Kleinen, an Straßen- und an Wegesrainen. Dort wird gemäht, ganz ohne Not, dies ist vieler Tiere Tod. Moderne Maschinen zu unserem Schrecken, lassen Schmetterlingsraupen
kläglich verrecken. Weil von den Raupen niemand profitiert, dies dann auch kaum Jemand interes-siert. Doch der Jammer ist schon groß; wo bleiben die Schmetterlinge bloß?
Auch unser Obst ist in Gefahr, denn die Bienen werden rar. Wir uns deshalb ernsthaft fragen, wer wird in Zukunft die Pollen übertragen. Eine
eingeschleppte Milbe ist der Bienen Tod und die Imker leiden Not. Dazu spritzt man noch Neonikotinoide und Glyphosat, damit man reiche Ernte hat. Das vergiftet nicht nur Tiere, sondern jetzt auch viele Biere. Glyphosat soll krebserregend sein, doch das kümmert hier kein Schwein.
Hauptsache es rollt weiterhin der Kiesel, denn man hat ja noch den Diesel. Der ist jetzt an Allem schuld und man gönnt ihm keine Huld. Elektrofahrzeuge sind die neue Devise, doch verhindern diese wirklich unsere Krise? Braunkohle und Atom, erzeugen zumeist unseren Strom. Wie nun jeder Bürger weiß, ist auch dieses Thema
heiß.
Gäbe es immerzu Sonnenschein, wäre Solarenergie fein. Aber da sind ja noch die Windanlagen, die hoch in den Himmel ragen. Wo sie dann an manchen Tagen, Vögel in der Luft erschlagen. Diese zogen erst von Süden fort, entkamen knapp dem Vogelmord. Nun hat es sie doch noch erwischt, nur werden sie hier nicht aufgetischt.
Wie haben die Ortolane schön ge-sungen, nun liegen auf dem Teller ihre Zungen. War das schön, als sie noch lebten, bevor sie auf `ner Rute klebten. Immer weniger wird ihr Gesang, uns wird es langsam angst und bang .Gesetze wurden
zwar gemacht, sie werden jedoch zumeist belacht. Wenn Vögel brutzeln in Pfanne und Schüssel, wen interessiert da das „Geschwätz“ aus Brüssel.
Es gibt ein paar Leute, die sind vor Ort und stellen sich gegen den Vogelmord. Die wenigen, die es wagen, riskieren dabei Kopf und Kragen. Wenn sie beseitigen Ruten und Fallen, oder hindern Jäger, Vögel abzuknallen. Riesige Netze, so stellen wir fest, geben den Vögeln nun noch den Rest. Wir sollten dies schnellstens verhindern, sonst werden wir mit unseren Kindern, bald keinen Vogelsang mehr hören. So manchen würde das kaum stören, doch mit diesem Artenschwund, schlägt irgendwann auch unsere Stund`.
Quelle
Hubertus Zinnecker
Es beginnt doch schon im Kleinen, an Straßen- und an Wegesrainen. Dort wird gemäht, ganz ohne Not, dies ist vieler Tiere Tod. Moderne Maschinen zu unserem Schrecken, lassen Schmetterlingsraupen
kläglich verrecken. Weil von den Raupen niemand profitiert, dies dann auch kaum Jemand interes-siert. Doch der Jammer ist schon groß; wo bleiben die Schmetterlinge bloß?
Auch unser Obst ist in Gefahr, denn die Bienen werden rar. Wir uns deshalb ernsthaft fragen, wer wird in Zukunft die Pollen übertragen. Eine
eingeschleppte Milbe ist der Bienen Tod und die Imker leiden Not. Dazu spritzt man noch Neonikotinoide und Glyphosat, damit man reiche Ernte hat. Das vergiftet nicht nur Tiere, sondern jetzt auch viele Biere. Glyphosat soll krebserregend sein, doch das kümmert hier kein Schwein.
Hauptsache es rollt weiterhin der Kiesel, denn man hat ja noch den Diesel. Der ist jetzt an Allem schuld und man gönnt ihm keine Huld. Elektrofahrzeuge sind die neue Devise, doch verhindern diese wirklich unsere Krise? Braunkohle und Atom, erzeugen zumeist unseren Strom. Wie nun jeder Bürger weiß, ist auch dieses Thema
heiß.
Gäbe es immerzu Sonnenschein, wäre Solarenergie fein. Aber da sind ja noch die Windanlagen, die hoch in den Himmel ragen. Wo sie dann an manchen Tagen, Vögel in der Luft erschlagen. Diese zogen erst von Süden fort, entkamen knapp dem Vogelmord. Nun hat es sie doch noch erwischt, nur werden sie hier nicht aufgetischt.
Wie haben die Ortolane schön ge-sungen, nun liegen auf dem Teller ihre Zungen. War das schön, als sie noch lebten, bevor sie auf `ner Rute klebten. Immer weniger wird ihr Gesang, uns wird es langsam angst und bang .Gesetze wurden
zwar gemacht, sie werden jedoch zumeist belacht. Wenn Vögel brutzeln in Pfanne und Schüssel, wen interessiert da das „Geschwätz“ aus Brüssel.
Es gibt ein paar Leute, die sind vor Ort und stellen sich gegen den Vogelmord. Die wenigen, die es wagen, riskieren dabei Kopf und Kragen. Wenn sie beseitigen Ruten und Fallen, oder hindern Jäger, Vögel abzuknallen. Riesige Netze, so stellen wir fest, geben den Vögeln nun noch den Rest. Wir sollten dies schnellstens verhindern, sonst werden wir mit unseren Kindern, bald keinen Vogelsang mehr hören. So manchen würde das kaum stören, doch mit diesem Artenschwund, schlägt irgendwann auch unsere Stund`.
Quelle
Hubertus Zinnecker
Ein Frühsommer-Bild aus Schleswig-Holstein

Ein Frühsommer-Bild aus Schleswig-Holstein ...da wir jedoch im ganzen Land wiederfinden!
Eine weite Grünlandniederung, vier riesige Mähmaschinen fahren nebeneinander mit rasanter Geschwindigkeit über ein Areal von einigen hundert Hektar Wiesen.
Wo gestern noch zahlreiche Feldvögel sangen und ihre Jungen fütterten, Wiesen- und Rohrweihen jagten, ein Sumpfohreulenpaar balzte und offensichtlich einen Brutplatz hatte, bietet sich heute ein Bild der Zerstörung. Kiebitze und Brachvögel rufen verzweifelt und haben ihre Gelege verloren.
Eine weite Grünlandniederung, vier riesige Mähmaschinen fahren nebeneinander mit rasanter Geschwindigkeit über ein Areal von einigen hundert Hektar Wiesen.
Wo gestern noch zahlreiche Feldvögel sangen und ihre Jungen fütterten, Wiesen- und Rohrweihen jagten, ein Sumpfohreulenpaar balzte und offensichtlich einen Brutplatz hatte, bietet sich heute ein Bild der Zerstörung. Kiebitze und Brachvögel rufen verzweifelt und haben ihre Gelege verloren.
Schafstelzen, Wiesenpieper und Feldlerchen hüpfen mit Würmern im Schnabel auf der Suche nach ihren längst zerstückelten Jungvögeln verzweifelt über den Boden.
Alles nichts Neues.
Das kennen wir ja. Das BNatSchG §44 erlaubt es ja schließlich gemäß der „guten fachliche Praxis“, streng geschützte Vogelarten zu töten - denn verboten ist es ja nur „ohne sinnvollen Grund“.
Aber was ist an dieser uns allen bekannten Situation anders als noch vor 10, 20 Jahren?
Die Mähmaschinen sind größer und stärker denn je, schneller denn je, mähen tiefer denn je, mähen in immer kürzeren Intervallen, mähen die Gräben bis tief in jede Grabenböschung mit ab.
Wie zum Hohn kommt nun noch ein weiterer Trecker und mäht alle Stauden der Wegesränder ab, scheinbar um das letzte verbliebene Wiesenpieper- oder Blaukehlchennnest dann auch noch zu erwischen.
23.00h: Es wird dunkel, es wird weiter gemäht. Ich denke an die Wiesenweihen, den gerade erschienenen Artikel aus der Zeitschrift dem Falken: " bei nächtlicher Mahd bleiben die adulten Weihen auf dem Nest sitzen und werden mit getötet“.
Wo ist unsere Landwirtschaft hingekommen, dass jetzt hier 4 Maschinen der neusten Generation parallel nebeneinander in rasendem Tempo mähen, dahinter wird schon gewendet und das Gras abtransportiert.
Nicht ein junger Vogel, nicht ein junger Hase hat hier die geringste Chance, noch zu entkommen.
Früher habe ich nach der Mahd noch junge Kiebitze und junge Hasen gesehen, die überlebt haben. Früher hat ein Bauer noch das Mähwerk angehoben, wenn er von oben ein Kiebitznest gesehen hat.
Hier ist nun nichts mehr, nur hunderte von Krähen und Möwen, die sich über das „Fastfood“ freuen (und nebenbei bemerkt damit einen äußerst wichtigen Beitrag zur Beseitigung von Clostridien leisten, welche die Silage verunreinigen und damit den Rinderbestand gefährden könnten - gedankt wird es den Krähen aber natürlich nicht)
Diese Entwicklung der Grünlandbewirtschaftung ist sehr besorgniserregend, nicht nur für den Vogel des Jahres, die Feldlerche. Das Wettrüsten der Landwirte ist verständlich aus deren wirtschaftlicher Sicht, aber eine ökologische Vollkatastrophe und das Ergebnis einer verfehlten Agrarpolitik.
Was ist denn der „sinnvolle Grund“, der diese Entwicklung überhaupt zulässt?
Dass die Milch und das Fleisch immer noch billiger werden, und dafür das letzte Stück Natur geschreddert wird? Ist das wirklich im Sinne der Allgemeinheit, denn es sind doch nicht nur wir Naturschützer*innen und Vogelkundler*innen, die sich über blühende Wiesen und singende Lerchen freuen.
Dieser massenhafte Vogelmord auf unserem Grünland (und natürlich Amphibien, Reptilien, Säugetiere, Insekten) wird immer aggressiver und ist vielen Menschen gar nicht bewusst.
Es müssen dringend Maßnahmen ergriffen werden, wie z.B. gesetzlich vorgeschriebene Randstreifen zu Gräben und Wegesrändern, Verbot nächtlicher Mahd, Begrenzung der Mahdhöhe- und Mahdgeschwindigkeit usw.
Ansonsten brauchen wir uns auch nicht über vogeljagende Mittelmeerländer aufzuregen - denn das was hier stattfindet ist letztendlich genauso zerstörerisch wie zum Spaß zur Flinte zu greifen.
Juni 2019
Autorin
Natascha Gaedecke
Alles nichts Neues.
Das kennen wir ja. Das BNatSchG §44 erlaubt es ja schließlich gemäß der „guten fachliche Praxis“, streng geschützte Vogelarten zu töten - denn verboten ist es ja nur „ohne sinnvollen Grund“.
Aber was ist an dieser uns allen bekannten Situation anders als noch vor 10, 20 Jahren?
Die Mähmaschinen sind größer und stärker denn je, schneller denn je, mähen tiefer denn je, mähen in immer kürzeren Intervallen, mähen die Gräben bis tief in jede Grabenböschung mit ab.
Wie zum Hohn kommt nun noch ein weiterer Trecker und mäht alle Stauden der Wegesränder ab, scheinbar um das letzte verbliebene Wiesenpieper- oder Blaukehlchennnest dann auch noch zu erwischen.
23.00h: Es wird dunkel, es wird weiter gemäht. Ich denke an die Wiesenweihen, den gerade erschienenen Artikel aus der Zeitschrift dem Falken: " bei nächtlicher Mahd bleiben die adulten Weihen auf dem Nest sitzen und werden mit getötet“.
Wo ist unsere Landwirtschaft hingekommen, dass jetzt hier 4 Maschinen der neusten Generation parallel nebeneinander in rasendem Tempo mähen, dahinter wird schon gewendet und das Gras abtransportiert.
Nicht ein junger Vogel, nicht ein junger Hase hat hier die geringste Chance, noch zu entkommen.
Früher habe ich nach der Mahd noch junge Kiebitze und junge Hasen gesehen, die überlebt haben. Früher hat ein Bauer noch das Mähwerk angehoben, wenn er von oben ein Kiebitznest gesehen hat.
Hier ist nun nichts mehr, nur hunderte von Krähen und Möwen, die sich über das „Fastfood“ freuen (und nebenbei bemerkt damit einen äußerst wichtigen Beitrag zur Beseitigung von Clostridien leisten, welche die Silage verunreinigen und damit den Rinderbestand gefährden könnten - gedankt wird es den Krähen aber natürlich nicht)
Diese Entwicklung der Grünlandbewirtschaftung ist sehr besorgniserregend, nicht nur für den Vogel des Jahres, die Feldlerche. Das Wettrüsten der Landwirte ist verständlich aus deren wirtschaftlicher Sicht, aber eine ökologische Vollkatastrophe und das Ergebnis einer verfehlten Agrarpolitik.
Was ist denn der „sinnvolle Grund“, der diese Entwicklung überhaupt zulässt?
Dass die Milch und das Fleisch immer noch billiger werden, und dafür das letzte Stück Natur geschreddert wird? Ist das wirklich im Sinne der Allgemeinheit, denn es sind doch nicht nur wir Naturschützer*innen und Vogelkundler*innen, die sich über blühende Wiesen und singende Lerchen freuen.
Dieser massenhafte Vogelmord auf unserem Grünland (und natürlich Amphibien, Reptilien, Säugetiere, Insekten) wird immer aggressiver und ist vielen Menschen gar nicht bewusst.
Es müssen dringend Maßnahmen ergriffen werden, wie z.B. gesetzlich vorgeschriebene Randstreifen zu Gräben und Wegesrändern, Verbot nächtlicher Mahd, Begrenzung der Mahdhöhe- und Mahdgeschwindigkeit usw.
Ansonsten brauchen wir uns auch nicht über vogeljagende Mittelmeerländer aufzuregen - denn das was hier stattfindet ist letztendlich genauso zerstörerisch wie zum Spaß zur Flinte zu greifen.
Juni 2019
Autorin
Natascha Gaedecke
Waldsterben 2.0 – Nein eine Chance zur Gestaltung naturnaher Wälder!

Waldsterben 2.0 – Nein eine Chance zur Gestaltung naturnaher Wälder!
Artenschutz in Franken® verfolgt seit geraumer Zeit die Diskussionen um den propagierten Niedergang des deutschen Waldes.
Als Ursache dieses Niedergangs wurde der/die Schuldige/n bereits ausgemacht. Der Klimawandel der die Bäume verdursten lässt und hie und da auch noch einige Großsäuger die unseren Wald „auffressen“. Diesen wird es vielerorts zugeschrieben, dass wir in wenigen Jahren wohl unseren Wald verlieren werden?!
Artenschutz in Franken® verfolgt seit geraumer Zeit die Diskussionen um den propagierten Niedergang des deutschen Waldes.
Als Ursache dieses Niedergangs wurde der/die Schuldige/n bereits ausgemacht. Der Klimawandel der die Bäume verdursten lässt und hie und da auch noch einige Großsäuger die unseren Wald „auffressen“. Diesen wird es vielerorts zugeschrieben, dass wir in wenigen Jahren wohl unseren Wald verlieren werden?!
Als Ursache für das infolge des Klimawandels erkennbare „Absterben“ unserer Wirtschaftswälder liegt jedoch vielmehr auch darin, dass wir unsere Wälder in den vergangenen Jahrhunderten ständig waldbaulich manipulierten und dieses auch heute noch sehr ausgeprägt und vielfach intensiver den je tun.
In dieser Zeitspanne haben wir in unserem Land nahezu alle unsere ursprünglich geformten Wälder verloren. Wir haben diesen Systemen seither ständig unsere menschliche Handschrift auferlegt um aufzuzeigen wie wir uns einen nachhaltig geformten Wirtschaftswald vorstellen. Und diesen selbstverständlich auch intensiv nutzen können.
Ohne große Rücksicht auf Pflanzen und Tiere welche in diesem Ökosystem leben.Wir haben somit keinen Wald mehr vor Augen wie dieser von Natur aus gedacht war – wir haben einen Wald vor unseren Augen wie wir uns Menschen einen Wald vorstellen.
Somit „stirbt“ nun auch nicht der Wald, sondern lediglich der vom Menschen fehlgeformte Wald.
Nun wird also fleißig darüber nachgedacht mit einem Millionenaufwand unseren Wald mit Aufforstungsprogrammen zu retten. Doch dieser Ansatz ist in unseren Augen eine weitere Verfehlung menschlichen Wirkens. Denn was hier zusammengepflanzt wird ist wieder kein sich natürlich entwickelter Wald der seine Dynamik sichtbar werden lassen kann. Nein es wird wieder ein vom Menschen manipulierter Wirtschaftswald entstehen der nur die Lebensformen in sich duldet die wir dieser Holzproduktionsfläche zugestehen.
Die Vielfalt der Arten wird hier auf immens großen Flächen abermals keine Rolle spielen.
Doch warum lassen wir es nicht einfach mal zu das wir dem Wald die Chance eröffnen uns zu zeigen wie Waldbau funktioniert und wie ein robuster Wald aussieht. „Dieser Wald“ wird uns in 50 – 70 Jahren zeigen welche Artenzusammensetzung für den jeweiligen Standort die richtige Mischung ist.
Es ist uns schon klar das bis dahin viele vom Menschen geschaffenen Wälder nicht mehr stehen werden denn sie werden tatsächlich „aufgefressen“.
Doch nicht vom Reh, welches Luchs und Wolf als Nahrungsgrundlage dringlich benötigen, wollen wir verhindern das diese sich an unseren Schafen & Co. bedienen, sondern von ganz kleinen Tieren. Der Borkenkäfer wird die Fläche für die nachfolgenden Naturwälder vorbereiten so wie wir es an mancher Stelle in Bayern sehr gut erkennen können.
Es bedarf somit in unseren Augen einem gesellschaftlichen Umdenken das endlich greifen muss.
Gerade im Sinne unserer Kinder und Enkelkinder welchen wir eine an Arten reiche Welt hinterlassen sollten.
AiF
12.08.2019
Ein sehr interessanter Bericht zu diesem Thema findet sich hier
In dieser Zeitspanne haben wir in unserem Land nahezu alle unsere ursprünglich geformten Wälder verloren. Wir haben diesen Systemen seither ständig unsere menschliche Handschrift auferlegt um aufzuzeigen wie wir uns einen nachhaltig geformten Wirtschaftswald vorstellen. Und diesen selbstverständlich auch intensiv nutzen können.
Ohne große Rücksicht auf Pflanzen und Tiere welche in diesem Ökosystem leben.Wir haben somit keinen Wald mehr vor Augen wie dieser von Natur aus gedacht war – wir haben einen Wald vor unseren Augen wie wir uns Menschen einen Wald vorstellen.
Somit „stirbt“ nun auch nicht der Wald, sondern lediglich der vom Menschen fehlgeformte Wald.
Nun wird also fleißig darüber nachgedacht mit einem Millionenaufwand unseren Wald mit Aufforstungsprogrammen zu retten. Doch dieser Ansatz ist in unseren Augen eine weitere Verfehlung menschlichen Wirkens. Denn was hier zusammengepflanzt wird ist wieder kein sich natürlich entwickelter Wald der seine Dynamik sichtbar werden lassen kann. Nein es wird wieder ein vom Menschen manipulierter Wirtschaftswald entstehen der nur die Lebensformen in sich duldet die wir dieser Holzproduktionsfläche zugestehen.
Die Vielfalt der Arten wird hier auf immens großen Flächen abermals keine Rolle spielen.
Doch warum lassen wir es nicht einfach mal zu das wir dem Wald die Chance eröffnen uns zu zeigen wie Waldbau funktioniert und wie ein robuster Wald aussieht. „Dieser Wald“ wird uns in 50 – 70 Jahren zeigen welche Artenzusammensetzung für den jeweiligen Standort die richtige Mischung ist.
Es ist uns schon klar das bis dahin viele vom Menschen geschaffenen Wälder nicht mehr stehen werden denn sie werden tatsächlich „aufgefressen“.
Doch nicht vom Reh, welches Luchs und Wolf als Nahrungsgrundlage dringlich benötigen, wollen wir verhindern das diese sich an unseren Schafen & Co. bedienen, sondern von ganz kleinen Tieren. Der Borkenkäfer wird die Fläche für die nachfolgenden Naturwälder vorbereiten so wie wir es an mancher Stelle in Bayern sehr gut erkennen können.
Es bedarf somit in unseren Augen einem gesellschaftlichen Umdenken das endlich greifen muss.
Gerade im Sinne unserer Kinder und Enkelkinder welchen wir eine an Arten reiche Welt hinterlassen sollten.
AiF
12.08.2019
Ein sehr interessanter Bericht zu diesem Thema findet sich hier