Das leise Verschwinden: Wie moderne Mähtechnik unsere Heuschrecken auslöscht

Das leise Verschwinden: Wie moderne Mähtechnik unsere Heuschrecken auslöscht
13/14.07.2025
Was einst ein selbstverständlicher Teil des sommerlichen Landschaftserlebens war, ist heute vielerorts kaum noch wahrnehmbar. Der Rückgang unserer heimischen Heuschrecken ist kein natürliches Phänomen, sondern menschengemacht – und eine unterschätzte ökologische Katastrophe.
13/14.07.2025
- In den frühen Morgenstunden, wenn der Tau noch auf den Wiesen liegt und die Sonne erste goldene Streifen über die Felder legt, erwacht ein vielstimmiger Klang: das Zirpen, Schnarren und Flirren unzähliger Heuschreckenarten – ein uraltes Orchester der Natur. Doch dieser Klang wird von Jahr zu Jahr leiser.
Was einst ein selbstverständlicher Teil des sommerlichen Landschaftserlebens war, ist heute vielerorts kaum noch wahrnehmbar. Der Rückgang unserer heimischen Heuschrecken ist kein natürliches Phänomen, sondern menschengemacht – und eine unterschätzte ökologische Katastrophe.
Ein zentraler, jedoch wenig bekannter Faktor für dieses stille Sterben ist die Art und Weise, wie wir unsere Wiesen bewirtschaften. Insbesondere das Mähen mit Kreiselmähwerken und Mulchgeräten hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einer der Hauptursachen für den Tod unzähliger Insekten entwickelt – Heuschrecken an vorderster Stelle.
Tödliche Technik: Wenn Effizienz zur Gefahr wird
Moderne Mähmaschinen sind auf Leistung getrimmt: Schnell, flächendeckend und mit hoher Schlagkraft schneiden sie Vegetation in kürzester Zeit nieder. Kreiselmähwerke arbeiten mit rotierenden Scheiben oder Messern, die das Gras nicht nur abschneiden, sondern auch mit enormer Geschwindigkeit durch die Luft wirbeln. Mulchgeräte zerkleinern das Schnittgut direkt vor Ort, um es als Nährstoffträger auf der Fläche zu belassen. Was für die Landwirtschaft praktisch erscheint, ist für bodennahe Tiere wie Heuschrecken, Käfer, Spinnen, Schmetterlingsraupen und viele andere Insektenarten ein tödliches Inferno.
Heuschrecken flüchten nicht in Panik wie Vögel. Viele Arten verlassen sich auf Tarnung, verharren bewegungslos im hohen Gras. Ihre geringe Fluchtgeschwindigkeit und die oft bodennahe Lebensweise machen sie zu leichten Opfern. Innerhalb weniger Sekunden werden sie erfasst, verletzt oder getötet. Studien zeigen, dass beim konventionellen Mähen mit Kreiseltechnik bis zu 90 % der Insekten auf einer Wiese sterben können – ein schockierender Wert, der sich direkt in den schrumpfenden Populationen widerspiegelt.
Ein komplexes Netzwerk bricht zusammen
Das Verschwinden der Heuschrecken ist kein isoliertes Problem. Als wichtige Primärverbraucher spielen sie eine Schlüsselrolle im ökologischen Gefüge. Sie zersetzen Pflanzenmaterial, halten das Gleichgewicht zwischen Vegetationstypen und dienen einer Vielzahl von Tierarten als Nahrung – darunter Vögeln wie dem Neuntöter, Reptilien, Amphibien und sogar kleinen Säugetieren. Wenn die Heuschrecken verschwinden, bricht eine ganze Nahrungskette in sich zusammen. Der Rückgang von Feldvögeln, der vielerorts zu beobachten ist, hängt direkt mit dem Verschwinden ihrer Hauptnahrungsquelle zusammen.
Ökologische Sensibilität statt technischer Radikalität
Doch es gibt Alternativen. Zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen und Praxisprojekte zeigen, dass durch relativ einfache Anpassungen bereits große Fortschritte im Insektenschutz erzielt werden können:
All diese Maßnahmen sind praktikabel – sie erfordern lediglich das Umdenken von Praktiker:innen, die Bereitschaft zur ökologischen Verantwortung und den politischen Willen, nachhaltige Landwirtschaft zu fördern.
Was auf dem Spiel steht
Das leise Zirpen der Heuschrecken ist mehr als ein Geräusch. Es ist Ausdruck lebendiger Vielfalt, Zeichen eines funktionierenden Ökosystems und Teil unserer kulturellen und natürlichen Identität. Wenn wir diesen Klang verlieren, verlieren wir mehr als nur ein Insekt – wir verlieren die Verbindung zu einer Landschaft, die uns nährt, formt und durch ihre Vielfalt lebenswert macht.
Die industrielle Logik der Flächenbewirtschaftung darf nicht über die Bedürfnisse unserer Mitgeschöpfe triumphieren. Denn letztlich hängen auch wir Menschen am selben ökologischen Netz wie die Heuschrecken. Je mehr Fäden darin reißen, desto instabiler wird es – bis auch wir keinen Halt mehr finden.
In der Aufnahme von Albert Meier
Tödliche Technik: Wenn Effizienz zur Gefahr wird
Moderne Mähmaschinen sind auf Leistung getrimmt: Schnell, flächendeckend und mit hoher Schlagkraft schneiden sie Vegetation in kürzester Zeit nieder. Kreiselmähwerke arbeiten mit rotierenden Scheiben oder Messern, die das Gras nicht nur abschneiden, sondern auch mit enormer Geschwindigkeit durch die Luft wirbeln. Mulchgeräte zerkleinern das Schnittgut direkt vor Ort, um es als Nährstoffträger auf der Fläche zu belassen. Was für die Landwirtschaft praktisch erscheint, ist für bodennahe Tiere wie Heuschrecken, Käfer, Spinnen, Schmetterlingsraupen und viele andere Insektenarten ein tödliches Inferno.
Heuschrecken flüchten nicht in Panik wie Vögel. Viele Arten verlassen sich auf Tarnung, verharren bewegungslos im hohen Gras. Ihre geringe Fluchtgeschwindigkeit und die oft bodennahe Lebensweise machen sie zu leichten Opfern. Innerhalb weniger Sekunden werden sie erfasst, verletzt oder getötet. Studien zeigen, dass beim konventionellen Mähen mit Kreiseltechnik bis zu 90 % der Insekten auf einer Wiese sterben können – ein schockierender Wert, der sich direkt in den schrumpfenden Populationen widerspiegelt.
Ein komplexes Netzwerk bricht zusammen
Das Verschwinden der Heuschrecken ist kein isoliertes Problem. Als wichtige Primärverbraucher spielen sie eine Schlüsselrolle im ökologischen Gefüge. Sie zersetzen Pflanzenmaterial, halten das Gleichgewicht zwischen Vegetationstypen und dienen einer Vielzahl von Tierarten als Nahrung – darunter Vögeln wie dem Neuntöter, Reptilien, Amphibien und sogar kleinen Säugetieren. Wenn die Heuschrecken verschwinden, bricht eine ganze Nahrungskette in sich zusammen. Der Rückgang von Feldvögeln, der vielerorts zu beobachten ist, hängt direkt mit dem Verschwinden ihrer Hauptnahrungsquelle zusammen.
Ökologische Sensibilität statt technischer Radikalität
Doch es gibt Alternativen. Zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen und Praxisprojekte zeigen, dass durch relativ einfache Anpassungen bereits große Fortschritte im Insektenschutz erzielt werden können:
- Mähzeitpunkte verschieben: Wer nicht während der Hauptfortpflanzungszeit mäht (Juni–Juli), sondern spätere Schnitte bevorzugt, schützt Eier, Larven und erwachsene Tiere.
- Schnitttechnik anpassen: Doppelmesserbalken oder Sichelmäher mit niedrigeren Umdrehungszahlen sind deutlich insektenfreundlicher.
- Schnittmuster ändern: Statt die Wiese von außen nach innen zu mähen, beginnt man in der Mitte und arbeitet sich nach außen vor. So erhalten Tiere die Möglichkeit zur Flucht.
- Blühstreifen und Rückzugsflächen erhalten: Unbearbeitete Teilflächen bieten Zuflucht und Überlebensraum.
All diese Maßnahmen sind praktikabel – sie erfordern lediglich das Umdenken von Praktiker:innen, die Bereitschaft zur ökologischen Verantwortung und den politischen Willen, nachhaltige Landwirtschaft zu fördern.
Was auf dem Spiel steht
Das leise Zirpen der Heuschrecken ist mehr als ein Geräusch. Es ist Ausdruck lebendiger Vielfalt, Zeichen eines funktionierenden Ökosystems und Teil unserer kulturellen und natürlichen Identität. Wenn wir diesen Klang verlieren, verlieren wir mehr als nur ein Insekt – wir verlieren die Verbindung zu einer Landschaft, die uns nährt, formt und durch ihre Vielfalt lebenswert macht.
Die industrielle Logik der Flächenbewirtschaftung darf nicht über die Bedürfnisse unserer Mitgeschöpfe triumphieren. Denn letztlich hängen auch wir Menschen am selben ökologischen Netz wie die Heuschrecken. Je mehr Fäden darin reißen, desto instabiler wird es – bis auch wir keinen Halt mehr finden.
In der Aufnahme von Albert Meier
- Brauner Heuhüpfer
Artenschutz in Franken®
Das stille Sterben junger Erdkröten unter unter den Messern der Mulchgeräte
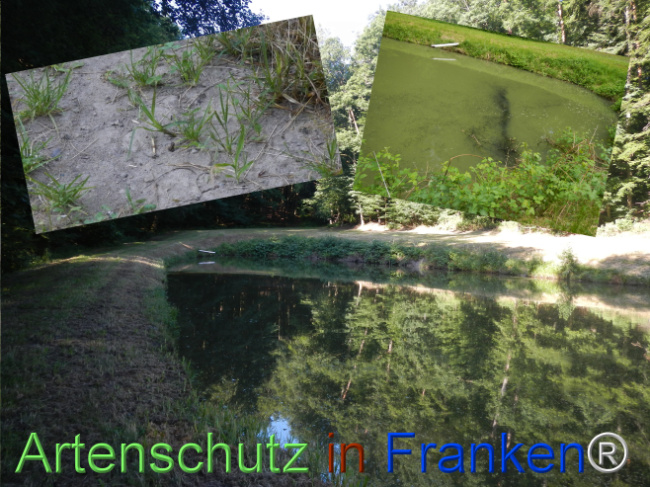
Wenn die Stille schreit: Das stille Sterben junger Erdkröten unter unter den Messern der Mulchgeräte
12/13.07.2025
Es sind junge Erdkröten, gerade erst der Metamorphose entstiegen, nicht länger Kaulquappen, sondern kleine Amphibien auf vier Beinen.
12/13.07.2025
- In einer frühen Sommernacht, wenn sich die Dunkelheit wie ein samtener Schleier über Felder und Wälder legt, regt sich etwas am Rand eines kleinen, glitzernden Tümpels. Tausende winzige Wesen – kaum größer als eine Euromünze – beginnen ihren allerersten Weg hinaus ins Leben.
Es sind junge Erdkröten, gerade erst der Metamorphose entstiegen, nicht länger Kaulquappen, sondern kleine Amphibien auf vier Beinen.
Es ist ein uraltes Ritual, ein Naturereignis von stiller Magie. Getrieben vom Instinkt, wandern sie aus dem Gewässer, das ihr Ursprung war – auf der Suche nach Verstecken, Nahrung, Schutz. Ihre Reise ist voller Hoffnung. Doch was wie ein Neubeginn aussieht, wird für unzählige von ihnen zum plötzlichen Ende.
Was sich auf den ersten Blick harmlos und unscheinbar zeigt – der Einsatz von landwirtschaftlichen Maschinen und das nicht nur zur späten Abendstunde, das Mulchen von Wiesen und Feldrändern – ist in Wahrheit eine Katastrophe im Verborgenen. Dort, wo Mähwerke rotieren, Mulcher die Vegetation niederschlagen und tonnenschwere Traktoren über feuchte Wiesen rollen, spielt sich alljährlich ein kaum beachtetes Massensterben ab.
Denn genau hier – in den feuchten Säumen, den naturbelassenen Gräben, den wilden Ackerrändern – halten sich die jungen Erdkröten auf. Es sind genau diese Rückzugsorte, die ihnen einst Schutz boten, die nun zur Todesfalle werden. Die scharfen Klingen der Geräte lassen keine Flucht zu. Ihr kleiner Körper, ihr zartes Gewebe – sie haben keine Chance. Lautlos, ohne Widerstand, werden sie getötet.
Ein stiller Tod, der niemandem auffällt – außer, man schaut genau hin.
Was bedeutet das für eine Welt, die sich zunehmend von der Natur entfremdet? Für eine Gesellschaft, die den Wandel der Jahreszeiten noch kennt, aber oft nur noch aus der Perspektive landwirtschaftlicher Nutzbarkeit?
Die Erdkröte – Bufo bufo – ist kein spektakuläres Tier. Sie glänzt nicht, sie springt nicht elegant, sie ist weder bunt noch laut. Und doch ist sie ein uraltes Geschöpf, ein Bindeglied zwischen Wasser und Land, zwischen Frühling und Sommer, zwischen den Welten. Ihre Rolle im Ökosystem ist bedeutend: Sie frisst Mückenlarven, Schnecken, Insekten – sie ist Beute und Räuber zugleich. Und sie ist ein stiller Zeuge dafür, wie sehr wir als Menschen in das feine Gefüge der Natur eingreifen – oft ohne es überhaupt zu merken.
Es ist leicht, sich über den Zustand unserer Umwelt zu beklagen. Schwerer ist es, die kleinen Zusammenhänge zu erkennen – wie das scheinbar unbedeutende Schicksal der jungen Erdkröten mit unserem Handeln verknüpft ist.
Denn dieses Sterben ist menschengemacht. Es geschieht nicht aus Notwendigkeit, sondern oft aus Unwissenheit, aus Zeitdruck, aus mangelnder Rücksicht. Doch es könnte anders sein.
Was wir tun können:
Ein Plädoyer für Achtsamkeit
Wer einmal gesehen hat, wie ein frisch metamorphosiertes Krötchen – kleiner als ein Daumennagel – unbeholfen über das Moos krabbelt, wird begreifen, wie zerbrechlich Leben sein kann. Wie schnell Hoffnung zerstört wird, wenn wir achtlos handeln.
Diese jungen Erdkröten sind keine Randnotiz. Sie sind ein Symbol dafür, wie wenig es oft braucht, um Leben zu bewahren – und wie tragisch der Preis der Gedankenlosigkeit sein kann.
Lasst uns innehalten. Lasst uns schauen, bevor wir mähen. Lasst uns nachdenken, bevor wir handeln. Damit die nächste Generation von Erdkröten nicht im Gras vergeht, sondern weiterwandern kann – in eine Zukunft, in der auch für sie noch Platz ist.
In der Aufnahme
Was sich auf den ersten Blick harmlos und unscheinbar zeigt – der Einsatz von landwirtschaftlichen Maschinen und das nicht nur zur späten Abendstunde, das Mulchen von Wiesen und Feldrändern – ist in Wahrheit eine Katastrophe im Verborgenen. Dort, wo Mähwerke rotieren, Mulcher die Vegetation niederschlagen und tonnenschwere Traktoren über feuchte Wiesen rollen, spielt sich alljährlich ein kaum beachtetes Massensterben ab.
Denn genau hier – in den feuchten Säumen, den naturbelassenen Gräben, den wilden Ackerrändern – halten sich die jungen Erdkröten auf. Es sind genau diese Rückzugsorte, die ihnen einst Schutz boten, die nun zur Todesfalle werden. Die scharfen Klingen der Geräte lassen keine Flucht zu. Ihr kleiner Körper, ihr zartes Gewebe – sie haben keine Chance. Lautlos, ohne Widerstand, werden sie getötet.
Ein stiller Tod, der niemandem auffällt – außer, man schaut genau hin.
Was bedeutet das für eine Welt, die sich zunehmend von der Natur entfremdet? Für eine Gesellschaft, die den Wandel der Jahreszeiten noch kennt, aber oft nur noch aus der Perspektive landwirtschaftlicher Nutzbarkeit?
Die Erdkröte – Bufo bufo – ist kein spektakuläres Tier. Sie glänzt nicht, sie springt nicht elegant, sie ist weder bunt noch laut. Und doch ist sie ein uraltes Geschöpf, ein Bindeglied zwischen Wasser und Land, zwischen Frühling und Sommer, zwischen den Welten. Ihre Rolle im Ökosystem ist bedeutend: Sie frisst Mückenlarven, Schnecken, Insekten – sie ist Beute und Räuber zugleich. Und sie ist ein stiller Zeuge dafür, wie sehr wir als Menschen in das feine Gefüge der Natur eingreifen – oft ohne es überhaupt zu merken.
Es ist leicht, sich über den Zustand unserer Umwelt zu beklagen. Schwerer ist es, die kleinen Zusammenhänge zu erkennen – wie das scheinbar unbedeutende Schicksal der jungen Erdkröten mit unserem Handeln verknüpft ist.
Denn dieses Sterben ist menschengemacht. Es geschieht nicht aus Notwendigkeit, sondern oft aus Unwissenheit, aus Zeitdruck, aus mangelnder Rücksicht. Doch es könnte anders sein.
Was wir tun können:
- Mulcharbeiten bewusst terminieren – möglichst erst nach der Wanderzeit junger Amphibien oder in Etappen, damit Fluchtmöglichkeiten bleiben.
- Unzerschnittene Rückzugsräume schaffen, in denen sich Kröten, Frösche und Molche sicher entwickeln können.
- Landwirtschaft und Naturschutz versöhnen, durch Kooperation, durch Rücksicht, durch Bildung.
- Sensibilisierung in der Bevölkerung stärken, um Empathie zu wecken – nicht nur für charismatische Arten, sondern auch für die unscheinbaren Mitgeschöpfe.
Ein Plädoyer für Achtsamkeit
Wer einmal gesehen hat, wie ein frisch metamorphosiertes Krötchen – kleiner als ein Daumennagel – unbeholfen über das Moos krabbelt, wird begreifen, wie zerbrechlich Leben sein kann. Wie schnell Hoffnung zerstört wird, wenn wir achtlos handeln.
Diese jungen Erdkröten sind keine Randnotiz. Sie sind ein Symbol dafür, wie wenig es oft braucht, um Leben zu bewahren – und wie tragisch der Preis der Gedankenlosigkeit sein kann.
Lasst uns innehalten. Lasst uns schauen, bevor wir mähen. Lasst uns nachdenken, bevor wir handeln. Damit die nächste Generation von Erdkröten nicht im Gras vergeht, sondern weiterwandern kann – in eine Zukunft, in der auch für sie noch Platz ist.
In der Aufnahme
- Viel planloser kann ein Eingriff in die Bodenvegetation wohl kaum terminiert werden. Der Sauberkeitswahn hat wieder einmal zugeschlagen ... gerade hatten die kleinen Erdkröten die Metamorphose erfolgreich hinter sich gebracht und sind als "Hüpferlinge" an Land gegangen. Exakt einen Tag später rückten die "Unwissenden und planlosen unserer Gesellschaft" an um am Teichkörper alles niederzumulchen. Abertausende kleine Amphibien kamen hierbei zu Tode. Für einen solchen Einsatz haben wir keinerlei Verständnis und die welches dieses Treiben umsetzen müssen keine "Augen im Kopf" gehabt haben, um das intensive Treiben der Tiere nicht erkennen zu können. War es gar bewusst umgesetzt - fand hier eine Straftat statt?
Artenschutz in Franken®
Der Hainlaufkäfer (Carabus nemoralis) – ein nützlicher Jäger am Waldboden

Der Hainlaufkäfer (Carabus nemoralis) – ein nützlicher Jäger am Waldboden
11/12.07.2025
Ursprünglich in Mittel- und Westeuropa beheimatet, wurde er im Laufe der Zeit auch in anderen Regionen eingeführt, unter anderem in Nordamerika, wo er sich erfolgreich angesiedelt hat. Als typischer Vertreter der Gattung Carabus zeichnet sich der Hainlaufkäfer durch seine Lebensweise als bodenlebender Räuber aus, der eine wichtige Rolle im Ökosystem einnimmt.
11/12.07.2025
- Der Hainlaufkäfer (Carabus nemoralis) gehört zur Familie der Laufkäfer (Carabidae) und ist eine in weiten Teilen Europas verbreitete Art.
Ursprünglich in Mittel- und Westeuropa beheimatet, wurde er im Laufe der Zeit auch in anderen Regionen eingeführt, unter anderem in Nordamerika, wo er sich erfolgreich angesiedelt hat. Als typischer Vertreter der Gattung Carabus zeichnet sich der Hainlaufkäfer durch seine Lebensweise als bodenlebender Räuber aus, der eine wichtige Rolle im Ökosystem einnimmt.
Merkmale und Aussehen
Der Hainlaufkäfer ist ein relativ großer Laufkäfer mit einer Körperlänge von etwa 15 bis 25 Millimetern. Sein Körper ist langgestreckt, kräftig gebaut und wirkt durch die glatte, glänzende Oberfläche sehr robust. Die Färbung ist in der Regel schwarz oder dunkelbraun, oft mit einem bronzenen oder violetten metallischen Schimmer, besonders auf den Flügeldecken (Elytren). Diese Elytren sind längs gefurcht und mit feinen Punktreihen versehen – ein typisches Merkmal vieler Carabus-Arten.
Die Flügeldecken sind verwachsen, was bedeutet, dass der Hainlaufkäfer flugunfähig ist. Stattdessen bewegt er sich schnell laufend am Boden fort. Die Beine sind kräftig und für das Laufen optimiert, die Antennen lang und fadenförmig.
Lebensraum und Verbreitung
Der Hainlaufkäfer bevorzugt halbschattige bis schattige Lebensräume mit ausreichend Bodenbedeckung. Man findet ihn häufig in Laubwäldern, Mischwäldern, Heckenlandschaften, Parks, Gärten und an Waldrändern. Auch in landwirtschaftlich genutzten Gebieten kann er vorkommen, sofern dort Rückzugsräume wie Feldraine oder ungestörte Bodenabschnitte vorhanden sind.
Er ist ein Kulturfolger und gilt als anpassungsfähig. Dank seiner Fähigkeit, auch in vom Menschen beeinflussten Lebensräumen zu überleben, ist Carabus nemoralis heute weit verbreitet und in vielen Regionen recht häufig.
Lebensweise und Ernährung
Der Hainlaufkäfer ist nachtaktiv und versteckt sich tagsüber unter Laub, Steinen, Totholz oder in Erdhöhlen. In der Dämmerung und nachts geht er auf Nahrungssuche. Dabei ernährt er sich räuberisch von verschiedenen kleinen Wirbellosen. Sein Beutespektrum reicht von Insektenlarven über Schnecken bis hin zu Regenwürmern. Mit seinen kräftigen Mundwerkzeugen kann er auch Schneckenhäuser aufbrechen – ein Verhalten, das ihm insbesondere im Gartenbau einen guten Ruf eingebracht hat.
Seine räuberische Lebensweise macht den Hainlaufkäfer zu einem wichtigen biologischen Schädlingsbekämpfer. Besonders nützlich ist er in Gärten und landwirtschaftlichen Flächen, wo er unter anderem Nacktschnecken und schädliche Insektenlarven frisst.
Fortpflanzung und Entwicklung
Die Fortpflanzung erfolgt im Frühjahr oder Sommer. Die Weibchen legen ihre Eier in lockeren, feuchten Boden ab. Aus den Eiern schlüpfen Larven, die ebenfalls räuberisch leben. Sie durchlaufen mehrere Larvenstadien, bevor sie sich verpuppen. Die vollständige Entwicklung vom Ei bis zum adulten Käfer dauert mehrere Wochen bis Monate – abhängig von Temperatur und Nahrungsangebot.
Viele Hainlaufkäfer überwintern als ausgewachsene Tiere in geschützten Bodenverstecken. Im Frühjahr werden sie wieder aktiv und beginnen ihre nächtliche Nahrungssuche.
Ökologische Bedeutung
Der Hainlaufkäfer ist ein bedeutender Bestandteil der Bodenfauna. Als Räuber reguliert er die Populationen anderer kleiner Tiere, darunter viele potenzielle Schädlinge. Dadurch trägt er zur Stabilität des Ökosystems bei und ist ein wichtiger Indikator für eine intakte, vielfältige Bodenstruktur.
Außerdem zeigt sein Vorkommen, dass ein Lebensraum nicht vollständig degradiert ist, denn obwohl er recht anpassungsfähig ist, benötigt er dennoch strukturreiche Flächen mit Versteckmöglichkeiten und genügend Nahrung.
Schutzstatus
Der Hainlaufkäfer ist in Europa nicht gefährdet und gehört nicht zu den streng geschützten Arten. Dennoch profitieren er und andere Laufkäfer von naturnahen Lebensräumen und dem Erhalt von Strukturen wie Totholz, Laubstreu und extensiv genutzten Grünflächen.
In er Aufnahme von Albert Meier
Der Hainlaufkäfer ist ein relativ großer Laufkäfer mit einer Körperlänge von etwa 15 bis 25 Millimetern. Sein Körper ist langgestreckt, kräftig gebaut und wirkt durch die glatte, glänzende Oberfläche sehr robust. Die Färbung ist in der Regel schwarz oder dunkelbraun, oft mit einem bronzenen oder violetten metallischen Schimmer, besonders auf den Flügeldecken (Elytren). Diese Elytren sind längs gefurcht und mit feinen Punktreihen versehen – ein typisches Merkmal vieler Carabus-Arten.
Die Flügeldecken sind verwachsen, was bedeutet, dass der Hainlaufkäfer flugunfähig ist. Stattdessen bewegt er sich schnell laufend am Boden fort. Die Beine sind kräftig und für das Laufen optimiert, die Antennen lang und fadenförmig.
Lebensraum und Verbreitung
Der Hainlaufkäfer bevorzugt halbschattige bis schattige Lebensräume mit ausreichend Bodenbedeckung. Man findet ihn häufig in Laubwäldern, Mischwäldern, Heckenlandschaften, Parks, Gärten und an Waldrändern. Auch in landwirtschaftlich genutzten Gebieten kann er vorkommen, sofern dort Rückzugsräume wie Feldraine oder ungestörte Bodenabschnitte vorhanden sind.
Er ist ein Kulturfolger und gilt als anpassungsfähig. Dank seiner Fähigkeit, auch in vom Menschen beeinflussten Lebensräumen zu überleben, ist Carabus nemoralis heute weit verbreitet und in vielen Regionen recht häufig.
Lebensweise und Ernährung
Der Hainlaufkäfer ist nachtaktiv und versteckt sich tagsüber unter Laub, Steinen, Totholz oder in Erdhöhlen. In der Dämmerung und nachts geht er auf Nahrungssuche. Dabei ernährt er sich räuberisch von verschiedenen kleinen Wirbellosen. Sein Beutespektrum reicht von Insektenlarven über Schnecken bis hin zu Regenwürmern. Mit seinen kräftigen Mundwerkzeugen kann er auch Schneckenhäuser aufbrechen – ein Verhalten, das ihm insbesondere im Gartenbau einen guten Ruf eingebracht hat.
Seine räuberische Lebensweise macht den Hainlaufkäfer zu einem wichtigen biologischen Schädlingsbekämpfer. Besonders nützlich ist er in Gärten und landwirtschaftlichen Flächen, wo er unter anderem Nacktschnecken und schädliche Insektenlarven frisst.
Fortpflanzung und Entwicklung
Die Fortpflanzung erfolgt im Frühjahr oder Sommer. Die Weibchen legen ihre Eier in lockeren, feuchten Boden ab. Aus den Eiern schlüpfen Larven, die ebenfalls räuberisch leben. Sie durchlaufen mehrere Larvenstadien, bevor sie sich verpuppen. Die vollständige Entwicklung vom Ei bis zum adulten Käfer dauert mehrere Wochen bis Monate – abhängig von Temperatur und Nahrungsangebot.
Viele Hainlaufkäfer überwintern als ausgewachsene Tiere in geschützten Bodenverstecken. Im Frühjahr werden sie wieder aktiv und beginnen ihre nächtliche Nahrungssuche.
Ökologische Bedeutung
Der Hainlaufkäfer ist ein bedeutender Bestandteil der Bodenfauna. Als Räuber reguliert er die Populationen anderer kleiner Tiere, darunter viele potenzielle Schädlinge. Dadurch trägt er zur Stabilität des Ökosystems bei und ist ein wichtiger Indikator für eine intakte, vielfältige Bodenstruktur.
Außerdem zeigt sein Vorkommen, dass ein Lebensraum nicht vollständig degradiert ist, denn obwohl er recht anpassungsfähig ist, benötigt er dennoch strukturreiche Flächen mit Versteckmöglichkeiten und genügend Nahrung.
Schutzstatus
Der Hainlaufkäfer ist in Europa nicht gefährdet und gehört nicht zu den streng geschützten Arten. Dennoch profitieren er und andere Laufkäfer von naturnahen Lebensräumen und dem Erhalt von Strukturen wie Totholz, Laubstreu und extensiv genutzten Grünflächen.
In er Aufnahme von Albert Meier
- Der Hainlaufkäfer (Carabus nemoralis)
Artenschutz in Franken®
Umfassende Suche nach besonderen Tierarten

Umfassende Suche nach besonderen Tierarten
10/11.07.2025
Im Stadtgebiet von Regensburg wurde in den Jahren 2022 bis 2023 die botanisch ausgerichtete Biotopkartierung durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Kartierung werden im Laufe des Jahres veröffentlicht. Nun sollen zoologische Daten das Wissen über besonders bedeutende Lebensräume vervollständigen.
Damit beginnt ein weiteres umfassendes Kartierungsprojekt im Auftrag des Bayerischen Landesamtes für Umwelt (LfU). Über einen Zeitraum von zwei Jahren werden im Rahmen der Naturschutzfachkartierung seltene Tierarten aus verschiedenen Artengruppen erfasst und dokumentiert. Die Ergebnisse werden voraussichtlich im Sommer 2027 vorliegen und stehen für verschiedene Maßnahmen und Planungen zur Verfügung.
10/11.07.2025
- Start der Naturschutzfachkartierung im Stadtgebiet von Regensburg
Im Stadtgebiet von Regensburg wurde in den Jahren 2022 bis 2023 die botanisch ausgerichtete Biotopkartierung durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Kartierung werden im Laufe des Jahres veröffentlicht. Nun sollen zoologische Daten das Wissen über besonders bedeutende Lebensräume vervollständigen.
Damit beginnt ein weiteres umfassendes Kartierungsprojekt im Auftrag des Bayerischen Landesamtes für Umwelt (LfU). Über einen Zeitraum von zwei Jahren werden im Rahmen der Naturschutzfachkartierung seltene Tierarten aus verschiedenen Artengruppen erfasst und dokumentiert. Die Ergebnisse werden voraussichtlich im Sommer 2027 vorliegen und stehen für verschiedene Maßnahmen und Planungen zur Verfügung.
Die jetzt beginnenden Kartierungsarbeiten, die in enger Abstimmung mit dem Umweltamt der Stadt vorbereitet wurden, umfassen die Artengruppen Reptilien, Amphibien, Libellen, Tagfalter sowie Heuschrecken und werden von einem Fachbüro aus München durchgeführt. Im Frühjahr 2026 startet die Bearbeitung der Artengruppe Vögel, die von Ornithologen aus Regensburg übernommen wird. Für alle untersuchten Artengruppen wird ein guter Überblick zu den Vorkommen im Stadtgebiet und zur Bestandsentwicklungen der einzelnen Arten angestrebt. Einerseits wird geprüft, ob bekannte Fundorte gefährdeter Arten noch von diesen besiedelt sind, andererseits sollen auch Flächen untersucht werden, zu denen noch kaum Erkenntnisse vorliegen. Daraus können Pflege- und Fördermaßnahmen abgeleitet werden, die vor allem bedrohten Arten zugutekommen.
Die Fachleute an der Stadt und am Landesamt haben etwa 100 Zielarten benannt, nach denen gesucht wird. Dazu gehören beispielsweise das Rebhuhn und die Feldlerche, die Schlingnatter, die Gelbbauchunke und eine ganze Reihe von Insektenarten, wie die Kleine Zangenlibelle, der Magerrasen-Perlmuttfalter oder der Feld-Grashüpfer. Auf den jeweiligen Untersuchungsflächen werden nicht nur die besonders gefährdeten Arten, sondern auch häufige Arten dokumentiert, um eine Vergleichsgrundlage für künftige Entwicklungen zu erhalten. Die Artenzusammensetzung ändert sich aufgrund unterschiedlicher Bewirtschaftung oder durch klimatische Umwälzungen mitunter stark. Nach Abschluss der Geländearbeiten ist mit Erkenntnissen zu etwa 200 wertvollen Lebensräumen im Stadtgebiet zu rechnen. Hinzu kommen konkrete Empfehlungen für Verbesserungs- und Pflegemaßnahmen, die in den folgenden Jahren umgesetzt werden können. Dem Umweltamt werden die Ergebnisse helfen, Fördermaßnahmen für bedrohte Arten gezielt umzusetzen.
Weitere Informationen:
Die Naturschutzfachkartierung liefert Informationen über bedrohte Tierarten in Landkreisen und kreisfreien Städten. Sie ist eine Bestandsaufnahme und erfasst eine fachlich begründete Auswahl an Flächen, die für den Naturschutz wichtig und erhaltenswert sind. Sie hat weder das Ziel noch die Möglichkeit, Flächen unter Schutz zu stellen oder Grundstückseigentümern bestimmte Bewirtschaftungsweisen vorzuschreiben. Mögliche Einschränkungen ergeben sich ausschließlich aus bestehenden gesetzlichen Vorgaben.
Bei der Kartierung werden vorhandene Daten auf den neuesten Stand gebracht und bisher nicht betrachtete Flächen erstmalig untersucht. Die Ergebnisse werden in einer landesweiten Datenbank zentral gespeichert. Das LfU koordiniert die Arbeiten bayernweit und stellt die Ergebnisse auf Anfrage für Planungsvorhaben zur Verfügung.
In der Aufnahme von Wolfgang Völkl
Quelle
Bayerisches Landesamt für Umwelt
Pressestelle
Bürgermeister-Ulrich-Straße 160
86179 Augsburg
Stand
01.07.2025
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung. Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Die Fachleute an der Stadt und am Landesamt haben etwa 100 Zielarten benannt, nach denen gesucht wird. Dazu gehören beispielsweise das Rebhuhn und die Feldlerche, die Schlingnatter, die Gelbbauchunke und eine ganze Reihe von Insektenarten, wie die Kleine Zangenlibelle, der Magerrasen-Perlmuttfalter oder der Feld-Grashüpfer. Auf den jeweiligen Untersuchungsflächen werden nicht nur die besonders gefährdeten Arten, sondern auch häufige Arten dokumentiert, um eine Vergleichsgrundlage für künftige Entwicklungen zu erhalten. Die Artenzusammensetzung ändert sich aufgrund unterschiedlicher Bewirtschaftung oder durch klimatische Umwälzungen mitunter stark. Nach Abschluss der Geländearbeiten ist mit Erkenntnissen zu etwa 200 wertvollen Lebensräumen im Stadtgebiet zu rechnen. Hinzu kommen konkrete Empfehlungen für Verbesserungs- und Pflegemaßnahmen, die in den folgenden Jahren umgesetzt werden können. Dem Umweltamt werden die Ergebnisse helfen, Fördermaßnahmen für bedrohte Arten gezielt umzusetzen.
Weitere Informationen:
Die Naturschutzfachkartierung liefert Informationen über bedrohte Tierarten in Landkreisen und kreisfreien Städten. Sie ist eine Bestandsaufnahme und erfasst eine fachlich begründete Auswahl an Flächen, die für den Naturschutz wichtig und erhaltenswert sind. Sie hat weder das Ziel noch die Möglichkeit, Flächen unter Schutz zu stellen oder Grundstückseigentümern bestimmte Bewirtschaftungsweisen vorzuschreiben. Mögliche Einschränkungen ergeben sich ausschließlich aus bestehenden gesetzlichen Vorgaben.
Bei der Kartierung werden vorhandene Daten auf den neuesten Stand gebracht und bisher nicht betrachtete Flächen erstmalig untersucht. Die Ergebnisse werden in einer landesweiten Datenbank zentral gespeichert. Das LfU koordiniert die Arbeiten bayernweit und stellt die Ergebnisse auf Anfrage für Planungsvorhaben zur Verfügung.
In der Aufnahme von Wolfgang Völkl
- Kleine Zangenlibelle
Quelle
Bayerisches Landesamt für Umwelt
Pressestelle
Bürgermeister-Ulrich-Straße 160
86179 Augsburg
Stand
01.07.2025
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung. Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Artenschutz in Franken®
SandAchse Franken: Flugplatz in Bamberg wird Naturschutzgebiet

SandAchse Franken: Flugplatz in Bamberg wird Naturschutzgebiet
09/10.07.2025
Die Trägerverbände des Projektes SandAchse Franken, der BUND Naturschutz in Bayern e.V. und der Landschaftspflegeverband Mittelfranken e.V. begrüßen diese Entscheidung und danken der Regierung für diesen Schritt.
09/10.07.2025
- Passend zum 25-jährigen Projekt-Jubiläum: Der Regierungspräsident von Oberfranken, Florian Luderschmid, verkündete am 26. Juni 2025 auf der Tagung der Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege zur Zukunft von Sandlebensräumen in Nürnberg die Ausweisung des Flugplatzes in Bamberg als weiteres Naturschutzgebiet (NSG) in Oberfranken.
Die Trägerverbände des Projektes SandAchse Franken, der BUND Naturschutz in Bayern e.V. und der Landschaftspflegeverband Mittelfranken e.V. begrüßen diese Entscheidung und danken der Regierung für diesen Schritt.
Martin Geilhufe, BN-Landesbeauftragter: „Die Flugplatz-Nebenflächen in der Breitenau bilden eines der großen Kerngebiete der SandAchse Franken, das bislang noch nicht naturschutzrechtlich gesichert war. Wir haben uns das Schutzgebiet seit langem gewünscht und freuen uns riesig, dass die der Regierung uns zum 25-jährigen Jubiläum dieses Geschenk macht.“
Karin Klein-Schmidt, Landschaftspflegeverband Mittelfranken: „Das Naturschutzgebiet Breitenau ergänzt mit seinen großen Silbergrasrasen, Besenginsterheiden und Sandtümpeln die bestehenden Naturschutzgebiete auf Sand im Raum Bamberg wie das NSG Börstig bei Hallstadt, das NSG Muna Bamberg oder das Nationale Naturerbe Hauptsmoorwald.“
Bis 2012 wurde die Breitenau in Bamberg von der US-Armee als Flugplatz genutzt. Nach dem Abzug der US-Armee wurde dann der Flugplatz unter der Obhut des Aeroclubs Bamberg e.V. zivil weiterbetrieben. 2013 kam es in einer Nacht- und Nebelaktion zur Verbreiterung der Start- und Landebahn mit entsprechenden Eingriffen in die wertvollen Naturflächen. Selbst die Untere Naturschutzbehörde der Stadt Bamberg erfuhr erst im Nachhinein von den Eingriffen und erließ nachträglich Auflagen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, die dann auch umgesetzt werden mussten.
Um die Ausweisung als Naturschutzgebiet zu befördern, hatte die Kreisgruppe Bamberg des BUND Naturschutz im Jahr 2019 einen Bürgerantrag zur Unterschutzstellung auf den Weg gebracht, den 1.400 Wahlberechtigte mit ihrer Unterschrift unterstützten. Damit war auch die Stadt Bamberg verpflichtet, die Ausweisung zu unterstützen.
Bei der Tagung der bayerischen Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (ANL) am 26. und 27.6.2025 treffen sich Fachleute des Projektes SandAchse Franken aus Naturschutzbehörden, Landschaftspflege- und Naturschutzverbänden sowie der Wissenschaft und die interessierte Öffentlichkeit im Presseclub Nürnberg. 25 Jahre nach Projektbeginn wird Bilanz gezogen und über aktuelle Entwicklungen zu sandtypischen Arten und Lebensräumen berichtet.
In der Aufnahme von Fotograf: Stefan Mümmler
Quelle
BUND NATURSCHUTZ IN BAYERN E.V. (BN)
Dr.-Johann-Maier-Straße 4
93049 Regensburg
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung. Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Karin Klein-Schmidt, Landschaftspflegeverband Mittelfranken: „Das Naturschutzgebiet Breitenau ergänzt mit seinen großen Silbergrasrasen, Besenginsterheiden und Sandtümpeln die bestehenden Naturschutzgebiete auf Sand im Raum Bamberg wie das NSG Börstig bei Hallstadt, das NSG Muna Bamberg oder das Nationale Naturerbe Hauptsmoorwald.“
Bis 2012 wurde die Breitenau in Bamberg von der US-Armee als Flugplatz genutzt. Nach dem Abzug der US-Armee wurde dann der Flugplatz unter der Obhut des Aeroclubs Bamberg e.V. zivil weiterbetrieben. 2013 kam es in einer Nacht- und Nebelaktion zur Verbreiterung der Start- und Landebahn mit entsprechenden Eingriffen in die wertvollen Naturflächen. Selbst die Untere Naturschutzbehörde der Stadt Bamberg erfuhr erst im Nachhinein von den Eingriffen und erließ nachträglich Auflagen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, die dann auch umgesetzt werden mussten.
Um die Ausweisung als Naturschutzgebiet zu befördern, hatte die Kreisgruppe Bamberg des BUND Naturschutz im Jahr 2019 einen Bürgerantrag zur Unterschutzstellung auf den Weg gebracht, den 1.400 Wahlberechtigte mit ihrer Unterschrift unterstützten. Damit war auch die Stadt Bamberg verpflichtet, die Ausweisung zu unterstützen.
Bei der Tagung der bayerischen Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (ANL) am 26. und 27.6.2025 treffen sich Fachleute des Projektes SandAchse Franken aus Naturschutzbehörden, Landschaftspflege- und Naturschutzverbänden sowie der Wissenschaft und die interessierte Öffentlichkeit im Presseclub Nürnberg. 25 Jahre nach Projektbeginn wird Bilanz gezogen und über aktuelle Entwicklungen zu sandtypischen Arten und Lebensräumen berichtet.
In der Aufnahme von Fotograf: Stefan Mümmler
- Von links: Karin Klein-Schmidt (LPV Mittelfranken) Martin Geilhufe (BUND Naturschutz); Florian Luderschmid (Regierungspräsident von Oberfranken); Britta Walthelm (Stadt Nürnberg) und Ulrike Lorenz (Vorständin Bayerischer Naturschutzfond) freuen sich über die Ausweisung des Flugplatzes in Bamberg als weiteres Naturschutzgebiet in Oberfranken
Quelle
BUND NATURSCHUTZ IN BAYERN E.V. (BN)
Dr.-Johann-Maier-Straße 4
93049 Regensburg
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung. Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Artenschutz in Franken®
Aufbruch in die Luft: Der spektakuläre Ameisen-Hochzeitsflug

Aufbruch in die Luft: Der spektakuläre Ameisen-Hochzeitsflug
26/27.06.2025
Diese einzigartige Phase im Leben von Ameisenkolonien markiert den Beginn neuer Generationen und spielt eine entscheidende Rolle im Fortbestand dieser faszinierenden Insekten.
26/27.06.2025
- Der bevorstehende Ameisen-Hochzeitsflug ist ein bemerkenswertes Naturspektakel, das jährlich Millionen von Ameisen auf nahezu der ganzen Welt betrifft.
Diese einzigartige Phase im Leben von Ameisenkolonien markiert den Beginn neuer Generationen und spielt eine entscheidende Rolle im Fortbestand dieser faszinierenden Insekten.
Ein Blick auf den Ablauf
Der Ameisen-Hochzeitsflug, auch als Schwarmflug bekannt, ist ein koordinierter Prozess, bei dem geflügelte, geschlechtsreife Ameisen aus ihren Nestern ausschwärmen, um sich zu paaren und neue Kolonien zu gründen. Dieser Flug ist stark wetterabhängig und wird oft von hoher Luftfeuchtigkeit und warmen Temperaturen begünstigt, die ideale Bedingungen für die Verbreitung der Jungköniginnen und -männchen bieten.
Die Rolle der geflügelten Ameisen
Die geflügelten Ameisen, die normalerweise nur für kurze Zeit fliegen können, nutzen diesen Flug, um sich zu vermehren. Männliche Ameisen geben dabei ihre Spermien ab, während die Jungköniginnen Spermien speichern, um später neue Kolonien zu gründen. Dieser Prozess ist entscheidend für die genetische Vielfalt und das Überleben der Ameisenpopulationen.
Wichtige ökologische Auswirkungen
Der Ameisen-Hochzeitsflug hat auch bedeutende ökologische Auswirkungen. Er trägt zur Verteilung von Ameisenpopulationen bei, die sowohl als Beutetiere als auch als Beutegreifer eine Schlüsselrolle in vielen Ökosystemen spielen. Durch die Etablierung neuer Kolonien fördert der Hochzeitsflug die Gesundheit und Anpassungsfähigkeit von Ameisenpopulationen in verschiedenen Umgebungen.
Schutz und Beobachtung
Für Biologen und Naturforscher bietet der Ameisen-Hochzeitsflug eine wertvolle Gelegenheit, das Verhalten und die Dynamik von Ameisenkolonien genauer zu studieren. Der Schutz dieser Ereignisse und der Lebensräume, in denen sie stattfinden, ist daher von entscheidender Bedeutung für die langfristige Erhaltung dieser wichtigen Insektenarten.
Faszination und Lernen
Abschließend bleibt der Ameisen-Hochzeitsflug nicht nur ein beeindruckendes Spektakel der Natur, sondern auch eine Quelle der Faszination und des Lernens für Menschen jeden Alters. Durch die Beobachtung und das Verständnis dieses Phänomens können wir nicht nur die natürliche Welt besser schätzen, sondern auch dazu beitragen, sie zu schützen und zu bewahren.
In der Aufnahme
Der Ameisen-Hochzeitsflug, auch als Schwarmflug bekannt, ist ein koordinierter Prozess, bei dem geflügelte, geschlechtsreife Ameisen aus ihren Nestern ausschwärmen, um sich zu paaren und neue Kolonien zu gründen. Dieser Flug ist stark wetterabhängig und wird oft von hoher Luftfeuchtigkeit und warmen Temperaturen begünstigt, die ideale Bedingungen für die Verbreitung der Jungköniginnen und -männchen bieten.
Die Rolle der geflügelten Ameisen
Die geflügelten Ameisen, die normalerweise nur für kurze Zeit fliegen können, nutzen diesen Flug, um sich zu vermehren. Männliche Ameisen geben dabei ihre Spermien ab, während die Jungköniginnen Spermien speichern, um später neue Kolonien zu gründen. Dieser Prozess ist entscheidend für die genetische Vielfalt und das Überleben der Ameisenpopulationen.
Wichtige ökologische Auswirkungen
Der Ameisen-Hochzeitsflug hat auch bedeutende ökologische Auswirkungen. Er trägt zur Verteilung von Ameisenpopulationen bei, die sowohl als Beutetiere als auch als Beutegreifer eine Schlüsselrolle in vielen Ökosystemen spielen. Durch die Etablierung neuer Kolonien fördert der Hochzeitsflug die Gesundheit und Anpassungsfähigkeit von Ameisenpopulationen in verschiedenen Umgebungen.
Schutz und Beobachtung
Für Biologen und Naturforscher bietet der Ameisen-Hochzeitsflug eine wertvolle Gelegenheit, das Verhalten und die Dynamik von Ameisenkolonien genauer zu studieren. Der Schutz dieser Ereignisse und der Lebensräume, in denen sie stattfinden, ist daher von entscheidender Bedeutung für die langfristige Erhaltung dieser wichtigen Insektenarten.
Faszination und Lernen
Abschließend bleibt der Ameisen-Hochzeitsflug nicht nur ein beeindruckendes Spektakel der Natur, sondern auch eine Quelle der Faszination und des Lernens für Menschen jeden Alters. Durch die Beobachtung und das Verständnis dieses Phänomens können wir nicht nur die natürliche Welt besser schätzen, sondern auch dazu beitragen, sie zu schützen und zu bewahren.
In der Aufnahme
- Nahezu gleichzeitig bereiten sich die Ameisenarten auf den ersten Jahres- Ameisenflug vor ... hier einige Aufnahmen der Braunen Wegameise (Lasius alienus) ...
Artenschutz in Franken®
Projektziel verfehlt - Zweckentfremdung von Naturschutzflächen gefährdet bedrohte Arten

Zweckentfremdung von Naturschutzflächen gefährdet bedrohte Arten
08/09.07.2025
08/09.07.2025
- Ein mit öffentlichen und privaten Mitteln speziell für den Naturschutz entwickeltes Gebiet – einst geschaffen zum Erhalt wertvoller Lebensräume und zur Förderung der Artenvielfalt – wird seit Jahren zweckentfremdet (hier gilt es die Zweckbindungsfrist des Projekts zu beachten), für Veranstaltungen und Feste, die nach unserer Auffassung mit den Grundsätzen des Naturschutzes unvereinbar sind.
Diese Nutzung widerspricht dem ursprünglichen Schutzziel und führt zu erheblichen Störungen sensibler Ökosysteme. Besonders betroffen sind nachweislich gefährdete Arten, darunter auch solche, die auf der Roten Liste stehen. Trittschäden, Lärm, Müll und nächtliche Beleuchtung beeinträchtigen nicht nur Brut- und Rückzugsräume, sondern untergraben das Vertrauen in naturverträgliche Schutzkonzepte.
Wir appellieren an alle Verantwortlichen und Besucher:innen: Naturschutzflächen sind kein Veranstaltungsort. Sie sind Rückzugsort für bedrohte Arten und ein Fundament für ökologische Stabilität – heute und in Zukunft. Nur durch konsequenten Schutz kann ihr eigentlicher Zweck erhalten bleiben.
Wo der gefährdete Drosselrohrsänger (Acrocephalus arundinaceus), die in Bayern vom Aussterben bedrohte Bekassine (Gallinago gallinago) oder der ebenso vom Aussterben bedrohte Große Brachvogel (Numenius arquata) bestätigt werden konnten, findet alle zwei Jahre eine Veranstaltung statt.
Für wenige Tage "menschlicher Freude" entsteht unzähliges Tierleid! Viele Millionen unserer Mitgeschöpfe verlieren ihren Lebensraum, manche Arten gar inmitten der Fortpflanzungszeit. Und was machen die informierten und zuständigen Naturschutzbehörden? Wir werden es sehen - wir sind aktuell in jedem Fall positiv gestimmt!
So kann das nach unsererer Auffassung nicht mehr praktiziert werden - es bedarf eines Projektmanagements das im Idealfall allen Aspekten gerecht werden kann!
In der Aufnahme
Wir appellieren an alle Verantwortlichen und Besucher:innen: Naturschutzflächen sind kein Veranstaltungsort. Sie sind Rückzugsort für bedrohte Arten und ein Fundament für ökologische Stabilität – heute und in Zukunft. Nur durch konsequenten Schutz kann ihr eigentlicher Zweck erhalten bleiben.
Wo der gefährdete Drosselrohrsänger (Acrocephalus arundinaceus), die in Bayern vom Aussterben bedrohte Bekassine (Gallinago gallinago) oder der ebenso vom Aussterben bedrohte Große Brachvogel (Numenius arquata) bestätigt werden konnten, findet alle zwei Jahre eine Veranstaltung statt.
Für wenige Tage "menschlicher Freude" entsteht unzähliges Tierleid! Viele Millionen unserer Mitgeschöpfe verlieren ihren Lebensraum, manche Arten gar inmitten der Fortpflanzungszeit. Und was machen die informierten und zuständigen Naturschutzbehörden? Wir werden es sehen - wir sind aktuell in jedem Fall positiv gestimmt!
So kann das nach unsererer Auffassung nicht mehr praktiziert werden - es bedarf eines Projektmanagements das im Idealfall allen Aspekten gerecht werden kann!
In der Aufnahme
- In dieser Form zeigt sich das Areal vor der "Flächenfreistellung" ...
Artenschutz in Franken®
Die Bachstelze (Motacilla alba): Ein eleganter Bewohner unserer Natur

Die Bachstelze (Motacilla alba): Ein eleganter Bewohner unserer Natur
07/08.07.2025
Diese Vogelart ist in Europa, Asien und Teilen Nordafrikas verbreitet und bevorzugt offene Landschaften mit Gewässern in der Nähe.
07/08.07.2025
- Die Bachstelze, wissenschaftlich bekannt als Motacilla alba, ist ein faszinierender Vogel, der sowohl durch sein Aussehen als auch durch sein Verhalten beeindruckt.
Diese Vogelart ist in Europa, Asien und Teilen Nordafrikas verbreitet und bevorzugt offene Landschaften mit Gewässern in der Nähe.
Beschreibung und Aussehen:
Die Bachstelze zeichnet sich durch ihr kontrastreiches Federkleid aus, das hauptsächlich schwarz, weiß und grau gefärbt ist. Sie haben eine markante schwarze Kappe auf dem Kopf und einen weißen Bauch, der bei den Männchen oft etwas intensiver gefärbt ist als bei den Weibchen. Diese Farbgebung hilft ihnen, sich sowohl im Wasser als auch in der Luft effektiv zu orientieren.
Lebensraum und Verhalten:
Bachstelzen sind vor allem in der Nähe von Gewässern wie Flüssen, Seen oder auch in städtischen Parks anzutreffen. Sie sind ausgezeichnete Flieger und können elegant durch die Luft gleiten, während sie nach Insekten und kleinen Wirbellosen jagen. Typischerweise bauen sie ihre Nester in Spalten von Gebäuden oder auf Felsen, wo sie ihre Jungen sicher aufziehen können.
Ökologische Bedeutung:
Als Insektenfresser spielen Bachstelzen eine wichtige Rolle im Ökosystem, da sie dazu beitragen, die Populationen von schädlichen Insekten zu kontrollieren. Ihre Anwesenheit in städtischen und ländlichen Gebieten zeigt auch die gute Qualität der Umwelt an, da sie auf saubere Wasserquellen und reichhaltige Insektenpopulationen angewiesen sind.
Schutzstatus und Gefährdung:
Die Bachstelze gilt derzeit nicht als gefährdet, jedoch können Verluste geeigneter Lebensräume durch menschliche Entwicklung ihre Populationen bedrohen. Maßnahmen zum Schutz und zur Erhaltung ihrer Lebensräume sind daher entscheidend, um sicherzustellen, dass diese faszinierenden Vögel weiterhin unsere Umwelt bereichern können.
Insgesamt ist die Bachstelze ein Symbol für Anpassungsfähigkeit und natürliche Schönheit, das uns daran erinnert, wie wichtig es ist, unsere natürlichen Lebensräume zu schützen und zu respektieren. Ihre Präsenz in unserer Umgebung bereichert nicht nur die Natur, sondern auch unsere täglichen Begegnungen mit der Tierwelt.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
Die Bachstelze zeichnet sich durch ihr kontrastreiches Federkleid aus, das hauptsächlich schwarz, weiß und grau gefärbt ist. Sie haben eine markante schwarze Kappe auf dem Kopf und einen weißen Bauch, der bei den Männchen oft etwas intensiver gefärbt ist als bei den Weibchen. Diese Farbgebung hilft ihnen, sich sowohl im Wasser als auch in der Luft effektiv zu orientieren.
Lebensraum und Verhalten:
Bachstelzen sind vor allem in der Nähe von Gewässern wie Flüssen, Seen oder auch in städtischen Parks anzutreffen. Sie sind ausgezeichnete Flieger und können elegant durch die Luft gleiten, während sie nach Insekten und kleinen Wirbellosen jagen. Typischerweise bauen sie ihre Nester in Spalten von Gebäuden oder auf Felsen, wo sie ihre Jungen sicher aufziehen können.
Ökologische Bedeutung:
Als Insektenfresser spielen Bachstelzen eine wichtige Rolle im Ökosystem, da sie dazu beitragen, die Populationen von schädlichen Insekten zu kontrollieren. Ihre Anwesenheit in städtischen und ländlichen Gebieten zeigt auch die gute Qualität der Umwelt an, da sie auf saubere Wasserquellen und reichhaltige Insektenpopulationen angewiesen sind.
Schutzstatus und Gefährdung:
Die Bachstelze gilt derzeit nicht als gefährdet, jedoch können Verluste geeigneter Lebensräume durch menschliche Entwicklung ihre Populationen bedrohen. Maßnahmen zum Schutz und zur Erhaltung ihrer Lebensräume sind daher entscheidend, um sicherzustellen, dass diese faszinierenden Vögel weiterhin unsere Umwelt bereichern können.
Insgesamt ist die Bachstelze ein Symbol für Anpassungsfähigkeit und natürliche Schönheit, das uns daran erinnert, wie wichtig es ist, unsere natürlichen Lebensräume zu schützen und zu respektieren. Ihre Präsenz in unserer Umgebung bereichert nicht nur die Natur, sondern auch unsere täglichen Begegnungen mit der Tierwelt.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- Bachstelze
Artenschutz in Franken®
Der Braunbrustigel: Herausforderungen durch Lebensraumveränderungen ...

Der Braunbrustigel: Herausforderungen durch Lebensraumveränderungen und Klimawandel
04/05.07.2025
Diese stacheligen Gesellen sind für ihre nützliche Rolle als Insektenfresser und als natürliche Schädlingsbekämpfer bekannt. Trotz ihrer Bekanntheit und Beliebtheit stehen Braunbrustigel jedoch zunehmend vor Herausforderungen, die durch elementare Veränderungen ihres Lebensraums und den Klimawandel bedingt sind.
04/05.07.2025
- Der Braunbrustigel (Erinaceus europaeus) ist eine charismatische Art der heimischen Fauna, die in weiten Teilen Europas anzutreffen ist.
Diese stacheligen Gesellen sind für ihre nützliche Rolle als Insektenfresser und als natürliche Schädlingsbekämpfer bekannt. Trotz ihrer Bekanntheit und Beliebtheit stehen Braunbrustigel jedoch zunehmend vor Herausforderungen, die durch elementare Veränderungen ihres Lebensraums und den Klimawandel bedingt sind.
Lebensraumveränderungen und ihre Auswirkungen:
Braunbrustigel sind an vielfältige Lebensräume angepasst, von Wäldern über Gärten bis hin zu städtischen Gebieten. Ihre Fähigkeit, in verschiedenen Umgebungen zu leben, hat zu ihrer Verbreitung beigetragen. Dennoch sind sie empfindlich gegenüber Veränderungen in ihrem natürlichen Lebensraum. Die fortschreitende Urbanisierung, intensive Landnutzung und Fragmentierung von Lebensräumen setzen den Lebensraum des Braunbrustigels unter Druck. Die Zerschneidung ihrer Lebensräume durch Straßen und Siedlungen führt zu isolierten Populationen und erschwert den Austausch zwischen diesen, was langfristig die genetische Vielfalt gefährden kann.
Klimawandel als zusätzliche Belastung:
Der Klimawandel stellt eine weitere große Herausforderung für den Braunbrustigel dar. Veränderte Niederschlagsmuster, längere Trockenperioden und häufigere Extremwetterereignisse können die Verfügbarkeit von Nahrung und Unterschlupfmöglichkeiten beeinträchtigen. Insbesondere die zunehmende Häufigkeit von Hitzeperioden im Sommer kann für die stacheligen Säugetiere gefährlich sein, da sie aufgrund ihrer physiologischen Eigenschaften anfällig für Überhitzung sind.
Schutzmaßnahmen und Erhaltungsbemühungen:
Um den Rückgang der Braunbrustigel-Populationen zu verlangsamen, sind gezielte Schutzmaßnahmen und Erhaltungsbemühungen von entscheidender Bedeutung. Dazu gehören die Schaffung und der Schutz von Biotopverbundsystemen, die Förderung naturnaher Gärten und die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Bedürfnisse dieser Tierart. Darüber hinaus ist die Überwachung und Erforschung ihrer Lebensräume sowie die Entwicklung von Anpassungsstrategien an den Klimawandel von großer Wichtigkeit.
Insgesamt ist der Braunbrustigel ein Beispiel für die vielfältigen Herausforderungen, denen viele Arten durch menschliche Aktivitäten und Umweltveränderungen ausgesetzt sind. Durch ein bewusstes Handeln auf individueller und gesellschaftlicher Ebene können wir dazu beitragen, diese faszinierenden Tiere und ihre Lebensräume für zukünftige Generationen zu bewahren.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
Braunbrustigel sind an vielfältige Lebensräume angepasst, von Wäldern über Gärten bis hin zu städtischen Gebieten. Ihre Fähigkeit, in verschiedenen Umgebungen zu leben, hat zu ihrer Verbreitung beigetragen. Dennoch sind sie empfindlich gegenüber Veränderungen in ihrem natürlichen Lebensraum. Die fortschreitende Urbanisierung, intensive Landnutzung und Fragmentierung von Lebensräumen setzen den Lebensraum des Braunbrustigels unter Druck. Die Zerschneidung ihrer Lebensräume durch Straßen und Siedlungen führt zu isolierten Populationen und erschwert den Austausch zwischen diesen, was langfristig die genetische Vielfalt gefährden kann.
Klimawandel als zusätzliche Belastung:
Der Klimawandel stellt eine weitere große Herausforderung für den Braunbrustigel dar. Veränderte Niederschlagsmuster, längere Trockenperioden und häufigere Extremwetterereignisse können die Verfügbarkeit von Nahrung und Unterschlupfmöglichkeiten beeinträchtigen. Insbesondere die zunehmende Häufigkeit von Hitzeperioden im Sommer kann für die stacheligen Säugetiere gefährlich sein, da sie aufgrund ihrer physiologischen Eigenschaften anfällig für Überhitzung sind.
Schutzmaßnahmen und Erhaltungsbemühungen:
Um den Rückgang der Braunbrustigel-Populationen zu verlangsamen, sind gezielte Schutzmaßnahmen und Erhaltungsbemühungen von entscheidender Bedeutung. Dazu gehören die Schaffung und der Schutz von Biotopverbundsystemen, die Förderung naturnaher Gärten und die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Bedürfnisse dieser Tierart. Darüber hinaus ist die Überwachung und Erforschung ihrer Lebensräume sowie die Entwicklung von Anpassungsstrategien an den Klimawandel von großer Wichtigkeit.
Insgesamt ist der Braunbrustigel ein Beispiel für die vielfältigen Herausforderungen, denen viele Arten durch menschliche Aktivitäten und Umweltveränderungen ausgesetzt sind. Durch ein bewusstes Handeln auf individueller und gesellschaftlicher Ebene können wir dazu beitragen, diese faszinierenden Tiere und ihre Lebensräume für zukünftige Generationen zu bewahren.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- Nachtaufnahme - Igel sind auch in Bayern seltener anzutreffen - Negative Lebensraumveränderungen und der Klimawandel bringen den Säuger an seine Grenzen.
Artenschutz in Franken®
Der Walker ...

Der Walker, der auch Türkischer Maikäfer (Polyphylla fullo) genannt wird
06/07.06.2025
06/07.06.2025
- Als Polyphylla fullo, auch bekannt als Walker, möchte ich meine faszinierende Existenz aus meiner eigenen Perspektive erklären, während ich gleichzeitig einige fachliche Aspekte einbinde.
Ich bin ein Käfer der Familie Scarabaeidae und gehöre zur Gattung Polyphylla. Mein wissenschaftlicher Name, Polyphylla fullo, deutet auf meine Zugehörigkeit innerhalb dieser Gruppe hin.Als Mitglied dieser Familie spiele ich eine wichtige ökologische Rolle, besonders während meiner Larvenphase. Meine Larven leben in morschem Holz, wo sie sich von abgestorbenem organischen Material ernähren und so zur Zersetzung und Recycling von Nährstoffen beitragen.
Als erwachsener Käfer bin ich zwischen 15 und 30 Millimeter groß und besitze eine charakteristische, robuste Gestalt mit auffälligen, gezackten Antennen. Diese Antennen sind nicht nur ein markantes Merkmal, sondern dienen auch der Wahrnehmung meiner Umwelt und der Suche nach Partnern. Ich ernähre mich hauptsächlich von Blättern und bin besonders in warmen, sandigen Lebensräumen anzutreffen, wo ich mich durch Sand und Erde grabe, um mich vor Hitze zu schützen.
Meine Fortpflanzung ist ein interessanter Teil meines Lebenszyklus. Als Männchen bin ich aktiv auf der Suche nach Weibchen, um mich zu paaren. Dies geschieht häufig in den Abendstunden oder nachts, wenn die Temperaturen angenehmer sind. Einmal gepaart, legt das Weibchen Eier in den Boden, wo sie nach einiger Zeit schlüpfen und sich zu Larven entwickeln, um den Zyklus von neuem zu beginnen.
Fachlich betrachtet bin ich ein wichtiger Bestandteil des Ökosystems, da ich nicht nur zur Nährstoffrückführung beitrage, sondern auch als Nahrungsquelle für verschiedene Tiere diene, darunter Vögel und andere Insekten. Meine Anpassungsfähigkeit an verschiedene Lebensräume und meine Fähigkeit, Nahrung zu finden und mich fortzupflanzen, sind evolutionäre Merkmale, die mich erfolgreich gemacht haben.
Insgesamt bin ich als Polyphylla fullo stolz darauf, Teil der reichen Vielfalt der Natur zu sein und durch meine Lebensweise zur Aufrechterhaltung des ökologischen Gleichgewichts beizutragen.
In der Aufnahme von K.Schmidt
Als erwachsener Käfer bin ich zwischen 15 und 30 Millimeter groß und besitze eine charakteristische, robuste Gestalt mit auffälligen, gezackten Antennen. Diese Antennen sind nicht nur ein markantes Merkmal, sondern dienen auch der Wahrnehmung meiner Umwelt und der Suche nach Partnern. Ich ernähre mich hauptsächlich von Blättern und bin besonders in warmen, sandigen Lebensräumen anzutreffen, wo ich mich durch Sand und Erde grabe, um mich vor Hitze zu schützen.
Meine Fortpflanzung ist ein interessanter Teil meines Lebenszyklus. Als Männchen bin ich aktiv auf der Suche nach Weibchen, um mich zu paaren. Dies geschieht häufig in den Abendstunden oder nachts, wenn die Temperaturen angenehmer sind. Einmal gepaart, legt das Weibchen Eier in den Boden, wo sie nach einiger Zeit schlüpfen und sich zu Larven entwickeln, um den Zyklus von neuem zu beginnen.
Fachlich betrachtet bin ich ein wichtiger Bestandteil des Ökosystems, da ich nicht nur zur Nährstoffrückführung beitrage, sondern auch als Nahrungsquelle für verschiedene Tiere diene, darunter Vögel und andere Insekten. Meine Anpassungsfähigkeit an verschiedene Lebensräume und meine Fähigkeit, Nahrung zu finden und mich fortzupflanzen, sind evolutionäre Merkmale, die mich erfolgreich gemacht haben.
Insgesamt bin ich als Polyphylla fullo stolz darauf, Teil der reichen Vielfalt der Natur zu sein und durch meine Lebensweise zur Aufrechterhaltung des ökologischen Gleichgewichts beizutragen.
In der Aufnahme von K.Schmidt
- Walker / Türkischer Maikäfer (Polyphylla fullo) - Todfund vom 27.06.205
Artenschutz in Franken®
Oase des (Über)-Lebens - Lechtingen ... Ein Lebensraum entsteht ...

Oase des (Über)-Lebens - Lechtingen
03/04.07.2025
Niedersachsen / Lechtingen. Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und dem Windmühle Lechtingen e.V. das von der der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.
Zielsetzung dieses Gemeinschaftsprojekts soll es in erster Linie sein, aus einer vormals artenfernen Struktur einen Lebensraum zu gestalten, der es zahlreichen Tier- und Pflanzenarten ermöglichen soll in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt wertvolle Rückzugsräume zu finden.
03/04.07.2025
Niedersachsen / Lechtingen. Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und dem Windmühle Lechtingen e.V. das von der der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.
Zielsetzung dieses Gemeinschaftsprojekts soll es in erster Linie sein, aus einer vormals artenfernen Struktur einen Lebensraum zu gestalten, der es zahlreichen Tier- und Pflanzenarten ermöglichen soll in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt wertvolle Rückzugsräume zu finden.
Dabei legen wir besonderen Wert darauf, auch Menschen mit in diese Kulisse mitzunehmen und über die entsprechenden Biotopstrukturen zu informieren. Wenn es uns dabei auch noch gelingt hier Interesse zu fördern, sich gleichfalls für den Erhalt der Biodiversität zu engagieren, dann haben wir unser Ziel erreicht.
In der Aufnahme
In der Aufnahme
- Die "Wilde Bienchen Station"
Artenschutz in Franken®
Die Rote Holzmulmschwebfliege (Brachypalpoides lentus)

Die Rote Holzmulmschwebfliege (Brachypalpoides lentus)
05/06.07.2025
Sie fällt durch ihre auffällige Färbung und ihre seltene Erscheinung auf und spielt eine wichtige Rolle in unseren heimischen Ökosystemen.
05/06.07.2025
- Die Rote Holzmulmschwebfliege, wissenschaftlich Brachypalpoides lentus, gehört zur Familie der Schwebfliegen (Syrphidae).
Sie fällt durch ihre auffällige Färbung und ihre seltene Erscheinung auf und spielt eine wichtige Rolle in unseren heimischen Ökosystemen.
Aussehen und Merkmale
Diese Schwebfliegenart ist relativ groß: Die ausgewachsenen Tiere erreichen eine Körperlänge von etwa 10 bis 14 Millimetern. Charakteristisch sind der dunkle Thorax, das rotbraune Abdomen und die relativ breiten, dunkel getönten Flügel. Durch ihre Färbung erinnert sie auf den ersten Blick an eine Wespe oder Biene – eine typische Schutzmimikry, die viele Schwebfliegenarten zeigen.
Lebensweise und Entwicklung
Die Rote Holzmulmschwebfliege bevorzugt alte Laubwälder mit totholzreichen Bereichen. Die Larven leben im vermoderten Holz, insbesondere im Mulm alter Baumstämme – daher auch der Name. Dort zersetzen sie abgestorbenes Pflanzenmaterial und tragen zur Humusbildung bei. Die erwachsenen Tiere sind zwischen April und Juni aktiv und besuchen bevorzugt Blüten von Doldenblütlern, um Nektar und Pollen aufzunehmen. Dabei leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Bestäubung.
Verbreitung
Brachypalpoides lentus ist in weiten Teilen Mitteleuropas verbreitet, allerdings nicht überall häufig. Ihre Bestände gelten als empfindlich gegenüber Habitatverlust, insbesondere durch die Entfernung von Alt- und Totholz in Wäldern.
Ökologische Bedeutung
Die Art erfüllt zwei wichtige ökologische Funktionen:
Schutzstatus
In manchen Regionen wird die Rote Holzmulmschwebfliege als potenziell gefährdet eingestuft, da geeignete Lebensräume durch forstwirtschaftliche Nutzung zurückgehen. Der Erhalt von Alt- und Totholz ist daher essenziell für ihren Schutz.
Fazit
Die Rote Holzmulmschwebfliege ist nicht nur schön anzusehen, sondern auch ökologisch wertvoll. Ihre Lebensweise macht sie zu einem guten Indikator für naturnahe Wälder mit funktionierenden Stoffkreisläufen. Wer sich für Natur- und Artenschutz interessiert, sollte auch auf diese eher unscheinbaren, aber nützlichen Insekten achten.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
Diese Schwebfliegenart ist relativ groß: Die ausgewachsenen Tiere erreichen eine Körperlänge von etwa 10 bis 14 Millimetern. Charakteristisch sind der dunkle Thorax, das rotbraune Abdomen und die relativ breiten, dunkel getönten Flügel. Durch ihre Färbung erinnert sie auf den ersten Blick an eine Wespe oder Biene – eine typische Schutzmimikry, die viele Schwebfliegenarten zeigen.
Lebensweise und Entwicklung
Die Rote Holzmulmschwebfliege bevorzugt alte Laubwälder mit totholzreichen Bereichen. Die Larven leben im vermoderten Holz, insbesondere im Mulm alter Baumstämme – daher auch der Name. Dort zersetzen sie abgestorbenes Pflanzenmaterial und tragen zur Humusbildung bei. Die erwachsenen Tiere sind zwischen April und Juni aktiv und besuchen bevorzugt Blüten von Doldenblütlern, um Nektar und Pollen aufzunehmen. Dabei leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Bestäubung.
Verbreitung
Brachypalpoides lentus ist in weiten Teilen Mitteleuropas verbreitet, allerdings nicht überall häufig. Ihre Bestände gelten als empfindlich gegenüber Habitatverlust, insbesondere durch die Entfernung von Alt- und Totholz in Wäldern.
Ökologische Bedeutung
Die Art erfüllt zwei wichtige ökologische Funktionen:
- Als Bestäuber von Wildpflanzen.
- Als Zersetzer in ihrer Larvenphase, wodurch sie zur Nährstoffkreislauf beiträgt.
Schutzstatus
In manchen Regionen wird die Rote Holzmulmschwebfliege als potenziell gefährdet eingestuft, da geeignete Lebensräume durch forstwirtschaftliche Nutzung zurückgehen. Der Erhalt von Alt- und Totholz ist daher essenziell für ihren Schutz.
Fazit
Die Rote Holzmulmschwebfliege ist nicht nur schön anzusehen, sondern auch ökologisch wertvoll. Ihre Lebensweise macht sie zu einem guten Indikator für naturnahe Wälder mit funktionierenden Stoffkreisläufen. Wer sich für Natur- und Artenschutz interessiert, sollte auch auf diese eher unscheinbaren, aber nützlichen Insekten achten.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- Die Rote Holzmulmschwebfliege (Brachypalpoides lentus) findet man von Mai bis August in Wäldern, auf Lichtungen oder an Waldrändern.
Artenschutz in Franken®
Der Große Puppenräuber ist nach 100 Jahren zurück!

Citizen-Science-Projekt der LWF belegt: Der Große Puppenräuber ist nach 100 Jahren zurück!
02/03.07.2025
Speziell in der Landeshauptstadt wurde er aktuell bereits mehrfach gesichtet. Seit 2018 hatte die Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF) mit „Citizen Science“-Aufrufen dazu aufgefordert, Beobachtungen dieses Laufkäfers in Bayern zu melden. Nun steht fest: Der Große Puppenräuber (Calosoma sycophanta) wird nicht nur in Nordbayern häufiger - er ist endlich auch wieder in Südbayern zu Hause!
Sogar mitten in der Landeshauptstadt konnte die Art 2025 nachgewiesen werden: In einem Garten in Bogenhausen und in einem Lohwald in Moosach. Auch aus Freising und Landshut liegen aktuelle Meldungen vor. Alle Funde wurden per Fotonachweis durch die LWF bestätigt.
02/03.07.2025
- Freising, 11.06.2025: Der Große Puppenräuber ist zurück! Nach deutlich mehr als einem Jahrhundert wurde der große Nützling wieder in Südbayern gefunden.
Speziell in der Landeshauptstadt wurde er aktuell bereits mehrfach gesichtet. Seit 2018 hatte die Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF) mit „Citizen Science“-Aufrufen dazu aufgefordert, Beobachtungen dieses Laufkäfers in Bayern zu melden. Nun steht fest: Der Große Puppenräuber (Calosoma sycophanta) wird nicht nur in Nordbayern häufiger - er ist endlich auch wieder in Südbayern zu Hause!
Sogar mitten in der Landeshauptstadt konnte die Art 2025 nachgewiesen werden: In einem Garten in Bogenhausen und in einem Lohwald in Moosach. Auch aus Freising und Landshut liegen aktuelle Meldungen vor. Alle Funde wurden per Fotonachweis durch die LWF bestätigt.
Nützliche Käfer mit Appetit auf Schädlinge
Seit einigen Jahren breiten sich aufgrund der massiven Klimaerwärmung verschiedene Nachtfalter-Arten stark aus – es gibt Massenvermehrungen. Einige an Eichen lebende Arten können dabei erhebliche Probleme verursachen: Sei es, dass sie die Bäume kahlfressen und dadurch schädigen, oder sei es, dass Brennhaare ihre Raupen allergische Reaktionen auslösen. Glücklicherweise haben sich zwei heimische große Laufkäfer-Arten, der Große und der Kleine Puppenräuber, auf den Verzehr solcher Raupen spezialisiert und breiten sich in der Folge ebenfalls aus.
Vor allem in Nordbayerns Laubwäldern sind die beiden Arten aus der Gattung Calosoma wieder recht verbreitet. Dagegen lagen die letzten Nachweise südlich der Donau schon über 100 Jahre zurück, konkret stammten sie aus dem Jahr 1906.
Erfolgreiches Citizen Science Projekt geht weiter! Meldungen erwünscht!
Der Große wie der Kleine Puppenräuber gelten weiterhin als gefährdet bzw. stark gefährdet und sind dabei äußerst nützlich. „Die Meldungen der aufmerksamen Bürgerinnen und Bürger sind für uns als Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft unglaublich wertvoll.
Nur so können wir uns einen Überblick verschaffen, wo die beiden Puppenräuber tatsächlich vorkommen“, so der Präsident der Landesanstalt, Dr. Peter Pröbstle.
„Bitte melden Sie uns daher Sichtungen oder Verdachtsbeobachtungen dieser beiden Laufkäfer. Wichtig dabei ist gutes Bildmaterial und insbesondere der genaue Fundort.
Erkennungsmerkmale und Lebensraum
Die Aktivitätszeit liegt bei beiden Arten streng begrenzt auf das Frühjahr, mit einem Maximum im Mai bis Juni. Gerade in dieser und den nächsten Wochen treten sie noch in Wäldern und urbanen Grünflächen auf.
Beiden Käfern gemeinsam ist das querovale Halsschild - und damit das wichtigste Unterscheidungsmerkmal gegenüber den ansonsten sehr ähnlich gefärbten Rosenkäfern und den Großlaufkäfern der Gattung Carabus.
Die LWF bietet auf ihrer Homepage ein Faltblatt mit Portraits beider Arten zum Download an: https://link2.bayern/puppenraeuber
In der Aufnahme von © B. Flicker
Ansprechpartner zum Thema:
Dr. Stefan Müller-Kroehling
Tel.: 081614591612
E-Mail: poststelle@lwf.bayern.de
Quelle
Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft
Hans-Carl-von-Carlowitz-Platz 1
85354 Freising
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung. Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Seit einigen Jahren breiten sich aufgrund der massiven Klimaerwärmung verschiedene Nachtfalter-Arten stark aus – es gibt Massenvermehrungen. Einige an Eichen lebende Arten können dabei erhebliche Probleme verursachen: Sei es, dass sie die Bäume kahlfressen und dadurch schädigen, oder sei es, dass Brennhaare ihre Raupen allergische Reaktionen auslösen. Glücklicherweise haben sich zwei heimische große Laufkäfer-Arten, der Große und der Kleine Puppenräuber, auf den Verzehr solcher Raupen spezialisiert und breiten sich in der Folge ebenfalls aus.
Vor allem in Nordbayerns Laubwäldern sind die beiden Arten aus der Gattung Calosoma wieder recht verbreitet. Dagegen lagen die letzten Nachweise südlich der Donau schon über 100 Jahre zurück, konkret stammten sie aus dem Jahr 1906.
- Der Große Puppenräuber folgt den „Massenvermehrungen“
- Was ist mit dem Kleinen Puppenräuber?
Erfolgreiches Citizen Science Projekt geht weiter! Meldungen erwünscht!
Der Große wie der Kleine Puppenräuber gelten weiterhin als gefährdet bzw. stark gefährdet und sind dabei äußerst nützlich. „Die Meldungen der aufmerksamen Bürgerinnen und Bürger sind für uns als Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft unglaublich wertvoll.
Nur so können wir uns einen Überblick verschaffen, wo die beiden Puppenräuber tatsächlich vorkommen“, so der Präsident der Landesanstalt, Dr. Peter Pröbstle.
„Bitte melden Sie uns daher Sichtungen oder Verdachtsbeobachtungen dieser beiden Laufkäfer. Wichtig dabei ist gutes Bildmaterial und insbesondere der genaue Fundort.
Erkennungsmerkmale und Lebensraum
Die Aktivitätszeit liegt bei beiden Arten streng begrenzt auf das Frühjahr, mit einem Maximum im Mai bis Juni. Gerade in dieser und den nächsten Wochen treten sie noch in Wäldern und urbanen Grünflächen auf.
- Großer Puppenräuber
- Kleiner Puppenräuber
Beiden Käfern gemeinsam ist das querovale Halsschild - und damit das wichtigste Unterscheidungsmerkmal gegenüber den ansonsten sehr ähnlich gefärbten Rosenkäfern und den Großlaufkäfern der Gattung Carabus.
Die LWF bietet auf ihrer Homepage ein Faltblatt mit Portraits beider Arten zum Download an: https://link2.bayern/puppenraeuber
In der Aufnahme von © B. Flicker
- Großer Puppenräuber, Größe: 17 – 28 mm
Ansprechpartner zum Thema:
Dr. Stefan Müller-Kroehling
Tel.: 081614591612
E-Mail: poststelle@lwf.bayern.de
Quelle
Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft
Hans-Carl-von-Carlowitz-Platz 1
85354 Freising
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung. Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Artenschutz in Franken®
Norderoog verliert Brandseeschwalbe als Brutvogel

Norderoog verliert Brandseeschwalbe als Brutvogel
01/02.07.2025
Erst Scharhörn, dann Trischen – jetzt verliert auch Norderoog seine Brandseeschwalben als Brutvogel
Ahrensburg / Norderoog. Die Vogelhallig Norderoog ist seit mehr als 100 Jahren bedeutender Brutplatz der vom Aussterben bedrohten Brandseeschwalbe im nordfriesischen Wattenmeer. Doch was lange als stabiler Brutplatz galt, ist nun verwaist. Die Livestreams des Projekts Klimahallig Norderoog zeigen eine ungewohnte Szenerie: keine brütenden Brandseeschwalben, keine Koloniegeräusche. Es ist still geworden auf der Vogelhallig. Dabei begann das Jahr hoffnungsvoll: Im März und April flogen wie üblich Brandseeschwalben über Norderoog, um ihr künftiges Brutrevier zu erkunden. Sie brüten dort für gewöhnlich gemeinsam mit Lachmöwen in großen Kolonien.
01/02.07.2025
- Der Verein Jordsand ist alarmiert:
Erst Scharhörn, dann Trischen – jetzt verliert auch Norderoog seine Brandseeschwalben als Brutvogel
Ahrensburg / Norderoog. Die Vogelhallig Norderoog ist seit mehr als 100 Jahren bedeutender Brutplatz der vom Aussterben bedrohten Brandseeschwalbe im nordfriesischen Wattenmeer. Doch was lange als stabiler Brutplatz galt, ist nun verwaist. Die Livestreams des Projekts Klimahallig Norderoog zeigen eine ungewohnte Szenerie: keine brütenden Brandseeschwalben, keine Koloniegeräusche. Es ist still geworden auf der Vogelhallig. Dabei begann das Jahr hoffnungsvoll: Im März und April flogen wie üblich Brandseeschwalben über Norderoog, um ihr künftiges Brutrevier zu erkunden. Sie brüten dort für gewöhnlich gemeinsam mit Lachmöwen in großen Kolonien.
Doch mittlerweile ist klar: Es fehlen tausende Brutpaare.
„Angesichts dieser Entwicklung bin ich erschrocken und in großer Sorge“, sagt Dr. Veit Hennig, 1. Vorsitzender des Vereins Jordsand. „Nachdem Mitte Mai auch die Lachmöwen ihre Brutkolonien auf Norderoog wieder verlassen haben, ist gewiss: die Brandseeschwalbe wird in diesem Jahr nicht auf Norderoog brüten.“
Eine einzelne Ursache ist nicht zu erkennen. Die Einflüsse sind so vielfältig wie die Bedrohungen, mit denen die Seevögel in ihrem Leben konfrontiert sind. In den letzten Jahren wurde Norderoog immer wieder von Sommerfluten heimgesucht, bei denen tausende Gelege zerstört wurden und Jungvögel starben. Darüber berichtete der Verein Jordsand auch in seiner Pressemitteilung vom 11.06.2024. Weiterhin fielen Brandseeschwalben und Lachmöwen der Vogelgrippe zum Opfer und Wanderratten fraßen die Eier der Seevögel. All das merken sich die Brandseeschwalben und Lachmöwen, sodass Norderoog seine Bedeutung als Brutplatz für diese Arten verliert.
Nils Bayer, Vogelwart des Vereins Jordsand auf Hallig Norderoog, beobachtet die Veränderungen aus nächster Nähe. „Ich erlebe hier die drastischen Auswirkungen der Klimakrise auf die Natur. Hart getroffen davon ist das zerbrechliche Ökosystem im Wattenmeer und auch die Vogelhallig Norderoog. Die Artenzusammensetzung befindet sich in einem massiven Wandel. Invasive Arten wie die Wanderratte erobern neue Lebensräume und Jungfische wie der Nachwuchs von Heringen bleibt aus. Dies hat Folgen für die stark bedrohten Seevögel und ist eine beunruhigende Entwicklung“, so Nils Bayer.
Dem allem zum Trotz brüten derzeit noch einzelne Paare der Küstenseeschwalbe auf Norderoog. Auch Flussseeschwalben, Silber- und Heringsmöwen können auf der Internetseite www.klimahallig.de live über fünf Webcams beobachtet werden. Das vom Land Schleswig-Holstein geförderte Projekt „Klimahallig Norderoog“ des Vereins Jordsand verfolgt das Ziel über die verheerenden Auswirkungen der Klimakrise zu informieren und aufzuklären. „Besonders jetzt ist es wichtig, den Fortbestand des Klimahallig-Projektes zu sichern, denn nur so kann der Zustand langfristig dokumentiert und erforscht werden“, so Bela Catherin Bruhn, Projektleiterin des Klimahallig Projektes.
Und es gibt Lichtblicke: Auf der benachbarten Hallig Süderoog haben in den letzten Wochen Brandseeschwalben mit der Brut begonnen und auch im niedersächsischen Wattenmeer brüten sie glücklicherweise weiterhin. Die Hoffnung bleibt, dass die Brandseeschwalben und Lachmöwen in den nächsten Jahren wieder nach Norderoog zurückkehren werden. Der Verein Jordsand gibt sein Bestes diesen einzigartigen Ort zu schützen und als Brutplatz zu bewahren.
In der Aufnahme von Sebastian Conradt
Quelle
Verein Jordsand zum Schutz der Seevögel und der Natur e. V.
Bornkampsweg 35
22926 Ahrensburg
Stand
13.06.2025
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung. Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
„Angesichts dieser Entwicklung bin ich erschrocken und in großer Sorge“, sagt Dr. Veit Hennig, 1. Vorsitzender des Vereins Jordsand. „Nachdem Mitte Mai auch die Lachmöwen ihre Brutkolonien auf Norderoog wieder verlassen haben, ist gewiss: die Brandseeschwalbe wird in diesem Jahr nicht auf Norderoog brüten.“
Eine einzelne Ursache ist nicht zu erkennen. Die Einflüsse sind so vielfältig wie die Bedrohungen, mit denen die Seevögel in ihrem Leben konfrontiert sind. In den letzten Jahren wurde Norderoog immer wieder von Sommerfluten heimgesucht, bei denen tausende Gelege zerstört wurden und Jungvögel starben. Darüber berichtete der Verein Jordsand auch in seiner Pressemitteilung vom 11.06.2024. Weiterhin fielen Brandseeschwalben und Lachmöwen der Vogelgrippe zum Opfer und Wanderratten fraßen die Eier der Seevögel. All das merken sich die Brandseeschwalben und Lachmöwen, sodass Norderoog seine Bedeutung als Brutplatz für diese Arten verliert.
Nils Bayer, Vogelwart des Vereins Jordsand auf Hallig Norderoog, beobachtet die Veränderungen aus nächster Nähe. „Ich erlebe hier die drastischen Auswirkungen der Klimakrise auf die Natur. Hart getroffen davon ist das zerbrechliche Ökosystem im Wattenmeer und auch die Vogelhallig Norderoog. Die Artenzusammensetzung befindet sich in einem massiven Wandel. Invasive Arten wie die Wanderratte erobern neue Lebensräume und Jungfische wie der Nachwuchs von Heringen bleibt aus. Dies hat Folgen für die stark bedrohten Seevögel und ist eine beunruhigende Entwicklung“, so Nils Bayer.
Dem allem zum Trotz brüten derzeit noch einzelne Paare der Küstenseeschwalbe auf Norderoog. Auch Flussseeschwalben, Silber- und Heringsmöwen können auf der Internetseite www.klimahallig.de live über fünf Webcams beobachtet werden. Das vom Land Schleswig-Holstein geförderte Projekt „Klimahallig Norderoog“ des Vereins Jordsand verfolgt das Ziel über die verheerenden Auswirkungen der Klimakrise zu informieren und aufzuklären. „Besonders jetzt ist es wichtig, den Fortbestand des Klimahallig-Projektes zu sichern, denn nur so kann der Zustand langfristig dokumentiert und erforscht werden“, so Bela Catherin Bruhn, Projektleiterin des Klimahallig Projektes.
Und es gibt Lichtblicke: Auf der benachbarten Hallig Süderoog haben in den letzten Wochen Brandseeschwalben mit der Brut begonnen und auch im niedersächsischen Wattenmeer brüten sie glücklicherweise weiterhin. Die Hoffnung bleibt, dass die Brandseeschwalben und Lachmöwen in den nächsten Jahren wieder nach Norderoog zurückkehren werden. Der Verein Jordsand gibt sein Bestes diesen einzigartigen Ort zu schützen und als Brutplatz zu bewahren.
In der Aufnahme von Sebastian Conradt
- Brütende Brandseeschwalbe
Quelle
Verein Jordsand zum Schutz der Seevögel und der Natur e. V.
Bornkampsweg 35
22926 Ahrensburg
Stand
13.06.2025
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung. Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Artenschutz in Franken®
Der Feldmaikäfer (Melolontha melolontha): Vom Frühlingsboten zur ...

Der Feldmaikäfer (Melolontha melolontha): Vom Frühlingsboten zur ökologischen Schlüsselfigur
30.06/01.07.2025
Mit seinem kräftigen Körper, dem braunen Flügelkleid und den fächerförmigen Fühlern ist er nicht nur ein Sinnbild für den Frühling, sondern auch ein wichtiger Bestandteil im ökologischen Gefüge.
30.06/01.07.2025
- Der Feldmaikäfer gehört zu den auffälligsten Käferarten Mitteleuropas.
Mit seinem kräftigen Körper, dem braunen Flügelkleid und den fächerförmigen Fühlern ist er nicht nur ein Sinnbild für den Frühling, sondern auch ein wichtiger Bestandteil im ökologischen Gefüge.
Rolle im Ökosystem: Mehr als nur ein „Käfer“
Sowohl die ausgewachsenen Käfer als auch ihre Larven – die sogenannten Engerlinge – erfüllen eine wichtige Funktion im Naturhaushalt:
Feldmaikäfer im Spannungsfeld: Zwischen natürlichem Vorkommen und Schädlingsimage
In der Vergangenheit galten Feldmaikäfer regional als landwirtschaftlicher Schädling – vor allem in Jahren mit Massenvermehrung. Ihre Larven ernähren sich von Wurzeln, was bei starkem Befall zu Schäden an Kulturpflanzen führen kann.
Doch großflächige Ausbrüche sind heute selten geworden.
Warum? Weil der Bestand der Maikäfer in vielen Regionen drastisch zurückgegangen ist – bedingt durch:
Stark strukturierte Agrarflächen und monotone Landschaften lassen dem Feldmaikäfer wenig Raum zur Entwicklung. Hinzu kommen klimatische Veränderungen, die den empfindlichen mehrjährigen Entwicklungszyklus stören können.
Wie wir den Feldmaikäfer schützen können
Auch wenn der Maikäfer regional als Kulturfolger auftreten kann, ist er ein wichtiger Teil der heimischen Artenvielfalt. Um ihn langfristig zu erhalten, sind folgende Maßnahmen sinnvoll:
Lebensräume fördern
Nachhaltige Landwirtschaft unterstützen
Akzeptanz fördern
Fazit: Ein traditionsreicher Käfer mit Zukunft
Der Feldmaikäfer ist nicht nur ein Symbol für den Frühling, sondern auch ein Bindeglied im Kreislauf der Natur. Seine Rückkehr in strukturreiche Landschaften ist ein Indikator für ein funktionierendes Ökosystem. Wenn wir ihm wieder mehr Raum geben, profitieren nicht nur Käfer und Vögel – sondern die biologische Vielfalt insgesamt.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
Sowohl die ausgewachsenen Käfer als auch ihre Larven – die sogenannten Engerlinge – erfüllen eine wichtige Funktion im Naturhaushalt:
- Nahrungsquelle: Feldmaikäfer sind ein wertvolles Beutetier für zahlreiche Vögel, Igel, Fledermäuse und Kleinsäuger. Auch Wildschweine graben gezielt nach den energiereichen Engerlingen.
- Bodenstruktur: Die Larven leben mehrere Jahre im Boden und tragen durch ihre Bewegung zur Durchlüftung und Durchmischung der Erdschichten bei – ähnlich wie Regenwürmer.
- Teil des Nährstoffkreislaufs: Abgestorbene Käfer und Engerlinge werden von Mikroorganismen zersetzt und führen dem Boden wieder wichtige Nährstoffe zu.
Feldmaikäfer im Spannungsfeld: Zwischen natürlichem Vorkommen und Schädlingsimage
In der Vergangenheit galten Feldmaikäfer regional als landwirtschaftlicher Schädling – vor allem in Jahren mit Massenvermehrung. Ihre Larven ernähren sich von Wurzeln, was bei starkem Befall zu Schäden an Kulturpflanzen führen kann.
Doch großflächige Ausbrüche sind heute selten geworden.
Warum? Weil der Bestand der Maikäfer in vielen Regionen drastisch zurückgegangen ist – bedingt durch:
- Intensive Bodenbearbeitung in der Landwirtschaft
- Einsatz chemischer Pflanzenschutzmittel
- Verlust von Wiesen, Feldrändern und Hecken – wichtige Lebensräume für adulte Käfer
Stark strukturierte Agrarflächen und monotone Landschaften lassen dem Feldmaikäfer wenig Raum zur Entwicklung. Hinzu kommen klimatische Veränderungen, die den empfindlichen mehrjährigen Entwicklungszyklus stören können.
Wie wir den Feldmaikäfer schützen können
Auch wenn der Maikäfer regional als Kulturfolger auftreten kann, ist er ein wichtiger Teil der heimischen Artenvielfalt. Um ihn langfristig zu erhalten, sind folgende Maßnahmen sinnvoll:
Lebensräume fördern
- Erhalt und Neuanlage von Blühwiesen, extensiv bewirtschafteten Flächen und Hecken
- Schutz von ungestörten Bodenzonen, in denen die Larven sich entwickeln können
Nachhaltige Landwirtschaft unterstützen
- Reduzierter oder gezielter Einsatz von Pflanzenschutzmitteln
- Förderung ökologischer Bewirtschaftungsformen mit Rücksicht auf Bodentiere
Akzeptanz fördern
- Aufklärung über die ökologische Rolle des Käfers
- Enttabuisierung seines „Schädlings“-Images durch ausgewogene Kommunikation
Fazit: Ein traditionsreicher Käfer mit Zukunft
Der Feldmaikäfer ist nicht nur ein Symbol für den Frühling, sondern auch ein Bindeglied im Kreislauf der Natur. Seine Rückkehr in strukturreiche Landschaften ist ein Indikator für ein funktionierendes Ökosystem. Wenn wir ihm wieder mehr Raum geben, profitieren nicht nur Käfer und Vögel – sondern die biologische Vielfalt insgesamt.
- Mehr zum Feldmaikäfer hier auf unseren Seiten
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
- Feldmaikäfer
Artenschutz in Franken®
Die Amsel (Turdus merula): Ein heimischer Vogel mit großer Bedeutung ...

Die Amsel (Turdus merula): Ein heimischer Vogel mit großer Bedeutung für Natur und Garten
29/30.06.2025
Mit ihrem tiefschwarzen Gefieder (beim Männchen), dem leuchtend gelben Schnabel und ihrem klaren, melodischen Gesang bereichert sie unsere Gärten, Parks und Wälder – nicht nur akustisch, sondern auch ökologisch.
29/30.06.2025
- Die Amsel – auch als Schwarzdrossel bekannt – ist eine der bekanntesten und beliebtesten Vogelarten in Europa.
Mit ihrem tiefschwarzen Gefieder (beim Männchen), dem leuchtend gelben Schnabel und ihrem klaren, melodischen Gesang bereichert sie unsere Gärten, Parks und Wälder – nicht nur akustisch, sondern auch ökologisch.
Ein natürlicher Schädlingsbekämpfer: Die ökologische Rolle der Amsel
Was viele nicht wissen: Die Amsel spielt eine zentrale Rolle bei der natürlichen Regulierung von Insektenpopulationen. Während der Brutzeit im Frühjahr und Sommer benötigen Amseln große Mengen an tierischer Nahrung – vor allem für die Fütterung ihrer Jungen.
Auf dem Speiseplan stehen unter anderem:
- Insekten (z. B. Käfer, Raupen, Heuschrecken)
- Spinnen
- Schnecken
- Regenwürmer
Eine Amselfamilie kann während der Aufzuchtphase täglich mehrere hundert Insekten und Würmer vertilgen. Damit trägt sie maßgeblich zur Kontrolle von Schadinsekten bei – ein natürlicher Beitrag zum ökologischen Gleichgewicht, von dem nicht nur Gartenbesitzer, sondern auch die Landwirtschaft profitiert.
Gefährdung der Amsel: Ein Rückgang trotz Bekanntheit
Trotz ihrer weiten Verbreitung ist die Amsel nicht vor Gefahren geschützt. In den letzten Jahren zeigen sich in manchen Regionen Rückgänge in der Population – ein Warnsignal, das ernst genommen werden muss.
Die Ursachen dafür sind vielfältig:
Lebensraumverlust
Die zunehmende Versiegelung von Flächen, der Rückgang naturnaher Gärten und der Verlust von Hecken und Gehölzen nehmen der Amsel wertvolle Brut- und Nahrungsräume.
Pestizideinsatz
Der flächendeckende Einsatz von Insektiziden in der Landwirtschaft reduziert das Nahrungsangebot drastisch. Weniger Insekten bedeuten weniger Futter – vor allem für Jungvögel in der Aufzuchtzeit.
Klimawandel und Wetterextreme
Veränderte Witterungsverhältnisse, wie plötzliche Spätfröste oder anhaltende Trockenperioden, wirken sich negativ auf die Verfügbarkeit von Nahrung aus – insbesondere in der Brutzeit.
Krankheiten wie das Usutu-Virus
In einigen Regionen kam es in den letzten Jahren zu lokalen Massensterben von Amseln – ausgelöst durch das Usutu-Virus, das von Mücken übertragen wird. Besonders warme Sommer fördern die Ausbreitung dieses tropischen Erregers.
Was wir zum Schutz der Amsel tun können
Jeder kann einen Beitrag zum Schutz der Amsel und vieler anderer heimischer Vogelarten leisten – sei es im eigenen Garten, auf dem Balkon oder durch bewusstes Konsumverhalten.
Naturnahe Gärten gestalten
- Verzichten Sie auf chemische Pflanzenschutzmittel.
- Lassen Sie Laubhaufen, Sträucher und Bodenbewuchs stehen – das bietet Lebensraum für Insekten und Nahrung für die Amsel.
- Pflanzen Sie heimische Gehölze wie Holunder, Hagebutte oder Vogelbeere, die zusätzlich Nahrung im Herbst liefern.
Ganzjährig Wasser anbieten
Gerade in heißen Sommern sind Vogeltränken und kleine Gartenteiche überlebenswichtig. Sauberes, flaches Wasser hilft nicht nur beim Trinken, sondern auch beim Reinigen des Gefieders.
Nistmöglichkeiten erhalten
Amseln bauen ihre Nester gerne in dichtem Gebüsch oder Efeu. Verzichten Sie im Frühling auf das radikale Zurückschneiden von Sträuchern oder Fassadenbegrünung.
Aufklären und unterstützen
Teilen Sie Ihr Wissen, sensibilisieren Sie Ihr Umfeld und unterstützen Sie lokale Naturschutzprojekte oder Vogelschutzvereine – etwa durch Spenden oder aktive Mitgliedschaft.
Fazit: Ein vertrauter Vogel mit besonderer Bedeutung
Die Amsel ist weit mehr als nur ein gefiederter Gartengast mit schöner Stimme. Sie ist ein unermüdlicher Helfer bei der natürlichen Schädlingsbekämpfung und ein unverzichtbarer Bestandteil unseres heimischen Ökosystems. Ihr Schutz ist nicht nur ein Akt der Verantwortung, sondern auch ein Beitrag zur Erhaltung der biologischen Vielfalt direkt vor unserer Haustür.
- Mehr zur Amsel hier auf unserer Internetpräsenz
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- Ein Amselweibchen hat einen Engerling erbeutet, für ihren Nachwuchs.
Artenschutz in Franken®
Wie viel Leben bleibt stehen? – Mulcher vs. Balkenmäher im Vergleich

Wie viel Leben bleibt stehen? – Mulcher vs. Balkenmäher im Vergleich
28/29.06.2025
Die Art, wie wir Wegeränder, Wiesen oder Brachflächen pflegen, hat enorme Auswirkungen auf die dort lebenden Tiere. Viele Insekten, Amphibien, Kleinsäuger und bodenbrütende Vögel sind auf diese Flächen angewiesen – doch durch falsche Mähtechnik sterben jedes Jahr Millionen von ihnen.
Besonders entscheidend ist dabei das eingesetzte Gerät. Der Unterschied zwischen einem rotierenden Mulchgerät und einem Balkenmäher ist größer, als viele denken – und kann über Leben und Tod entscheiden.
28/29.06.2025
- Warum es auf die Art des Mähens ankommt
Die Art, wie wir Wegeränder, Wiesen oder Brachflächen pflegen, hat enorme Auswirkungen auf die dort lebenden Tiere. Viele Insekten, Amphibien, Kleinsäuger und bodenbrütende Vögel sind auf diese Flächen angewiesen – doch durch falsche Mähtechnik sterben jedes Jahr Millionen von ihnen.
Besonders entscheidend ist dabei das eingesetzte Gerät. Der Unterschied zwischen einem rotierenden Mulchgerät und einem Balkenmäher ist größer, als viele denken – und kann über Leben und Tod entscheiden.
Mulcher – effizient, aber tödlich
Was passiert beim Mulchen?
Mulchgeräte zerkleinern die Vegetation mit rotierenden Schlegeln oder Messern. Sie reißen, schlagen oder häckseln das Gras und zerschneiden dabei alles, was sich darin befindet – auch Insekten, Spinnen, Larven, Eier, kleine Reptilien, Amphibien oder Mäusenester.
Folgen für die Tierwelt:
Balkenmäher – schonend und bewährt
Was passiert beim Mähen mit dem Balkenmäher?
Der Balkenmäher schneidet mit zwei gegenläufigen Klingen wie eine große Schere das Gras ab, ohne es zu zerschlagen oder zu wirbeln. Tiere in der Vegetation spüren die Bewegung oft frühzeitig und können fliehen.
Vorteile für Tiere und Pflanzen:
Direkter Vergleich:
Kriterium Mulcher Balkenmäher
Sterblichkeit bei Insekten ca. 80–100 % ca. 10–20 %
Auswirkung auf Kleintiere sehr hoch (oft tödlich) gering bis moderat
Grasnarbe / Lebensraum zerstört weitgehend erhalten
Lärm- und Energieverbrauch hoch niedriger
Ökologische Verträglichkeit schlecht deutlich besser
Unser Appell: Naturschonend mähen statt mulchen
Wenn Mahd wirklich notwendig ist, dann:
Jede Schonung zählt
In Zeiten des dramatischen Artenrückgangs ist jede Fläche ein Rückzugsort – und jede Entscheidung über das Mähgerät eine Entscheidung für oder gegen das Leben. Technischer Fortschritt darf nicht blind machen für ökologische Verantwortung.
Helfen Sie mit, das stille Sterben zu beenden. Lassen wir das Leben wachsen – nicht mulchen.
Zur Info
In der Aufnahme
Was passiert beim Mulchen?
Mulchgeräte zerkleinern die Vegetation mit rotierenden Schlegeln oder Messern. Sie reißen, schlagen oder häckseln das Gras und zerschneiden dabei alles, was sich darin befindet – auch Insekten, Spinnen, Larven, Eier, kleine Reptilien, Amphibien oder Mäusenester.
Folgen für die Tierwelt:
- Sehr hohe Sterblichkeit: Studien und Feldbeobachtungen zeigen, dass beim Mulchen zwischen 80 und nahezu 100 % der Insektenpopulationen in der betroffenen Fläche getötet werden.
- Auch Jungvögel, Amphibien und andere bodennahe Tiere werden oft nicht rechtzeitig erfasst und zerhäckselt.
- Die Fläche wirkt danach „aufgeräumt“, ist aber ökologisch tot – es dauert Wochen bis Monate, bis sich neues Leben ansiedelt.
Balkenmäher – schonend und bewährt
Was passiert beim Mähen mit dem Balkenmäher?
Der Balkenmäher schneidet mit zwei gegenläufigen Klingen wie eine große Schere das Gras ab, ohne es zu zerschlagen oder zu wirbeln. Tiere in der Vegetation spüren die Bewegung oft frühzeitig und können fliehen.
Vorteile für Tiere und Pflanzen:
- Deutlich geringere Sterblichkeitsrate: Nur etwa 10–20 % der Insekten sind bei sorgfältigem Einsatz betroffen.
- Die Grasnarbe bleibt weitgehend intakt – wichtig für bodenlebende Arten.
- Durch langsames Fahren und gestaffeltes Mähen kann die Belastung weiter reduziert werden.
Direkter Vergleich:
Kriterium Mulcher Balkenmäher
Sterblichkeit bei Insekten ca. 80–100 % ca. 10–20 %
Auswirkung auf Kleintiere sehr hoch (oft tödlich) gering bis moderat
Grasnarbe / Lebensraum zerstört weitgehend erhalten
Lärm- und Energieverbrauch hoch niedriger
Ökologische Verträglichkeit schlecht deutlich besser
Unser Appell: Naturschonend mähen statt mulchen
Wenn Mahd wirklich notwendig ist, dann:
- Verwenden Sie möglichst Balkenmäher oder Sensen statt Mulchgeräte.
- Mähen Sie außerhalb der Brut- und Fortpflanzungszeit (am besten ab September).
- Lassen Sie Blühstreifen und Rückzugsräume stehen.
- Führen Sie abschnittsweises Mähen durch – nie die gesamte Fläche auf einmal.
Jede Schonung zählt
In Zeiten des dramatischen Artenrückgangs ist jede Fläche ein Rückzugsort – und jede Entscheidung über das Mähgerät eine Entscheidung für oder gegen das Leben. Technischer Fortschritt darf nicht blind machen für ökologische Verantwortung.
Helfen Sie mit, das stille Sterben zu beenden. Lassen wir das Leben wachsen – nicht mulchen.
Zur Info
- Derzeit läuft ein umfangreiches Monitoring des Artenschutz in Franken® das diesen Vorgang intensiv untersucht. Die Ergebnisse werden wir zu gegebener Zeit hier auf unserer Internetpräsenz veröffentlichen!
In der Aufnahme
- Mit dem Einsatz des Mulchers wird nahezu alles Leben eliminiert - mit solchen Prozessen tragen die Verursacher konkret zur Zerstörung der Artenvielfalt bei und gefährden hierbei auch die Existenzgrundlage der uns nachfolgenden Generationen!
Artenschutz in Franken®
"Die Todmulcher" – Wenn Pflegemaßnahmen Leben vernichten

"Die Todmulcher" – Wenn Pflegemaßnahmen Leben vernichten
27/28.06.2025
Was aussieht wie Landschaftspflege, ist oft das Gegenteil. Mit schwerem Gerät werden Grünflächen und Wegeränder „aufgeräumt“, Gras wird gemulcht, vermeintlich „überwuchernde“ Natur entfernt. Was dabei häufig vergessen wird: Diese Eingriffe zerstören wertvolle Lebensräume – und töten unzählige Insekten, Kleintiere und Pflanzen in wenigen Minuten. Wir müssen reden. Über "die Todmulcher".
27/28.06.2025
- Ein stiller Verlust an unseren Wegesrändern
Was aussieht wie Landschaftspflege, ist oft das Gegenteil. Mit schwerem Gerät werden Grünflächen und Wegeränder „aufgeräumt“, Gras wird gemulcht, vermeintlich „überwuchernde“ Natur entfernt. Was dabei häufig vergessen wird: Diese Eingriffe zerstören wertvolle Lebensräume – und töten unzählige Insekten, Kleintiere und Pflanzen in wenigen Minuten. Wir müssen reden. Über "die Todmulcher".
Ein Biotop am Wegesrand – unscheinbar, aber überlebenswichtig
Wegeränder, Wiesenstreifen, Brachflächen: Sie wirken auf den ersten Blick unspektakulär. Doch sie sind oft die letzten Rückzugsorte für Wildbienen, Schmetterlinge, Käfer, Spinnen, Heuschrecken und viele andere Tiere. Auch bodenbrütende Vögel oder kleine Säugetiere wie Mäuse und Igel nutzen diese Flächen zur Nahrungssuche, zur Aufzucht ihres Nachwuchses oder zum Schutz vor Fressfeinden.Jedes Halmstück, jede Distel, jedes „Unkraut“ trägt dazu bei, ein fragiles Ökosystem aufrechtzuerhalten. Ein Lebensnetz, das aus unserer Perspektive leicht übersehen wird – aber für viele Arten überlebensnotwendig ist.
Mulchen – eine unsichtbare Katastrophe
Beim Mulchen werden nicht nur Pflanzen zerschnitten. Es wird alles zerkleinert, was sich darin befindet: Tiere, ihre Nester, ihre Eier. Ein einziger Durchgang vernichtet unzählige Leben – leise, mechanisch, routiniert. Es gibt keine Fluchtmöglichkeit. Kein Entkommen.
Noch dramatischer ist: Häufig erfolgt das Mulchen mitten in der Brut- und Fortpflanzungszeit. Der Schaden ist dann nicht nur kurzfristig – er wirkt in die nächste Generation hinein. Der Verlust ist irreversibel.
Warum das passiert? Ordnung über Leben.
Die Motivation ist meist nachvollziehbar: Verkehrssicherheit, Pflegepflichten, Ästhetik. Doch oft wird weit über das Notwendige hinaus gemulcht – aus Gewohnheit, aus Unwissenheit oder weil es „so gemacht wird“. Dabei gäbe es sanftere Alternativen: gestaffeltes Mähen, Schonzeiten, blühstreifenfreundliche Pflege, selektiver Schnitt – Lösungen, die Natur und Menschen gleichermaßen dienen.
Was wir fordern
Was Sie tun können
Fazit
Wir dürfen nicht länger zulassen, dass unter dem Deckmantel der Pflege ganze Lebensgemeinschaften ausgelöscht werden. Die Biodiversitätskrise beginnt nicht irgendwo – sie beginnt genau hier, am Rand des Weges, den wir täglich gehen. Dort, wo bald nichts mehr flattert, nichts mehr zirpt. Weil die Todmulcher da waren.
In der Aufnahme
Wegeränder, Wiesenstreifen, Brachflächen: Sie wirken auf den ersten Blick unspektakulär. Doch sie sind oft die letzten Rückzugsorte für Wildbienen, Schmetterlinge, Käfer, Spinnen, Heuschrecken und viele andere Tiere. Auch bodenbrütende Vögel oder kleine Säugetiere wie Mäuse und Igel nutzen diese Flächen zur Nahrungssuche, zur Aufzucht ihres Nachwuchses oder zum Schutz vor Fressfeinden.Jedes Halmstück, jede Distel, jedes „Unkraut“ trägt dazu bei, ein fragiles Ökosystem aufrechtzuerhalten. Ein Lebensnetz, das aus unserer Perspektive leicht übersehen wird – aber für viele Arten überlebensnotwendig ist.
Mulchen – eine unsichtbare Katastrophe
Beim Mulchen werden nicht nur Pflanzen zerschnitten. Es wird alles zerkleinert, was sich darin befindet: Tiere, ihre Nester, ihre Eier. Ein einziger Durchgang vernichtet unzählige Leben – leise, mechanisch, routiniert. Es gibt keine Fluchtmöglichkeit. Kein Entkommen.
Noch dramatischer ist: Häufig erfolgt das Mulchen mitten in der Brut- und Fortpflanzungszeit. Der Schaden ist dann nicht nur kurzfristig – er wirkt in die nächste Generation hinein. Der Verlust ist irreversibel.
Warum das passiert? Ordnung über Leben.
Die Motivation ist meist nachvollziehbar: Verkehrssicherheit, Pflegepflichten, Ästhetik. Doch oft wird weit über das Notwendige hinaus gemulcht – aus Gewohnheit, aus Unwissenheit oder weil es „so gemacht wird“. Dabei gäbe es sanftere Alternativen: gestaffeltes Mähen, Schonzeiten, blühstreifenfreundliche Pflege, selektiver Schnitt – Lösungen, die Natur und Menschen gleichermaßen dienen.
Was wir fordern
- Ein Umdenken bei kommunaler und landwirtschaftlicher Pflege.
- Schonzeiten beim Mulchen: keine Schnitte während der Hauptbrutzeit (März–August).
- Erhalt von Blühstreifen und Wildwuchs als Lebensraum.
- Aufklärung der Öffentlichkeit über die Auswirkungen von Mulchmaßnahmen.
- Einbeziehung von Naturschutzverbänden in Pflegekonzepte.
Was Sie tun können
- Sprechen Sie Ihre Kommune oder den Bauhof an, wenn regelmäßig gemulcht wird.
- Unterstützen Sie Initiativen für naturnahe Pflege.
- Lassen Sie selbst wilde Ecken im Garten oder auf dem Grundstück stehen – auch sie sind wertvoll.
- Nicht zu vergessen sind die unsäglichen Eingriffe dieser Art innerhalb der vornehmlich industriell geführten Landwirtschaft
Fazit
Wir dürfen nicht länger zulassen, dass unter dem Deckmantel der Pflege ganze Lebensgemeinschaften ausgelöscht werden. Die Biodiversitätskrise beginnt nicht irgendwo – sie beginnt genau hier, am Rand des Weges, den wir täglich gehen. Dort, wo bald nichts mehr flattert, nichts mehr zirpt. Weil die Todmulcher da waren.
In der Aufnahme
- Mit dem Einsatz des Mulchers wird nahezu alles Leben eliminiert - mit solchen Prozessen tragen die Verursacher konkret zur Zerstörung der Artenvielfalt bei und gefährden hierbei auch die Existenzgrundlage der uns nachfolgenden Generationen!
Artenschutz in Franken®
Gefährdung des Feuersalamanders auf Forstwegen – stilles Sterben im Wald

Gefährdung des Feuersalamanders auf Forstwegen – stilles Sterben im Wald
25/26.06.2025
Besonders in unseren Wäldern wird er zunehmend Opfer menschlicher Eingriffe, die auf den ersten Blick harmlos erscheinen: Forstwege.
25/26.06.2025
- Der Feuersalamander (Salamandra salamandra) ist eine der bekanntesten Amphibienarten Europas – und dennoch massiv gefährdet.
Besonders in unseren Wäldern wird er zunehmend Opfer menschlicher Eingriffe, die auf den ersten Blick harmlos erscheinen: Forstwege.
Wieso sind Forstwege ein Problem für den Feuersalamander?
Feuersalamander sind auf feuchte, schattige Laub- und Mischwälder angewiesen, in deren Nähe sich klare, kühle Quellbäche befinden. Genau dort verlaufen häufig Waldwege, die für forstwirtschaftliche Maschinen, Wandernde oder Radfahrende erschlossen wurden. Das Problem: Forstwege durchschneiden Lebensräume, zerstören Fortpflanzungsgewässer und wirken wie tödliche Fallen.
Die wichtigsten Gefahren im Überblick:
Zusätzliche Bedrohung: Das Salamanderfresser-Syndrom
Als wäre das nicht genug, breitet sich seit einigen Jahren der Hautpilz Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal) in Mitteleuropa aus. Dieser hochinfektiöse Erreger verursacht bei Feuersalamandern tödliche Hautläsionen und hat bereits in mehreren Regionen ganze Populationen ausgelöscht. Gerade durch den Verkehr auf Forstwegen (nicht zu vergessen ist dabie auch der Verkehr direkt im wald durch Forstgroßmaschinen die von A nach B transportiert auch den Pilz tragen können), kann der Erreger ungewollt verschleppt werden – etwa über Reifenprofile, Schuhsohlen oder Hundepfoten.
Was können wir tun?
Die gute Nachricht: Mit verhältnismäßig einfachen Maßnahmen lässt sich viel erreichen:
Fazit: Ein stiller Rückzug, der nicht sein muss
Der Feuersalamander ist mehr als nur ein Symbol für unsere heimischen Wälder – er ist ein Gradmesser für deren Gesundheit. Der zunehmende Druck durch Forstwege darf nicht länger unterschätzt werden. Nur durch achtsames Planen, umsichtiges Handeln und konsequenten Schutz können wir verhindern, dass dieser faszinierende Waldbewohner aus vielen Regionen verschwindet.
In der Aufahme
Feuersalamander sind auf feuchte, schattige Laub- und Mischwälder angewiesen, in deren Nähe sich klare, kühle Quellbäche befinden. Genau dort verlaufen häufig Waldwege, die für forstwirtschaftliche Maschinen, Wandernde oder Radfahrende erschlossen wurden. Das Problem: Forstwege durchschneiden Lebensräume, zerstören Fortpflanzungsgewässer und wirken wie tödliche Fallen.
Die wichtigsten Gefahren im Überblick:
- Überrollung durch Fahrzeuge: Besonders in der Dämmerung und bei Regen sind Feuersalamander aktiv. Dann werden sie auf den nassen Wegen leicht übersehen – und von Forstmaschinen oder Autos tödlich verletzt.
- Zerschneidung von Lebensräumen: Viele Forstwege verlaufen quer durch Landlebensräume und trennen diese von Bachsystemen, in denen die Larven aufwachsen. Das führt zu genetischer Isolation und Populationseinbrüchen.
- Austrocknung und Lebensraumverlust: Aufgeschotterte Wege verändern den Wasserhaushalt im Waldboden und können Laichgewässer beeinträchtigen oder zum Versiegen von Quellläufen führen.
- Eintrag von Schadstoffen: Abrieb von Fahrzeugen, Streusalz oder Schmierstoffe können in angrenzende Gewässer gelangen und die empfindlichen Amphibienlarven schädigen.
Zusätzliche Bedrohung: Das Salamanderfresser-Syndrom
Als wäre das nicht genug, breitet sich seit einigen Jahren der Hautpilz Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal) in Mitteleuropa aus. Dieser hochinfektiöse Erreger verursacht bei Feuersalamandern tödliche Hautläsionen und hat bereits in mehreren Regionen ganze Populationen ausgelöscht. Gerade durch den Verkehr auf Forstwegen (nicht zu vergessen ist dabie auch der Verkehr direkt im wald durch Forstgroßmaschinen die von A nach B transportiert auch den Pilz tragen können), kann der Erreger ungewollt verschleppt werden – etwa über Reifenprofile, Schuhsohlen oder Hundepfoten.
Was können wir tun?
Die gute Nachricht: Mit verhältnismäßig einfachen Maßnahmen lässt sich viel erreichen:
- Temporäre Sperrung sensibler Wege während der Aktivitätszeiten (vor allem an feuchten Tagen im Frühjahr und Herbst)
- Geschwindigkeitsbegrenzungen für forstliche Nutzfahrzeuge
- Aufklärung von Waldbesuchern, insbesondere über Hygiene zur Vermeidung der Pilzverschleppung
- Monitoringprogramme und gezielte Schutzprojekte in gefährdeten Gebieten
- Förderung naturnaher Waldwirtschaft, bei der Lebensräume erhalten bleiben
Fazit: Ein stiller Rückzug, der nicht sein muss
Der Feuersalamander ist mehr als nur ein Symbol für unsere heimischen Wälder – er ist ein Gradmesser für deren Gesundheit. Der zunehmende Druck durch Forstwege darf nicht länger unterschätzt werden. Nur durch achtsames Planen, umsichtiges Handeln und konsequenten Schutz können wir verhindern, dass dieser faszinierende Waldbewohner aus vielen Regionen verschwindet.
- Helfen Sie mit! Unterstützen Sie Projekte zum Amphibienschutz oder informieren Sie sich bei Ihrer lokalen Naturschutzbehörde, wie Sie zum Erhalt des Feuersalamanders beitragen können.
- Mehr zum Feuersalamander hier auf unseren Seiten
- Mehr zu unseren Amphibien Schutzprojekten
In der Aufahme
- Akkut gefährdet - der Feuersalamander auf den Forstwegen!
Artenschutz in Franken®
Fledermaus-Spaltenquartiere im urbanen Raum

Fledermaus-Spaltenquartiere im urbanen Raum
24/25.06.2025
Mitten in unseren Städten spielt sich oft unbemerkt ein dramatischer Rückgang der Artenvielfalt ab. Besonders betroffen: unsere heimischen Fledermäuse. Als stille Helfer in der Nacht regulieren sie Insektenbestände und sind ein wichtiger Bestandteil unseres Ökosystems – doch ihre natürlichen Lebensräume werden durch Bau- und Sanierungsmaßnahmen immer knapper.
24/25.06.2025
- Ein aktiver Beitrag zum Artenschutz mitten in der Stadt
Mitten in unseren Städten spielt sich oft unbemerkt ein dramatischer Rückgang der Artenvielfalt ab. Besonders betroffen: unsere heimischen Fledermäuse. Als stille Helfer in der Nacht regulieren sie Insektenbestände und sind ein wichtiger Bestandteil unseres Ökosystems – doch ihre natürlichen Lebensräume werden durch Bau- und Sanierungsmaßnahmen immer knapper.
Warum Fledermaus-Spaltenquartiere?
Moderne Gebäude bieten kaum noch geeignete Spalten oder Hohlräume, die Fledermäuse zum Ruhen oder zur Jungenaufzucht benötigen. Genau hier setzen Fledermaus-Spaltenquartiere an: Diese speziell entwickelten Unterschlupfe schaffen Ersatzlebensräume – direkt an Hauswänden, Dachvorsprüngen oder an Brücken montiert. Sie sind wetterfest, langlebig und orientieren sich in ihrer Struktur an den natürlichen Bedürfnissen der Tiere.
Artenschutz mit Wirkung
Die Montage von Spaltenquartieren ist eine einfache, aber wirkungsvolle Maßnahme im urbanen Artenschutz. Jede einzelne Unterkunft kann eine lebenswichtige Rolle spielen – denn ohne passende Quartiere finden viele Fledermäuse keinen sicheren Unterschlupf mehr. Fledermäuse stehen unter strengem Schutz – sowohl national als auch europaweit. Wer ihnen durch künstliche Quartiere hilft, fördert nicht nur ihre Bestände, sondern trägt auch zur Erhaltung eines gesunden, artenreichen Stadtökosystems bei.
Verantwortung zeigen – Natur bewahren
Ob als Stadtverwaltung, Unternehmen oder Privatperson: Wer Fledermausquartiere installiert, sendet ein klares Zeichen für Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein. Solche Maßnahmen…
Unser Projekt zeigt: Artenschutz lässt sich erfolgreich in das Stadtbild integrieren – mit Respekt, Kreativität und Verantwortung.
Gemeinsam für mehr Artenvielfalt
Wir setzen uns aktiv für den Schutz heimischer Fledermäuse ein – durch die gezielte Montage hochwertiger Spaltenquartiere in städtischen Räumen. Möchten auch Sie ein Zeichen setzen?
In der Aufnahme von K.Krebs
Moderne Gebäude bieten kaum noch geeignete Spalten oder Hohlräume, die Fledermäuse zum Ruhen oder zur Jungenaufzucht benötigen. Genau hier setzen Fledermaus-Spaltenquartiere an: Diese speziell entwickelten Unterschlupfe schaffen Ersatzlebensräume – direkt an Hauswänden, Dachvorsprüngen oder an Brücken montiert. Sie sind wetterfest, langlebig und orientieren sich in ihrer Struktur an den natürlichen Bedürfnissen der Tiere.
Artenschutz mit Wirkung
- Kleine Maßnahme – große Bedeutung
Die Montage von Spaltenquartieren ist eine einfache, aber wirkungsvolle Maßnahme im urbanen Artenschutz. Jede einzelne Unterkunft kann eine lebenswichtige Rolle spielen – denn ohne passende Quartiere finden viele Fledermäuse keinen sicheren Unterschlupf mehr. Fledermäuse stehen unter strengem Schutz – sowohl national als auch europaweit. Wer ihnen durch künstliche Quartiere hilft, fördert nicht nur ihre Bestände, sondern trägt auch zur Erhaltung eines gesunden, artenreichen Stadtökosystems bei.
Verantwortung zeigen – Natur bewahren
Ob als Stadtverwaltung, Unternehmen oder Privatperson: Wer Fledermausquartiere installiert, sendet ein klares Zeichen für Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein. Solche Maßnahmen…
- verbessern das Mikroklima im urbanen Raum,
- steigern das ökologische Profil von Gebäuden,
- und fördern das Umweltbewusstsein der Bevölkerung.
Unser Projekt zeigt: Artenschutz lässt sich erfolgreich in das Stadtbild integrieren – mit Respekt, Kreativität und Verantwortung.
Gemeinsam für mehr Artenvielfalt
Wir setzen uns aktiv für den Schutz heimischer Fledermäuse ein – durch die gezielte Montage hochwertiger Spaltenquartiere in städtischen Räumen. Möchten auch Sie ein Zeichen setzen?
- Kontaktieren Sie uns für eine Beratung oder Unterstützung bei Ihrem eigenen Fledermaus-Projekt!
In der Aufnahme von K.Krebs
- Montiertes Fledermaus Spaltenquartier im Dachfirst eines offenen Baukörpers
Artenschutz in Franken®
Der Hausrotschwanz – Ein Glutfunke der Stadt- und Berglandschaften

Der Hausrotschwanz – Ein Glutfunke der Stadt- und Berglandschaften
23/24.06.2025
Der Hausrotschwanz ist mehr als nur ein hübscher Singvogel – er ist ein Symbol für Anpassungsfähigkeit und stille Eleganz. Mit seinem rußgrauen Gefieder und dem markanten rostroten Schwanz ist er in vielen Regionen Europas ein vertrauter Anblick.
Einst vorwiegend in felsigen Bergregionen heimisch, hat er sich im Laufe der Zeit erfolgreich an menschliche Siedlungen angepasst.
23/24.06.2025
- Ein kleiner Vogel mit großer Ausstrahlung
Der Hausrotschwanz ist mehr als nur ein hübscher Singvogel – er ist ein Symbol für Anpassungsfähigkeit und stille Eleganz. Mit seinem rußgrauen Gefieder und dem markanten rostroten Schwanz ist er in vielen Regionen Europas ein vertrauter Anblick.
Einst vorwiegend in felsigen Bergregionen heimisch, hat er sich im Laufe der Zeit erfolgreich an menschliche Siedlungen angepasst.
Steckbrief – Der Hausrotschwanz im Überblick
Ein kleiner Vogel mit großer Ausstrahlung
Der Hausrotschwanz ist mehr als nur ein hübscher Singvogel – er ist ein Symbol für Anpassungsfähigkeit und stille Eleganz. Mit seinem rußgrauen Gefieder und dem markanten rostroten Schwanz ist er in vielen Regionen Europas ein vertrauter Anblick. Einst vorwiegend in felsigen Bergregionen heimisch, hat er sich im Laufe der Zeit erfolgreich an menschliche Siedlungen angepasst.
Heute begegnet man ihm in Städten, Dörfern, auf Friedhöfen, in Industriegebieten oder alten Gemäuern – überall dort, wo Nischen, Mauervorsprünge und freistehende Strukturen ihm Unterschlupf bieten.
Lebensraum und Verbreitung
Der Hausrotschwanz ist fast in ganz Europa verbreitet, seine Verbreitung reicht von Nordafrika bis Zentralasien. Besonders auffällig ist seine Vorliebe für strukturreiche Lebensräume – Felsen, Ruinen, Hauswände, Baustellen, aber auch hoch gelegene Bergregionen sind seine Domäne.
In Mitteleuropa ist er ein regelmäßiger Brutvogel, der sich besonders im urbanen Raum behauptet hat. Dank seiner Flexibilität beim Nestbau findet er selbst in unwirtlichen Umgebungen geeignete Brutplätze.
Aussehen – Schlicht, aber eindrucksvoll
Der Hausrotschwanz wirkt auf den ersten Blick unauffällig, doch sein Erscheinungsbild ist durchaus markant:
Gesang und Stimme – Urbaner Sänger mit Charakter
Der Gesang des Hausrotschwanzes beginnt oft mit kratzenden, schmirgelnden Tönen, die sich in feine, klare Strophen auflösen. Besonders im Frühling ist sein Gesang schon in den frühen Morgenstunden zu hören – oft vom höchsten Dachfirst, Kamin oder einer Antenne.
Typisch: Der Gesang wirkt manchmal wie eine Mischung aus scharfem „tikk-tikk“ und zwitschernden Trillern – mit einem charakteristischen metallischen Nachhall.
Ernährung – Insektenjäger mit saisonaler Flexibilität
Als Insektenfresser ernährt sich der Hausrotschwanz hauptsächlich von:
Er jagt gerne vom Ansitz aus: Vom Zaunpfahl oder Mauervorsprung aus fliegt er seine Beute gezielt an.
Fortpflanzung – Brutverhalten und Aufzucht
Die Brutzeit beginnt meist im April. Der Hausrotschwanz ist dabei äußerst anpassungsfähig:
In warmen Jahren kann es zu zwei Bruten kommen.
Zugverhalten – Teilzieher mit südlichem Winterquartier
In Mitteleuropa ist der Hausrotschwanz ein sogenannter Teilzieher. Während einige Individuen in ihren Brutgebieten überwintern, zieht der Großteil im Herbst Richtung Mittelmeerraum oder Nordafrika.
Mit dem Frühling kehrt er zurück – oft an denselben Ort.
Gefährdung und Schutz
Der Hausrotschwanz gilt derzeit als nicht gefährdet, allerdings können lokale Populationen durch den Verlust geeigneter Brutplätze (z. B. durch Sanierungen alter Gebäude oder moderne Architektur) zurückgehen.
Was kann man tun?
Fazit – Ein stiller Held der urbanen Tierwelt
Der Hausrotschwanz ist ein Paradebeispiel für die Anpassungsfähigkeit heimischer Wildtiere. Trotz des wachsenden Einflusses des Menschen in seiner Umwelt findet er Wege, sich neuen Herausforderungen zu stellen – und dabei ein Stück Natur in unsere Städte zu bringen.
Sein feiner Gesang, der rote Schwanz und seine scheue Eleganz machen ihn zu einem faszinierenden Bewohner unseres Alltags, den es zu schätzen und zu schützen gilt.
In der Aufnahme / Info vom 09.06.2025 von Bernhard Schmalisch
- Wissenschaftlicher Name: Phoenicurus ochruros
- Ordnung: Sperlingsvögel (Passeriformes)
- Familie: Fliegenschnäpper (Muscicapidae)
- Größe: ca. 13–15 cm
- Spannweite: ca. 23–26 cm
- Gewicht: 14–20 g
- Besonderes Merkmal: Zitternder, rostroter Schwanz
- Status: Nicht gefährdet (LC – Least Concern)
Ein kleiner Vogel mit großer Ausstrahlung
Der Hausrotschwanz ist mehr als nur ein hübscher Singvogel – er ist ein Symbol für Anpassungsfähigkeit und stille Eleganz. Mit seinem rußgrauen Gefieder und dem markanten rostroten Schwanz ist er in vielen Regionen Europas ein vertrauter Anblick. Einst vorwiegend in felsigen Bergregionen heimisch, hat er sich im Laufe der Zeit erfolgreich an menschliche Siedlungen angepasst.
Heute begegnet man ihm in Städten, Dörfern, auf Friedhöfen, in Industriegebieten oder alten Gemäuern – überall dort, wo Nischen, Mauervorsprünge und freistehende Strukturen ihm Unterschlupf bieten.
Lebensraum und Verbreitung
Der Hausrotschwanz ist fast in ganz Europa verbreitet, seine Verbreitung reicht von Nordafrika bis Zentralasien. Besonders auffällig ist seine Vorliebe für strukturreiche Lebensräume – Felsen, Ruinen, Hauswände, Baustellen, aber auch hoch gelegene Bergregionen sind seine Domäne.
In Mitteleuropa ist er ein regelmäßiger Brutvogel, der sich besonders im urbanen Raum behauptet hat. Dank seiner Flexibilität beim Nestbau findet er selbst in unwirtlichen Umgebungen geeignete Brutplätze.
Aussehen – Schlicht, aber eindrucksvoll
Der Hausrotschwanz wirkt auf den ersten Blick unauffällig, doch sein Erscheinungsbild ist durchaus markant:
- Männchen: Rußgraues bis schwarzes Gefieder mit heller Flügelbinde, rostrot leuchtender Schwanz
- Weibchen: Schlichteres, bräunliches Federkleid, ebenfalls mit rostrotem Schwanz
- Bewegung: Typisch ist das ständige Zucken und Zittern des Schwanzes – ein Verhalten, das oft vor dem Abflug zu beobachten ist.
Gesang und Stimme – Urbaner Sänger mit Charakter
Der Gesang des Hausrotschwanzes beginnt oft mit kratzenden, schmirgelnden Tönen, die sich in feine, klare Strophen auflösen. Besonders im Frühling ist sein Gesang schon in den frühen Morgenstunden zu hören – oft vom höchsten Dachfirst, Kamin oder einer Antenne.
Typisch: Der Gesang wirkt manchmal wie eine Mischung aus scharfem „tikk-tikk“ und zwitschernden Trillern – mit einem charakteristischen metallischen Nachhall.
Ernährung – Insektenjäger mit saisonaler Flexibilität
Als Insektenfresser ernährt sich der Hausrotschwanz hauptsächlich von:
- Fliegen, Mücken und Käfern
- Spinnen, Raupen, Ameisen
- Im Herbst auch Beeren und kleinere Früchte
Er jagt gerne vom Ansitz aus: Vom Zaunpfahl oder Mauervorsprung aus fliegt er seine Beute gezielt an.
Fortpflanzung – Brutverhalten und Aufzucht
Die Brutzeit beginnt meist im April. Der Hausrotschwanz ist dabei äußerst anpassungsfähig:
- Neststandorte: Mauernischen, Dachrinnen, Holzstapel, Blumenkästen oder verlassene Schwalbennester
- Nestbau: Das Nest wird vom Weibchen aus Halmen, Moos, Tierhaaren und Wurzeln gebaut
- Gelege: 4–6 Eier, Brutdauer ca. 12–14 Tage
- Nestlingszeit: Weitere 14–16 Tage bis zum Ausfliegen der Jungen
In warmen Jahren kann es zu zwei Bruten kommen.
Zugverhalten – Teilzieher mit südlichem Winterquartier
In Mitteleuropa ist der Hausrotschwanz ein sogenannter Teilzieher. Während einige Individuen in ihren Brutgebieten überwintern, zieht der Großteil im Herbst Richtung Mittelmeerraum oder Nordafrika.
Mit dem Frühling kehrt er zurück – oft an denselben Ort.
Gefährdung und Schutz
Der Hausrotschwanz gilt derzeit als nicht gefährdet, allerdings können lokale Populationen durch den Verlust geeigneter Brutplätze (z. B. durch Sanierungen alter Gebäude oder moderne Architektur) zurückgehen.
Was kann man tun?
- Nistkästen anbieten
- Unversiegelte Flächen und strukturreiche Gärten schaffen
- Auf den Einsatz von Pestiziden verzichten
Fazit – Ein stiller Held der urbanen Tierwelt
Der Hausrotschwanz ist ein Paradebeispiel für die Anpassungsfähigkeit heimischer Wildtiere. Trotz des wachsenden Einflusses des Menschen in seiner Umwelt findet er Wege, sich neuen Herausforderungen zu stellen – und dabei ein Stück Natur in unsere Städte zu bringen.
Sein feiner Gesang, der rote Schwanz und seine scheue Eleganz machen ihn zu einem faszinierenden Bewohner unseres Alltags, den es zu schätzen und zu schützen gilt.
In der Aufnahme / Info vom 09.06.2025 von Bernhard Schmalisch
- Hausrotschwanz Männchen - Der Bestand dieser Vögel mit dem Insektenfresserschnabel scheint immer noch ab zu nehmen. Der abnehmende Bestand korrespondiert halt auch mit der Menge der Insekten, deren Bestand auch immer weniger wird. Zumindest sehe ich diese Vögel inzwischen höchst selten hier in meiner Umfeld.
Artenschutz in Franken®
Zerstörung geschützter Lebensräume der Zauneidechse (Lacerta agilis) ...

Zerstörung geschützter Lebensräume der Zauneidechse (Lacerta agilis) durch unzulässige Landschaftspflege im Steigerwald
23/24.06.2024
Über eine Strecke von mehr als 100 Metern wurden zusammenhängende Heckenstrukturen und Saumbiotope flächig niedergemulcht – Maßnahmen, die in dieser Form nach § 39 Absatz 5 Satz 2 Nr. 2 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) in der Zeit vom 1. März bis 30. September unzulässig sind. Ziel dieser Regelung ist der Schutz brütender Vögel sowie anderer wildlebender Tiere, die diese Strukturen als Fortpflanzungs- und Rückzugsräume nutzen.
23/24.06.2024
- Im Gebiet des bayerischen Steigerwalds wurde auf einer öffentlich zugänglichen Fläche durch einen Landwirt innerhalb der gesetzlich festgelegten Schutzfrist massiv in die dortige Vegetation eingegriffen.
Über eine Strecke von mehr als 100 Metern wurden zusammenhängende Heckenstrukturen und Saumbiotope flächig niedergemulcht – Maßnahmen, die in dieser Form nach § 39 Absatz 5 Satz 2 Nr. 2 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) in der Zeit vom 1. März bis 30. September unzulässig sind. Ziel dieser Regelung ist der Schutz brütender Vögel sowie anderer wildlebender Tiere, die diese Strukturen als Fortpflanzungs- und Rückzugsräume nutzen.
Besonders gravierend ist in diesem Fall die Zerstörung eines nachgewiesen geeigneten Lebensraums der streng geschützten Zauneidechse (Lacerta agilis), deren Vorkommen vor Ort bereits fachlich dokumentiert war. Die Zauneidechse ist gemäß Anhang IV der FFH-Richtlinie (Fauna-Flora-Habitat) sowie nach Bundesnaturschutzgesetz eine besonders streng geschützte Art. Durch das Mulchen wurde nicht nur der Lebensraum der Tiere dauerhaft geschädigt – es kam Berichten zufolge auch zum Tod mehrerer Individuen, was einen Verstoß gegen das Tötungsverbot gemäß § 44 BNatSchG darstellt.
Diese Art der Landschaftspflege steht im klaren Widerspruch zu geltendem Naturschutzrecht und zeugt von einem mangelnden Verständnis für die Bedeutung strukturreicher Biotope im Offenland. Hecken, Altgrasstreifen und Krautsäume stellen essenzielle Habitatstrukturen für zahlreiche gefährdete Arten dar, insbesondere in intensiv genutzten Agrarlandschaften wie dem Steigerwaldgebiet.
Es liegt nun in der Verantwortung dieser Stellen, den Vorfall konsequent aufzuklären, mögliche Ordnungswidrigkeiten zu prüfen und geeignete Maßnahmen zur Wiederherstellung und zum dauerhaften Schutz des betroffenen Lebensraums einzuleiten.
Dieser Vorfall unterstreicht eindrücklich, wie wichtig eine stärkere Sensibilisierung und Schulung im Umgang mit schutzwürdigen Biotopstrukturen und Artvorkommen ist – nicht zuletzt auch in Verantwortung gegenüber der biologischen Vielfalt und dem gesetzlichen Auftrag zum Artenschutz.
Wir werden über das Ergebnis dieses Vorgangs aufgrund der immensen Bedeutung für den Naturschutz fortlaufend berichten!
In der Aufnahme
Diese Art der Landschaftspflege steht im klaren Widerspruch zu geltendem Naturschutzrecht und zeugt von einem mangelnden Verständnis für die Bedeutung strukturreicher Biotope im Offenland. Hecken, Altgrasstreifen und Krautsäume stellen essenzielle Habitatstrukturen für zahlreiche gefährdete Arten dar, insbesondere in intensiv genutzten Agrarlandschaften wie dem Steigerwaldgebiet.
- Der Vorfall wurde dokumentiert und die zuständigen Behörden auf Gemeinde- und Landkreisebene sowie die Naturschutzfachbehörden des Freistaats Bayern wurden über den Vorgang informiert.
Es liegt nun in der Verantwortung dieser Stellen, den Vorfall konsequent aufzuklären, mögliche Ordnungswidrigkeiten zu prüfen und geeignete Maßnahmen zur Wiederherstellung und zum dauerhaften Schutz des betroffenen Lebensraums einzuleiten.
Dieser Vorfall unterstreicht eindrücklich, wie wichtig eine stärkere Sensibilisierung und Schulung im Umgang mit schutzwürdigen Biotopstrukturen und Artvorkommen ist – nicht zuletzt auch in Verantwortung gegenüber der biologischen Vielfalt und dem gesetzlichen Auftrag zum Artenschutz.
Wir werden über das Ergebnis dieses Vorgangs aufgrund der immensen Bedeutung für den Naturschutz fortlaufend berichten!
In der Aufnahme
- Lebensraumzerstörung mit Todesfolge
Artenschutz in Franken®
Ein Tag im Leben eines Kernbeißers – Ein Bericht aus erster Feder

Ein Tag im Leben eines Kernbeißers – Ein Bericht aus erster Feder
22/23.06.2025
Mein Gefieder glänzt im Licht, doch meine Aufmerksamkeit gilt nur einem: meinem Nachwuchs. Mein Junges, noch flaumig und unbeholfen, blickt mich mit neugierigen Augen an. Es wartet darauf, dass ich ihm die nächste Mahlzeit bringe – ein zartes Samenstück, das ich mit meinem kräftigen Schnabel geknackt habe.
22/23.06.2025
- Die Sonne steht bereits hoch am Himmel, als ich mich auf dem stabilen Ast der alten Buche niederlasse.
Mein Gefieder glänzt im Licht, doch meine Aufmerksamkeit gilt nur einem: meinem Nachwuchs. Mein Junges, noch flaumig und unbeholfen, blickt mich mit neugierigen Augen an. Es wartet darauf, dass ich ihm die nächste Mahlzeit bringe – ein zartes Samenstück, das ich mit meinem kräftigen Schnabel geknackt habe.
Ich bin ein Kernbeißer, ein Vogel von robuster Gestalt mit beeindruckender Schnabelkraft. Mit Leichtigkeit öffne ich die härtesten Kirschkerne und Sonnenblumenkerne, eine Fähigkeit, die für mich überlebenswichtig ist. Doch heute geht es nicht nur ums eigene Überleben, sondern um die Zukunft meines kleinen Nachkommens.
Mein Junges fiept leise, ein Zeichen der Ungeduld. Ich lege den Kern vorsichtig in seinen weit geöffneten Schnabel. Anfangs ist es noch ungeschickt, doch mit der Zeit wird es lernen, seine eigenen Samen zu knacken – so wie ich es einst tat. Ich beobachte es voller Stolz, denn es wächst heran und wird bald selbst die Welt entdecken.
Doch die Gefahr lauert überall. Ein Bussard kreist am Himmel, und ich spüre instinktiv, dass es Zeit ist, Schutz zu suchen. Mit einem leisen Laut rufe ich mein Junges näher zu mir, damit es unter meinem Flügel sicher bleibt. Hier, im dichten Laub, sind wir verborgen vor den Blicken der Raubvögel.
Die Tage vergehen, und mein Junges wird kräftiger. Bald wird es selbst fliegen, selbst Nahrung suchen und die Kunst des Kernknackens perfektionieren. Doch bis dahin bleibe ich an seiner Seite, lehre es die Geheimnisse des Waldes und beschütze es vor den Gefahren der Welt. Denn das ist meine Aufgabe – als Elternteil, als Lehrer, als Beschützer.
Ich strecke meine Flügel aus, das Abendrot färbt den Himmel, und mein Junges kuschelt sich an mich. Noch ein weiterer Tag ist vergangen, ein Tag voller Herausforderungen, aber auch voller Liebe. Morgen werden wir wieder aufbrechen – in eine Zukunft, die mit jedem Sonnenstrahl heller leuchtet.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
Mein Junges fiept leise, ein Zeichen der Ungeduld. Ich lege den Kern vorsichtig in seinen weit geöffneten Schnabel. Anfangs ist es noch ungeschickt, doch mit der Zeit wird es lernen, seine eigenen Samen zu knacken – so wie ich es einst tat. Ich beobachte es voller Stolz, denn es wächst heran und wird bald selbst die Welt entdecken.
Doch die Gefahr lauert überall. Ein Bussard kreist am Himmel, und ich spüre instinktiv, dass es Zeit ist, Schutz zu suchen. Mit einem leisen Laut rufe ich mein Junges näher zu mir, damit es unter meinem Flügel sicher bleibt. Hier, im dichten Laub, sind wir verborgen vor den Blicken der Raubvögel.
Die Tage vergehen, und mein Junges wird kräftiger. Bald wird es selbst fliegen, selbst Nahrung suchen und die Kunst des Kernknackens perfektionieren. Doch bis dahin bleibe ich an seiner Seite, lehre es die Geheimnisse des Waldes und beschütze es vor den Gefahren der Welt. Denn das ist meine Aufgabe – als Elternteil, als Lehrer, als Beschützer.
Ich strecke meine Flügel aus, das Abendrot färbt den Himmel, und mein Junges kuschelt sich an mich. Noch ein weiterer Tag ist vergangen, ein Tag voller Herausforderungen, aber auch voller Liebe. Morgen werden wir wieder aufbrechen – in eine Zukunft, die mit jedem Sonnenstrahl heller leuchtet.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- Kernbeißer Altvogel mit Jungtier (links) - 07.06.2025
Artenschutz in Franken®
Ein Biotop für die Biodiversität im urbanen Raum

Die Bedeutung unversiegelter Blütenreihen und Grünflächen am städtischen Eingangsbereich: Ein Biotop für die Biodiversität im urbanen Raum
21/22.06.2025
In diesem Kontext gewinnen unversiegelte Blütenreihen und Grünflächen am städtischen Eingangsbereich an Bedeutung, da sie nicht nur ästhetische Vorteile bieten, sondern auch einen wertvollen Beitrag zur Erhaltung der Biodiversität leisten.
21/22.06.2025
- Die zunehmende Urbanisierung stellt Städte vor die Herausforderung, Lebensräume für eine vielfältige Flora und Fauna zu erhalten.
In diesem Kontext gewinnen unversiegelte Blütenreihen und Grünflächen am städtischen Eingangsbereich an Bedeutung, da sie nicht nur ästhetische Vorteile bieten, sondern auch einen wertvollen Beitrag zur Erhaltung der Biodiversität leisten.
Unversiegelte Blütenreihen und Grünflächen fungieren als wertvolle Refugien für zahlreiche Pflanzenarten, darunter Wildblumen und Gräser, die eine vielfältige Insektenwelt anziehen. Diese Flächen bieten Nahrung und Lebensraum für Bienen, Schmetterlinge und andere bestäubende Insekten, die für die Bestäubung von Pflanzen und somit für die Nahrungsmittelproduktion unverzichtbar sind.
Trotz ihrer ökologischen Bedeutung sind viele Verantwortliche möglicherweise nicht ausreichend über die negativen Auswirkungen des regelmäßigen Mähens informiert. Das routinemäßige Abmähen solcher Flächen kann nicht nur Lebensräume zerstören, sondern auch die Populationen von bestäubenden Insekten gefährden und die lokale Biodiversität verringern.
Es ist entscheidend, dass Verantwortliche im städtischen Bereich sich der Bedeutung unversiegelter Blütenreihen und Grünflächen bewusst werden und nachhaltige Pflegepraktiken implementieren, die sowohl ästhetische als auch ökologische Ziele unterstützen. Nur durch den Schutz und die Förderung dieser natürlichen Lebensräume können Städte langfristig ihre Biodiversität bewahren und eine gesunde, nachhaltige Umwelt für zukünftige Generationen sichern.
In der Aufnahme von Rolf Thiemann am 05.06.2025
Einige Fragen die uns dabei wichtig erscheinen:
Quelle
---------------------------------------------------------------------------------------------
Gewässer und Naturschutz im Erftkreis
Flora-Fauna-Artenschutz
Naturschutzökologie
Rolf Thiemann
Naturschutzberater
Eisvogelweg 1
50181 Bedburg
Stand 05.06.2025
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung. Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Trotz ihrer ökologischen Bedeutung sind viele Verantwortliche möglicherweise nicht ausreichend über die negativen Auswirkungen des regelmäßigen Mähens informiert. Das routinemäßige Abmähen solcher Flächen kann nicht nur Lebensräume zerstören, sondern auch die Populationen von bestäubenden Insekten gefährden und die lokale Biodiversität verringern.
Es ist entscheidend, dass Verantwortliche im städtischen Bereich sich der Bedeutung unversiegelter Blütenreihen und Grünflächen bewusst werden und nachhaltige Pflegepraktiken implementieren, die sowohl ästhetische als auch ökologische Ziele unterstützen. Nur durch den Schutz und die Förderung dieser natürlichen Lebensräume können Städte langfristig ihre Biodiversität bewahren und eine gesunde, nachhaltige Umwelt für zukünftige Generationen sichern.
In der Aufnahme von Rolf Thiemann am 05.06.2025
- Und schon wieder wird bei uns in Bedburg eine Grünfläche sinnlos vernichtet. Unsere Bürger erfreuten sich einige Jahre an der Blühwiese am Kreisverkehr Monte Mare. Vögel, Igel und Insekten nutzten die Fläche als Nahrungsareal im innerstädtischen Bereich.Wenn man aus dem Kreisverkehr fuhr war es immer ein schöner Anblick, die Blumen das Grün zu sehen.
Einige Fragen die uns dabei wichtig erscheinen:
- Wir fragen uns, warum man nicht auf dem mehrere tausend Quadratmeter großen Parkplatz nebenan in der Lage ist, dort die Ladestationen und Wohnmobil-Parkplätze zu bauen?
- Weshalb wurde diese Fläche gerade während der auch Reproduktionsphase zahlreicher Spezies abgemäht?
- Wäre es ggf. nicht an der Zeit das die Stadt Bedburg einfach aus dem Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt e.V. (Kommbio) austritt, wenn ökologische Aspekte ggf. nur Randerscheinigungen abbilden können?
- Wir sind entäuscht, kann es sein dass das größte deutsche Netzwerk für naturnahe Kommunen sich nicht über die Gegebenheiten hier informiert?
- Stellt sich, von dieser Warte aus gesehen, eigentlich eine Mitgliedschaft in diesem Bündnis womöglich nicht selbst in Frage?
- Ist es den Verantwortlichen beim Einfahren in die Stadt lieber auf Ladestationen und Wohnmobile zu schauen, anstatt auf eine blühende Wiese?
Quelle
---------------------------------------------------------------------------------------------
Gewässer und Naturschutz im Erftkreis
Flora-Fauna-Artenschutz
Naturschutzökologie
Rolf Thiemann
Naturschutzberater
Eisvogelweg 1
50181 Bedburg
Stand 05.06.2025
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung. Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Artenschutz in Franken®
Stele der Biodiversität® - Oberschwappach

Stele der Biodiversität® - Oberschwappach
20/21.06.2025
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutzes in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. sowie der Gemeinde Knetzgau, das unabhängig von der Deutschen Postcode Lotterie, der Petra und Matthias Hanft-Stiftung für Tier- und Naturschutz und der Steuerkanzlei Bauerfeind aus München unterstützt wird.
Oberschwappach / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen, kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
20/21.06.2025
- Start der grafischen Gestaltung
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutzes in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. sowie der Gemeinde Knetzgau, das unabhängig von der Deutschen Postcode Lotterie, der Petra und Matthias Hanft-Stiftung für Tier- und Naturschutz und der Steuerkanzlei Bauerfeind aus München unterstützt wird.
Oberschwappach / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen, kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
In der Aufnahme
- Am 04.06.2025 können wir den Start der grafischen Gestaltung erkennen ...
Artenschutz in Franken®
Erfolg beim Wanderfalkenschutz 2025

Der Wanderfalke (Falco peregrinus) ist eine faszinierende Greifvogelart, die für ihre Schnelligkeit und ihre Anpassungsfähigkeit bekannt ist.
19/20.06.2025
Über den Wanderfalken (Falco peregrinus)
Der Wanderfalke ist einer der schnellsten Vögel der Welt, der Geschwindigkeiten von über 300 km/h erreichen kann. Diese Greifvogelart ist global verbreitet und bewohnt eine Vielzahl von Lebensräumen, von Küstenlinien bis hin zu städtischen Gebieten. Sie ernähren sich hauptsächlich von anderen Vögeln, die sie im Sturzflug jagen.
19/20.06.2025
- Der Schutz dieser Art, einschließlich der Jungvogelberingung, spielt eine entscheidende Rolle für ihre langfristige Erhaltung.
Über den Wanderfalken (Falco peregrinus)
Der Wanderfalke ist einer der schnellsten Vögel der Welt, der Geschwindigkeiten von über 300 km/h erreichen kann. Diese Greifvogelart ist global verbreitet und bewohnt eine Vielzahl von Lebensräumen, von Küstenlinien bis hin zu städtischen Gebieten. Sie ernähren sich hauptsächlich von anderen Vögeln, die sie im Sturzflug jagen.
Bedrohungen für den Wanderfalken
Obwohl der Wanderfalke ein breites Verbreitungsgebiet hat, ist er verschiedenen Bedrohungen ausgesetzt:
Bedeutung der Jungvogelberingung
Die Jungvogelberingung ist eine Praxis, die es Wissenschaftlern ermöglicht, Informationen über das Verhalten, die Wanderungen und die Überlebensrate junger Vögel zu sammeln. Hier sind einige Gründe, warum dies wichtig ist:
Schutzmaßnahmen für den Wanderfalken
Zum Schutz des Wanderfalken und seiner Lebensräume werden verschiedene Maßnahmen ergriffen:
Fazit
Der Schutz des Wanderfalken ist entscheidend, um diese beeindruckende Greifvogelart für zukünftige Generationen zu erhalten. Durch Maßnahmen wie die Jungvogelberingung und die Umsetzung von Schutzstrategien können wir dazu beitragen, dass der Wanderfalke weiterhin einen Platz in unseren Ökosystemen behält.
In der Aufnahme von A. Brehm
Obwohl der Wanderfalke ein breites Verbreitungsgebiet hat, ist er verschiedenen Bedrohungen ausgesetzt:
- Habitatverlust: Zerstörung natürlicher Lebensräume durch Urbanisierung und industrielle Entwicklung.
- Giftstoffe: Bioakkumulation von Pestiziden und anderen Schadstoffen, die ihre Populationen gefährden können.
- Menschliche Störungen: Unangemessene menschliche Interaktionen in Brutgebieten können zu Störungen führen und die Reproduktion beeinträchtigen.
Bedeutung der Jungvogelberingung
Die Jungvogelberingung ist eine Praxis, die es Wissenschaftlern ermöglicht, Informationen über das Verhalten, die Wanderungen und die Überlebensrate junger Vögel zu sammeln. Hier sind einige Gründe, warum dies wichtig ist:
- Wissenschaftliche Forschung: Die Beringung hilft Forschern, Muster der Wanderungen und Verhaltensweisen von Wanderfalken zu verstehen.
- Bestandsüberwachung: Durch die Rückverfolgung beringter Vögel können Bestandsänderungen und Bedrohungen erkannt werden.
- Schutzmaßnahmen: Daten aus Beringungsstudien unterstützen den Schutz und das Management von Wanderfalkenpopulationen.
Schutzmaßnahmen für den Wanderfalken
Zum Schutz des Wanderfalken und seiner Lebensräume werden verschiedene Maßnahmen ergriffen:
- Schutz der Brutgebiete: Einrichtung von Schutzgebieten und Maßnahmen zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume.
- Umweltbildung: Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Bedeutung des Schutzes von Greifvögeln wie dem Wanderfalken.
- Überwachung und Forschung: Kontinuierliche Überwachung der Bestände und Forschung zur Verbesserung des Schutzes.
Fazit
Der Schutz des Wanderfalken ist entscheidend, um diese beeindruckende Greifvogelart für zukünftige Generationen zu erhalten. Durch Maßnahmen wie die Jungvogelberingung und die Umsetzung von Schutzstrategien können wir dazu beitragen, dass der Wanderfalke weiterhin einen Platz in unseren Ökosystemen behält.
In der Aufnahme von A. Brehm
- Beringter Jungfalke 2025
Artenschutz in Franken®
„Verdrängt, durchnässt, vergessen ...

„Verdrängt, durchnässt, vergessen – Der stille Rückzug der Großen Wiesenameise aus der Agrarlandschaft“
18/19.06.2025
In der heutigen, hochintensiv bewirtschafteten Kulturlandschaft stehen viele Tierarten unter massivem Druck – doch kaum ein Beispiel verdeutlicht die stille Erosion ökologischer Resilienz so eindrucksvoll wie das der geschützten Formica–Ameisenarten, insbesondere der Große Wiesenameise (Formica pratensis).
Diese Arten spielen eine Schlüsselrolle im ökologischen Gefüge: Sie regulieren Insektenpopulationen, fördern die Bodenbelüftung und sind zentrale Akteure im Stoffkreislauf – und dennoch werden ihre Niststätten zunehmend zerstört oder entwertet.
18/19.06.2025
- Ein unterschätzter Indikator biologischer Resilienz im Spannungsfeld von Monokultur und Klimadynamik
In der heutigen, hochintensiv bewirtschafteten Kulturlandschaft stehen viele Tierarten unter massivem Druck – doch kaum ein Beispiel verdeutlicht die stille Erosion ökologischer Resilienz so eindrucksvoll wie das der geschützten Formica–Ameisenarten, insbesondere der Große Wiesenameise (Formica pratensis).
Diese Arten spielen eine Schlüsselrolle im ökologischen Gefüge: Sie regulieren Insektenpopulationen, fördern die Bodenbelüftung und sind zentrale Akteure im Stoffkreislauf – und dennoch werden ihre Niststätten zunehmend zerstört oder entwertet.
Ein Blick in den ländlich geprägten Raum zeigt: Wo einst strukturreiche Feldraine, lichte Waldränder und extensive Grünlandbrachen Rückzugsorte boten, dominieren heute homogene Anbausysteme, allen voran großflächige Maismonokulturen. Während der Maisanbau in vielen Regionen Mitteleuropas inzwischen zu einem der flächenstärksten Kulturpflanzensysteme gehört, geht er einher mit erheblichen ökologischen Kollateralschäden – besonders für bodenabhängige Arten mit festen Neststandorten.
Erosion durch Erosion – wie Starkregenereignisse Ameisennester zerstören
Eine der bislang zu wenig beachteten Auswirkungen betrifft die zunehmende Häufigkeit von Starkregenereignissen im Zuge des Klimawandels. Insbesondere im Frühsommer, zur kritischen Phase der Nestentwicklung, treffen sintflutartige Regenfälle auf Bodenflächen, die durch intensive landwirtschaftliche Nutzung stark verdichtet, unbedeckt oder gar erosionsanfällig sind – ein typisches Merkmal von Maismonokulturen.
Die angrenzenden Ameisennester, oft in oder nahe an Feldrändern oder Hecken angesiedelt, fungieren in diesem hydrologischen System als unfreiwillige Senken. Durch das Fehlen natürlicher Pufferzonen – etwa durch Hecken, strukturreiche Übergänge oder Mulchstreifen – können die Niederschlagsmengen nicht mehr in den Oberboden infiltrieren, sondern sammeln sich oberflächlich und folgen den kleinsten Gefällelinien. Dies führt zu punktueller Überflutung und zur strukturellen Zerstörung der Nestkuppen, die für die Temperaturregulation und Brutpflege der Kolonie essenziell sind.
Darüber hinaus kommt es durch Hangwasserabfluss oder Vernässung zur mikrobiellen Destabilisierung des Nestgefüges – Schimmelbildung, faulige Zersetzung organischen Materials und Abwanderung oder Kollaps der Kolonie sind dokumentierte Folgen. Insbesondere Jungvölker, die sich noch im Aufbau ihrer Kuppelstruktur befinden, sind hiervon massiv betroffen.
Landschaft als Risiko – wenn das Umfeld zum Problem wird
Hinzu tritt die kombinierte Wirkung mehrerer Stressoren: Pestizideinträge über Drainwasser, mechanische Bodenbearbeitung in direkter Nähe, das Fehlen von Wintereinstrahlung durch angrenzende hohe Maispflanzen und die zunehmende Fragmentierung geeigneter Siedlungsräume. Eine ehemalige Habitatvielfalt, die Wanderungen und Neugründungen begünstigte, ist durch intensiven Maisanbau heute weitgehend zerstückelt.
Die Summe dieser Faktoren bedeutet für Wiesenameisen nicht nur eine ökologische Stresssituation, sondern faktisch ein Auslöschen aus der Agrarlandschaft – ein leiser Verlust, der kaum registriert wird. Dabei ist der gesetzliche Schutzstatus dieser Arten (§ 44 BNatSchG) eindeutig – doch die Realität vor Ort spricht eine andere Sprache.
Schutzmaßnahmen und Perspektiven:
Der wirksame Schutz dieser ökologisch hochrelevanten Arten setzt voraus, dass auch die Landschaft als funktionaler Organismus verstanden wird. Einzelmaßnahmen – wie das Umsetzen von Nestern in Schutzgebiete – greifen zu kurz, wenn die Ursachen nicht adressiert werden. Es braucht:
Nur durch eine systemische Umgestaltung der Agrarlandschaft können die Ameisen als Schlüsselorganismen in ihren Lebensräumen verbleiben – und ihrer Rolle im biologischen Netzwerk weiterhin gerecht werden. Der Schutz ihrer Nester ist damit nicht nur ein Akt des Artenschutzes, sondern ein Indikator für den Grad an ökologischer Mitverantwortung in der Landbewirtschaftung unserer Zeit.
In der Aufnahme
Erosion durch Erosion – wie Starkregenereignisse Ameisennester zerstören
Eine der bislang zu wenig beachteten Auswirkungen betrifft die zunehmende Häufigkeit von Starkregenereignissen im Zuge des Klimawandels. Insbesondere im Frühsommer, zur kritischen Phase der Nestentwicklung, treffen sintflutartige Regenfälle auf Bodenflächen, die durch intensive landwirtschaftliche Nutzung stark verdichtet, unbedeckt oder gar erosionsanfällig sind – ein typisches Merkmal von Maismonokulturen.
Die angrenzenden Ameisennester, oft in oder nahe an Feldrändern oder Hecken angesiedelt, fungieren in diesem hydrologischen System als unfreiwillige Senken. Durch das Fehlen natürlicher Pufferzonen – etwa durch Hecken, strukturreiche Übergänge oder Mulchstreifen – können die Niederschlagsmengen nicht mehr in den Oberboden infiltrieren, sondern sammeln sich oberflächlich und folgen den kleinsten Gefällelinien. Dies führt zu punktueller Überflutung und zur strukturellen Zerstörung der Nestkuppen, die für die Temperaturregulation und Brutpflege der Kolonie essenziell sind.
Darüber hinaus kommt es durch Hangwasserabfluss oder Vernässung zur mikrobiellen Destabilisierung des Nestgefüges – Schimmelbildung, faulige Zersetzung organischen Materials und Abwanderung oder Kollaps der Kolonie sind dokumentierte Folgen. Insbesondere Jungvölker, die sich noch im Aufbau ihrer Kuppelstruktur befinden, sind hiervon massiv betroffen.
Landschaft als Risiko – wenn das Umfeld zum Problem wird
Hinzu tritt die kombinierte Wirkung mehrerer Stressoren: Pestizideinträge über Drainwasser, mechanische Bodenbearbeitung in direkter Nähe, das Fehlen von Wintereinstrahlung durch angrenzende hohe Maispflanzen und die zunehmende Fragmentierung geeigneter Siedlungsräume. Eine ehemalige Habitatvielfalt, die Wanderungen und Neugründungen begünstigte, ist durch intensiven Maisanbau heute weitgehend zerstückelt.
Die Summe dieser Faktoren bedeutet für Wiesenameisen nicht nur eine ökologische Stresssituation, sondern faktisch ein Auslöschen aus der Agrarlandschaft – ein leiser Verlust, der kaum registriert wird. Dabei ist der gesetzliche Schutzstatus dieser Arten (§ 44 BNatSchG) eindeutig – doch die Realität vor Ort spricht eine andere Sprache.
Schutzmaßnahmen und Perspektiven:
Der wirksame Schutz dieser ökologisch hochrelevanten Arten setzt voraus, dass auch die Landschaft als funktionaler Organismus verstanden wird. Einzelmaßnahmen – wie das Umsetzen von Nestern in Schutzgebiete – greifen zu kurz, wenn die Ursachen nicht adressiert werden. Es braucht:
- Pufferstreifen und gezielte Strukturzonen zwischen Monokulturfeldern und naturnahen Saumbiotopen
- Erosionsvermeidende Bewirtschaftungsmethoden, wie reduzierte Bodenbearbeitung, Untersaaten oder Terrassierungen
- Hydrologische Entzerrung, z. B. durch Versickerungsmulden, um Oberflächenwasser kontrolliert abzuleiten
- Förderung naturnaher Ackerrandstreifen, auch im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der EU
- Verbindliche Schutzregelungen für bekannte Neststandorte im Rahmen betrieblicher Bewirtschaftungspläne
Nur durch eine systemische Umgestaltung der Agrarlandschaft können die Ameisen als Schlüsselorganismen in ihren Lebensräumen verbleiben – und ihrer Rolle im biologischen Netzwerk weiterhin gerecht werden. Der Schutz ihrer Nester ist damit nicht nur ein Akt des Artenschutzes, sondern ein Indikator für den Grad an ökologischer Mitverantwortung in der Landbewirtschaftung unserer Zeit.
In der Aufnahme
- Eine der bislang zu wenig beachteten Auswirkungen betrifft die zunehmende Häufigkeit von Starkregenereignissen im Zuge des Klimawandels. Insbesondere im Frühsommer, zur kritischen Phase der Nestentwicklung, treffen sintflutartige Regenfälle auf Bodenflächen, die durch intensive landwirtschaftliche Nutzung stark verdichtet, unbedeckt oder gar erosionsanfällig sind – ein typisches Merkmal von Maismonokulturen.
Artenschutz in Franken®
Zwischen Anspruch und Wirklichkeit – Der Mythos der behutsamen Waldwirtschaft

Zwischen Anspruch und Wirklichkeit – Der Mythos der behutsamen Waldwirtschaft
17/18.06.2025
Dieses Narrativ ist u.a. in politischen Strategien, forstlichen Leitbildern und öffentlichen Debatten tief verankert. Doch bei genauerem Hinsehen entpuppt sich dieser vermeintliche Ausgleich oftmals als Illusion – als Rhetorik, die die tatsächliche Praxis übertüncht.
17/18.06.2025
- Der Begriff der „behutsamen Waldwirtschaft“ suggeriert eine harmonische Verbindung von Ökologie und Ökonomie, eine verantwortungsvolle Balance zwischen dem Schutz natürlicher Lebensräume und ihrer nachhaltigen Nutzung.
Dieses Narrativ ist u.a. in politischen Strategien, forstlichen Leitbildern und öffentlichen Debatten tief verankert. Doch bei genauerem Hinsehen entpuppt sich dieser vermeintliche Ausgleich oftmals als Illusion – als Rhetorik, die die tatsächliche Praxis übertüncht.
Denn was in vielen Fällen als „Waldwirtschaft“ bezeichnet wird, ist faktisch ein systematisch bewirtschafteter Produktionsraum: ein Wirtschaftsforst. Monostrukturierte, auf maximale Holzerträge optimierte Bestände, regelmäßige Befahrung mit schweren Maschinen, (im worstcase gar auch flächendeckende Kahlschläge in geschlossenen Zeitintervallen) – all dies steht im klaren Widerspruch zu einer Waldnutzung, die sich dem Prinzip der Behutsamkeit verpflichtet fühlt. Die eigentliche Vielfalt, Resilienz und Selbstregulationskraft naturnaher Wälder wird dabei nicht gefördert, sondern sukzessive verdrängt.
„Schützen und nützen“ bleibt in diesem Kontext häufig ein bloßer Slogan, der die Dominanz des ökonomischen Interesses tarnt. Die Schutzfunktion des Waldes – etwa als Kohlenstoffspeicher, als Wasserrückhalte- und -filtersystem, als Lebensraum für unzählige Arten – tritt zurück hinter die kurzfristige Verwertung seiner Biomasse. Selbst dort, wo Begriffe wie „Nachhaltigkeit“ bemüht werden, wird oft ein quantitatives Verständnis zugrunde gelegt: Es wird nur so viel geerntet, wie nachwächst. Doch diese Definition ignoriert ökologische Qualität, strukturelle Komplexität und das Zeitempfinden eines Ökosystems, das in Jahrhunderten denkt.
Die Behauptung, mit forstlicher Nutzung zugleich aktiv zum Naturschutz beizutragen, erscheint daher vielfach als instrumentalisierter Anspruch, der kritischer Prüfung nicht standhält. Ein ökologisch funktionierender Wald ist mehr als eine Ansammlung von Bäumen; er ist ein komplexes Netzwerk aus Boden, Mikroklima, Artenvielfalt und langfristiger Entwicklungsdynamik. Die technische Steuerung dieses Systems durch den Menschen – selbst unter dem Banner der „behutsamen Nutzung“ – reduziert den Wald auf ein System von Outputs.
Was nötig wäre, ist eine grundlegende Neuausrichtung des forstlichen Selbstverständnisses: weg vom Vorrang der Nutzfunktion, hin zu einem tiefgreifenden Respekt vor der Eigenlogik des Waldes. Dies erfordert, insbesondere in Zeiten des Klimawandels und massiver Biodiversitätsverluste, nicht weniger als eine Umkehr: Wälder dürfen nicht länger primär Wirtschaftsraum sein, sondern müssen in erster Linie als lebendige, dynamische und verletzliche Ökosysteme verstanden und behandelt werden. Das bedeutet auch: Schutz ist nicht immer mit Nutzung vereinbar. Und Behutsamkeit beginnt dort, wo der Mensch bereit ist, sich selbst zurückzunehmen.
In der Aufnahme
„Schützen und nützen“ bleibt in diesem Kontext häufig ein bloßer Slogan, der die Dominanz des ökonomischen Interesses tarnt. Die Schutzfunktion des Waldes – etwa als Kohlenstoffspeicher, als Wasserrückhalte- und -filtersystem, als Lebensraum für unzählige Arten – tritt zurück hinter die kurzfristige Verwertung seiner Biomasse. Selbst dort, wo Begriffe wie „Nachhaltigkeit“ bemüht werden, wird oft ein quantitatives Verständnis zugrunde gelegt: Es wird nur so viel geerntet, wie nachwächst. Doch diese Definition ignoriert ökologische Qualität, strukturelle Komplexität und das Zeitempfinden eines Ökosystems, das in Jahrhunderten denkt.
Die Behauptung, mit forstlicher Nutzung zugleich aktiv zum Naturschutz beizutragen, erscheint daher vielfach als instrumentalisierter Anspruch, der kritischer Prüfung nicht standhält. Ein ökologisch funktionierender Wald ist mehr als eine Ansammlung von Bäumen; er ist ein komplexes Netzwerk aus Boden, Mikroklima, Artenvielfalt und langfristiger Entwicklungsdynamik. Die technische Steuerung dieses Systems durch den Menschen – selbst unter dem Banner der „behutsamen Nutzung“ – reduziert den Wald auf ein System von Outputs.
Was nötig wäre, ist eine grundlegende Neuausrichtung des forstlichen Selbstverständnisses: weg vom Vorrang der Nutzfunktion, hin zu einem tiefgreifenden Respekt vor der Eigenlogik des Waldes. Dies erfordert, insbesondere in Zeiten des Klimawandels und massiver Biodiversitätsverluste, nicht weniger als eine Umkehr: Wälder dürfen nicht länger primär Wirtschaftsraum sein, sondern müssen in erster Linie als lebendige, dynamische und verletzliche Ökosysteme verstanden und behandelt werden. Das bedeutet auch: Schutz ist nicht immer mit Nutzung vereinbar. Und Behutsamkeit beginnt dort, wo der Mensch bereit ist, sich selbst zurückzunehmen.
In der Aufnahme
- An einer forstlichen Einrichtung fand sich dieser Satz der uns vor wenigen Tagen zugeleitet wurde. Von unserer Seite haben wir zahlreiche forstliche Strukturen eingebunden und dokumentieren deren Entwicklungen vielfach seit Jahrzenten in abertausenden von Aufnahmen. Das ermöglicht uns sehr wohl zu erkennen ob Aussprüche wie der in der Abbildung vorgestellte mehr als leere Worthülsen sind oder nicht!
Artenschutz in Franken®
Windkraft und Vogelschutz: Ein Konflikt mit Lösungen

Windkraft und Vogelschutz: Ein Konflikt mit Lösungen
16/17.06.2025
Doch ihre Errichtung und Nutzung sind nicht ohne Umweltfolgen: Der Vogelschlag an Windrädern ist ein ernstzunehmendes Problem. In diesem komprimierten Textkörper werden einige Problemstellungen analysiert und mögliche Lösungsansätze aufgezeigt.
Regelmäßig werden Informationen vermittelt das besonders Greifvögel wie der Seeadler und Rotmilane, daneben Wasservögel vom sogenannten "Rotorenschlag" betroffen sind. Interne Informationen zeigen jedoch auch auf das Feldlerchen und Schleiereulen regelmäßig Opfer dieser regenerativen Energieerzeugungsmaschinen weren.
16/17.06.2025
- Windkraftanlagen sind ein wohl essenzieller Bestandteil der Energiewende und leisten einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung von CO₂-Emissionen.
Doch ihre Errichtung und Nutzung sind nicht ohne Umweltfolgen: Der Vogelschlag an Windrädern ist ein ernstzunehmendes Problem. In diesem komprimierten Textkörper werden einige Problemstellungen analysiert und mögliche Lösungsansätze aufgezeigt.
Regelmäßig werden Informationen vermittelt das besonders Greifvögel wie der Seeadler und Rotmilane, daneben Wasservögel vom sogenannten "Rotorenschlag" betroffen sind. Interne Informationen zeigen jedoch auch auf das Feldlerchen und Schleiereulen regelmäßig Opfer dieser regenerativen Energieerzeugungsmaschinen weren.
Problemstellungen
Lösungsansätze
Fazit
Windenergie ist eine unverzichtbare Technologie für eine nachhaltige Zukunft, doch ihr Ausbau muss mit ökologischer Verantwortung erfolgen. Durch kluge Standortwahl, innovative Technologien und intensivere Forschung können wir die Konflikte zwischen erneuerbarer Energie und Naturschutz minimieren. Nur durch eine ganzheitliche Betrachtung wird es gelingen, Windkraft und Vogelschutz in Einklang zu bringen.
In der Aufnahme von Rolf Thiemann
- Kollisionen mit Rotorblättern Viele Vogelarten, insbesondere Greifvögel und Zugvögel, können Windkraftanlagen nicht rechtzeitig erkennen und kollidieren mit den schnell rotierenden Rotorblättern. Dies führt nicht nur zu erheblichen Bestandsverlusten gefährdeter Arten, sondern auch zu einem ethischen und ökologischen Konflikt.
- Standortwahl und Zugrouten Windräder werden oft in offenen Landschaften errichtet, die für Vögel natürliche Lebensräume darstellen. Wenn solche Anlagen in wichtigen Brut- und Zuggebieten installiert werden, erhöht sich die Gefahr von Kollisionen erheblich.
- Unzureichende Überwachung und Forschung Die tatsächlichen Zahlen der getöteten Vögel sind schwer zu erfassen, da viele Opfer nicht gefunden oder registriert werden. Dies erschwert fundierte wissenschaftliche Analysen und effektive Schutzmaßnahmen.
Lösungsansätze
- Optimierung der Standortwahl Eine detaillierte Untersuchung der Vogelzugrouten sowie Brut- und Rastgebiete kann helfen, problematische Standorte zu vermeiden. Durch den gezielten Bau von Windrädern in weniger sensiblen Gebieten lassen sich Kollisionen erheblich reduzieren.
- Intelligente Abschaltmechanismen Moderne Technologien ermöglichen es, Windräder temporär abzuschalten, wenn sich große Vogelgruppen nähern. Systeme wie Radarsensoren oder KI-gestützte Kameras können frühzeitig eine Gefahr erkennen und eine präventive Abschaltung veranlassen.
- Sichtbarkeit der Rotoren verbessern Untersuchungen zeigen, dass eine gezielte Farbgestaltung der Rotorblätter dazu beitragen kann, dass Vögel die Windräder besser wahrnehmen und ausweichen. Schwarz-weiße Muster oder fluoreszierende Farben könnten sich als effektiv erweisen.
- Forschung und Monitoring ausbauen Mehr Langzeitstudien und flächendeckende Erfassungen von Vogelschlag-Vorfällen sind notwendig, um die Effektivität verschiedener Schutzmaßnahmen zu bewerten und weiterzuentwickeln.
Fazit
Windenergie ist eine unverzichtbare Technologie für eine nachhaltige Zukunft, doch ihr Ausbau muss mit ökologischer Verantwortung erfolgen. Durch kluge Standortwahl, innovative Technologien und intensivere Forschung können wir die Konflikte zwischen erneuerbarer Energie und Naturschutz minimieren. Nur durch eine ganzheitliche Betrachtung wird es gelingen, Windkraft und Vogelschutz in Einklang zu bringen.
In der Aufnahme von Rolf Thiemann
- Von einem Jäger wurden zum wiederholten Male Windradopfer gemeldet, immer wieder werden tote Vögel gefunden. Diesmal eine zerteilte Lerche und 50 Meter weiter ebenfalls eine durchgeschnittene Schleiereule.Die Naturschutzfachbehörden wurden informiert.
Artenschutz in Franken®
Erste Patienten in neuer Voliere

Schutzräume für gefiederte Patienten – Die Bedeutung spezialisierter Volieren im Wildvogelschutz
15/16.06.2025
In Auffangstationen und Pflegestellen werden sie medizinisch versorgt und auf eine mögliche Wiederfreilassung vorbereitet. Spezielle Volieren spielen dabei eine entscheidende Rolle, denn sie bieten nicht nur artgerechte Unterbringung, sondern fördern auch die Rehabilitation der Tiere.
15/16.06.2025
- Wildvögel geraten durch verschiedene Faktoren wie Umweltverschmutzung, Habitatverlust und menschliche Eingriffe oft in Not.
In Auffangstationen und Pflegestellen werden sie medizinisch versorgt und auf eine mögliche Wiederfreilassung vorbereitet. Spezielle Volieren spielen dabei eine entscheidende Rolle, denn sie bieten nicht nur artgerechte Unterbringung, sondern fördern auch die Rehabilitation der Tiere.
Die Funktion spezieller Volieren
Wildvogelpfleglinge benötigen während ihrer Genesung möglichst naturnahe Bedingungen, um ihre Flugmuskulatur zu trainieren und sich auf das Leben in Freiheit vorzubereiten. Volieren für Wildvögel sind daher oft großräumig, strukturiert und speziell auf die Bedürfnisse der jeweiligen Art ausgelegt. Sie ermöglichen eine stressfreie Umgebung, in der die Vögel ihre natürlichen Verhaltensweisen ausüben können.
Wichtige Aspekte spezieller Volieren:
Einfluss auf die erfolgreiche Wiederauswilderung
Die richtige Gestaltung und Nutzung spezieller Volieren erhöht die Überlebenschancen der Vögel erheblich. Sie lernen, Futter selbstständig zu finden und entwickeln die nötige Kondition, um sich in der Natur zu behaupten. Erfolgreiche Beispiele von Wildvogelstationen zeigen, dass angepasste Volieren einen direkten Beitrag zum Artenschutz leisten und die Zahl der erfolgreichen Auswilderungen steigern.
Die Investition in spezialisierte Volieren ist daher nicht nur eine Frage des Tierschutzes, sondern auch eine langfristige Maßnahme zum Erhalt gefährdeter Vogelpopulationen.
In der Aufnahme
Wildvogelpfleglinge benötigen während ihrer Genesung möglichst naturnahe Bedingungen, um ihre Flugmuskulatur zu trainieren und sich auf das Leben in Freiheit vorzubereiten. Volieren für Wildvögel sind daher oft großräumig, strukturiert und speziell auf die Bedürfnisse der jeweiligen Art ausgelegt. Sie ermöglichen eine stressfreie Umgebung, in der die Vögel ihre natürlichen Verhaltensweisen ausüben können.
Wichtige Aspekte spezieller Volieren:
- Flugtraining: Eine ausreichende Größe und Höhe erlauben den Tieren, ihre Flugfähigkeiten zu verbessern.
- Naturnahe Umgebung: Strukturen wie Äste, Büsche und Wasserelemente simulieren den späteren Lebensraum.
- Schutz und Sicherheit: Eine stabile Bauweise schützt die Vögel vor Raubtieren und anderen Gefahren.
- Minimierung des Menschenkontakts: Damit sich die Tiere nicht an Menschen gewöhnen, ist eine ruhige und abgeschirmte Haltung essenziell.
Einfluss auf die erfolgreiche Wiederauswilderung
Die richtige Gestaltung und Nutzung spezieller Volieren erhöht die Überlebenschancen der Vögel erheblich. Sie lernen, Futter selbstständig zu finden und entwickeln die nötige Kondition, um sich in der Natur zu behaupten. Erfolgreiche Beispiele von Wildvogelstationen zeigen, dass angepasste Volieren einen direkten Beitrag zum Artenschutz leisten und die Zahl der erfolgreichen Auswilderungen steigern.
Die Investition in spezialisierte Volieren ist daher nicht nur eine Frage des Tierschutzes, sondern auch eine langfristige Maßnahme zum Erhalt gefährdeter Vogelpopulationen.
In der Aufnahme
- Am 27.03.2025 zogen die ersten Pfleglinge in die Voliere ein ...
Artenschutz in Franken®
Stele der Biodiversität® - Oberschwappach
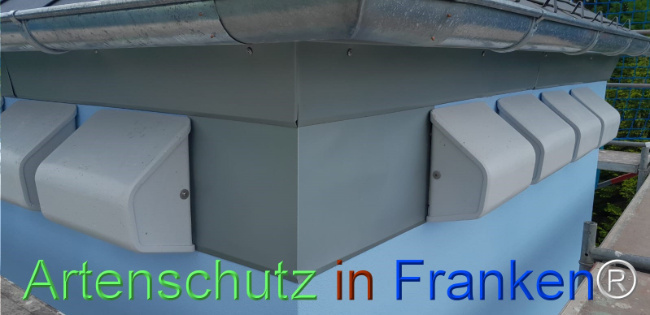
Stele der Biodiversität® - Oberschwappach
14/15.06.2025
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutzes in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. sowie der Gemeinde Knetzgau, das unabhängig von der Deutschen Postcode Lotterie, der Petra und Matthias Hanft-Stiftung für Tier- und Naturschutz und der Steuerkanzlei Bauerfeind aus München unterstützt wird.
Oberschwappach / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen, kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
14/15.06.2025
- Projekt in der Umsetzungsphase
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutzes in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. sowie der Gemeinde Knetzgau, das unabhängig von der Deutschen Postcode Lotterie, der Petra und Matthias Hanft-Stiftung für Tier- und Naturschutz und der Steuerkanzlei Bauerfeind aus München unterstützt wird.
Oberschwappach / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen, kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
In der Aufnahme
- Am 27.05.2025 wurde mit der Aufbringung der Mauerseglernisthilfen begonnen ... hier mit der Traufkörper- Cornerverblendung ..
Artenschutz in Franken®
Gefährliche Begegnung ...

Gefährliche Begegnung – Wie freilaufende Katzen das Leben junger Wildvögel bedrohen
13/14.06.2025
Doch eine der größten Bedrohungen stammt nicht aus der Natur selbst, sondern von freilaufenden Hauskatzen. Während Katzen instinktiv jagen, geraten junge, unerfahrene Vögel häufig in ihre Reichweite – mit fatalen Folgen.
13/14.06.2025
- Die ersten Wochen im Leben eines Jungvogels sind voller Herausforderungen: Nahrungssuche, Flugtraining und die Gefahr durch natürliche Fressfeinde.
Doch eine der größten Bedrohungen stammt nicht aus der Natur selbst, sondern von freilaufenden Hauskatzen. Während Katzen instinktiv jagen, geraten junge, unerfahrene Vögel häufig in ihre Reichweite – mit fatalen Folgen.
Warum sind Jungvögel so gefährdet?
Jungvögel, vor allem sogenannte Ästlinge, verlassen das Nest, bevor sie vollständig flugfähig sind. Sie verbringen oft mehrere Tage am Boden oder auf niedrigen Ästen, während sie von den Eltern weiter gefüttert werden. In dieser Phase sind sie besonders anfällig für Angriffe. Freilaufende Katzen sind geschickte Jäger, die sich leise anschleichen und blitzschnell zuschlagen können. Einmal erbeutet, haben die jungen Vögel kaum eine Überlebenschance.
Besonders gefährliche Situationen für Jungvögel:
Die Auswirkungen auf die Vogelpopulation
Freilaufende Katzen töten jährlich Millionen von Wildvögeln. Besonders betroffen sind Bodenbrüter und Arten, die in der Nähe von Wohngebieten leben. In manchen Regionen tragen sie erheblich zum Rückgang von Vogelpopulationen bei. Auch seltene und gefährdete Arten geraten unter Druck, da sie sich nicht schnell genug vermehren können, um die Verluste auszugleichen.
Schutzmaßnahmen – Was kann getan werden?
Der Schutz von Jungvögeln ist ein wichtiger Bestandteil des Naturschutzes, und ein verantwortungsbewusster Umgang mit Hauskatzen kann dazu beitragen, das Überleben vieler Arten zu sichern.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
Jungvögel, vor allem sogenannte Ästlinge, verlassen das Nest, bevor sie vollständig flugfähig sind. Sie verbringen oft mehrere Tage am Boden oder auf niedrigen Ästen, während sie von den Eltern weiter gefüttert werden. In dieser Phase sind sie besonders anfällig für Angriffe. Freilaufende Katzen sind geschickte Jäger, die sich leise anschleichen und blitzschnell zuschlagen können. Einmal erbeutet, haben die jungen Vögel kaum eine Überlebenschance.
Besonders gefährliche Situationen für Jungvögel:
- Nestnähe: Katzen können Nester entdecken und plündern.
- Flugübungen: Junge Vögel sind noch unerfahren und können nicht schnell genug fliehen.
- Nähe zu menschlichen Siedlungen: Stadtparks und Gärten sind oft Hotspots für Katzen und Jungvögel.
Die Auswirkungen auf die Vogelpopulation
Freilaufende Katzen töten jährlich Millionen von Wildvögeln. Besonders betroffen sind Bodenbrüter und Arten, die in der Nähe von Wohngebieten leben. In manchen Regionen tragen sie erheblich zum Rückgang von Vogelpopulationen bei. Auch seltene und gefährdete Arten geraten unter Druck, da sie sich nicht schnell genug vermehren können, um die Verluste auszugleichen.
Schutzmaßnahmen – Was kann getan werden?
- Katzen kontrolliert halten: Besonders in der Brutzeit (Frühling und Sommer) sollten Katzenbesitzer ihre Tiere möglichst drinnen halten oder beaufsichtigen.
- Glocken an Katzenhalsbändern: Sie können Vögel warnen und ihnen Zeit zur Flucht geben.
- Naturnahe Gärten ohne Fressfallen: Keine Futterstellen am Boden, keine niedrigen Nistplätze.
- Bewusstseinsbildung: Aufklärung über die Auswirkungen von Katzen auf Wildvögel kann helfen, verantwortungsvollen Umgang zu fördern.
Der Schutz von Jungvögeln ist ein wichtiger Bestandteil des Naturschutzes, und ein verantwortungsbewusster Umgang mit Hauskatzen kann dazu beitragen, das Überleben vieler Arten zu sichern.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- Männlicher Haussperling füttert seinen Nachwuchs
Artenschutz in Franken®
Eisvogelnachwuchs in zerstörter Brutwand

Eisvogelnachwuchs in zerstörter Brutwand
12/13.05.2025
Künstliche Eisvogelwände sind innovative Strukturen, die entwickelt wurden, um die Lebensbedingungen für Eisvögel in ihrem natürlichen Lebensraum zu verbessern. Diese speziellen Wände sind so gestaltet, dass sie den natürlichen Brutbedingungen der Vögel nahekommen und gleichzeitig den Schutz und die Sicherheit fördern.
12/13.05.2025
- Künstliche Eisvogelwände: Funktion und Erfolge
Künstliche Eisvogelwände sind innovative Strukturen, die entwickelt wurden, um die Lebensbedingungen für Eisvögel in ihrem natürlichen Lebensraum zu verbessern. Diese speziellen Wände sind so gestaltet, dass sie den natürlichen Brutbedingungen der Vögel nahekommen und gleichzeitig den Schutz und die Sicherheit fördern.
Die Hauptfunktion dieser künstlichen Wände besteht darin, den Eisvögeln geeignete Nistplätze zu bieten, die sie aufgrund von Umweltveränderungen oder menschlichen Eingriffen möglicherweise verloren haben. Durch ihre Bauweise und Platzierung sollen sie das Brutverhalten der Vögel unterstützen und ihre Fortpflanzungsraten erhöhen.
In Bezug auf ihre Erfolge haben künstliche Eisvogelwände bereits in verschiedenen Regionen nachweislich positive Auswirkungen gezeigt. Sie tragen zur Erhaltung der Eisvogelbestände bei, indem sie stabile Brutplätze zur Verfügung stellen, die natürlichen Gegebenheiten ähneln. Dies ist besonders wichtig in Gebieten, wo natürliche Lebensräume durch menschliche Aktivitäten gestört wurden.
Darüber hinaus dienen diese Wände auch der Forschung und dem Monitoring von Eisvogelpopulationen. Durch die Beobachtung und Analyse des Verhaltens der Vögel an diesen Strukturen können Wissenschaftler wichtige Erkenntnisse über ihre Lebensweise gewinnen und gezielte Schutzmaßnahmen entwickeln.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass künstliche Eisvogelwände eine effektive Lösung darstellen, um den Lebensraum dieser faszinierenden Vögel zu unterstützen und langfristig zu erhalten. Ihre Funktionen reichen von der Bereitstellung sicherer Nistplätze bis hin zur Förderung der Forschung und zum Schutz bedrohter Populationen. Mit weiterer Forschung und Entwicklung können diese Strukturen weiter optimiert werden, um einen noch größeren Beitrag zum Naturschutz zu leisten.
In der Aufnahme von Rolf Thiemann
----------------------------------------------------------------------------------
Rolf Thiemann - Gewässer und Naturschutz im Erftkreis
Flora-Fauna-Artenschutz
Naturschutzökologie
Eisvogelweg 1
50181 Bedburg
In Bezug auf ihre Erfolge haben künstliche Eisvogelwände bereits in verschiedenen Regionen nachweislich positive Auswirkungen gezeigt. Sie tragen zur Erhaltung der Eisvogelbestände bei, indem sie stabile Brutplätze zur Verfügung stellen, die natürlichen Gegebenheiten ähneln. Dies ist besonders wichtig in Gebieten, wo natürliche Lebensräume durch menschliche Aktivitäten gestört wurden.
Darüber hinaus dienen diese Wände auch der Forschung und dem Monitoring von Eisvogelpopulationen. Durch die Beobachtung und Analyse des Verhaltens der Vögel an diesen Strukturen können Wissenschaftler wichtige Erkenntnisse über ihre Lebensweise gewinnen und gezielte Schutzmaßnahmen entwickeln.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass künstliche Eisvogelwände eine effektive Lösung darstellen, um den Lebensraum dieser faszinierenden Vögel zu unterstützen und langfristig zu erhalten. Ihre Funktionen reichen von der Bereitstellung sicherer Nistplätze bis hin zur Förderung der Forschung und zum Schutz bedrohter Populationen. Mit weiterer Forschung und Entwicklung können diese Strukturen weiter optimiert werden, um einen noch größeren Beitrag zum Naturschutz zu leisten.
In der Aufnahme von Rolf Thiemann
- Die Eisvogelbrutwand wurde vor einigen Monaten zerstört ... da ich noch keine Gelegenheit hatte die Wand zu reparieren und das am Ende des Jahres machen wollte, war ich nochmal da kontrollieren. Nun, die große Freude! 6 junge Eisvögel waren in der defekten Brutwand zu erkennen. Hoffentlich gehts noch 2 Wochen gut, das die Jungen gesund ausfliegen können. Danach muß die Wand repariert werden damit keine Räuber (Marder,Ratte) vor der Wand in die Brutröhre springen können.
----------------------------------------------------------------------------------
Rolf Thiemann - Gewässer und Naturschutz im Erftkreis
Flora-Fauna-Artenschutz
Naturschutzökologie
Eisvogelweg 1
50181 Bedburg
Artenschutz in Franken®
Kernbeißer - Die faszinierende Entwicklung eines Jungvogels

Kernbeißer (Coccothraustes coccothraustes): Die faszinierende Entwicklung eines Jungvogels
11/12.06.2025
Besonders interessant ist die Entwicklung seines Jungvogels, die einen faszinierenden Einblick in das Leben dieses Vogels bietet.
11/12.06.2025
- Der Kernbeißer, wissenschaftlich bekannt als Coccothraustes coccothraustes, ist ein imposanter Singvogel, der mit seiner beeindruckenden Erscheinung und seinem kräftigen Schnabel beeindruckt.
Besonders interessant ist die Entwicklung seines Jungvogels, die einen faszinierenden Einblick in das Leben dieses Vogels bietet.
Der Kernbeißer gehört zur Familie der Finken (Fringillidae) und ist in Europa, Teilen Asiens und Nordafrikas verbreitet. Er zeichnet sich durch seine kräftige Gestalt, den massiven Schnabel und die auffällige Färbung aus, die ihn zu einem markanten Vertreter der heimischen Vogelwelt macht.
Lebensraum und Verhalten
Fortpflanzung und Brutpflege
Entwicklung des Jungvogels
Ernährung und Wachstum
Flugfähigkeit und Unabhängigkeit
Fazit
Der Kernbeißer ist nicht nur ein imposanter Vogel mit auffälligem Aussehen, sondern auch ein faszinierendes Beispiel für die Aufzucht und Entwicklung von Jungvögeln in der heimischen Vogelwelt. Seine robuste Natur und sein soziales Verhalten machen ihn zu einem interessanten Studienobjekt für Vogelkundler und Naturbegeisterte gleichermaßen.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch vom 27.05.2025
Lebensraum und Verhalten
- Typischerweise bewohnt der Kernbeißer Laub- und Mischwälder sowie Gärten, wo er sich von verschiedenen Samen, insbesondere von Hartholzgewächsen, ernährt. Sein Gesang ist laut und melodisch, besonders während der Balzzeit im Frühling.
Fortpflanzung und Brutpflege
- Im Frühling beginnt die Brutzeit, während der das Paarungsverhalten intensiv wird. Das Weibchen legt 3-5 Eier, die dann gemeinsam vom Männchen und Weibchen ausgebrütet werden. Die Aufzucht der Jungvögel ist eine aufopfernde Aufgabe, bei der beide Eltern aktiv an der Fütterung und Pflege beteiligt sind.
Entwicklung des Jungvogels
- Die Entwicklung eines Kernbeißer-Jungvogels ist ein bemerkenswerter Prozess. Nach dem Schlüpfen sind die Küken zunächst nackt und hilflos. Innerhalb weniger Tage beginnen sie, ihr charakteristisches Gefieder zu entwickeln, das zunächst unscheinbar graubraun ist.
Ernährung und Wachstum
- Die Hauptnahrung der Jungvögel besteht aus Sämereien und gelegentlich auch aus kleinen Insekten, die von den Eltern in den Nestlinge gefüttert werden. Dies fördert ihr schnelles Wachstum und ihre Entwicklung.
Flugfähigkeit und Unabhängigkeit
- Mit etwa zwei Wochen beginnen die Jungvögel, ihre Flügel zu trainieren, und nach etwa drei Wochen sind sie in der Lage, kurze Flüge zu unternehmen. Mit etwa einem Monat sind sie in der Lage, selbständig zu fressen und sind weitgehend unabhängig von den Eltern.
Fazit
Der Kernbeißer ist nicht nur ein imposanter Vogel mit auffälligem Aussehen, sondern auch ein faszinierendes Beispiel für die Aufzucht und Entwicklung von Jungvögeln in der heimischen Vogelwelt. Seine robuste Natur und sein soziales Verhalten machen ihn zu einem interessanten Studienobjekt für Vogelkundler und Naturbegeisterte gleichermaßen.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch vom 27.05.2025
- Nachwuchs von unserem größten heimischen Fink, eben flügge, wird von den Eltern noch gefüttert - er hat noch sein Jugendkleid - um 20:31 aufgenommen, zu Beginn der Dunkelheit.In dem Alter sind die Jungvögel durch Fressfeinde, primär Katzen, noch stark gefährdet.
Artenschutz in Franken®
Aktueller Ordner:
Archiv
Parallele Themen:
2019-11
2019-10
2019-12
2020-01
2020-02
2020-03
2020-04
2020-05
2020-06
2020-07
2020-08
2020-09
2020-10
2020-11
2020-12
2021-01
2021-02
2021-03
2021-04
2021-05
2021-06
2021-07
2021-08
2021-09
2021-10
2021-11
2021-12
2022-01
2022-02
2022-03
2022-04
2022-05
2022-06
2022-07
2022-08
2022-09
2022-10
2022-11
2022-12
2023-01
2023-02
2023-03
2023-04
2023-05
2023-06
2023-07
2023-08
2023-09
2023-10
2023-11
2023-12
2024-01
2024-02
2024-03
2024-04
2024-05
2024-06
2024-07
2024-08
2024-09
2024-10
2024-11
2024-12
2025-01
2025-02
2025-03
2025-04
2025-05
2025-06
2025-07
2025-08
2025-09
2025-10
















