Kaulquappen der Erdkröte (Bufo bufo) ..

Kaulquappen der Erdkröte (Bufo bufo) – Entwicklung, Merkmale und ökologische Bedeutung
21/22.05.2025
Ihr Fortpflanzungszyklus umfasst eine aquatische Larvalphase, in der sich aus Eiern die sogenannten Kaulquappen entwickeln. Diese Entwicklungsphase ist nicht nur biologisch faszinierend, sondern auch ökologisch relevant, da Kaulquappen eine zentrale Rolle im Nahrungsnetz und in der ökologischen Dynamik von Kleingewässern spielen.
21/22.05.2025
- Die Erdkröte (Bufo bufo) ist eine der häufigsten Amphibienarten Europas und ein bedeutender Bestandteil mitteleuropäischer Gewässer- und Landökosysteme.
Ihr Fortpflanzungszyklus umfasst eine aquatische Larvalphase, in der sich aus Eiern die sogenannten Kaulquappen entwickeln. Diese Entwicklungsphase ist nicht nur biologisch faszinierend, sondern auch ökologisch relevant, da Kaulquappen eine zentrale Rolle im Nahrungsnetz und in der ökologischen Dynamik von Kleingewässern spielen.
Eiablage und Schlupf
Die Fortpflanzung der Erdkröte beginnt früh im Jahr – meist zwischen März und April –, sobald die Temperaturen steigen und die Laichgewässer eisfrei sind. Die Weibchen legen während der Paarung Laichschnüre mit bis zu 6.000–8.000 Eiern ab, die in langen Doppelschnüren um Wasserpflanzen oder Äste gewickelt werden. Jedes Ei ist in eine gallertartige Schutzhülle eingebettet, die es vor Austrocknung und mechanischen Schäden schützt. Nach etwa 8–14 Tagen (temperaturabhängig) schlüpfen die Kaulquappen. Diese erste Entwicklungsphase ist stark an die Wassertemperatur und die Sauerstoffverhältnisse im Gewässer gekoppelt.
Morphologie und Entwicklung
Die Kaulquappen der Erdkröte sind einheitlich schwarz gefärbt, was sie von anderen Amphibienlarven – etwa denen des Grasfroschs – unterscheidet. Die dunkle Pigmentierung bietet Schutz vor UV-Strahlung und dient der Tarnung am Gewässergrund.
Wichtige Merkmale:
Die Entwicklung durchläuft mehrere Stadien:
Der gesamte Prozess dauert etwa 8–12 Wochen, abhängig von Umweltfaktoren wie Temperatur, Sauerstoffgehalt, Nahrungsangebot und Populationsdichte.
Ernährung und ökologische Funktion
Kaulquappen der Erdkröte sind im Gegensatz zu den räuberischeren Larven anderer Arten überwiegend herbivor oder detritivor. Sie ernähren sich vornehmlich von Algenaufwuchs, abgestorbenem Pflanzenmaterial und Mikroorganismen. Dadurch tragen sie maßgeblich zur Kontrolle von Algenblüten bei und fördern die Wasserqualität in ihren Laichgewässern.
Sie stellen selbst eine wichtige Nahrungsquelle für verschiedene aquatische Prädatoren dar, z. B. Wasserkäferlarven, Libellenlarven, Fische und Vögel. Auch Kannibalismus kann unter Nahrungsmangelbedingungen vorkommen.
Gefährdungen und Mortalität
Die Sterblichkeitsrate von Kaulquappen ist natürlicherweise sehr hoch, was durch die große Eizahl kompensiert wird. Zu den wichtigsten Mortalitätsfaktoren zählen:
Besonders problematisch ist die Fragmentierung der Lebensräume durch Verkehrsinfrastruktur, da sie den Zugang zu Laichgewässern erschwert oder verhindert. Dies kann die Populationen auf lange Sicht destabilisieren.
Schutzaspekte
Die Erdkröte einschließlich ihrer Larvenstadien ist nach Anhang IV der FFH-Richtlinie (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie) als streng zu schützende Art gelistet. In Deutschland unterliegt sie darüber hinaus dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Schutzmaßnahmen umfassen:
Fazit
Die Kaulquappen der Erdkröte sind ein bedeutender Bestandteil aquatischer Ökosysteme und übernehmen dort zentrale Funktionen als Pflanzenfresser, Algenregulatoren und Beuteorganismen. Ihre Entwicklung ist ein empfindlicher biologischer Prozess, der durch zahlreiche Umweltfaktoren beeinflusst wird. Die Kenntnis ihrer Ökologie ist essenziell für den wirksamen Amphibienschutz. Ihr Vorkommen kann als Hinweis auf die Funktionalität von Kleingewässern und die ökologische Qualität von Feuchtlebensräumen dienen.
In der Aufnahme
Die Fortpflanzung der Erdkröte beginnt früh im Jahr – meist zwischen März und April –, sobald die Temperaturen steigen und die Laichgewässer eisfrei sind. Die Weibchen legen während der Paarung Laichschnüre mit bis zu 6.000–8.000 Eiern ab, die in langen Doppelschnüren um Wasserpflanzen oder Äste gewickelt werden. Jedes Ei ist in eine gallertartige Schutzhülle eingebettet, die es vor Austrocknung und mechanischen Schäden schützt. Nach etwa 8–14 Tagen (temperaturabhängig) schlüpfen die Kaulquappen. Diese erste Entwicklungsphase ist stark an die Wassertemperatur und die Sauerstoffverhältnisse im Gewässer gekoppelt.
Morphologie und Entwicklung
Die Kaulquappen der Erdkröte sind einheitlich schwarz gefärbt, was sie von anderen Amphibienlarven – etwa denen des Grasfroschs – unterscheidet. Die dunkle Pigmentierung bietet Schutz vor UV-Strahlung und dient der Tarnung am Gewässergrund.
Wichtige Merkmale:
- Kopfform: Rundlich mit einem relativ breiten Maulfeld
- Schwanz: Länglich, mit abgerundeter Schwanzspitze und einem gut entwickelten Flossensaum
- Größe: Bis zum Abschluss der Larvalphase etwa 2,5–3 cm lang
- Atemorgane: Zunächst Kiemenatmung, später Umstellung auf Lungenatmung im Zuge der Metamorphose
Die Entwicklung durchläuft mehrere Stadien:
- Frühstadium: Aufnahme von Mikroalgen und Detritus
- Mittleres Larvenstadium: Entwicklung von Hinterbeinen, Umstellung der Nahrungsaufnahme
- Spätstadium: Ausbildung der Vorderbeine, Rückbildung des Darms (in Vorbereitung auf den karnivoren Lebensstil der adulten Kröte), Beginn der Lungenatmung
- Metamorphose: Vollständige Rückbildung des Schwanzes, Umstellung auf das Landleben
Der gesamte Prozess dauert etwa 8–12 Wochen, abhängig von Umweltfaktoren wie Temperatur, Sauerstoffgehalt, Nahrungsangebot und Populationsdichte.
Ernährung und ökologische Funktion
Kaulquappen der Erdkröte sind im Gegensatz zu den räuberischeren Larven anderer Arten überwiegend herbivor oder detritivor. Sie ernähren sich vornehmlich von Algenaufwuchs, abgestorbenem Pflanzenmaterial und Mikroorganismen. Dadurch tragen sie maßgeblich zur Kontrolle von Algenblüten bei und fördern die Wasserqualität in ihren Laichgewässern.
Sie stellen selbst eine wichtige Nahrungsquelle für verschiedene aquatische Prädatoren dar, z. B. Wasserkäferlarven, Libellenlarven, Fische und Vögel. Auch Kannibalismus kann unter Nahrungsmangelbedingungen vorkommen.
Gefährdungen und Mortalität
Die Sterblichkeitsrate von Kaulquappen ist natürlicherweise sehr hoch, was durch die große Eizahl kompensiert wird. Zu den wichtigsten Mortalitätsfaktoren zählen:
- Fressfeinde
- Trockenfallen temporärer Gewässer
- Sauerstoffmangel und Überdüngung
- Krankheiten wie Chytridpilze (Batrachochytrium dendrobatidis)
- Anthropogene Einflüsse: Eintrag von Pestiziden, Straßenbau, Habitatfragmentierung
Besonders problematisch ist die Fragmentierung der Lebensräume durch Verkehrsinfrastruktur, da sie den Zugang zu Laichgewässern erschwert oder verhindert. Dies kann die Populationen auf lange Sicht destabilisieren.
Schutzaspekte
Die Erdkröte einschließlich ihrer Larvenstadien ist nach Anhang IV der FFH-Richtlinie (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie) als streng zu schützende Art gelistet. In Deutschland unterliegt sie darüber hinaus dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Schutzmaßnahmen umfassen:
- Erhalt und Wiederherstellung naturnaher Laichgewässer
- Anlage von Amphibiendurchlässen an Straßen
- Schaffung von Rückzugsräumen im Umland (z. B. strukturreiche Waldränder, Feuchtwiesen)
- Verzicht auf den Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln in Gewässernähe
Fazit
Die Kaulquappen der Erdkröte sind ein bedeutender Bestandteil aquatischer Ökosysteme und übernehmen dort zentrale Funktionen als Pflanzenfresser, Algenregulatoren und Beuteorganismen. Ihre Entwicklung ist ein empfindlicher biologischer Prozess, der durch zahlreiche Umweltfaktoren beeinflusst wird. Die Kenntnis ihrer Ökologie ist essenziell für den wirksamen Amphibienschutz. Ihr Vorkommen kann als Hinweis auf die Funktionalität von Kleingewässern und die ökologische Qualität von Feuchtlebensräumen dienen.
In der Aufnahme
- Kaulquappen der Erdkröte (Bufo bufo)
Artenschutz in Franken®
Verein zur Erforschung der Flora des Regnitzgebietes - Exkursionen 2025
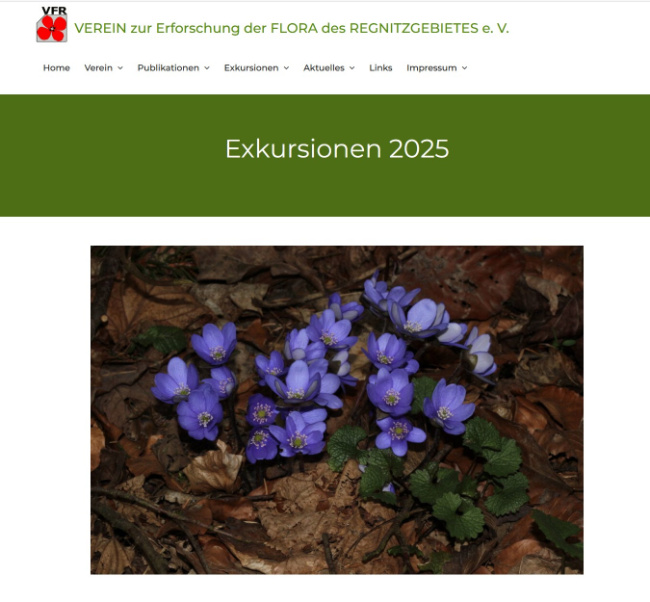
Verein zur Erforschung der Flora des Regnitzgebietes - Exkursionen 2025
20/21.05.2025
Die Arbeit geht weiter!
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde des VFR,
letztes Jahr ist nach langer Vorbereitung die Flora von Bayern erschienen. In dieses fundamentale Werk ist auch ein erheblicher Teil der Arbeit des Vereins zur Erforschung der Flora des Regnitzgebiets (VFR) eingegangen, dessen Ziel es unter anderem ist, Bestand und Veränderung der Flora im Regnitzgebiet zu erfassen und zu kartieren.
Auch wenn mit dem Erscheinen der Flora von Bayern ein gewaltiges Projekt sein Ende gefunden hat, die Natur setzt sich damit nicht zur Ruhe und für uns heißt das: Die Arbeit geht weiter!
Die Veranstaltungen sind offen und kostenlos für alle, richten sich allerdings an Fachpublikum oder Interessierte mit Vorkenntnissen, die sich systematischer mit Botanik auseinandersetzen wollen. Sie dienen neben der Erfassung der Bestände auch der Vernetzung, der Wissensvermittlung sowie dem fachlichen Austausch.
Wir würden uns sehr freuen, wenn wir die eine oder den anderen von Ihnen bei einer Exkursion begrüßen könnten!
20/21.05.2025
Die Arbeit geht weiter!
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde des VFR,
letztes Jahr ist nach langer Vorbereitung die Flora von Bayern erschienen. In dieses fundamentale Werk ist auch ein erheblicher Teil der Arbeit des Vereins zur Erforschung der Flora des Regnitzgebiets (VFR) eingegangen, dessen Ziel es unter anderem ist, Bestand und Veränderung der Flora im Regnitzgebiet zu erfassen und zu kartieren.
Auch wenn mit dem Erscheinen der Flora von Bayern ein gewaltiges Projekt sein Ende gefunden hat, die Natur setzt sich damit nicht zur Ruhe und für uns heißt das: Die Arbeit geht weiter!
Die Veranstaltungen sind offen und kostenlos für alle, richten sich allerdings an Fachpublikum oder Interessierte mit Vorkenntnissen, die sich systematischer mit Botanik auseinandersetzen wollen. Sie dienen neben der Erfassung der Bestände auch der Vernetzung, der Wissensvermittlung sowie dem fachlichen Austausch.
Wir würden uns sehr freuen, wenn wir die eine oder den anderen von Ihnen bei einer Exkursion begrüßen könnten!
Verein zur Erforschung der Flora des Regnitzgebietes
Exkursionen 2025
Abkürzungen: TK = Topographische Karte 1:25 000; TP = Treffpunkt
1.) Sa 31. Mai, TK 6532/4 Nürnberg, TP Langwasser-Süd, Endhaltestelle U 1 (49,39854°N/11,14072°E) Achtung: der TP liegt außerhalb des Ziel-TK), Flora einer Trabantensiedlung: Scherrasen und urbane Gehölzbestände im Bereich Liegnitzer-, Gleiwitzer- und Breslauer Str., Schwerpunkt Lysichiton americanus, Leitung Georg Hetzel und Gerhard Schillai, Naturraum 113.6 – Nürnberger Becken
2.) Sa 7. Juni, TK 6231/1 Adelsdorf, TP Zentbechhofen Keller (49,75924°N/10,90031°E), Schwerpunkt Äcker auf Kalk und Sand, Leitung Harald Schott, Naturraum 113. 7 – Aischtal und Aischgrund.
3.) Sa 14. Juni, TK 6428/1 Bad Windsheim, TP Humprechtsau Kirche (49,55764°N/10,391°E), Schwerpunkt Mittelwald, Leitung Hans Seitz, Naturraum 131 – Windsheimer Bucht
4.) Sa 12. Juli, TK 6435/1 Pommelsbrunn, TP Hartenstein Kirche (49,59627°N/11,52337°E), Submontane Flora, Leitung Bernhard Lang, Naturraum 080.2 – Gräfenberger Flächenalb
5.) Sa 2. August, TK 6331/1 Röttenbach, TP SW-Ortsende Röttenbach, Wegkreuzung am Ende der Hannberger-Str. (49,66443°N/10,91559°E), Schwerpunkt Sandflora, Leitung Harald Schott, Naturraum 113.7 – Aischtal und Aischgrund
6.) Sa 6. September, TK 6929/4 Wassertrüdingen, TP Herrenweiher NE Auhausen, (49,01347°N/10,62759°E), Gemeinschaftsexkursion mit der Arge Flora Nordschwaben, Leitung Günther Kunzmann, Naturraum 110.1 – Hesselberg-Liasplatten
7.) Sa 13. September, TK 5934/2 Thurnau, TP Rohr (an der B 85) Ortsmitte (50,05677°N/11,47835°E), Aue Roter Main (Cirsium canum), örtliche Ruderalflora (Bryonia alba), Leitung Georg Hetzel und Gerhard Schillai, Naturraum 117.3 – Lichtenfelser Maintal
Es liegt im berechtigten Interesse des Vereins, Mitglieder und Öffentlichkeit über seine Mitgliederversammlungen und Exkursionen zu informieren. Zu diesem Zweck werden Bildaufnahmen gemacht und in der Vereinszeitschrift veröffentlicht (print/online). Wer nicht abgebildet sein möchte, muss dies vor der Veranstaltung der Versammlungs-/Exkursionsleitung mitteilen.
Wir bitten unsere Mitglieder um rege Teilnahme an den Exkursionen. Sie finden grundsätzlich bei jeder Witterung statt.
Handy J. Wagenknecht 0160 95912693
G. Schillai 0159 08484951
Mit besten Grüßen
Dr. Rudolf Kötter und Annika Lange
(1. Vorsitzender) (Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit)
Quelle / Abbildungen
VEREIN zur Erforschung der FLORA des REGNITZGEBIETES e.V.
Schwalbenweg 15
91056 Erlangen
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung. Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Exkursionen 2025
Abkürzungen: TK = Topographische Karte 1:25 000; TP = Treffpunkt
1.) Sa 31. Mai, TK 6532/4 Nürnberg, TP Langwasser-Süd, Endhaltestelle U 1 (49,39854°N/11,14072°E) Achtung: der TP liegt außerhalb des Ziel-TK), Flora einer Trabantensiedlung: Scherrasen und urbane Gehölzbestände im Bereich Liegnitzer-, Gleiwitzer- und Breslauer Str., Schwerpunkt Lysichiton americanus, Leitung Georg Hetzel und Gerhard Schillai, Naturraum 113.6 – Nürnberger Becken
2.) Sa 7. Juni, TK 6231/1 Adelsdorf, TP Zentbechhofen Keller (49,75924°N/10,90031°E), Schwerpunkt Äcker auf Kalk und Sand, Leitung Harald Schott, Naturraum 113. 7 – Aischtal und Aischgrund.
3.) Sa 14. Juni, TK 6428/1 Bad Windsheim, TP Humprechtsau Kirche (49,55764°N/10,391°E), Schwerpunkt Mittelwald, Leitung Hans Seitz, Naturraum 131 – Windsheimer Bucht
4.) Sa 12. Juli, TK 6435/1 Pommelsbrunn, TP Hartenstein Kirche (49,59627°N/11,52337°E), Submontane Flora, Leitung Bernhard Lang, Naturraum 080.2 – Gräfenberger Flächenalb
5.) Sa 2. August, TK 6331/1 Röttenbach, TP SW-Ortsende Röttenbach, Wegkreuzung am Ende der Hannberger-Str. (49,66443°N/10,91559°E), Schwerpunkt Sandflora, Leitung Harald Schott, Naturraum 113.7 – Aischtal und Aischgrund
6.) Sa 6. September, TK 6929/4 Wassertrüdingen, TP Herrenweiher NE Auhausen, (49,01347°N/10,62759°E), Gemeinschaftsexkursion mit der Arge Flora Nordschwaben, Leitung Günther Kunzmann, Naturraum 110.1 – Hesselberg-Liasplatten
7.) Sa 13. September, TK 5934/2 Thurnau, TP Rohr (an der B 85) Ortsmitte (50,05677°N/11,47835°E), Aue Roter Main (Cirsium canum), örtliche Ruderalflora (Bryonia alba), Leitung Georg Hetzel und Gerhard Schillai, Naturraum 117.3 – Lichtenfelser Maintal
Es liegt im berechtigten Interesse des Vereins, Mitglieder und Öffentlichkeit über seine Mitgliederversammlungen und Exkursionen zu informieren. Zu diesem Zweck werden Bildaufnahmen gemacht und in der Vereinszeitschrift veröffentlicht (print/online). Wer nicht abgebildet sein möchte, muss dies vor der Veranstaltung der Versammlungs-/Exkursionsleitung mitteilen.
- Beginn der Exkursionen jeweils 10.00 Uhr
Wir bitten unsere Mitglieder um rege Teilnahme an den Exkursionen. Sie finden grundsätzlich bei jeder Witterung statt.
- Gäste sind stets sehr herzlich willkommen.
Handy J. Wagenknecht 0160 95912693
G. Schillai 0159 08484951
Mit besten Grüßen
Dr. Rudolf Kötter und Annika Lange
(1. Vorsitzender) (Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit)
Quelle / Abbildungen
VEREIN zur Erforschung der FLORA des REGNITZGEBIETES e.V.
Schwalbenweg 15
91056 Erlangen
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung. Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Artenschutz in Franken®
Der Schwarze Schnegel (Limax cinereoniger)

Der Schwarze Schnegel (Limax cinereoniger) – Ein ökologisch bedeutsamer Bewohner naturnaher Wälder
20/21.05.2025
Mit einer Körperlänge von bis zu 20 cm – in Ausnahmefällen auch darüber hinaus – ist er die größte heimische Landschnecke und fällt durch seine Größe sowie durch das meist dunkelgraue bis schwärzliche, manchmal auch marmorierte oder gefleckte Erscheinungsbild auf. Sein Vorkommen gilt als Indikator für naturnahe, alte Laub- und Mischwälder mit hoher Habitatkontinuität.
20/21.05.2025
- Der Schwarze Schnegel (Limax cinereoniger) ist eine der größten in Europa vorkommenden Nacktschneckenarten und zählt zur Familie der Schnegel (Limacidae).
Mit einer Körperlänge von bis zu 20 cm – in Ausnahmefällen auch darüber hinaus – ist er die größte heimische Landschnecke und fällt durch seine Größe sowie durch das meist dunkelgraue bis schwärzliche, manchmal auch marmorierte oder gefleckte Erscheinungsbild auf. Sein Vorkommen gilt als Indikator für naturnahe, alte Laub- und Mischwälder mit hoher Habitatkontinuität.
Verbreitung und Lebensraum
Limax cinereoniger ist in weiten Teilen Europas verbreitet, wobei der Verbreitungsschwerpunkt in Mitteleuropa liegt. Die Art bevorzugt kühle, feuchte und strukturreiche Wälder mit einem hohen Anteil an Totholz und dauerhaft schattigen Mikroklimaten. Besonders häufig findet man den Schwarzen Schnegel in alten Buchenwäldern, Schluchtwäldern sowie in moosreichen, humusreichen Bodengesellschaften. Aufgrund seiner hohen Habitatansprüche ist sein Vorkommen stark an ökologische Stabilität gebunden und er gilt als empfindlich gegenüber forstwirtschaftlichen Eingriffen, Habitatfragmentierung und Bodenversauerung.
Lebensweise und Ernährung
Der Schwarze Schnegel ist vorwiegend nachtaktiv und versteckt sich tagsüber unter Rinde, in Totholz, unter Steinen oder im Laub. Seine Fortbewegung ist – trotz seiner Größe – relativ elegant und gleichmäßig. Anders als viele Nacktschnecken ernährt sich Limax cinereoniger nicht von lebenden Pflanzen, sondern bevorzugt abgestorbenes pflanzliches Material, Pilze und Detritus. Auch andere tote Tiere oder Eier von Schnecken werden nicht verschmäht. Damit erfüllt der Schnegel eine wichtige ökologische Rolle im Nährstoffkreislauf des Waldes, indem er organische Substanz abbaut und dem Bodenleben wieder zuführt.
Fortpflanzung und Entwicklung
Die Art ist zwittrig (hermaphroditisch) und zeigt ein bemerkenswertes Paarungsverhalten, bei dem die Tiere an einem Schleimfaden hängend kopulieren können – ein für Schnegel typisches Verhalten. Die Eiablage erfolgt meist im Spätsommer bis Herbst. Die Jungtiere schlüpfen im darauffolgenden Frühjahr. Aufgrund ihrer langsamen Entwicklung und der Langlebigkeit der Tiere (bis zu 3 Jahre) ist der Schwarze Schnegel besonders empfindlich gegenüber Störungen des Lebensraumes.
Naturschutzfachliche Bedeutung
Als typischer Bewohner alter, strukturreicher Waldstandorte mit hoher Feuchtigkeit stellt Limax cinereoniger einen bedeutenden Zeiger für habitatgereifte, weitgehend ungestörte Waldökosysteme dar. Sein Vorhandensein kann in der naturschutzfachlichen Bewertung von Waldflächen als Hinweis auf ein günstiges mikroklimatisches und strukturelles Milieu gewertet werden. Die Art ist in vielen Regionen rückläufig und steht in mehreren Bundesländern auf den Roten Listen gefährdeter Tierarten. Hauptgefährdungsursachen sind die Intensivierung der Forstwirtschaft, der Rückgang von Alt- und Totholzbeständen, Bodenverdichtung sowie klimabedingte Austrocknung von Lebensräumen.
Fazit
Der Schwarze Schnegel ist weit mehr als eine unscheinbare Waldbewohnerin. Durch seine ökologische Funktion als Zersetzer, seine besondere Habitatbindung und seine Bedeutung als Indikatorart für naturnahe, biodiverse Wälder kommt ihm eine hohe Bedeutung im Rahmen des Waldschutzes und der Biodiversitätsforschung zu. Der Schutz und die Förderung seiner Lebensräume – insbesondere durch die Erhaltung von Alt- und Totholz, die Förderung von Strukturreichtum sowie die Vermeidung großflächiger Eingriffe – sind entscheidend für den Fortbestand dieser bemerkenswerten Art.
In der Aufnahme
Limax cinereoniger ist in weiten Teilen Europas verbreitet, wobei der Verbreitungsschwerpunkt in Mitteleuropa liegt. Die Art bevorzugt kühle, feuchte und strukturreiche Wälder mit einem hohen Anteil an Totholz und dauerhaft schattigen Mikroklimaten. Besonders häufig findet man den Schwarzen Schnegel in alten Buchenwäldern, Schluchtwäldern sowie in moosreichen, humusreichen Bodengesellschaften. Aufgrund seiner hohen Habitatansprüche ist sein Vorkommen stark an ökologische Stabilität gebunden und er gilt als empfindlich gegenüber forstwirtschaftlichen Eingriffen, Habitatfragmentierung und Bodenversauerung.
Lebensweise und Ernährung
Der Schwarze Schnegel ist vorwiegend nachtaktiv und versteckt sich tagsüber unter Rinde, in Totholz, unter Steinen oder im Laub. Seine Fortbewegung ist – trotz seiner Größe – relativ elegant und gleichmäßig. Anders als viele Nacktschnecken ernährt sich Limax cinereoniger nicht von lebenden Pflanzen, sondern bevorzugt abgestorbenes pflanzliches Material, Pilze und Detritus. Auch andere tote Tiere oder Eier von Schnecken werden nicht verschmäht. Damit erfüllt der Schnegel eine wichtige ökologische Rolle im Nährstoffkreislauf des Waldes, indem er organische Substanz abbaut und dem Bodenleben wieder zuführt.
Fortpflanzung und Entwicklung
Die Art ist zwittrig (hermaphroditisch) und zeigt ein bemerkenswertes Paarungsverhalten, bei dem die Tiere an einem Schleimfaden hängend kopulieren können – ein für Schnegel typisches Verhalten. Die Eiablage erfolgt meist im Spätsommer bis Herbst. Die Jungtiere schlüpfen im darauffolgenden Frühjahr. Aufgrund ihrer langsamen Entwicklung und der Langlebigkeit der Tiere (bis zu 3 Jahre) ist der Schwarze Schnegel besonders empfindlich gegenüber Störungen des Lebensraumes.
Naturschutzfachliche Bedeutung
Als typischer Bewohner alter, strukturreicher Waldstandorte mit hoher Feuchtigkeit stellt Limax cinereoniger einen bedeutenden Zeiger für habitatgereifte, weitgehend ungestörte Waldökosysteme dar. Sein Vorhandensein kann in der naturschutzfachlichen Bewertung von Waldflächen als Hinweis auf ein günstiges mikroklimatisches und strukturelles Milieu gewertet werden. Die Art ist in vielen Regionen rückläufig und steht in mehreren Bundesländern auf den Roten Listen gefährdeter Tierarten. Hauptgefährdungsursachen sind die Intensivierung der Forstwirtschaft, der Rückgang von Alt- und Totholzbeständen, Bodenverdichtung sowie klimabedingte Austrocknung von Lebensräumen.
Fazit
Der Schwarze Schnegel ist weit mehr als eine unscheinbare Waldbewohnerin. Durch seine ökologische Funktion als Zersetzer, seine besondere Habitatbindung und seine Bedeutung als Indikatorart für naturnahe, biodiverse Wälder kommt ihm eine hohe Bedeutung im Rahmen des Waldschutzes und der Biodiversitätsforschung zu. Der Schutz und die Förderung seiner Lebensräume – insbesondere durch die Erhaltung von Alt- und Totholz, die Förderung von Strukturreichtum sowie die Vermeidung großflächiger Eingriffe – sind entscheidend für den Fortbestand dieser bemerkenswerten Art.
In der Aufnahme
- Schwarzer Schnegel an Totholz
Artenschutz in Franken®
Kartierung des Schwarzstorchs im Naturpark Frankenwald

Kartierung des Schwarzstorchs im Naturpark Frankenwald
19/20.05.2025
Seit März werden im Naturpark Frankenwald Reviere des Schwarzstorchs kartiert. Die letzte Kartierung des scheuen Waldvogels mit rotem Schnabel erfolgte zwischen 2011 und 2014. Angesichts der starken Waldverluste in den letzten Jahren soll untersucht werden, ob diese Veränderungen zu einem Rückgang der Revierzahlen geführt haben.
19/20.05.2025
- Bestandsaufnahme für den Schutz einer bedrohten Tierart
Seit März werden im Naturpark Frankenwald Reviere des Schwarzstorchs kartiert. Die letzte Kartierung des scheuen Waldvogels mit rotem Schnabel erfolgte zwischen 2011 und 2014. Angesichts der starken Waldverluste in den letzten Jahren soll untersucht werden, ob diese Veränderungen zu einem Rückgang der Revierzahlen geführt haben.
Der Naturpark Frankenwald umfasst Teile der Landkreise Kulmbach, Kronach, Hof und Bayreuth und ist ein deutschlandweiter Verbreitungsschwerpunkt des Schwarzstorchs. Etwa 10 % der bundesweiten Population leben hier. Die Kartierung erfolgt in den Jahren 2025 bis 2027 jeweils vom März bis in den Sommer, wobei die Beobachtungen an exponierten Geländepunkten, sogenannten Checkpoints, durchgeführt werden. Ziel ist es, die Zahl der Brutpaare im Naturpark Frankenwald zu erfassen und die Revierstandorte detailliert zu beschreiben.
Der Schwarzstorch (Ciconia nigra) ist eine streng geschützte Art, die in alten, störungsarmen Wäldern mit Feuchtgebieten und Fließgewässern brütet. Er ernährt sich von Fischen, Amphibien, Krebsen und Insekten und ist sehr störungsempfindlich am Horststandort. Die Erhaltung seiner Lebensräume und ruhiger Wälder als Brutplätze ist von großer Bedeutung.
Das Projekt steht im Einklang mit der EU-Biodiversitätsstrategie für 2030, die darauf abzielt, den Zustand gefährdeter Arten zu verbessern. Deutschland hat sich verpflichtet, einen günstigen Zustand für den Schwarzstorch zu erreichen, und die Kartierung wird eine wichtige Grundlage für zukünftige Schutzmaßnahmen darstellen.
Der Naturpark Frankenwald erstreckt sich über eine Fläche von 102.250 Hektar, von denen rund 59.000 Hektar bewaldet sind. In den letzten Jahren sind durch Trockenstress, Windwurf und Borkenkäfer mehr als 10.000 Hektar Wald verloren gegangen. Diese Entwicklungen stellen eine Herausforderung für den Schwarzstorch dar.
Die Kartierung erfolgt in Kooperation mit der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF), den Bayerischen Staatsforsten, dem Naturpark Frankenwald und dem Landesbund für Vogel- und Naturschutz in Bayern e.V. (LBV).
In der Aufnahme
Quelle
Bayerisches Landesamt für Umwelt
Pressestelle
Bürgermeister-Ulrich-Straße 160
86179 Augsburg
Stand
30.04.2025
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung. Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Der Schwarzstorch (Ciconia nigra) ist eine streng geschützte Art, die in alten, störungsarmen Wäldern mit Feuchtgebieten und Fließgewässern brütet. Er ernährt sich von Fischen, Amphibien, Krebsen und Insekten und ist sehr störungsempfindlich am Horststandort. Die Erhaltung seiner Lebensräume und ruhiger Wälder als Brutplätze ist von großer Bedeutung.
Das Projekt steht im Einklang mit der EU-Biodiversitätsstrategie für 2030, die darauf abzielt, den Zustand gefährdeter Arten zu verbessern. Deutschland hat sich verpflichtet, einen günstigen Zustand für den Schwarzstorch zu erreichen, und die Kartierung wird eine wichtige Grundlage für zukünftige Schutzmaßnahmen darstellen.
Der Naturpark Frankenwald erstreckt sich über eine Fläche von 102.250 Hektar, von denen rund 59.000 Hektar bewaldet sind. In den letzten Jahren sind durch Trockenstress, Windwurf und Borkenkäfer mehr als 10.000 Hektar Wald verloren gegangen. Diese Entwicklungen stellen eine Herausforderung für den Schwarzstorch dar.
Die Kartierung erfolgt in Kooperation mit der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF), den Bayerischen Staatsforsten, dem Naturpark Frankenwald und dem Landesbund für Vogel- und Naturschutz in Bayern e.V. (LBV).
In der Aufnahme
- Der Schwarzstorch (Ciconia nigra) ist eine streng geschützte Art, die in alten, störungsarmen Wäldern mit Feuchtgebieten und Fließgewässern brütet (Quelle: Hans Glader)
Quelle
Bayerisches Landesamt für Umwelt
Pressestelle
Bürgermeister-Ulrich-Straße 160
86179 Augsburg
Stand
30.04.2025
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung. Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Artenschutz in Franken®
Bedeutung fischarmer Waldbäche für die Reproduktion des Feuersalamanders ...

Bedeutung fischarmer Waldbäche für die Reproduktion des Feuersalamanders (Salamandra salamandra) im Kontext klimatischer Veränderungsphasen
18/19.05.2025
Als obligat aquatil-terrestrischer Doppel-Lebensraumnutzer ist er in besonderem Maße auf geeignete Fortpflanzungsgewässer angewiesen. Vor allem fischarme, strukturreiche Waldbäche gelten als essenziell für seine Reproduktion.
Angesichts aktueller klimatischer Veränderungsprozesse gewinnen diese Habitate zunehmend an Bedeutung für den Erhalt stabiler Populationen. Der vorliegende Bericht erläutert die ökologischen Abhängigkeiten dieser Art im Hinblick auf ihre Reproduktion sowie die sich wandelnden Rahmenbedingungen durch den Klimawandel.
18/19.05.2025
- Der Feuersalamander (Salamandra salamandra) zählt zu den prominentesten Amphibienarten Mitteleuropas.
Als obligat aquatil-terrestrischer Doppel-Lebensraumnutzer ist er in besonderem Maße auf geeignete Fortpflanzungsgewässer angewiesen. Vor allem fischarme, strukturreiche Waldbäche gelten als essenziell für seine Reproduktion.
Angesichts aktueller klimatischer Veränderungsprozesse gewinnen diese Habitate zunehmend an Bedeutung für den Erhalt stabiler Populationen. Der vorliegende Bericht erläutert die ökologischen Abhängigkeiten dieser Art im Hinblick auf ihre Reproduktion sowie die sich wandelnden Rahmenbedingungen durch den Klimawandel.
Reproduktionsökologie des Feuersalamanders
Der Feuersalamander weist eine für europäische Amphibien außergewöhnliche Fortpflanzungsstrategie auf: Die Weibchen gebären lebende, weit entwickelte Larven (Ovoviviparie), die unmittelbar nach der Geburt in fließende Kleingewässer abgegeben werden. Für eine erfolgreiche Entwicklung der Larven bis zur Metamorphose sind bestimmte Habitatbedingungen erforderlich:
Zunehmende Bedeutung fischarmer Waldbäche unter klimatischen Veränderungsbedingungen
In Phasen klimatischer Veränderung – insbesondere im Zuge des anthropogenen Klimawandels – kommt es zu erheblichen Veränderungen hydrologischer und thermischer Umweltparameter. Diese wirken sich sowohl direkt als auch indirekt auf die Lebensräume des Feuersalamanders aus.
Schlussfolgerung
Fischarme Waldbäche erfüllen zentrale Habitatfunktionen für die Reproduktion des Feuersalamanders. Insbesondere ihre strukturelle Vielfalt, hohe Wasserqualität und die Abwesenheit von Fischprädatoren machen sie zu einem unersetzlichen Bestandteil der Fortpflanzungsökologie dieser Art. Im Kontext des fortschreitenden Klimawandels gewinnen diese Lebensräume an Bedeutung als klimatisch stabile Refugien. Ihre Erhaltung, Renaturierung und der Schutz vor fischlicher Besiedlung sind daher prioritär zu verfolgen, um lokale Populationen langfristig zu sichern und Biodiversitätsverluste im Amphibienbereich entgegenzuwirken.
Empfehlungen:
In der Aufnahme vom
Der Feuersalamander weist eine für europäische Amphibien außergewöhnliche Fortpflanzungsstrategie auf: Die Weibchen gebären lebende, weit entwickelte Larven (Ovoviviparie), die unmittelbar nach der Geburt in fließende Kleingewässer abgegeben werden. Für eine erfolgreiche Entwicklung der Larven bis zur Metamorphose sind bestimmte Habitatbedingungen erforderlich:
- Abwesenheit von Fischen: Larven des Feuersalamanders sind prädationsanfällig gegenüber Fischarten wie Forellen oder Stichlingen. Studien belegen signifikant geringere Überlebensraten in fischbesetzten Gewässern. Fischarme Waldbäche bieten somit ein weitgehend prädationsfreies Milieu.
- Geringe Fließgeschwindigkeit und hohe Strukturvielfalt: Ideale Larvalgewässer zeichnen sich durch wechselnde Tiefenzonen, Uferunterspülungen und Totholzstrukturen aus. Diese bieten Rückzugsräume und Schutz vor Verdriftung bei Hochwasserereignissen.
- Gute Wasserqualität: Die Larven sind auf hohe Sauerstoffgehalte und geringe Schadstoffbelastung angewiesen, wie sie typischerweise in schattigen, waldnahen Bächen mit natürlicher Vegetationspufferung vorzufinden sind.
Zunehmende Bedeutung fischarmer Waldbäche unter klimatischen Veränderungsbedingungen
In Phasen klimatischer Veränderung – insbesondere im Zuge des anthropogenen Klimawandels – kommt es zu erheblichen Veränderungen hydrologischer und thermischer Umweltparameter. Diese wirken sich sowohl direkt als auch indirekt auf die Lebensräume des Feuersalamanders aus.
- Temperaturanstieg und Austrocknung temporärer Gewässer: Höhere Durchschnittstemperaturen und verlängerte Trockenphasen führen zur Austrocknung zahlreicher Tümpel und Quellrinnsale, wodurch klassische Amphibienlaichgewässer zunehmend als Fortpflanzungshabitate entfallen. Waldbäche mit ganzjähriger Wasserführung bleiben als Refugien bestehen.
- Stabilisierung des Mikroklimas durch Waldkulisse: Die umgebenden Wälder sorgen für eine Beschattung der Bäche und damit für niedrigere Wassertemperaturen sowie eine geringere Verdunstung. Diese stabilen Mikroklimata puffern Extremereignisse wie Hitze- oder Starkregenperioden ab.
- Verdrängung durch invasive oder klimatolerante Fischarten: Mit steigenden Temperaturen können sich auch in ehemals fischfreien Bereichen neue Fischarten etablieren, welche eine Gefährdung der Salamanderlarven darstellen. Natürliche Barrieren in kleineren Waldbächen verhindern diese Besiedlung weitgehend.
- Klimawandelbedingter Verlust offener Wasserstellen in Agrarlandschaften: Während Feuersalamander historisch auch kleinräumig genutzte Offenlandgewässer besiedelten, schrumpft dieses Angebot durch Trockenlegung und intensive landwirtschaftliche Nutzung. Waldbäche bleiben als letzte Rückzugsräume bestehen.
Schlussfolgerung
Fischarme Waldbäche erfüllen zentrale Habitatfunktionen für die Reproduktion des Feuersalamanders. Insbesondere ihre strukturelle Vielfalt, hohe Wasserqualität und die Abwesenheit von Fischprädatoren machen sie zu einem unersetzlichen Bestandteil der Fortpflanzungsökologie dieser Art. Im Kontext des fortschreitenden Klimawandels gewinnen diese Lebensräume an Bedeutung als klimatisch stabile Refugien. Ihre Erhaltung, Renaturierung und der Schutz vor fischlicher Besiedlung sind daher prioritär zu verfolgen, um lokale Populationen langfristig zu sichern und Biodiversitätsverluste im Amphibienbereich entgegenzuwirken.
Empfehlungen:
- Schutz und Wiederherstellung strukturreicher, fischfreier Waldbachabschnitte
- Etablierung von Pufferzonen zur Reduktion landwirtschaftlicher Einträge
- Monitoringprogramme zur Populationsentwicklung in klimatisch besonders exponierten Regionen
- Forschung zu möglichen Anpassungskapazitäten des Feuersalamanders an neue klimatische Bedingungen
In der Aufnahme vom
- Feuersalamander Weibchen beim Absetzen der Larven in ein bislang fischfreies Fließgewässer, dessen ganzjährige Wasserführung eine Anpassung der Art an die klimatischen Faktoren sichtbar weren lässt!
Artenschutz in Franken®
Rettet die Insekten ... so wird das wohl nix!

Rettet die Insekten: Warum ständiges Mähen von Wiesen dem Insektenschutz entgegenwirkt
17/18.05.2025
Der Erhalt ihrer Lebensräume, insbesondere von Wiesen, ist daher entscheidend für ihre Populationen und die gesamte Biodiversität.
17/18.05.2025
- Insekten spielen eine unersetzliche Rolle in unserem Ökosystem, sei es als Bestäuber von Pflanzen oder als Nahrungsquelle für viele andere Tiere.
Der Erhalt ihrer Lebensräume, insbesondere von Wiesen, ist daher entscheidend für ihre Populationen und die gesamte Biodiversität.
Das regelmäßige Mähen von Wiesen stellt jedoch eine ernsthafte Bedrohung für Insekten dar. Durch diese Praxis werden nicht nur unzählige Lebensräume zerstört, sondern auch Nahrungspflanzen und Rückzugsorte für Insekten vernichtet. Insbesondere für bodenbrütende Insektenarten wie Wildbienen und Schmetterlinge bedeutet das häufige Mähen einen Verlust ihrer Nistplätze und Brutstätten.
Darüber hinaus führt das Mähen zu einem Verlust an Pflanzenvielfalt in den Wiesen. Viele blühende Pflanzen, die für Insekten lebenswichtig sind, haben nicht genug Zeit, um zu blühen und Samen zu setzen, bevor sie gemäht werden. Dies verringert die Nahrungsgrundlage für Insekten drastisch und trägt zur weiteren Dezimierung ihrer Populationen bei.
Insekten sind auch stark von der Qualität und dem Zustand ihrer Lebensräume abhängig. Durch das ständige Mähen werden die natürlichen Strukturen der Wiesen gestört, die für das Überleben vieler Arten unerlässlich sind. Dies schafft eine sich verschlechternde Umgebung, die für Insekten weniger lebensfähig ist und ihre langfristige Existenz gefährdet.
Um effektiven Insektenschutz zu betreiben, ist es daher unerlässlich, die Mähpraxis in Wiesen zu überdenken und alternative Managementansätze zu fördern, die den Lebensraum der Insekten besser schützen. Dies kann durch gezieltes Mähen zu bestimmten Zeiten, die Förderung von blühenden Randstreifen oder die Schaffung von Schutzgebieten geschehen, um die Vielfalt und Gesundheit der Insektenpopulationen zu erhalten.
Insgesamt ist das ständige Mähen von Wiesen eine wesentliche Hürde im Kampf um den Erhalt der Insektenvielfalt. Nur durch einen nachhaltigeren Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen können wir langfristig den Schutz und die Bewahrung dieser fundamentalen Tiergruppe gewährleisten.
Aber hier hilft wohl alles Reden nichts und wir schreiten eben gemeinsam diesen Weg entlang, bis dieser endet!
In der Aufnahme
Darüber hinaus führt das Mähen zu einem Verlust an Pflanzenvielfalt in den Wiesen. Viele blühende Pflanzen, die für Insekten lebenswichtig sind, haben nicht genug Zeit, um zu blühen und Samen zu setzen, bevor sie gemäht werden. Dies verringert die Nahrungsgrundlage für Insekten drastisch und trägt zur weiteren Dezimierung ihrer Populationen bei.
Insekten sind auch stark von der Qualität und dem Zustand ihrer Lebensräume abhängig. Durch das ständige Mähen werden die natürlichen Strukturen der Wiesen gestört, die für das Überleben vieler Arten unerlässlich sind. Dies schafft eine sich verschlechternde Umgebung, die für Insekten weniger lebensfähig ist und ihre langfristige Existenz gefährdet.
Um effektiven Insektenschutz zu betreiben, ist es daher unerlässlich, die Mähpraxis in Wiesen zu überdenken und alternative Managementansätze zu fördern, die den Lebensraum der Insekten besser schützen. Dies kann durch gezieltes Mähen zu bestimmten Zeiten, die Förderung von blühenden Randstreifen oder die Schaffung von Schutzgebieten geschehen, um die Vielfalt und Gesundheit der Insektenpopulationen zu erhalten.
Insgesamt ist das ständige Mähen von Wiesen eine wesentliche Hürde im Kampf um den Erhalt der Insektenvielfalt. Nur durch einen nachhaltigeren Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen können wir langfristig den Schutz und die Bewahrung dieser fundamentalen Tiergruppe gewährleisten.
Aber hier hilft wohl alles Reden nichts und wir schreiten eben gemeinsam diesen Weg entlang, bis dieser endet!
In der Aufnahme
- "Grüne Wüsten" ... so wie auf dieser Aufnahme erkennbar sieht es an unzähligen Standorten in unserem Land aus ... Insekten? - Fehlanzeige!
Artenschutz in Franken®
Artenschutzprojekt Steigerwald Dohle & Co.

Artenschutzprojekt Steigerwald Dohle & Co.
16/17.05.2025
Ein innovatives Artenschutz-Umweltbildungsprojekt des Artenschutzes in Franken®, Turmstationen Deutschland e.V. und Katholische Kirchenstiftung Burgwindheim, das von der Deutschen Postcode Lotterie, Steuerkanzlei Bauerfeind und weiteren Projektpartnern unabhängig unterstützt wird.
Burgwindheim / Bayern. Selten sind sie geworden, kulturhistorische Bauwerke, in und an welchen sich typische Kulturfolger niederlassen. Ein solch interessantes Bauwerk stellt das Burgwindheimer Schloss und die naheliegende Pfarrkirche dar in der sich Dohlen, Mauersegler, Turmfalken, Fledermäuse und auch Weißstörche, seit teils vielen Jahren niedergelassen haben.
16/17.05.2025
Ein innovatives Artenschutz-Umweltbildungsprojekt des Artenschutzes in Franken®, Turmstationen Deutschland e.V. und Katholische Kirchenstiftung Burgwindheim, das von der Deutschen Postcode Lotterie, Steuerkanzlei Bauerfeind und weiteren Projektpartnern unabhängig unterstützt wird.
Burgwindheim / Bayern. Selten sind sie geworden, kulturhistorische Bauwerke, in und an welchen sich typische Kulturfolger niederlassen. Ein solch interessantes Bauwerk stellt das Burgwindheimer Schloss und die naheliegende Pfarrkirche dar in der sich Dohlen, Mauersegler, Turmfalken, Fledermäuse und auch Weißstörche, seit teils vielen Jahren niedergelassen haben.
Jedoch stellen diese Besiedlungen die Bauwerke sowie die Artenvielfalt vor Herausforderungen, welche die "moderne Zeit" einfach mit sich bringt und so haben wir uns gemeinsam aufgemacht aufzuzeigen, wie die Erhaltung der Artenvielfalt und der Bauwerke miteinander in Einklang zu bringen sind.
Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können zahlreiche Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
• Begleiten Sie uns bei der nicht alltäglichen Entwicklung eines Hotspots der Biodiversität hier auf unseren Seiten.
In dieser Aufnahme/Webcam
• Erfolgreiche Annahme der bereitgestellten Nisthilfen
Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können zahlreiche Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
• Begleiten Sie uns bei der nicht alltäglichen Entwicklung eines Hotspots der Biodiversität hier auf unseren Seiten.
In dieser Aufnahme/Webcam
• Erfolgreiche Annahme der bereitgestellten Nisthilfen
Artenschutz in Franken®
Kolken - letzte Überlebensräume für Feuersalamander
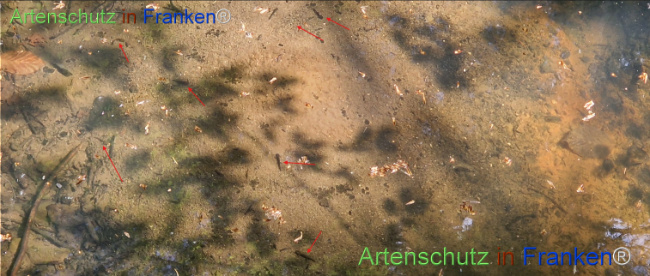
Kolken - letzte Überlebensräume für Feuersalamander - im Monitoring
15/16.05.2025
Ein innovatives Kooperationsprojekt aufgrund der Initiative von Artenschutz in Franken®, das von den Fachbehörden des Naturschutzes (HNB und UNB), sowie den Bayerischen Staatsforsten AÖR der Stiftung "Unsere Erde", der Deutschen Postcode Lotterie und Turmstationen Deutschland e.V. unterstützt wird.
Bayern. Die extreme Trockenheit die auch diesjährig viele Teile Frankens umfasste gefährdete auch zunehmend den Nachwuchs des Feuersalamanders.Auch traditionelle Laichbiotope die bislang immer in der Lage waren, das für den Nachwuchs überlebenswichtige Wasser zu halten, stoßen zunehmend an ihre Grenzen. Da kein natürliches Wasser mehr nachfoss, wurde der Lebensraum der den Feuersalamanderlarven verbieb, immer kleiner und qualitativ immer kritischer.
15/16.05.2025
Ein innovatives Kooperationsprojekt aufgrund der Initiative von Artenschutz in Franken®, das von den Fachbehörden des Naturschutzes (HNB und UNB), sowie den Bayerischen Staatsforsten AÖR der Stiftung "Unsere Erde", der Deutschen Postcode Lotterie und Turmstationen Deutschland e.V. unterstützt wird.
Bayern. Die extreme Trockenheit die auch diesjährig viele Teile Frankens umfasste gefährdete auch zunehmend den Nachwuchs des Feuersalamanders.Auch traditionelle Laichbiotope die bislang immer in der Lage waren, das für den Nachwuchs überlebenswichtige Wasser zu halten, stoßen zunehmend an ihre Grenzen. Da kein natürliches Wasser mehr nachfoss, wurde der Lebensraum der den Feuersalamanderlarven verbieb, immer kleiner und qualitativ immer kritischer.
In einer zugegeben nicht alltäglichen Maßnahme versuchten wir die Lebensräume von Feuersalamanderlarven, die vom Austrocknen bedroht waren und mit ihnen die Larven!, so zu erhalten das die Jungtiere eine Chance erhielten ihre Metamorphose abzuschließen.
So wurden als akuter Projektimpuls rund 1000 Liter Frischwasser zugeführt. Sehr interessant war das Verhalten der Larven im Laichgewässer ... die Tiere strömten unmittelbar beim Einlassen des Frischwassers an diesen Bereich, um wohl intensiv Sauerstoff aufzunehmen.
Nach diesem akuten Ersteinsatz wurden diese ausgewählten Bereiche über Monate hinweg in die Lage versetzt den Tieren in einer zugegeben prekären Lage bestmögliche Überlebensbedingungen zu verschaffen. Hier galt es darauf zu achten die sensiblen Zusammensetzungen der Gewässer nicht zu verändern um das Überleben der Tiere nicht zu gefährden.
Somit wurde also "nicht nur" Wasser eingefüllt, im Gegenteil, es fand ein begleitend umfangreiches Monitoring statt das diese Maßnahme in seiner komplexen Entwicklung beobachtete. Dabei konnten wertvolle Erkenntnisse gewonnen werden die uns in die Lage versetzen möglichen erneuten Projekteinsätze ähnlicher Art effektiv zu begegnen.
Die Aufnahme vom 30.04.2025 macht sichtbar was Feuersalamander von unserem Projekt halten ... mit dem Einsatz konnten wir den Tieren eine bessere Chance einräumen hier eine erfolgreiche Metamorphose hinzulegen ... während zahlreiche traditionelle Laichgewässer bereits vollständig ausgetrocknet sind, zeigen sich die von uns optimierten Bereiche als wasserführend und stabil ...
So wurden als akuter Projektimpuls rund 1000 Liter Frischwasser zugeführt. Sehr interessant war das Verhalten der Larven im Laichgewässer ... die Tiere strömten unmittelbar beim Einlassen des Frischwassers an diesen Bereich, um wohl intensiv Sauerstoff aufzunehmen.
Nach diesem akuten Ersteinsatz wurden diese ausgewählten Bereiche über Monate hinweg in die Lage versetzt den Tieren in einer zugegeben prekären Lage bestmögliche Überlebensbedingungen zu verschaffen. Hier galt es darauf zu achten die sensiblen Zusammensetzungen der Gewässer nicht zu verändern um das Überleben der Tiere nicht zu gefährden.
Somit wurde also "nicht nur" Wasser eingefüllt, im Gegenteil, es fand ein begleitend umfangreiches Monitoring statt das diese Maßnahme in seiner komplexen Entwicklung beobachtete. Dabei konnten wertvolle Erkenntnisse gewonnen werden die uns in die Lage versetzen möglichen erneuten Projekteinsätze ähnlicher Art effektiv zu begegnen.
Die Aufnahme vom 30.04.2025 macht sichtbar was Feuersalamander von unserem Projekt halten ... mit dem Einsatz konnten wir den Tieren eine bessere Chance einräumen hier eine erfolgreiche Metamorphose hinzulegen ... während zahlreiche traditionelle Laichgewässer bereits vollständig ausgetrocknet sind, zeigen sich die von uns optimierten Bereiche als wasserführend und stabil ...
Artenschutz in Franken®
Steinschmätzer besiedeln neuen Steinhaufen

Steinschmätzer besiedeln neuen Steinhaufen
14/15.05.2025
Nordrhein - Westfalen. Ende des Jahres 2024 wurde der alte Steinhaufen auf der Königshovener Höhe zerstört ( hier haben wir darüber berichtet ). Ein Traktor oder Radlader fuhr in den Haufen und entwendete die Steine.
Nach unserer Forderung einen neuen Haufen aufzukippen, wurde nach einigen Wochen ein großer neuer Steinhaufen an anderer Stelle aufgekippt. Heute dann die große Überraschung.Kurz nach dem Aufkippen des Steinhaufen wurde er durch ein Vogelpaar angeflogen.
14/15.05.2025
Nordrhein - Westfalen. Ende des Jahres 2024 wurde der alte Steinhaufen auf der Königshovener Höhe zerstört ( hier haben wir darüber berichtet ). Ein Traktor oder Radlader fuhr in den Haufen und entwendete die Steine.
Nach unserer Forderung einen neuen Haufen aufzukippen, wurde nach einigen Wochen ein großer neuer Steinhaufen an anderer Stelle aufgekippt. Heute dann die große Überraschung.Kurz nach dem Aufkippen des Steinhaufen wurde er durch ein Vogelpaar angeflogen.
Ein Steinschmätzerpaar hat dort sein Revier und Reproduktionsstätte gefunden. Immer wieder ist zu Beobachten, wenn man den Tieren Lebensraum anbietet, wird dieser auch in der Regel angenommen. Hoffentlich kommt jetzt keiner auf die Idee, Steine für den Garten von dort mitzunehmen.
Vor allem bleibt der Haufen jetzt unter Beobachtung, damit die Nachhaltigkeit lange erhalten bleibt und der Haufen nicht verbuscht oder zerstört wird. Hoffen wir das bei erfolgreicher Jungenaufzucht die Vögel nicht von den Windrädern nebenan geschreddert werden!
Der Steinschmätzer ist mit einer der seltensten Vögel in NRW.
Quelle / Aufnahme
Gewässer und Naturschutz im Erftkreis
Flora-Fauna-Artenschutz
Naturschutzökologie
Rolf Thiemann
Naturschutzberater
Eisvogelweg 1
50181 Bedburg
In der Aufnahme
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung. Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Vor allem bleibt der Haufen jetzt unter Beobachtung, damit die Nachhaltigkeit lange erhalten bleibt und der Haufen nicht verbuscht oder zerstört wird. Hoffen wir das bei erfolgreicher Jungenaufzucht die Vögel nicht von den Windrädern nebenan geschreddert werden!
Der Steinschmätzer ist mit einer der seltensten Vögel in NRW.
Quelle / Aufnahme
Gewässer und Naturschutz im Erftkreis
Flora-Fauna-Artenschutz
Naturschutzökologie
Rolf Thiemann
Naturschutzberater
Eisvogelweg 1
50181 Bedburg
In der Aufnahme
- Steinschmätzer auf angebrachten Sekundärlebensraum
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung. Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Artenschutz in Franken®
Artenschutzprojekt Steigerwald Dohle & Co.

Artenschutzprojekt Steigerwald Dohle & Co.
13/14.05.2025
Ein innovatives Artenschutz-Umweltbildungsprojekt des Artenschutzes in Franken®, Turmstationen Deutschland e.V. und Katholische Kirchenstiftung Burgwindheim, das von der Deutschen Postcode Lotterie, Steuerkanzlei Bauerfeind und weiteren Projektpartnern unabhängig unterstützt wird.
Burgwindheim / Bayern. Selten sind sie geworden, kulturhistorische Bauwerke, in und an welchen sich typische Kulturfolger niederlassen. Ein solch interessantes Bauwerk stellt das Burgwindheimer Schloss und die naheliegende Pfarrkirche dar in der sich Dohlen, Mauersegler, Turmfalken, Fledermäuse und auch Weißstörche, seit teils vielen Jahren niedergelassen haben.
13/14.05.2025
Ein innovatives Artenschutz-Umweltbildungsprojekt des Artenschutzes in Franken®, Turmstationen Deutschland e.V. und Katholische Kirchenstiftung Burgwindheim, das von der Deutschen Postcode Lotterie, Steuerkanzlei Bauerfeind und weiteren Projektpartnern unabhängig unterstützt wird.
Burgwindheim / Bayern. Selten sind sie geworden, kulturhistorische Bauwerke, in und an welchen sich typische Kulturfolger niederlassen. Ein solch interessantes Bauwerk stellt das Burgwindheimer Schloss und die naheliegende Pfarrkirche dar in der sich Dohlen, Mauersegler, Turmfalken, Fledermäuse und auch Weißstörche, seit teils vielen Jahren niedergelassen haben.
Jedoch stellen diese Besiedlungen die Bauwerke sowie die Artenvielfalt vor Herausforderungen, welche die "moderne Zeit" einfach mit sich bringt und so haben wir uns gemeinsam aufgemacht aufzuzeigen, wie die Erhaltung der Artenvielfalt und der Bauwerke miteinander in Einklang zu bringen sind.
Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können zahlreiche Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
• Begleiten Sie uns bei der nicht alltäglichen Entwicklung eines Hotspots der Biodiversität hier auf unseren Seiten.
In dieser Aufnahme/Webcam
• In der Aufnahme einer unserer Webcams wird das erfreuliche Ergebnis unserer Bemühungen zur Erhaltung der Dohlenpopulation sichtbar ... 02.05.2025
Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können zahlreiche Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
• Begleiten Sie uns bei der nicht alltäglichen Entwicklung eines Hotspots der Biodiversität hier auf unseren Seiten.
In dieser Aufnahme/Webcam
• In der Aufnahme einer unserer Webcams wird das erfreuliche Ergebnis unserer Bemühungen zur Erhaltung der Dohlenpopulation sichtbar ... 02.05.2025
Artenschutz in Franken®
Die Nilgans (Alopochen aegyptiaca) ... auf Nistplatzsuche

Die Nilgans (Alopochen aegyptiaca) Eine anpassungsfähige Wasservogelart mit Vorliebe für ungewöhnliche Brutplätze
12/13.05.2025
Ursprünglich in Afrika südlich der Sahara und im Niltal beheimatet, hat sich diese Art in den letzten Jahrzehnten auch in Mitteleuropa, insbesondere in Deutschland, stark ausgebreitet. Ihr markantes Aussehen, ihr ausgeprägtes Revierverhalten und ihre ungewöhnlichen Brutstrategien machen sie zu einem spannenden Studienobjekt in der modernen Ornithologie.
12/13.05.2025
- Die Nilgans (Alopochen aegyptiaca) ist ein auffälliger und äußerst anpassungsfähiger Wasservogel aus der Familie der Entenvögel (Anatidae).
Ursprünglich in Afrika südlich der Sahara und im Niltal beheimatet, hat sich diese Art in den letzten Jahrzehnten auch in Mitteleuropa, insbesondere in Deutschland, stark ausgebreitet. Ihr markantes Aussehen, ihr ausgeprägtes Revierverhalten und ihre ungewöhnlichen Brutstrategien machen sie zu einem spannenden Studienobjekt in der modernen Ornithologie.
Aussehen und Merkmale
Die Nilgans ist leicht zu erkennen: Erwachsene Tiere sind etwa 63 bis 73 cm groß und wiegen bis zu 2,3 Kilogramm. Ihr Gefieder ist überwiegend hellbraun bis beigefarben mit auffälligen dunklen Flecken um die Augen, die wie eine Maske wirken. Auf den Flügeln tragen sie ein deutlich sichtbares weißes Flügelfeld und grünlich schimmernde Spiegel. Weibchen und Männchen sehen sich sehr ähnlich, allerdings sind die Männchen meist etwas größer und schwerer.
Lebensweise und Verhalten
Nilgänse sind tagaktiv, sehr territorial und monogam. Sie leben in dauerhaften Paarbindungen, wobei beide Elternteile die Aufzucht der Küken übernehmen. Sie bevorzugen offene Landschaften in der Nähe von Gewässern – Flüsse, Seen, Teiche oder Feuchtwiesen. In Städten haben sie sich jedoch erstaunlich gut angepasst und nutzen inzwischen auch urbane Strukturen als Lebensraum.
Brutverhalten und ungewöhnliche Nistplätze
Ein bemerkenswerter Aspekt der Nilgans ist ihr flexibles Brutverhalten. Ursprünglich in Uferregionen oder auf Bäumen brütend, sucht sie in Mitteleuropa zunehmend auch ungewöhnliche Nistplätze auf – darunter Dächer, Balkone, Kirchenvorsprünge und andere hochgelegene Bereiche von Gebäuden. Diese Bauwerke bieten Schutz vor Bodenräubern und erlauben einen weiten Überblick über das Revier. Die Gans legt meist 5 bis 10 Eier, die in einer mit Daunen ausgepolsterten Mulde abgelegt werden. Das Weibchen brütet rund 28 bis 30 Tage, während das Männchen das Umfeld bewacht.
Ein kurioser Moment im Leben vieler städtischer Nilgansküken ist der sogenannte „Sprung aus dem Nest“: Da viele Nester hoch oben auf Gebäuden angelegt werden, müssen die frisch geschlüpften Küken wenige Tage nach dem Schlüpfen den mutigen Sprung in die Tiefe wagen, um zum Wasser geführt zu werden. Dank ihres geringen Gewichts und ihres weichen Gefieders überstehen die meisten diesen Sprung unbeschadet – ein faszinierendes Beispiel für tierische Anpassungsfähigkeit.
Verbreitung und Bestand
Die Nilgans wurde im 18. Jahrhundert in England als Ziergeflügel eingeführt und ist später aus Gefangenschaft entwichen. Seit den 1980er Jahren breitet sie sich in Deutschland aus – zunächst am Niederrhein, später in ganz Nordrhein-Westfalen und mittlerweile in vielen Teilen Deutschlands. In vielen Regionen hat sie stabile Populationen aufgebaut. Aufgrund ihrer weiten Verbreitung gilt die Art heute in Deutschland nicht als gefährdet.
Konflikte mit Menschen und ökologischer Einfluss
Trotz ihrer Attraktivität als exotischer Vogel kommt es gelegentlich zu Nutzungskonflikten. Durch ihr aggressives Verhalten während der Brutzeit, besonders gegenüber anderen Wasservögeln, wird die Nilgans mitunter als störend empfunden. Auch auf landwirtschaftlichen Flächen kann sie Schaden anrichten, etwa durch Fraß an jungen Feldfrüchten. Dennoch wird ihr ökologischer Einfluss bisher als begrenzt eingestuft – langfristige Studien laufen noch.
Fazit
Die Nilgans ist ein Paradebeispiel für die erfolgreiche Anpassung einer Wildtierart an veränderte Lebensräume. Ihre Bereitschaft, auch auf städtischen Bauwerken zu brüten, zeigt nicht nur ihre Flexibilität, sondern verdeutlicht auch die zunehmende Verflechtung von Natur und urbanem Raum. Als auffälliger, lauter und selbstbewusster Vogel ist sie nicht nur eine biologische Besonderheit, sondern auch ein spannender Teil unserer modernen Kulturlandschaft.
In der Aufnahme
Die Nilgans ist leicht zu erkennen: Erwachsene Tiere sind etwa 63 bis 73 cm groß und wiegen bis zu 2,3 Kilogramm. Ihr Gefieder ist überwiegend hellbraun bis beigefarben mit auffälligen dunklen Flecken um die Augen, die wie eine Maske wirken. Auf den Flügeln tragen sie ein deutlich sichtbares weißes Flügelfeld und grünlich schimmernde Spiegel. Weibchen und Männchen sehen sich sehr ähnlich, allerdings sind die Männchen meist etwas größer und schwerer.
Lebensweise und Verhalten
Nilgänse sind tagaktiv, sehr territorial und monogam. Sie leben in dauerhaften Paarbindungen, wobei beide Elternteile die Aufzucht der Küken übernehmen. Sie bevorzugen offene Landschaften in der Nähe von Gewässern – Flüsse, Seen, Teiche oder Feuchtwiesen. In Städten haben sie sich jedoch erstaunlich gut angepasst und nutzen inzwischen auch urbane Strukturen als Lebensraum.
Brutverhalten und ungewöhnliche Nistplätze
Ein bemerkenswerter Aspekt der Nilgans ist ihr flexibles Brutverhalten. Ursprünglich in Uferregionen oder auf Bäumen brütend, sucht sie in Mitteleuropa zunehmend auch ungewöhnliche Nistplätze auf – darunter Dächer, Balkone, Kirchenvorsprünge und andere hochgelegene Bereiche von Gebäuden. Diese Bauwerke bieten Schutz vor Bodenräubern und erlauben einen weiten Überblick über das Revier. Die Gans legt meist 5 bis 10 Eier, die in einer mit Daunen ausgepolsterten Mulde abgelegt werden. Das Weibchen brütet rund 28 bis 30 Tage, während das Männchen das Umfeld bewacht.
Ein kurioser Moment im Leben vieler städtischer Nilgansküken ist der sogenannte „Sprung aus dem Nest“: Da viele Nester hoch oben auf Gebäuden angelegt werden, müssen die frisch geschlüpften Küken wenige Tage nach dem Schlüpfen den mutigen Sprung in die Tiefe wagen, um zum Wasser geführt zu werden. Dank ihres geringen Gewichts und ihres weichen Gefieders überstehen die meisten diesen Sprung unbeschadet – ein faszinierendes Beispiel für tierische Anpassungsfähigkeit.
Verbreitung und Bestand
Die Nilgans wurde im 18. Jahrhundert in England als Ziergeflügel eingeführt und ist später aus Gefangenschaft entwichen. Seit den 1980er Jahren breitet sie sich in Deutschland aus – zunächst am Niederrhein, später in ganz Nordrhein-Westfalen und mittlerweile in vielen Teilen Deutschlands. In vielen Regionen hat sie stabile Populationen aufgebaut. Aufgrund ihrer weiten Verbreitung gilt die Art heute in Deutschland nicht als gefährdet.
Konflikte mit Menschen und ökologischer Einfluss
Trotz ihrer Attraktivität als exotischer Vogel kommt es gelegentlich zu Nutzungskonflikten. Durch ihr aggressives Verhalten während der Brutzeit, besonders gegenüber anderen Wasservögeln, wird die Nilgans mitunter als störend empfunden. Auch auf landwirtschaftlichen Flächen kann sie Schaden anrichten, etwa durch Fraß an jungen Feldfrüchten. Dennoch wird ihr ökologischer Einfluss bisher als begrenzt eingestuft – langfristige Studien laufen noch.
Fazit
Die Nilgans ist ein Paradebeispiel für die erfolgreiche Anpassung einer Wildtierart an veränderte Lebensräume. Ihre Bereitschaft, auch auf städtischen Bauwerken zu brüten, zeigt nicht nur ihre Flexibilität, sondern verdeutlicht auch die zunehmende Verflechtung von Natur und urbanem Raum. Als auffälliger, lauter und selbstbewusster Vogel ist sie nicht nur eine biologische Besonderheit, sondern auch ein spannender Teil unserer modernen Kulturlandschaft.
In der Aufnahme
- Systematisch sucht ein Paar Nilgänse u.a. die Häuser eines kleinen Weilers ab um dann auf die Nisthilfe eines Turmfalken welche durch Artenschutz in Franken® vor über 10 Jahren angebracht wurde, zu treffen und die ersten Verdrängunsversuche zu starten.
Artenschutz in Franken®
Überlebensräume für Zauneidechse & Co. 2025

Überlebensräume für Zauneidechse & Co. 2025
10/11.05.2025
Die Gestaltung von Lebensräumen entlang von Flurwegen für Zauneidechsen erfordert ein innovatives und ganzheitliches Konzept, das sowohl die Bedürfnisse der Tiere als auch die Umweltbedingungen berücksichtigt.
10/11.05.2025
- Zauneidechsen besiedeln bereits nach 4 Monaten die Überlebensräume
Die Gestaltung von Lebensräumen entlang von Flurwegen für Zauneidechsen erfordert ein innovatives und ganzheitliches Konzept, das sowohl die Bedürfnisse der Tiere als auch die Umweltbedingungen berücksichtigt.
Hier sind einige wichtige Aspekte, die bei der Planung und Umsetzung berücksichtigt werden sollten:
Insgesamt bietet die innovative Gestaltung von Zauneidechsenlebensräumen entlang von Flurwegen eine Chance, städtische und ländliche Landschaften ökologisch aufzuwerten und gleichzeitig zur Erhaltung bedrohter Arten beizutragen. Durch sorgfältige Planung und Umsetzung können solche Projekte als Modell für nachhaltige Entwicklung und Biodiversitätserhaltung dienen.
In der Aufnahme
- Habitatstruktur und Vielfalt: Ein erfolgreicher Lebensraum für Zauneidechsen zeichnet sich durch eine Vielzahl von Strukturen aus, die verschiedene Lebensphasen der Tiere unterstützen. Dazu gehören sonnenexponierte Flächen, Vegetationszonen mit niedriger Vegetation für das Sonnenbaden, sowie Versteckmöglichkeiten wie Steinhaufen oder Holzstapel.
- Vernetzung und Korridore: Um die Mobilität und genetische Vielfalt der Populationen zu fördern, sollten Lebensräume entlang von Flurwegen durch grüne Korridore verbunden werden. Diese ermöglichen es den Zauneidechsen, sich sicher zwischen verschiedenen Lebensräumen zu bewegen.
- Berücksichtigung ökologischer Ansprüche: Es ist wichtig, die spezifischen ökologischen Bedürfnisse der Zauneidechsen zu kennen und in die Gestaltung einzubeziehen. Dazu gehören Aspekte wie Nahrungsvorkommen, Neststandorte und Winterquartiere.
- Nachhaltige Pflege und Management: Die langfristige Erhaltung des Lebensraums erfordert eine nachhaltige Pflege, die invasive Pflanzen kontrolliert, natürliche Sukzession zulässt und regelmäßige Untersuchungen der Populationen durchführt.
- Partizipative Planung und Bildung: Die Einbindung der lokalen Gemeinschaft in die Planung und Pflege der Lebensräume fördert nicht nur das Verständnis für die Bedeutung der Artenvielfalt, sondern auch die langfristige Unterstützung und den Schutz der Lebensräume.
Insgesamt bietet die innovative Gestaltung von Zauneidechsenlebensräumen entlang von Flurwegen eine Chance, städtische und ländliche Landschaften ökologisch aufzuwerten und gleichzeitig zur Erhaltung bedrohter Arten beizutragen. Durch sorgfältige Planung und Umsetzung können solche Projekte als Modell für nachhaltige Entwicklung und Biodiversitätserhaltung dienen.
In der Aufnahme
- Wie wichtig Projekte dieser Art sind belegt die Aufnahme vom 29.04.2025 ... ein Paar Zauneidechsen hat den bereitgestellten Überlebensraum angenommen!
Artenschutz in Franken®
Die Kohlschnake (Tipula oleracea)

Die Kohlschnake (Tipula oleracea) aus ihrer eigenen Perspektive
11/12.05.2025
Dieser Artikel bietet einen Einblick in unser Verhalten, unsere Lebensweise und unsere Bedeutung in der Natur.
11/12.05.2025
- Ich, die Kohlschnake (Tipula oleracea), eine faszinierende Kreatur der Ordnung Diptera und der Familie Tipulidae, habe das Vergnügen, mein Leben und meine Artgenossen aus meiner eigenen Perspektive zu beschreiben.
Dieser Artikel bietet einen Einblick in unser Verhalten, unsere Lebensweise und unsere Bedeutung in der Natur.
Beschreibung und Morphologie Als Kohlschnake bin ich eine große, zarte Fliege mit einem langen, dünnen Körper und langen Beinen. Meine Flügelspannweite kann bis zu fünf Zentimeter betragen, was es mir ermöglicht, leicht durch die Luft zu gleiten. Meine Augen sind groß und facettenreich, was mir eine ausgezeichnete Sicht auf meine Umgebung gibt. Meine Art ist bekannt für ihre braunen oder grauen Körper mit markanten Musterungen, die uns in der Natur gut tarnen.
Lebensraum und Verbreitung Wir Kohlschnaken sind in vielen Teilen der Welt verbreitet, besonders häufig jedoch in gemäßigten Klimazonen. Wir bevorzugen feuchte, offene Habitate wie Gärten, Wiesen und landwirtschaftliche Flächen. Dort finden wir reichlich Nahrung und ideale Bedingungen für die Fortpflanzung.
Ernährung und ökologische Rolle Als erwachsene Kohlschnake ernähre ich mich hauptsächlich von Nektar und anderen Pflanzensäften. Unsere Larven, bekannt als Engerlinge, spielen eine wichtige Rolle im Ökosystem, indem sie sich von verrottendem Pflanzenmaterial und Wurzeln ernähren. Dadurch tragen wir zur Bodenbelüftung und -verbesserung bei, was für das Pflanzenwachstum von Vorteil ist.
Fortpflanzung und Entwicklung Unsere Fortpflanzung erfolgt nach einem komplexen Ritual der Paarung, bei dem die Männchen oft im Schwarm um Weibchen buhlen. Nach der Paarung legen die Weibchen ihre Eier in feuchte Böden oder Gewässer ab, wo die Larven schlüpfen und sich entwickeln. Die Larven verbringen einen Großteil ihres Lebens unterirdisch, bevor sie sich zu erwachsenen Kohlschnaken verwandeln.
Interaktionen mit Menschen Obwohl wir Kohlschnaken aufgrund unserer Größe und Erscheinung oft fälschlicherweise mit Mücken verwechselt werden, sind wir für Menschen im Allgemeinen harmlos. Unsere Larven können jedoch in großen Populationen gelegentlich landwirtschaftliche Schäden verursachen, indem sie Wurzeln beschädigen.
Schlussfolgerung
Insgesamt sind wir Kohlschnaken eine faszinierende Spezies, die einen wichtigen Platz im ökologischen Gefüge einnimmt. Unser Leben ist geprägt von Anpassungsfähigkeit und unserer Rolle als Bestäuber und Zersetzer. Durch unsere Präsenz unterstützen wir die Gesundheit von Ökosystemen und tragen zur Vielfalt der Natur bei.
Diese Zusammenfassung aus der Perspektive einer Kohlschnake soll dazu beitragen, das Verständnis und die Wertschätzung für unsere Art zu fördern und die Komplexität unseres Lebenszyklus zu verdeutlichen.
In der Aufnahme von S. Bertelmann
Lebensraum und Verbreitung Wir Kohlschnaken sind in vielen Teilen der Welt verbreitet, besonders häufig jedoch in gemäßigten Klimazonen. Wir bevorzugen feuchte, offene Habitate wie Gärten, Wiesen und landwirtschaftliche Flächen. Dort finden wir reichlich Nahrung und ideale Bedingungen für die Fortpflanzung.
Ernährung und ökologische Rolle Als erwachsene Kohlschnake ernähre ich mich hauptsächlich von Nektar und anderen Pflanzensäften. Unsere Larven, bekannt als Engerlinge, spielen eine wichtige Rolle im Ökosystem, indem sie sich von verrottendem Pflanzenmaterial und Wurzeln ernähren. Dadurch tragen wir zur Bodenbelüftung und -verbesserung bei, was für das Pflanzenwachstum von Vorteil ist.
Fortpflanzung und Entwicklung Unsere Fortpflanzung erfolgt nach einem komplexen Ritual der Paarung, bei dem die Männchen oft im Schwarm um Weibchen buhlen. Nach der Paarung legen die Weibchen ihre Eier in feuchte Böden oder Gewässer ab, wo die Larven schlüpfen und sich entwickeln. Die Larven verbringen einen Großteil ihres Lebens unterirdisch, bevor sie sich zu erwachsenen Kohlschnaken verwandeln.
Interaktionen mit Menschen Obwohl wir Kohlschnaken aufgrund unserer Größe und Erscheinung oft fälschlicherweise mit Mücken verwechselt werden, sind wir für Menschen im Allgemeinen harmlos. Unsere Larven können jedoch in großen Populationen gelegentlich landwirtschaftliche Schäden verursachen, indem sie Wurzeln beschädigen.
Schlussfolgerung
Insgesamt sind wir Kohlschnaken eine faszinierende Spezies, die einen wichtigen Platz im ökologischen Gefüge einnimmt. Unser Leben ist geprägt von Anpassungsfähigkeit und unserer Rolle als Bestäuber und Zersetzer. Durch unsere Präsenz unterstützen wir die Gesundheit von Ökosystemen und tragen zur Vielfalt der Natur bei.
Diese Zusammenfassung aus der Perspektive einer Kohlschnake soll dazu beitragen, das Verständnis und die Wertschätzung für unsere Art zu fördern und die Komplexität unseres Lebenszyklus zu verdeutlichen.
In der Aufnahme von S. Bertelmann
- Frisch geschlüpfte Kohlschnake ... 30.04.2025
Artenschutz in Franken®
Der Mauersegler - Kindergarten im Steigerwald

Der Mauersegler - Kindergarten im Steigerwald - Mauerseglercams wieder online!
- 15 Jahre gemeinsames Engagement für eine gefährdete Zugvogelart.
11/12.05.2025
• Ein breit angelegtes Gemeinschaftsprojekt macht in bislang wohl in ganz Deutschland einmaliger Form innerhalb einer überregionalen Projektreihe auf zunehmende Lebensraumverluste sogenannter „Gebäudebrüter“ aufmerksam und setzt sichtbare Zeichen zur Sicherung fränkischer Biodiversität.
Gemeinsam im Sinne uns nachfolgender Generationen
Artenschutz in Franken®, der Kindergarten St. Sebastian und die Gemeinde Rauhenebrach sind die Partner dieses in die Zukunft gerichteten, innovativen Gemeinschaftsprojektes, das unabhängig voneinander durch die Bayernwerk AG, der Deutschen Postcode Lotterie, der Sparkasse Ostunterfranken, der Allianz Generalvertretung Basel Theinheim, der Pfarrgemeinde Untersteinbach / Prölsdorf, E.ON Bayern, der Allianz Umweltstiftung „der Blaue Adler“ und die Veolia Stiftung, sowie zahlreichen weiteren Projektpartnern nachhaltig unterstützt wurde und wird.
- 15 Jahre gemeinsames Engagement für eine gefährdete Zugvogelart.
11/12.05.2025
• Ein breit angelegtes Gemeinschaftsprojekt macht in bislang wohl in ganz Deutschland einmaliger Form innerhalb einer überregionalen Projektreihe auf zunehmende Lebensraumverluste sogenannter „Gebäudebrüter“ aufmerksam und setzt sichtbare Zeichen zur Sicherung fränkischer Biodiversität.
Gemeinsam im Sinne uns nachfolgender Generationen
Artenschutz in Franken®, der Kindergarten St. Sebastian und die Gemeinde Rauhenebrach sind die Partner dieses in die Zukunft gerichteten, innovativen Gemeinschaftsprojektes, das unabhängig voneinander durch die Bayernwerk AG, der Deutschen Postcode Lotterie, der Sparkasse Ostunterfranken, der Allianz Generalvertretung Basel Theinheim, der Pfarrgemeinde Untersteinbach / Prölsdorf, E.ON Bayern, der Allianz Umweltstiftung „der Blaue Adler“ und die Veolia Stiftung, sowie zahlreichen weiteren Projektpartnern nachhaltig unterstützt wurde und wird.
Bayern / Prölsdorf 02.06.2010 / 11.05.2025. Ein über 8 Jahre angesetztes Mauersegler – Monitoring war für die Initiative Artenschutz im Steigerwald Anlass sich höchst intensiv mit dem Mauerseglerschutz zu befassen. Das darin erfasste Ergebnis ließ uns alle sehr aufmerksam werden, zeigte diese Untersuchung eindeutig regional stark ausgeprägte Bestandsreduktionen auf.
Die „Langlebigkeit“ einer lediglich temporär in Franken präsenten Vogelart macht es dem Mauersegler und seinen Ansprüchen an den geforderten Lebensraum nicht einfacher. Besonders der Bestandsrückgang in vielen fränkischen Dörfern ließ aufhorchen, da sich im direkten Lebensumfeld (Nahrungsspektrum) kaum eine offensichtliche (Lebens) – Raumveränderung ergeben hat. Selbst strukturelle Biotopverbesserungen (Verbesserung des regionalen Nahrungsspektrums, durch Optimierungsmaßnahmen) ließen die Rückläufigkeit eindeutig erkennen.
Als Hauptursache des Bestandsrückgangs kristallisierten sich nach weitere Untersuchungsprozessen nachweislich, deutlich zunehmende Brutplatzverluste heraus, welche in erschreckendem Maße zunehmen. Vormals lediglich bereits meist auf Einzelbauwerke beschränkt, trugen und tragen zunehmend energetische Bausubstanzveränderungen mit zu diesem gravierenden Einbruch bei. Besonders (hochwertige) ältere Bauwerke, unter dessen Dächern sich der Mauersegler traditionell noch fortpflanzen durfte, sind von Bauwerksanierungen zunehmend betroffen.
Somit brechen vielfach letzte intakte Mauersegler - Brutplatzbiotopbindungen unwiederbringlich weg.
Das Ergebnis dieses Prozesses ist eine zunehmende Verarmung der kulturfolgenden Spezies, welche sich seit Jahrhunderten auf den „Lebensraum menschliches Umfeld“ einstellen mussten. Ohne effektive Projektreihen werden wir wohl in wenigen Jahrzehnten auch den spektakulären Mauersegler in vielen fränkischen Dörfern als Brutvogel verloren haben. Einer Vogelart, die wie kaum eine Zweite für eine „Grenzenlose Biotopverbindung“ im Sinne einer sich mehr und mehr „zusammenrückenden“ Welt – Global Player - steht. Mauersegler verbringen rund 90 % ihres Lebens im Flug. Hier wird getrunken, Nahrung zu sich genommen und vielfach auch geschlafen! Lediglich die Fortpflanzung muss „auf festem Untergrund“ stattfinden. Fast pünktlich am 1. Mai finden sich die pfeilschnellen Segler bei uns in Mitteleuropa ein, um die angestammten Nistbereiche zu besiedeln. Was aber wenn diese zwischenzeitlich „wegsaniert“ wurden? Oder noch bedenklicher, wenn Sanierungsarbeiten dann einsetzen, wenn die Reproduktion bereits begonnen wurde!
Ganze Mauerseglergenerationen verlieren hierbei zu Tausenden ihr Leben!
Hier nun setzt ein im Jahre 2009 ins Leben gerufenes, auf breitem Fundament gegründetes Gemeinschaftsprojekt an. 60 Projektpartner leisten an dreißig Einzelstandorten die über ganz Franken verteilt sind Immenses zur Sicherung fränkischer Biodiversität. Ziel des Maßnahmenpakets soll die enge Verbindung eines innovativen Artenschutzes, einer konkret erlebbaren Umweltbildung, sowie der Darstellung des sich im Einklang mit dem Artenschutz verbindenden Denkmalsschutzes darstellen. Uns gemeinsam ist die Erhaltung sogenannter „Mauersegler Mutterkolonien“ also die Bestandssicherung langjährig bestehender Grundkolonien genauso wertvoll wie das Zurückerschließen vormals bestätigter, jedoch infolge baulicher Gegebenheiten verloren gegangener Bereiche. Seit über 10 Jahren bringt sich Artenschutz in Franken unter anderen für den Mauersegler und dessen Erhaltung ein. Trotz aller höchst erfreulichen Ergebnisreihen kann das Geleistete jedoch bislang lediglich der berühmte Tropfen auf dem heißen Stein sein. Nun folgt durch das hier generierte Maßnahmenpaket eine flächige Spiegelung auf große Bereiche unserer Heimat. Damit kann und wird es gelingen, eine Biotopvernetzung zu erzielen. Des Weiteren kann die Projektvorstellung dazu dienen auch anderen Projektgruppen Anreize anzubieten sich dem Projekt anzuschließen. Wenn nur in jedem größeren Ort unserer Heimat ein Bauwerk mit diesem Vorgehensmuster erfasst würde, ließe sich mit geringem Aufwand eine effektive Bestandssicherung für sogenannte Gebäudebrüter erreichen.
„Zurück zu den Wurzeln“
Welches Gebäude bietet sich für die „Turmschwalbe“, wie der Mauersegler im Volksmund auch genannt wird, besser für diesen Zweck an, als der Kirchturm fränkischer Gotteshäuser, oder auch hohe Gebäudestrukturen an z. B. markanten Bauwerken wie Schlösser, Burgen und anderen prägenden „Kunstfelsen“. Vormals (über Jahrhunderte hinweg) bereits primärer Fortpflanzungsort, möchten wir den Mauerseglern diesen Lebensraum zurück erschließen? Durchdacht, unauffällig z. B. in den Schalllamellen der Kirchtürme angebracht, können spezielle, höchst bewährte Nistmodule als sogenannte Sekundärlebensräume, hier zukünftig einen effektiven Ausgleich zu erfolgten Brutplatzverlusten schaffen. Ebenfalls zeigen diese Maßnahmen auf, und das ist mindestens ebenso wichtig, wie es gelingen kann, im Zuge von Sanierungsmaßnahmen Lebensraumkompensation zu betreiben, ohne dass Einschränkungen für das Bauwerk erfolgen. Die uns nachfolgende Generation verliert zunehmend den immens wichtigen Kontakt, zu der sie umgebenden Umwelt, und damit das Wissen über den Anspruch unserer Mitgeschöpfe an ihren (unseren) Lebensraum. So soll das (Leuchtturm) - Projekt, „Fränkische (Kirch) - Türme für die Turmschwalbe“ auch Wegweiser sein, dieses Defizit (nur was wir kennen, erachten wir auch zu schützen) in den Köpfen unserer Kinder nachhaltig zu vermindern.
Neben zahlreichen Informationsveranstaltungen vor Ort (in Schulen / Kindergärten) ist an den Einsatz modernster Technologie gedacht. Unsere Schüler wachsen mit Computer, Laptop und Internet auf. Für sie sind diese Werkzeuge Bestandteil des täglichen Lebens. Wir möchten die Chance nutzen, den Artenschutz- und die Umweltbildung über diesen Weg an die Kinder / Schüler heranzuführen. In Kooperation mit Schulen und Kindergärten wollen wir diesen wichtigen Weg beschreiten. Spezielle Kameras, installiert in einigen Nistmodulen werden es Schülern / Kindergartenkindern uvm. zukünftig ermöglichen, das interessante (verborgene) Leben (Aufzucht der Jungvögel / Verhaltensmuster) und somit den konkreten Kontakt „zu ihren Lebensformen“, die als sogenannte Gebäudebrüter eine Leitartfunktion für weitere auf Gebäude geprägte Spezies z. B. (z.B. verschiedene Fledermausarten) erfüllen, live in Schulprojekten (Facharbeiten / Tagebüchern usw.) zu erleben. Und das alles störungsfrei für die Tiere. Darüber hinaus senden wir diese Daten, auch per Livestream ist Internet. Damit möchten wir es erreichen z. B. (über)-regionale Schulen in diese Maßnahme einzubinden! Wie anspruchsvoll die Maßnahme ist, zeigt sich in einigen nüchternen Zahlen. 2.500 Stunden ehrenamtlicher Tätigkeit sind in 60 Einzelprojekte und deren Entwicklung geflossen. 150 Stunden Umweltbildungsarbeit wurden bislang getätigt. 4 Webcams geschaltet. 4 eigens für dieses Projektreihe kreierte Informationstafeln gestaltet. 20 Bäume werden gepflanzt (das Pflanzmaterial wurde von der Fa. Fielmann „Brille“ beigesteuert). Die Gestaltung von 4 Internetplattformen ist ebenfalls Bestandteil dieses Tätigkeitsfeldes, dessen Monitoring auf 10 Jahre angesetzt ist.
„Menschenkinder für Vogelkinder"
Am Projekt Kindergarten Prölsdorf waren neben der Organisation Artenschutz im Steigerwald und dem Landesbund für Vogelschutz, der Caritas Kindergarten St. Sebastian, die politische Gemeinde Rauhenebrach, die Sparkasse Ostunterfranken, die Allianz Generalvertretung Basel Theinheim, die Pfarrgemeinde Untersteinbach / Prölsdorf, E.ON Bayern, die Allianz Umweltstiftung „der Blaue Adler“ und die Veolia Stiftung beteiligt.
Die Auswahl viel nicht ohne Grund auf den Prölsdorfer Kindergarten.
Seit Mai 2004 befindet sich das Gebäude wie weitere 134 Bauwerke in Franken im A.i.S-MonitorringMonitoring. Der Prölsdorfer Kindergarten erfüllt fast schon auf den ersten Blick die Vorgaben zum erfolgreichen Mauerseglerreproduktionsort. Neben einer markanten Sandsteinfassade, die dem natürlichen Nistplatz Suchspektrum des Mauerseglers weit entgegenkommt, verfügt es über eine entsprechende Bauwerkshöhe, sowie über einen freien Anflug zur Traufe. Das mehr oder minder naturbelassene Rauhe Ebrachtal verfügt mit dem nahe liegenden Steigerwald über ein Nahrungsspektrum das auch und gerade dieser spektakulären Vogelart sehr entgegenkommt. Mit Installation der speziell auf das Bauwerk und die anzusprechende Vogelart zugeschnittenen Modulnisthilfe möchten wir es gemeinsam erreichen dem Artenschwund in Franken Paroli zu bieten. Das Nistmodul mit seinen 5 darin integrierten Einzelnistplätzen kann den Mauersegleroutput in Zukunft deutlich steigern. Damit trägt es direkt zur Stabilisation der Mauerseglerpopulation in Prölsdorf bei. Ein sich anschließendes Monitoring das über ein Zeitfenster von 8 Jahren angedacht ist und mit dem Kindergarten und seinen „wechselnden Bewohnern“ im engen Prozess erfolgen wird, soll zukünftig Aufschluss über den Er- oder Misserfolg dieser Projektreihe geben.
Für die Kinder soll das Projekt weit mehr sein als nur ein „Vogelprojekt“. Die Auswahl auf den Mauersegler und dessen Zugverhalten soll pädagogisch wertvolle Dienste leisten. Die Vorfreude auf die nahende Ankunft des Tieres (die Jahreszeiten werden verstärkt wahrgenommen) dessen Präsenz zeitlich sehr gut eingegrenzt werden kann (Ankunft 27. April bis 03. Mai p.a.), seine zeitlich begrenzte Anwesenheit und im besten Fall das Erleben des Reproduktionserfolgs (Jungvögel), jedoch auch der Wegzug der Vögel und damit die Ankündigung des nahenden Herbstes prägen sich in die Köpfe der Kinder. Weit mehr versprechen wir uns jedoch davon, dass die Jüngsten im Elternhaus das Erlebte besprechen und diskutieren. Erlebbare Umweltbildung vor der eigenen Haustür wird sicherlich verstärkt dazu beitragen das sich der Artenschutz in den Dörfern unserer Region mehr und mehr manifestiert. Nur das was wir und unsere Kinder und Enkelkinder kennen werden wir gemeinsam auch schützen! Die Installation der Mauerseglercam ermöglicht es die Entwicklung der Vögel für Kinder und Erwachsene sichtbar zu machen ohne die Tiere und deren Nachwuchs in irgendeiner Form zu beeinträchtigen.
Somit ist das Projekt „Türme für die fränkische Turmschwalbe 2010“ weit mehr als „nur“ ein Vogelschutzprojekt wie viele andere. Nein es vermag weit mehr zu leisten – möchte es doch pädagogische Umweltbildung, erlebbaren Artenschutz in Franken sowie innovativem Bautenschutz in Verbindung zu bringen. Gerade im energetischen Zeitalter kann das Aufzeigen sichtbarer Lösungskomponenten einen zielführenden Beitrag zur Erhaltung bundesdeutscher Biodiversität zu leisten.
MIt der Installation spezieller Mauersegler Webcams ist möglich störungsfreie Einblicke in die "Kinderstuben der Mauersegler" zu erhalten:
In der Aufnahme
• Einblicke in eine der Mauerseglernisthilfen - Eindrucksvolle Erlebnisse hier auf den Seiten des Artenschutz in Franken®
Die „Langlebigkeit“ einer lediglich temporär in Franken präsenten Vogelart macht es dem Mauersegler und seinen Ansprüchen an den geforderten Lebensraum nicht einfacher. Besonders der Bestandsrückgang in vielen fränkischen Dörfern ließ aufhorchen, da sich im direkten Lebensumfeld (Nahrungsspektrum) kaum eine offensichtliche (Lebens) – Raumveränderung ergeben hat. Selbst strukturelle Biotopverbesserungen (Verbesserung des regionalen Nahrungsspektrums, durch Optimierungsmaßnahmen) ließen die Rückläufigkeit eindeutig erkennen.
Als Hauptursache des Bestandsrückgangs kristallisierten sich nach weitere Untersuchungsprozessen nachweislich, deutlich zunehmende Brutplatzverluste heraus, welche in erschreckendem Maße zunehmen. Vormals lediglich bereits meist auf Einzelbauwerke beschränkt, trugen und tragen zunehmend energetische Bausubstanzveränderungen mit zu diesem gravierenden Einbruch bei. Besonders (hochwertige) ältere Bauwerke, unter dessen Dächern sich der Mauersegler traditionell noch fortpflanzen durfte, sind von Bauwerksanierungen zunehmend betroffen.
Somit brechen vielfach letzte intakte Mauersegler - Brutplatzbiotopbindungen unwiederbringlich weg.
Das Ergebnis dieses Prozesses ist eine zunehmende Verarmung der kulturfolgenden Spezies, welche sich seit Jahrhunderten auf den „Lebensraum menschliches Umfeld“ einstellen mussten. Ohne effektive Projektreihen werden wir wohl in wenigen Jahrzehnten auch den spektakulären Mauersegler in vielen fränkischen Dörfern als Brutvogel verloren haben. Einer Vogelart, die wie kaum eine Zweite für eine „Grenzenlose Biotopverbindung“ im Sinne einer sich mehr und mehr „zusammenrückenden“ Welt – Global Player - steht. Mauersegler verbringen rund 90 % ihres Lebens im Flug. Hier wird getrunken, Nahrung zu sich genommen und vielfach auch geschlafen! Lediglich die Fortpflanzung muss „auf festem Untergrund“ stattfinden. Fast pünktlich am 1. Mai finden sich die pfeilschnellen Segler bei uns in Mitteleuropa ein, um die angestammten Nistbereiche zu besiedeln. Was aber wenn diese zwischenzeitlich „wegsaniert“ wurden? Oder noch bedenklicher, wenn Sanierungsarbeiten dann einsetzen, wenn die Reproduktion bereits begonnen wurde!
Ganze Mauerseglergenerationen verlieren hierbei zu Tausenden ihr Leben!
Hier nun setzt ein im Jahre 2009 ins Leben gerufenes, auf breitem Fundament gegründetes Gemeinschaftsprojekt an. 60 Projektpartner leisten an dreißig Einzelstandorten die über ganz Franken verteilt sind Immenses zur Sicherung fränkischer Biodiversität. Ziel des Maßnahmenpakets soll die enge Verbindung eines innovativen Artenschutzes, einer konkret erlebbaren Umweltbildung, sowie der Darstellung des sich im Einklang mit dem Artenschutz verbindenden Denkmalsschutzes darstellen. Uns gemeinsam ist die Erhaltung sogenannter „Mauersegler Mutterkolonien“ also die Bestandssicherung langjährig bestehender Grundkolonien genauso wertvoll wie das Zurückerschließen vormals bestätigter, jedoch infolge baulicher Gegebenheiten verloren gegangener Bereiche. Seit über 10 Jahren bringt sich Artenschutz in Franken unter anderen für den Mauersegler und dessen Erhaltung ein. Trotz aller höchst erfreulichen Ergebnisreihen kann das Geleistete jedoch bislang lediglich der berühmte Tropfen auf dem heißen Stein sein. Nun folgt durch das hier generierte Maßnahmenpaket eine flächige Spiegelung auf große Bereiche unserer Heimat. Damit kann und wird es gelingen, eine Biotopvernetzung zu erzielen. Des Weiteren kann die Projektvorstellung dazu dienen auch anderen Projektgruppen Anreize anzubieten sich dem Projekt anzuschließen. Wenn nur in jedem größeren Ort unserer Heimat ein Bauwerk mit diesem Vorgehensmuster erfasst würde, ließe sich mit geringem Aufwand eine effektive Bestandssicherung für sogenannte Gebäudebrüter erreichen.
„Zurück zu den Wurzeln“
Welches Gebäude bietet sich für die „Turmschwalbe“, wie der Mauersegler im Volksmund auch genannt wird, besser für diesen Zweck an, als der Kirchturm fränkischer Gotteshäuser, oder auch hohe Gebäudestrukturen an z. B. markanten Bauwerken wie Schlösser, Burgen und anderen prägenden „Kunstfelsen“. Vormals (über Jahrhunderte hinweg) bereits primärer Fortpflanzungsort, möchten wir den Mauerseglern diesen Lebensraum zurück erschließen? Durchdacht, unauffällig z. B. in den Schalllamellen der Kirchtürme angebracht, können spezielle, höchst bewährte Nistmodule als sogenannte Sekundärlebensräume, hier zukünftig einen effektiven Ausgleich zu erfolgten Brutplatzverlusten schaffen. Ebenfalls zeigen diese Maßnahmen auf, und das ist mindestens ebenso wichtig, wie es gelingen kann, im Zuge von Sanierungsmaßnahmen Lebensraumkompensation zu betreiben, ohne dass Einschränkungen für das Bauwerk erfolgen. Die uns nachfolgende Generation verliert zunehmend den immens wichtigen Kontakt, zu der sie umgebenden Umwelt, und damit das Wissen über den Anspruch unserer Mitgeschöpfe an ihren (unseren) Lebensraum. So soll das (Leuchtturm) - Projekt, „Fränkische (Kirch) - Türme für die Turmschwalbe“ auch Wegweiser sein, dieses Defizit (nur was wir kennen, erachten wir auch zu schützen) in den Köpfen unserer Kinder nachhaltig zu vermindern.
Neben zahlreichen Informationsveranstaltungen vor Ort (in Schulen / Kindergärten) ist an den Einsatz modernster Technologie gedacht. Unsere Schüler wachsen mit Computer, Laptop und Internet auf. Für sie sind diese Werkzeuge Bestandteil des täglichen Lebens. Wir möchten die Chance nutzen, den Artenschutz- und die Umweltbildung über diesen Weg an die Kinder / Schüler heranzuführen. In Kooperation mit Schulen und Kindergärten wollen wir diesen wichtigen Weg beschreiten. Spezielle Kameras, installiert in einigen Nistmodulen werden es Schülern / Kindergartenkindern uvm. zukünftig ermöglichen, das interessante (verborgene) Leben (Aufzucht der Jungvögel / Verhaltensmuster) und somit den konkreten Kontakt „zu ihren Lebensformen“, die als sogenannte Gebäudebrüter eine Leitartfunktion für weitere auf Gebäude geprägte Spezies z. B. (z.B. verschiedene Fledermausarten) erfüllen, live in Schulprojekten (Facharbeiten / Tagebüchern usw.) zu erleben. Und das alles störungsfrei für die Tiere. Darüber hinaus senden wir diese Daten, auch per Livestream ist Internet. Damit möchten wir es erreichen z. B. (über)-regionale Schulen in diese Maßnahme einzubinden! Wie anspruchsvoll die Maßnahme ist, zeigt sich in einigen nüchternen Zahlen. 2.500 Stunden ehrenamtlicher Tätigkeit sind in 60 Einzelprojekte und deren Entwicklung geflossen. 150 Stunden Umweltbildungsarbeit wurden bislang getätigt. 4 Webcams geschaltet. 4 eigens für dieses Projektreihe kreierte Informationstafeln gestaltet. 20 Bäume werden gepflanzt (das Pflanzmaterial wurde von der Fa. Fielmann „Brille“ beigesteuert). Die Gestaltung von 4 Internetplattformen ist ebenfalls Bestandteil dieses Tätigkeitsfeldes, dessen Monitoring auf 10 Jahre angesetzt ist.
„Menschenkinder für Vogelkinder"
Am Projekt Kindergarten Prölsdorf waren neben der Organisation Artenschutz im Steigerwald und dem Landesbund für Vogelschutz, der Caritas Kindergarten St. Sebastian, die politische Gemeinde Rauhenebrach, die Sparkasse Ostunterfranken, die Allianz Generalvertretung Basel Theinheim, die Pfarrgemeinde Untersteinbach / Prölsdorf, E.ON Bayern, die Allianz Umweltstiftung „der Blaue Adler“ und die Veolia Stiftung beteiligt.
Die Auswahl viel nicht ohne Grund auf den Prölsdorfer Kindergarten.
Seit Mai 2004 befindet sich das Gebäude wie weitere 134 Bauwerke in Franken im A.i.S-MonitorringMonitoring. Der Prölsdorfer Kindergarten erfüllt fast schon auf den ersten Blick die Vorgaben zum erfolgreichen Mauerseglerreproduktionsort. Neben einer markanten Sandsteinfassade, die dem natürlichen Nistplatz Suchspektrum des Mauerseglers weit entgegenkommt, verfügt es über eine entsprechende Bauwerkshöhe, sowie über einen freien Anflug zur Traufe. Das mehr oder minder naturbelassene Rauhe Ebrachtal verfügt mit dem nahe liegenden Steigerwald über ein Nahrungsspektrum das auch und gerade dieser spektakulären Vogelart sehr entgegenkommt. Mit Installation der speziell auf das Bauwerk und die anzusprechende Vogelart zugeschnittenen Modulnisthilfe möchten wir es gemeinsam erreichen dem Artenschwund in Franken Paroli zu bieten. Das Nistmodul mit seinen 5 darin integrierten Einzelnistplätzen kann den Mauersegleroutput in Zukunft deutlich steigern. Damit trägt es direkt zur Stabilisation der Mauerseglerpopulation in Prölsdorf bei. Ein sich anschließendes Monitoring das über ein Zeitfenster von 8 Jahren angedacht ist und mit dem Kindergarten und seinen „wechselnden Bewohnern“ im engen Prozess erfolgen wird, soll zukünftig Aufschluss über den Er- oder Misserfolg dieser Projektreihe geben.
Für die Kinder soll das Projekt weit mehr sein als nur ein „Vogelprojekt“. Die Auswahl auf den Mauersegler und dessen Zugverhalten soll pädagogisch wertvolle Dienste leisten. Die Vorfreude auf die nahende Ankunft des Tieres (die Jahreszeiten werden verstärkt wahrgenommen) dessen Präsenz zeitlich sehr gut eingegrenzt werden kann (Ankunft 27. April bis 03. Mai p.a.), seine zeitlich begrenzte Anwesenheit und im besten Fall das Erleben des Reproduktionserfolgs (Jungvögel), jedoch auch der Wegzug der Vögel und damit die Ankündigung des nahenden Herbstes prägen sich in die Köpfe der Kinder. Weit mehr versprechen wir uns jedoch davon, dass die Jüngsten im Elternhaus das Erlebte besprechen und diskutieren. Erlebbare Umweltbildung vor der eigenen Haustür wird sicherlich verstärkt dazu beitragen das sich der Artenschutz in den Dörfern unserer Region mehr und mehr manifestiert. Nur das was wir und unsere Kinder und Enkelkinder kennen werden wir gemeinsam auch schützen! Die Installation der Mauerseglercam ermöglicht es die Entwicklung der Vögel für Kinder und Erwachsene sichtbar zu machen ohne die Tiere und deren Nachwuchs in irgendeiner Form zu beeinträchtigen.
Somit ist das Projekt „Türme für die fränkische Turmschwalbe 2010“ weit mehr als „nur“ ein Vogelschutzprojekt wie viele andere. Nein es vermag weit mehr zu leisten – möchte es doch pädagogische Umweltbildung, erlebbaren Artenschutz in Franken sowie innovativem Bautenschutz in Verbindung zu bringen. Gerade im energetischen Zeitalter kann das Aufzeigen sichtbarer Lösungskomponenten einen zielführenden Beitrag zur Erhaltung bundesdeutscher Biodiversität zu leisten.
MIt der Installation spezieller Mauersegler Webcams ist möglich störungsfreie Einblicke in die "Kinderstuben der Mauersegler" zu erhalten:
In der Aufnahme
• Einblicke in eine der Mauerseglernisthilfen - Eindrucksvolle Erlebnisse hier auf den Seiten des Artenschutz in Franken®
Artenschutz in Franken®
Naturtreff Bedburg hat 2025 sein Projekt „ Igeltot im Straßenverkehr “ gestartet.

Das stille Verschwinden des Europäischen Braunbrustigels – Ein Überlebenskampf im Schatten unserer Zivilisation
09/10.05.2025
Heute aber steht dieser kleine Insektenfresser symbolisch für das große Artensterben vor unserer Haustür. Der Igel ist in vielen Teilen Europas stark gefährdet – und das nicht etwa durch Raubtiere oder natürliche Feinde, sondern durch den Menschen und seine moderne Lebensweise.
09/10.05.2025
- Er war einst ein vertrauter Besucher in unseren Gärten, sein nächtliches Schnaufen gehörte zum Klang der Dämmerung: der Europäische Braunbrustigel (Erinaceus europaeus).
Heute aber steht dieser kleine Insektenfresser symbolisch für das große Artensterben vor unserer Haustür. Der Igel ist in vielen Teilen Europas stark gefährdet – und das nicht etwa durch Raubtiere oder natürliche Feinde, sondern durch den Menschen und seine moderne Lebensweise.
Zerschlagene Lebensräume
Das Hauptproblem ist der dramatische Verlust geeigneter Lebensräume. Früher fand der Igel in extensiv genutzten Wiesen, Heckenlandschaften und naturnahen Gärten ideale Bedingungen vor: Schutz, Nahrung, Nistplätze. Heute aber sind diese Rückzugsräume zerschnitten, versiegelt oder verschwunden. Großflächige Bebauung, sterile Gärten mit Kies und Rasenrobotern sowie der Verlust von Hecken und Unterholz verdrängen den Igel zunehmend. Wo früher wilde Ecken als Verstecke dienten, herrscht heute aufgeräumte Ordnung – tödliche Ordnung.
Tödlicher Verkehr
Besonders fatal ist der Straßenverkehr. Der Igel ist dämmerungs- und nachtaktiv, langsam und bei Gefahr bleibt er stehen – ein Verhalten, das ihm an Straßen zum Verhängnis wird. Jährlich fallen in Deutschland schätzungsweise Hunderttausende Igel dem Straßenverkehr zum Opfer. Verkehrsreiche Gebiete wirken wie Barrieren in der Landschaft, zersplittern die Populationen und verhindern den genetischen Austausch. Die Folge: Inzucht, Krankheitsanfälligkeit und langfristig das Ausbluten der lokalen Bestände.
Nahrungsmangel in der Nacht
Der moderne Lebensstil wirkt sich auch auf die Ernährung des Igels verheerend aus. Durch den Rückgang von Insekten – verursacht durch Pestizide, Monokulturen und Flächenversiegelung – findet der Igel oft nicht mehr genug Nahrung. Käfer, Raupen, Regenwürmer oder Schnecken: Sie werden rar in überdüngten, aufgeräumten und pestizidbehandelten Umgebungen. Der Igel hungert in einer Landschaft, die zwar grün erscheint, aber ökologisch leer ist.
Klimawandel und falsche Hilfe
Auch der Klimawandel bringt neue Probleme: Mildere Winter führen dazu, dass Igel aus dem Winterschlaf zu früh oder mehrmals erwachen – in einer Zeit, in der es noch keine Nahrung gibt. Zudem werden viele Igel unnötig „gerettet“ und in Auffangstationen gebracht, obwohl sie keine Hilfe benötigen. Gut gemeint, doch oft schlecht informiert – auch das kann Stress und Krankheit verursachen.
Ein stiller Rückzug
Der Europäische Braunbrustigel leidet nicht an einem einzigen Feind. Es ist das Zusammenspiel aus Verlust von Lebensraum, Nahrungsknappheit, Verkehrstod und klimatischen Veränderungen, das ihn an den Rand seiner Existenz drängt. Der einst so häufige Kulturfolger zieht sich zurück – leise, unspektakulär, aber unumkehrbar, wenn kein Umdenken erfolgt.
Was jetzt zählt
Wenn der Igel überleben soll, braucht es nicht nur Naturschutzgebiete, sondern artenfreundliche Gärten, vernetzte Grünflächen, verkehrsberuhigte Zonen und eine naturnahe Landwirtschaft. Jeder Gartenbesitzer kann helfen – mit einem Laubhaufen, einem Durchschlupf im Zaun und dem Verzicht auf Gifte. Denn der Igel ist nicht nur ein Sympathieträger – er ist ein Indikator für die Gesundheit unserer Umwelt.
Sein Überleben ist ein Test – einer, den unsere Gesellschaft bislang nicht besteht.
Artenschutz in Franken®
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naturtreff Bedburg hat 2025 sein Projekt „ Igeltot im Straßenverkehr “ gestartet
„ Igeltot im Straßenverkehr “
Der Naturtreff Bedburg hat 2025 sein Projekt „ Igeltot im Straßenverkehr “ gestartet.
Unseren Igeln geht es zur Zeit sehr schlecht! Nahrungs- und Biotopsverluste haben enorm zugenommen. In den letzten Jahren sind viele Hausgärten und Blühwiesen verschwunden. In unserer heutigen Stadtplanung mit Bodenversiegelungen und aufgeräumter Landschaft, hat es nicht nur der Igel schwer.
Lückenlose Zäune und hohe Straßenbortsteine machen es dem Stachelritter nicht gerade leicht. Hinzu kommen noch die Rasenmähroboter und etliche Innen- und Außen- Parasiten , die eine ernste Gefahr für die Tiere werden können.
Das Überqueren der Straßen bei Dunkelheit bedeutet fast immer den Tod der Tiere, da sie nicht vor der Gefahr eines KFZ fliehen, sondern sich auf ihre Abwehr durch die Stacheln verlassen und sich zur Kugel einrollen und an Ort und Stelle liegen bleiben.
Unsere braunbrüstigen Igel fressen Insekten, Würmer, Schnecken und kleine Wirbeltiere. In der Natur wird der Igel etwa 3 bis 7 Jahre alt.
Um einen Überblick von überfahrenen Igeln zu bekommen, bittet der Naturtreff Bedburg um Meldung, wo und wann Igel im Stadtgebiet gefunden wurden.
Quelle
Gewässer und Naturschutz im Erftkreis
Flora-Fauna-Artenschutz
Naturschutzökologie
Rolf Thiemann
Naturschutzberater
Eisvogelweg 1
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung. Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
In der Aufnahme / Collage von Achim Schumacher und Rolf Thiemann
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Das Hauptproblem ist der dramatische Verlust geeigneter Lebensräume. Früher fand der Igel in extensiv genutzten Wiesen, Heckenlandschaften und naturnahen Gärten ideale Bedingungen vor: Schutz, Nahrung, Nistplätze. Heute aber sind diese Rückzugsräume zerschnitten, versiegelt oder verschwunden. Großflächige Bebauung, sterile Gärten mit Kies und Rasenrobotern sowie der Verlust von Hecken und Unterholz verdrängen den Igel zunehmend. Wo früher wilde Ecken als Verstecke dienten, herrscht heute aufgeräumte Ordnung – tödliche Ordnung.
Tödlicher Verkehr
Besonders fatal ist der Straßenverkehr. Der Igel ist dämmerungs- und nachtaktiv, langsam und bei Gefahr bleibt er stehen – ein Verhalten, das ihm an Straßen zum Verhängnis wird. Jährlich fallen in Deutschland schätzungsweise Hunderttausende Igel dem Straßenverkehr zum Opfer. Verkehrsreiche Gebiete wirken wie Barrieren in der Landschaft, zersplittern die Populationen und verhindern den genetischen Austausch. Die Folge: Inzucht, Krankheitsanfälligkeit und langfristig das Ausbluten der lokalen Bestände.
Nahrungsmangel in der Nacht
Der moderne Lebensstil wirkt sich auch auf die Ernährung des Igels verheerend aus. Durch den Rückgang von Insekten – verursacht durch Pestizide, Monokulturen und Flächenversiegelung – findet der Igel oft nicht mehr genug Nahrung. Käfer, Raupen, Regenwürmer oder Schnecken: Sie werden rar in überdüngten, aufgeräumten und pestizidbehandelten Umgebungen. Der Igel hungert in einer Landschaft, die zwar grün erscheint, aber ökologisch leer ist.
Klimawandel und falsche Hilfe
Auch der Klimawandel bringt neue Probleme: Mildere Winter führen dazu, dass Igel aus dem Winterschlaf zu früh oder mehrmals erwachen – in einer Zeit, in der es noch keine Nahrung gibt. Zudem werden viele Igel unnötig „gerettet“ und in Auffangstationen gebracht, obwohl sie keine Hilfe benötigen. Gut gemeint, doch oft schlecht informiert – auch das kann Stress und Krankheit verursachen.
Ein stiller Rückzug
Der Europäische Braunbrustigel leidet nicht an einem einzigen Feind. Es ist das Zusammenspiel aus Verlust von Lebensraum, Nahrungsknappheit, Verkehrstod und klimatischen Veränderungen, das ihn an den Rand seiner Existenz drängt. Der einst so häufige Kulturfolger zieht sich zurück – leise, unspektakulär, aber unumkehrbar, wenn kein Umdenken erfolgt.
Was jetzt zählt
Wenn der Igel überleben soll, braucht es nicht nur Naturschutzgebiete, sondern artenfreundliche Gärten, vernetzte Grünflächen, verkehrsberuhigte Zonen und eine naturnahe Landwirtschaft. Jeder Gartenbesitzer kann helfen – mit einem Laubhaufen, einem Durchschlupf im Zaun und dem Verzicht auf Gifte. Denn der Igel ist nicht nur ein Sympathieträger – er ist ein Indikator für die Gesundheit unserer Umwelt.
Sein Überleben ist ein Test – einer, den unsere Gesellschaft bislang nicht besteht.
Artenschutz in Franken®
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naturtreff Bedburg hat 2025 sein Projekt „ Igeltot im Straßenverkehr “ gestartet
„ Igeltot im Straßenverkehr “
Der Naturtreff Bedburg hat 2025 sein Projekt „ Igeltot im Straßenverkehr “ gestartet.
Unseren Igeln geht es zur Zeit sehr schlecht! Nahrungs- und Biotopsverluste haben enorm zugenommen. In den letzten Jahren sind viele Hausgärten und Blühwiesen verschwunden. In unserer heutigen Stadtplanung mit Bodenversiegelungen und aufgeräumter Landschaft, hat es nicht nur der Igel schwer.
Lückenlose Zäune und hohe Straßenbortsteine machen es dem Stachelritter nicht gerade leicht. Hinzu kommen noch die Rasenmähroboter und etliche Innen- und Außen- Parasiten , die eine ernste Gefahr für die Tiere werden können.
Das Überqueren der Straßen bei Dunkelheit bedeutet fast immer den Tod der Tiere, da sie nicht vor der Gefahr eines KFZ fliehen, sondern sich auf ihre Abwehr durch die Stacheln verlassen und sich zur Kugel einrollen und an Ort und Stelle liegen bleiben.
Unsere braunbrüstigen Igel fressen Insekten, Würmer, Schnecken und kleine Wirbeltiere. In der Natur wird der Igel etwa 3 bis 7 Jahre alt.
Um einen Überblick von überfahrenen Igeln zu bekommen, bittet der Naturtreff Bedburg um Meldung, wo und wann Igel im Stadtgebiet gefunden wurden.
- Die Funde der toten Igel können per Email unter Igel-Fund@web.de oder unter Telefon / AB 02272-81153 gemeldet werden.
Quelle
Gewässer und Naturschutz im Erftkreis
Flora-Fauna-Artenschutz
Naturschutzökologie
Rolf Thiemann
Naturschutzberater
Eisvogelweg 1
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung. Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
In der Aufnahme / Collage von Achim Schumacher und Rolf Thiemann
- Akkut gefährdet - der Europäische Braunbrustigel hier in Deuschland
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Artenschutz in Franken®
Erste Mahd der "grünen Wüsten" ...

Erste Mahd der "grünen Wüsten" ...
08/09.05.2025
Die Bezeichnung „Wiese“ suggeriert oft ein artenreiches, blühendes Biotop – tatsächlich handelt es sich bei vielen heutigen Wiesen jedoch um sogenannte „grüne Wüsten“, und das aus folgenden Gründen:
08/09.05.2025
Die Bezeichnung „Wiese“ suggeriert oft ein artenreiches, blühendes Biotop – tatsächlich handelt es sich bei vielen heutigen Wiesen jedoch um sogenannte „grüne Wüsten“, und das aus folgenden Gründen:
Artenarmut durch Intensivnutzung
"Moderne Wiesen", vor allem im Agrarbereich, werden häufig intensiv genutzt: mehrfach jährlich gemäht, regelmäßig gedüngt und zum Teil mit Pflanzenschutzmitteln behandelt. Dadurch dominieren wenige leistungsstarke Grasarten (z. B. Deutsches Weidelgras), während blütenreiche Wildpflanzen verdrängt werden. Es fehlen Nahrungspflanzen für Insekten, was zu einem Rückgang der Artenvielfalt führt.
Durch regelmäßiges Entfernen des Grünschnitts werden Nährstoffe aus dem Ökosystem entzogen. Das führt zur Verarmung des Bodens und beeinträchtigt das Wachstum von Pflanzen, die weniger konkurrenzfähig sind gegenüber schnell wachsenden, nährstoffliebenden Arten.
Fehlende Strukturvielfalt
Naturnahe Wiesen zeichnen sich durch unterschiedliche Wuchshöhen, Blühphasen und Mikrohabitate aus. Bei häufig gemähten oder beweideten Flächen ist das nicht der Fall – die Vegetation ist gleichförmig, niedrig, monoton. Diese Homogenität macht sie für viele Tierarten ökologisch wertlos, ähnlich wie eine Wüste.
Häufiges Mähen reduziert die strukturelle Vielfalt in Wiesen, indem es Blumen, Gräser und andere Pflanzenarten ständig auf kurze Höhen abschneidet. Dadurch gehen spezialisierte Lebensräume für verschiedene Arten verloren, die auf unterschiedliche Höhen und Vegetationsdichten angewiesen sind.
Verlust von Blüten und Samenständen
Durch zu häufiges Mähen kommen Pflanzen kaum zur Blüte oder Samenreife. Ohne Blüten fehlt die Grundlage für Bestäuber wie Wildbienen, Schmetterlinge und andere Insekten. Ebenso fehlt vielen Vogelarten die Nahrungsgrundlage oder das Nistmaterial.
Viele Insektenarten, wie Schmetterlinge und andere Bestäuber, sind auf spezifische Lebenszyklen und Pflanzen angewiesen, die durch häufiges Mähen gestört werden. Die Entfernung von Blüten kann die Nahrungsgrundlage und die Fortpflanzungsmöglichkeiten dieser Arten stark beeinträchtigen.
Reduktion auf Funktion
Die sogenannte „Wiese“ dient in vielen Fällen ausschließlich der Futtermittelproduktion. Ihre ökologische Funktion als Lebensraum tritt in den Hintergrund. In dieser rein funktionalen Nutzung – ähnlich wie bei Monokulturen – liegt die Parallele zur Wüste: eine biologisch weitgehend entleerte Fläche mit minimaler Artenvielfalt.
Was mit dem Grünschnitt hauptsächlich passiert, variiert je nach örtlichen Bestimmungen und Praktiken. Typischerweise wird der Grünschnitt entweder als Futter für Nutztiere verwendet, zur Kompostierung gebracht oder als Biomasse zur Energiegewinnung genutzt.
Daher sprechen wir vom Artenschutz in Franken® auch von „grünen Wüsten“, um auf den dramatischen Verlust der Biodiversität in unserer Kulturlandschaft aufmerksam zu machen.
In der Aufnahme
"Moderne Wiesen", vor allem im Agrarbereich, werden häufig intensiv genutzt: mehrfach jährlich gemäht, regelmäßig gedüngt und zum Teil mit Pflanzenschutzmitteln behandelt. Dadurch dominieren wenige leistungsstarke Grasarten (z. B. Deutsches Weidelgras), während blütenreiche Wildpflanzen verdrängt werden. Es fehlen Nahrungspflanzen für Insekten, was zu einem Rückgang der Artenvielfalt führt.
Durch regelmäßiges Entfernen des Grünschnitts werden Nährstoffe aus dem Ökosystem entzogen. Das führt zur Verarmung des Bodens und beeinträchtigt das Wachstum von Pflanzen, die weniger konkurrenzfähig sind gegenüber schnell wachsenden, nährstoffliebenden Arten.
Fehlende Strukturvielfalt
Naturnahe Wiesen zeichnen sich durch unterschiedliche Wuchshöhen, Blühphasen und Mikrohabitate aus. Bei häufig gemähten oder beweideten Flächen ist das nicht der Fall – die Vegetation ist gleichförmig, niedrig, monoton. Diese Homogenität macht sie für viele Tierarten ökologisch wertlos, ähnlich wie eine Wüste.
Häufiges Mähen reduziert die strukturelle Vielfalt in Wiesen, indem es Blumen, Gräser und andere Pflanzenarten ständig auf kurze Höhen abschneidet. Dadurch gehen spezialisierte Lebensräume für verschiedene Arten verloren, die auf unterschiedliche Höhen und Vegetationsdichten angewiesen sind.
Verlust von Blüten und Samenständen
Durch zu häufiges Mähen kommen Pflanzen kaum zur Blüte oder Samenreife. Ohne Blüten fehlt die Grundlage für Bestäuber wie Wildbienen, Schmetterlinge und andere Insekten. Ebenso fehlt vielen Vogelarten die Nahrungsgrundlage oder das Nistmaterial.
Viele Insektenarten, wie Schmetterlinge und andere Bestäuber, sind auf spezifische Lebenszyklen und Pflanzen angewiesen, die durch häufiges Mähen gestört werden. Die Entfernung von Blüten kann die Nahrungsgrundlage und die Fortpflanzungsmöglichkeiten dieser Arten stark beeinträchtigen.
Reduktion auf Funktion
Die sogenannte „Wiese“ dient in vielen Fällen ausschließlich der Futtermittelproduktion. Ihre ökologische Funktion als Lebensraum tritt in den Hintergrund. In dieser rein funktionalen Nutzung – ähnlich wie bei Monokulturen – liegt die Parallele zur Wüste: eine biologisch weitgehend entleerte Fläche mit minimaler Artenvielfalt.
Was mit dem Grünschnitt hauptsächlich passiert, variiert je nach örtlichen Bestimmungen und Praktiken. Typischerweise wird der Grünschnitt entweder als Futter für Nutztiere verwendet, zur Kompostierung gebracht oder als Biomasse zur Energiegewinnung genutzt.
Daher sprechen wir vom Artenschutz in Franken® auch von „grünen Wüsten“, um auf den dramatischen Verlust der Biodiversität in unserer Kulturlandschaft aufmerksam zu machen.
In der Aufnahme
- Vor wenigen Tagen wurden an zahlreichen Standorten der Republik der erste Grünschnitt gesetzt. Es werden wohl diesjährig noch 3 bis 5 Schnitte folgen, um auch das letzte Grashälmchen verwerten zu können. Auf diesen Flächen suchen wir die Biodiversität vielfach vergebens, da hier kaum mehr etwas zu finden ist was diesem Anspruch genügt. Bodenbrüter die hier ihren Nistplatz gesetzt hatten haben sich vielfach auch auf der Suche begeben ... und zwar nach ihrem Gelege, oder bereits geschlüpftem Nachwuchs der sich nun zwischen dem Grüngut befindet und verendet ist.
Artenschutz in Franken®
Große Wiesenameise - Erhaltung von Nistplätzen 2025 ...

Große Wiesenameise - Erhaltung von Nistplätzen 2025 ...
07/08.05.2025
Die Große Wiesenameise, auch bekannt als (Formica pratensis), ist eine im Bestand gefährdete Art in Deutschland. Es ist wichtig, ihre Nistplätze zu pflegen, da diese Ameisen einen bedeutenden ökologischen Beitrag leisten.
07/08.05.2025
Die Große Wiesenameise, auch bekannt als (Formica pratensis), ist eine im Bestand gefährdete Art in Deutschland. Es ist wichtig, ihre Nistplätze zu pflegen, da diese Ameisen einen bedeutenden ökologischen Beitrag leisten.
Hier sind einige Gründe, warum der Schutz ihrer Nistplätze von Bedeutung ist:
Die Lebensweise der Großen Wiesenameise in Deutschland ist geprägt von kolonialer Organisation und spezifischen Verhaltensweisen:
Die Pflege der Nistplätze und der Schutz der Großen Wiesenameise erfordern daher ein umfassendes Verständnis ihrer Lebensweise sowie eine kontinuierliche Überwachung und Unterstützung ihrer Lebensräume, um langfristig zu gewährleisten, dass diese wichtige Art erhalten bleibt.
In der Aufnahme
- Ökologische Rolle: Die große Wiesenameise spielt eine Schlüsselrolle im Ökosystem, insbesondere in Wiesen- und Graslandbiomen. Sie hilft bei der Zersetzung organischer Substanz, belüftet den Boden durch ihre Tätigkeit und trägt zur biologischen Vielfalt bei, indem sie Nahrung für viele andere Tiere darstellt.
- Erhaltung der Biodiversität: Indem wir ihre Nistplätze schützen, tragen wir zur Erhaltung der Artenvielfalt bei. Diese Ameisen sind oft Indikatoren für die Gesundheit von Ökosystemen. Ihre Anwesenheit zeigt an, dass das Ökosystem intakt ist und andere Arten von Pflanzen und Tieren unterstützen kann.
- Kontinuität und Sorgfalt: Die Pflege der Nistplätze erfordert eine regelmäßige Überwachung und gezielte Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Bedingungen für die Ameisen optimal bleiben. Dazu gehört die Erhaltung der natürlichen Vegetation, die Vermeidung von Störungen und die gegebenenfalls notwendige Renaturierung von Lebensräumen.
Die Lebensweise der Großen Wiesenameise in Deutschland ist geprägt von kolonialer Organisation und spezifischen Verhaltensweisen:
- Struktur: Der Nest dieser Art enthält eine Königinn und kann bis zu rund 10.000 Exemplare groß werden.
- Nestbau: Die Nester werden in offenen, grasbewachsenen Bereichen angelegt, oft in der Nähe von Waldsäumen oder in Wiesen. Die Ameisen bauen ihre Nester unterirdisch und nutzen sie als Brutstätten sowie zur Aufbewahrung von Nahrung.
- Ernährung: Die Große Wiesenameise ernährt sich vornehmlich von Insekten aber auch anderen kleinen Nahrungstieren (auch von anderen Ameisen und Aas) es wird daneben auch der sogenannte Honigtau von Bllattläusen zu sich genommen.
- Verhalten und Fortpflanzung: Die Fortpflanzung erfolgt durch Schwärmen, bei dem neue Königinnen und Männchen aus der Kolonie ausschwärmen, um neue Kolonien zu gründen. Dieser Prozess ist entscheidend für die Ausbreitung und den Fortbestand der Art. Diese schwarmflüge finden in der Regel von April bis Juni und dann noch einmal von August bis September im Jahr statt.
Die Pflege der Nistplätze und der Schutz der Großen Wiesenameise erfordern daher ein umfassendes Verständnis ihrer Lebensweise sowie eine kontinuierliche Überwachung und Unterstützung ihrer Lebensräume, um langfristig zu gewährleisten, dass diese wichtige Art erhalten bleibt.
In der Aufnahme
- Freigestellter und erhaltener Nistplatz der Großen Wiesenameise.
Artenschutz in Franken®
Schwindende Kronen, verlorene Welten ...

„Schwindende Kronen, verlorene Welten – Das stille Sterben unserer Wälder im Zeitalter des Klimawandels“
06/07.05.2025
Die Wälder Mitteleuropas, insbesondere Deutschlands, sind aktuell einem dramatischen Wandel unterworfen. Der Klimawandel beschleunigt Prozesse, die unsere Landschaften radikal verändern. Besonders sichtbar ist dies am lichter werdenden Kronendach unserer Forste.
Doch diese Entwicklung ist nicht allein dem Klimawandel geschuldet – auch historische (jedoch nicht nur) Fehler in der Waldbewirtschaftung tragen erheblich zur heutigen Misere bei.
06/07.05.2025
Die Wälder Mitteleuropas, insbesondere Deutschlands, sind aktuell einem dramatischen Wandel unterworfen. Der Klimawandel beschleunigt Prozesse, die unsere Landschaften radikal verändern. Besonders sichtbar ist dies am lichter werdenden Kronendach unserer Forste.
Doch diese Entwicklung ist nicht allein dem Klimawandel geschuldet – auch historische (jedoch nicht nur) Fehler in der Waldbewirtschaftung tragen erheblich zur heutigen Misere bei.
Warum werden die Wälder immer lichter?
Zunehmende klimatische Belastungen: Höhere Temperaturen, längere Trockenperioden und häufigere Extremwetterereignisse (Stürme, Dürren, Starkregen) setzen den Wäldern massiv zu. Trockenstress führt dazu, dass Bäume ihre Wasserversorgung nicht mehr aufrechterhalten können. Infolge dessen verkleinern sie ihre Kronen oder sterben ab, wodurch die Wälder zunehmend „aufreißen“ und lichter werden.
Schädlingsbefall als Folge des Klimawandels: Geschwächte Bäume sind anfälliger für Schädlinge wie den Borkenkäfer, der sich durch wärmere Temperaturen rasant ausbreitet. Besonders betroffen sind Fichtenbestände – große Monokulturen, die ursprünglich zur schnellen Holzproduktion angelegt wurden.
Erhöhte Sterblichkeit bei Jungbäumen: Junge Bäume sind extrem hitze- und trockenheitsanfällig. Die natürliche Verjüngung scheitert in vielen Regionen bereits, weil Keimlinge und Jungpflanzen unter den veränderten Bedingungen absterben, bevor sie sich etablieren können.
Fehler der Vergangenheit: Warum Forste heute so verletzlich sind
Fichten- und Kiefermonokulturen: Nach Kriegszerstörungen und zur Befriedigung der wachsenden Holz-Nachfrage pflanzte man schnellwachsende Baumarten wie Fichte oder Kiefer flächendeckend – oft fernab ihrer natürlichen Verbreitungsgrenzen. Diese Monokulturen sind extrem anfällig gegenüber Trockenheit, Stürmen und Schädlingen.
Fehlende Artenvielfalt: Natürliche, artenreiche Mischwälder wurden weitgehend verdrängt. Doch Vielfalt ist ein Schlüssel zu Resilienz: Verschiedene Baumarten können auf Klimastress unterschiedlich reagieren und so das Gesamtsystem stabilisieren.
Vernachlässigung des Boden- und Wassermanagements: Böden wurden durch intensive forstwirtschaftliche Nutzung verdichtet oder ausgelaugt. Eine schwache Bodenstruktur reduziert die Wasserspeicherfähigkeit enorm – ein katastrophaler Nachteil in Dürreperioden.
Eine düstere Zukunft: Die 3-Grad-Welt
Steigt die globale Durchschnittstemperatur um 3 Grad Celsius, drohen dramatische Veränderungen:
Fazit
Unsere Wälder befinden sich an einem Kipppunkt. Die Fehler der Vergangenheit – insbesondere die Schaffung instabiler, artenarmer Forste – rächen sich unter den neuen klimatischen Bedingungen. Ohne sofortige, umfassende Maßnahmen zur Förderung naturnaher, klimaresilienter Wälder wird die 3-Grad-Welt zu einer Landschaft des Verlustes: kahle Flächen, zerstörte Ökosysteme und der stille Rückzug zahlloser Lebensformen.
In der Aufnahme
Zunehmende klimatische Belastungen: Höhere Temperaturen, längere Trockenperioden und häufigere Extremwetterereignisse (Stürme, Dürren, Starkregen) setzen den Wäldern massiv zu. Trockenstress führt dazu, dass Bäume ihre Wasserversorgung nicht mehr aufrechterhalten können. Infolge dessen verkleinern sie ihre Kronen oder sterben ab, wodurch die Wälder zunehmend „aufreißen“ und lichter werden.
Schädlingsbefall als Folge des Klimawandels: Geschwächte Bäume sind anfälliger für Schädlinge wie den Borkenkäfer, der sich durch wärmere Temperaturen rasant ausbreitet. Besonders betroffen sind Fichtenbestände – große Monokulturen, die ursprünglich zur schnellen Holzproduktion angelegt wurden.
Erhöhte Sterblichkeit bei Jungbäumen: Junge Bäume sind extrem hitze- und trockenheitsanfällig. Die natürliche Verjüngung scheitert in vielen Regionen bereits, weil Keimlinge und Jungpflanzen unter den veränderten Bedingungen absterben, bevor sie sich etablieren können.
Fehler der Vergangenheit: Warum Forste heute so verletzlich sind
Fichten- und Kiefermonokulturen: Nach Kriegszerstörungen und zur Befriedigung der wachsenden Holz-Nachfrage pflanzte man schnellwachsende Baumarten wie Fichte oder Kiefer flächendeckend – oft fernab ihrer natürlichen Verbreitungsgrenzen. Diese Monokulturen sind extrem anfällig gegenüber Trockenheit, Stürmen und Schädlingen.
Fehlende Artenvielfalt: Natürliche, artenreiche Mischwälder wurden weitgehend verdrängt. Doch Vielfalt ist ein Schlüssel zu Resilienz: Verschiedene Baumarten können auf Klimastress unterschiedlich reagieren und so das Gesamtsystem stabilisieren.
Vernachlässigung des Boden- und Wassermanagements: Böden wurden durch intensive forstwirtschaftliche Nutzung verdichtet oder ausgelaugt. Eine schwache Bodenstruktur reduziert die Wasserspeicherfähigkeit enorm – ein katastrophaler Nachteil in Dürreperioden.
Eine düstere Zukunft: Die 3-Grad-Welt
Steigt die globale Durchschnittstemperatur um 3 Grad Celsius, drohen dramatische Veränderungen:
- Großflächiges Waldsterben: Insbesondere standortfremde Arten wie Fichte und Kiefer würden nahezu komplett verschwinden. Selbst Eichen und Buchen – bisher relativ klimaresilient – könnten in vielen Regionen nicht mehr überleben.
- Verlust von Lebensräumen: Mit dem Zerfall der Wälder verschwinden hochspezialisierte Tier- und Pflanzenarten. Vögel wie der Schwarzstorch, Amphibien, Insekten und viele Fledermausarten verlieren ihre Brut- und Rückzugsräume.
- Bodenerosion und Wüstungsprozesse: Ohne den Schutz der Wälder wird der Boden durch Wind und Starkregen abgetragen. Örtliche Mikroklimate verschlechtern sich weiter, was die Wiederbewaldung erheblich erschwert.
- Ökologische Kipppunkte: Wälder könnten sich von CO₂-Senken zu CO₂-Quellen wandeln, wenn abgestorbene Biomasse in großem Stil zersetzt wird. Das wiederum würde die Erderwärmung zusätzlich anheizen.
- Soziale und wirtschaftliche Folgen: Die Forstwirtschaft würde massive Verluste erleiden. Naherholungsgebiete, Trinkwasserschutzräume und kulturelle Landschaften gingen unwiederbringlich verloren.
Fazit
Unsere Wälder befinden sich an einem Kipppunkt. Die Fehler der Vergangenheit – insbesondere die Schaffung instabiler, artenarmer Forste – rächen sich unter den neuen klimatischen Bedingungen. Ohne sofortige, umfassende Maßnahmen zur Förderung naturnaher, klimaresilienter Wälder wird die 3-Grad-Welt zu einer Landschaft des Verlustes: kahle Flächen, zerstörte Ökosysteme und der stille Rückzug zahlloser Lebensformen.
In der Aufnahme
- Unsere "Wälder" (eigentlich Forste) werden immer lichter ... doch nicht "nur" durch Fehler die in der Vergangenheit begangen wurden ... sind wir aktuell tatsächlich weiter?
Artenschutz in Franken®
Feuerstellen im "Wald" - Risiken abgewogen?

Feuerstellen im "Wald" - Risiken abgewogen?
05/06.05.2025
Nördlicher/Oberer Steigerwald. Für uns wäre das ein No-Go ... für Andere wohl ein Highlight ? ... Die Anlage von Feuerstellen im vom Klimwandel gezeichneten "Klimaforst"!
Das Risiko von Waldbränden infolge des Klimawandels ist beträchtlich und resultiert aus mehreren entscheidenden Faktoren. Erstens erhöht sich die Häufigkeit und Intensität extremer Wetterereignisse wie Hitzewellen und Dürren, die die Vegetation trocknen und die Brandgefahr erhöhen. Trockenes Biomasse-Material, das normalerweise Feuchtigkeit speichert, wird dadurch extrem leicht entzündlich.
05/06.05.2025
Nördlicher/Oberer Steigerwald. Für uns wäre das ein No-Go ... für Andere wohl ein Highlight ? ... Die Anlage von Feuerstellen im vom Klimwandel gezeichneten "Klimaforst"!
Das Risiko von Waldbränden infolge des Klimawandels ist beträchtlich und resultiert aus mehreren entscheidenden Faktoren. Erstens erhöht sich die Häufigkeit und Intensität extremer Wetterereignisse wie Hitzewellen und Dürren, die die Vegetation trocknen und die Brandgefahr erhöhen. Trockenes Biomasse-Material, das normalerweise Feuchtigkeit speichert, wird dadurch extrem leicht entzündlich.
Zweitens verändern sich die klimatischen Bedingungen, was zu einer Verschiebung der geografischen Verteilung von Pflanzenarten führt. Das bedeutet, dass einige Gebiete, die zuvor weniger anfällig für Brände waren, nun höhere Risiken aufweisen können, da neue Vegetationsmuster entstehen, die sich möglicherweise schneller entzünden und verbreiten.
Drittens sind durch den Klimawandel auch fragile Ökosysteme betroffen, insbesondere Reproduktionsorte gefährdeter Arten. Diese sensiblen Standorte sind oft weniger anpassungsfähig gegenüber Veränderungen und reagieren empfindlich auf Störungen wie Brände. Ein Feuer in solchen Gebieten kann nicht nur die direkte Vernichtung der Pflanzen und Lebensräume bedeuten, sondern auch langfristige Schäden durch Verlust der genetischen Vielfalt und der ökologischen Resilienz verursachen.
Zusammengefasst zeigt die Einrichtung von Feuerstellen inmitten solch sensibler Reproduktionsorte eine komplexe Problemstellung auf, die das fragile Gleichgewicht von Ökosystemen und die langfristige Überlebensfähigkeit gefährdeter Arten bedroht. Es verdeutlicht die Notwendigkeit einer sorgfältigen Planung und eines umfassenden Risikomanagements im Umgang mit Feuer in Zeiten des Klimawandels.
In der Aufnahme
Drittens sind durch den Klimawandel auch fragile Ökosysteme betroffen, insbesondere Reproduktionsorte gefährdeter Arten. Diese sensiblen Standorte sind oft weniger anpassungsfähig gegenüber Veränderungen und reagieren empfindlich auf Störungen wie Brände. Ein Feuer in solchen Gebieten kann nicht nur die direkte Vernichtung der Pflanzen und Lebensräume bedeuten, sondern auch langfristige Schäden durch Verlust der genetischen Vielfalt und der ökologischen Resilienz verursachen.
Zusammengefasst zeigt die Einrichtung von Feuerstellen inmitten solch sensibler Reproduktionsorte eine komplexe Problemstellung auf, die das fragile Gleichgewicht von Ökosystemen und die langfristige Überlebensfähigkeit gefährdeter Arten bedroht. Es verdeutlicht die Notwendigkeit einer sorgfältigen Planung und eines umfassenden Risikomanagements im Umgang mit Feuer in Zeiten des Klimawandels.
In der Aufnahme
- Für uns erscheinen solche Anlagen mitten im "Wald", noch dazu an Standorten in welchen im Bestand beeinträchtigte Arten ihre Lebensräume haben, als stark Risiko behaftet. Was man sich dabei gedacht hat erschließt sich uns nicht, denn wir denken nicht in solchen Kategorien ... Durchdachte, verantwortungsvolle Nachhaltigkeit welche immer wieder so markant benannt wird ... kann hier wohl nicht die treibende Kraft geweisen sein?
Artenschutz in Franken®
Jagen auf ökologischen Vorrangflächen - ein ethisches No-Go

Jagen auf ökologischen Vorrangflächen - ein ethisches No-Go
04/05.05.2025
04/05.05.2025
- Das Jagen auf ökologischen Vorrangflächen gilt aus ethischer, ökologischer und gesellschaftlicher Sicht als besonders verwerflich – aus folgenden Gründen:
Verrat an der eigentlichen Schutzfunktion
Ökologische Vorrangflächen (ÖVF) sind explizit dafür geschaffen worden, dem Natur- und Artenschutz zu dienen. Hier sollen bedrohte Pflanzen- und Tierarten ungestört leben, sich fortpflanzen und Rückzugsräume finden. Wer dort jagt, widerspricht dem Grundgedanken dieser Flächen fundamental – es ist ein klarer Zielkonflikt: Statt Schutz wird hier Störung betrieben.
Störung gefährdeter Arten
Gerade seltene und empfindliche Tierarten, wie z. B. Bodenbrüter, Amphibien oder Insekten, sind auf störungsfreie Lebensräume angewiesen. Schon die reine Präsenz von Menschen – insbesondere während der Brut- und Aufzuchtzeiten – kann dazu führen, dass Tiere ihre Gelege aufgeben oder Stressreaktionen zeigen. Jagdliche Aktivitäten verschärfen diese Belastung zusätzlich durch Lärm, Hundeeinsatz und Schusswaffengebrauch.
Widerspruch zu ökologischer Verantwortung
In Zeiten massiven Artensterbens und zunehmender Flächenversiegelung ist jeder intakte Naturraum kostbar. Wer auf Vorrangflächen jagt, handelt entgegen jeder ökologischen Verantwortung und ignoriert die Dringlichkeit des Biodiversitätsschutzes. Das ist nicht nur fahrlässig – es ist moralisch inakzeptabel.
Signalwirkung und Glaubwürdigkeitsverlust
Wird Jagd auf ÖVF toleriert oder gar regelmäßig praktiziert, sendet das ein fatales Signal: Schutzflächen sind verhandelbar. Das untergräbt das Vertrauen in agrar- und umweltpolitische Maßnahmen und schwächt das gesellschaftliche Bekenntnis zu nachhaltiger Landnutzung.
Langfristiger Schaden für Natur und Gesellschaft
Was kurzfristig jagdlich motiviert sein mag, wirkt langfristig destruktiv: Arten verschwinden, Lebensräume verlieren an Qualität, und die Akzeptanz für Naturschutz sinkt. Der angerichtete Schaden lässt sich oft nicht mehr rückgängig machen.
Fazit:
Das Jagen auf ökologischen Vorrangflächen ist nicht nur ökologisch schädlich – es ist ein für uns unvereinbarer, moralischer Widerspruch zur eigentlichen Intention dieser Schutzräume. Wer solche Flächen zur Jagd nutzt, stellt kurzfristige Interessen über das langfristige Wohl von Natur und Gesellschaft. Das ist ethisch wie fachlich für uns nicht vertretbar.
In der Aufnahme
Ökologische Vorrangflächen (ÖVF) sind explizit dafür geschaffen worden, dem Natur- und Artenschutz zu dienen. Hier sollen bedrohte Pflanzen- und Tierarten ungestört leben, sich fortpflanzen und Rückzugsräume finden. Wer dort jagt, widerspricht dem Grundgedanken dieser Flächen fundamental – es ist ein klarer Zielkonflikt: Statt Schutz wird hier Störung betrieben.
Störung gefährdeter Arten
Gerade seltene und empfindliche Tierarten, wie z. B. Bodenbrüter, Amphibien oder Insekten, sind auf störungsfreie Lebensräume angewiesen. Schon die reine Präsenz von Menschen – insbesondere während der Brut- und Aufzuchtzeiten – kann dazu führen, dass Tiere ihre Gelege aufgeben oder Stressreaktionen zeigen. Jagdliche Aktivitäten verschärfen diese Belastung zusätzlich durch Lärm, Hundeeinsatz und Schusswaffengebrauch.
Widerspruch zu ökologischer Verantwortung
In Zeiten massiven Artensterbens und zunehmender Flächenversiegelung ist jeder intakte Naturraum kostbar. Wer auf Vorrangflächen jagt, handelt entgegen jeder ökologischen Verantwortung und ignoriert die Dringlichkeit des Biodiversitätsschutzes. Das ist nicht nur fahrlässig – es ist moralisch inakzeptabel.
Signalwirkung und Glaubwürdigkeitsverlust
Wird Jagd auf ÖVF toleriert oder gar regelmäßig praktiziert, sendet das ein fatales Signal: Schutzflächen sind verhandelbar. Das untergräbt das Vertrauen in agrar- und umweltpolitische Maßnahmen und schwächt das gesellschaftliche Bekenntnis zu nachhaltiger Landnutzung.
Langfristiger Schaden für Natur und Gesellschaft
Was kurzfristig jagdlich motiviert sein mag, wirkt langfristig destruktiv: Arten verschwinden, Lebensräume verlieren an Qualität, und die Akzeptanz für Naturschutz sinkt. Der angerichtete Schaden lässt sich oft nicht mehr rückgängig machen.
Fazit:
Das Jagen auf ökologischen Vorrangflächen ist nicht nur ökologisch schädlich – es ist ein für uns unvereinbarer, moralischer Widerspruch zur eigentlichen Intention dieser Schutzräume. Wer solche Flächen zur Jagd nutzt, stellt kurzfristige Interessen über das langfristige Wohl von Natur und Gesellschaft. Das ist ethisch wie fachlich für uns nicht vertretbar.
In der Aufnahme
- Verkommen zu einem Anfütter und Schießplatz ... so sah eine Fläche aus welche dem rein ökologischen Aspekt zugeordnet war. Artenschutz in Franken® sorgt mit Projektpartnern dafür das diese Fläche unverzüglich geräumt und ihrem ursprünglichen Zweck zu geführt wird. Was in den Köpfen der Verantwortlichen hier vorgegangen sein mag erschließt sich uns nicht und wir möchten auch nicht solche Gedanken entwickeln welche dem Töten von Tieren, rein zur Freude dienen! Denn um Nahrungserwerb geht es hier in erster Linie nicht!.
Artenschutz in Franken®
Die nächste Generation ...

Die nächste Generation ...
03/04.05.2025
Dieser Prozess ist ein faszinierendes Beispiel für die Anpassungsfähigkeit und den Überlebenswillen dieser Amphibien.
03/04.05.2025
- In einem Teich, weit weg von der Hektik der menschlichen Welt, entfaltet sich ein bemerkenswerter Zyklus des Lebens: die Entwicklung der Erdkröten und ihrer Nachkommen, den Kaulquappen.
Dieser Prozess ist ein faszinierendes Beispiel für die Anpassungsfähigkeit und den Überlebenswillen dieser Amphibien.
Erdkröten beginnen ihren Lebenszyklus mit der Paarung im Frühjahr. Männchen locken Weibchen durch charakteristische Rufe an, und sobald ein Paar gefunden ist, legen die Weibchen ihre Eier in großen Laichschnüren ab, die oft an Wasserpflanzen haften. Aus diesen Eiern schlüpfen nach einiger Zeit die Kaulquappen, kleine, fischähnliche Larven mit Kiemen, die an das Leben im Wasser angepasst sind.
Die Kaulquappen durchlaufen eine bemerkenswerte Metamorphose, während der sie sich allmählich zu erwachsenen Kröten entwickeln. Sie ernähren sich von Algen und kleinen Wasserpflanzen und sind selbst Beute für verschiedene Raubtiere wie Vögel, Fische und Insektenlarven. Diese Phase ist entscheidend für das Überleben der Krötenpopulationen, da viele Kaulquappen Opfer dieser Räuber werden.
Die Bedrohungen für die Kaulquappen sind vielfältig. Verlust und Verschmutzung von Lebensräumen, insbesondere von Feuchtgebieten und Teichen, stellen eine ernste Gefahr dar. Chemikalien und Pestizide können das Wasser verschmutzen und die empfindlichen Larven schädigen. Auch die Einführung invasiver Arten, die natürliche Räuber der Kaulquappen sind, kann zu einem Rückgang der Populationen führen.
Trotz dieser Herausforderungen zeigen Erdkröten eine bemerkenswerte Anpassungsfähigkeit. Individuen, die überleben, kehren oft zu den Teichen zurück, in denen sie selbst geschlüpft sind, um zu paaren und den Zyklus fortzusetzen. Dieses Verhalten hilft, die genetische Vielfalt und die Überlebensfähigkeit der Art zu sichern.
Die Entwicklung von Erdkröten und ihren Kaulquappen in einem Teich ist daher nicht nur ein Naturwunder, sondern auch ein Beispiel für die zarten, aber entscheidenden Verbindungen in Ökosystemen und die Herausforderungen, die diese Arten überwinden müssen, um fortzubestehen.
In der Aufnahme
Die Kaulquappen durchlaufen eine bemerkenswerte Metamorphose, während der sie sich allmählich zu erwachsenen Kröten entwickeln. Sie ernähren sich von Algen und kleinen Wasserpflanzen und sind selbst Beute für verschiedene Raubtiere wie Vögel, Fische und Insektenlarven. Diese Phase ist entscheidend für das Überleben der Krötenpopulationen, da viele Kaulquappen Opfer dieser Räuber werden.
Die Bedrohungen für die Kaulquappen sind vielfältig. Verlust und Verschmutzung von Lebensräumen, insbesondere von Feuchtgebieten und Teichen, stellen eine ernste Gefahr dar. Chemikalien und Pestizide können das Wasser verschmutzen und die empfindlichen Larven schädigen. Auch die Einführung invasiver Arten, die natürliche Räuber der Kaulquappen sind, kann zu einem Rückgang der Populationen führen.
Trotz dieser Herausforderungen zeigen Erdkröten eine bemerkenswerte Anpassungsfähigkeit. Individuen, die überleben, kehren oft zu den Teichen zurück, in denen sie selbst geschlüpft sind, um zu paaren und den Zyklus fortzusetzen. Dieses Verhalten hilft, die genetische Vielfalt und die Überlebensfähigkeit der Art zu sichern.
Die Entwicklung von Erdkröten und ihren Kaulquappen in einem Teich ist daher nicht nur ein Naturwunder, sondern auch ein Beispiel für die zarten, aber entscheidenden Verbindungen in Ökosystemen und die Herausforderungen, die diese Arten überwinden müssen, um fortzubestehen.
In der Aufnahme
- Hierfür setzen wir uns intensiv ein ... die nächste Erdkrötengeneration ist geschlüpft ...
Artenschutz in Franken®
Unprofessioneller Einsatz von Pflanzenschutzmittel und dessen Auswirkung auf Ameisen

Unprofessioneller Einsatz von Pflanzenschutzmittel und dessen Auswirkung auf Ameisen
02/03.05.2025
02/03.05.2025
- Die Problematik zwischen Pflanzenvernichtungsmitteln und streng geschützten Ameisennestern ist ziemlich komplex und berührt mehrere wichtige Aspekte des Umweltschutzes.
Ameisennester, besonders die von seltenen oder bedrohten Arten, sind oft gesetzlich geschützt, da sie eine Schlüsselrolle im Ökosystem spielen und zur Biodiversität beitragen. Diese Nester können durch chemische Pflanzenvernichtungsmittel gefährdet sein, die zur Unkrautbekämpfung eingesetzt werden.
Einerseits sind Pflanzenvernichtungsmittel wie Herbizide wohl in unserer industriell geführten Landwirtschaft notwendig, um landwirtschaftliche Erträge zu sichern und invasive Pflanzenarten zu kontrollieren. Andererseits können sie durch ihre Auswirkungen auf die Umwelt die Lebensräume von Ameisen und anderen Bodenbewohnern beeinträchtigen. Die direkte oder indirekte Exposition gegenüber diesen Chemikalien kann Ameisennester schädigen oder sogar zerstören, was langfristige Auswirkungen auf die örtliche Artenvielfalt und das Ökosystem haben kann.
Die Herausforderung besteht darin, einen ausgewogenen Ansatz zu finden, der sowohl den Schutz der landwirtschaftlichen Produktion als auch den Erhalt natürlicher Lebensräume und geschützter Arten wie Ameisen berücksichtigt. Dies erfordert oft strengere Regulierungen, um sicherzustellen, dass Pestizide und Herbizide verantwortungsvoll angewendet werden, sowie Forschung und Entwicklung von umweltfreundlicheren Alternativen, die weniger Auswirkungen auf natürliche Lebensräume haben.
In der Aufnahme
Einerseits sind Pflanzenvernichtungsmittel wie Herbizide wohl in unserer industriell geführten Landwirtschaft notwendig, um landwirtschaftliche Erträge zu sichern und invasive Pflanzenarten zu kontrollieren. Andererseits können sie durch ihre Auswirkungen auf die Umwelt die Lebensräume von Ameisen und anderen Bodenbewohnern beeinträchtigen. Die direkte oder indirekte Exposition gegenüber diesen Chemikalien kann Ameisennester schädigen oder sogar zerstören, was langfristige Auswirkungen auf die örtliche Artenvielfalt und das Ökosystem haben kann.
Die Herausforderung besteht darin, einen ausgewogenen Ansatz zu finden, der sowohl den Schutz der landwirtschaftlichen Produktion als auch den Erhalt natürlicher Lebensräume und geschützter Arten wie Ameisen berücksichtigt. Dies erfordert oft strengere Regulierungen, um sicherzustellen, dass Pestizide und Herbizide verantwortungsvoll angewendet werden, sowie Forschung und Entwicklung von umweltfreundlicheren Alternativen, die weniger Auswirkungen auf natürliche Lebensräume haben.
In der Aufnahme
- Verantwortungsvoller und amateurhafter Umgang mit Pflanzenvernichtungsmittel ... während es auf der einen Seite gut gelang den Einsatz der Mittel im Feld (also auf den eigenen landwirtschaftlichen Flächen) zu halten, ist auf der anderen Aufnahme zu erkennen das hier laienhaft und unverantwortlich über die eigene Fläche hinaus getötet wurde .. dabei: denn es ist sehr wohl möglich Arten- und Pflanzenschutz in unserer "modernen" Zeit unter einen "Hut" zu bringen wenn man bei der Arbeit etwas denkt und sich bemüht. Ansonsten werden andere sich gesetzeskonform darum bemühen das Andere sich bemühen!
Artenschutz in Franken®
Stele der Biodiversität® - Oberschwappach

Stele der Biodiversität® - Oberschwappach
01/02.05.2025
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutzes in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. sowie der Gemeinde Knetzgau, das unabhängig von der Deutschen Postcode Lotterie, der Petra und Matthias Hanft-Stiftung für Tier- und Naturschutz und der Steuerkanzlei Bauerfeind aus München unterstützt wird.
Oberschwappach / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen, kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
01/02.05.2025
- Projekt in der Umsetzungsphase
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutzes in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. sowie der Gemeinde Knetzgau, das unabhängig von der Deutschen Postcode Lotterie, der Petra und Matthias Hanft-Stiftung für Tier- und Naturschutz und der Steuerkanzlei Bauerfeind aus München unterstützt wird.
Oberschwappach / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen, kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
In der Aufnahme
- Am 23/24.04.2025 wurde die alte Dachhaut entfernt und fachgerecht entsorgt ... nachfolgend wurde die bereits intern vorbereitete Fledermaus-Thermokammer installiert und diese mit Folie gegen den, für die nächsten Tage angekündigten Regen abgesichert.
Artenschutz in Franken®
Wenn "Naturschutzkonzepte" zur Farce werden ...

Wenn "Naturschutzkonzepte" zur Farce werden ...
30.04./01.05.2025
Nördlicher/Oberer Steigerwald. Ernüchterung macht sich in unseren Reihen und weit darüber hinaus breit.
Mehr und mehr festigt sich in unseren Augen der Eindruck, dass der Ansatz eines tatsächlich tragfähigen, dem Gedanken des Naturschutzes ausgerichteten Konzeptes zur Verbesserung der Habitatstrukturen in den nach eigenen Aussagen "nachhaltig bewirtschafteten Wäldern", einfach nicht greift.
30.04./01.05.2025
- Wenn Konzepte nachhaltig enttäuschen.
Nördlicher/Oberer Steigerwald. Ernüchterung macht sich in unseren Reihen und weit darüber hinaus breit.
Mehr und mehr festigt sich in unseren Augen der Eindruck, dass der Ansatz eines tatsächlich tragfähigen, dem Gedanken des Naturschutzes ausgerichteten Konzeptes zur Verbesserung der Habitatstrukturen in den nach eigenen Aussagen "nachhaltig bewirtschafteten Wäldern", einfach nicht greift.
Es gründen sich hier Konzepte welche womöglich einen oberflächlich Gesichtspunkt standhalten mögen, doch bei näherem Hinsehen werden vorhandene Defizite rasch erkennbar.
Hier hatten wir ja in den vergangenen Jahren regelmäßig in Wort und Bild berichtet, was sich in den Waldabteilungen und angrenzenden Strukturen so zeigt. Weitere Eindrücke, was einige verantwortliche Organisationen unter nachhaltiger Bewirtschaftung „verstehen“ machen uns jedoch doch zunehmend nachdenklich.Denn mit Nachhaltigkeit im Sinne des Artenschutzes hat das nach unserer Auffassung nichts, aber rein gar nichts zu tun.
Damit gerät der Ansatz dieses schön zu lesenden Konzeptes rasch an seine Grenzen und wird zur Farce!
Abermals wurde das Konzept du seine Wirkungsweise sichtbar, sei es nun Unvermögen, Leichtsinn oder Unwissenheit … aber nein, Unwissenheit kann es eigentlich nicht sein. Denn es fanden vor Ort Termine statt um das womöglich vorhandene Unwissen zu schärfen und vorhanden Wissenslücken mit Wissen auszustatten.
Ganze Arbeit wurde bei der Zerstörung hochwertiger Lebensräume geleistet und die Begründung, welche darauf hin auf unsere Anfrage hin folgte, zeigte sich mehr als unbefriedigend. Wir gehen derzeit davon aus, dass die verantwortliche Organisation diese Schäden im kommenden Herbst 2025 beseitigen wird
Wir bitten um Verständnis, dass wir ein solches Vorgehen keinesfalls akzeptieren und gar durch ein gemeinschaftliches Engagement auch noch unterstützen sollen. Es bedarf, sich der Verantwortung gegenüber dem Artenschutz endlich bewusst zu werden ... erst wenn über den "Tellerrand" hinausgeblickt werden kann, sollte das Wort Nachhaltigkeit verwendet werden.
Für uns greift der Ansatz viel zu kurz.
Auf keinen Fall stehen wir vom Artenschutz in Franken® für so eine „nachhaltige Waldbewirtschaftung“ zur Verfügung, wir lehnen diese nachdrücklich und voller Überzeugung ab! Solche Organisationen sind für uns „Durch“, da hilft es auch wenig, wenn an anderer Stelle ggf. schöne Täfelchen enthüllt werden. Jedoch fehlt auf diesen Täfelchen auch noch einer der Hauptgründe, weshalb es zur Ausbreitung des geschilderten Problems kam. Mehr als oberflächliche Floskeln die ggf. Außenstehende zu beeindrucken vermögen erkennen wir hier nicht. Die Hauptursache liegt viel tiefer im Thema!
In der Aufnahme
Hier hatten wir ja in den vergangenen Jahren regelmäßig in Wort und Bild berichtet, was sich in den Waldabteilungen und angrenzenden Strukturen so zeigt. Weitere Eindrücke, was einige verantwortliche Organisationen unter nachhaltiger Bewirtschaftung „verstehen“ machen uns jedoch doch zunehmend nachdenklich.Denn mit Nachhaltigkeit im Sinne des Artenschutzes hat das nach unserer Auffassung nichts, aber rein gar nichts zu tun.
Damit gerät der Ansatz dieses schön zu lesenden Konzeptes rasch an seine Grenzen und wird zur Farce!
Abermals wurde das Konzept du seine Wirkungsweise sichtbar, sei es nun Unvermögen, Leichtsinn oder Unwissenheit … aber nein, Unwissenheit kann es eigentlich nicht sein. Denn es fanden vor Ort Termine statt um das womöglich vorhandene Unwissen zu schärfen und vorhanden Wissenslücken mit Wissen auszustatten.
Ganze Arbeit wurde bei der Zerstörung hochwertiger Lebensräume geleistet und die Begründung, welche darauf hin auf unsere Anfrage hin folgte, zeigte sich mehr als unbefriedigend. Wir gehen derzeit davon aus, dass die verantwortliche Organisation diese Schäden im kommenden Herbst 2025 beseitigen wird
Wir bitten um Verständnis, dass wir ein solches Vorgehen keinesfalls akzeptieren und gar durch ein gemeinschaftliches Engagement auch noch unterstützen sollen. Es bedarf, sich der Verantwortung gegenüber dem Artenschutz endlich bewusst zu werden ... erst wenn über den "Tellerrand" hinausgeblickt werden kann, sollte das Wort Nachhaltigkeit verwendet werden.
Für uns greift der Ansatz viel zu kurz.
Auf keinen Fall stehen wir vom Artenschutz in Franken® für so eine „nachhaltige Waldbewirtschaftung“ zur Verfügung, wir lehnen diese nachdrücklich und voller Überzeugung ab! Solche Organisationen sind für uns „Durch“, da hilft es auch wenig, wenn an anderer Stelle ggf. schöne Täfelchen enthüllt werden. Jedoch fehlt auf diesen Täfelchen auch noch einer der Hauptgründe, weshalb es zur Ausbreitung des geschilderten Problems kam. Mehr als oberflächliche Floskeln die ggf. Außenstehende zu beeindrucken vermögen erkennen wir hier nicht. Die Hauptursache liegt viel tiefer im Thema!
In der Aufnahme
- Zerstörter Waldsaum und hoch verdichteter Boden ..
Artenschutz in Franken®
Riecht wie eine ... Ringelnatter

Riecht wie eine ... Ringelnatter
29/30.04.2025
Dieses Verhalten dient der Verteidigung gegen potenzielle Feinde. Der Geruch wird durch spezielle Drüsen an der Basis des Schwanzes der Ringelnatter erzeugt, die eine Mischung aus verschiedenen chemischen Verbindungen enthalten.
29/30.04.2025
- Die Ringelnatter (Natrix natrix) ist bekannt dafür, bei Bedrohung einen stark riechenden Geruch zu produzieren.
Dieses Verhalten dient der Verteidigung gegen potenzielle Feinde. Der Geruch wird durch spezielle Drüsen an der Basis des Schwanzes der Ringelnatter erzeugt, die eine Mischung aus verschiedenen chemischen Verbindungen enthalten.
Diese Drüsen produzieren ein Sekret, das neben wasserlöslichen Proteinen und Enzymen auch lipophile Substanzen wie Fettsäuren und Lipide enthält. Diese Mischung ist verantwortlich für den intensiven und oft unangenehmen Geruch, den die Ringelnatter absondert, wenn sie sich bedroht fühlt. Der Geruch dient dazu, potenzielle Fressfeinde abzuschrecken oder zu verwirren, indem er sie irritiert oder abstößt.
Ein weiterer Aspekt dieser Verteidigungsstrategie ist, dass der Geruch oft mit giftigen oder gefährlichen Tieren assoziiert wird, selbst wenn die Ringelnatter selbst nicht giftig ist. Dies kann potenzielle Feinde dazu veranlassen, von einem Angriff abzusehen oder die Natter loszulassen, falls sie bereits gefangen wurde.
Insgesamt ist diese Abwehrmechanismus der Ringelnatter ein faszinierendes Beispiel für die Evolution von Verteidigungsstrategien bei Reptilien, die darauf abzielen, Gefahren durch chemische Signale zu mindern und potenzielle Angreifer abzuhalten.
Neben dem doch recht aufdringlichen Geruch führt dieser bei hoher Dosierung (unmittelbarer Kontakt / Einatmen aus nächster Entfernung) unter Umständen zu Schwindel und leichter Atemnot ... auch bei Erwachsenen (konnten wir aus eiger Erfahrung schildern) .. und bei Hunden (größerer Hund) zu intensivem Speichelfluss (Hunde hatten keinen direkten Kontakt mit dem Tier sondern reagierten "lediglich" auf den Geruch in dieser Fom).
In der Aufnahme
Ein weiterer Aspekt dieser Verteidigungsstrategie ist, dass der Geruch oft mit giftigen oder gefährlichen Tieren assoziiert wird, selbst wenn die Ringelnatter selbst nicht giftig ist. Dies kann potenzielle Feinde dazu veranlassen, von einem Angriff abzusehen oder die Natter loszulassen, falls sie bereits gefangen wurde.
Insgesamt ist diese Abwehrmechanismus der Ringelnatter ein faszinierendes Beispiel für die Evolution von Verteidigungsstrategien bei Reptilien, die darauf abzielen, Gefahren durch chemische Signale zu mindern und potenzielle Angreifer abzuhalten.
Neben dem doch recht aufdringlichen Geruch führt dieser bei hoher Dosierung (unmittelbarer Kontakt / Einatmen aus nächster Entfernung) unter Umständen zu Schwindel und leichter Atemnot ... auch bei Erwachsenen (konnten wir aus eiger Erfahrung schildern) .. und bei Hunden (größerer Hund) zu intensivem Speichelfluss (Hunde hatten keinen direkten Kontakt mit dem Tier sondern reagierten "lediglich" auf den Geruch in dieser Fom).
In der Aufnahme
- Bei unseren Bemühungen zur Absicherung der Amphibienmassenwanderung treffen wir mehr oder minder regelmäßig auch auf Ringelnattern, die sich den Lebensraum mit den Amphibien teilen.
Artenschutz in Franken®
Überlebensräume für Zauneidechse & Co. 2025

Überlebensräume für Zauneidechse & Co. 2025
28/29.04.2025
Die Gestaltung von Lebensräumen entlang von Flurwegen für Zauneidechsen erfordert ein innovatives und ganzheitliches Konzept, das sowohl die Bedürfnisse der Tiere als auch die Umweltbedingungen berücksichtigt.
28/29.04.2025
- Artenschutzprojekt geht neue Wege
Die Gestaltung von Lebensräumen entlang von Flurwegen für Zauneidechsen erfordert ein innovatives und ganzheitliches Konzept, das sowohl die Bedürfnisse der Tiere als auch die Umweltbedingungen berücksichtigt.
Hier sind einige wichtige Aspekte, die bei der Planung und Umsetzung berücksichtigt werden sollten:
Insgesamt bietet die innovative Gestaltung von Zauneidechsenlebensräumen entlang von Flurwegen eine Chance, städtische und ländliche Landschaften ökologisch aufzuwerten und gleichzeitig zur Erhaltung bedrohter Arten beizutragen. Durch sorgfältige Planung und Umsetzung können solche Projekte als Modell für nachhaltige Entwicklung und Biodiversitätserhaltung dienen.
In der Aufnahme
- Habitatstruktur und Vielfalt: Ein erfolgreicher Lebensraum für Zauneidechsen zeichnet sich durch eine Vielzahl von Strukturen aus, die verschiedene Lebensphasen der Tiere unterstützen. Dazu gehören sonnenexponierte Flächen, Vegetationszonen mit niedriger Vegetation für das Sonnenbaden, sowie Versteckmöglichkeiten wie Steinhaufen oder Holzstapel.
- Vernetzung und Korridore: Um die Mobilität und genetische Vielfalt der Populationen zu fördern, sollten Lebensräume entlang von Flurwegen durch grüne Korridore verbunden werden. Diese ermöglichen es den Zauneidechsen, sich sicher zwischen verschiedenen Lebensräumen zu bewegen.
- Berücksichtigung ökologischer Ansprüche: Es ist wichtig, die spezifischen ökologischen Bedürfnisse der Zauneidechsen zu kennen und in die Gestaltung einzubeziehen. Dazu gehören Aspekte wie Nahrungsvorkommen, Neststandorte und Winterquartiere.
- Nachhaltige Pflege und Management: Die langfristige Erhaltung des Lebensraums erfordert eine nachhaltige Pflege, die invasive Pflanzen kontrolliert, natürliche Sukzession zulässt und regelmäßige Untersuchungen der Populationen durchführt.
- Partizipative Planung und Bildung: Die Einbindung der lokalen Gemeinschaft in die Planung und Pflege der Lebensräume fördert nicht nur das Verständnis für die Bedeutung der Artenvielfalt, sondern auch die langfristige Unterstützung und den Schutz der Lebensräume.
Insgesamt bietet die innovative Gestaltung von Zauneidechsenlebensräumen entlang von Flurwegen eine Chance, städtische und ländliche Landschaften ökologisch aufzuwerten und gleichzeitig zur Erhaltung bedrohter Arten beizutragen. Durch sorgfältige Planung und Umsetzung können solche Projekte als Modell für nachhaltige Entwicklung und Biodiversitätserhaltung dienen.
In der Aufnahme
- Durch die Anlage spezieller Lebensraumstrukturen geben wir "nachrangigen" Strukturen eine Perspektive!
Artenschutz in Franken®
Rostgans (Tadorna ferruginea) ... auf Nistplatzsuche

Rostgans (Tadorna ferruginea) ... auf Nistplatzsuche
26/27.04.2025
Sie wird auch als Rosapelikanente oder Schabrackengans bezeichnet, aufgrund ihres auffälligen Gefieders und ihrer eleganten Erscheinung.
26/27.04.2025
- Die Rostgans (Tadorna ferruginea) ist eine faszinierende Wasservogelart aus der Familie der Entenvögel (Anatidae).
Sie wird auch als Rosapelikanente oder Schabrackengans bezeichnet, aufgrund ihres auffälligen Gefieders und ihrer eleganten Erscheinung.
Beschreibung der Rostgans:
Die Rostgans ist eine mittelgroße Entenart, die eine Körperlänge von etwa 58 bis 72 Zentimetern erreicht, mit einer Flügelspannweite von ungefähr 110 bis 135 Zentimetern. Charakteristisch ist ihr kontrastreiches Gefieder: Der Kopf und Hals sind dunkelgrün, der Brustbereich ist rostrot bis kastanienbraun gefärbt, während der Rücken und die Flügel eine dunkle Schuppenzeichnung aufweisen. Die Unterseite ist heller und zeigt weiße Flecken, besonders auffällig im Flug.
Verbreitung und Lebensraum:
Rostgänse sind Zugvögel und brüten hauptsächlich in Zentralasien und Osteuropa, einschließlich Russlands. Während des Winters ziehen sie in mildere Regionen, darunter Südeuropa, Nordafrika, Indien und Teile Südostasiens. Sie bevorzugen feuchte, offene Landschaften wie Wiesen, Feuchtgebiete, Seen und Flüsse.
Verhalten und Nahrung:
Diese Gänse sind gesellig und bilden oft große Schwärme. Sie ernähren sich hauptsächlich von Pflanzenmaterial, darunter Gräser, Kräuter und Wasservegetation. Gelegentlich nehmen sie auch Insekten und andere kleine Wirbellose zu sich.
Nistverhalten und Präferenzen:
Interessanterweise zeigen Rostgänse eine Vorliebe für ungewöhnliche Nistplätze, einschließlich Nistkästen, die normalerweise von Turmfalken oder Schleiereulen besiedelt werden. Diese Vögel nutzen oft die erhöhten Positionen dieser Nistkästen, um potenzielle Gefahren frühzeitig zu erkennen und sich vor Fressfeinden zu schützen. Diese Verhaltensweise ist eine Anpassung an ihre natürliche Umgebung, in der die erhöhte Position eine bessere Sicht und Sicherheit bietet.
Zusammenfassung:
Die Rostgans ist nicht nur ein auffälliger Wasservogel, sondern auch ein Beispiel für Anpassungsfähigkeit und das Nutzen ungewöhnlicher Nistgelegenheiten. Ihre Fähigkeit, Nisthilfen von Turmfalken oder Schleiereulen zu besiedeln, zeigt ihre flexible Natur und ihr intelligentes Verhalten, um optimale Brutbedingungen zu finden.
In der Aufnahme
Die Rostgans ist eine mittelgroße Entenart, die eine Körperlänge von etwa 58 bis 72 Zentimetern erreicht, mit einer Flügelspannweite von ungefähr 110 bis 135 Zentimetern. Charakteristisch ist ihr kontrastreiches Gefieder: Der Kopf und Hals sind dunkelgrün, der Brustbereich ist rostrot bis kastanienbraun gefärbt, während der Rücken und die Flügel eine dunkle Schuppenzeichnung aufweisen. Die Unterseite ist heller und zeigt weiße Flecken, besonders auffällig im Flug.
Verbreitung und Lebensraum:
Rostgänse sind Zugvögel und brüten hauptsächlich in Zentralasien und Osteuropa, einschließlich Russlands. Während des Winters ziehen sie in mildere Regionen, darunter Südeuropa, Nordafrika, Indien und Teile Südostasiens. Sie bevorzugen feuchte, offene Landschaften wie Wiesen, Feuchtgebiete, Seen und Flüsse.
Verhalten und Nahrung:
Diese Gänse sind gesellig und bilden oft große Schwärme. Sie ernähren sich hauptsächlich von Pflanzenmaterial, darunter Gräser, Kräuter und Wasservegetation. Gelegentlich nehmen sie auch Insekten und andere kleine Wirbellose zu sich.
Nistverhalten und Präferenzen:
Interessanterweise zeigen Rostgänse eine Vorliebe für ungewöhnliche Nistplätze, einschließlich Nistkästen, die normalerweise von Turmfalken oder Schleiereulen besiedelt werden. Diese Vögel nutzen oft die erhöhten Positionen dieser Nistkästen, um potenzielle Gefahren frühzeitig zu erkennen und sich vor Fressfeinden zu schützen. Diese Verhaltensweise ist eine Anpassung an ihre natürliche Umgebung, in der die erhöhte Position eine bessere Sicht und Sicherheit bietet.
Zusammenfassung:
Die Rostgans ist nicht nur ein auffälliger Wasservogel, sondern auch ein Beispiel für Anpassungsfähigkeit und das Nutzen ungewöhnlicher Nistgelegenheiten. Ihre Fähigkeit, Nisthilfen von Turmfalken oder Schleiereulen zu besiedeln, zeigt ihre flexible Natur und ihr intelligentes Verhalten, um optimale Brutbedingungen zu finden.
In der Aufnahme
- Systematisch sucht ein Paar Rostgänse u.a. die Häuser eines kleinen Weilers ab um dann auf die Nisthilfe eines Turmfalken welche durch Artenschutz in Franken® vor über 10 Jahren angebracht wurde, zu treffen und die ersten Verdrängunsversuche zu starten.
Artenschutz in Franken®
Wenn die Minikröten erscheinen ...

Wenn die Minikröten erscheinen ...
27/28.04.2025
Besonders bemerkenswert ist ihr alljährliches Verhalten zur Fortpflanzungszeit: die sogenannte Laichwanderung, die oft ganze Populationen in Bewegung setzt.
27/28.04.2025
- Die Erdkröte (Bufo bufo) ist eine der bekanntesten Amphibienarten Europas und spielt eine wichtige Rolle im ökologischen Gleichgewicht ihrer Lebensräume.
Besonders bemerkenswert ist ihr alljährliches Verhalten zur Fortpflanzungszeit: die sogenannte Laichwanderung, die oft ganze Populationen in Bewegung setzt.
Allgemeine Merkmale der Erdkröte:
Die Erdkröte gehört zur Familie der echten Kröten (Bufonidae). Sie ist relativ groß für eine Kröte: Weibchen erreichen bis zu 12 cm, Männchen bleiben mit etwa 8 cm kleiner. Ihre Haut ist trocken, warzig und meist bräunlich oder grau gefärbt – eine perfekte Tarnung am Waldboden. Die Augen stechen durch ihre goldene Iris mit waagerechtem, dunklem Pupillenschlitz hervor.
Lebensraum und Lebensweise:
Erdkröten sind dämmerungs- und nachtaktiv und leben bevorzugt in Laub- und Mischwäldern, Parks, Gärten sowie in der Nähe von Teichen und anderen Stillgewässern. Tagsüber verbergen sie sich unter Steinen, Holz oder in selbst gegrabenen Erdhöhlen. Ihre Nahrung besteht vor allem aus Insekten, Würmern, Nacktschnecken und anderen wirbellosen Kleintieren.
Laichwanderung – ein jährliches Naturschauspiel:
Im zeitigen Frühjahr – oft schon im Februar oder März – erwachen die Erdkröten aus der Winterstarre. Wenn die Temperaturen anhaltend über etwa 5–7 °C liegen und feuchtes Wetter herrscht, machen sie sich auf den Weg zu ihren angestammten Laichgewässern – oft genau zu dem Ort, an dem sie selbst einst geschlüpft sind. Dieses Verhalten zeigt einen beeindruckenden Orientierungssinn.
Die Wanderung kann mehrere hundert Meter bis hin zu mehreren Kilometern lang sein und stellt eine große Gefahr dar, besonders in von Menschen geprägten Landschaften mit Straßenverkehr. Daher sind vielerorts Krötenzäune und „Krötenretter“ aktiv, um die Tiere sicher über Straßen zu geleiten. Während der Wanderung reiten die kleineren Männchen oft schon auf dem Rücken der größeren Weibchen – das sogenannte Amplexus-Verhalten. Am Gewässer angekommen, legen die Weibchen in spiralig gedrehten Laichschnüren mehrere tausend Eier ab, die vom Männchen gleichzeitig befruchtet werden.
Der Abschluss der Wanderung – ein besonderes Zeichen:
Ein besonders faszinierender Aspekt dieser Wanderung ist das Erscheinen sehr junger Tiere gegen Ende der Fortpflanzungszeit. Diese Jungtiere, oft erst im Vorjahr selbst geschlüpft, machen sich ebenfalls auf den Weg zum Laichgewässer – möglicherweise noch nicht zur Fortpflanzung, sondern zur Prägung des Ortes. Ihr Auftauchen in der Nähe der Wanderroute gilt vielerorts als sicheres Zeichen dafür, dass die große Wanderbewegung der adulten Tiere bald abgeschlossen ist.
Dieses Verhalten zeigt, dass bereits junge Erdkröten Teil dieses generationsübergreifenden Zyklus sind – ein weiterer Hinweis auf den tief verwurzelten Instinkt, den Ursprungsort aufzusuchen und vielleicht im nächsten oder übernächsten Jahr selbst zum Fortpflanzungsgeschehen beizutragen.
Fazit:
Die Erdkröte beeindruckt nicht nur durch ihre Anpassungsfähigkeit und Robustheit, sondern besonders durch ihr jährliches Wanderverhalten zu den Laichgewässern. Der instinkthafte Marsch, der von alten wie jungen Tieren unternommen wird, zeugt von einem uralten Naturereignis, das Jahr für Jahr stattfindet – oft unbemerkt und dennoch voller Bedeutung. Das Erscheinen junger Tiere zum Abschluss der Wanderung markiert nicht nur das Ende eines Zyklus, sondern auch den Anfang des nächsten.
In der Aufnahme
Die Erdkröte gehört zur Familie der echten Kröten (Bufonidae). Sie ist relativ groß für eine Kröte: Weibchen erreichen bis zu 12 cm, Männchen bleiben mit etwa 8 cm kleiner. Ihre Haut ist trocken, warzig und meist bräunlich oder grau gefärbt – eine perfekte Tarnung am Waldboden. Die Augen stechen durch ihre goldene Iris mit waagerechtem, dunklem Pupillenschlitz hervor.
Lebensraum und Lebensweise:
Erdkröten sind dämmerungs- und nachtaktiv und leben bevorzugt in Laub- und Mischwäldern, Parks, Gärten sowie in der Nähe von Teichen und anderen Stillgewässern. Tagsüber verbergen sie sich unter Steinen, Holz oder in selbst gegrabenen Erdhöhlen. Ihre Nahrung besteht vor allem aus Insekten, Würmern, Nacktschnecken und anderen wirbellosen Kleintieren.
Laichwanderung – ein jährliches Naturschauspiel:
Im zeitigen Frühjahr – oft schon im Februar oder März – erwachen die Erdkröten aus der Winterstarre. Wenn die Temperaturen anhaltend über etwa 5–7 °C liegen und feuchtes Wetter herrscht, machen sie sich auf den Weg zu ihren angestammten Laichgewässern – oft genau zu dem Ort, an dem sie selbst einst geschlüpft sind. Dieses Verhalten zeigt einen beeindruckenden Orientierungssinn.
Die Wanderung kann mehrere hundert Meter bis hin zu mehreren Kilometern lang sein und stellt eine große Gefahr dar, besonders in von Menschen geprägten Landschaften mit Straßenverkehr. Daher sind vielerorts Krötenzäune und „Krötenretter“ aktiv, um die Tiere sicher über Straßen zu geleiten. Während der Wanderung reiten die kleineren Männchen oft schon auf dem Rücken der größeren Weibchen – das sogenannte Amplexus-Verhalten. Am Gewässer angekommen, legen die Weibchen in spiralig gedrehten Laichschnüren mehrere tausend Eier ab, die vom Männchen gleichzeitig befruchtet werden.
Der Abschluss der Wanderung – ein besonderes Zeichen:
Ein besonders faszinierender Aspekt dieser Wanderung ist das Erscheinen sehr junger Tiere gegen Ende der Fortpflanzungszeit. Diese Jungtiere, oft erst im Vorjahr selbst geschlüpft, machen sich ebenfalls auf den Weg zum Laichgewässer – möglicherweise noch nicht zur Fortpflanzung, sondern zur Prägung des Ortes. Ihr Auftauchen in der Nähe der Wanderroute gilt vielerorts als sicheres Zeichen dafür, dass die große Wanderbewegung der adulten Tiere bald abgeschlossen ist.
Dieses Verhalten zeigt, dass bereits junge Erdkröten Teil dieses generationsübergreifenden Zyklus sind – ein weiterer Hinweis auf den tief verwurzelten Instinkt, den Ursprungsort aufzusuchen und vielleicht im nächsten oder übernächsten Jahr selbst zum Fortpflanzungsgeschehen beizutragen.
Fazit:
Die Erdkröte beeindruckt nicht nur durch ihre Anpassungsfähigkeit und Robustheit, sondern besonders durch ihr jährliches Wanderverhalten zu den Laichgewässern. Der instinkthafte Marsch, der von alten wie jungen Tieren unternommen wird, zeugt von einem uralten Naturereignis, das Jahr für Jahr stattfindet – oft unbemerkt und dennoch voller Bedeutung. Das Erscheinen junger Tiere zum Abschluss der Wanderung markiert nicht nur das Ende eines Zyklus, sondern auch den Anfang des nächsten.
In der Aufnahme
- Mit dem Auftauchen kleiner Erdkröten erwarten wir das nahe Ende der jährlichen Zulaufphase.
Artenschutz in Franken®
Optimierung einer Artenschutzwand

Optimierung einer Artenschutzwand
25/26.04.2025
Was ist den eine Artenschutzwand?
25/26.04.2025
- Ein innovatives Kultur- Natur und Umweltbildungsprojekt von Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V.
Was ist den eine Artenschutzwand?
Eine Artenschutzwand ist eine spezielle Konstruktion, die darauf abzielt, Lebensraum und Schutz für bestimmte Tierarten zu bieten, insbesondere in menschlich beeinflussten oder urbanisierten Gebieten. Sie wird häufig in Bauprojekten oder bei der Renaturierung von Landschaften eingesetzt, um die Biodiversität zu fördern und den Anforderungen des Artenschutzes gerecht zu werden.
Aufbau und Funktion
Bedeutung für die Biodiversität
Erhalt von gefährdeten Arten:
Förderung der ökologischen Vernetzung:
Ersatzlebensraum:
Förderung von Ökosystemleistungen:
Sensibilisierung:
Fazit
In der Aufnahme
Aufbau und Funktion
- Materialien: Artenschutzwände bestehen häufig aus natürlichen Materialien wie Lehm, Holz, Sandstein oder einer Kombination aus künstlichen und natürlichen Substanzen.
- Struktur: Sie haben oft Löcher, Nischen oder Schlitze, die als Brut- und Nistplätze für verschiedene Arten dienen können.
- Standort: Die Wände werden strategisch in der Nähe von Lebensräumen aufgestellt, die von der Fragmentierung bedroht sind, z. B. an Straßenrändern, in Parks oder entlang von Flussufern.
Bedeutung für die Biodiversität
Erhalt von gefährdeten Arten:
- Artenschutzwände bieten gezielten Schutz für Tiere wie Fledermäuse, Vögel, Amphibien, Insekten (z. B. Wildbienen) und Reptilien. Diese Arten sind oft durch Habitatverlust, Urbanisierung und landwirtschaftliche Intensivierung bedroht.
Förderung der ökologischen Vernetzung:
- In fragmentierten Landschaften stellen Artenschutzwände „Trittsteine“ dar, die den Austausch zwischen Populationen erleichtern. Dies hilft, genetische Vielfalt zu erhalten.
Ersatzlebensraum:
- In stark bebauten oder landwirtschaftlich genutzten Regionen können solche Wände als Ersatz für natürliche Nistplätze oder Rückzugsorte dienen, die durch Bau- oder Abholzungsarbeiten verloren gegangen sind.
Förderung von Ökosystemleistungen:
- Die Arten, die von Artenschutzwänden profitieren, spielen oft eine Schlüsselrolle im Ökosystem. Wildbienen beispielsweise bestäuben Pflanzen, was zur Erhaltung der Pflanzenvielfalt beiträgt. Fledermäuse und Vögel regulieren Schädlingspopulationen.
Sensibilisierung:
- Artenschutzwände haben oft auch eine edukative Funktion. Sie machen Menschen auf die Bedeutung des Artenschutzes aufmerksam und zeigen, wie gezielte Maßnahmen helfen können, Biodiversität zu schützen.
Fazit
- Artenschutzwände sind ein effektives Mittel, um die negativen Auswirkungen menschlicher Eingriffe auf die Natur abzumildern. Sie fördern die Biodiversität, indem sie Schutzräume schaffen und zur Vernetzung von Lebensräumen beitragen. Ihre Bedeutung wird insbesondere in Zeiten wachsender Umweltprobleme immer größer.
In der Aufnahme
- Am 17. April 2025 wurde die Schattierung in die farbige Fassade eingebunden um einen natürlichen Eindruck einer Sandwandfläche zu imitieren ...
Artenschutz in Franken®
Die Zauneidechse (Lacerta agilis)

Die Zauneidechse (Lacerta agilis)
24/24.04.2025
- Schwanzautotomie – Selbstamputation als Überlebensstrategie
Ein faszinierender Aspekt der Zauneidechse ist die Fähigkeit zur Autotomie – dem gezielten Abwerfen des Schwanzes als Fluchtmechanismus bei Feindkontakt. Dies ist eine wichtige Schutzmaßnahme gegen Fressfeinde wie Greifvögel, Marder oder Katzen.
Ablauf der Autotomie:
Regeneration:
Diese Strategie ist zwar lebensrettend, stellt jedoch einen hohen energetischen Aufwand dar und kann langfristig zu Wettbewerbsnachteilen bei der Fortpflanzung führen.
In der Aufnahme
- Der Schwanz ist in mehreren Segmenten vorgeformt für eine kontrollierte Abtrennung.
- Bei Bedrohung zieht die Eidechse ihre Muskulatur so zusammen, dass der Schwanz an einer Sollbruchstelle abfällt.
- Der abgeworfene Schwanz zuckt und windet sich weiterhin – dies lenkt den Angreifer ab und verschafft dem Tier Zeit zur Flucht.
Regeneration:
- Ein neuer Schwanz wächst nach, jedoch meist kürzer und mit veränderter Struktur (z. B. fehlende Knochen, stattdessen Knorpelgewebe).
- Die Regenerationszeit beträgt mehrere Wochen bis Monate.
- Der nachgewachsene Schwanz ist weniger funktional, vor allem hinsichtlich Balance und Kommunikation.
Diese Strategie ist zwar lebensrettend, stellt jedoch einen hohen energetischen Aufwand dar und kann langfristig zu Wettbewerbsnachteilen bei der Fortpflanzung führen.
In der Aufnahme
- Zauneidechse die bereits schon inmal einen Teil ihres Schwanzes verloren hatte und der kürzer als der ursprüngliche Schwanz nachgewachsen ist.
Artenschutz in Franken®
Zweites Storchenpaar in der Stadt Schlüsselfeld

Zweites Storchenpaar in der Stadt Schlüsselfeld
23/24.04.2025
Hier einige Vorraussetzungen die gegeben sein sollten:
23/24.04.2025
- Mehrere Weißstorchpaare (Ciconia ciconia) können sich unmittelbar nebeneinander niederlassen, wenn bestimmte ökologische, soziale und territoriale Bedingungen erfüllt sind.
Hier einige Vorraussetzungen die gegeben sein sollten:
Ausreichendes Nahrungsangebot
Die wichtigste Voraussetzung ist ein reichhaltiges, ausreichend großes Nahrungsrevier in der Umgebung. Weißstörche benötigen feuchte Wiesen, Flachgewässer oder extensiv genutztes Grünland, um Futter wie Amphibien, Insekten, Regenwürmer oder Kleinsäuger zu finden. Nur wenn genügend Nahrung vorhanden ist, tolerieren sich mehrere Brutpaare in direkter Nähe.
Nistplatzangebot und -struktur
Wenn geeignete Niststrukturen vorhanden sind – wie Dachflächen, Schornsteine, Nistplattformen oder Bäume – und diese statisch stabil und groß genug sind, können mehrere Paare in geringer Distanz brüten. Manchmal entstehen sogenannte Koloniebruten, bei denen Nester nur wenige Meter auseinanderliegen.
Soziale Toleranz und Verhalten
Obwohl Weißstörche grundsätzlich territoriale Brutvögel sind, zeigen sie unter günstigen Umweltbedingungen eine erhöhte sozialräumliche Toleranz. Das heißt: Wenn kein Mangel an Ressourcen besteht, akzeptieren sie die Nähe anderer Paare, ohne aggressives Revierverhalten zu zeigen.
Populationsdruck und Erfahrung
In Jahren mit hoher Populationsdichte oder wenn viele unerfahrene Jungstörche zurückkehren, kann es zu einer Verdichtung von Neststandorten kommen. Insbesondere junge Paare siedeln sich oft in unmittelbarer Nähe etablierter Brutpaare an.
Menschliche Einflussfaktoren
In manchen Regionen haben Menschen gezielt Nisthilfen (z. B. mehrere Plattformen auf demselben Gebäude) errichtet oder dulden Nester auf Häusern und Kaminen. Dies schafft zusätzliche Brutplätze, die auch in unmittelbarer Nähe zueinander akzeptiert werden.
Fazit:
Mehrere Weißstorchpaare können sich unmittelbar nebeneinander niederlassen, wenn Nahrung in ausreichender Menge vorhanden ist, geeignete Nistplätze bestehen, und eine hohe soziale Toleranz unter den Individuen möglich ist – etwa durch gute Umweltbedingungen oder Koloniebrüten. Das Verhalten ist also ökologisch flexibel und passt sich an lokale Gegebenheiten an.
In der Aufnahme
Die wichtigste Voraussetzung ist ein reichhaltiges, ausreichend großes Nahrungsrevier in der Umgebung. Weißstörche benötigen feuchte Wiesen, Flachgewässer oder extensiv genutztes Grünland, um Futter wie Amphibien, Insekten, Regenwürmer oder Kleinsäuger zu finden. Nur wenn genügend Nahrung vorhanden ist, tolerieren sich mehrere Brutpaare in direkter Nähe.
Nistplatzangebot und -struktur
Wenn geeignete Niststrukturen vorhanden sind – wie Dachflächen, Schornsteine, Nistplattformen oder Bäume – und diese statisch stabil und groß genug sind, können mehrere Paare in geringer Distanz brüten. Manchmal entstehen sogenannte Koloniebruten, bei denen Nester nur wenige Meter auseinanderliegen.
Soziale Toleranz und Verhalten
Obwohl Weißstörche grundsätzlich territoriale Brutvögel sind, zeigen sie unter günstigen Umweltbedingungen eine erhöhte sozialräumliche Toleranz. Das heißt: Wenn kein Mangel an Ressourcen besteht, akzeptieren sie die Nähe anderer Paare, ohne aggressives Revierverhalten zu zeigen.
Populationsdruck und Erfahrung
In Jahren mit hoher Populationsdichte oder wenn viele unerfahrene Jungstörche zurückkehren, kann es zu einer Verdichtung von Neststandorten kommen. Insbesondere junge Paare siedeln sich oft in unmittelbarer Nähe etablierter Brutpaare an.
Menschliche Einflussfaktoren
In manchen Regionen haben Menschen gezielt Nisthilfen (z. B. mehrere Plattformen auf demselben Gebäude) errichtet oder dulden Nester auf Häusern und Kaminen. Dies schafft zusätzliche Brutplätze, die auch in unmittelbarer Nähe zueinander akzeptiert werden.
Fazit:
Mehrere Weißstorchpaare können sich unmittelbar nebeneinander niederlassen, wenn Nahrung in ausreichender Menge vorhanden ist, geeignete Nistplätze bestehen, und eine hohe soziale Toleranz unter den Individuen möglich ist – etwa durch gute Umweltbedingungen oder Koloniebrüten. Das Verhalten ist also ökologisch flexibel und passt sich an lokale Gegebenheiten an.
In der Aufnahme
- Im April 2025 können wir diese Situation dokumentieren ... auf dem Rathaus findet sich der Weißstorch seit geraumer Zeit ein um sich zu Reproduzieren. Nur wenige Meter weiter konnte ein zweites Paar nun auf einem Kamin eine Nistplatzgrundlage installieren.
Artenschutz in Franken®
Erst wenn der letzte Waldbach trocken gefallen ist ...

Erst wenn der letzte Waldbach trocken gefallen ist ...
22/23.04.2025
Steigerwald / Bayern. Hohe Temperaturen finden sich im Forstinneren ... vormals konnte man beim Betreten des "Waldes" deutlich den Unterschied zwischen Offenland und "Wald" auf der eigenen Haut spüren ... doch die Verantwortlichen welche mit dem Umbau zum Klimawald befasst sind haben spürbar dafür gesorgt, dass dieser Unterschied kaum mehr spürbar ist.
Hier wurde wirklich ganze Arbeit geleistet und nun stellt sich die Frage auch kaum mehr weshalb es im "Wald" so warm ist ...
22/23.04.2025
Steigerwald / Bayern. Hohe Temperaturen finden sich im Forstinneren ... vormals konnte man beim Betreten des "Waldes" deutlich den Unterschied zwischen Offenland und "Wald" auf der eigenen Haut spüren ... doch die Verantwortlichen welche mit dem Umbau zum Klimawald befasst sind haben spürbar dafür gesorgt, dass dieser Unterschied kaum mehr spürbar ist.
Hier wurde wirklich ganze Arbeit geleistet und nun stellt sich die Frage auch kaum mehr weshalb es im "Wald" so warm ist ...
... selbst weniger fachlich bewanderte Strukturen können sehen an was dieser Temperatursprung liegt ... was soll denn das für eine Art Klimawald werden? Ein Hitzewald? Von Kühle ist zumindest kaum mehr was zu spüren. Wohl noch einige dieser Trockenjahre und das mit dem Klimawald hat sich erledigt auch wenn die "letzten Rehe gefallen sind".
Dann sprechen wir bald über 2,5 oder gar 3,0 Grad welche auch diesen "Klimawald" neu herausfordern werden. Was für ein Klimawald wird denn dann gepflanzt? Ein womöglich gentechnisch veränderter Wald? Es wäre an der Zeit mal einen wirklichen Wald wachsen zu lassen damit uns dieser zeigen kann was standortgerecht wachsen kann.
Den Pflanzen einfach mal die Chance einzuräumen sich an klimatische Faktoren anpassen zu können wäre angebracht, anstatt ständig "herumzuforsten", das ist unsere feste Überzeugung. Im Idealfall wäre die Installation eines Großschutzgebiets, die nach unserer Auffassung optimale Vorbereitung auf ein sich wandelndes Klima.
In der Aufnahme
Dann sprechen wir bald über 2,5 oder gar 3,0 Grad welche auch diesen "Klimawald" neu herausfordern werden. Was für ein Klimawald wird denn dann gepflanzt? Ein womöglich gentechnisch veränderter Wald? Es wäre an der Zeit mal einen wirklichen Wald wachsen zu lassen damit uns dieser zeigen kann was standortgerecht wachsen kann.
Den Pflanzen einfach mal die Chance einzuräumen sich an klimatische Faktoren anpassen zu können wäre angebracht, anstatt ständig "herumzuforsten", das ist unsere feste Überzeugung. Im Idealfall wäre die Installation eines Großschutzgebiets, die nach unserer Auffassung optimale Vorbereitung auf ein sich wandelndes Klima.
In der Aufnahme
- Hohe Bodenverdichtung und eine zunehmend "Lichtstellung" setzen auch dem Steigerwald merklich zu. Dennoch ... es wird vielfach weiter umgebaut bis ein Klimawald (ein 1,5 Grad Klimawald oder ein 2,5 Grad Klimawald oder ein 3,5 Grad Klimwald?) entstanden ist .. das Problem, bis der Klimawald groß geworden ist werden ganz andere klimatische Bedingungen herrschen als derzeit - und dann?
Artenschutz in Franken®
Die Europäische Maulwurfsgrille (Gryllotalpa gryllotalpa)

Stark gefährdet - Die Europäische Maulwurfsgrille (Gryllotalpa gryllotalpa)
21/22.04.2025
Sie ist in verschiedenen Teilen Europas heimisch und hat eine einzigartige ökologische Rolle sowie eine komplexe Beziehung zu menschlichen Aktivitäten.
21/22.04.2025
- Die Europäische Maulwurfsgrille, wissenschaftlich bekannt als Gryllotalpa gryllotalpa, ist ein Insekt aus der Familie der Maulwurfsgrillen (Gryllotalpidae).
Sie ist in verschiedenen Teilen Europas heimisch und hat eine einzigartige ökologische Rolle sowie eine komplexe Beziehung zu menschlichen Aktivitäten.
Taxonomie und Merkmale
Die Gryllotalpa gryllotalpa gehört zur Ordnung der Orthopteren und zeichnet sich durch ihre robuste Körperstruktur und ihre adaptierten Grabbeine aus. Erwachsene Individuen können eine Körperlänge von bis zu 4 cm erreichen und besitzen charakteristische kraftvolle Mandibeln zur Nahrungsaufnahme und Tunnelgrabung.
Lebensraum und Verbreitung
Diese Art bewohnt vorwiegend landwirtschaftlich genutzte Gebiete sowie feuchte Wiesen und Gärten in gemäßigten Klimazonen Europas. Sie sind besonders häufig in Regionen mit lockerem Boden und ausreichender Feuchtigkeit anzutreffen, die ideale Bedingungen für ihre Lebensweise bieten.
Biologie und Verhalten
Europäische Maulwurfsgrillen sind nachtaktiv und ernähren sich von Pflanzenwurzeln, insbesondere von Gräsern und landwirtschaftlichen Kulturpflanzen. Ihr Grabverhalten führt oft zu weitläufigen unterirdischen Gängen, die den Wurzelsystemen von Pflanzen schaden können, was sie zu einer potenziellen Bedrohung für landwirtschaftliche Erträge macht.
Ökologische Bedeutung
Obwohl sie als menschliche Schädlinge betrachtet werden, spielen Maulwurfsgrillen eine wichtige Rolle im Ökosystem, indem sie den Boden belüften und die Durchlässigkeit für Wasser verbessern. Ihr Kot trägt zur Bodenfruchtbarkeit bei, was ihre ökologische Bedeutung trotz ihrer negativen Auswirkungen auf die Landwirtschaft unterstreicht.
Menschliche Interaktion und Konflikte
Die Europäische Maulwurfsgrille wird von Landwirten und Gärtnern oft als Schädling angesehen, da ihre Aktivitäten direkte wirtschaftliche Verluste verursachen können. Die Schäden an Wurzelsystemen können das Pflanzenwachstum hemmen und die Ernteerträge verringern, was zu finanziellen Einbußen führt.
Schutzmaßnahmen und Förderung
Um den (aus menschlicher Sicht) negativen Auswirkungen entgegenzuwirken und den Schutz dieser Art zu fördern, sind verschiedene Maßnahmen möglich:
Schlussfolgerung
Die Europäische Maulwurfsgrille ist ein faszinierendes Beispiel für die komplexen Wechselwirkungen zwischen Mensch und Natur. Ihr Schutz erfordert eine ausgewogene Herangehensweise, die ökologische, wirtschaftliche und soziale Aspekte berücksichtigt, um langfristige Lösungen für die Koexistenz zu entwickeln.
Diese umfassende Analyse zeigt, dass trotz ihrer negativen Auswirkungen die Förderung eines ausgewogenen ökologischen Gleichgewichts entscheidend ist, um sowohl die Interessen der Landwirtschaft (wobei gerade die industriell geführte Landwischrtschaft eine in unserer Augen immense Gefahr für ie Biodiversität abbildet) als auch den Erhalt der Biodiversität zu unterstützen.
In der Aufnahme von Helga und Hubertus Zinnecker
Die Gryllotalpa gryllotalpa gehört zur Ordnung der Orthopteren und zeichnet sich durch ihre robuste Körperstruktur und ihre adaptierten Grabbeine aus. Erwachsene Individuen können eine Körperlänge von bis zu 4 cm erreichen und besitzen charakteristische kraftvolle Mandibeln zur Nahrungsaufnahme und Tunnelgrabung.
Lebensraum und Verbreitung
Diese Art bewohnt vorwiegend landwirtschaftlich genutzte Gebiete sowie feuchte Wiesen und Gärten in gemäßigten Klimazonen Europas. Sie sind besonders häufig in Regionen mit lockerem Boden und ausreichender Feuchtigkeit anzutreffen, die ideale Bedingungen für ihre Lebensweise bieten.
Biologie und Verhalten
Europäische Maulwurfsgrillen sind nachtaktiv und ernähren sich von Pflanzenwurzeln, insbesondere von Gräsern und landwirtschaftlichen Kulturpflanzen. Ihr Grabverhalten führt oft zu weitläufigen unterirdischen Gängen, die den Wurzelsystemen von Pflanzen schaden können, was sie zu einer potenziellen Bedrohung für landwirtschaftliche Erträge macht.
Ökologische Bedeutung
Obwohl sie als menschliche Schädlinge betrachtet werden, spielen Maulwurfsgrillen eine wichtige Rolle im Ökosystem, indem sie den Boden belüften und die Durchlässigkeit für Wasser verbessern. Ihr Kot trägt zur Bodenfruchtbarkeit bei, was ihre ökologische Bedeutung trotz ihrer negativen Auswirkungen auf die Landwirtschaft unterstreicht.
Menschliche Interaktion und Konflikte
Die Europäische Maulwurfsgrille wird von Landwirten und Gärtnern oft als Schädling angesehen, da ihre Aktivitäten direkte wirtschaftliche Verluste verursachen können. Die Schäden an Wurzelsystemen können das Pflanzenwachstum hemmen und die Ernteerträge verringern, was zu finanziellen Einbußen führt.
Schutzmaßnahmen und Förderung
Um den (aus menschlicher Sicht) negativen Auswirkungen entgegenzuwirken und den Schutz dieser Art zu fördern, sind verschiedene Maßnahmen möglich:
- Integriertes Schädlingsmanagement: Nutzung von biologischen Kontrollmethoden, die gezielt auf die Bekämpfung der Maulwurfsgrillen abzielen, ohne die Umwelt zu belasten.
- Habitatschutz: Erhalt und Schaffung von Lebensräumen, die für die Maulwurfsgrillen weniger attraktiv sind, um Konflikte mit landwirtschaftlichen Interessen zu reduzieren.
- Bildung und Forschung: Förderung des Verständnisses für die ökologische Rolle der Maulwurfsgrillen und die Entwicklung nachhaltiger Praktiken im Umgang mit Schädlingen.
Schlussfolgerung
Die Europäische Maulwurfsgrille ist ein faszinierendes Beispiel für die komplexen Wechselwirkungen zwischen Mensch und Natur. Ihr Schutz erfordert eine ausgewogene Herangehensweise, die ökologische, wirtschaftliche und soziale Aspekte berücksichtigt, um langfristige Lösungen für die Koexistenz zu entwickeln.
Diese umfassende Analyse zeigt, dass trotz ihrer negativen Auswirkungen die Förderung eines ausgewogenen ökologischen Gleichgewichts entscheidend ist, um sowohl die Interessen der Landwirtschaft (wobei gerade die industriell geführte Landwischrtschaft eine in unserer Augen immense Gefahr für ie Biodiversität abbildet) als auch den Erhalt der Biodiversität zu unterstützen.
In der Aufnahme von Helga und Hubertus Zinnecker
- Maulwurfsgrile in Nahaufanhme
Artenschutz in Franken®
Aktueller Ordner:
Archiv
Parallele Themen:
2019-11
2019-10
2019-12
2020-01
2020-02
2020-03
2020-04
2020-05
2020-06
2020-07
2020-08
2020-09
2020-10
2020-11
2020-12
2021-01
2021-02
2021-03
2021-04
2021-05
2021-06
2021-07
2021-08
2021-09
2021-10
2021-11
2021-12
2022-01
2022-02
2022-03
2022-04
2022-05
2022-06
2022-07
2022-08
2022-09
2022-10
2022-11
2022-12
2023-01
2023-02
2023-03
2023-04
2023-05
2023-06
2023-07
2023-08
2023-09
2023-10
2023-11
2023-12
2024-01
2024-02
2024-03
2024-04
2024-05
2024-06
2024-07
2024-08
2024-09
2024-10
2024-11
2024-12
2025-01
2025-02
2025-03
2025-04
2025-05
2025-06
2025-07
2025-08
2025-09
2025-10
2025-11
2025-12
















