Parasiten – Meister der Tarnung und Manipulation

Parasiten – Meister der Tarnung und Manipulation
14/15.08.2025
Selbst wehrhafte Insekten wie Wespen oder Bienen, die mit ihrem Stachel viele Feinde abschrecken, können sich nicht gegen alle Angreifer wehren. Unter ihren unsichtbaren Widersachern finden sich hochspezialisierte Arten, deren Lebensweise so bizarr wie raffiniert ist.
14/15.08.2025
- Sie sind winzig, unscheinbar und doch wahre Strategen: Parasiten. Viele von ihnen leben verborgen im Körper eines anderen Lebewesens, steuern dessen Verhalten und verändern sein Leben – oft ohne dass der Wirt überhaupt etwas bemerkt.
Selbst wehrhafte Insekten wie Wespen oder Bienen, die mit ihrem Stachel viele Feinde abschrecken, können sich nicht gegen alle Angreifer wehren. Unter ihren unsichtbaren Widersachern finden sich hochspezialisierte Arten, deren Lebensweise so bizarr wie raffiniert ist.
Der fast unsichtbare Feind im Wespenkörper
Eine dieser Arten ist ein winziger Fächerflügler (Strepsiptera), der gezielt Feldwespen befällt. Seine Larven klammern sich am Hinterleib der Wespe fest und entwickeln sich dort. Weibliche Parasiten verlassen den Wirt nie wieder – ihre Kopfkapseln ragen gut sichtbar zwischen den Hinterleibsringen hervor. Solche Wespen gelten als „stylopisiert“ – äußerlich noch Wespe, innerlich längst vom Parasiten beherrscht.
Wenn Parasiten das Verhalten umschreiben
Rund 40 % aller bekannten Tierarten sind Parasiten – und viele davon greifen nicht nur den Körper, sondern auch das Gehirn ihres Wirts an.
Ein bekanntes Beispiel: der Erreger der Toxoplasmose. Bei Mäusen löscht er die angeborene Angst vor Katzen, sodass sie leichter gefressen werden – und der Parasit so in seinen nächsten Wirt gelangt. Selbst beim Menschen wird erforscht, ob eine Infektion das Verhalten beeinflusst. Klar ist: In der Schwangerschaft kann der Erreger gefährlich werden.
Der „Zombie-Mechanismus“ im Ameisenkörper
Besonders eindringlich zeigt sich die Macht der Parasiten beim kleinen Leberegel. Er nutzt Ameisen als Zwischenwirt – und verändert deren Verhalten auf erschreckende Weise:
Dieses Verhalten ist kein Zufall – es ist das Ergebnis gezielter Manipulation durch den Parasiten. Die Ameise wird zu einem „Zombie“ im Dienst ihres ungebetenen Passagiers.
Parasiten – Gefahr und Motor der Evolution
Was zunächst nur bedrohlich wirkt, ist auch ein treibender Faktor der Natur. Wirte entwickeln Abwehrstrategien, Parasiten neue Angriffsmethoden. Dieses unsichtbare Wettrennen formt beide Seiten – und trägt dazu bei, dass sich das Leben immer weiter verändert und anpasst.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
Eine dieser Arten ist ein winziger Fächerflügler (Strepsiptera), der gezielt Feldwespen befällt. Seine Larven klammern sich am Hinterleib der Wespe fest und entwickeln sich dort. Weibliche Parasiten verlassen den Wirt nie wieder – ihre Kopfkapseln ragen gut sichtbar zwischen den Hinterleibsringen hervor. Solche Wespen gelten als „stylopisiert“ – äußerlich noch Wespe, innerlich längst vom Parasiten beherrscht.
Wenn Parasiten das Verhalten umschreiben
Rund 40 % aller bekannten Tierarten sind Parasiten – und viele davon greifen nicht nur den Körper, sondern auch das Gehirn ihres Wirts an.
Ein bekanntes Beispiel: der Erreger der Toxoplasmose. Bei Mäusen löscht er die angeborene Angst vor Katzen, sodass sie leichter gefressen werden – und der Parasit so in seinen nächsten Wirt gelangt. Selbst beim Menschen wird erforscht, ob eine Infektion das Verhalten beeinflusst. Klar ist: In der Schwangerschaft kann der Erreger gefährlich werden.
Der „Zombie-Mechanismus“ im Ameisenkörper
Besonders eindringlich zeigt sich die Macht der Parasiten beim kleinen Leberegel. Er nutzt Ameisen als Zwischenwirt – und verändert deren Verhalten auf erschreckende Weise:
- Infizierte Ameisen verlassen nachts nicht mehr den Grashalm, an dem sie sitzen.
- Sie klammern sich dort fest, scheinbar willenlos.
- So werden sie leicht von Weidetieren gefressen – und der Parasit gelangt in seinen Endwirt, um sich fortzupflanzen.
Dieses Verhalten ist kein Zufall – es ist das Ergebnis gezielter Manipulation durch den Parasiten. Die Ameise wird zu einem „Zombie“ im Dienst ihres ungebetenen Passagiers.
Parasiten – Gefahr und Motor der Evolution
Was zunächst nur bedrohlich wirkt, ist auch ein treibender Faktor der Natur. Wirte entwickeln Abwehrstrategien, Parasiten neue Angriffsmethoden. Dieses unsichtbare Wettrennen formt beide Seiten – und trägt dazu bei, dass sich das Leben immer weiter verändert und anpasst.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- Die Art xenos vesparum befällt die Feldwespen, Gattung Polistes. Ihre Larven heften sich am Hinterleib der Wespe fest. Wenn sie erwachsen sind, bleiben die Weibchen auf ihrem Wirt. Die Kopfkapseln schauen zwischen den Hinterleibsringen hervor. Eine solche Wespe nennt man "stylopisiert".
Artenschutz in Franken®
Schutz der Großen Wiesenameise ... Kennzeichung der Nistplätze

Schutz der Großen Wiesenameise – Kennzeichnung und Bewahrung wertvoller Nistplätze
13/14.08.2025
Sie besiedelt bevorzugt sonnige, offene Wiesenflächen, extensiv genutzte Weiden oder magere Säume, wo sie ihre charakteristischen Nesthügel errichtet. Diese Hügel sind nicht nur das Zentrum eines hochkomplexen Ameisenstaates, sondern auch Lebensraum und Nahrungsquelle für viele andere Tierarten – von spezialisierten Käfern über Spinnen bis hin zu verschiedenen Vogelarten.
13/14.08.2025
- Die Große Wiesenameise (Formica pratensis) ist eine auffällige und ökologisch bedeutsame Ameisenart unserer heimischen Kulturlandschaften.
Sie besiedelt bevorzugt sonnige, offene Wiesenflächen, extensiv genutzte Weiden oder magere Säume, wo sie ihre charakteristischen Nesthügel errichtet. Diese Hügel sind nicht nur das Zentrum eines hochkomplexen Ameisenstaates, sondern auch Lebensraum und Nahrungsquelle für viele andere Tierarten – von spezialisierten Käfern über Spinnen bis hin zu verschiedenen Vogelarten.
Durch ihre Bautätigkeit lockern die Ameisen den Boden auf, fördern die Durchlüftung und verbessern die Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens. Zusätzlich tragen sie zur Verbreitung von Pflanzensamen bei und helfen, das ökologische Gleichgewicht zu bewahren, indem sie zahlreiche Insektenlarven und andere Kleintiere als Nahrungsquelle nutzen. Die Große Wiesenameise ist damit ein wichtiger „Schlüsselakteur“ im Ökosystem – klein an Körpergröße, aber groß in ihrer Wirkung.
Bedrohung durch menschliche Nutzung
Trotz ihrer ökologischen Bedeutung sind die Bestände der Großen Wiesenameise in vielen Regionen stark zurückgegangen. Hauptursachen sind die Intensivierung der Landwirtschaft, die Umwandlung von Wiesen in Ackerland sowie der Verlust geeigneter Lebensräume durch Bebauung. Eine besondere Gefahr stellt jedoch die unbeabsichtigte Zerstörung der Nesthügel bei Mäh- und Mulcharbeiten dar.
Da die Hügel oft unscheinbar im hohen Gras verborgen liegen, werden sie leicht übersehen. Ein einzelner Mähdurchgang kann das aufwendig errichtete Bauwerk irreparabel beschädigen und damit den gesamten Ameisenstaat vernichten.
Kennzeichnung als wirksamer Schutz
Um diesen Verlusten vorzubeugen, markieren wir die Nistplätze der Großen Wiesenameise mit hochwertigen, witterungsbeständigen Informationstafeln. Jede Tafel ist so gestaltet, dass sie sowohl Fachinformationen als auch gut verständliche Hinweise für die breite Öffentlichkeit bietet.
Die Beschilderung erfüllt zwei zentrale Funktionen:
Gemeinschaftsprojekt mit kommunaler Unterstützung
Dieses Vorhaben wird in enger Kooperation und Abstimmung mit verschiedenen Landkreisen und Städten umgesetzt. Durch die Zusammenarbeit mit den zuständigen Fachbehörden können wir sicherstellen, dass die Tafeln an den richtigen Standorten installiert und dauerhaft erhalten bleiben.
Ein Gewinn für Natur und Mensch
Die Kennzeichnung der Nistplätze ist ein vergleichsweise einfacher, aber sehr wirksamer Beitrag zum Erhalt einer bedrohten Art. Gleichzeitig leisten wir damit auch einen wichtigen Beitrag zur Umweltbildung. Wer einmal bewusst einen Ameisenhügel betrachtet, erkennt schnell, dass er kein „Hindernis“ bei der Pflege einer Fläche ist, sondern ein faszinierendes Naturbauwerk mit hohem Wert für das gesamte Ökosystem.
Unser Ziel ist klar: Die Große Wiesenameise soll auch in Zukunft in unseren Wiesenlandschaften leben und ihre wertvolle Arbeit als „Baumeisterin der Biodiversität“ fortsetzen können. Mit jeder Informationstafel setzen wir ein sichtbares Zeichen für Artenvielfalt, Rücksichtnahme und den achtsamen Umgang mit unserer Natur.
In der Aufnahme
Bedrohung durch menschliche Nutzung
Trotz ihrer ökologischen Bedeutung sind die Bestände der Großen Wiesenameise in vielen Regionen stark zurückgegangen. Hauptursachen sind die Intensivierung der Landwirtschaft, die Umwandlung von Wiesen in Ackerland sowie der Verlust geeigneter Lebensräume durch Bebauung. Eine besondere Gefahr stellt jedoch die unbeabsichtigte Zerstörung der Nesthügel bei Mäh- und Mulcharbeiten dar.
Da die Hügel oft unscheinbar im hohen Gras verborgen liegen, werden sie leicht übersehen. Ein einzelner Mähdurchgang kann das aufwendig errichtete Bauwerk irreparabel beschädigen und damit den gesamten Ameisenstaat vernichten.
Kennzeichnung als wirksamer Schutz
Um diesen Verlusten vorzubeugen, markieren wir die Nistplätze der Großen Wiesenameise mit hochwertigen, witterungsbeständigen Informationstafeln. Jede Tafel ist so gestaltet, dass sie sowohl Fachinformationen als auch gut verständliche Hinweise für die breite Öffentlichkeit bietet.
Die Beschilderung erfüllt zwei zentrale Funktionen:
- Schutzfunktion: Sie macht Nistplätze für Landwirte, kommunale Pflegekräfte und andere Flächennutzer klar erkennbar, sodass diese Bereiche bei Mäharbeiten gezielt ausgespart werden können.
- Bildungsfunktion: Passanten, Spaziergänger und Naturinteressierte erfahren Wissenswertes über die Lebensweise der Ameisen, ihre ökologische Rolle und die Gründe für ihren Schutz.
Gemeinschaftsprojekt mit kommunaler Unterstützung
Dieses Vorhaben wird in enger Kooperation und Abstimmung mit verschiedenen Landkreisen und Städten umgesetzt. Durch die Zusammenarbeit mit den zuständigen Fachbehörden können wir sicherstellen, dass die Tafeln an den richtigen Standorten installiert und dauerhaft erhalten bleiben.
Ein Gewinn für Natur und Mensch
Die Kennzeichnung der Nistplätze ist ein vergleichsweise einfacher, aber sehr wirksamer Beitrag zum Erhalt einer bedrohten Art. Gleichzeitig leisten wir damit auch einen wichtigen Beitrag zur Umweltbildung. Wer einmal bewusst einen Ameisenhügel betrachtet, erkennt schnell, dass er kein „Hindernis“ bei der Pflege einer Fläche ist, sondern ein faszinierendes Naturbauwerk mit hohem Wert für das gesamte Ökosystem.
Unser Ziel ist klar: Die Große Wiesenameise soll auch in Zukunft in unseren Wiesenlandschaften leben und ihre wertvolle Arbeit als „Baumeisterin der Biodiversität“ fortsetzen können. Mit jeder Informationstafel setzen wir ein sichtbares Zeichen für Artenvielfalt, Rücksichtnahme und den achtsamen Umgang mit unserer Natur.
In der Aufnahme
- Kennzeichung eines Nistplatzes der Großen Wiesenameise mittelbar an einer Kreisstraße gelegen. Der Nistplatz wurde bei den jählichen Mäharbeiten erkannt und ausgespart!
Artenschutz in Franken®
Respekt vor Natur und Tierwelt – Wenn Schutzgesetze ignoriert werden

„Wer mitten in der Brutzeit Lebensräume zerstört, zerstört Leben.“
12/13.08.2025
Zwischen März und September herrscht Vogelschutzzeit – ein gesetzlich verankerter Schutzraum für brütende Tiere und ihre Jungen. Trotzdem wurden Nester und ganze Lebensräume rücksichtslos beseitigt. Das ist nicht nur moralisch falsch, sondern in vielen Fällen gesetzeswidrig.
Respekt vor Natur und Tierwelt – Wenn Schutzgesetze ignoriert werden
Es ist ein Bild, das betroffen macht: Eine Böschung, einst Lebensraum für Vögel, Insekten und Kleintiere – jetzt eine kahle, zerschredderte Fläche.
12/13.08.2025
Zwischen März und September herrscht Vogelschutzzeit – ein gesetzlich verankerter Schutzraum für brütende Tiere und ihre Jungen. Trotzdem wurden Nester und ganze Lebensräume rücksichtslos beseitigt. Das ist nicht nur moralisch falsch, sondern in vielen Fällen gesetzeswidrig.
Respekt vor Natur und Tierwelt – Wenn Schutzgesetze ignoriert werden
Es ist ein Bild, das betroffen macht: Eine Böschung, einst Lebensraum für Vögel, Insekten und Kleintiere – jetzt eine kahle, zerschredderte Fläche.
Was bleibt, sind zerstörte Nester und tote Tiere. In einem Fall lagen sogar die Überreste eines Vogels zwischen den Ästen. Auch Feldwespen mit ihren Nestern fielen der Maßnahme zum Opfer. So etwas darf nicht passieren – erst recht nicht mitten in der gesetzlich geschützten Brut- und Setzzeit.
Die Vogelschutzzeit ist kein „Kann“, sondern Gesetz
Zwischen dem 1. März und dem 30. September gilt in Deutschland die Vogelschutzzeit.
In dieser Zeit ist es streng verboten, Hecken, Büsche oder Böschungen radikal zu entfernen oder stark zurückzuschneiden (§ 39 Abs. 5 Satz 2 Bundesnaturschutzgesetz).
Der Grund ist einfach:
Erlaubt sind nur schonende Pflegearbeiten – und auch nur dann, wenn dabei nachweislich keine Nester oder Tiere zu Schaden kommen.
Klare Rechtslage: Zerstörung ist kein Kavaliersdelikt
Diese Gesetze existieren nicht zum Selbstzweck, sondern um Arten zu schützen, deren Lebensräume ohnehin immer kleiner werden.
Ausnahmen sind selten – und müssen genehmigt werden
Nur wenn eine Hecke oder ein Gebüsch nachweislich eine akute Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellt, können auch in der Schutzzeit stärkere Eingriffe erlaubt sein. Dafür braucht es jedoch die Zustimmung der zuständigen Naturschutzbehörde.
In diesem Fall gab es keine Genehmigung – und auch keine zwingende Notwendigkeit.
Wir fordern: Solche Vorfälle dürfen sich nicht wiederholen
Natur- und Tierschutz sind verbindlich. Sie erfordern Verantwortungsbewusstsein, Umsicht und Respekt vor allem Leben. Wer Lebensräume rücksichtslos zerstört, schadet nicht nur den Tieren vor Ort – sondern auch dem Vertrauen der Öffentlichkeit in den ernsthaften Vollzug von Schutzgesetzen.
Unser Appell:
Nur so können wir sicherstellen, dass Vögel, Insekten und andere Tiere auch in Zukunft einen Platz in unserer gemeinsamen Umwelt haben.
Sachstandsbericht – Mulcharbeiten an der Lärmschutzwand-Böschung
Am 15. August endet bundesweit das Mäh- und Mulchverbot auf stillgelegten landwirtschaftlichen Flächen. In städtischen und kommunalen Bereichen können Pflegearbeiten an Grünflächen ganzjährig durchgeführt werden, sofern dies zur Grünpflege oder zur Sicherung erforderlich ist. Bei dringendem Handlungsbedarf erfolgt in der Regel eine vorherige Abstimmung mit fachkundigen Personen aus dem Bereich Tier- und Naturschutz. Für größere Rodungsmaßnahmen ist eine Befreiung nach § 67 Bundesnaturschutzgesetz bei der zuständigen Naturschutzbehörde zu beantragen.
Die Böschung an der Lärmschutzwand war ursprünglich mit Gras und niedrigem Bewuchs versehen, hatte sich jedoch im Laufe der Zeit durch Brombeer- und Strauchbewuchs verdichtet. Aufgrund der in der Umgebung erfolgten Bebauung hat sich die Böschung zu einem wichtigen Ersatzlebensraum für Vögel und Kleintiere entwickelt.
Die geplante Maßnahme umfasste im August ausschließlich den Rückschnitt eines 1–2 Meter breiten Streifens entlang der Parkbuchten zur Vermeidung von Beeinträchtigungen. Der umfassende Rückschnitt der restlichen Böschungsfläche sollte erst im September nach Ende der Brut- und Setzzeit erfolgen.
Aufgrund eines Kommunikationsfehlers kam es zu einer vorzeitigen und großflächigeren Rodung der Böschung. Ursache war eine fehlende schriftliche Dokumentation der Abstimmung sowie die Abwesenheit des zuständigen Bauhofleiters.
Der Vorfall wurde intern aufgearbeitet. Künftig werden Pflege- und Rückschnittmaßnahmen in sensiblen Bereichen enger koordiniert und dokumentiert, um den Erhalt ökologisch wertvoller Strukturen sicherzustellen.
In der Aufnahme
Quelle / Aufnahme
Gewässer und Naturschutz im Erftkreis
Flora-Fauna-Artenschutz
Naturschutzökologie
Rolf Thiemann
Naturschutzberater
Eisvogelweg 1
50181 Bedburg
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung. Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Die Vogelschutzzeit ist kein „Kann“, sondern Gesetz
Zwischen dem 1. März und dem 30. September gilt in Deutschland die Vogelschutzzeit.
In dieser Zeit ist es streng verboten, Hecken, Büsche oder Böschungen radikal zu entfernen oder stark zurückzuschneiden (§ 39 Abs. 5 Satz 2 Bundesnaturschutzgesetz).
Der Grund ist einfach:
- Brutplätze dürfen nicht zerstört werden.
- Jungtiere dürfen nicht gefährdet werden.
Erlaubt sind nur schonende Pflegearbeiten – und auch nur dann, wenn dabei nachweislich keine Nester oder Tiere zu Schaden kommen.
Klare Rechtslage: Zerstörung ist kein Kavaliersdelikt
- Roden ohne Genehmigung während der Schutzzeit: Ordnungswidrigkeit
- Töten von Wirbeltieren ohne vernünftigen Grund: Straftat nach § 17 Nr. 1 Tierschutzgesetz, strafbar mit bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe
Diese Gesetze existieren nicht zum Selbstzweck, sondern um Arten zu schützen, deren Lebensräume ohnehin immer kleiner werden.
Ausnahmen sind selten – und müssen genehmigt werden
Nur wenn eine Hecke oder ein Gebüsch nachweislich eine akute Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellt, können auch in der Schutzzeit stärkere Eingriffe erlaubt sein. Dafür braucht es jedoch die Zustimmung der zuständigen Naturschutzbehörde.
In diesem Fall gab es keine Genehmigung – und auch keine zwingende Notwendigkeit.
Wir fordern: Solche Vorfälle dürfen sich nicht wiederholen
Natur- und Tierschutz sind verbindlich. Sie erfordern Verantwortungsbewusstsein, Umsicht und Respekt vor allem Leben. Wer Lebensräume rücksichtslos zerstört, schadet nicht nur den Tieren vor Ort – sondern auch dem Vertrauen der Öffentlichkeit in den ernsthaften Vollzug von Schutzgesetzen.
Unser Appell:
- Schutzgesetze müssen konsequent eingehalten werden
- Jeder Eingriff in Lebensräume ist mit größter Vorsicht zu prüfen
Nur so können wir sicherstellen, dass Vögel, Insekten und andere Tiere auch in Zukunft einen Platz in unserer gemeinsamen Umwelt haben.
Sachstandsbericht – Mulcharbeiten an der Lärmschutzwand-Böschung
Am 15. August endet bundesweit das Mäh- und Mulchverbot auf stillgelegten landwirtschaftlichen Flächen. In städtischen und kommunalen Bereichen können Pflegearbeiten an Grünflächen ganzjährig durchgeführt werden, sofern dies zur Grünpflege oder zur Sicherung erforderlich ist. Bei dringendem Handlungsbedarf erfolgt in der Regel eine vorherige Abstimmung mit fachkundigen Personen aus dem Bereich Tier- und Naturschutz. Für größere Rodungsmaßnahmen ist eine Befreiung nach § 67 Bundesnaturschutzgesetz bei der zuständigen Naturschutzbehörde zu beantragen.
Die Böschung an der Lärmschutzwand war ursprünglich mit Gras und niedrigem Bewuchs versehen, hatte sich jedoch im Laufe der Zeit durch Brombeer- und Strauchbewuchs verdichtet. Aufgrund der in der Umgebung erfolgten Bebauung hat sich die Böschung zu einem wichtigen Ersatzlebensraum für Vögel und Kleintiere entwickelt.
Die geplante Maßnahme umfasste im August ausschließlich den Rückschnitt eines 1–2 Meter breiten Streifens entlang der Parkbuchten zur Vermeidung von Beeinträchtigungen. Der umfassende Rückschnitt der restlichen Böschungsfläche sollte erst im September nach Ende der Brut- und Setzzeit erfolgen.
Aufgrund eines Kommunikationsfehlers kam es zu einer vorzeitigen und großflächigeren Rodung der Böschung. Ursache war eine fehlende schriftliche Dokumentation der Abstimmung sowie die Abwesenheit des zuständigen Bauhofleiters.
Der Vorfall wurde intern aufgearbeitet. Künftig werden Pflege- und Rückschnittmaßnahmen in sensiblen Bereichen enger koordiniert und dokumentiert, um den Erhalt ökologisch wertvoller Strukturen sicherzustellen.
In der Aufnahme
- Es ist ein Bild, das betroffen macht: Eine Böschung, einst Lebensraum für Vögel, Insekten und Kleintiere – jetzt eine kahle, zerschredderte Fläche.
Quelle / Aufnahme
Gewässer und Naturschutz im Erftkreis
Flora-Fauna-Artenschutz
Naturschutzökologie
Rolf Thiemann
Naturschutzberater
Eisvogelweg 1
50181 Bedburg
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung. Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Artenschutz in Franken®
Die stille, aber tödliche Krise unserer Waldbäche

Wenn das Herz des Waldes verstummt – Die stille, aber tödliche Krise unserer Waldbäche
11/12.08.2025
Sein Wasser glitzert im Sonnenlicht, springt über Wurzeln, sammelt sich in kleinen, kühlen Gumpen. Libellen tanzen über der Oberfläche, das Rauschen übertönt das leise Knacken im Unterholz. Hier, am Wasser, ist das Leben dicht gewebt – jedes Blatt, jeder Flügelschlag, jede Welle Teil eines jahrtausendealten Rhythmus.
Doch was geschieht, wenn dieser Rhythmus bricht?
11/12.08.2025
- Zwischen alten Buchen und moosbewachsenen Steinen schlängelt sich ein Bach durchs Tal.
Sein Wasser glitzert im Sonnenlicht, springt über Wurzeln, sammelt sich in kleinen, kühlen Gumpen. Libellen tanzen über der Oberfläche, das Rauschen übertönt das leise Knacken im Unterholz. Hier, am Wasser, ist das Leben dicht gewebt – jedes Blatt, jeder Flügelschlag, jede Welle Teil eines jahrtausendealten Rhythmus.
Doch was geschieht, wenn dieser Rhythmus bricht?
- Das neue Bild: Stille, Staub, Stillstand
Wo einst klares Wasser floss, bleibt ein ausgetrocknetes Bett aus grauem Kies zurück. Die Steine sind heiß, der Boden riecht nach Staub. Risse ziehen sich wie Narben durch das ehemalige Bachbett. Keine Kaulquappen im flachen Wasser, keine Wasserläufer, keine schwirrenden Mücken – nur Stille.
Diese Szenen sind längst kein Einzelfall mehr. Immer mehr Waldbäche trocknen aus, oft über Wochen oder Monate hinweg. Die Ursache liegt in einer gefährlichen Doppelwirkung: dem Klimawandel und der zunehmenden Wasserentnahme.
Der Klimawandel – wenn die Quelle schweigt
Noch vor wenigen Jahrzehnten waren Waldbäche selbst in heißen Sommern verlässliche Wasseradern. Heute jedoch verändert der Klimawandel die Grundlagen dieses Systems tiefgreifend:
Die Quellen versiegen früher im Jahr. Manchmal bleibt der Bach schon im Juni trocken – lange bevor der Hochsommer beginnt.
"Das Wasser verschwindet nicht plötzlich – es zieht sich zurück wie ein scheues Tier, das spürt, dass sein Lebensraum nicht mehr sicher ist."
Die unsichtbare Entnahme – ein ständiger Aderlass
Neben dem Klimawandel wirkt ein zweiter, stiller Gegner: die stetige Entnahme von Wasser für Landwirtschaft, Industrie und private Nutzung.
Was für uns wie eine unsichtbare Nutzung aussieht, ist für den Bach ein schleichendes Ausbluten.
Warum Waldbäche unersetzlich sind
Waldbäche sind nicht nur Wasserläufe – sie sind Lebensadern:
Verschwindet der Bach, zerfällt ein ganzes Geflecht ökologischer Beziehungen – und oft ist dieser Verlust endgültig.
"Ein trockener Bach ist kein schlafender Bach. Er ist ein Herz, das aufgehört hat zu schlagen."
Was wir verlieren, wenn wir nichts tun
Ein trockengefallener Bach ist nicht automatisch ein vorübergehendes Sommerphänomen. Viele Ökosysteme kehren nicht mehr zurück, weil ihre Arten fehlen, das Bachbett verlandet oder die Mikroklimata verschwunden sind. Selbst wenn Wasser später wieder fließt, ist das Netzwerk aus Leben oft unwiederbringlich zerstört.
Jetzt handeln – nicht später
Es gibt Wege, diese Entwicklung zu stoppen oder umzukehren:
Jeder still gewordene Bach ist eine Warnung.
Er erzählt von einem Wald, der langsam sein Herz verliert. Von einem Gleichgewicht, das zu kippen droht. Und von einer Zukunft, in der wir entscheiden müssen, ob das Rauschen des Wassers eine Erinnerung bleibt – oder wieder zur Realität wird.
In der Aufnahme
Diese Szenen sind längst kein Einzelfall mehr. Immer mehr Waldbäche trocknen aus, oft über Wochen oder Monate hinweg. Die Ursache liegt in einer gefährlichen Doppelwirkung: dem Klimawandel und der zunehmenden Wasserentnahme.
Der Klimawandel – wenn die Quelle schweigt
Noch vor wenigen Jahrzehnten waren Waldbäche selbst in heißen Sommern verlässliche Wasseradern. Heute jedoch verändert der Klimawandel die Grundlagen dieses Systems tiefgreifend:
- Trockenzeiten dauern länger, die Wasserspeicher des Bodens sind schon im Frühsommer erschöpft.
- Die Temperaturen steigen, und mit ihnen die Verdunstung. Weniger Wasser erreicht überhaupt den Bachlauf.
- Regen fällt ungleichmäßiger – oft in kurzen, heftigen Schüben, die das Wasser oberflächlich wegspülen, ohne den Untergrund zu durchtränken.
Die Quellen versiegen früher im Jahr. Manchmal bleibt der Bach schon im Juni trocken – lange bevor der Hochsommer beginnt.
"Das Wasser verschwindet nicht plötzlich – es zieht sich zurück wie ein scheues Tier, das spürt, dass sein Lebensraum nicht mehr sicher ist."
Die unsichtbare Entnahme – ein ständiger Aderlass
Neben dem Klimawandel wirkt ein zweiter, stiller Gegner: die stetige Entnahme von Wasser für Landwirtschaft, Industrie und private Nutzung.
- Grundwasserabsenkung entkoppelt viele Quellen von ihrem natürlichen Nachschub.
- Künstliche Umleitungen verändern den Flusslauf und unterbrechen den natürlichen Rhythmus.
- Kleinere Entnahmen wirken in Trockenzeiten wie ein Tropfen zu viel, der das System kippen lässt.
Was für uns wie eine unsichtbare Nutzung aussieht, ist für den Bach ein schleichendes Ausbluten.
Warum Waldbäche unersetzlich sind
Waldbäche sind nicht nur Wasserläufe – sie sind Lebensadern:
- Sie bieten Heimat für Spezialisten wie Bachforelle, Feuersalamander und unzählige Insektenlarven.
- Ihre Ufer sind Rückzugsorte für Pflanzen, die Feuchtigkeit brauchen – von Moosbänken bis zur Sumpfdotterblume.
- Sie schaffen kühle, feuchte Zonen, die den Wald auch in Hitzeperioden am Leben halten.
- Sie reinigen Wasser, speichern Nährstoffe und verbinden Lebensräume.
Verschwindet der Bach, zerfällt ein ganzes Geflecht ökologischer Beziehungen – und oft ist dieser Verlust endgültig.
"Ein trockener Bach ist kein schlafender Bach. Er ist ein Herz, das aufgehört hat zu schlagen."
Was wir verlieren, wenn wir nichts tun
Ein trockengefallener Bach ist nicht automatisch ein vorübergehendes Sommerphänomen. Viele Ökosysteme kehren nicht mehr zurück, weil ihre Arten fehlen, das Bachbett verlandet oder die Mikroklimata verschwunden sind. Selbst wenn Wasser später wieder fließt, ist das Netzwerk aus Leben oft unwiederbringlich zerstört.
Jetzt handeln – nicht später
Es gibt Wege, diese Entwicklung zu stoppen oder umzukehren:
- Wasser schützen – Entnahmen in Trockenzeiten begrenzen, ökologischen Mindestabfluss sichern.
- Renaturieren – Barrieren entfernen, Quellen und Zuflüsse wiederherstellen.
- Klimaschutz ernst nehmen – Emissionen reduzieren, um das Wassergleichgewicht langfristig zu sichern.
- Bewusstsein schaffen – Jeder Liter Wasser zählt, und jede Handlung wirkt.
Jeder still gewordene Bach ist eine Warnung.
Er erzählt von einem Wald, der langsam sein Herz verliert. Von einem Gleichgewicht, das zu kippen droht. Und von einer Zukunft, in der wir entscheiden müssen, ob das Rauschen des Wassers eine Erinnerung bleibt – oder wieder zur Realität wird.
In der Aufnahme
- ... an vielen Standorten können wir diese Situation erkennen ... trockengefallener Waldbach!
Artenschutz in Franken®
Die Igelfliege (Tachina fera)

Lina, die kleine Igelfliege
10/11.08.2025
„Oh, was für eine große, bunte Welt!“ summte sie leise.
Lina war nicht irgendeine Fliege. Ihr Bauch glänzte orange wie ein Sonnenuntergang, und überall wuchsen ihr kleine Borsten, fast wie winzige Stacheln. Die anderen Waldbewohner nannten sie deswegen „Igelfliege“.Neugierig flog Lina los und entdeckte bald eine Wiese voller Blumen. Dort traf sie Berti, eine dicke Hummel.
10/11.08.2025
- An einem warmen Sommertag schlüpfte Lina, eine winzige Igelfliege, aus ihrer Puppenhülle im weichen Waldboden. Sie streckte vorsichtig ihre langen Flügel aus und blinzelte in die Sonne.
„Oh, was für eine große, bunte Welt!“ summte sie leise.
Lina war nicht irgendeine Fliege. Ihr Bauch glänzte orange wie ein Sonnenuntergang, und überall wuchsen ihr kleine Borsten, fast wie winzige Stacheln. Die anderen Waldbewohner nannten sie deswegen „Igelfliege“.Neugierig flog Lina los und entdeckte bald eine Wiese voller Blumen. Dort traf sie Berti, eine dicke Hummel.
„Willkommen, kleine Fliegerin!“, brummte Berti freundlich. „Komm, probier mal den Nektar von dieser Distel. Er schmeckt süß wie Honig.“
Lina tunkte ihren Rüssel hinein – mmmh, köstlich!
Am nächsten Tag sah Lina eine Raupe, die langsam an einem Kohlblatt knabberte.
„Hallo, Raupe!“, rief sie. „Was machst du da?“
„Ich frühstücke“, kicherte die Raupe, „denn ich will einmal ein Schmetterling werden!“ Lina freute sich für die Raupe, doch sie wusste: Ihre eigenen Kinder würden in einer Raupe wohnen müssen, um groß zu werden – so war es bei Igelfliegen eben.
Sie summte leise: „Das ist der Kreislauf der Natur. Jeder hat seinen Platz, und wir alle gehören zusammen.“
Im Laufe des Sommers lernte Lina viele Freunde kennen: Libellen am Teich, Schmetterlinge in der Sonne und sogar einen alten Käfer, der Geschichten von längst vergangenen Sommern erzählte. Sie merkte, dass es wichtig war, aufeinander zu achten, egal, ob man summt, brummt, krabbelt oder flattert.
Als der Herbst kam, zog sich Lina an einen geschützten Platz zurück. Sie wusste, dass neue Igelfliegen im nächsten Jahr schlüpfen würden – und dass die Wiese dann wieder voller Leben sein würde.
Und irgendwo zwischen den Grashalmen hörte man noch lange ihr leises Summen:
„Jeder ist wichtig – so, wie er ist.“
Aufnahme von Bernhard Schmalisch
Lina tunkte ihren Rüssel hinein – mmmh, köstlich!
Am nächsten Tag sah Lina eine Raupe, die langsam an einem Kohlblatt knabberte.
„Hallo, Raupe!“, rief sie. „Was machst du da?“
„Ich frühstücke“, kicherte die Raupe, „denn ich will einmal ein Schmetterling werden!“ Lina freute sich für die Raupe, doch sie wusste: Ihre eigenen Kinder würden in einer Raupe wohnen müssen, um groß zu werden – so war es bei Igelfliegen eben.
Sie summte leise: „Das ist der Kreislauf der Natur. Jeder hat seinen Platz, und wir alle gehören zusammen.“
Im Laufe des Sommers lernte Lina viele Freunde kennen: Libellen am Teich, Schmetterlinge in der Sonne und sogar einen alten Käfer, der Geschichten von längst vergangenen Sommern erzählte. Sie merkte, dass es wichtig war, aufeinander zu achten, egal, ob man summt, brummt, krabbelt oder flattert.
Als der Herbst kam, zog sich Lina an einen geschützten Platz zurück. Sie wusste, dass neue Igelfliegen im nächsten Jahr schlüpfen würden – und dass die Wiese dann wieder voller Leben sein würde.
Und irgendwo zwischen den Grashalmen hörte man noch lange ihr leises Summen:
„Jeder ist wichtig – so, wie er ist.“
Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- Igelfliege (Tachina fera)
Artenschutz in Franken®
Gelbgefleckte Sichelwespe (Ophion obscuratus)

Die Gelbgefleckte Sichelwespe (Ophion obscuratus)
09/10.08.2025
Mit ihrer eleganten Körperform und den gelblichen Zeichnungen gehört sie zu den interessanteren Arten unserer heimischen Insektenwelt. Trotz ihrer auffälligen Erscheinung ist sie relativ unbekannt – zu Unrecht, denn sie erfüllt eine wichtige ökologische Rolle.
09/10.08.2025
- Die Gelbgefleckte Sichelwespe (Ophion obscuratus) ist eine auffällige Vertreterin der Schlupfwespenfamilie (Ichneumonidae).
Mit ihrer eleganten Körperform und den gelblichen Zeichnungen gehört sie zu den interessanteren Arten unserer heimischen Insektenwelt. Trotz ihrer auffälligen Erscheinung ist sie relativ unbekannt – zu Unrecht, denn sie erfüllt eine wichtige ökologische Rolle.
Vorkommen und Lebensraum
Diese Wespenart ist in weiten Teilen Europas verbreitet und kommt auch in Deutschland regelmäßig vor. Man findet sie vor allem in Wäldern, Heckenlandschaften und naturnahen Gärten. Ihre Aktivität fällt in die wärmeren Monate – meist von Frühjahr bis Herbst.
Lebensweise und Ernährung
Die Gelbgefleckte Sichelwespe ist ein sogenannter Parasitoid. Das bedeutet: Die Larve entwickelt sich im Inneren eines Wirts, in diesem Fall meist der Larve eines Nachtfalters (z. B. Eulenfalter). Das Weibchen spürt die Raupen mit erstaunlicher Präzision auf und legt ein Ei in den Wirt ab. Die Sichelwespenlarve ernährt sich von ihrem Wirt und verlässt ihn schließlich zur Verpuppung. So hilft sie dabei, Schmetterlingspopulationen in einem natürlichen Gleichgewicht zu halten.
Ökologische Bedeutung
Auch wenn der Begriff „Parasit“ abschreckend wirken mag, ist die Rolle der Sichelwespe im Ökosystem äußerst positiv:
Sie trägt zur natürlichen Schädlingsregulierung bei und hilft, das ökologische Gleichgewicht zu wahren – ganz ohne chemische Mittel.
Gefährdung und Schutz
Aktuell gilt Ophion obscuratus nicht als gefährdet. Dennoch können intensiver Pestizideinsatz, Lebensraumverlust und nächtliche Lichtverschmutzung ihre Bestände beeinträchtigen. Wer die Art fördern möchte, sollte auf naturnahe Gartengestaltung, nächtliche Dunkelzonen und den Erhalt von Wildpflanzen achten.
Wussten Sie schon?
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
Diese Wespenart ist in weiten Teilen Europas verbreitet und kommt auch in Deutschland regelmäßig vor. Man findet sie vor allem in Wäldern, Heckenlandschaften und naturnahen Gärten. Ihre Aktivität fällt in die wärmeren Monate – meist von Frühjahr bis Herbst.
Lebensweise und Ernährung
Die Gelbgefleckte Sichelwespe ist ein sogenannter Parasitoid. Das bedeutet: Die Larve entwickelt sich im Inneren eines Wirts, in diesem Fall meist der Larve eines Nachtfalters (z. B. Eulenfalter). Das Weibchen spürt die Raupen mit erstaunlicher Präzision auf und legt ein Ei in den Wirt ab. Die Sichelwespenlarve ernährt sich von ihrem Wirt und verlässt ihn schließlich zur Verpuppung. So hilft sie dabei, Schmetterlingspopulationen in einem natürlichen Gleichgewicht zu halten.
Ökologische Bedeutung
Auch wenn der Begriff „Parasit“ abschreckend wirken mag, ist die Rolle der Sichelwespe im Ökosystem äußerst positiv:
Sie trägt zur natürlichen Schädlingsregulierung bei und hilft, das ökologische Gleichgewicht zu wahren – ganz ohne chemische Mittel.
Gefährdung und Schutz
Aktuell gilt Ophion obscuratus nicht als gefährdet. Dennoch können intensiver Pestizideinsatz, Lebensraumverlust und nächtliche Lichtverschmutzung ihre Bestände beeinträchtigen. Wer die Art fördern möchte, sollte auf naturnahe Gartengestaltung, nächtliche Dunkelzonen und den Erhalt von Wildpflanzen achten.
Wussten Sie schon?
- Die Weibchen besitzen einen auffälligen Legestachel – dieser wird jedoch nicht zur Verteidigung genutzt.
- Trotz ihres wehrhaften Aussehens sind Sichelwespen völlig harmlos für den Menschen.
- Die langen, sichelförmigen Fühler gaben der Wespe ihren deutschen Namen.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- Gelbgefleckte Sichelwespe (Ophion obscuratus) an Blüten des Dills (Anethum graveolens)
Artenschutz in Franken®
Die Blaue Federlibelle (Platycnemis pennipes)

Die Blaue Federlibelle (Platycnemis pennipes)
08/09.08.2025
Die Blaue Federlibelle, wissenschaftlich Platycnemis pennipes genannt, ist eine auffällige und elegante Vertreterin der Kleinlibellen (Zygoptera). Besonders charakteristisch sind ihre leuchtend hellblauen Färbungen bei den Männchen sowie die auffallend verbreiterten Schienen (Tibien) an den Beinen – daher auch der Name „Federlibelle“.
- Ein filigraner Juwel an unseren Gewässern
08/09.08.2025
Die Blaue Federlibelle, wissenschaftlich Platycnemis pennipes genannt, ist eine auffällige und elegante Vertreterin der Kleinlibellen (Zygoptera). Besonders charakteristisch sind ihre leuchtend hellblauen Färbungen bei den Männchen sowie die auffallend verbreiterten Schienen (Tibien) an den Beinen – daher auch der Name „Federlibelle“.
Die Blaue Federlibelle ist etwa 35 bis 40 Millimeter lang. Die Männchen sind durch ihre himmelblaue Körperfarbe mit schwarzen Zeichnungen leicht zu erkennen. Weibchen zeigen dagegen oft eine hellere, gelblich bis bräunliche Tönung mit schwächerer Zeichnung.
Ein auffälliges Unterscheidungsmerkmal gegenüber anderen Libellenarten sind die erweiterten Schienen an den Mittel- und Hinterbeinen – diese wirken fast wie kleine "Fächer" oder "Federblätter", was der Art ihren deutschen Namen gegeben hat. Die Flügel sind durchsichtig und zart geädert, wie bei allen Kleinlibellen.
Aufnahme von Bernhard Schmalisch
Ein auffälliges Unterscheidungsmerkmal gegenüber anderen Libellenarten sind die erweiterten Schienen an den Mittel- und Hinterbeinen – diese wirken fast wie kleine "Fächer" oder "Federblätter", was der Art ihren deutschen Namen gegeben hat. Die Flügel sind durchsichtig und zart geädert, wie bei allen Kleinlibellen.
Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- Blaue Federlibelle (Platycnemis pennipes)
Artenschutz in Franken®
Naturerbe Buchenwälder – Wald.Boden.Vielfalt ...

Naturerbe Buchenwälder
07/08.08.2025
Die Artenvielfalt alter Buchenwälder
Buchenmischwälder beheimaten einen enormen Artenreichtum: von Mikroorganismen über Pflanzen, Pilze, Insekten bis zu den Wirbeltieren – etwa 11.000 unterschiedliche Arten leben hier. Davon ist mindestens ein Drittel speziell auf alte Wälder angewiesen. Und auch für den Wald spielen seine Bewohner eine wichtige Rolle für das Gleichgewicht des Ökosystems. Gemeinsam sorgen sie damit u.a. für die Speicherung von sauberem Wasser und von Kohlendioxid, die Bildung von Humus und die Kühlung der Umgebung.
- Naturerbe Buchenwälder – Wald.Boden.Vielfalt am 27. September 2025 von 10:00 bis 17:30 Uhr in Ebrach im Steigerwald
07/08.08.2025
Die Artenvielfalt alter Buchenwälder
Buchenmischwälder beheimaten einen enormen Artenreichtum: von Mikroorganismen über Pflanzen, Pilze, Insekten bis zu den Wirbeltieren – etwa 11.000 unterschiedliche Arten leben hier. Davon ist mindestens ein Drittel speziell auf alte Wälder angewiesen. Und auch für den Wald spielen seine Bewohner eine wichtige Rolle für das Gleichgewicht des Ökosystems. Gemeinsam sorgen sie damit u.a. für die Speicherung von sauberem Wasser und von Kohlendioxid, die Bildung von Humus und die Kühlung der Umgebung.
Themen & Referenten
Veranstaltungsort
Historikhotel Klosterbräu
Remise, Marktplatz 4
96157 Ebrach
Exkursion
Am Vorabend (26.09.2025) findet von 16:00 bis 19:00 Uhr wie gewohnt eine Exkursion in eines der Naturwaldreservate des Steigerwaldes (NWR Kleinengelein) statt. Bitte bei Anmeldung über den untenstehenden Link angeben. Treffpunkt zur Exkursion um 16:00 Uhr am Parkplatz zum Pfad der Artenvielfalt bei Obersteinbach/Rauhenebrach.
Anmeldung
Die Tagung ist kostenfrei. Die Reise-, Verpflegungs- und evtl. Übernachtungskosten sind von den Teilnehmenden selbst zu tragen.
Bitte melden Sie sich bis zum 21.09.2025 zum Seminar an:
https://helfen.bund-naturschutz.de/naturerbe-buchenwaelder/
Mit besten Grüßen
Ulla Reck, Dr. Janina Deutschmann & Dr. Ralf Straußberger
_____________________________________
Waldreferat
BUND Naturschutz in Bayern e.V.
Landesfachgeschäftsstelle
Bauernfeindstraße 23
90471 Nürnberg
Quelle / Abbldung
Ulla Reck
BUND Naturschutz in Bayern e.V.
Informationsbüro Steigerwald
Brucksteigstr. 21, 96157 Ebrach
Tel: 09553/ 98 90 42
mobil: 0176/ 200 38 523
ulla.reck@bund-naturschutz.de
Öffnungszeiten:
Di – Do von 9 – 17 Uhr
Wir sind zeitweise im Außendienst unterwegs
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung. Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
- Richard Mergner, Vorsitzender, BUND Naturschutz in Bayern e. V. - Begrüßung
- Dr. Max Zibold , Universität Bayreuth - Holzbewohnende Pilzarten in alten Buchenmischwäldern
- Prof. Dr. Roman Türk, Universität Salzburg - Flechten als Bioindikatoren für Naturwälder
- Prof. Dr. Stefan Scheu, Universität Göttingen - Die Tierwelt unserer Waldböden: Nahrungsnetze und Einfluss von Waldmanagement
- Ulrich Meßlinger, Freiberuflicher Diplom-Biologe - Amphibien in wilden Wäldern
- Hans Mühle, Insektenkundler/Käferexperte - Käfervielfalt in alten Wäldern – ein Problem oder ein Gewinn?
- Dr. Markus Dietz, Institut für Tierökologie und Naturbildung GmbH - Fledermäuse brauchen Naturwaldstrukturen: Lebensraumansprüche waldbewohnender Fledermausarten
- Dr. Ralf Straußberger, Waldreferent, BUND Naturschutz in Bayern e. V. - Moderation, Résumé & Abschluss
Veranstaltungsort
Historikhotel Klosterbräu
Remise, Marktplatz 4
96157 Ebrach
Exkursion
Am Vorabend (26.09.2025) findet von 16:00 bis 19:00 Uhr wie gewohnt eine Exkursion in eines der Naturwaldreservate des Steigerwaldes (NWR Kleinengelein) statt. Bitte bei Anmeldung über den untenstehenden Link angeben. Treffpunkt zur Exkursion um 16:00 Uhr am Parkplatz zum Pfad der Artenvielfalt bei Obersteinbach/Rauhenebrach.
Anmeldung
Die Tagung ist kostenfrei. Die Reise-, Verpflegungs- und evtl. Übernachtungskosten sind von den Teilnehmenden selbst zu tragen.
Bitte melden Sie sich bis zum 21.09.2025 zum Seminar an:
https://helfen.bund-naturschutz.de/naturerbe-buchenwaelder/
- Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung – Info-Tel: 0176/200 385 23, Mail: ulla.reck@bund-naturschutz.de
Mit besten Grüßen
Ulla Reck, Dr. Janina Deutschmann & Dr. Ralf Straußberger
_____________________________________
Waldreferat
BUND Naturschutz in Bayern e.V.
Landesfachgeschäftsstelle
Bauernfeindstraße 23
90471 Nürnberg
Quelle / Abbldung
Ulla Reck
BUND Naturschutz in Bayern e.V.
Informationsbüro Steigerwald
Brucksteigstr. 21, 96157 Ebrach
Tel: 09553/ 98 90 42
mobil: 0176/ 200 38 523
ulla.reck@bund-naturschutz.de
Öffnungszeiten:
Di – Do von 9 – 17 Uhr
Wir sind zeitweise im Außendienst unterwegs
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung. Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Artenschutz in Franken®
Der Teichfrosch (Pelophylax esculentus) ...

Der Teichfrosch (Pelophylax esculentus) – Lautstarker Bewohner heimischer Gewässer
06/07.08.2025
Als Teil des sogenannten "grünen Frosch-Komplexes" bildet er eine biologische Besonderheit, die sowohl in ökologischer als auch genetischer Hinsicht äußerst bemerkenswert ist. Neben seiner Rolle als akustischer Botschafter heimischer Gewässer trägt er entscheidend zur biologischen Vielfalt unserer Feuchtlebensräume bei.
06/07.08.2025
- Der Teichfrosch ist eine der bekanntesten Amphibienarten Mitteleuropas – nicht zuletzt durch sein weithin hörbares Quaken an warmen Sommerabenden.
Als Teil des sogenannten "grünen Frosch-Komplexes" bildet er eine biologische Besonderheit, die sowohl in ökologischer als auch genetischer Hinsicht äußerst bemerkenswert ist. Neben seiner Rolle als akustischer Botschafter heimischer Gewässer trägt er entscheidend zur biologischen Vielfalt unserer Feuchtlebensräume bei.
Der Teichfrosch ist keine eigenständige Art im klassischen Sinne, sondern ein sogenannter Hybrid aus dem Kleinen Wasserfrosch (Pelophylax lessonae) und dem Seefrosch (Pelophylax ridibundus).
Diese hybride Entstehung macht ihn genetisch einzigartig: In der Natur kommt er oft zusammen mit einem oder beiden Elternarten vor und bildet sogenannte Hybridpopulationen (z. B. L-E- oder E-E-Systeme), in denen Fortpflanzung nur durch ein komplexes Zusammenspiel der beteiligten Genpools möglich ist.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
Diese hybride Entstehung macht ihn genetisch einzigartig: In der Natur kommt er oft zusammen mit einem oder beiden Elternarten vor und bildet sogenannte Hybridpopulationen (z. B. L-E- oder E-E-Systeme), in denen Fortpflanzung nur durch ein komplexes Zusammenspiel der beteiligten Genpools möglich ist.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- Teichfrosch (Pelophylax esculentus)
Artenschutz in Franken®
Die Gartenkreuzspinne (Araneus diadematus)

Die Gartenkreuzspinne (Araneus diadematus) – Architektin des Spätsommers
05/06.08.2025
Ihr charakteristisches Kreuzmuster auf dem Hinterleib hat ihr nicht nur den Namen eingebracht, sondern macht sie auch für Laien leicht erkennbar. Trotz ihrer auffälligen Erscheinung ist sie völlig harmlos für den Menschen – und spielt eine wichtige Rolle im ökologischen Gleichgewicht.
05/06.08.2025
- Die Gartenkreuzspinne gehört zu den bekanntesten und am weitesten verbreiteten Spinnenarten Mitteleuropas.
Ihr charakteristisches Kreuzmuster auf dem Hinterleib hat ihr nicht nur den Namen eingebracht, sondern macht sie auch für Laien leicht erkennbar. Trotz ihrer auffälligen Erscheinung ist sie völlig harmlos für den Menschen – und spielt eine wichtige Rolle im ökologischen Gleichgewicht.
Die Gartenkreuzspinne ist in nahezu ganz Europa heimisch und kommt von Gärten über Waldränder bis zu Stadtparks in einer Vielzahl von Lebensräumen vor. Sie bevorzugt strukturreiche, vegetationsreiche Umgebungen, in denen sie ihre kunstvollen Netze aufspannen kann.
Aufnahme von Bernhard Schmalisch
Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- Weibchen der Gartenkreuzspinne (Araneus diadematus)
Artenschutz in Franken®
Ambrosia artemisiifolia ...

Ambrosia artemisiifolia – Das Beifußblättrige Traubenkraut
04/05.08.2025
Das Beifußblättrige Traubenkraut (Ambrosia artemisiifolia) ist eine in Mitteleuropa zunehmend verbreitete, invasive Pflanzenart, die ursprünglich aus Nordamerika stammt. Sie gehört zur Familie der Korbblütler (Asteraceae) und ist eng verwandt mit bekannten Arten wie Sonnenblume oder Beifuß.
04/05.08.2025
- Ein unscheinbares Gewächs mit gefährlichem Potenzial
Das Beifußblättrige Traubenkraut (Ambrosia artemisiifolia) ist eine in Mitteleuropa zunehmend verbreitete, invasive Pflanzenart, die ursprünglich aus Nordamerika stammt. Sie gehört zur Familie der Korbblütler (Asteraceae) und ist eng verwandt mit bekannten Arten wie Sonnenblume oder Beifuß.
Aufgrund ihres hohen allergenen Potenzials und ihrer aggressiven Ausbreitungsfähigkeit stellt sie eine ernste Bedrohung für Umwelt, Landwirtschaft und insbesondere die menschliche Gesundheit dar.
In der Aufnahme von Bernhand Schmalisch
In der Aufnahme von Bernhand Schmalisch
- ... in dieser Jahreszeit (Juli/August) beginnt die starke Allergien auslösende Ambrosia ihre Pollen zu verteilen.
Artenschutz in Franken®
Gebirgsstelze (Motacilla cinerea)

Die Gebirgsstelze (Motacilla cinerea) – Ein eleganter Wasserliebhaber
02/03.08.2025
Ihr lateinischer Name Motacilla cinerea verweist bereits auf das markante grau-gelbe Federkleid. Sie wird häufig auch als "Wasserstelze" bezeichnet, was ihren engen Bezug zu fließenden Gewässern treffend beschreibt.
02/03.08.2025
- Die Gebirgsstelze ist eine schlanke, grazile Vogelart aus der Familie der Stelzen und Pieper (Motacillidae) und gehört zur Gattung der Stelzen (Motacilla).
Ihr lateinischer Name Motacilla cinerea verweist bereits auf das markante grau-gelbe Federkleid. Sie wird häufig auch als "Wasserstelze" bezeichnet, was ihren engen Bezug zu fließenden Gewässern treffend beschreibt.
Aussehen und Merkmale
Die Gebirgsstelze ist etwa 18 bis 20 Zentimeter lang und zählt damit zu den mittelgroßen Stelzenarten. Auffällig sind ihr langer, ständig wippender Schwanz sowie das kontrastreiche Gefieder:
Durch die elegante Körperhaltung und das typische Schwanzwippen wirkt sie äußerst lebendig und dynamisch.
Verbreitung und Lebensraum
Die Gebirgsstelze ist in weiten Teilen Europas, Nordafrikas und Asiens verbreitet. Ihr bevorzugter Lebensraum sind naturnahe, fließende Gewässer – darunter Bäche, Flüsse und Bergbäche, aber auch künstlich angelegte Kanäle oder Mühlgräben, sofern sie eine gewisse Strukturvielfalt bieten. Besonders wichtig sind ...
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
Die Gebirgsstelze ist etwa 18 bis 20 Zentimeter lang und zählt damit zu den mittelgroßen Stelzenarten. Auffällig sind ihr langer, ständig wippender Schwanz sowie das kontrastreiche Gefieder:
- Oberseite: Aschgrau
- Unterseite: Zitronengelb, besonders kräftig im Bereich der Unterschwanzdecken
- Brust und Kehle: Beim Männchen in der Brutzeit deutlich schwarz; beim Weibchen weniger intensiv oder ganz fehlend
- Flügel: Dunkel mit weißen Flügelkanten
- Beine und Schnabel: Dunkelbraun bis schwarz
Durch die elegante Körperhaltung und das typische Schwanzwippen wirkt sie äußerst lebendig und dynamisch.
Verbreitung und Lebensraum
Die Gebirgsstelze ist in weiten Teilen Europas, Nordafrikas und Asiens verbreitet. Ihr bevorzugter Lebensraum sind naturnahe, fließende Gewässer – darunter Bäche, Flüsse und Bergbäche, aber auch künstlich angelegte Kanäle oder Mühlgräben, sofern sie eine gewisse Strukturvielfalt bieten. Besonders wichtig sind ...
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
- Gebirgsstelze (Motacilla cinerea)
Artenschutz in Franken®
Die Kurzstiel-Sandwespe (Podalonia affinis)

Die Kurzstiel-Sandwespe (Podalonia affinis) – Eine faszinierende Jägerin im Verborgenen
01/02.08.2025
Sie gehört zu den Solitärwespen, was bedeutet, dass jedes Weibchen eigenständig für die Versorgung ihres Nachwuchses sorgt – ohne ein staatenbildendes Sozialverhalten wie bei Honigbienen oder Hornissen.
01/02.08.2025
- Die Kurzstiel-Sandwespe, wissenschaftlich Podalonia affinis, ist eine eher unscheinbare, aber ökologisch bedeutende Art aus der Familie der Grabwespen (Sphecidae).
Sie gehört zu den Solitärwespen, was bedeutet, dass jedes Weibchen eigenständig für die Versorgung ihres Nachwuchses sorgt – ohne ein staatenbildendes Sozialverhalten wie bei Honigbienen oder Hornissen.
Merkmale und Lebensraum
Erkennbar ist Podalonia affinis an ihrem relativ kurzen Petiolus, dem „Stiel“, der Brust und Hinterleib verbindet – daher der deutsche Name „Kurzstiel-Sandwespe“. Ihr Körper ist überwiegend schwarz, mit leicht silbriger Behaarung und teils rötlich getönten Hinterleibssegmenten. Die Tiere erreichen eine Körperlänge von etwa 10 bis 15 Millimetern. Bevorzugte Lebensräume dieser Art sind warme, offene und sandige Gebiete mit spärlicher Vegetation – etwa Binnendünen, Trockenrasen, Sandgruben oder Heideflächen. Hier findet die Sandwespe ideale Bedingungen zum Nestbau und zur Jagd.
Lebensweise und Brutpflege
Die Kurzstiel-Sandwespe ist eine spezialisierte Jägerin: Die Weibchen suchen gezielt nach Raupen, insbesondere von Eulenfaltern (Noctuidae), die sie mit einem präzisen Stich lähmen. Die so betäubte Beute wird anschließend in ein selbst gegrabenes Nest im Sand eingetragen. Dort legt das Weibchen ein Ei auf die lebende, aber bewegungsunfähige Raupe. Nach dem Schlüpfen beginnt die Wespenlarve sofort mit der Nahrungsaufnahme – ein raffiniertes Beispiel für instinktive Brutpflege im Tierreich. Ein Weibchen kann mehrere solcher Brutröhren anlegen, die es mit großer Sorgfalt anlegt und verschließt. Die Entwicklung zur erwachsenen Wespe dauert – je nach Witterung – mehrere Wochen. Die adulten Tiere sind meist zwischen Juni und September zu beobachten.
Ökologische Bedeutung
Trotz ihrer Zurückgezogenheit spielt die Kurzstiel-Sandwespe eine wichtige Rolle im ökologischen Gefüge. Als natürlicher Gegenspieler von Schmetterlingsraupen trägt sie zur Regulierung bestimmter Insektenpopulationen bei. Gleichzeitig dient sie Vögeln, Spinnen und anderen Insekten als Nahrungsquelle und ist somit Teil eines vielschichtigen Nahrungsnetzes.
Für den Menschen ungefährlich
Podalonia affinis ist vollkommen friedlich und stellt keinerlei Gefahr für den Menschen dar. Da sie nicht in Gruppen lebt und nur bei der Jagd oder beim Nestbau aktiv ist, begegnet man ihr meist nur mit viel Aufmerksamkeit – oder gar nicht.
Aufnahme von Bernhard Schmalisch
Erkennbar ist Podalonia affinis an ihrem relativ kurzen Petiolus, dem „Stiel“, der Brust und Hinterleib verbindet – daher der deutsche Name „Kurzstiel-Sandwespe“. Ihr Körper ist überwiegend schwarz, mit leicht silbriger Behaarung und teils rötlich getönten Hinterleibssegmenten. Die Tiere erreichen eine Körperlänge von etwa 10 bis 15 Millimetern. Bevorzugte Lebensräume dieser Art sind warme, offene und sandige Gebiete mit spärlicher Vegetation – etwa Binnendünen, Trockenrasen, Sandgruben oder Heideflächen. Hier findet die Sandwespe ideale Bedingungen zum Nestbau und zur Jagd.
Lebensweise und Brutpflege
Die Kurzstiel-Sandwespe ist eine spezialisierte Jägerin: Die Weibchen suchen gezielt nach Raupen, insbesondere von Eulenfaltern (Noctuidae), die sie mit einem präzisen Stich lähmen. Die so betäubte Beute wird anschließend in ein selbst gegrabenes Nest im Sand eingetragen. Dort legt das Weibchen ein Ei auf die lebende, aber bewegungsunfähige Raupe. Nach dem Schlüpfen beginnt die Wespenlarve sofort mit der Nahrungsaufnahme – ein raffiniertes Beispiel für instinktive Brutpflege im Tierreich. Ein Weibchen kann mehrere solcher Brutröhren anlegen, die es mit großer Sorgfalt anlegt und verschließt. Die Entwicklung zur erwachsenen Wespe dauert – je nach Witterung – mehrere Wochen. Die adulten Tiere sind meist zwischen Juni und September zu beobachten.
Ökologische Bedeutung
Trotz ihrer Zurückgezogenheit spielt die Kurzstiel-Sandwespe eine wichtige Rolle im ökologischen Gefüge. Als natürlicher Gegenspieler von Schmetterlingsraupen trägt sie zur Regulierung bestimmter Insektenpopulationen bei. Gleichzeitig dient sie Vögeln, Spinnen und anderen Insekten als Nahrungsquelle und ist somit Teil eines vielschichtigen Nahrungsnetzes.
Für den Menschen ungefährlich
Podalonia affinis ist vollkommen friedlich und stellt keinerlei Gefahr für den Menschen dar. Da sie nicht in Gruppen lebt und nur bei der Jagd oder beim Nestbau aktiv ist, begegnet man ihr meist nur mit viel Aufmerksamkeit – oder gar nicht.
Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- ... eine Kurzstiel Sandwespe ... trägt hier eine Raupe in ihre vorher gegrabene Bruthöhle ein ... die Raupe ist größer als die Grabwespe und wird mit Flugsprüngen transportiert ...danach wird diese Röhre kunstvoll verschlossen.Viele Steinchen werden bewegt um diese Grabungen unsichtbar zu machen.
Artenschutz in Franken®
Die Totmulcher

Die Totmulcher
31.07 / 01.08.2025
Auf kommunalen Grundstücken, die ausweislich geltender Grünordnungspläne, Landschaftspflegekonzepte oder Förderkulissen als „ökologisch sensible Flächen“ geführt werden, kommt es in vielen Gemeinden regelmäßig zu schwerwiegenden Eingriffen durch sogenannte Totmulchungen.
Dabei werden mittels schwerem Gerät – meist Schlegelmulchern – sämtliche Vegetationsschichten bis in Bodennähe mechanisch zerkleinert und auf großer Fläche verteilt. Derartige Maßnahmen haben gravierende Folgen für das lokale Ökosystem und werfen zugleich rechtlich erhebliche Fragen auf.
31.07 / 01.08.2025
- Ökologisch unverantwortliche Eingriffe auf kommunalen Flächen – ein juristisch und ökologisch fragwürdiges Vorgehen
Auf kommunalen Grundstücken, die ausweislich geltender Grünordnungspläne, Landschaftspflegekonzepte oder Förderkulissen als „ökologisch sensible Flächen“ geführt werden, kommt es in vielen Gemeinden regelmäßig zu schwerwiegenden Eingriffen durch sogenannte Totmulchungen.
Dabei werden mittels schwerem Gerät – meist Schlegelmulchern – sämtliche Vegetationsschichten bis in Bodennähe mechanisch zerkleinert und auf großer Fläche verteilt. Derartige Maßnahmen haben gravierende Folgen für das lokale Ökosystem und werfen zugleich rechtlich erhebliche Fragen auf.
Ökologische Schäden mit juristischen Implikationen
Das flächendeckende Mulchen zum falschen Zeitpunkt (z. B. während der Hauptbrutzeit oder im Hochsommer) steht im Widerspruch zu den Zielen des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG), insbesondere:
Kommunale Verantwortung und Vergabepraxis
Besonders kritisch ist, dass diese Eingriffe häufig durch beauftragte Lohnunternehmer im Rahmen von Pflegeverträgen erfolgen – ohne ökologische Begleitung oder genaue Absprachen hinsichtlich Zeitpunkt, Methode und Flächenkulisse. Kommunen tragen hier jedoch eine besondere Verantwortung:
Beispielhafte Auswirkungen des Totmulchens
Forderung: Rechtssicherheit durch ökologische Fachbegleitung
Es braucht dringend einen verbindlichen Rahmen, wie Pflege auf ökologisch relevanten kommunalen Flächen zu erfolgen hat. Dabei sind folgende Punkte zentral:
Fazit:
Totmulchungen auf ökologisch bedeutsamen kommunalen Flächen sind nicht nur Ausdruck einer gravierenden ökologischen Fehleinschätzung – sie können auch gegen geltendes Naturschutzrecht verstoßen. Die kommunale Selbstverwaltung endet dort, wo gesetzlich geschützte Rechtsgüter, wie Artenvielfalt und Lebensräume, systematisch geschädigt werden. Eine grundlegende Neubewertung der Pflegepraxis ist überfällig – zugunsten einer rechtskonformen, ökologisch verantwortlichen und zukunftsorientierten Flächennutzung.
Bildunterschrift:
Das flächendeckende Mulchen zum falschen Zeitpunkt (z. B. während der Hauptbrutzeit oder im Hochsommer) steht im Widerspruch zu den Zielen des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG), insbesondere:
- § 1 BNatSchG – Ziele des Naturschutzes: Der Schutz der biologischen Vielfalt, der Lebensräume wild lebender Tiere und Pflanzen sowie der dauerhaft leistungsfähigen Naturgüter wird konterkariert, wenn strukturreiche Wiesen, Brachen oder Säume regelmäßig komplett zerstört werden.
- § 39 Abs. 5 BNatSchG – Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen: Diese Vorschrift verbietet unter anderem die „vorsätzliche Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten wild lebender Tiere“. Das maschinelle Mulchen zur Hauptfortpflanzungszeit kann je nach Fallkonstellation einen rechtswidrigen Eingriff darstellen – insbesondere wenn besonders geschützte Arten betroffen sind.
- § 15 BNatSchG – Eingriffsregelung: Auch kommunale Pflegemaßnahmen können als Eingriffe in Natur und Landschaft gewertet werden, sofern sie das Landschaftsbild erheblich verändern oder die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts beeinträchtigen. In solchen Fällen besteht eine Pflicht zur Vermeidung, zum Ausgleich oder zur Kompensation.
Kommunale Verantwortung und Vergabepraxis
Besonders kritisch ist, dass diese Eingriffe häufig durch beauftragte Lohnunternehmer im Rahmen von Pflegeverträgen erfolgen – ohne ökologische Begleitung oder genaue Absprachen hinsichtlich Zeitpunkt, Methode und Flächenkulisse. Kommunen tragen hier jedoch eine besondere Verantwortung:
- Vertragsgestaltung: Die öffentliche Hand darf keine Leistungen vergeben, deren Ausführung absehbar gegen umwelt- oder naturschutzrechtliche Bestimmungen verstößt oder Zielkonflikte mit bestehenden Schutzkonzepten erzeugt.
- Sorgfaltspflichten: Kommunen müssen vor der Vergabe prüfen, ob die geplanten Maßnahmen im Einklang mit ihren eigenen Satzungen, Pflegeplänen, Biotopverbundkonzepten oder Biodiversitätsstrategien stehen.
- Haftung: Sofern durch diese Maßnahmen geschützte Arten, Lebensstätten oder Habitate beeinträchtigt werden, besteht im Einzelfall auch eine rechtliche Haftung – sowohl verwaltungsrechtlich (z. B. durch Eingriffsregelung) als auch zivilrechtlich (Schadensersatzforderungen durch Umweltverbände im Rahmen des Umweltrechtsbehelfsgesetzes, UmwRG).
Beispielhafte Auswirkungen des Totmulchens
- Dezimierung von Insektenpopulationen (Wildbienen, Schmetterlinge, Käfer)
- Zerstörung von Brutplätzen bodenbrütender Vögel (z. B. Feldlerche)
- Verlust von Rückzugsräumen für Kleinsäuger, Amphibien und Reptilien
- Bodenverdichtung und Humusverlust durch schwere Maschinen
- Förderung invasiver Arten durch Schwächung der Standortvielfalt
Forderung: Rechtssicherheit durch ökologische Fachbegleitung
Es braucht dringend einen verbindlichen Rahmen, wie Pflege auf ökologisch relevanten kommunalen Flächen zu erfolgen hat. Dabei sind folgende Punkte zentral:
- Erstellung und Anwendung kommunaler Pflegekonzepte unter ökologischen Gesichtspunkten
- Fachliche Begleitung von Mulch- und Mähmaßnahmen durch biologisch geschultes Personal
- Schutzzeiträume (insbesondere März bis Oktober) sind zu beachten und einzuhalten
- Umstellung auf selektive, mosaikartige Mahd mit Belassen von Rückzugsstreifen
- Förderung von extensiver Nutzung statt totaler Zerstörung
Fazit:
Totmulchungen auf ökologisch bedeutsamen kommunalen Flächen sind nicht nur Ausdruck einer gravierenden ökologischen Fehleinschätzung – sie können auch gegen geltendes Naturschutzrecht verstoßen. Die kommunale Selbstverwaltung endet dort, wo gesetzlich geschützte Rechtsgüter, wie Artenvielfalt und Lebensräume, systematisch geschädigt werden. Eine grundlegende Neubewertung der Pflegepraxis ist überfällig – zugunsten einer rechtskonformen, ökologisch verantwortlichen und zukunftsorientierten Flächennutzung.
Bildunterschrift:
- Totmulchen im Juli – mitten in der Hauptbrut- und Vegetationszeit: Auf dieser kommunalen Fläche wurde innerhalb weniger Minuten ein artenreicher Lebensraum zerstört. Zahlreiche Insekten, Kleintiere und bodenbrütende Vögel verlieren durch solche Eingriffe ihre Existenzgrundlage.
Artenschutz in Franken®
Stele der Biodiversität® - Oberschwappach

Stele der Biodiversität® - Oberschwappach
30/31.07.2025
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutzes in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. sowie der Gemeinde Knetzgau, das unabhängig von der Deutschen Postcode Lotterie, der Petra und Matthias Hanft-Stiftung für Tier- und Naturschutz und der Steuerkanzlei Bauerfeind aus München unterstützt wird.
Oberschwappach / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen, kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
30/31.07.2025
- Grafische Gestaltung abgeschlossen
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutzes in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. sowie der Gemeinde Knetzgau, das unabhängig von der Deutschen Postcode Lotterie, der Petra und Matthias Hanft-Stiftung für Tier- und Naturschutz und der Steuerkanzlei Bauerfeind aus München unterstützt wird.
Oberschwappach / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen, kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
In der Aufnahme
- Am 26.07.2025 konnten wir die grafische Gestaltung abschließen.
Artenschutz in Franken®
Unser täglicher Einsatz im praktischen Naturschutz

Für Artenvielfalt und Lebensräume: Unser täglicher Einsatz im praktischen Naturschutz
29/30.07.2025
Genau hier setzt unsere bundesweit tätige Naturschutzinitiative an: mit konkretem Handeln, mit Fachwissen, mit Herzblut. Tag für Tag engagieren wir uns für den praktischen Artenschutz, der über schöne Worte hinausgeht – und direkt dort ansetzt, wo Natur Unterstützung braucht.
Praktischer Artenschutz – was bedeutet das?
29/30.07.2025
- Unsere Natur ist einzigartig – doch sie steht unter Druck. Der Verlust biologischer Vielfalt, das Verschwinden wertvoller Lebensräume und der Rückgang zahlreicher Tier- und Pflanzenarten sind längst Realität.
Genau hier setzt unsere bundesweit tätige Naturschutzinitiative an: mit konkretem Handeln, mit Fachwissen, mit Herzblut. Tag für Tag engagieren wir uns für den praktischen Artenschutz, der über schöne Worte hinausgeht – und direkt dort ansetzt, wo Natur Unterstützung braucht.
Praktischer Artenschutz – was bedeutet das?
Praktischer Artenschutz ist mehr als ein Ideal. Es ist tägliche Arbeit draußen im Gelände: das Anlegen von Gewässern für Amphibien, das Anbringen von Nistkästen für Gebäudebrüter, das Mähen von artenreichen Wiesen zur richtigen Zeit oder die Pflege strukturreicher Hecken und Streuobstwiesen. Es bedeutet auch, invasive Arten zurückzudrängen, gefährdete Populationen zu beobachten und gezielte Schutzmaßnahmen wissenschaftlich zu begleiten. Dabei folgen wir stets dem Grundsatz: Schützen, was schützenswert ist – gemeinsam, wirkungsvoll und langfristig.
Deutschlandweit aktiv – regional verwurzelt
Unsere Initiative ist bundesweit aktiv – von den Küsten bis zu den Mittelgebirgen, von Moorlandschaften bis in städtische Grünzonen. Überall dort, wo Arten verschwinden oder Lebensräume unter Druck geraten, setzen wir gezielt an. Dabei arbeiten wir eng mit lokalen Akteurinnen zusammen: mit Ehrenamtlichen, Schulen, Landwirtinnen, Kommunen und anderen Umweltorganisationen. Denn Naturschutz funktioniert nur im Dialog und durch Zusammenarbeit auf Augenhöhe.
Unsere Schwerpunkte:
Engagement, das wirkt
Unser Ansatz ist lösungsorientiert und praxisnah. Statt auf Symbolpolitik setzen wir auf messbare Wirkung: Wo wir tätig sind, wächst neue Vielfalt. Amphibien wandern wieder, Insekten finden Nahrung, seltene Pflanzen kehren zurück. Dieses Ergebnis verdanken wir nicht zuletzt den zahlreichen Menschen, die sich mit uns für die Natur stark machen – als Ehrenamtliche, Förderer, Projektpartner oder einfach als Naturfreund*innen.
Bildung – für eine nachhaltige Zukunft
Wir verstehen Artenschutz auch als Bildungsauftrag. Deshalb entwickeln wir Programme, Workshops und Lehrmaterialien, die ökologische Zusammenhänge vermitteln und den Wert der Natur erlebbar machen. Gerade junge Menschen gewinnen bei uns einen direkten Zugang zur Natur – und oft auch den Anstoß für langjähriges Engagement im Umweltschutz.
Jeder Beitrag zählt
Ob durch aktive Mitarbeit, das Teilen unseres Anliegens oder die Veränderung im eigenen Alltag: Jeder Beitrag hilft, unsere Natur zu bewahren. Denn Artenschutz geht uns alle an – und beginnt genau dort, wo Menschen Verantwortung übernehmen.
Unsere Vision ist klar: eine lebendige Landschaft mit Platz für Vielfalt, für Wildnis, für Miteinander. Eine Zukunft, in der auch kommende Generationen eine reiche Natur erleben können.
Artenschutz in Franken®
Deutschlandweit aktiv – regional verwurzelt
Unsere Initiative ist bundesweit aktiv – von den Küsten bis zu den Mittelgebirgen, von Moorlandschaften bis in städtische Grünzonen. Überall dort, wo Arten verschwinden oder Lebensräume unter Druck geraten, setzen wir gezielt an. Dabei arbeiten wir eng mit lokalen Akteurinnen zusammen: mit Ehrenamtlichen, Schulen, Landwirtinnen, Kommunen und anderen Umweltorganisationen. Denn Naturschutz funktioniert nur im Dialog und durch Zusammenarbeit auf Augenhöhe.
Unsere Schwerpunkte:
- Schutz bedrohter Arten: Durch Monitoring, gezielte Maßnahmen und Schutzkonzepte helfen wir gefährdeten Tieren und Pflanzen.
- Pflege und Wiederherstellung von Lebensräumen: Ob Wiesen, Wälder, Feuchtgebiete oder Gewässer – wir schaffen Bedingungen, unter denen die Natur sich erholen kann.
- Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit: Wir bringen Naturwissen in Schulen, Kindergärten und die breite Öffentlichkeit – verständlich, spannend und praxisnah.
- Beteiligung und Ehrenamt: Wir bieten Mitmachangebote für Menschen jeden Alters – von Pflanzaktionen bis zu Biotoppflegeeinsätzen.
- Beratung für Flächennutzende: Wir unterstützen Landwirt*innen, Gemeinden und Unternehmen bei naturverträglicher Bewirtschaftung.
Engagement, das wirkt
Unser Ansatz ist lösungsorientiert und praxisnah. Statt auf Symbolpolitik setzen wir auf messbare Wirkung: Wo wir tätig sind, wächst neue Vielfalt. Amphibien wandern wieder, Insekten finden Nahrung, seltene Pflanzen kehren zurück. Dieses Ergebnis verdanken wir nicht zuletzt den zahlreichen Menschen, die sich mit uns für die Natur stark machen – als Ehrenamtliche, Förderer, Projektpartner oder einfach als Naturfreund*innen.
Bildung – für eine nachhaltige Zukunft
Wir verstehen Artenschutz auch als Bildungsauftrag. Deshalb entwickeln wir Programme, Workshops und Lehrmaterialien, die ökologische Zusammenhänge vermitteln und den Wert der Natur erlebbar machen. Gerade junge Menschen gewinnen bei uns einen direkten Zugang zur Natur – und oft auch den Anstoß für langjähriges Engagement im Umweltschutz.
Jeder Beitrag zählt
Ob durch aktive Mitarbeit, das Teilen unseres Anliegens oder die Veränderung im eigenen Alltag: Jeder Beitrag hilft, unsere Natur zu bewahren. Denn Artenschutz geht uns alle an – und beginnt genau dort, wo Menschen Verantwortung übernehmen.
Unsere Vision ist klar: eine lebendige Landschaft mit Platz für Vielfalt, für Wildnis, für Miteinander. Eine Zukunft, in der auch kommende Generationen eine reiche Natur erleben können.
Artenschutz in Franken®
Artenschutz in Franken®
... ein unterschätzter Nützling an unserer Wildbienenwand

Die Haus-Feldwespe (Polistes dominula) – ein unterschätzter Nützling an unserer Wildbienenwand
28/29.07.2025
Diese filigrane Wespenart fällt durch ihre schlanke Gestalt, die lange Taille und die kontrastreiche schwarz-gelbe Färbung auf – Merkmale, die sie auf den ersten Blick mit den bekannteren „klassischen“ Wespenarten wie der Deutschen oder der Gemeinen Wespe verbinden lässt. Doch in ihrem Verhalten unterscheidet sich Polistes dominula deutlich: Sie ist weniger aufdringlich, ausgesprochen friedfertig und in vielerlei Hinsicht ein nützlicher Bestandteil unserer heimischen Insektenwelt.
Warum gerade Metall?
28/29.07.2025
- An vielen Wildbienenwänden mit schützender Überdachung, insbesondere bei Konstruktionen mit Metall- oder Blechdach, lässt sich ein interessanter und oft übersehener Gast beobachten: die Haus-Feldwespe (Polistes dominula).
Diese filigrane Wespenart fällt durch ihre schlanke Gestalt, die lange Taille und die kontrastreiche schwarz-gelbe Färbung auf – Merkmale, die sie auf den ersten Blick mit den bekannteren „klassischen“ Wespenarten wie der Deutschen oder der Gemeinen Wespe verbinden lässt. Doch in ihrem Verhalten unterscheidet sich Polistes dominula deutlich: Sie ist weniger aufdringlich, ausgesprochen friedfertig und in vielerlei Hinsicht ein nützlicher Bestandteil unserer heimischen Insektenwelt.
Warum gerade Metall?
Die Haus-Feldwespe zeigt eine bemerkenswerte Vorliebe für glatte, wettergeschützte Oberflächen – insbesondere für solche aus Metall. An überdachten Wildbienenwänden mit Blech- oder Aluminiumdach findet sie ideale Bedingungen: Die metallischen Oberflächen speichern Wärme, bieten Schutz vor Regen und Wind, und sind oft so gelegen, dass sie vor Fressfeinden gut verborgen sind. Diese Kombination macht sie zu einem bevorzugten Standort für den Nestbau.
Ihr Nest besteht aus papierähnlichem Material, das die Wespe aus zerkauten Pflanzenfasern und Speichel selbst herstellt. Die kleinen, offenen Waben werden meist direkt unter dem Überstand des Metalldachs befestigt – gut zugänglich für das Weibchen, aber gleichzeitig geschützt vor Witterungseinflüssen. Solche Nester bleiben oft über Wochen hinweg unbemerkt, da sie klein und unauffällig sind und die Tiere kaum Aggressionsverhalten zeigen.
Friedliche Mitbewohner mit Nutzen
Im Gegensatz zu den bekannten „Kuchentisch-Wespen“ sind Haus-Feldwespen wenig an menschlicher Nahrung interessiert. Sie ernähren sich überwiegend von Nektar und anderen süßen Pflanzensäften, während ihre Larven mit kleinen Insekten und Spinnen gefüttert werden. Auf diese Weise leisten sie einen nicht zu unterschätzenden Beitrag zur natürlichen Schädlingskontrolle in Gärten und naturnahen Flächen.
Für den Menschen sind Polistes dominula in der Regel vollkommen ungefährlich. Selbst in unmittelbarer Nähe ihres Nestes bleiben sie ruhig, solange sie sich nicht bedroht fühlen. Ihre friedliche Art und ihr ökologischer Nutzen machen sie zu einem willkommenen Bewohner an Wildbienenwänden – selbst wenn sie dort ursprünglich nicht gezielt angesiedelt wurden.
Ein Zeichen für Artenvielfalt
Dass sich Haus-Feldwespen an Wildbienenwänden niederlassen, ist nicht etwa ein „Störfall“, sondern vielmehr ein Zeichen dafür, dass diese Strukturen nicht nur Wildbienen, sondern auch anderen nützlichen Insekten wertvollen Lebensraum bieten. Ihre Anwesenheit ist ein gutes Beispiel dafür, wie naturnahe Gestaltung im Garten oder auf öffentlichen Flächen zur Förderung der Artenvielfalt beiträgt.
Wer genau hinsieht, kann die Entwicklung der kleinen Nester über Wochen hinweg beobachten – vom ersten zarten Nestansatz bis zur Aufzucht mehrerer Generationen. Für Naturfreunde und Insekteninteressierte ist das eine einmalige Gelegenheit, das Leben dieser faszinierenden Wespenart aus nächster Nähe zu erleben.
Tipp: Wenn Sie ein Nest der Haus-Feldwespe an Ihrer Wildbienenwand entdecken, lassen Sie es ruhig bestehen – die Tiere ziehen im Herbst von selbst wieder aus, und das Nest wird nicht erneut besiedelt. Eine wertvolle Beobachtung ...
In der Aufnahme
Ihr Nest besteht aus papierähnlichem Material, das die Wespe aus zerkauten Pflanzenfasern und Speichel selbst herstellt. Die kleinen, offenen Waben werden meist direkt unter dem Überstand des Metalldachs befestigt – gut zugänglich für das Weibchen, aber gleichzeitig geschützt vor Witterungseinflüssen. Solche Nester bleiben oft über Wochen hinweg unbemerkt, da sie klein und unauffällig sind und die Tiere kaum Aggressionsverhalten zeigen.
Friedliche Mitbewohner mit Nutzen
Im Gegensatz zu den bekannten „Kuchentisch-Wespen“ sind Haus-Feldwespen wenig an menschlicher Nahrung interessiert. Sie ernähren sich überwiegend von Nektar und anderen süßen Pflanzensäften, während ihre Larven mit kleinen Insekten und Spinnen gefüttert werden. Auf diese Weise leisten sie einen nicht zu unterschätzenden Beitrag zur natürlichen Schädlingskontrolle in Gärten und naturnahen Flächen.
Für den Menschen sind Polistes dominula in der Regel vollkommen ungefährlich. Selbst in unmittelbarer Nähe ihres Nestes bleiben sie ruhig, solange sie sich nicht bedroht fühlen. Ihre friedliche Art und ihr ökologischer Nutzen machen sie zu einem willkommenen Bewohner an Wildbienenwänden – selbst wenn sie dort ursprünglich nicht gezielt angesiedelt wurden.
Ein Zeichen für Artenvielfalt
Dass sich Haus-Feldwespen an Wildbienenwänden niederlassen, ist nicht etwa ein „Störfall“, sondern vielmehr ein Zeichen dafür, dass diese Strukturen nicht nur Wildbienen, sondern auch anderen nützlichen Insekten wertvollen Lebensraum bieten. Ihre Anwesenheit ist ein gutes Beispiel dafür, wie naturnahe Gestaltung im Garten oder auf öffentlichen Flächen zur Förderung der Artenvielfalt beiträgt.
Wer genau hinsieht, kann die Entwicklung der kleinen Nester über Wochen hinweg beobachten – vom ersten zarten Nestansatz bis zur Aufzucht mehrerer Generationen. Für Naturfreunde und Insekteninteressierte ist das eine einmalige Gelegenheit, das Leben dieser faszinierenden Wespenart aus nächster Nähe zu erleben.
Tipp: Wenn Sie ein Nest der Haus-Feldwespe an Ihrer Wildbienenwand entdecken, lassen Sie es ruhig bestehen – die Tiere ziehen im Herbst von selbst wieder aus, und das Nest wird nicht erneut besiedelt. Eine wertvolle Beobachtung ...
In der Aufnahme
- Hier ist eine Haus-Feldwespe (Polistes dominula) dabei, ihr kleines Nest direkt unter dem Dach einer Wildbienenwand zu errichten. Deutlich zu erkennen sind die filigranen Wabenstrukturen, die sie aus zerkauten Pflanzenfasern formt und sorgfältig am Metall befestigt. Die geschützte Lage unter dem Überstand bietet ideale Bedingungen für die Brutpflege – ein spannender Einblick in das natürliche Verhalten dieser friedlichen und nützlichen Wespenart.
Artenschutz in Franken®
Unterwasser-Schottergärten ...

Unterwasser-Schottergärten – Wenn Fischteiche zu ökologischen Problemzonen werden
27/28.07.2025
Doch während die vegetationsfreien Steinflächen an der Oberfläche zunehmend kritisch betrachtet werden, bleibt ein ähnliches Phänomen unter Wasser oft unbeachtet – dabei sind die ökologischen Folgen ebenso gravierend. Die Rede ist von der zunehmenden Praxis, private Fischzuchtteiche oder Gartenteiche mit Kalksteinen oder anderen mineralischen Materialien flächig zu befestigen.
27/28.07.2025
- Die Debatte um Schottergärten im Siedlungsbereich hat das Bewusstsein für den Verlust von Biodiversität im urbanen Raum geschärft.
Doch während die vegetationsfreien Steinflächen an der Oberfläche zunehmend kritisch betrachtet werden, bleibt ein ähnliches Phänomen unter Wasser oft unbeachtet – dabei sind die ökologischen Folgen ebenso gravierend. Die Rede ist von der zunehmenden Praxis, private Fischzuchtteiche oder Gartenteiche mit Kalksteinen oder anderen mineralischen Materialien flächig zu befestigen.
Ein aktuelles Beispiel zeigt einen frisch angelegten Teich, dessen gesamte Uferzone zu 100 Prozent mit grobem "Kalkbruch" belegt wurde – ohne jede Bepflanzung oder Strukturierung mit naturnahen Materialien. Was aus gestalterischer oder pflegetechnischer Sicht als „pflegeleicht“ gilt, entpuppt sich aus ökologischer Perspektive als strukturarmer Lebensraum, eine submerse Schotterwüste, die weder als Laichhabitat noch als Rückzugsort für aquatische Organismen dient.
Strukturelle Vielfalt ist Grundlage biologischer Vielfalt
Für ein funktionierendes Teichökosystem ist Habitatdiversität – also die Vielfalt an Mikrohabitaten – von zentraler Bedeutung. Ufer- und Flachwasserbereiche spielen dabei eine Schlüsselrolle. In einem naturnah gestalteten Teich finden sich beispielsweise:
Diese Elemente ermöglichen das Vorkommen zahlreicher Arten: von Libellenlarven und Amphibien über Wasserkäfer und Mollusken bis hin zu verschiedenen Fischarten, die strukturreiche Zonen als Laichplatz und Brutrevier benötigen. Ein monoton mit Gestein bedecktes Ufer hingegen verhindert diese ökologische Nischenbildung.
Negative Auswirkungen auf Wasserqualität und Ökosystemfunktionen
Auch die wasserchemische Dynamik wird durch solche Eingriffe beeinflusst. Vor allem Kalkgesteine (z. B. Dolomit oder Muschelkalk) können den pH-Wert und die Karbonathärte (KH) des Wassers verändern, was sich negativ auf empfindliche Arten auswirken kann. Die fehlende Bepflanzung reduziert die Fähigkeit des Systems, Nährstoffe wie Nitrat oder Phosphat aufzunehmen, wodurch das Risiko von Algenblüten steigt.
Zudem entfallen durch die fehlende Vegetation ökosystemare Dienstleistungen wie:
Wasserentnahme – eine oft unterschätzte Gefährdung
Ein weiteres ernstzunehmendes Problem stellt die Wasserentnahme aus natürlichen Fließgewässern zur Befüllung privater Teiche dar. In einem dokumentierten Fall wurde einem kleinen, ökologisch wertvollen Bachlauf – in dem sich zur gleichen Zeit mehrere Amphibienarten in der Reproduktion befanden – in kurzer Zeit so viel Wasser entzogen, dass das Gewässer stellenweise trocken zu fallen drohte. Das hätte dramatische Folgen für Laich und Larvenbestand gehabt. Dank der frühzeitigen Einbindung der zuständigen Fachbehörden konnte das Vorgehen gestoppt und das Gewässer vor dem Austrocknen bewahrt werden. Dieser Vorfall zeigt eindrücklich, wie wichtig es ist, wasserrechtliche Vorgaben zu beachten und stets den ökologischen Zustand eines Gewässers mitzudenken – besonders in Zeiten zunehmender Trockenperioden durch den Klimawandel.
Fischzucht versus Naturschutz – ein vermeidbarer Zielkonflikt
Private Fischteiche werden häufig als Nutzgewässer betrachtet, bei denen gestalterische und naturschutzfachliche Aspekte vernachlässigt werden. Dabei schließen sich Fischzucht und Naturnähe keineswegs aus. Im Gegenteil: Ein strukturreicher Teich fördert die Gesundheit der Fische, verbessert die Wasserqualität und trägt zur Förderung seltener und gefährdeter Arten bei – wie etwa der Kammmolch oder die Große Moosjungfer, die auf strukturreiche, fischfreie Flachgewässer angewiesen sind.
Handlungsempfehlungen für eine ökologische Teichgestaltung
Wer einen Teich ökologisch wertvoll gestalten möchte, sollte folgende Grundsätze beachten:
Fazit
Die flächige Steinabdeckung in privaten Fischteichen mag optisch ansprechend erscheinen, doch sie ist aus ökologischer Sicht ein Irrweg. Wer sich für artenreiche und funktionsfähige Gewässerökosysteme einsetzt, sollte auf naturnahe Strukturen und Materialien setzen – sowohl über als auch unter Wasser. Nur so kann ein Teich zu einem wertvollen Lebensraum werden, der über seine reine Nutzfunktion hinaus einen Beitrag zur Förderung der Biodiversität leistet.
In der Aufnahme
Strukturelle Vielfalt ist Grundlage biologischer Vielfalt
Für ein funktionierendes Teichökosystem ist Habitatdiversität – also die Vielfalt an Mikrohabitaten – von zentraler Bedeutung. Ufer- und Flachwasserbereiche spielen dabei eine Schlüsselrolle. In einem naturnah gestalteten Teich finden sich beispielsweise:
- Makrophytenzonen (z. B. mit Schilfrohr, Laichkräutern, Wasserlinsen)
- Substrate mit unterschiedlichen Korngrößen (Lehm, Sand, Kies)
- Totholzstrukturen als Versteck- und Nahrungsquellen
- Wechsel zwischen Beschattung und Sonneneinstrahlung
Diese Elemente ermöglichen das Vorkommen zahlreicher Arten: von Libellenlarven und Amphibien über Wasserkäfer und Mollusken bis hin zu verschiedenen Fischarten, die strukturreiche Zonen als Laichplatz und Brutrevier benötigen. Ein monoton mit Gestein bedecktes Ufer hingegen verhindert diese ökologische Nischenbildung.
Negative Auswirkungen auf Wasserqualität und Ökosystemfunktionen
Auch die wasserchemische Dynamik wird durch solche Eingriffe beeinflusst. Vor allem Kalkgesteine (z. B. Dolomit oder Muschelkalk) können den pH-Wert und die Karbonathärte (KH) des Wassers verändern, was sich negativ auf empfindliche Arten auswirken kann. Die fehlende Bepflanzung reduziert die Fähigkeit des Systems, Nährstoffe wie Nitrat oder Phosphat aufzunehmen, wodurch das Risiko von Algenblüten steigt.
Zudem entfallen durch die fehlende Vegetation ökosystemare Dienstleistungen wie:
- Sauerstoffproduktion durch submerse Pflanzen
- Sedimentstabilisierung durch Wurzelwerk
- Filtrationsleistung durch Röhrichtzonen
- Klimaregulation durch Wasserverdunstung und Beschattung
Wasserentnahme – eine oft unterschätzte Gefährdung
Ein weiteres ernstzunehmendes Problem stellt die Wasserentnahme aus natürlichen Fließgewässern zur Befüllung privater Teiche dar. In einem dokumentierten Fall wurde einem kleinen, ökologisch wertvollen Bachlauf – in dem sich zur gleichen Zeit mehrere Amphibienarten in der Reproduktion befanden – in kurzer Zeit so viel Wasser entzogen, dass das Gewässer stellenweise trocken zu fallen drohte. Das hätte dramatische Folgen für Laich und Larvenbestand gehabt. Dank der frühzeitigen Einbindung der zuständigen Fachbehörden konnte das Vorgehen gestoppt und das Gewässer vor dem Austrocknen bewahrt werden. Dieser Vorfall zeigt eindrücklich, wie wichtig es ist, wasserrechtliche Vorgaben zu beachten und stets den ökologischen Zustand eines Gewässers mitzudenken – besonders in Zeiten zunehmender Trockenperioden durch den Klimawandel.
Fischzucht versus Naturschutz – ein vermeidbarer Zielkonflikt
Private Fischteiche werden häufig als Nutzgewässer betrachtet, bei denen gestalterische und naturschutzfachliche Aspekte vernachlässigt werden. Dabei schließen sich Fischzucht und Naturnähe keineswegs aus. Im Gegenteil: Ein strukturreicher Teich fördert die Gesundheit der Fische, verbessert die Wasserqualität und trägt zur Förderung seltener und gefährdeter Arten bei – wie etwa der Kammmolch oder die Große Moosjungfer, die auf strukturreiche, fischfreie Flachgewässer angewiesen sind.
Handlungsempfehlungen für eine ökologische Teichgestaltung
Wer einen Teich ökologisch wertvoll gestalten möchte, sollte folgende Grundsätze beachten:
- Verzicht auf flächendeckende Steine in Ufer- und Flachwasserbereichen
- Einbindung autochthoner Wasser- und Uferpflanzen
- Anlage strukturreicher Uferzonen mit unterschiedlichen Substraten
- Schaffung fischfreier Rückzugsbereiche für Amphibien und Insekten
- Reduktion künstlicher Eingriffe wie Umwälzpumpen oder chemischer Wasserbehandlung
Fazit
Die flächige Steinabdeckung in privaten Fischteichen mag optisch ansprechend erscheinen, doch sie ist aus ökologischer Sicht ein Irrweg. Wer sich für artenreiche und funktionsfähige Gewässerökosysteme einsetzt, sollte auf naturnahe Strukturen und Materialien setzen – sowohl über als auch unter Wasser. Nur so kann ein Teich zu einem wertvollen Lebensraum werden, der über seine reine Nutzfunktion hinaus einen Beitrag zur Förderung der Biodiversität leistet.
In der Aufnahme
- fast 100% sch(au)ott .. erig
Artenschutz in Franken®
... Zielkonflikt mit wachsender Bedeutung für die Biodiversität

Windkraft und Artenschutz – ein Zielkonflikt mit wachsender Bedeutung für die Biodiversität
26/27.07.2025
Der Ausbau der Windenergie spielt dabei eine zentrale Rolle in der deutschen und europäischen Energie- und Klimapolitik. Doch während Windkraftanlagen als Symbol des Fortschritts und der Nachhaltigkeit gelten, geraten sie zunehmend in das Spannungsfeld zwischen Klimaschutz und Artenschutz – ein Konflikt, der sich besonders im offenen Landschaftsraum manifestiert.
26/27.07.2025
- Der Übergang zu erneuerbaren Energiequellen ist eine der dringendsten Aufgaben unserer Zeit.
Der Ausbau der Windenergie spielt dabei eine zentrale Rolle in der deutschen und europäischen Energie- und Klimapolitik. Doch während Windkraftanlagen als Symbol des Fortschritts und der Nachhaltigkeit gelten, geraten sie zunehmend in das Spannungsfeld zwischen Klimaschutz und Artenschutz – ein Konflikt, der sich besonders im offenen Landschaftsraum manifestiert.
Die Aufnahme eines fliegenden Mäusebussards (Buteo buteo), der nur wenige Meter entfernt an den Rotorblättern einer Windkraftanlage vorbeizieht, verdeutlicht die Dringlichkeit und Brisanz dieser Problematik auf eindrucksvolle Weise. Es ist ein Sinnbild für eine Entwicklung, bei der Schutzgüter, die eigentlich gleichermaßen Priorität genießen sollten – Klima und biologische Vielfalt – in direkte Konkurrenz zueinander geraten.
Greifvögel und Windkraft – eine gefährliche Begegnung
Besonders betroffen sind Großvögel wie Rotmilan, Schwarzmilan, Seeadler, Uhu und eben auch der Mäusebussard – alles Arten, die entweder als gefährdet eingestuft oder streng geschützt sind. Ihre Flugverhalten, Nahrungssuche und Revierverhalten führen sie häufig in Höhenlagen und offene Räume, in denen sich auch Windkraftanlagen konzentrieren. Anders als Fledermäuse, die durch plötzliche Luftdruckänderungen in der Nähe der Rotoren verunglücken (Barotrauma), sind Greifvögel besonders anfällig für direkte Kollisionen mit den sich drehenden Rotorblättern.
Was oft übersehen wird: Der Flugstil dieser Arten – langsam kreisend, mit hohem Anteil an Gleitflug und geringer Manövrierfähigkeit – macht ihnen das rechtzeitige Ausweichen besonders schwer. Hinzu kommt, dass Windenergieanlagen zunehmend in strukturreichen Agrarlandschaften oder auf bewaldeten Höhenlagen entstehen, wo diese Arten bevorzugt jagen oder brüten. Die technische Präsenz in diesen sensiblen Habitaten stellt eine ernstzunehmende Gefährdung dar.
Ein Konflikt mit ökologischer Tiefe
Die Kollision von Vögeln mit Windenergieanlagen ist kein marginales Phänomen. Zahlreiche Studien und Monitoringprogramme belegen regelmäßig Schlagopfer – viele davon aus artenschutzrechtlich besonders relevanten Gruppen. Der kumulative Effekt solcher Verluste auf Populationsebene ist nicht zu unterschätzen, insbesondere bei Arten mit geringer Reproduktionsrate und engem Arealbezug.
Artenschutzkonflikte mit Windkraft entstehen aber nicht nur durch direkte Mortalität. Auch Verdrängungseffekte (sogenannte Scheuchwirkung) im Umkreis von Windrädern, Habitatfragmentierung, Verlust von Horstbäumen oder Störungen während der Brutzeit wirken sich negativ auf viele Arten aus. Was als lokal begrenzte technische Maßnahme erscheint, kann im ökologischen Gefüge weiträumige Konsequenzen nach sich ziehen.
Notwendigkeit integrativer Lösungen
Die Herausforderung besteht nicht in der Frage, ob wir Windkraft ausbauen sollen – sondern wie. Eine naturverträgliche Energiewende verlangt nach integrativen, planungsgeleiteten Lösungen, die den Erhalt der Biodiversität als gleichrangiges Ziel berücksichtigen. Dazu gehören:
Nur wenn der Ausbau der Windkraft auf wissenschaftlich fundierter und ökologisch verantwortungsvoller Grundlage erfolgt, kann die Energiewende nicht nur klimaneutral, sondern auch naturverträglich gelingen.
Fazit: Zwischen Anspruch und Realität
Die ökologische Transformation unserer Energieversorgung darf nicht auf Kosten der Artenvielfalt gehen. Der Schutz von Klima und Biodiversität ist kein Widerspruch – er ist nur dann tragfähig, wenn beide Ziele gleichwertig betrachtet und konsequent miteinander in Einklang gebracht werden.
Die Szene eines Mäusebussards im unmittelbaren Luftraum eines Windrades erinnert uns eindrucksvoll daran, dass wir Verantwortung tragen – für das Klima ebenso wie für die Arten, die in dieser sich wandelnden Landschaft ihren Platz behaupten müssen. Es liegt an uns, Wege zu finden, die beides ermöglichen.
Greifvögel und Windkraft – eine gefährliche Begegnung
Besonders betroffen sind Großvögel wie Rotmilan, Schwarzmilan, Seeadler, Uhu und eben auch der Mäusebussard – alles Arten, die entweder als gefährdet eingestuft oder streng geschützt sind. Ihre Flugverhalten, Nahrungssuche und Revierverhalten führen sie häufig in Höhenlagen und offene Räume, in denen sich auch Windkraftanlagen konzentrieren. Anders als Fledermäuse, die durch plötzliche Luftdruckänderungen in der Nähe der Rotoren verunglücken (Barotrauma), sind Greifvögel besonders anfällig für direkte Kollisionen mit den sich drehenden Rotorblättern.
Was oft übersehen wird: Der Flugstil dieser Arten – langsam kreisend, mit hohem Anteil an Gleitflug und geringer Manövrierfähigkeit – macht ihnen das rechtzeitige Ausweichen besonders schwer. Hinzu kommt, dass Windenergieanlagen zunehmend in strukturreichen Agrarlandschaften oder auf bewaldeten Höhenlagen entstehen, wo diese Arten bevorzugt jagen oder brüten. Die technische Präsenz in diesen sensiblen Habitaten stellt eine ernstzunehmende Gefährdung dar.
Ein Konflikt mit ökologischer Tiefe
Die Kollision von Vögeln mit Windenergieanlagen ist kein marginales Phänomen. Zahlreiche Studien und Monitoringprogramme belegen regelmäßig Schlagopfer – viele davon aus artenschutzrechtlich besonders relevanten Gruppen. Der kumulative Effekt solcher Verluste auf Populationsebene ist nicht zu unterschätzen, insbesondere bei Arten mit geringer Reproduktionsrate und engem Arealbezug.
Artenschutzkonflikte mit Windkraft entstehen aber nicht nur durch direkte Mortalität. Auch Verdrängungseffekte (sogenannte Scheuchwirkung) im Umkreis von Windrädern, Habitatfragmentierung, Verlust von Horstbäumen oder Störungen während der Brutzeit wirken sich negativ auf viele Arten aus. Was als lokal begrenzte technische Maßnahme erscheint, kann im ökologischen Gefüge weiträumige Konsequenzen nach sich ziehen.
Notwendigkeit integrativer Lösungen
Die Herausforderung besteht nicht in der Frage, ob wir Windkraft ausbauen sollen – sondern wie. Eine naturverträgliche Energiewende verlangt nach integrativen, planungsgeleiteten Lösungen, die den Erhalt der Biodiversität als gleichrangiges Ziel berücksichtigen. Dazu gehören:
- Raumplanerische Steuerung: Ausschluss besonders sensibler Gebiete (z. B. Brutareale oder Zugkorridore) durch verpflichtende Ausschlusskulissen.
- Fachlich fundierte Standortwahl: Berücksichtigung aktueller Vogelkartierungen, telemetrischer Daten und artspezifischer Raumnutzung.
- Technische Schutzmaßnahmen: Einsatz von Detektionssystemen zur automatisierten Abschaltung bei Vogelflug (z. B. IDAS, DTBird), Rotorstillstand in der Brut- und Aufzuchtzeit, Bepflanzungslenkung zur Vermeidung attraktiver Nahrungshabitate unter Anlagen.
- Monitoring und Nachbesserung: Verpflichtende Begleituntersuchungen mit Anpassungsoptionen bei nachgewiesenen Konflikten.
Nur wenn der Ausbau der Windkraft auf wissenschaftlich fundierter und ökologisch verantwortungsvoller Grundlage erfolgt, kann die Energiewende nicht nur klimaneutral, sondern auch naturverträglich gelingen.
Fazit: Zwischen Anspruch und Realität
Die ökologische Transformation unserer Energieversorgung darf nicht auf Kosten der Artenvielfalt gehen. Der Schutz von Klima und Biodiversität ist kein Widerspruch – er ist nur dann tragfähig, wenn beide Ziele gleichwertig betrachtet und konsequent miteinander in Einklang gebracht werden.
Die Szene eines Mäusebussards im unmittelbaren Luftraum eines Windrades erinnert uns eindrucksvoll daran, dass wir Verantwortung tragen – für das Klima ebenso wie für die Arten, die in dieser sich wandelnden Landschaft ihren Platz behaupten müssen. Es liegt an uns, Wege zu finden, die beides ermöglichen.
Artenschutz in Franken®
Der Pappelblattkäfer (Chrysomela populi)

Der Pappelblattkäfer (Chrysomela populi)
25/26.07.2025
Diese Käferart ist in Europa und Teilen Asiens verbreitet und zeichnet sich durch ihr auffälliges Erscheinungsbild und ihr Verhalten aus.
25/26.07.2025
- Der Pappelblattkäfer, wissenschaftlich bekannt als Chrysomela populi, ist eine Art von Blattkäfer aus der Familie der Chrysomelidae.
Diese Käferart ist in Europa und Teilen Asiens verbreitet und zeichnet sich durch ihr auffälliges Erscheinungsbild und ihr Verhalten aus.
Merkmale:
Der Pappelblattkäfer erreicht eine Körperlänge von etwa 6 bis 10 mm. Sein Körper ist oval geformt und von einer metallisch glänzenden, grünen Farbe, die oft einen bläulichen oder kupfernen Schimmer aufweist. Typischerweise sind die Flügeldecken mit schwarzen Flecken versehen, die je nach Unterart variieren können.
Lebensraum und Verbreitung:
Die bevorzugten Lebensräume des Pappelblattkäfers sind Laubwälder, insbesondere solche, die von Pappeln dominiert werden. Diese Käfer sind nicht nur an Pappeln, sondern auch an anderen Laubbäumen wie Weiden und Erlen anzutreffen. Aufgrund ihrer breiten Verbreitung und Anpassungsfähigkeit sind sie in verschiedenen europäischen Ländern und asiatischen Regionen anzutreffen.
Lebensweise:
Die Larven des Pappelblattkäfers entwickeln sich auf den Blättern ihrer Wirtspflanzen. Sie fressen an den Blättern, wobei sie charakteristische Fensterfraßbilder hinterlassen, die durch das Fressen des Blattgewebes entstehen. Die erwachsenen Käfer sind ebenfalls Pflanzenfresser und ernähren sich von den Blättern der Pappel und anderer geeigneter Baumarten.
Ökologische Bedeutung:
Obwohl der Pappelblattkäfer gelegentlich Schäden an Pappeln und anderen Laubbäumen verursachen kann, ist er ein integraler Bestandteil des Ökosystems. Als natürlicher Teil des Nahrungsnetzes dienen sie verschiedenen Räubern als Nahrung und tragen zur Regulation der Pflanzenpopulationen bei.
Schutzmaßnahmen:
Für Baumschulen und Plantagen, in denen Pappeln angebaut werden, sind Schutzmaßnahmen gegen den Pappelblattkäfer oft notwendig, um bedeutende Schäden zu vermeiden. Dies kann durch den Einsatz von biologischen Kontrollmethoden oder spezifischen Insektiziden geschehen, die gezielt auf die Larven oder erwachsenen Käfer abzielen.
Forschung und Studien:
Aufgrund ihrer ökologischen und landwirtschaftlichen Bedeutung werden Pappelblattkäfer in der wissenschaftlichen Forschung intensiv untersucht. Untersuchungen zu ihrer Biologie, Ökologie und möglichen Bekämpfungsstrategien sind von Interesse für Agrarwissenschaftler, Forstwirte und Biologen gleichermaßen.
Aufnahme von Bernhard Schmalisch
Der Pappelblattkäfer erreicht eine Körperlänge von etwa 6 bis 10 mm. Sein Körper ist oval geformt und von einer metallisch glänzenden, grünen Farbe, die oft einen bläulichen oder kupfernen Schimmer aufweist. Typischerweise sind die Flügeldecken mit schwarzen Flecken versehen, die je nach Unterart variieren können.
Lebensraum und Verbreitung:
Die bevorzugten Lebensräume des Pappelblattkäfers sind Laubwälder, insbesondere solche, die von Pappeln dominiert werden. Diese Käfer sind nicht nur an Pappeln, sondern auch an anderen Laubbäumen wie Weiden und Erlen anzutreffen. Aufgrund ihrer breiten Verbreitung und Anpassungsfähigkeit sind sie in verschiedenen europäischen Ländern und asiatischen Regionen anzutreffen.
Lebensweise:
Die Larven des Pappelblattkäfers entwickeln sich auf den Blättern ihrer Wirtspflanzen. Sie fressen an den Blättern, wobei sie charakteristische Fensterfraßbilder hinterlassen, die durch das Fressen des Blattgewebes entstehen. Die erwachsenen Käfer sind ebenfalls Pflanzenfresser und ernähren sich von den Blättern der Pappel und anderer geeigneter Baumarten.
Ökologische Bedeutung:
Obwohl der Pappelblattkäfer gelegentlich Schäden an Pappeln und anderen Laubbäumen verursachen kann, ist er ein integraler Bestandteil des Ökosystems. Als natürlicher Teil des Nahrungsnetzes dienen sie verschiedenen Räubern als Nahrung und tragen zur Regulation der Pflanzenpopulationen bei.
Schutzmaßnahmen:
Für Baumschulen und Plantagen, in denen Pappeln angebaut werden, sind Schutzmaßnahmen gegen den Pappelblattkäfer oft notwendig, um bedeutende Schäden zu vermeiden. Dies kann durch den Einsatz von biologischen Kontrollmethoden oder spezifischen Insektiziden geschehen, die gezielt auf die Larven oder erwachsenen Käfer abzielen.
Forschung und Studien:
Aufgrund ihrer ökologischen und landwirtschaftlichen Bedeutung werden Pappelblattkäfer in der wissenschaftlichen Forschung intensiv untersucht. Untersuchungen zu ihrer Biologie, Ökologie und möglichen Bekämpfungsstrategien sind von Interesse für Agrarwissenschaftler, Forstwirte und Biologen gleichermaßen.
Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- ... ein Pappelblattkäfer der leuchtet schon intensiv, von orange bis rot. ... frisst von Espen, Weiden, etc. aber knabbert nicht an Nadelbäumen. Bei uns selten zu sehen, Verwechsung ev. mit dem Ameisen Sackkäfer möglich, aber der hat je einen dicken schwarzen Punkt auf den Flügeldecken.
Artenschutz in Franken®
Stele der Biodiversität® - Oberschwappach

Stele der Biodiversität® - Oberschwappach
24/25.07.2025
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutzes in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. sowie der Gemeinde Knetzgau, das unabhängig von der Deutschen Postcode Lotterie, der Petra und Matthias Hanft-Stiftung für Tier- und Naturschutz und der Steuerkanzlei Bauerfeind aus München unterstützt wird.
Oberschwappach / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen, kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
24/25.07.2025
- Grafische Gestaltung ... kurz vor dem Abschluss
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutzes in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. sowie der Gemeinde Knetzgau, das unabhängig von der Deutschen Postcode Lotterie, der Petra und Matthias Hanft-Stiftung für Tier- und Naturschutz und der Steuerkanzlei Bauerfeind aus München unterstützt wird.
Oberschwappach / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen, kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
In der Aufnahme
- Am 20.07.2025 haben wir diesen grafischen Gestaltungsfortschritt erreicht ...
Artenschutz in Franken®
Die Europäische Maulwurfsgrille (Gryllotalpa gryllotalpa)
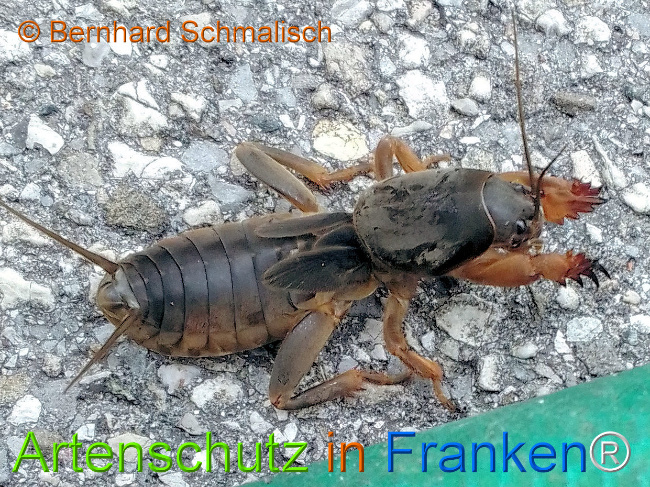
Die Europäische Maulwurfsgrille (Gryllotalpa gryllotalpa) – ein verborgenes Insekt mit faszinierenden Eigenschaften
23/24.07.2025
Trotz ihrer Ähnlichkeit mit einem Schädling spielt sie im Naturhaushalt eine wichtige Rolle.
23/24.07.2025
- Die Europäische Maulwurfsgrille (Gryllotalpa gryllotalpa) ist ein besonders interessantes Insekt, das in Mitteleuropa heimisch ist, aber aufgrund ihrer verborgenen Lebensweise und zurückgehender Bestände nur selten wahrgenommen wird.
Trotz ihrer Ähnlichkeit mit einem Schädling spielt sie im Naturhaushalt eine wichtige Rolle.
Merkmale und Aussehen
Die Maulwurfsgrille gehört zur Ordnung der Heuschrecken (Orthoptera), innerhalb der Familie der Maulwurfsgrillen (Gryllotalpidae). Sie erreicht eine Körperlänge von 3,5 bis 5 cm und ist durch ihren walzenförmigen Körper, die samtig braune Färbung und die kräftigen Vorderbeine gut zu erkennen. Diese Vorderbeine ähneln stark denen eines Maulwurfs und sind perfekt an das Graben im Boden angepasst – daher auch ihr deutscher Name.
Lebensweise und Verhalten
Gryllotalpa gryllotalpa lebt nahezu ausschließlich im Boden und bevorzugt feuchte, humusreiche und lockere Böden wie sie z. B. in Flussauen, extensiv bewirtschafteten Wiesen oder naturnahen Gärten vorkommen. Die Art ist dämmerungs- und nachtaktiv, ernährt sich von Wurzeln, Insektenlarven, Regenwürmern sowie pflanzlichen Resten.
Ein besonders bemerkenswertes Verhalten zeigt das Männchen während der Fortpflanzungszeit: Es gräbt spezielle „Rufröhren“, um seinen zirpenden Gesang zu verstärken und Weibchen anzulocken. Diese Rufe sind unter günstigen Bedingungen über mehrere Meter hinweg hörbar.
Fortpflanzung
Die Eiablage erfolgt im späten Frühjahr bis Frühsommer. Das Weibchen legt die Eier in selbstgebaute unterirdische Brutkammern. Nach dem Schlüpfen entwickeln sich die Jungtiere über mehrere Larvenstadien hinweg, bis sie nach etwa ein bis zwei Jahren geschlechtsreif sind. In kühleren Regionen kann die Entwicklung sogar bis zu drei Jahre dauern.
Gefährdung und Schutz
Die Europäische Maulwurfsgrille ist in vielen Teilen Europas stark im Rückgang begriffen. Gründe hierfür sind:
In Deutschland steht Gryllotalpa gryllotalpa auf der Roten Liste gefährdeter Arten. In mehreren Bundesländern ist sie als streng geschützt eingestuft (§ 44 BNatSchG), was auch den Schutz ihrer Lebensräume umfasst.
Bedeutung für das Ökosystem
Auch wenn sie in Gärten gelegentlich als „Schädling“ angesehen wird, übernimmt die Maulwurfsgrille eine wichtige Rolle im Bodenökosystem. Sie lockert den Boden auf, trägt zur Zersetzung von organischem Material bei und reguliert das Vorkommen bodenlebender Insektenlarven.
Fazit
Die Europäische Maulwurfsgrille ist ein faszinierendes und ökologisch bedeutsames Insekt, das mehr Aufmerksamkeit verdient. Ihr Schutz ist ein wichtiger Beitrag zur Erhaltung der biologischen Vielfalt in unseren Böden. Maßnahmen wie die Förderung strukturreicher Wiesen, der Verzicht auf chemische Pflanzenschutzmittel und die Entsiegelung von Böden tragen entscheidend zum Erhalt dieser bedrohten Art bei.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
Die Maulwurfsgrille gehört zur Ordnung der Heuschrecken (Orthoptera), innerhalb der Familie der Maulwurfsgrillen (Gryllotalpidae). Sie erreicht eine Körperlänge von 3,5 bis 5 cm und ist durch ihren walzenförmigen Körper, die samtig braune Färbung und die kräftigen Vorderbeine gut zu erkennen. Diese Vorderbeine ähneln stark denen eines Maulwurfs und sind perfekt an das Graben im Boden angepasst – daher auch ihr deutscher Name.
Lebensweise und Verhalten
Gryllotalpa gryllotalpa lebt nahezu ausschließlich im Boden und bevorzugt feuchte, humusreiche und lockere Böden wie sie z. B. in Flussauen, extensiv bewirtschafteten Wiesen oder naturnahen Gärten vorkommen. Die Art ist dämmerungs- und nachtaktiv, ernährt sich von Wurzeln, Insektenlarven, Regenwürmern sowie pflanzlichen Resten.
Ein besonders bemerkenswertes Verhalten zeigt das Männchen während der Fortpflanzungszeit: Es gräbt spezielle „Rufröhren“, um seinen zirpenden Gesang zu verstärken und Weibchen anzulocken. Diese Rufe sind unter günstigen Bedingungen über mehrere Meter hinweg hörbar.
Fortpflanzung
Die Eiablage erfolgt im späten Frühjahr bis Frühsommer. Das Weibchen legt die Eier in selbstgebaute unterirdische Brutkammern. Nach dem Schlüpfen entwickeln sich die Jungtiere über mehrere Larvenstadien hinweg, bis sie nach etwa ein bis zwei Jahren geschlechtsreif sind. In kühleren Regionen kann die Entwicklung sogar bis zu drei Jahre dauern.
Gefährdung und Schutz
Die Europäische Maulwurfsgrille ist in vielen Teilen Europas stark im Rückgang begriffen. Gründe hierfür sind:
- Intensivierung der Landwirtschaft
- Verlust strukturreicher Feuchtlebensräume
- Bodenverdichtung und Einsatz von Pestiziden
- Flächenversiegelung
In Deutschland steht Gryllotalpa gryllotalpa auf der Roten Liste gefährdeter Arten. In mehreren Bundesländern ist sie als streng geschützt eingestuft (§ 44 BNatSchG), was auch den Schutz ihrer Lebensräume umfasst.
Bedeutung für das Ökosystem
Auch wenn sie in Gärten gelegentlich als „Schädling“ angesehen wird, übernimmt die Maulwurfsgrille eine wichtige Rolle im Bodenökosystem. Sie lockert den Boden auf, trägt zur Zersetzung von organischem Material bei und reguliert das Vorkommen bodenlebender Insektenlarven.
Fazit
Die Europäische Maulwurfsgrille ist ein faszinierendes und ökologisch bedeutsames Insekt, das mehr Aufmerksamkeit verdient. Ihr Schutz ist ein wichtiger Beitrag zur Erhaltung der biologischen Vielfalt in unseren Böden. Maßnahmen wie die Förderung strukturreicher Wiesen, der Verzicht auf chemische Pflanzenschutzmittel und die Entsiegelung von Böden tragen entscheidend zum Erhalt dieser bedrohten Art bei.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- Europäische Maulwurfsgrille (Gryllotalpa gryllotalpa)
Artenschutz in Franken®
Schutz und Lebensraum für Fledermäuse – Aus alt wird artenreich

Schutz und Lebensraum für Fledermäuse – Aus alt wird artenreich
22/23.07.2025
Im Rahmen eines ökologisch ausgerichteten Naturschutzprojekts das wir mit Unterstützung des Vereins Turmstationen Deutschland e.V. umsetzen, wird ein stillgelegter, historischer Quellschacht umfassend umgestaltet, um einer besonders gefährdeten Tiergruppe – den heimischen Fledermäusen – ein sicheres und stabiles Winterquartier zu bieten.
Der Umbau dieses ehemaligen technischen Bauwerks erfolgt unter Berücksichtigung aktueller Erkenntnisse der Quartierökologie, Mikroklimaregulierung und artspezifischer Habitatansprüche.
22/23.07.2025
- Revitalisierung eines Quellschachtes als Fledermaus-Winterquartier
Im Rahmen eines ökologisch ausgerichteten Naturschutzprojekts das wir mit Unterstützung des Vereins Turmstationen Deutschland e.V. umsetzen, wird ein stillgelegter, historischer Quellschacht umfassend umgestaltet, um einer besonders gefährdeten Tiergruppe – den heimischen Fledermäusen – ein sicheres und stabiles Winterquartier zu bieten.
Der Umbau dieses ehemaligen technischen Bauwerks erfolgt unter Berücksichtigung aktueller Erkenntnisse der Quartierökologie, Mikroklimaregulierung und artspezifischer Habitatansprüche.
Fledermäuse (Chiroptera) sind auf eine Vielzahl unterschiedlicher Quartiere angewiesen. Während der kalten Jahreszeit ziehen sich viele Arten in unterirdische Winterquartiere (Hibernakel) zurück, in denen konstante Temperaturen zwischen 4 und 9 °C sowie eine hohe Luftfeuchtigkeit von über 85 % herrschen.
Der ehemalige Quellschacht wird hierzu mit spezifischen Hang- und Spaltquartieren ausgestattet. Diese schaffen optimale Bedingungen für eine energiesparende Winterruhe (Torporphase), in der die Tiere ihre Körperfunktionen drastisch herunterfahren.Die Zugänglichkeit des Schachtes wird durch fledermausfreundliche Flugöffnungen gewährleistet.
Gleichzeitig wird der Innenraum gegen Störungen, Raubfeinde und Witterungseinflüsse geschützt – essenziell, da Störungen im Winterquartier zum vorzeitigen Aufwachen und damit zur lebensbedrohlichen Erschöpfung der Tiere führen können.
Gestaltung einer artenreichen Offenlandschaft mit Baumquartieren
Im direkten Umfeld des Quellschachtes entsteht eine strukturreiche, naturnahe Offenfläche mit hoher Biodiversität. Alte Laubbäume – insbesondere höhlenreiche Eichen und Buchen – wurden erhalten und gezielt ergänzt. An diesen ökologisch wertvollen Habitatbäumen werden verschiedene Fledermaus-Sommerquartiere installiert, darunter spezielle Spalten- und Kastentypen, die den unterschiedlichen Ansprüchen von Quartiergemeinschaften gerecht werden.
Diese sogenannten Wochenstubenquartiere bieten vor allem im Sommer weiblichen Tieren sichere Rückzugsräume zur Jungenaufzucht. Einige Quartiere fungieren zudem als Übergangs- und Schwärmquartiere während der Reproduktions- und Paarungszeit. Auch oberirdische Überwinterungsquartiere werden auf dem Gelände installiert werden, auch um die Quartiervielfalt weiter zu erhöhen und zu optimieren. Die angrenzenden Wiesenflächen werden extensiv gepflegt und als insektenreiche Jagdhabitate aufgewertet. Dabei kommen Maßnahmen wie Mahdgutübertragung, Staffelmahd und das gezielte Zulassen von Altgrasstreifen zum Einsatz – wichtige Nahrungsquellen für insektenfressende Fledermausarten.
Gefährdungssituation – warum wir handeln müssen
In Deutschland sind alle 25 heimischen Fledermausarten nach dem Bundesnaturschutzgesetz streng geschützt (§44 BNatSchG). Dennoch gelten 18 von ihnen laut Roter Liste als gefährdet oder vom Aussterben bedroht. Hauptursachen sind der Verlust geeigneter Quartierstrukturen (Gebäudesanierungen, Baumfällungen), der Rückgang strukturreicher Landschaften sowie die Insektenverarmung infolge intensiver Landwirtschaft und Lichtverschmutzung.
Insbesondere gebäudebewohnende Arten wie die Große Mausohren (Myotis myotis), das Graue Langohr (Plecotus austriacus) oder die Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) leiden unter dem Verlust traditioneller Dachböden und Spalten. Baumhöhlenbewohnende Arten wie die Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii) oder die Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) finden immer seltener geeignete Altbäume in Wirtschaftswäldern oder Siedlungsnähe.Unsere Maßnahmen setzen genau hier an: durch gezielte Quartierschaffung, Habitataufwertung und langfristige Schutzkonzepte schaffen wir Lebensräume mit Zukunft – kleinräumig, nachhaltig und naturnah.
Ein Projekt mit Wirkung – für Artenvielfalt und Umweltbildung
Die Umgestaltung des Quellschachtes zu einem artenschutzgerechten Winterquartier sowie die Entwicklung der angrenzenden Offenfläche ist ein wichtiger Baustein im kommunalen Arten- und Habitatmanagement. Neben dem direkten Schutz der Fledermäuse leistet das Projekt auch einen Beitrag zur Umweltbildung und Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Belange des Artenschutzes. Infotafeln vor Ort sollen langfristig helfen, Akzeptanz und Verständnis für den Schutz dieser ökologisch bedeutsamen Tiergruppe zu fördern.
Fazit: Aus Verantwortung für die Nacht
Fledermäuse sind faszinierende, aber hochgradig gefährdete Begleiter unserer Kulturlandschaft. Ihr Schutz ist ein Maßstab für den Zustand unserer Umwelt – und zugleich ein Appell zum Handeln. Die Umgestaltung des alten Quellschachtes und der angrenzenden Fläche zeigt eindrucksvoll, wie technische Relikte der Vergangenheit zu wertvollen Biotopen der Zukunft werden können. Schützen wir gemeinsam die heimischen Fledermäuse – für die Artenvielfalt, für kommende Generationen, für eine lebendige Nacht.
Wir möchten uns auf diesem Weg bei der BEATRICE NOLTE STIFTUNG FÜR NATUR- UND UMWELTSCHUTZ, der Hans Georg Schneider Stiftung, sowie der Stiftung Unsere Erde für die gewährte Projektunterstützung bedanken.
- Mehr zur detaillierten Entwicklung demnächst hier auf unseren Seiten.
In der Abbildung
- Aus einem alten Quellschacht entwickeln wir ein wertvolles Überwinterungsquartier und den Umgriff zu einer Nahrungsoase für Fledermäuse.
Artenschutz in Franken®
Rhagonycha fulva – Der Rote Weichkäfer

Rhagonycha fulva – Der Rote Weichkäfer: Ein flammendfarbener Jäger der Blütenwelt
21/22.07.2025
Der Rote oder Rotgelbe Weichkäfer (Rhagonycha fulva) zählt zu den auffälligsten Käfern Mitteleuropas. Mit seinem leuchtend rot-orangen Körper, den kontrastreich schwarzen Fühlern und Beinen ist er kaum zu übersehen.
Als typisches Mitglied der Familie Cantharidae (Weichkäfer) zeigt er einen weichhäutigen, biegsamen Körperbau – eine Anpassung, die ihm nicht nur Mobilität, sondern auch eine ungewöhnlich vielseitige Lebensweise ermöglicht.
21/22.07.2025
- Auffällige Erscheinung in Rot und Schwarz
Der Rote oder Rotgelbe Weichkäfer (Rhagonycha fulva) zählt zu den auffälligsten Käfern Mitteleuropas. Mit seinem leuchtend rot-orangen Körper, den kontrastreich schwarzen Fühlern und Beinen ist er kaum zu übersehen.
Als typisches Mitglied der Familie Cantharidae (Weichkäfer) zeigt er einen weichhäutigen, biegsamen Körperbau – eine Anpassung, die ihm nicht nur Mobilität, sondern auch eine ungewöhnlich vielseitige Lebensweise ermöglicht.
Körperbau und Bestimmungsmerkmale
Ausgewachsen misst Rhagonycha fulva zwischen 7 und 11 mm. Die Elytren (Flügeldecken) sind matt rötlich-orange und enden stumpf. Die Antenne ist fadenförmig, mehrgliedrig und ein wichtiges Bestimmungsmerkmal. Der Körper ist leicht behaart, wenig sklerotisiert (verhärtet) und auffallend flexibel – ein für Weichkäfer typisches Merkmal.
Aktiv in der Hochsaison des Sommers
Zwischen Juni und August ist der Käfer häufig auf offenen, blütenreichen Flächen zu beobachten – etwa auf Wiesen, Brachflächen, Waldrändern oder in Gärten. Besonders gern besucht er Doldenblütler wie Wilde Möhre (Daucus carota), Pastinak oder Engelwurz.
Räuberisch trotz Blütennähe
Trotz der häufigen Blütenbesuche handelt es sich nicht um einen reinen Pflanzenfresser. Der Rote Weichkäfer ist omnivor mit klarem Schwerpunkt auf kleinen Gliederfüßern. Beutetiere sind unter anderem Blattläuse, Mücken oder kleine Raupen. Mit seinen kräftigen Mandibeln ist er ein effektiver Insektenjäger.Die Larven leben im Boden oder unter der Streuschicht, wo sie ebenfalls räuberisch aktiv sind – etwa auf Insektenlarven, Würmer und junge Schnecken.
Nützling und Bioindikator
Durch seine räuberische Lebensweise trägt Rhagonycha fulva zur natürlichen Schädlingsregulation bei. Gleichzeitig ist er durch seine häufigen Blütenbesuche auch ein sekundärer Bestäuber und spielt somit eine unterstützende Rolle im Ökosystem.Die Art gilt zudem als Bioindikator für strukturreiche, artenreiche Habitate. Ihre Präsenz weist auf ein funktionierendes, ausgewogenes Ökosystem hin. Durch intensive Landwirtschaft, Pestizideinsatz und den Verlust von Blühflächen ist die Art lokal rückläufig.
Kleiner Käfer mit großer Bedeutung
Obwohl der Rote Weichkäfer auf den ersten Blick unscheinbar wirken mag, erfüllt er eine Schlüsselrolle im ökologischen Gefüge vieler Lebensräume. Als Beutegreifer, Bestäuber und Nahrungsquelle für andere Tiere ist er ein Paradebeispiel für die oft unterschätzte Bedeutung von Insekten in natürlichen Kreisläufen.
Steckbrief: Rhagonycha fulva
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
Ausgewachsen misst Rhagonycha fulva zwischen 7 und 11 mm. Die Elytren (Flügeldecken) sind matt rötlich-orange und enden stumpf. Die Antenne ist fadenförmig, mehrgliedrig und ein wichtiges Bestimmungsmerkmal. Der Körper ist leicht behaart, wenig sklerotisiert (verhärtet) und auffallend flexibel – ein für Weichkäfer typisches Merkmal.
Aktiv in der Hochsaison des Sommers
Zwischen Juni und August ist der Käfer häufig auf offenen, blütenreichen Flächen zu beobachten – etwa auf Wiesen, Brachflächen, Waldrändern oder in Gärten. Besonders gern besucht er Doldenblütler wie Wilde Möhre (Daucus carota), Pastinak oder Engelwurz.
Räuberisch trotz Blütennähe
Trotz der häufigen Blütenbesuche handelt es sich nicht um einen reinen Pflanzenfresser. Der Rote Weichkäfer ist omnivor mit klarem Schwerpunkt auf kleinen Gliederfüßern. Beutetiere sind unter anderem Blattläuse, Mücken oder kleine Raupen. Mit seinen kräftigen Mandibeln ist er ein effektiver Insektenjäger.Die Larven leben im Boden oder unter der Streuschicht, wo sie ebenfalls räuberisch aktiv sind – etwa auf Insektenlarven, Würmer und junge Schnecken.
Nützling und Bioindikator
Durch seine räuberische Lebensweise trägt Rhagonycha fulva zur natürlichen Schädlingsregulation bei. Gleichzeitig ist er durch seine häufigen Blütenbesuche auch ein sekundärer Bestäuber und spielt somit eine unterstützende Rolle im Ökosystem.Die Art gilt zudem als Bioindikator für strukturreiche, artenreiche Habitate. Ihre Präsenz weist auf ein funktionierendes, ausgewogenes Ökosystem hin. Durch intensive Landwirtschaft, Pestizideinsatz und den Verlust von Blühflächen ist die Art lokal rückläufig.
Kleiner Käfer mit großer Bedeutung
Obwohl der Rote Weichkäfer auf den ersten Blick unscheinbar wirken mag, erfüllt er eine Schlüsselrolle im ökologischen Gefüge vieler Lebensräume. Als Beutegreifer, Bestäuber und Nahrungsquelle für andere Tiere ist er ein Paradebeispiel für die oft unterschätzte Bedeutung von Insekten in natürlichen Kreisläufen.
Steckbrief: Rhagonycha fulva
- Ordnung: Coleoptera (Käfer)
- Familie: Cantharidae (Weichkäfer)
- Größe: 7–11 mm
- Farbe: Rot-orange mit schwarzen Beinen und Fühlern
- Aktivzeit: Juni–August
- Lebensraum: Wiesen, Waldränder, Gärten
- Ernährung: räuberisch und blütenbesuchend (omnivor)
- Besonderheit: Häufig in Kopula auf Blüten anzutreffen
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- ... die roten Weichkäfer sind noch häufig ... auf Doldenblüten treten sie vermehrt auf ... Ich meine fast jeder hat sie schon mal, eben auf diesen Blüten, gesehen.Sind primär Jäger die kleinere Insekten, auch tote, fressen.
Artenschutz in Franken®
Igel Totfund Vogelwäldchen

Igel Totfund
20/21.07.2025
Ich habe mir den Igel daraufhin angesehen.
20/21.07.2025
- Am 13.07.2025 wurde erneut ein Igel tot gefunden. Die Finderin meinte, dass kommunale Mitarbeiter einer Stadt die Wiese abgemäht hat und den Igel dabei getötet hätte.
Ich habe mir den Igel daraufhin angesehen.
Die Wiese wurde am Wegrand (Pflegeschnitt) abgemäht, aber schon vor zwei Wochen. Der Igel war aber erst seit einigen Stunden tot (Blut frisch/nass). Schmeißfliegeneier und winzige Maden waren zu erkennen.
Wenn Schmeißfliegen-Weibchen mit herangereiften Eiern kein entsprechendes Substrat zur Eiablage finden können, entwickeln sich die Embryonen weiter, so dass bei der Ablage dieser „vorgereiften“ Eier die Maden schon nach 50 Minuten schlüpfen können.
Meine naheliegende Vermutung ist, dass der Igel von einem Mähroboter in den angrenzenden Gärten zu Tode kam. Das Tier wurde dann in die Parkanlage geworfen oder von Krähen oder Elstern dahin getragen und angefressen.
Quelle / Aufnahmen
Gewässer und Naturschutz im Erftkreis
Flora-Fauna-Artenschutz
Naturschutzökologie
Rolf Thiemann
Naturschutzberater
Eisvogelweg 1
50181 Bedburg
Stand 14.07.2025
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung. Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Wenn Schmeißfliegen-Weibchen mit herangereiften Eiern kein entsprechendes Substrat zur Eiablage finden können, entwickeln sich die Embryonen weiter, so dass bei der Ablage dieser „vorgereiften“ Eier die Maden schon nach 50 Minuten schlüpfen können.
Meine naheliegende Vermutung ist, dass der Igel von einem Mähroboter in den angrenzenden Gärten zu Tode kam. Das Tier wurde dann in die Parkanlage geworfen oder von Krähen oder Elstern dahin getragen und angefressen.
Quelle / Aufnahmen
Gewässer und Naturschutz im Erftkreis
Flora-Fauna-Artenschutz
Naturschutzökologie
Rolf Thiemann
Naturschutzberater
Eisvogelweg 1
50181 Bedburg
Stand 14.07.2025
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung. Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Artenschutz in Franken®
Schutzprojekt für Steinkauz und Wiedehopf

Schutzprojekt für Steinkauz und Wiedehopf
19/20.07.2025
Im Rahmen eines praxisorientierten Artenschutzprojekts schaffen wir gemeinsam mit dem Verein Turmstationen Deutschland e.V. auf einer mehrere Hektar großen, extensiv beweideten Offenfläche gezielt Lebensräume für zwei streng geschützte Vogelarten: den Steinkauz (Athene noctua) sowie den Wiedehopf (Upupa epops).
Beide Arten zeigen sich im Bestand in einer prekären Situation!
Unsere vereinseigene Fläche wird als Vielweide mit Mutterkühen und deren Kälbern genutzt. Durch diese extensive Form der nahezu Ganzjahresbeweidung bleibt das Gelände offen, nährstoffarm und mosaikartig strukturiert – eine entscheidende Grundlage für den Erhalt halboffener Kulturlandschaften, wie sie beide Zielarten benötigen. Das Projekt verbindet somit Landwirtschaft mit praktischer Biodiversitätsförderung.
19/20.07.2025
- Zielgerichtetes Habitatmanagement für gefährdete Brutvogelarten
Im Rahmen eines praxisorientierten Artenschutzprojekts schaffen wir gemeinsam mit dem Verein Turmstationen Deutschland e.V. auf einer mehrere Hektar großen, extensiv beweideten Offenfläche gezielt Lebensräume für zwei streng geschützte Vogelarten: den Steinkauz (Athene noctua) sowie den Wiedehopf (Upupa epops).
Beide Arten zeigen sich im Bestand in einer prekären Situation!
Unsere vereinseigene Fläche wird als Vielweide mit Mutterkühen und deren Kälbern genutzt. Durch diese extensive Form der nahezu Ganzjahresbeweidung bleibt das Gelände offen, nährstoffarm und mosaikartig strukturiert – eine entscheidende Grundlage für den Erhalt halboffener Kulturlandschaften, wie sie beide Zielarten benötigen. Das Projekt verbindet somit Landwirtschaft mit praktischer Biodiversitätsförderung.
Habitatoptimierung durch gezielte Maßnahmen
Um die Habitatqualität für Steinkauz und Wiedehopf signifikant zu verbessern, setzen wir eine Kombination bewährter und innovativer Artenschutzmaßnahmen um:
Mehrwert für die Agrarlandschaft
Unser Projekt wirkt nicht nur auf die beiden Zielarten, sondern entfaltet eine Leitbildfunktion für Agrarökosysteme mit hoher biologischer Vielfalt. Auch Begleitarten wie Neuntöter (Lanius collurio), Feldlerche (Alauda arvensis), Schachbrettfalter (Melanargia galathea) oder Wildbienen profitieren unmittelbar von den Maßnahmen.
Kooperation und wissenschaftliche Begleitung
Das Projekt wird in enger Kooperation mit verschiedenen Partnern realisiert. Eine fortlaufende Erfolgskontrolle (Monitoring) begleitet die Umsetzung und liefert u.a. wertvolle Daten zur Reproduktionsrate, Revierbindung und Habitatnutzung der Zielarten. Dieses Projekt ist ein Beispiel dafür, wie landwirtschaftliche Nutzung und Artenschutz Hand in Hand gehen können – konkret, wirksam und zukunftsorientiert.
Wir möchten uns auf diesem Weg bei der Beatrice Nolte Stiftung, der Hans Georg Schneider Stiftung, sowie der Stiftung Unsere Erde für die gewährte Projektunterstützung bedanken.
Um die Habitatqualität für Steinkauz und Wiedehopf signifikant zu verbessern, setzen wir eine Kombination bewährter und innovativer Artenschutzmaßnahmen um:
- Installation artspezifischer Nisthilfen: Für den Steinkauz und en Wiedehopf werden optimal ausgerichtete Brutkästen mit geeigneter Mikroklimatisierung angebracht – teils als Pilotmodelle mit verbessertem Prädatorenschutz.
- Pflege offener Landschaftsstrukturen: Durch die Beweidung mit robusten Mutterkühen erfolgt eine natürliche Vegetationskontrolle. So entstehen Trittstellen, Rohbodenbereiche und Insektenhabitate, die für den Wiedehopf als Nahrungsspezialist (z. B. auf Feldgrillen und Engerlinge) essenziell sind.
- Erhalt von Altbaumbeständen und Einzelstrukturen: Alte Obstbäume, Lesesteinwälle und abgestorbene Baumstämme bleiben gezielt erhalten und bieten zusätzliche Habitatstrukturen für Eulen und Insekten.
Mehrwert für die Agrarlandschaft
Unser Projekt wirkt nicht nur auf die beiden Zielarten, sondern entfaltet eine Leitbildfunktion für Agrarökosysteme mit hoher biologischer Vielfalt. Auch Begleitarten wie Neuntöter (Lanius collurio), Feldlerche (Alauda arvensis), Schachbrettfalter (Melanargia galathea) oder Wildbienen profitieren unmittelbar von den Maßnahmen.
Kooperation und wissenschaftliche Begleitung
Das Projekt wird in enger Kooperation mit verschiedenen Partnern realisiert. Eine fortlaufende Erfolgskontrolle (Monitoring) begleitet die Umsetzung und liefert u.a. wertvolle Daten zur Reproduktionsrate, Revierbindung und Habitatnutzung der Zielarten. Dieses Projekt ist ein Beispiel dafür, wie landwirtschaftliche Nutzung und Artenschutz Hand in Hand gehen können – konkret, wirksam und zukunftsorientiert.
Wir möchten uns auf diesem Weg bei der Beatrice Nolte Stiftung, der Hans Georg Schneider Stiftung, sowie der Stiftung Unsere Erde für die gewährte Projektunterstützung bedanken.
Artenschutz in Franken®
Gewässeruferstreifen als Lebensadern der Artenvielfalt

Gewässeruferstreifen als Lebensadern der Artenvielfalt – Naturschutz und kleinbäuerliche Nutzung im Einklang
18/19.07.2025
Als Verein setzen wir uns aktiv dafür ein, Lebensräume zu schaffen und zu sichern, in denen Pflanzen, Tiere und Menschen im Gleichgewicht miteinander existieren können. Dabei verfolgen wir einen besonderen Ansatz: Naturschutz im Einklang mit kleinbäuerlichen Strukturen.
18/19.07.2025
- Der Erhalt und die Förderung der biologischen Vielfalt ist eine der dringendsten Aufgaben unserer Zeit.
Als Verein setzen wir uns aktiv dafür ein, Lebensräume zu schaffen und zu sichern, in denen Pflanzen, Tiere und Menschen im Gleichgewicht miteinander existieren können. Dabei verfolgen wir einen besonderen Ansatz: Naturschutz im Einklang mit kleinbäuerlichen Strukturen.
Auf unseren vereinseigenen Flächen entwickeln wir modellhafte Projekte, bei denen ökologische Aufwertung und nachhaltige Nutzung Hand in Hand gehen. Ein zentrales Element dabei sind Gewässeruferstreifen – schmale, extensiv gepflegte Zonen entlang von Bachläufen, Gräben oder Teichen, die sich durch hohe ökologische Bedeutung auszeichnen.
Diese Uferstreifen fungieren als Rückzugsräume für zahlreiche bedrohte und spezialisierte Arten. Durch den bewussten Verzicht auf Düngung, Pestizide und maschinelle Bodenbearbeitung entstehen naturnahe Lebensräume, in denen sich eine beeindruckende Vielfalt an Flora und Fauna entfalten kann:
Neben ihrem direkten Nutzen für die Biodiversität erfüllen diese Streifen wichtige ökologische Funktionen: Sie filtern Nährstoffe und Schadstoffe aus dem Oberflächenwasser, verbessern die Wasserqualität, stabilisieren Uferbereiche, mindern Erosion und tragen zur Klimaanpassung bei. Gleichzeitig dienen sie als Biotopverbund, indem sie Wanderwege für Tiere zwischen isolierten Lebensräumen schaffen.
Gerade in Kombination mit kleinbäuerlichen Wirtschaftsformen entfalten diese Maßnahmen ihr volles Potenzial. Denn wo Vielfalt gepflegt wird, entstehen fruchtbare Böden, gesunde Ökosysteme und langfristig auch mehr Resilienz gegenüber Klimawandel und Biodiversitätsverlust. Unsere Flächen zeigen: Landwirtschaft und Naturschutz müssen keine Gegensätze sein. Sie können sich sinnvoll ergänzen – zum Wohle aller.
Wir verstehen unsere Arbeit auch als Einladung an andere Einrichtungen ähnliche Wege zu gehen. Gemeinsam können wir zeigen, dass eine zukunftsfähige Landnutzung möglich ist – eine, die Arten schützt, Landschaften lebendig erhält und gleichzeitig gesunde Lebensmittel produziert.
In der Aufnahme
Diese Uferstreifen fungieren als Rückzugsräume für zahlreiche bedrohte und spezialisierte Arten. Durch den bewussten Verzicht auf Düngung, Pestizide und maschinelle Bodenbearbeitung entstehen naturnahe Lebensräume, in denen sich eine beeindruckende Vielfalt an Flora und Fauna entfalten kann:
- Insekten finden hier reich blühende Pflanzen und ungestörte Brutplätze.
- Amphibien nutzen feuchte Zonen zum Laichen und als temporären Lebensraum.
- Vögel profitieren von der Strukturvielfalt und dem reichen Nahrungsangebot.
- Wildpflanzen, darunter auch viele selten gewordene Arten, können sich in der ungestörten Uferzone wieder etablieren.
Neben ihrem direkten Nutzen für die Biodiversität erfüllen diese Streifen wichtige ökologische Funktionen: Sie filtern Nährstoffe und Schadstoffe aus dem Oberflächenwasser, verbessern die Wasserqualität, stabilisieren Uferbereiche, mindern Erosion und tragen zur Klimaanpassung bei. Gleichzeitig dienen sie als Biotopverbund, indem sie Wanderwege für Tiere zwischen isolierten Lebensräumen schaffen.
Gerade in Kombination mit kleinbäuerlichen Wirtschaftsformen entfalten diese Maßnahmen ihr volles Potenzial. Denn wo Vielfalt gepflegt wird, entstehen fruchtbare Böden, gesunde Ökosysteme und langfristig auch mehr Resilienz gegenüber Klimawandel und Biodiversitätsverlust. Unsere Flächen zeigen: Landwirtschaft und Naturschutz müssen keine Gegensätze sein. Sie können sich sinnvoll ergänzen – zum Wohle aller.
Wir verstehen unsere Arbeit auch als Einladung an andere Einrichtungen ähnliche Wege zu gehen. Gemeinsam können wir zeigen, dass eine zukunftsfähige Landnutzung möglich ist – eine, die Arten schützt, Landschaften lebendig erhält und gleichzeitig gesunde Lebensmittel produziert.
In der Aufnahme
- Mit dem Erwerb ausgewählter Flächen bemühen wir uns um den Erhalt der Biodiversität, sowie kleinbäuerlicher Strukturen in der Kulurlandschaft.
Artenschutz in Franken®
Extreme Trockenheit in Bayerns Wäldern – Eine stille Krise im Forst

Extreme Trockenheit in Bayerns Wäldern – Eine stille Krise im Forst
17/18.07.2025
Die Folgen sind nicht nur für die Forstwirtschaft gravierend – auch Erholungssuchende und das gesamte Ökosystem spüren die Auswirkungen zunehmend.
17/18.07.2025
- In den letzten Jahren haben sich die Anzeichen einer besorgniserregenden Entwicklung in Bayerns Wäldern verdichtet: anhaltende Trockenperioden, zurückgehende Niederschläge und steigende Temperaturen setzen unseren heimischen Forsten massiv zu.
Die Folgen sind nicht nur für die Forstwirtschaft gravierend – auch Erholungssuchende und das gesamte Ökosystem spüren die Auswirkungen zunehmend.
Trockenheit als Dauerstress für den Wald
Bäume sind auf ausreichend Wasser angewiesen – für das Wachstum, die Photosynthese und ihre natürlichen Abwehrmechanismen. Doch immer häufiger bleiben im Frühjahr und Sommer die dringend benötigten Regenfälle aus. Der Boden trocknet aus, Wasserreserven schwinden, und viele Bäume geraten unter extremen Trockenstress.
Besonders betroffen:
Eine gefährliche Folge: Astbruch durch Trockenstress
Ein oft unterschätztes, aber zunehmendes Risiko in trockengestressten Wäldern ist das plötzliche Abbrechen von Ästen – auch bei scheinbar gesunden Bäumen.
Der Hintergrund:
Dieses Phänomen, auch als "Trockenbruch" bekannt, stellt eine ernsthafte Gefahr für Waldbesucher dar – insbesondere auf Wegen, Rastplätzen oder Parkplätzen unter alten Bäumen.
Die Buche – Gewinnerin bei konsequent naturnahem Waldumbau?
Die Rotbuche (Fagus sylvatica) gilt als eine der ökologisch wertvollsten Baumarten Mitteleuropas. Sie ist heimisch, schattenertragend, konkurrenzstark – und sie bildet bei günstigen Bedingungen von Natur aus dichte, stabile Laubwälder, die viele weitere Arten beherbergen. Lange Zeit galt sie als anfällig für Trockenheit, doch neuere Erkenntnisse zeigen ein differenzierteres Bild.
Ihr Potenzial in naturnahen Wäldern:
In rein wirtschaftlich geprägten Wäldern oder auf degradierten Böden zeigt die Buche tatsächlich Stresssymptome bei Trockenheit:
Doch in strukturreichen, naturnahen Beständen, mit standortgerechter Entwicklung und wenig Störung, zeigt sich die Buche erstaunlich anpassungsfähig:
Voraussetzung: Natur lassen, statt gestalten
Viele Probleme der Buche sind hausgemacht: flächige Kahlschläge, Monokulturen, extreme Durchforstung und wirtschaftliche Übernutzung schwächen die Resilienz der Bäume. Wenn man stattdessen natürliche Buchenwälder zulässt, mit:
kann die Buche langfristig zu den klimastabileren Baumarten in Bayern zählen.
Fazit zur Buche:
Die Rotbuche ist kein pauschales Opfer des Klimawandels, sondern eine Baumart mit großem Zukunftspotenzial – vorausgesetzt, man verlässt die alte forstwirtschaftliche Praxis und setzt auf naturnahe Waldentwicklung. In ihrer natürlichen Form kann sie Mikroklimata stabilisieren, Wasser im System halten und Biodiversität fördern. Damit wird sie nicht nur ökologisch wertvoll, sondern auch zu einem strategischen Baustein im klimaangepassten Waldbau der Zukunft.
In der Aufnahme
Bäume sind auf ausreichend Wasser angewiesen – für das Wachstum, die Photosynthese und ihre natürlichen Abwehrmechanismen. Doch immer häufiger bleiben im Frühjahr und Sommer die dringend benötigten Regenfälle aus. Der Boden trocknet aus, Wasserreserven schwinden, und viele Bäume geraten unter extremen Trockenstress.
Besonders betroffen:
- Flachwurzelnde Baumarten wie die Fichte,
- Alte und vorgeschädigte Bäume,
- Wälder auf sandigen oder steinigen Böden mit geringer Wasserspeicherkapazität.
Eine gefährliche Folge: Astbruch durch Trockenstress
Ein oft unterschätztes, aber zunehmendes Risiko in trockengestressten Wäldern ist das plötzliche Abbrechen von Ästen – auch bei scheinbar gesunden Bäumen.
Der Hintergrund:
- Durch Wassermangel verlieren Bäume an Elastizität und Stabilität.
- Trockenheit schwächt die Holzstruktur, besonders in älteren Kronenteilen.
- Risse, Trockenschäden und innere Faulstellen entstehen unbemerkt.
- Bei Wind oder nach kurzer Regenbelastung können Äste unvermittelt abbrechen.
Dieses Phänomen, auch als "Trockenbruch" bekannt, stellt eine ernsthafte Gefahr für Waldbesucher dar – insbesondere auf Wegen, Rastplätzen oder Parkplätzen unter alten Bäumen.
Die Buche – Gewinnerin bei konsequent naturnahem Waldumbau?
Die Rotbuche (Fagus sylvatica) gilt als eine der ökologisch wertvollsten Baumarten Mitteleuropas. Sie ist heimisch, schattenertragend, konkurrenzstark – und sie bildet bei günstigen Bedingungen von Natur aus dichte, stabile Laubwälder, die viele weitere Arten beherbergen. Lange Zeit galt sie als anfällig für Trockenheit, doch neuere Erkenntnisse zeigen ein differenzierteres Bild.
Ihr Potenzial in naturnahen Wäldern:
In rein wirtschaftlich geprägten Wäldern oder auf degradierten Böden zeigt die Buche tatsächlich Stresssymptome bei Trockenheit:
- vorzeitiger Laubfall,
- Totholz in der Krone,
- verminderter Zuwachs.
Doch in strukturreichen, naturnahen Beständen, mit standortgerechter Entwicklung und wenig Störung, zeigt sich die Buche erstaunlich anpassungsfähig:
- Ihr tief verzweigtes Feinwurzelsystem kann auch bei Trockenheit Wasser aus dem Oberboden nutzen – wenn der Boden nicht verdichtet oder versiegelt ist.
- Durch ihre Schattenverträglichkeit kann sie stabile Waldbilder mit geschlossenem Kronendach bilden, was wiederum den Boden kühlt und das Mikroklima verbessert.
- Reine Buchenwälder bieten hohen Wasserrückhalt, wenig Verdunstung und Schutz vor Hitzespitzen – eine Art Waldkühlschrank im Klimawandel.
Voraussetzung: Natur lassen, statt gestalten
Viele Probleme der Buche sind hausgemacht: flächige Kahlschläge, Monokulturen, extreme Durchforstung und wirtschaftliche Übernutzung schwächen die Resilienz der Bäume. Wenn man stattdessen natürliche Buchenwälder zulässt, mit:
- kontinuierlicher Waldentwicklung,
- natürlicher Verjüngung,
- Artenmischung (z. B. mit Tanne, Eiche oder Ahorn),
kann die Buche langfristig zu den klimastabileren Baumarten in Bayern zählen.
Fazit zur Buche:
Die Rotbuche ist kein pauschales Opfer des Klimawandels, sondern eine Baumart mit großem Zukunftspotenzial – vorausgesetzt, man verlässt die alte forstwirtschaftliche Praxis und setzt auf naturnahe Waldentwicklung. In ihrer natürlichen Form kann sie Mikroklimata stabilisieren, Wasser im System halten und Biodiversität fördern. Damit wird sie nicht nur ökologisch wertvoll, sondern auch zu einem strategischen Baustein im klimaangepassten Waldbau der Zukunft.
In der Aufnahme
- Buche im Trockenstress ...
Artenschutz in Franken®
Die faszinierende Welt der Perlmutterfalter ...

Die faszinierende Welt der Perlmutterfalter – Gattung Argynnis
16/17.07.2025
16/17.07.2025
- Die Gattung Argynnis gehört zu den farbenprächtigsten Vertretern der Tagfalter. Ihre Flügel zeigen metallisch glänzende Flecken, die an Perlen erinnern – daher der deutsche Name „Perlmutterfalter“.
Auf dieser Seite erfahren Sie alles Wissenswerte über diese bemerkenswerte Schmetterlingsgattung: ihre Merkmale, Lebensweise, Artenvielfalt, Verbreitung sowie ihre Rolle im Ökosystem und im Naturschutz.
Systematik und Einordnung
Die Gattung Argynnis ist Teil der Familie der Edelfalter und steht in enger Verwandtschaft zu den Gattungen Speyeria, Fabriciana und Brenthis. In Europa umfasst sie nur wenige Arten, doch ...
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
Systematik und Einordnung
- Ordnung: Lepidoptera (Schmetterlinge)
- Familie: Nymphalidae (Edelfalter)
- Unterfamilie: Heliconiinae
- Gattung: Argynnis Fabricius, 1807
Die Gattung Argynnis ist Teil der Familie der Edelfalter und steht in enger Verwandtschaft zu den Gattungen Speyeria, Fabriciana und Brenthis. In Europa umfasst sie nur wenige Arten, doch ...
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- ... Perlmutterfalter ... hier ist das Mosaik der Außenflügel gut zu sehen ... dieser Eindruck von Perlmutt ist namensgebend.
Artenschutz in Franken®
Der Schwalbenschwanz (Papilio machaon) ...

Der Schwalbenschwanz (Papilio machaon) – Ein König unter den Schmetterlingen
15/16.07.2025
Seine auffälligen Farben und die charakteristischen "Schwänzchen" an den Hinterflügeln machen ihn zu einem unvergesslichen Anblick – ein wahres Symbol für die Schönheit und Vielfalt der Natur.
15/16.07.2025
- Mit seiner eindrucksvollen Erscheinung und majestätischen Flugweise gehört der Schwalbenschwanz zu den prächtigsten Schmetterlingen Europas.
Seine auffälligen Farben und die charakteristischen "Schwänzchen" an den Hinterflügeln machen ihn zu einem unvergesslichen Anblick – ein wahres Symbol für die Schönheit und Vielfalt der Natur.
Aussehen: Farbenpracht mit Funktion
Der Schwalbenschwanz erreicht eine Flügelspannweite von bis zu 10 Zentimetern. Die Flügel sind leuchtend gelb mit tiefschwarzen Adern und Mustern durchzogen – ein auffälliger Kontrast, der nicht nur ästhetisch wirkt, sondern auch der Tarnung und Abschreckung dient. Besonders markant: die blau-rot gefärbten Augenflecken auf den Hinterflügeln sowie die namensgebenden Schwalbenschwänze – verlängerte Flügelzipfel, die potenzielle Fressfeinde irritieren sollen.
Lebensraum: Ein Wanderer mit Vorlieben
Papilio machaon ist in großen Teilen Europas, Nordafrikas und Asiens verbreitet. Sein bevorzugter Lebensraum sind sonnige, offene Flächen wie Magerrasen, Wiesen, Feldränder und naturnahe Gärten. Auch alpine Regionen bis etwa 2.000 Meter Höhe besiedelt er. Entscheidend für seine Anwesenheit ist das Vorkommen bestimmter Futterpflanzen – vor allem Doldenblütler wie Wilde Möhre, Fenchel oder Dill.
Entwicklung: Vom Ei zum Edelfalter
Nach der Paarung legt das Weibchen einzelne Eier auf die Blätter geeigneter Futterpflanzen. Aus ihnen schlüpfen die Raupen, die durch ihre auffällige grün-schwarze Färbung mit orangefarbenen Punkten nicht weniger spektakulär wirken als der Falter selbst. Zur Verteidigung können sie ein übelriechendes Horn (Osmaterium) ausstülpen. Die Verpuppung erfolgt gut getarnt in Bodennähe oder an Pflanzenteilen – daraus schlüpft je nach Jahreszeit nach wenigen Wochen oder erst im nächsten Frühjahr der fertige Falter.
Gefährdung und Schutz: Ein sensibler Botschafter
Trotz seiner weiten Verbreitung ist der Schwalbenschwanz heute vielerorts selten geworden. Intensivierte Landwirtschaft, Flächenversiegelung und der Verlust artenreicher Lebensräume setzen ihm zu. In Deutschland steht er unter besonderem Schutz – auch als Zeichen dafür, wie wichtig strukturreiche, blühende Landschaften für die Artenvielfalt sind. Viele Naturgärten tragen heute aktiv zum Erhalt des Schwalbenschwanzes bei, indem sie gezielt Futterpflanzen anbauen und auf chemische Mittel verzichten.
Fazit: Ein Botschafter für lebendige Landschaften
Der Schwalbenschwanz ist mehr als nur ein schöner Falter – er ist ein Sinnbild für gesunde Ökosysteme und naturnahe Kulturlandschaften. Seine Rückkehr in unsere Gärten und Wiesen zeigt: Mit wenig Aufwand kann jeder einen Beitrag zum Artenschutz leisten. Wer dem Schwalbenschwanz Nahrung, Raum und Ruhe bietet, wird belohnt – mit einem der eindrucksvollsten Naturschauspiele unserer heimischen Tierwelt.
In der Collage von Bernhard Schmalisch
Der Schwalbenschwanz erreicht eine Flügelspannweite von bis zu 10 Zentimetern. Die Flügel sind leuchtend gelb mit tiefschwarzen Adern und Mustern durchzogen – ein auffälliger Kontrast, der nicht nur ästhetisch wirkt, sondern auch der Tarnung und Abschreckung dient. Besonders markant: die blau-rot gefärbten Augenflecken auf den Hinterflügeln sowie die namensgebenden Schwalbenschwänze – verlängerte Flügelzipfel, die potenzielle Fressfeinde irritieren sollen.
Lebensraum: Ein Wanderer mit Vorlieben
Papilio machaon ist in großen Teilen Europas, Nordafrikas und Asiens verbreitet. Sein bevorzugter Lebensraum sind sonnige, offene Flächen wie Magerrasen, Wiesen, Feldränder und naturnahe Gärten. Auch alpine Regionen bis etwa 2.000 Meter Höhe besiedelt er. Entscheidend für seine Anwesenheit ist das Vorkommen bestimmter Futterpflanzen – vor allem Doldenblütler wie Wilde Möhre, Fenchel oder Dill.
Entwicklung: Vom Ei zum Edelfalter
Nach der Paarung legt das Weibchen einzelne Eier auf die Blätter geeigneter Futterpflanzen. Aus ihnen schlüpfen die Raupen, die durch ihre auffällige grün-schwarze Färbung mit orangefarbenen Punkten nicht weniger spektakulär wirken als der Falter selbst. Zur Verteidigung können sie ein übelriechendes Horn (Osmaterium) ausstülpen. Die Verpuppung erfolgt gut getarnt in Bodennähe oder an Pflanzenteilen – daraus schlüpft je nach Jahreszeit nach wenigen Wochen oder erst im nächsten Frühjahr der fertige Falter.
Gefährdung und Schutz: Ein sensibler Botschafter
Trotz seiner weiten Verbreitung ist der Schwalbenschwanz heute vielerorts selten geworden. Intensivierte Landwirtschaft, Flächenversiegelung und der Verlust artenreicher Lebensräume setzen ihm zu. In Deutschland steht er unter besonderem Schutz – auch als Zeichen dafür, wie wichtig strukturreiche, blühende Landschaften für die Artenvielfalt sind. Viele Naturgärten tragen heute aktiv zum Erhalt des Schwalbenschwanzes bei, indem sie gezielt Futterpflanzen anbauen und auf chemische Mittel verzichten.
Fazit: Ein Botschafter für lebendige Landschaften
Der Schwalbenschwanz ist mehr als nur ein schöner Falter – er ist ein Sinnbild für gesunde Ökosysteme und naturnahe Kulturlandschaften. Seine Rückkehr in unsere Gärten und Wiesen zeigt: Mit wenig Aufwand kann jeder einen Beitrag zum Artenschutz leisten. Wer dem Schwalbenschwanz Nahrung, Raum und Ruhe bietet, wird belohnt – mit einem der eindrucksvollsten Naturschauspiele unserer heimischen Tierwelt.
In der Collage von Bernhard Schmalisch
- Schwalbenschwanz
Artenschutz in Franken®
Totholz – Lebensraum voller Leben

Totholz – Lebensraum voller Leben: Warum abgestorbene Bäume für die Artenvielfalt unverzichtbar sind
14/15.07.2025
Es bietet Nahrung, Schutz, Brutplätze und Überwinterungsmöglichkeiten für unzählige Tier-, Pilz- und Pflanzenarten – darunter auch viele gefährdete und spezialisierte Arten. Zwei eindrucksvolle Beispiele für diese enge Abhängigkeit vom Totholz sind die Große Blaue Holzbiene (Xylocopa violacea) und die Augenfalter (Satyrinae).
14/15.07.2025
- Was auf den ersten Blick wie ein ungenutzter, toter Baumstamm wirkt, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als Hotspot der Artenvielfalt: Totholz gehört zu den ökologisch wertvollsten Strukturen in unseren Wäldern, Parks und Gärten.
Es bietet Nahrung, Schutz, Brutplätze und Überwinterungsmöglichkeiten für unzählige Tier-, Pilz- und Pflanzenarten – darunter auch viele gefährdete und spezialisierte Arten. Zwei eindrucksvolle Beispiele für diese enge Abhängigkeit vom Totholz sind die Große Blaue Holzbiene (Xylocopa violacea) und die Augenfalter (Satyrinae).
Die Große Blaue Holzbiene: Ein schillernder Baumeister im Totholz
Die Große Blaue Holzbiene, auch Blauschwarze oder Violettflügelige Holzbiene genannt, ist eine der größten heimischen Wildbienenarten. Mit ihrem metallisch-blauen Schimmer und tief brummenden Flug fällt sie besonders ins Auge. Ihr Lebensraumanspruch macht sie jedoch ökologisch sensibel: Für die Fortpflanzung ist sie zwingend auf Totholz angewiesen. Die Weibchen bohren ihre Nistgänge bevorzugt in trockenes, sonnenbeschienenes Totholz – oft in abgestorbene Obstbäume oder alte Holzbalken. Hier legen sie Brutkammern an, die sie mit selbstgesammeltem Blütenpollen und Nektar versorgen, bevor sie das Gelege mit einer Wand aus Pflanzenfasern verschließen.
Fehlt dieses spezielle Nistmaterial, findet die Holzbiene keinen geeigneten Ort zur Fortpflanzung. Die zunehmende Entfernung von Totholz aus Gärten, Parks und Wäldern gefährdet daher direkt das Überleben dieser faszinierenden Bestäuberin. Der Erhalt von Totholz ist somit ein direkter Beitrag zum Schutz dieser selten gewordenen Wildbiene.
Augenfalter: Schmetterlinge, die im Verborgenen leben
Auch wenn sie nicht direkt im Totholz nisten, sind zahlreiche Schmetterlingsarten wie die Augenfalter auf abgestorbenes Holz angewiesen. Diese zur Familie der Edelfalter zählenden Arten – darunter das Große Ochsenauge, der Waldbrettspiel-Falter oder der Schornsteinfeger – profitieren gleich mehrfach vom Mikroklima, das Totholz schafft.
In der Nähe von verrottendem Holz finden sich vermehrt feuchte, krautreiche Stellen, die wichtige Futterpflanzen für die Raupen bereitstellen. Gleichzeitig nutzen viele Falter ruhige, schattige Plätze im Bereich von Totholzhaufen zum Ruhen, Überwintern oder zur Eiablage. Einige Arten verstecken sich im Herbst sogar zwischen der Rinde oder in Spalten toter Bäume, um dort geschützt zu überwintern.
Ohne diese Rückzugsorte und mikroklimatisch stabilen Lebensräume verschwinden Augenfalter nach und nach aus der Landschaft – ein Verlust, der sich negativ auf das gesamte Ökosystem auswirkt, da Schmetterlinge wichtige Indikatoren für die Umweltqualität und wertvolle Bestäuber sind.
Totholz erhalten heißt Biodiversität bewahren
Insgesamt nutzen über 1.300 Tierarten in Mitteleuropa Totholz direkt – darunter Insekten, Vögel, Fledermäuse, Amphibien und Pilze. Auch zahlreiche gefährdete Arten sind auf dieses vermeintlich „nutzlose“ Material angewiesen. Dabei spielt nicht nur das klassische morsche Stammholz eine Rolle: Stehendes Totholz, liegende Äste, alte Baumstümpfe oder absterbende Bäume – sie alle tragen zum ökologischen Gesamtwert eines Lebensraumes bei.
Um die biologische Vielfalt langfristig zu sichern, braucht es daher einen bewussten Umgang mit abgestorbenem Holz. Ob im eigenen Garten, in öffentlichen Grünflächen oder in der Forstwirtschaft: Wer Totholz erhält oder gezielt integriert, leistet einen wichtigen Beitrag zum Artenschutz – und unterstützt zugleich faszinierende Tiere wie die Große Blaue Holzbiene und die Augenfalter.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
Die Große Blaue Holzbiene, auch Blauschwarze oder Violettflügelige Holzbiene genannt, ist eine der größten heimischen Wildbienenarten. Mit ihrem metallisch-blauen Schimmer und tief brummenden Flug fällt sie besonders ins Auge. Ihr Lebensraumanspruch macht sie jedoch ökologisch sensibel: Für die Fortpflanzung ist sie zwingend auf Totholz angewiesen. Die Weibchen bohren ihre Nistgänge bevorzugt in trockenes, sonnenbeschienenes Totholz – oft in abgestorbene Obstbäume oder alte Holzbalken. Hier legen sie Brutkammern an, die sie mit selbstgesammeltem Blütenpollen und Nektar versorgen, bevor sie das Gelege mit einer Wand aus Pflanzenfasern verschließen.
Fehlt dieses spezielle Nistmaterial, findet die Holzbiene keinen geeigneten Ort zur Fortpflanzung. Die zunehmende Entfernung von Totholz aus Gärten, Parks und Wäldern gefährdet daher direkt das Überleben dieser faszinierenden Bestäuberin. Der Erhalt von Totholz ist somit ein direkter Beitrag zum Schutz dieser selten gewordenen Wildbiene.
Augenfalter: Schmetterlinge, die im Verborgenen leben
Auch wenn sie nicht direkt im Totholz nisten, sind zahlreiche Schmetterlingsarten wie die Augenfalter auf abgestorbenes Holz angewiesen. Diese zur Familie der Edelfalter zählenden Arten – darunter das Große Ochsenauge, der Waldbrettspiel-Falter oder der Schornsteinfeger – profitieren gleich mehrfach vom Mikroklima, das Totholz schafft.
In der Nähe von verrottendem Holz finden sich vermehrt feuchte, krautreiche Stellen, die wichtige Futterpflanzen für die Raupen bereitstellen. Gleichzeitig nutzen viele Falter ruhige, schattige Plätze im Bereich von Totholzhaufen zum Ruhen, Überwintern oder zur Eiablage. Einige Arten verstecken sich im Herbst sogar zwischen der Rinde oder in Spalten toter Bäume, um dort geschützt zu überwintern.
Ohne diese Rückzugsorte und mikroklimatisch stabilen Lebensräume verschwinden Augenfalter nach und nach aus der Landschaft – ein Verlust, der sich negativ auf das gesamte Ökosystem auswirkt, da Schmetterlinge wichtige Indikatoren für die Umweltqualität und wertvolle Bestäuber sind.
Totholz erhalten heißt Biodiversität bewahren
Insgesamt nutzen über 1.300 Tierarten in Mitteleuropa Totholz direkt – darunter Insekten, Vögel, Fledermäuse, Amphibien und Pilze. Auch zahlreiche gefährdete Arten sind auf dieses vermeintlich „nutzlose“ Material angewiesen. Dabei spielt nicht nur das klassische morsche Stammholz eine Rolle: Stehendes Totholz, liegende Äste, alte Baumstümpfe oder absterbende Bäume – sie alle tragen zum ökologischen Gesamtwert eines Lebensraumes bei.
Um die biologische Vielfalt langfristig zu sichern, braucht es daher einen bewussten Umgang mit abgestorbenem Holz. Ob im eigenen Garten, in öffentlichen Grünflächen oder in der Forstwirtschaft: Wer Totholz erhält oder gezielt integriert, leistet einen wichtigen Beitrag zum Artenschutz – und unterstützt zugleich faszinierende Tiere wie die Große Blaue Holzbiene und die Augenfalter.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- ... Große Blaue Holzbiene vor liegen gebliebenem Totholz ... direkt vor der Höhlung die sie für ihren Nachwuchs ins Hartholz bohrte.
Artenschutz in Franken®
Aktueller Ordner:
Archiv
Parallele Themen:
2019-11
2019-10
2019-12
2020-01
2020-02
2020-03
2020-04
2020-05
2020-06
2020-07
2020-08
2020-09
2020-10
2020-11
2020-12
2021-01
2021-02
2021-03
2021-04
2021-05
2021-06
2021-07
2021-08
2021-09
2021-10
2021-11
2021-12
2022-01
2022-02
2022-03
2022-04
2022-05
2022-06
2022-07
2022-08
2022-09
2022-10
2022-11
2022-12
2023-01
2023-02
2023-03
2023-04
2023-05
2023-06
2023-07
2023-08
2023-09
2023-10
2023-11
2023-12
2024-01
2024-02
2024-03
2024-04
2024-05
2024-06
2024-07
2024-08
2024-09
2024-10
2024-11
2024-12
2025-01
2025-02
2025-03
2025-04
2025-05
2025-06
2025-07
2025-08
2025-09
















