Die Waldeidechse – ein kleines Wunder der Anpassung

Die Waldeidechse – ein kleines Wunder der Anpassung
13/14.09.2025
Der Tau glitzert noch auf den Gräsern, und ein leichter Nebel liegt über der Wiese. Plötzlich raschelt es im Gras: Eine kleine Eidechse kriecht hervor und bleibt bewegungslos auf einem Stein liegen.
Langsam richtet sie den Kopf, breitet ihren Körper aus und genießt die ersten wärmenden Sonnenstrahlen. Diese Szene wiederholt sich Tag für Tag, doch nur wer geduldig und aufmerksam ist, wird Zeuge davon. Die Waldeidechse ist keine laute oder auffällige Erscheinung – sie lebt still und verborgen, und doch erzählt sie viel über die Anpassungsfähigkeit der Natur.
13/14.09.2025
- Es ist ein kühler Sommermorgen in den Alpen.
Der Tau glitzert noch auf den Gräsern, und ein leichter Nebel liegt über der Wiese. Plötzlich raschelt es im Gras: Eine kleine Eidechse kriecht hervor und bleibt bewegungslos auf einem Stein liegen.
Langsam richtet sie den Kopf, breitet ihren Körper aus und genießt die ersten wärmenden Sonnenstrahlen. Diese Szene wiederholt sich Tag für Tag, doch nur wer geduldig und aufmerksam ist, wird Zeuge davon. Die Waldeidechse ist keine laute oder auffällige Erscheinung – sie lebt still und verborgen, und doch erzählt sie viel über die Anpassungsfähigkeit der Natur.
Artbeschreibung
Die Waldeidechse (Lacerta vivipara, heute meist Zootoca vivipara) gehört zur Familie der Echten Eidechsen (Lacertidae). Sie ist eine der am weitesten verbreiteten Reptilienarten Europas und reicht von Frankreich über Skandinavien bis weit nach Asien hinein.
Besonderheit: Die Waldeidechse ist eines der wenigen Reptilien Europas, das lebendgebärend ist – die Eier entwickeln sich im Körper der Mutter, und sie bringt vollständig entwickelte Jungtiere zur Welt.
In der Aufnahme von Johannes Rother
Die Waldeidechse (Lacerta vivipara, heute meist Zootoca vivipara) gehört zur Familie der Echten Eidechsen (Lacertidae). Sie ist eine der am weitesten verbreiteten Reptilienarten Europas und reicht von Frankreich über Skandinavien bis weit nach Asien hinein.
- Körpergröße: Bis 18 cm, wovon etwa die Hälfte auf den Schwanz entfällt.
- Färbung: Braun, grau oder olivgrün; oft mit dunklen Punkten oder Streifen. Manche Männchen zeigen zur Paarungszeit rötliche Färbungen an Kehle oder Bauch.
- Geschlechtsunterschiede: Weibchen sind meist etwas größer und besitzen oft einen hellen Rückenstreifen.
Besonderheit: Die Waldeidechse ist eines der wenigen Reptilien Europas, das lebendgebärend ist – die Eier entwickeln sich im Körper der Mutter, und sie bringt vollständig entwickelte Jungtiere zur Welt.
In der Aufnahme von Johannes Rother
- Waldeidechse ( Lacerta vivipara )
Artenschutz in Franken®
Saurier-Überreste im Steigerwald entdeckt: CT-Scans enthüllen zehn ...

Saurier-Überreste im Steigerwald entdeckt: CT-Scans enthüllen zehn im Gestein eingeschlossene Schädel
12/13.09.2025
Eine Sensation verbargen riesige Sandsteinbrocken aus dem Steigerwald – beim Durchleuchten mit einem speziellen 3D-Computertomographen wurden darin zehn versteinerte, 230 Millionen Jahre alte Saurierschädel entdeckt.
Dies erklärte Roland Eichhorn, Leiter des Geologischen Dienstes am Bayerischen Landesamt für Umwelt nach Abschluss der Röntgenanalyse am Fraunhofer-Institut in Fürth: „Vor vier Jahren haben wir in einem Sandsteinbruch bei Rauhenebrach den versteinerten, mit Zähnen bestückten Unterkiefer eines Riesenlurchs geborgen. Bei der Nachsuche wurden weitere Sandsteinbrocken entdeckt, in denen wir auch Schädelfragmente vermuteten. Dies hat sich nun dank modernster Röntgentechnik bewahrheitet.“
12/13.09.2025
- Massensterben krokodilähnlicher Riesenlurche vor 230 Millionen Jahren gibt Rätsel auf: Fund mit zwei verschiedenen Lauerjägern ist einmalig in Europa
Eine Sensation verbargen riesige Sandsteinbrocken aus dem Steigerwald – beim Durchleuchten mit einem speziellen 3D-Computertomographen wurden darin zehn versteinerte, 230 Millionen Jahre alte Saurierschädel entdeckt.
Dies erklärte Roland Eichhorn, Leiter des Geologischen Dienstes am Bayerischen Landesamt für Umwelt nach Abschluss der Röntgenanalyse am Fraunhofer-Institut in Fürth: „Vor vier Jahren haben wir in einem Sandsteinbruch bei Rauhenebrach den versteinerten, mit Zähnen bestückten Unterkiefer eines Riesenlurchs geborgen. Bei der Nachsuche wurden weitere Sandsteinbrocken entdeckt, in denen wir auch Schädelfragmente vermuteten. Dies hat sich nun dank modernster Röntgentechnik bewahrheitet.“
Gleich zehn krokodilähnliche Schädel sind in den Sandsteinbrocken verborgen, die von zwei verschiedenen Saurierarten stammen: Cycloto- und Metoposaurier. Diese ähneln Krokodilen, sind aber fleischfressende Riesenlurche. Ihr Kiefer ist mehr als einen halben Meter lang und mit einer Reihe von spitzen Zähnen bestückt. Die Schädel wurden offenbar durch starke Regengüsse aus einem schlammigen Tümpel in den heutigen Fundort eines sandigen Flussbetts geschwemmt.
Die Todesumstände bleiben Eichhorn zufolge allerdings rätselhaft: In der Triaszeit lauerten offenbar mindestens zwei Arten von Riesenlurchen in Tümpeln auf Beute, ähnlich wie heute Alligatoren und Krokodile etwa in den Everglades in Florida. Möglicherweise haben sie sich bei einer Trockenzeit in einem Tümpel konzentriert. Als dieser dann aufgrund einer Dürrephase ganz austrocknete, könnten alle gemeinsam verendet sein. Der Überraschungsfund stellt ein weiteres Puzzleteil dar, um einen Blick zurück in die prähistorische Fauna im Steigerwald zu ermöglichen.
Weitere Informationen:
https://www.lfu.bayern.de/geologie/zentrales_geoarchiv/schaetze/cyclotosaurus/index.htm
In der Aufnahme von Quelle: LfU
Quelle
Bayerisches Landesamt für Umwelt
Pressestelle
Bürgermeister-Ulrich-Straße 160
86179 Augsburg
Stand
26.08.2025
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung. Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Die Todesumstände bleiben Eichhorn zufolge allerdings rätselhaft: In der Triaszeit lauerten offenbar mindestens zwei Arten von Riesenlurchen in Tümpeln auf Beute, ähnlich wie heute Alligatoren und Krokodile etwa in den Everglades in Florida. Möglicherweise haben sie sich bei einer Trockenzeit in einem Tümpel konzentriert. Als dieser dann aufgrund einer Dürrephase ganz austrocknete, könnten alle gemeinsam verendet sein. Der Überraschungsfund stellt ein weiteres Puzzleteil dar, um einen Blick zurück in die prähistorische Fauna im Steigerwald zu ermöglichen.
Weitere Informationen:
https://www.lfu.bayern.de/geologie/zentrales_geoarchiv/schaetze/cyclotosaurus/index.htm
In der Aufnahme von Quelle: LfU
- Regional-Geologe Dr. Sebastian Specht vom Landesamt für Umwelt zeigt auf den Schädel eines Riesenlurches, der im Sandsteinbrocken erkennbar ist
Quelle
Bayerisches Landesamt für Umwelt
Pressestelle
Bürgermeister-Ulrich-Straße 160
86179 Augsburg
Stand
26.08.2025
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung. Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Artenschutz in Franken®
Die Spalten-Wollbiene – ein verborgenes Leben zwischen Stein und Blüte

Die Spalten-Wollbiene – ein verborgenes Leben zwischen Stein und Blüte
11/12.09.2025
Zwischen den Steinen summt es leise – nicht die allgegenwärtige Honigbiene, sondern eine kleine, auffällig gezeichnete Wildbiene huscht geschäftig von Blüte zu Blüte. Sie verschwindet kurz darauf in einer schmalen Felsspalte, in der sie ihr Nest anlegt. Es handelt sich um die Spalten-Wollbiene (Anthidium oblongatum), eine wenig bekannte, aber faszinierende Vertreterin unserer heimischen Wildbienenwelt.
11/12.09.2025
- An einem warmen Sommertag wandert ein Spaziergänger durch ein altes Trockenmauerwerk.
Zwischen den Steinen summt es leise – nicht die allgegenwärtige Honigbiene, sondern eine kleine, auffällig gezeichnete Wildbiene huscht geschäftig von Blüte zu Blüte. Sie verschwindet kurz darauf in einer schmalen Felsspalte, in der sie ihr Nest anlegt. Es handelt sich um die Spalten-Wollbiene (Anthidium oblongatum), eine wenig bekannte, aber faszinierende Vertreterin unserer heimischen Wildbienenwelt.
Artbeschreibung
Die Spalten-Wollbiene gehört zur Familie der Megachilidae, also den Mauer- und Scherenbienenverwandten. Sie fällt durch ihren gedrungenen, etwa 8–12 mm langen Körper auf. Das Grundkleid ist dunkelbraun bis schwarz, dazu treten auffällige gelbe Bänder auf den Tergiten (Rückensegmenten des Hinterleibs). Diese Zeichnung kann an Wespen erinnern, dient aber rein der optischen Abschreckung und hat nichts mit Wehrhaftigkeit zu tun.
Charakteristisch für Wollbienen ist ihr Verhalten beim Nestbau: Die Weibchen sammeln Pflanzenhaare („Wolle“) von filzigen Blättern, zum Beispiel von Königskerzen, Ziesten oder Wollziest. Mit dem Kiefer reißen sie kleine Büschel heraus und formen daraus wattige Kügelchen, die sie in die Bruthöhle tragen. Bei Anthidium oblongatum liegen diese Nester bevorzugt in schmalen Ritzen von Felsen, Mauern oder Betonspalten – daher der deutsche Name „Felsspalten-Wollbiene“.
Die Brutzellen werden mit Pollen und Nektar aus verschiedenen Blüten versorgt. Besonders häufig besucht die Art Lippenblütler wie Ziest, Salbei oder Dost, doch auch Korbblütler und andere Sommerblumen werden genutzt. Nach der Eiablage verschließt das Weibchen die Zelle mit einer Schicht aus Pflanzenwolle. Die Larve entwickelt sich in dieser schützenden Kammer, verpuppt sich und überwintert schließlich als Ruhelarve. Die neue Generation schlüpft dann im nächsten Sommer.
Männchen lassen sich durch ihre kräftigen Dornen am Hinterleibsende erkennen. Sie sind sehr territorial und bewachen energisch blütenreiche Bereiche, um Weibchen anzulocken und Konkurrenten zu vertreiben. Dabei kommt es zu rasanten Luftkämpfen zwischen den Männchen.
Gefährdung und Ausblick in die Zukunft
Die Spalten-Wollbiene gilt in Mitteleuropa vielerorts als selten. Hauptursachen sind der Verlust geeigneter Nistplätze und das Verschwinden ihrer bevorzugten Pollenpflanzen. Moderne Bauweisen mit glatten Fassaden und versiegelte Flächen bieten kaum noch Ritzen und Spalten. Auch die intensive Landwirtschaft und der Einsatz von Pestiziden verringern das Nahrungsangebot.
Der Klimawandel wirkt ambivalent: Wärmere Sommer könnten zunächst eine Ausbreitung in nördlichere Regionen begünstigen. Gleichzeitig führen zunehmende Trockenheit, Hitzestress und Verschiebungen der Blühzeiten zu Unsicherheiten in der Versorgung mit Pollen und Nektar. Wenn Pflanzen und Bienen zeitlich nicht mehr „aufeinander abgestimmt“ sind, kann das die Fortpflanzung erheblich beeinträchtigen.
Für die Zukunft wird entscheidend sein, ob wir Lebensräume für spezialisierte Arten wie die Spalten-Wollbiene sichern können. Strukturelemente wie Trockenmauern, naturbelassene Gärten mit filzhaarigen Stauden und das Zulassen kleiner Ritzen an Gebäuden können viel bewirken. In Kombination mit einer vielfältigen Blütenlandschaft können solche Maßnahmen die Chancen erhöhen, dass Anthidium oblongatum auch in kommenden Jahrzehnten zwischen Steinen und Blüten summt.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
Die Spalten-Wollbiene gehört zur Familie der Megachilidae, also den Mauer- und Scherenbienenverwandten. Sie fällt durch ihren gedrungenen, etwa 8–12 mm langen Körper auf. Das Grundkleid ist dunkelbraun bis schwarz, dazu treten auffällige gelbe Bänder auf den Tergiten (Rückensegmenten des Hinterleibs). Diese Zeichnung kann an Wespen erinnern, dient aber rein der optischen Abschreckung und hat nichts mit Wehrhaftigkeit zu tun.
Charakteristisch für Wollbienen ist ihr Verhalten beim Nestbau: Die Weibchen sammeln Pflanzenhaare („Wolle“) von filzigen Blättern, zum Beispiel von Königskerzen, Ziesten oder Wollziest. Mit dem Kiefer reißen sie kleine Büschel heraus und formen daraus wattige Kügelchen, die sie in die Bruthöhle tragen. Bei Anthidium oblongatum liegen diese Nester bevorzugt in schmalen Ritzen von Felsen, Mauern oder Betonspalten – daher der deutsche Name „Felsspalten-Wollbiene“.
Die Brutzellen werden mit Pollen und Nektar aus verschiedenen Blüten versorgt. Besonders häufig besucht die Art Lippenblütler wie Ziest, Salbei oder Dost, doch auch Korbblütler und andere Sommerblumen werden genutzt. Nach der Eiablage verschließt das Weibchen die Zelle mit einer Schicht aus Pflanzenwolle. Die Larve entwickelt sich in dieser schützenden Kammer, verpuppt sich und überwintert schließlich als Ruhelarve. Die neue Generation schlüpft dann im nächsten Sommer.
Männchen lassen sich durch ihre kräftigen Dornen am Hinterleibsende erkennen. Sie sind sehr territorial und bewachen energisch blütenreiche Bereiche, um Weibchen anzulocken und Konkurrenten zu vertreiben. Dabei kommt es zu rasanten Luftkämpfen zwischen den Männchen.
Gefährdung und Ausblick in die Zukunft
Die Spalten-Wollbiene gilt in Mitteleuropa vielerorts als selten. Hauptursachen sind der Verlust geeigneter Nistplätze und das Verschwinden ihrer bevorzugten Pollenpflanzen. Moderne Bauweisen mit glatten Fassaden und versiegelte Flächen bieten kaum noch Ritzen und Spalten. Auch die intensive Landwirtschaft und der Einsatz von Pestiziden verringern das Nahrungsangebot.
Der Klimawandel wirkt ambivalent: Wärmere Sommer könnten zunächst eine Ausbreitung in nördlichere Regionen begünstigen. Gleichzeitig führen zunehmende Trockenheit, Hitzestress und Verschiebungen der Blühzeiten zu Unsicherheiten in der Versorgung mit Pollen und Nektar. Wenn Pflanzen und Bienen zeitlich nicht mehr „aufeinander abgestimmt“ sind, kann das die Fortpflanzung erheblich beeinträchtigen.
Für die Zukunft wird entscheidend sein, ob wir Lebensräume für spezialisierte Arten wie die Spalten-Wollbiene sichern können. Strukturelemente wie Trockenmauern, naturbelassene Gärten mit filzhaarigen Stauden und das Zulassen kleiner Ritzen an Gebäuden können viel bewirken. In Kombination mit einer vielfältigen Blütenlandschaft können solche Maßnahmen die Chancen erhöhen, dass Anthidium oblongatum auch in kommenden Jahrzehnten zwischen Steinen und Blüten summt.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- Spalten-Wollbiene
Artenschutz in Franken®
Das Europäische Mufflon (Ovis gmelini musimon)

Das Europäische Mufflon – Wildschaf mit wechselvoller Geschichte
10/11.09.2025
Der Nebel hängt noch schwer zwischen den Kiefern, als eine kleine Herde dunkler Silhouetten lautlos den Hang hinaufzieht. Vorne schreitet ein kräftiger Widder, sein imposantes, gedrehtes Hornpaar fängt das erste Sonnenlicht ein.
Wer dieses Schauspiel erlebt, wähnt sich fast in einer wilden Bergwelt – und doch handelt es sich nicht um ein Relikt der Urzeit, sondern um das Mufflon, ein Tier, das von Menschenhand nach Mitteleuropa gebracht wurde und seitdem hier seinen Platz sucht.
10/11.09.2025
- Es ist ein kühler Morgen im Mittelgebirge.
Der Nebel hängt noch schwer zwischen den Kiefern, als eine kleine Herde dunkler Silhouetten lautlos den Hang hinaufzieht. Vorne schreitet ein kräftiger Widder, sein imposantes, gedrehtes Hornpaar fängt das erste Sonnenlicht ein.
Wer dieses Schauspiel erlebt, wähnt sich fast in einer wilden Bergwelt – und doch handelt es sich nicht um ein Relikt der Urzeit, sondern um das Mufflon, ein Tier, das von Menschenhand nach Mitteleuropa gebracht wurde und seitdem hier seinen Platz sucht.
Artbeschreibung
Das Europäische Mufflon (Ovis gmelini musimon) gilt als Stammform des Hausschafs und gehört zur Familie der Hornträger (Bovidae). Ursprünglich stammt es von den Mittelmeerinseln Korsika und Sardinien, wo es seit Jahrtausenden lebt. In Mitteleuropa wurde es im 18. und 19. Jahrhundert in Jagdgattern und später in freier Wildbahn angesiedelt.
Merkmale:
Lebensweise:
Mufflons sind tagaktive Herdentiere. Schafe und Lämmer leben in Muttergruppen, während die Widder eigene Verbände bilden und sich zur Paarungszeit, der sogenannten Brunft im Herbst, den Schafgruppen anschließen. Als Wiederkäuer ernähren sie sich von Gräsern, Kräutern, jungen Trieben und Baumrinde.
Das Mufflon in Deutschland – Perspektiven und Herausforderungen
Heute lebt das Mufflon in Deutschland vor allem in Mittelgebirgen wie der Eifel, im Harz, im Thüringer Wald oder in Teilen Bayerns. Doch seine Zukunft ist nicht selbstverständlich – es gibt Chancen, aber auch Probleme:
Positive Aspekte:
Herausforderungen:
Perspektiven:
Langfristig wird sich zeigen, ob das Mufflon in Deutschland eine stabile Nische findet oder ob es durch Prädation und jagdliche Regulierung weiter zurückgeht. In einigen Regionen könnte es als Symboltier für naturnahe, offene Waldlandschaften bewahrt werden, wenn Schutz- und Pflegekonzepte greifen. Gleichzeitig bleibt die Debatte bestehen, ob es als Neozoon (eingebürgerte Art) aktiv gefördert oder eher geduldet werden soll.
Fazit
Das Europäische Mufflon ist ein Tier mit doppelter Geschichte: einerseits Relikt aus der Frühzeit der Schafdomestikation, andererseits kulturgeprägter Neubürger in Mitteleuropa. Für Deutschland ist es weder reines Wildtier noch reine Zuchtform – sondern ein Grenzgänger, der unsere Kulturlandschaften bereichert, aber auch Fragen nach seiner Zukunft aufwirft.
In der Aufnahme von Johannes Rother
Das Europäische Mufflon (Ovis gmelini musimon) gilt als Stammform des Hausschafs und gehört zur Familie der Hornträger (Bovidae). Ursprünglich stammt es von den Mittelmeerinseln Korsika und Sardinien, wo es seit Jahrtausenden lebt. In Mitteleuropa wurde es im 18. und 19. Jahrhundert in Jagdgattern und später in freier Wildbahn angesiedelt.
Merkmale:
- Schulterhöhe: ca. 65–75 cm
- Gewicht: 25–50 kg, Widder deutlich schwerer als Schafe
- Fell: im Sommer rötlichbraun, im Winter dunkler; Widder mit typischem „Sattel“ aus heller Behaarung
- Hörner: Widder tragen imposante, schneckenförmig gedrehte Hörner, die bis zu 80 cm lang werden können; weibliche Tiere sind meist hornlos oder tragen nur kleine Hörnchen
Lebensweise:
Mufflons sind tagaktive Herdentiere. Schafe und Lämmer leben in Muttergruppen, während die Widder eigene Verbände bilden und sich zur Paarungszeit, der sogenannten Brunft im Herbst, den Schafgruppen anschließen. Als Wiederkäuer ernähren sie sich von Gräsern, Kräutern, jungen Trieben und Baumrinde.
Das Mufflon in Deutschland – Perspektiven und Herausforderungen
Heute lebt das Mufflon in Deutschland vor allem in Mittelgebirgen wie der Eifel, im Harz, im Thüringer Wald oder in Teilen Bayerns. Doch seine Zukunft ist nicht selbstverständlich – es gibt Chancen, aber auch Probleme:
Positive Aspekte:
- Das Mufflon gilt als Bereicherung der heimischen Wildfauna und ist bei Naturfreunden und Jägern gleichermaßen beliebt.
- Seine Anpassungsfähigkeit ermöglicht es ihm, in verschiedenen Landschaften zu überleben, von offenen Wäldern bis zu felsigen Hängen.
Herausforderungen:
- Als nicht ursprünglich heimische Art wird es teilweise kritisch gesehen, da es mit anderen Wildtieren wie Reh- oder Rotwild in Nahrungskonkurrenz stehen kann.
- Mufflons sind empfindlich gegenüber strengen Wintern, da sie keinen so dichten Winterpelz wie echte Alpenbewohner entwickeln.
- Der Wolf als Rückkehrer stellt eine neue Herausforderung dar: Mufflons haben in vielen Regionen kaum wirksame Fluchtstrategien gegen große Beutegreifer, was ihre Bestände lokal stark dezimieren kann.
Perspektiven:
Langfristig wird sich zeigen, ob das Mufflon in Deutschland eine stabile Nische findet oder ob es durch Prädation und jagdliche Regulierung weiter zurückgeht. In einigen Regionen könnte es als Symboltier für naturnahe, offene Waldlandschaften bewahrt werden, wenn Schutz- und Pflegekonzepte greifen. Gleichzeitig bleibt die Debatte bestehen, ob es als Neozoon (eingebürgerte Art) aktiv gefördert oder eher geduldet werden soll.
Fazit
Das Europäische Mufflon ist ein Tier mit doppelter Geschichte: einerseits Relikt aus der Frühzeit der Schafdomestikation, andererseits kulturgeprägter Neubürger in Mitteleuropa. Für Deutschland ist es weder reines Wildtier noch reine Zuchtform – sondern ein Grenzgänger, der unsere Kulturlandschaften bereichert, aber auch Fragen nach seiner Zukunft aufwirft.
In der Aufnahme von Johannes Rother
- Europäisches Mufflon (Ovis gmelini musimon) ... hier ein Widdder.
Artenschutz in Franken®
Ökologische Kollateralschäden: Mulchen als Symptom industrieller Bewirtschaftung

Ökologische Kollateralschäden: Mulchen als Symptom industrieller Bewirtschaftung
09/10.09.2025
Im Vordergrund steht die Optimierung von Produktionsketten, während die Funktion von Landschaften als Biodiversitätsreservoir, Trittsteinbiotop oder ökologische Pufferzone in den Hintergrund tritt.
Ein besonders augenfälliges Beispiel für diese Entwicklung ist das Mulchen von Wegeseitenstreifen, Waldrändern und Flurwegen. Was in der Verwaltungssprache als „Pflegeeingriff“ deklariert wird, bedeutet in der ökologischen Realität eine großflächige Habitatzerstörung.
09/10.09.2025
- Die Parallelen zwischen industrieller Landwirtschaft und forstlicher Intensivwirtschaft sind in vielen Punkten deutlich: Beide Systeme folgen einer ökonomisierten Flächenlogik, die sich durch Rationalisierung, Mechanisierung und Homogenisierung auszeichnet.
Im Vordergrund steht die Optimierung von Produktionsketten, während die Funktion von Landschaften als Biodiversitätsreservoir, Trittsteinbiotop oder ökologische Pufferzone in den Hintergrund tritt.
Ein besonders augenfälliges Beispiel für diese Entwicklung ist das Mulchen von Wegeseitenstreifen, Waldrändern und Flurwegen. Was in der Verwaltungssprache als „Pflegeeingriff“ deklariert wird, bedeutet in der ökologischen Realität eine großflächige Habitatzerstörung.
Ökologische Folgen des Mulchens
Eliminierung der Sukzession
Wegeseitenstreifen sind natürliche Entwicklungsräume, in denen sich über die Jahre artenreiche Pflanzengesellschaften etablieren können – von Pionierarten bis hin zu Halbsträuchern. Durch regelmäßiges Mulchen wird diese Sukzession unterbunden, und die Vegetation verbleibt dauerhaft in einem gestörten, artenarmen Frühstadium.
Verlust von Saumbiotopen
Übergangszonen zwischen Wald, Acker oder Wiese und Wegen sind klassische Saumbiotope. Sie gelten als Hotspots der Biodiversität, da sie Strukturen wie Altgrasbestände, Krautsäume und Blühpflanzen bieten. Das Mulchen vernichtet diese Zonen und reduziert damit die Habitatheterogenität der Landschaft.
Auslöschung trophischer Netzwerke
Mit den Pflanzen verschwinden auch die Bestäuberinsekten (Wildbienen, Schmetterlinge, Schwebfliegen), die auf die Blühpflanzen angewiesen sind. Ihre Abnahme zieht eine Kaskade nach sich: weniger Nahrung für Vögel, Reptilien und Kleinsäuger, was letztlich zu einem Zusammenbruch lokaler trophischer Netzwerke führt.
Biomasse- und Nährstoffverluste
Durch das permanente Zerkleinern und Zersetzen der Biomasse entsteht eine gleichförmige, humusarme Schicht. Nährstoffdynamiken werden gestört, Böden verarmen und die Ansiedlung spezialisierter Pflanzenarten wird verhindert.
Fragmentierung ökologischer Korridore
Wegeseitenstreifen fungieren als Biotopverbundachsen. Werden sie regelmäßig zerstört, bricht die Konnektivität zwischen einzelnen Populationen zusammen. Seltene Arten verlieren damit ihre Möglichkeit zum genetischen Austausch.
Parallelen zur intensiven Landwirtschaft und Forstwirtschaft
Das Mulchen zeigt exemplarisch, wie ähnlich sich landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Intensivstrategien sind:
Perspektiven für die Zukunft
Um die negativen Effekte abzumildern, braucht es ein ökologisches Pflegekonzept, das Wegeseitenstreifen und Waldränder nicht als „Restflächen“, sondern als wertvolle Strukturen im Biotopverbundsystem anerkennt. Mögliche Ansätze:
In der Aufnahme
Eliminierung der Sukzession
Wegeseitenstreifen sind natürliche Entwicklungsräume, in denen sich über die Jahre artenreiche Pflanzengesellschaften etablieren können – von Pionierarten bis hin zu Halbsträuchern. Durch regelmäßiges Mulchen wird diese Sukzession unterbunden, und die Vegetation verbleibt dauerhaft in einem gestörten, artenarmen Frühstadium.
Verlust von Saumbiotopen
Übergangszonen zwischen Wald, Acker oder Wiese und Wegen sind klassische Saumbiotope. Sie gelten als Hotspots der Biodiversität, da sie Strukturen wie Altgrasbestände, Krautsäume und Blühpflanzen bieten. Das Mulchen vernichtet diese Zonen und reduziert damit die Habitatheterogenität der Landschaft.
Auslöschung trophischer Netzwerke
Mit den Pflanzen verschwinden auch die Bestäuberinsekten (Wildbienen, Schmetterlinge, Schwebfliegen), die auf die Blühpflanzen angewiesen sind. Ihre Abnahme zieht eine Kaskade nach sich: weniger Nahrung für Vögel, Reptilien und Kleinsäuger, was letztlich zu einem Zusammenbruch lokaler trophischer Netzwerke führt.
Biomasse- und Nährstoffverluste
Durch das permanente Zerkleinern und Zersetzen der Biomasse entsteht eine gleichförmige, humusarme Schicht. Nährstoffdynamiken werden gestört, Böden verarmen und die Ansiedlung spezialisierter Pflanzenarten wird verhindert.
Fragmentierung ökologischer Korridore
Wegeseitenstreifen fungieren als Biotopverbundachsen. Werden sie regelmäßig zerstört, bricht die Konnektivität zwischen einzelnen Populationen zusammen. Seltene Arten verlieren damit ihre Möglichkeit zum genetischen Austausch.
Parallelen zur intensiven Landwirtschaft und Forstwirtschaft
Das Mulchen zeigt exemplarisch, wie ähnlich sich landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Intensivstrategien sind:
- Landwirtschaft: Monokulturen, Pestizideinsatz, Überdüngung und mechanische Pflege reduzieren die Agrobiodiversität.
- Forstwirtschaft: Fichten- oder Kiefernmonokulturen, Kahlschlagflächen und begradigte Waldwege schaffen ein analoges Bild der Vereinheitlichung.
- Gemeinsamer Nenner: Die Landschaft wird auf Produktionsräume reduziert, und die ökologischen Funktionen treten in den Hintergrund.
Perspektiven für die Zukunft
Um die negativen Effekte abzumildern, braucht es ein ökologisches Pflegekonzept, das Wegeseitenstreifen und Waldränder nicht als „Restflächen“, sondern als wertvolle Strukturen im Biotopverbundsystem anerkennt. Mögliche Ansätze:
- Pflegeintervalle strecken: seltener mulchen, um Blühzyklen und Habitatbildung zu ermöglichen.
- Sicherheitsorientierte Pflege differenzieren: Nur dort mulchen, wo die Verkehrssicherheit es erfordert.
- Förderung von Saumgesellschaften: gezielte Ansaat von regionaltypischen Wildpflanzen, die Insekten fördern.
- Monitoring: systematische Erfassung der Artenvielfalt vor und nach Pflegemaßnahmen, um ökologische Wirkungen messbar zu machen.
- Langfristig muss ein Umdenken stattfinden: Wegeseitenstreifen sind keine „Pflegelasten“, sondern Schlüsselstrukturen im ökologischen Gefüge der Kulturlandschaft.
In der Aufnahme
- „Ordnung nach menschlichem Maß – Chaos im Ökosystem.“
Artenschutz in Franken®
Der Alpenskorpion – ein verborgenes Juwel der Alpenfauna

Der Alpenskorpion – ein verborgenes Juwel der Alpenfauna
08/09.09.2025
Im Gegensatz zu seinen tropischen Verwandten erreicht er nur eine Körperlänge von etwa 3–5 Zentimetern. Trotz seiner geringen Größe übt er auf viele Menschen eine besondere Faszination aus, da er zu den wenigen Skorpionarten Europas gehört und erfolgreich an ein Leben in gemäßigten Klimazonen angepasst ist.
08/09.09.2025
- Der Alpenskorpion, wissenschaftlich unter den Namen Euscorpius germanicus, Euscorpius germanus oder Euscorpius gamma geführt, ist ein kleiner, unscheinbarer Vertreter der Skorpione, der in Mitteleuropa – und insbesondere in den Alpen – vorkommt.
Im Gegensatz zu seinen tropischen Verwandten erreicht er nur eine Körperlänge von etwa 3–5 Zentimetern. Trotz seiner geringen Größe übt er auf viele Menschen eine besondere Faszination aus, da er zu den wenigen Skorpionarten Europas gehört und erfolgreich an ein Leben in gemäßigten Klimazonen angepasst ist.
Lebensraum und Lebensweise
Der Alpenskorpion bevorzugt feuchte, strukturreiche Lebensräume: Wälder, Waldränder, felsige Hänge und alte Trockenmauern bieten ihm Verstecke vor Fressfeinden und extreme Wetterbedingungen. Tagsüber hält er sich meist unter Steinen, in Felsspalten oder unter Rinde auf. Erst in der Dämmerung oder Nacht geht er auf Nahrungssuche.
Seine Beute besteht vor allem aus kleinen Insekten, Spinnen und anderen Wirbellosen, die er mit seinen Scheren packt und mithilfe eines schwachen Giftes überwältigt. Für den Menschen ist sein Stich ungefährlich – vergleichbar mit einem Bienenstich – und dient in erster Linie der Jagd auf Beutetiere.
Herausforderungen und Gefährdungen
Obwohl der Alpenskorpion eine erstaunliche Anpassungsfähigkeit zeigt, steht er in der heutigen Zeit vor verschiedenen Gefahren:
Lebensraumverlust: Der Ausbau von Siedlungsflächen, intensive Forstwirtschaft und die Zerstörung traditioneller Trockenmauern nehmen ihm Rückzugsorte.
Klimawandel: Steigende Temperaturen und veränderte Niederschlagsmuster können seinen empfindlichen Lebensraum langfristig verändern. Extreme Trockenheit oder starke Winterfröste ohne schützende Schneedecke setzen ihm zu.
Fragmentierung der Bestände: Kleine, isolierte Populationen sind besonders anfällig für das Aussterben, da der genetische Austausch erschwert wird.
Bedeutung im Ökosystem
Der Alpenskorpion spielt eine wichtige Rolle als Räuber kleinerer Insekten und Gliederfüßer. Er hilft, deren Populationen in Balance zu halten, und ist selbst eine Nahrungsquelle für größere Tiere wie Vögel oder kleine Säuger. Damit trägt er zu einem stabilen ökologischen Gleichgewicht in den Alpenregionen bei.
Blick in die Zukunft
Die Zukunft des Alpenskorpions hängt stark vom Umgang des Menschen mit seiner Umwelt ab. Schutzmaßnahmen, wie die Erhaltung naturnaher Wälder, die Pflege von Trockenmauern und der Verzicht auf chemische Pflanzenschutzmittel, können entscheidend dazu beitragen, seine Lebensräume zu sichern. Auch die Forschung spielt eine wichtige Rolle: Nur wenn wir seine Verbreitung und Ansprüche genau verstehen, lassen sich gezielte Schutzkonzepte entwickeln.
Langfristig könnte der Alpenskorpion sogar zu einem Symboltier für die empfindliche Biodiversität der Alpen werden – ein kleiner, fast unscheinbarer Botschafter für den respektvollen Umgang mit der Natur.
In der Aufnahme von Helga Zinnecker
Der Alpenskorpion bevorzugt feuchte, strukturreiche Lebensräume: Wälder, Waldränder, felsige Hänge und alte Trockenmauern bieten ihm Verstecke vor Fressfeinden und extreme Wetterbedingungen. Tagsüber hält er sich meist unter Steinen, in Felsspalten oder unter Rinde auf. Erst in der Dämmerung oder Nacht geht er auf Nahrungssuche.
Seine Beute besteht vor allem aus kleinen Insekten, Spinnen und anderen Wirbellosen, die er mit seinen Scheren packt und mithilfe eines schwachen Giftes überwältigt. Für den Menschen ist sein Stich ungefährlich – vergleichbar mit einem Bienenstich – und dient in erster Linie der Jagd auf Beutetiere.
Herausforderungen und Gefährdungen
Obwohl der Alpenskorpion eine erstaunliche Anpassungsfähigkeit zeigt, steht er in der heutigen Zeit vor verschiedenen Gefahren:
Lebensraumverlust: Der Ausbau von Siedlungsflächen, intensive Forstwirtschaft und die Zerstörung traditioneller Trockenmauern nehmen ihm Rückzugsorte.
Klimawandel: Steigende Temperaturen und veränderte Niederschlagsmuster können seinen empfindlichen Lebensraum langfristig verändern. Extreme Trockenheit oder starke Winterfröste ohne schützende Schneedecke setzen ihm zu.
Fragmentierung der Bestände: Kleine, isolierte Populationen sind besonders anfällig für das Aussterben, da der genetische Austausch erschwert wird.
Bedeutung im Ökosystem
Der Alpenskorpion spielt eine wichtige Rolle als Räuber kleinerer Insekten und Gliederfüßer. Er hilft, deren Populationen in Balance zu halten, und ist selbst eine Nahrungsquelle für größere Tiere wie Vögel oder kleine Säuger. Damit trägt er zu einem stabilen ökologischen Gleichgewicht in den Alpenregionen bei.
Blick in die Zukunft
Die Zukunft des Alpenskorpions hängt stark vom Umgang des Menschen mit seiner Umwelt ab. Schutzmaßnahmen, wie die Erhaltung naturnaher Wälder, die Pflege von Trockenmauern und der Verzicht auf chemische Pflanzenschutzmittel, können entscheidend dazu beitragen, seine Lebensräume zu sichern. Auch die Forschung spielt eine wichtige Rolle: Nur wenn wir seine Verbreitung und Ansprüche genau verstehen, lassen sich gezielte Schutzkonzepte entwickeln.
Langfristig könnte der Alpenskorpion sogar zu einem Symboltier für die empfindliche Biodiversität der Alpen werden – ein kleiner, fast unscheinbarer Botschafter für den respektvollen Umgang mit der Natur.
In der Aufnahme von Helga Zinnecker
- Der Alpenskorpion – ein verborgenes Juwel der Alpenfauna
Artenschutz in Franken®
Der Perlglanzspanner (Campaea margaritaria)

Der Perlglanzspanner (Campaea margaritaria)
07/08.09.2025
Lautlos gleitet ein zart geflügeltes Wesen durch die Dunkelheit, schwebt von Zweig zu Zweig und setzt sich schließlich auf ein Blatt, wo seine Flügel im Mondschein wie perlmuttfarben schimmern. Es ist der Perlglanzspanner (Campaea margaritaria), ein Nachtfalter, der seit Jahrhunderten in unseren Wäldern lebt – verborgen, aber nicht unscheinbar. Seine Anmut erschließt sich nur dem, der in der Stille innehält und genau hinsieht.
07/08.09.2025
- In einer warmen Sommernacht liegt ein stiller Waldweg im silbrigen Mondlicht. Zwischen den Schatten der Bäume löst sich plötzlich eine Bewegung: ein heller Schimmer, kaum greifbar, fast wie ein Lichtreflex.
Lautlos gleitet ein zart geflügeltes Wesen durch die Dunkelheit, schwebt von Zweig zu Zweig und setzt sich schließlich auf ein Blatt, wo seine Flügel im Mondschein wie perlmuttfarben schimmern. Es ist der Perlglanzspanner (Campaea margaritaria), ein Nachtfalter, der seit Jahrhunderten in unseren Wäldern lebt – verborgen, aber nicht unscheinbar. Seine Anmut erschließt sich nur dem, der in der Stille innehält und genau hinsieht.
Artbeschreibung
Aussehen:
Die Flügelspannweite liegt zwischen 30 und 40 Millimetern. Charakteristisch sind die zarten, weißlich bis blassgrünen Flügel, die im richtigen Licht einen perlmuttartigen Schimmer aufweisen – daher der Name. Die Flügelränder sind fein gesäumt, oft mit einem schwachen grünlichen Hauch, der sich im Laufe des Alters verblassen kann...
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- Der Perlglanzspanner gehört zur Familie der Spanner (Geometridae) und ist in weiten Teilen Europas verbreitet.
Aussehen:
Die Flügelspannweite liegt zwischen 30 und 40 Millimetern. Charakteristisch sind die zarten, weißlich bis blassgrünen Flügel, die im richtigen Licht einen perlmuttartigen Schimmer aufweisen – daher der Name. Die Flügelränder sind fein gesäumt, oft mit einem schwachen grünlichen Hauch, der sich im Laufe des Alters verblassen kann...
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- Perlglanzspanner (Campaea margaritaria) ... sitzt an einer Hauswand ...
Artenschutz in Franken®
Herbst im Hochsommer – ein stiller Hilferuf unserer Wälder

Herbst im Hochsommer – ein stiller Hilferuf unserer Wälder
06/07.09.2025
Fast könnte man meinen, der Herbst sei hereingebrochen – doch die Wahrheit ist ernüchternd. Was wir sehen, ist kein natürlicher Jahreszeitenwechsel, sondern ein stiller Hilferuf der Bäume.
06/07.09.2025
- Wer in diesen Tagen durch den Wald wandert, reibt sich verwundert die Augen: Statt sattgrüner Kronen liegt schon jetzt raschelndes Laub auf den Wegen.
Fast könnte man meinen, der Herbst sei hereingebrochen – doch die Wahrheit ist ernüchternd. Was wir sehen, ist kein natürlicher Jahreszeitenwechsel, sondern ein stiller Hilferuf der Bäume.
Wenn der Wald die Notbremse zieht
Die anhaltende Trockenheit zwingt viele Bäume dazu, frühzeitig ihre Blätter abzuwerfen. Es ist ihr letzter Versuch, Wasser zu sparen, ihre Lebenskräfte zu bündeln und dem Austrocknen zu entgehen. Was für Spaziergänger romantisch wirken mag, ist in Wahrheit ein Alarmsignal: Der Wald kämpft ums Überleben.
Wirtschaftsforste sind besonders verletzlich
Besonders stark zeigt sich dieses Phänomen in unseren Wirtschaftsforsten. Hier, wo über Jahrzehnte hinweg oft nur eine Baumart in gleichförmigen Reihen gepflanzt wurde, fehlt es an Vielfalt und Widerstandskraft. Monokulturen sind wie Armeen, die alle denselben Feind fürchten – wenn die Trockenheit zuschlägt, trifft sie alle zugleich.
Gleichaltrige Bestände können sich nicht gegenseitig stützen; ganze Flächen geraten auf einmal ins Wanken. Durch intensive Nutzung leidet oft auch der Boden – er speichert weniger Wasser, und die Bäume stehen schneller im Stress.
So wird der Wald, der einst als grüne Schatzkammer für kommende Generationen gedacht war, anfällig wie nie zuvor.
Naturnahe Wälder trotzen der Dürre besser
Ein Spaziergang in einem intakten, naturnahen Wald zeigt ein anderes Bild: Hier ist der Sommer noch spürbar. Unterschiedliche Baumarten, verschiedene Altersstufen und ein lebendiger Boden bilden ein Netz der Stabilität.
Auch diese Wälder bleiben nicht unberührt von Hitze und Dürre, doch sie zeigen uns: Mit Vielfalt und Balance kann die Natur selbst in schwierigen Zeiten Kraft schöpfen.
Ein Auftrag für uns alle
Das frühzeitige Herbstbild im Sommer ist mehr als eine optische Irritation – es ist ein Mahnmal. Unsere Wälder erzählen uns, dass sie an ihre Grenzen geraten. Sie fordern uns auf, umzudenken: Weg von anfälligen Monokulturen, hin zu artenreichen, widerstandsfähigen Mischwäldern.
Denn der Wald ist mehr als nur Holzlieferant. Er ist Lebensraum, Klimaschützer, Rückzugsort und Zukunftsgarant. Wenn wir jetzt handeln, können wir dafür sorgen, dass auch kommende Generationen in kraftvolle, grüne Wälder eintauchen dürfen – nicht in Wälder, die schon im Juli aussehen, als wäre der Sommer längst vergangen.
In der Aufnahme
Die anhaltende Trockenheit zwingt viele Bäume dazu, frühzeitig ihre Blätter abzuwerfen. Es ist ihr letzter Versuch, Wasser zu sparen, ihre Lebenskräfte zu bündeln und dem Austrocknen zu entgehen. Was für Spaziergänger romantisch wirken mag, ist in Wahrheit ein Alarmsignal: Der Wald kämpft ums Überleben.
Wirtschaftsforste sind besonders verletzlich
Besonders stark zeigt sich dieses Phänomen in unseren Wirtschaftsforsten. Hier, wo über Jahrzehnte hinweg oft nur eine Baumart in gleichförmigen Reihen gepflanzt wurde, fehlt es an Vielfalt und Widerstandskraft. Monokulturen sind wie Armeen, die alle denselben Feind fürchten – wenn die Trockenheit zuschlägt, trifft sie alle zugleich.
Gleichaltrige Bestände können sich nicht gegenseitig stützen; ganze Flächen geraten auf einmal ins Wanken. Durch intensive Nutzung leidet oft auch der Boden – er speichert weniger Wasser, und die Bäume stehen schneller im Stress.
So wird der Wald, der einst als grüne Schatzkammer für kommende Generationen gedacht war, anfällig wie nie zuvor.
Naturnahe Wälder trotzen der Dürre besser
Ein Spaziergang in einem intakten, naturnahen Wald zeigt ein anderes Bild: Hier ist der Sommer noch spürbar. Unterschiedliche Baumarten, verschiedene Altersstufen und ein lebendiger Boden bilden ein Netz der Stabilität.
- Das Mosaik der Artenvielfalt wirkt wie ein Schutzschild – wo eine Baumart leidet, springt eine andere ein.
- Laubstreu, Sträucher und Totholz halten den Boden feucht und schaffen ein kühleres Mikroklima.
- Vielfalt bedeutet Widerstandskraft – genau das, was in Zeiten des Klimawandels so dringend gebraucht wird.
Auch diese Wälder bleiben nicht unberührt von Hitze und Dürre, doch sie zeigen uns: Mit Vielfalt und Balance kann die Natur selbst in schwierigen Zeiten Kraft schöpfen.
Ein Auftrag für uns alle
Das frühzeitige Herbstbild im Sommer ist mehr als eine optische Irritation – es ist ein Mahnmal. Unsere Wälder erzählen uns, dass sie an ihre Grenzen geraten. Sie fordern uns auf, umzudenken: Weg von anfälligen Monokulturen, hin zu artenreichen, widerstandsfähigen Mischwäldern.
Denn der Wald ist mehr als nur Holzlieferant. Er ist Lebensraum, Klimaschützer, Rückzugsort und Zukunftsgarant. Wenn wir jetzt handeln, können wir dafür sorgen, dass auch kommende Generationen in kraftvolle, grüne Wälder eintauchen dürfen – nicht in Wälder, die schon im Juli aussehen, als wäre der Sommer längst vergangen.
In der Aufnahme
- „Herbst im Hochsommer – Trockenheit zwingt die Bäume zum frühen Laubfall.“
Artenschutz in Franken®
Die Europäische Sumpfschildkröte (Emys orbicularis)

Eine nachdenkliche Begegnung am Teichrand
05/06.09.2025
Eine Schildkröte taucht auf, hebt den Kopf und lauscht, als würde sie die Landschaft lesen: das Rascheln im Schilf, das leise Tropfen von Blättern, die Wärme des ersten Sonnenflecks. Seit Jahrhunderten kennt sie diesen Ort. Sie hat Hochwasser und Trockenzeiten gesehen, Fischnachwuchs und Eisdecken, Dorfbau und Straßenlärm.
05/06.09.2025
- An einem kühlen Frühsommermorgen liegt der Teich noch im Dunst. Libellen zeichnen zitternde Linien in die Luft, Frösche verstummen für einen Atemzug, als ein dunkler, runder Rücken die Wasseroberfläche durchschneidet.
Eine Schildkröte taucht auf, hebt den Kopf und lauscht, als würde sie die Landschaft lesen: das Rascheln im Schilf, das leise Tropfen von Blättern, die Wärme des ersten Sonnenflecks. Seit Jahrhunderten kennt sie diesen Ort. Sie hat Hochwasser und Trockenzeiten gesehen, Fischnachwuchs und Eisdecken, Dorfbau und Straßenlärm.
Nichts an ihr drängt sich auf – sie ist Gegenwart im Zeitlupentempo. Und doch erzählt ihr Auftauchen eine große Geschichte: von der Geduld der Natur und von der Frage, ob wir Menschen ihr genügend Raum lassen.
In der Aufnahme von Mario Will
In der Aufnahme von Mario Will
- Europäische Sumpfschildkröte (Emys orbicularis)
Artenschutz in Franken®
Die Europäische Wachtel (Coturnix coturnix)

Die Europäische Wachtel (Coturnix coturnix)
04/05.09.2025
An einem frühen Sommermorgen erklingt zwischen den Feldern ein leiser Ruf: „wett-wett-wett“. Nur wer genau hinhört, bemerkt die Stimme der Europäischen Wachtel (Coturnix coturnix). Dieser unscheinbare Hühnervogel lebt versteckt im hohen Gras und ist selten zu sehen. Dabei gehört er zu den faszinierendsten Zugvögeln Europas – klein, anpassungsfähig und perfekt getarnt.
04/05.09.2025
- Die verborgene Schönheit der Feldflur
An einem frühen Sommermorgen erklingt zwischen den Feldern ein leiser Ruf: „wett-wett-wett“. Nur wer genau hinhört, bemerkt die Stimme der Europäischen Wachtel (Coturnix coturnix). Dieser unscheinbare Hühnervogel lebt versteckt im hohen Gras und ist selten zu sehen. Dabei gehört er zu den faszinierendsten Zugvögeln Europas – klein, anpassungsfähig und perfekt getarnt.
Merkmale der Europäischen Wachtel
Die unauffällige Färbung macht die Wachtel fast unsichtbar. Erst beim Auffliegen verrät sie sich – dann aber nur für kurze Strecken, bevor sie wieder im dichten Bewuchs verschwindet.
In der Aufnahme von Andreas Gehrig
- Größe: 16–18 cm
- Gewicht: 70–135 g
- Gefieder: Braun-beige gestreift, ideale Tarnung im Gras
- Besonderheit: Kleinster Hühnervogel Europas, Bodenbewohner, fliegt nur ungern
Die unauffällige Färbung macht die Wachtel fast unsichtbar. Erst beim Auffliegen verrät sie sich – dann aber nur für kurze Strecken, bevor sie wieder im dichten Bewuchs verschwindet.
In der Aufnahme von Andreas Gehrig
- Paar der Europäischen Wachtel
Artenschutz in Franken®
Die Traubeneiche (Quercus petraea) und ihre Mastjahre

Die Traubeneiche (Quercus petraea) und ihre Mastjahre
Die Traubeneiche (Quercus petraea) ist neben der Stieleiche eine der beiden heimischen Hauptarten der Eichen in Mitteleuropa.
Sie erreicht Höhen von bis zu 35–40 Metern und kann mehrere Jahrhunderte alt werden. Ihre Rinde ist im Alter dunkelgrau und tief gefurcht, während junge Bäume eine glattere, graubraune Borke besitzen.
Ein wichtiges Merkmal zur Unterscheidung von der Stieleiche sind die Eicheln: Sie sitzen bei der Traubeneiche fast direkt am Zweig, häufig in kleinen Gruppen oder „Trauben“, was der Art ihren deutschen Namen gegeben hat. Die Blätter sind längergestielt als bei der Stieleiche (5–15 mm) und zeigen tiefe, ungleichmäßige Lappen. Die Traubeneiche bevorzugt eher trockene bis mäßig frische Standorte, ist lichtliebend und findet sich häufig in Hang- und Mittelgebirgslagen.
- 03/04.09.2025
Die Traubeneiche (Quercus petraea) ist neben der Stieleiche eine der beiden heimischen Hauptarten der Eichen in Mitteleuropa.
Sie erreicht Höhen von bis zu 35–40 Metern und kann mehrere Jahrhunderte alt werden. Ihre Rinde ist im Alter dunkelgrau und tief gefurcht, während junge Bäume eine glattere, graubraune Borke besitzen.
Ein wichtiges Merkmal zur Unterscheidung von der Stieleiche sind die Eicheln: Sie sitzen bei der Traubeneiche fast direkt am Zweig, häufig in kleinen Gruppen oder „Trauben“, was der Art ihren deutschen Namen gegeben hat. Die Blätter sind längergestielt als bei der Stieleiche (5–15 mm) und zeigen tiefe, ungleichmäßige Lappen. Die Traubeneiche bevorzugt eher trockene bis mäßig frische Standorte, ist lichtliebend und findet sich häufig in Hang- und Mittelgebirgslagen.
Mastjahre bei der Traubeneiche
Wie die Stieleiche zeigt auch die Traubeneiche das Phänomen der Mastjahre. Dabei handelt es sich um Jahre, in denen die Bäume außergewöhnlich viele Früchte – also Eicheln – hervorbringen.
Ursachen für Mastjahre
Mastjahre treten bei Traubeneichen in unregelmäßigen Abständen auf, meist alle 5–10 Jahre. Wichtige Faktoren sind:
Ökologische Bedeutung
Mastjahre der Traubeneiche haben große Auswirkungen auf das Ökosystem:
Klimawandel als Einflussfaktor
Der Klimawandel wirkt sich zunehmend auch auf die Mastjahre der Traubeneiche aus:
Damit wird deutlich: Auch wenn die Traubeneiche als robuste und langlebige Baumart gilt, stellen Klimaveränderungen ihr traditionelles Mastverhalten und ihre Verjüngung zunehmend vor Herausforderungen.
In der Aufnahme
Wie die Stieleiche zeigt auch die Traubeneiche das Phänomen der Mastjahre. Dabei handelt es sich um Jahre, in denen die Bäume außergewöhnlich viele Früchte – also Eicheln – hervorbringen.
- Normaljahre: Nur wenige Eicheln werden gebildet.
- Mastjahre: Es kommt zu einer massenhaften Eichelproduktion, oft gleichzeitig in ganzen Regionen.
- Dieses Verhalten ist eine Überlebensstrategie: Durch die Fülle an Samen bleibt trotz starker Fraßnutzung durch Wildtiere wie Wildschweine, Eichhörnchen oder Vögel ein Teil der Eicheln übrig, der keimen und zu Jungpflanzen heranwachsen kann.
Ursachen für Mastjahre
Mastjahre treten bei Traubeneichen in unregelmäßigen Abständen auf, meist alle 5–10 Jahre. Wichtige Faktoren sind:
- Klimatische Bedingungen: Warme Frühjahre mit günstiger Blütezeit erhöhen die Chancen auf Mast.
- Energiereserven: Nach guten Wachstumsjahren können Bäume mehr Ressourcen in die Fruchtbildung investieren.
- Synchronisation: Oft fruchten Eichen in einer ganzen Region gleichzeitig – das erhöht den „Übersättigungseffekt“ gegenüber Fraßfeinden.
Ökologische Bedeutung
Mastjahre der Traubeneiche haben große Auswirkungen auf das Ökosystem:
- Nahrung: Viele Tierarten profitieren von der reichen Eichelernte.
- Verjüngung: Nur in Mastjahren gelingt es der Traubeneiche in größerem Umfang, neue Generationen auszubilden.
- Dynamik im Wald: Durch die Schwankungen im Eichelangebot verändern sich Wildtierbestände, und auch die Konkurrenz mit anderen Baumarten wird beeinflusst.
Klimawandel als Einflussfaktor
Der Klimawandel wirkt sich zunehmend auch auf die Mastjahre der Traubeneiche aus:
- Hitzestress und Trockenheit können dazu führen, dass die Bildung von Eicheln eingeschränkt oder ganz ausbleibt.
- Verkürzte Mastzyklen belasten die Energiereserven der Bäume, da sie häufiger zur Fruchtbildung gezwungen sind.
- Geringere Keimchancen: Selbst wenn viele Eicheln gebildet werden, können Jungpflanzen unter trockenen Bedingungen schlecht anwachsen.
Damit wird deutlich: Auch wenn die Traubeneiche als robuste und langlebige Baumart gilt, stellen Klimaveränderungen ihr traditionelles Mastverhalten und ihre Verjüngung zunehmend vor Herausforderungen.
In der Aufnahme
- „Eicheln am Ast der Traubeneiche – sichtbares Zeichen für ein Mastjahr und Grundlage für neues Leben im Wald.
Artenschutz in Franken®
Akzeptanz eines umgestalteten Trafogebäudes als Stele der Biodiversität

Akzeptanz eines umgestalteten Trafogebäudes als Stele der Biodiversität
02/03.09.2025
Ein anschauliches Beispiel stellt die Umgestaltung eines vormaligen Trafogebäudes dar, das heute als „Stele der Biodiversität“ fungiert. Das Projekt verbindet Aspekte des Naturschutzes, der Umweltbildung und der regionalen Identitätsstiftung.
02/03.09.2025
- Die Umnutzung technischer Infrastrukturbauten zu Orten ökologischer und kultureller Vermittlung gewinnt zunehmend an Bedeutung.
Ein anschauliches Beispiel stellt die Umgestaltung eines vormaligen Trafogebäudes dar, das heute als „Stele der Biodiversität“ fungiert. Das Projekt verbindet Aspekte des Naturschutzes, der Umweltbildung und der regionalen Identitätsstiftung.
Ausgangslage
Kompakte Trafostationen prägen vielerorts das Bild städtischer und ländlicher Räume. Nach der Aufgabe ihrer technischen Funktion bleiben sie häufig ungenutzt. Im hier betrachteten Fall wurde die bauliche Substanz erhalten, um den Standort einer neuen Bestimmung zuzuführen. Die Entscheidung, das Gebäude als Stele der Biodiversität zu interpretieren, fußt auf dem Ansatz, technische Relikte in kulturelle und ökologische Bildungsräume zu transformieren.
Gestaltung und Funktion
Das ehemalige Trafogebäude wurde so adaptiert, dass es biologische Vielfalt in unterschiedlichen Facetten thematisiert. Informative Tafeln, künstlerische Elemente und naturkundliche Darstellungen verweisen auf die lokale Flora und Fauna. Ergänzt wird die Installation durch begleitende Veranstaltungen, die Naturerfahrung und Wissensvermittlung miteinander verknüpfen. Das Objekt erfüllt damit sowohl eine gestalterische Funktion im Ortsbild als auch eine pädagogische Aufgabe.
Akzeptanz in der Bevölkerung
Die Resonanz auf die Umgestaltung ist in weiten Teilen positiv. Besucherinnen und Besucher schätzen die Verbindung von Ästhetik und Umweltbildung. Befragungen vor Ort und Rückmeldungen aus Vereinen und Institutionen zeigen, dass die Stele als innovativer Beitrag zur Sensibilisierung für Biodiversität verstanden wird. Besonders hervorgehoben wird der niederschwellige Zugang: Auch Passantinnen und Passanten ohne spezielles Vorwissen finden hier einen Einstieg in ökologische Fragestellungen.
Darüber hinaus stärkt die Aufwertung des ehemaligen Zweckbaus die lokale Identifikation. Anwohnerinnen und Anwohner betonen, dass durch die Neugestaltung ein Ort mit Wiedererkennungswert entstanden ist, der überregionale Aufmerksamkeit erzeugt.
Bedeutung für Naturschutz und Umweltbildung
Das Projekt illustriert, wie brachliegende Infrastrukturbauten in einen Dialog zwischen Mensch und Natur überführt werden können. Indem das Trafogebäude zu einer Stele der Biodiversität transformiert wurde, entsteht ein sichtbares Zeichen für nachhaltiges Handeln. Gleichzeitig trägt es zur Vermittlung naturwissenschaftlicher Inhalte bei und regt zu eigenständigem Engagement im Naturschutz an.
Fazit
Die umfangreiche Akzeptanz des Projekts zeigt, dass sich ausgediente technische Gebäude erfolgreich in Orte ökologischer und gesellschaftlicher Bedeutung verwandeln lassen. Die Stele der Biodiversität erfüllt dabei mehrere Funktionen: Sie ist Denkmal, Bildungsmedium und Symbol für den bewussten Umgang mit Umwelt und Kultur.
In der Aufnahme
Kompakte Trafostationen prägen vielerorts das Bild städtischer und ländlicher Räume. Nach der Aufgabe ihrer technischen Funktion bleiben sie häufig ungenutzt. Im hier betrachteten Fall wurde die bauliche Substanz erhalten, um den Standort einer neuen Bestimmung zuzuführen. Die Entscheidung, das Gebäude als Stele der Biodiversität zu interpretieren, fußt auf dem Ansatz, technische Relikte in kulturelle und ökologische Bildungsräume zu transformieren.
Gestaltung und Funktion
Das ehemalige Trafogebäude wurde so adaptiert, dass es biologische Vielfalt in unterschiedlichen Facetten thematisiert. Informative Tafeln, künstlerische Elemente und naturkundliche Darstellungen verweisen auf die lokale Flora und Fauna. Ergänzt wird die Installation durch begleitende Veranstaltungen, die Naturerfahrung und Wissensvermittlung miteinander verknüpfen. Das Objekt erfüllt damit sowohl eine gestalterische Funktion im Ortsbild als auch eine pädagogische Aufgabe.
Akzeptanz in der Bevölkerung
Die Resonanz auf die Umgestaltung ist in weiten Teilen positiv. Besucherinnen und Besucher schätzen die Verbindung von Ästhetik und Umweltbildung. Befragungen vor Ort und Rückmeldungen aus Vereinen und Institutionen zeigen, dass die Stele als innovativer Beitrag zur Sensibilisierung für Biodiversität verstanden wird. Besonders hervorgehoben wird der niederschwellige Zugang: Auch Passantinnen und Passanten ohne spezielles Vorwissen finden hier einen Einstieg in ökologische Fragestellungen.
Darüber hinaus stärkt die Aufwertung des ehemaligen Zweckbaus die lokale Identifikation. Anwohnerinnen und Anwohner betonen, dass durch die Neugestaltung ein Ort mit Wiedererkennungswert entstanden ist, der überregionale Aufmerksamkeit erzeugt.
Bedeutung für Naturschutz und Umweltbildung
Das Projekt illustriert, wie brachliegende Infrastrukturbauten in einen Dialog zwischen Mensch und Natur überführt werden können. Indem das Trafogebäude zu einer Stele der Biodiversität transformiert wurde, entsteht ein sichtbares Zeichen für nachhaltiges Handeln. Gleichzeitig trägt es zur Vermittlung naturwissenschaftlicher Inhalte bei und regt zu eigenständigem Engagement im Naturschutz an.
Fazit
Die umfangreiche Akzeptanz des Projekts zeigt, dass sich ausgediente technische Gebäude erfolgreich in Orte ökologischer und gesellschaftlicher Bedeutung verwandeln lassen. Die Stele der Biodiversität erfüllt dabei mehrere Funktionen: Sie ist Denkmal, Bildungsmedium und Symbol für den bewussten Umgang mit Umwelt und Kultur.
In der Aufnahme
- Nahezu alle in 2025 installierten Kleinvogelnisthilfen wurden auch in 2025 erfolgreich bebrütet! Kotspuren lassen optische Rückschlüsse auf die Frequentierung zu.
Artenschutz in Franken®
Fakten zum Klimawandel, Unterstützung bei der Klimaanpassung
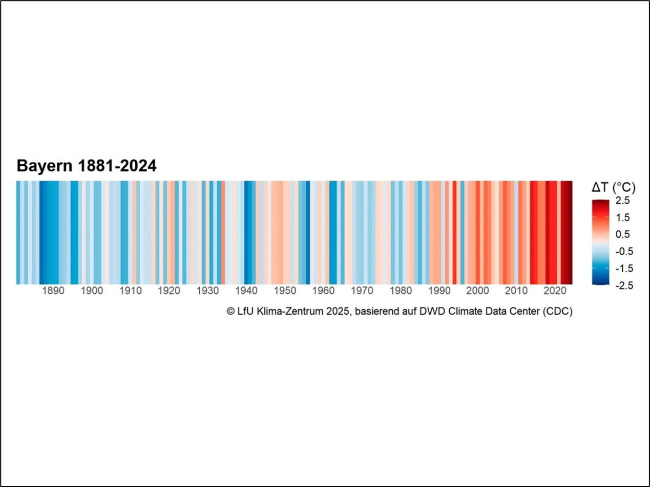
Fakten zum Klimawandel, Unterstützung bei der Klimaanpassung
01/02.09.2025
5 Jahre Klimazentrum am Bayerischen Landesamt für Umwelt
Anlässlich des fünfjährigen Bestehens betont Ralph Neumeier, Vizepräsident des LfU: „Eine solide und unabhängige Datengrundlage zum Klimawandel sowie praxisnahe Informationen sind Voraussetzungen für eine zielgerichtete Klimaanpassung. Dafür hat das Klimazentrum zentral für Bayern das Bayerische Klimainformationssystem aufgebaut.
Regionalisiert bis auf die Landkreisebene lassen sich dort Daten und Karten zum Klimawandel und seinen Folgen wie Hitzetage, Trockenperioden und Starkregentagen abrufen. Wie bei der jüngsten Hitzewelle im Juni spürbar war, wird Klimaanpassung immer wichtiger. Hierbei begleitet und unterstützt das Klimazentrum Kommunen und weitere Akteure mit Wissen, Werkzeugen und Veranstaltungen.“
01/02.09.2025
5 Jahre Klimazentrum am Bayerischen Landesamt für Umwelt
- Vor fünf Jahren, im Juli 2020, wurde am Bayerischen Landesamt für Umwelt (LfU) das Klimazentrum als zentrale Anlaufstelle rund um die Themen Klimawandel, Klimafolgen und Klimaanpassung in Bayern gegründet.
Anlässlich des fünfjährigen Bestehens betont Ralph Neumeier, Vizepräsident des LfU: „Eine solide und unabhängige Datengrundlage zum Klimawandel sowie praxisnahe Informationen sind Voraussetzungen für eine zielgerichtete Klimaanpassung. Dafür hat das Klimazentrum zentral für Bayern das Bayerische Klimainformationssystem aufgebaut.
Regionalisiert bis auf die Landkreisebene lassen sich dort Daten und Karten zum Klimawandel und seinen Folgen wie Hitzetage, Trockenperioden und Starkregentagen abrufen. Wie bei der jüngsten Hitzewelle im Juni spürbar war, wird Klimaanpassung immer wichtiger. Hierbei begleitet und unterstützt das Klimazentrum Kommunen und weitere Akteure mit Wissen, Werkzeugen und Veranstaltungen.“
Das Bayerische Klimainformationssystem bietet einen umfassenden Überblick zu allen relevanten Themen im Klimabereich und liefert Antworten auf die Frage, wie sich der Klimawandel regional auswirkt. Es lassen sich verschiedene Klimaszenarien darstellen und zum Beispiel Aussagen zu regionalen Hitzetagen oder Tropennächten abfragen. Langfristige Klimaprojektionen können bis Mitte oder Ende dieses Jahrhunderts abgebildet werden. Speziell für Kommunen wurden Praxisbeispiele zur Klimaanpassung und Fördermöglichkeiten sowie Werkzeuge zur Ermittlung der regionalen Betroffenheit zusammengestellt. Das Bayerische Klimainformationssystem wird fortlaufend erweitert und mit den neuesten Klimadaten aktualisiert.
Um Kommunen und andere Akteure zu unterstützen, setzt das Klimazentrum auf Vernetzung und Erfahrungsaustausch, beispielsweise mit Online-Klimagesprächen oder Workshops vor Ort. Im Jahr 2025 wird beispielsweise ein Netzwerktreffen für Großstädte und für mittelgroße Städte sowie eine Klimawerkstatt für bayerische Landkreise angeboten.
Ein weiterer Schwerpunkt des Klimazentrums liegt auf der Stärkung der sogenannten grün-blauen Infrastruktur in Bayerns Kommunen. Denn mit mehr Grün und Natur sowie nachhaltigem Umgang mit Wasser werden Städte und Gemeinden widerstandsfähiger gegenüber den Folgen des Klimawandels. Das Klimazentrum unterstützt hier die Umweltinitiative Stadt.Klima.Natur des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz und fördert den Austausch zwischen den kommunalen Klimaanpassungsmanagements.
In der Abbildung
Quelle
Bayerisches Landesamt für Umwelt
Pressestelle
Bürgermeister-Ulrich-Straße 160
86179 Augsburg
Stand
20.08.2025
Um Kommunen und andere Akteure zu unterstützen, setzt das Klimazentrum auf Vernetzung und Erfahrungsaustausch, beispielsweise mit Online-Klimagesprächen oder Workshops vor Ort. Im Jahr 2025 wird beispielsweise ein Netzwerktreffen für Großstädte und für mittelgroße Städte sowie eine Klimawerkstatt für bayerische Landkreise angeboten.
Ein weiterer Schwerpunkt des Klimazentrums liegt auf der Stärkung der sogenannten grün-blauen Infrastruktur in Bayerns Kommunen. Denn mit mehr Grün und Natur sowie nachhaltigem Umgang mit Wasser werden Städte und Gemeinden widerstandsfähiger gegenüber den Folgen des Klimawandels. Das Klimazentrum unterstützt hier die Umweltinitiative Stadt.Klima.Natur des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz und fördert den Austausch zwischen den kommunalen Klimaanpassungsmanagements.
In der Abbildung
- Klimastreifen oder Warming Stripes (je röter desto wärmer) für Bayern für die Jahre von 1881 (links) bis 2024 (rechts)
Quelle
Bayerisches Landesamt für Umwelt
Pressestelle
Bürgermeister-Ulrich-Straße 160
86179 Augsburg
Stand
20.08.2025
Artenschutz in Franken®
Wenn das Leben am Ackerrand verstummt

Wenn das Leben am Ackerrand verstummt
31.08/01.09.2025
Genau dort, wo Bienen summen, Vögel brüten und Amphibien Schutz suchen, greifen Maschinen ein und vernichten mit einem Mal, was über Wochen und Monate gewachsen ist. Mulchen von Randstreifen und Abmähen der Grabensysteme sind stille Katastrophen für die Biodiversität – oft unsichtbar für die Gesellschaft, aber mit Folgen für Generationen. Wenn wir jetzt nicht umdenken, werden unsere Kinder eines Tages fragen, warum wir diese Zerstörung zugelassen haben.
31.08/01.09.2025
- Unsere Landschaft ist voller Leben – doch viel davon geschieht im Verborgenen, am Rand der Felder oder entlang der Gräben.
Genau dort, wo Bienen summen, Vögel brüten und Amphibien Schutz suchen, greifen Maschinen ein und vernichten mit einem Mal, was über Wochen und Monate gewachsen ist. Mulchen von Randstreifen und Abmähen der Grabensysteme sind stille Katastrophen für die Biodiversität – oft unsichtbar für die Gesellschaft, aber mit Folgen für Generationen. Wenn wir jetzt nicht umdenken, werden unsere Kinder eines Tages fragen, warum wir diese Zerstörung zugelassen haben.
Es beginnt unscheinbar: Ein schmaler Streifen am Feldrand, ein Graben zwischen zwei Äckern, ein Saum aus wilden Blumen, Gräsern und Stauden. Für die meisten Menschen kaum der Rede wert, doch für die Natur von unschätzbarem Wert. Hier summen die Insekten, hier brüten Vögel, hier finden Amphibien und Kleinsäuger Versteck und Nahrung. Diese Streifen und Gräben sind keine Nebenschauplätze – sie sind Lebensadern in einer immer stärker ausgeräumten Kulturlandschaft.
Doch dann rollt die Maschine. Mit dröhnendem Motor wird gemulcht oder gemäht, Randstreifen und Grabenböschungen werden niedergemäht, das Grün bis auf den Boden gekappt. Was eben noch blühte, flatterte, lebte, wird in wenigen Minuten zerstört. Zurück bleibt eine kahle, leblose Fläche. Die stillen Opfer – Insekten, Vögel, Amphibien, Reptilien, Kleinsäuger – bleiben unsichtbar. Niemand zählt sie, niemand beklagt sie.
Die doppelte Tragik
Das Mulchen von Randstreifen und das Abmähen von Grabenböschungen sind Praktiken, die oft als „Pflege“ bezeichnet werden. Doch in Wahrheit sind sie eine doppelte Katastrophe:
Für die Artenvielfalt: Blühpflanzen, Nistplätze, Rückzugsräume und Nahrungspflanzen werden zerstört. Jungtiere und Insekten sterben direkt durch die Maschinen.
Für die Ökosysteme: Gräben verlieren durch die Mahd ihre natürliche Vegetation, die Wasser filtert, stabilisiert und Lebensraum bietet. Damit wird die Selbstreinigungskraft der Natur geschwächt und wertvoller Lebensraum für Frösche, Kröten, Molche und Libellen ausgelöscht.
Besonders bitter ist, dass diese Eingriffe oft auf Flächen stattfinden, die nicht einmal den Verursachenden gehören: öffentliche Wegränder, gemeindeeigene Gräben, Gemeinschaftsflächen. Lebensräume, die allen gehören sollten, werden zerstört, als wären sie bedeutungslos.
Fragen, die bleiben werden
Heute mag es vielen als Routine erscheinen. Doch unsere Kinder und Enkelkinder werden eines Tages fragen:
Diese Fragen werden gestellt werden – und wir werden ihnen kaum gute Antworten geben können, wenn wir jetzt nicht handeln.
Es geht auch anders
Dabei ist der Weg in eine andere Zukunft möglich:
Jeder Randstreifen, jeder Graben könnte zu einem bunten Band des Lebens werden – zu einem Ort, der Arten schützt, Wasser reinigt und Landschaften bereichert.
Ein Appell
Mulchen und Abmähen sind keine Nebensächlichkeiten. Sie sind Eingriffe, die Leben vernichten, Artenvielfalt zerstören und unserer Zukunft die Grundlage entziehen. Wer heute einen Graben kahl mäht oder einen Randstreifen mulcht, hinterlässt eine Spur des Verlustes.
Wir brauchen ein Umdenken:
Denn jeder stehen gelassene Halm, jede blühende Staude und jedes ungemähte Ufer ist ein Zeichen: für die Achtung vor dem Leben, für die Verantwortung gegenüber unseren Kindern – und für die Hoffnung, dass unsere Landschaft auch morgen noch lebt. Doch wir können unseren Kindern und Enkelkindern jedoch auch mitteilen wer beim Niedergang der Biodiversität mit in der Verantwortung stand!
In der Aufnahme
Doch dann rollt die Maschine. Mit dröhnendem Motor wird gemulcht oder gemäht, Randstreifen und Grabenböschungen werden niedergemäht, das Grün bis auf den Boden gekappt. Was eben noch blühte, flatterte, lebte, wird in wenigen Minuten zerstört. Zurück bleibt eine kahle, leblose Fläche. Die stillen Opfer – Insekten, Vögel, Amphibien, Reptilien, Kleinsäuger – bleiben unsichtbar. Niemand zählt sie, niemand beklagt sie.
Die doppelte Tragik
Das Mulchen von Randstreifen und das Abmähen von Grabenböschungen sind Praktiken, die oft als „Pflege“ bezeichnet werden. Doch in Wahrheit sind sie eine doppelte Katastrophe:
Für die Artenvielfalt: Blühpflanzen, Nistplätze, Rückzugsräume und Nahrungspflanzen werden zerstört. Jungtiere und Insekten sterben direkt durch die Maschinen.
Für die Ökosysteme: Gräben verlieren durch die Mahd ihre natürliche Vegetation, die Wasser filtert, stabilisiert und Lebensraum bietet. Damit wird die Selbstreinigungskraft der Natur geschwächt und wertvoller Lebensraum für Frösche, Kröten, Molche und Libellen ausgelöscht.
Besonders bitter ist, dass diese Eingriffe oft auf Flächen stattfinden, die nicht einmal den Verursachenden gehören: öffentliche Wegränder, gemeindeeigene Gräben, Gemeinschaftsflächen. Lebensräume, die allen gehören sollten, werden zerstört, als wären sie bedeutungslos.
Fragen, die bleiben werden
Heute mag es vielen als Routine erscheinen. Doch unsere Kinder und Enkelkinder werden eines Tages fragen:
- Warum habt ihr die blühenden Streifen und lebendigen Gräben zerstört?
- Warum habt ihr Lebensräume vernichtet, die so wichtig für die Artenvielfalt waren?
- Warum habt ihr zugelassen, dass Maschinen stärker zählten als die Stimme der Natur?
Diese Fragen werden gestellt werden – und wir werden ihnen kaum gute Antworten geben können, wenn wir jetzt nicht handeln.
Es geht auch anders
Dabei ist der Weg in eine andere Zukunft möglich:
- Randstreifen und Gräben können blühen, wenn sie gezielt und schonend gepflegt werden.
- Seltene Mahd zum richtigen Zeitpunkt erhält Lebensräume, statt sie zu zerstören.
- Blühflächen und Ufervegetation sind keine „Unordnung“, sondern ein Schatz an Biodiversität.
Jeder Randstreifen, jeder Graben könnte zu einem bunten Band des Lebens werden – zu einem Ort, der Arten schützt, Wasser reinigt und Landschaften bereichert.
Ein Appell
Mulchen und Abmähen sind keine Nebensächlichkeiten. Sie sind Eingriffe, die Leben vernichten, Artenvielfalt zerstören und unserer Zukunft die Grundlage entziehen. Wer heute einen Graben kahl mäht oder einen Randstreifen mulcht, hinterlässt eine Spur des Verlustes.
Wir brauchen ein Umdenken:
- Weg von blinder Pflege hin zu bewusster Verantwortung.
- Weg vom kurzfristigen Ordnungssinn hin zum langfristigen Schutz unserer Natur.
Denn jeder stehen gelassene Halm, jede blühende Staude und jedes ungemähte Ufer ist ein Zeichen: für die Achtung vor dem Leben, für die Verantwortung gegenüber unseren Kindern – und für die Hoffnung, dass unsere Landschaft auch morgen noch lebt. Doch wir können unseren Kindern und Enkelkindern jedoch auch mitteilen wer beim Niedergang der Biodiversität mit in der Verantwortung stand!
In der Aufnahme
- Negativbeispiel welches einen gravierenden Beitrag zum Niedergang der Biodiversität in unserem Land leistet. Unsere Kinder und Enkelkinder werden sich fragen wie es sich die Verursacher eigentlich herausnehmen konnten, Schäden am öffentlichen Grund zu verursachen. Und was meint eigentlich die betroffene Gemeinde dazu?
Artenschutz in Franken®
Die Hausmaus (Mus musculus) – kleiner Schattenbewohner mit großer Geschichte

Die Hausmaus (Mus musculus) – kleiner Schattenbewohner mit großer Geschichte
30/31.08.2025
Sie ist winzig, unscheinbar und doch eines der erfolgreichsten Säugetiere der Welt. Seit Jahrtausenden begleitet sie den Menschen, hat sich an unsere Vorräte, unsere Wärme und unsere Häuser angepasst. Manche sehen in ihr einen Schädling, andere einen unverzichtbaren Helfer der Wissenschaft.
30/31.08.2025
- Wer nachts in einem stillen Haus plötzlich ein leises Trippeln hört, ahnt oft schon, wer zu Besuch ist: die Hausmaus (Mus musculus).
Sie ist winzig, unscheinbar und doch eines der erfolgreichsten Säugetiere der Welt. Seit Jahrtausenden begleitet sie den Menschen, hat sich an unsere Vorräte, unsere Wärme und unsere Häuser angepasst. Manche sehen in ihr einen Schädling, andere einen unverzichtbaren Helfer der Wissenschaft.
Doch was macht die Hausmaus so besonders?
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- Hausmaus (Mus musculus)
Artenschutz in Franken®
Die Schwarze Wegameise – Kleine Helfer im Garten

Die Schwarze Wegameise – Kleine Helfer im Garten
29/30.08.2025
Ein Leben im Ameisenstaat
Eine Ameisenkolonie ist wie eine große Familie. In der Mitte lebt die Königin, die viele Jahre alt werden kann und Eier legt. Um sie herum kümmern sich tausende Arbeiterinnen. Sie bauen das Nest, pflegen die Larven und gehen auf Nahrungssuche. Jede Ameise hat ihre Aufgabe – so klappt das Zusammenleben perfekt.
29/30.08.2025
- Fast jeder kennt sie: die Schwarze Wegameise. Man sieht sie oft auf Wegen, im Rasen oder zwischen Pflastersteinen. Aber wenn man genauer hinschaut, entdeckt man, wie spannend diese kleinen Tiere wirklich sind!
Ein Leben im Ameisenstaat
Eine Ameisenkolonie ist wie eine große Familie. In der Mitte lebt die Königin, die viele Jahre alt werden kann und Eier legt. Um sie herum kümmern sich tausende Arbeiterinnen. Sie bauen das Nest, pflegen die Larven und gehen auf Nahrungssuche. Jede Ameise hat ihre Aufgabe – so klappt das Zusammenleben perfekt.
Ameisenstraßen – der Highway der Insekten
Wenn die Ameisen eine Futterquelle finden, etwa einen heruntergefallenen Apfel, teilen sie das den anderen mit. Sie legen eine Duftspur und schon bald folgen viele andere Arbeiterinnen. So entsteht eine richtige Ameisenstraße – ein reger Verkehr zwischen Nest und Futterstelle.
Was Ameisen gerne fressen
Damit versorgen sie sich selbst und ihre Larven.
Warum Ameisen wichtig sind
Die Schwarze Wegameise ist kein „Ungeziefer“, sondern ein wichtiger Teil der Natur:
Fazit
Auch wenn sie manchmal im Haus lästig sein kann – im Garten sind Schwarze Wegameisen fleißige Helfer. Ihre Ameisenstraßen und ihr geschäftiges Treiben zeigen, wie gut Teamarbeit in der Natur funktioniert.
Wenn die Ameisen eine Futterquelle finden, etwa einen heruntergefallenen Apfel, teilen sie das den anderen mit. Sie legen eine Duftspur und schon bald folgen viele andere Arbeiterinnen. So entsteht eine richtige Ameisenstraße – ein reger Verkehr zwischen Nest und Futterstelle.
- In unserer Aufnahmen könnt ihr das besonders gut sehen: lange Ameisenstraßen führen direkt zu den süßen Äpfeln am Boden.
Was Ameisen gerne fressen
- Süße Sachen wie Honigtau von Blattläusen oder Obst
- Kleine Insekten oder Reste von toten Tieren
- Pflanzensäfte und Nektar
Damit versorgen sie sich selbst und ihre Larven.
Warum Ameisen wichtig sind
Die Schwarze Wegameise ist kein „Ungeziefer“, sondern ein wichtiger Teil der Natur:
- Sie lockert den Boden und macht ihn fruchtbar.
- Sie räumt Abfälle und tote Insekten weg.
- Sie dient vielen Vögeln und anderen Tieren als Nahrung.
Fazit
Auch wenn sie manchmal im Haus lästig sein kann – im Garten sind Schwarze Wegameisen fleißige Helfer. Ihre Ameisenstraßen und ihr geschäftiges Treiben zeigen, wie gut Teamarbeit in der Natur funktioniert.
Artenschutz in Franken®
Wildbienen schützen – Ihr Garten als Paradies für Bestäuber

Wildbienen schützen – Ihr Garten als Paradies für Bestäuber
28/29.08.2025
Leider sind viele Wildbienenarten bedroht – durch den Verlust von Lebensräumen, den Einsatz von Pestiziden und die zunehmende Verarmung unserer Landschaft.
Die gute Nachricht: Jede*r kann etwas tun! Schon kleine Maßnahmen im eigenen Garten, auf dem Balkon oder sogar am Firmenstandort machen einen großen Unterschied.
28/29.08.2025
- Wildbienen sind wahre Helden der Natur. Während Honigbienen meist im Mittelpunkt stehen, leisten Wildbienen einen stillen, aber unschätzbaren Beitrag: Sie bestäuben Obstbäume, Wildblumen und Gemüsepflanzen und sichern damit unsere Ernährung und die Vielfalt unserer Landschaft.
Leider sind viele Wildbienenarten bedroht – durch den Verlust von Lebensräumen, den Einsatz von Pestiziden und die zunehmende Verarmung unserer Landschaft.
Die gute Nachricht: Jede*r kann etwas tun! Schon kleine Maßnahmen im eigenen Garten, auf dem Balkon oder sogar am Firmenstandort machen einen großen Unterschied.
Das Sandarium – ein unterschätztes Zuhause für Wildbienen
Wussten Sie, dass etwa drei Viertel aller Wildbienenarten ihre Nester im Boden anlegen? Für sie ist ein Sandarium der perfekte Lebensraum.
Ein Sandarium ist eine sonnige, offene Sandfläche mit lockerem Substrat, in die Wildbienen ihre Brutröhren graben können. Ideal ist eine geschützte Ecke im Garten, die nicht bepflanzt oder betreten wird. Schon ein Bereich von wenigen Quadratmetern reicht aus, um bodennistenden Arten ein Zuhause zu bieten.
Tipp: Achten Sie auf eine Südausrichtung, vermeiden Sie Beschattung und verwenden Sie ungewaschenen Sand in verschiedenen Körnungen.
Bitte beachte Sie unbedingt: Das auch staatenbildende Insekten hier ihre Brutplätze anlegen können, was an ungeeigneten Standorten zum Problem werden kann. Deshalb die regionalen Gegebenheiten unbedingt vor der Anlage intensiv prüfen und bei Unsicherheiten darauf verzichten!
Professionelle Wildbienenhotels – Qualität zahlt sich aus
Neben bodennistenden Arten gibt es viele Wildbienen, die Hohlräume bevorzugen. Für sie sind Wildbienenhotels ideal. Allerdings gilt hier: Qualität statt Quantität. Viele vielfach günstige Insektenhotels sehen hübsch aus, sind aber oft ungeeignet: zu große Öffnungen, scharfe Kanten oder ungeeignete Materialien können den Tieren sogar schaden.
Ein professionelles Wildbienenhotel hingegen bietet u.a.:
Empfehlung: Platzieren Sie das Hotel sonnig, wind- und regengeschützt in Südrichtung. Beobachten Sie schon bald das faszinierende Treiben, wenn Wildbienen einziehen!
Ein insektenfreundlicher Garten – Nahrung und Vielfalt
Lebensräume allein reichen nicht – Wildbienen brauchen auch Nahrung. Ein insektenfreundlicher Garten ist bunt, vielfältig und naturnah.
So schaffen Sie ein Paradies für Bestäuber:
Tipp für Unternehmen: Auch auf Firmengeländen können blühende Wiesen, Nisthilfen und Sandarien einen wertvollen Beitrag leisten – und gleichzeitig als Aushängeschild für Nachhaltigkeit dienen.
Gemeinsam für mehr Artenvielfalt
Jeder angelegte Quadratmeter, jedes Wildbienenhotel und jedes Sandarium zählt. Wenn viele Menschen kleine Schritte gehen, entsteht daraus eine große Wirkung. Wildbienen danken es mit ihrer unermüdlichen Arbeit als Bestäuber – und Sie dürfen sich über einen lebendigen, blühenden Garten freuen.
Fazit: Mit einfachen Mitteln können wir alle zum Schutz der Wildbienen beitragen. Ein Sandarium, ein hochwertiges Wildbienenhotel und ein insektenfreundlicher Garten sind der Schlüssel zu mehr Artenvielfalt – und zu einem lebendigeren Zuhause für Mensch und Natur.
Aufnahme von Mario Will
Wussten Sie, dass etwa drei Viertel aller Wildbienenarten ihre Nester im Boden anlegen? Für sie ist ein Sandarium der perfekte Lebensraum.
Ein Sandarium ist eine sonnige, offene Sandfläche mit lockerem Substrat, in die Wildbienen ihre Brutröhren graben können. Ideal ist eine geschützte Ecke im Garten, die nicht bepflanzt oder betreten wird. Schon ein Bereich von wenigen Quadratmetern reicht aus, um bodennistenden Arten ein Zuhause zu bieten.
Tipp: Achten Sie auf eine Südausrichtung, vermeiden Sie Beschattung und verwenden Sie ungewaschenen Sand in verschiedenen Körnungen.
Bitte beachte Sie unbedingt: Das auch staatenbildende Insekten hier ihre Brutplätze anlegen können, was an ungeeigneten Standorten zum Problem werden kann. Deshalb die regionalen Gegebenheiten unbedingt vor der Anlage intensiv prüfen und bei Unsicherheiten darauf verzichten!
Professionelle Wildbienenhotels – Qualität zahlt sich aus
Neben bodennistenden Arten gibt es viele Wildbienen, die Hohlräume bevorzugen. Für sie sind Wildbienenhotels ideal. Allerdings gilt hier: Qualität statt Quantität. Viele vielfach günstige Insektenhotels sehen hübsch aus, sind aber oft ungeeignet: zu große Öffnungen, scharfe Kanten oder ungeeignete Materialien können den Tieren sogar schaden.
Ein professionelles Wildbienenhotel hingegen bietet u.a.:
- Saubere, glatte Bohrungen in verschiedenen Durchmessern (3–9 mm).
- Naturmaterialien wie Hartholz, Schilfrohr oder Bambus.
- Witterungsschutz durch ein stabiles Dach und wetterfeste Bauweise.
Empfehlung: Platzieren Sie das Hotel sonnig, wind- und regengeschützt in Südrichtung. Beobachten Sie schon bald das faszinierende Treiben, wenn Wildbienen einziehen!
Ein insektenfreundlicher Garten – Nahrung und Vielfalt
Lebensräume allein reichen nicht – Wildbienen brauchen auch Nahrung. Ein insektenfreundlicher Garten ist bunt, vielfältig und naturnah.
So schaffen Sie ein Paradies für Bestäuber:
- Pflanzen Sie ungefüllte Blütenpflanzen wie Wildrosen, Lavendel oder Kornblumen.
- Nutzen Sie regionales, zertifiziertes Saatgut, um heimische Arten zu fördern.
- Schaffen Sie Strukturen wie Totholz, Trockenmauern oder kleine Wasserstellen.
- Lassen Sie Ecken im Garten „wild“ – Brennnesseln, Disteln ... sind wichtige Futterpflanzen.
- Verzichten Sie konsequent auf Pestizide und chemische Dünger.
Tipp für Unternehmen: Auch auf Firmengeländen können blühende Wiesen, Nisthilfen und Sandarien einen wertvollen Beitrag leisten – und gleichzeitig als Aushängeschild für Nachhaltigkeit dienen.
Gemeinsam für mehr Artenvielfalt
Jeder angelegte Quadratmeter, jedes Wildbienenhotel und jedes Sandarium zählt. Wenn viele Menschen kleine Schritte gehen, entsteht daraus eine große Wirkung. Wildbienen danken es mit ihrer unermüdlichen Arbeit als Bestäuber – und Sie dürfen sich über einen lebendigen, blühenden Garten freuen.
Fazit: Mit einfachen Mitteln können wir alle zum Schutz der Wildbienen beitragen. Ein Sandarium, ein hochwertiges Wildbienenhotel und ein insektenfreundlicher Garten sind der Schlüssel zu mehr Artenvielfalt – und zu einem lebendigeren Zuhause für Mensch und Natur.
Aufnahme von Mario Will
- Anlage eines Insektenschutzelements
Artenschutz in Franken®
Ein besonderer Moment in der Dämmerung

Ein besonderer Moment in der Dämmerung
27/28.08.2025
Beim genaueren Hinsehen fiel etwas auf: Die Augen sowohl des Jungvogels als auch der fütternden Drossel wirkten, als seien sie für einen Moment blind. Der Grund dafür ist die Nickhaut, eine zusätzliche Schutzmembran, die sich kurz über das Auge legt.
27/28.08.2025
- Zu Beginn der Dämmerung spielte sich ein berührendes Schauspiel ab: Eine Drossel fütterte ihr Junges. Obwohl der kleine Vogel bereits flügge war, ließ er sich das Futter noch gerne von der Mutter servieren – schließlich ist das bequemer, als selbst auf die Suche zu gehen.
Beim genaueren Hinsehen fiel etwas auf: Die Augen sowohl des Jungvogels als auch der fütternden Drossel wirkten, als seien sie für einen Moment blind. Der Grund dafür ist die Nickhaut, eine zusätzliche Schutzmembran, die sich kurz über das Auge legt.
Die Nickhaut – ein natürlicher Augenschutz
Die Nickhaut ist eine dünne, durchsichtige Schicht, die viele Tierarten besitzen – darunter Vögel, Katzen, Hunde und sogar Fische. Sie funktioniert wie eine Art "Scheibenwischer" fürs Auge:
Auch wir Menschen tragen Überreste dieser faszinierenden Einrichtung in uns: Im inneren Augenwinkel ist die rudimentäre Form der Nickhaut noch erkennbar. Anders als Tiere können wir sie jedoch nicht aktiv nutzen und müssen uns auf das Schließen der Augenlider verlassen.
Fazit
Die kleine Szene zwischen Drossel und Jungvogel zeigt nicht nur die Fürsorge im Tierreich, sondern auch, wie raffiniert die Natur ihre Geschöpfe ausgestattet hat. Ein unscheinbares Detail wie die Nickhaut kann im Alltag den entscheidenden Unterschied machen – zwischen verletztem und geschütztem Auge.
Aufnahme von Bernhard Schmalsich
Die Nickhaut ist eine dünne, durchsichtige Schicht, die viele Tierarten besitzen – darunter Vögel, Katzen, Hunde und sogar Fische. Sie funktioniert wie eine Art "Scheibenwischer" fürs Auge:
- Schutz vor Verletzungen beim Füttern, Jagen oder Fliegen
- Befeuchtung des Auges, ohne dass das Tier die Sicht verliert
- Durchlässigkeit für Licht, sodass die Tiere trotz Schutz noch erkennen, was um sie herum geschieht
Auch wir Menschen tragen Überreste dieser faszinierenden Einrichtung in uns: Im inneren Augenwinkel ist die rudimentäre Form der Nickhaut noch erkennbar. Anders als Tiere können wir sie jedoch nicht aktiv nutzen und müssen uns auf das Schließen der Augenlider verlassen.
Fazit
Die kleine Szene zwischen Drossel und Jungvogel zeigt nicht nur die Fürsorge im Tierreich, sondern auch, wie raffiniert die Natur ihre Geschöpfe ausgestattet hat. Ein unscheinbares Detail wie die Nickhaut kann im Alltag den entscheidenden Unterschied machen – zwischen verletztem und geschütztem Auge.
Aufnahme von Bernhard Schmalsich
Artenschutz in Franken®
Mauersegler retten – eine bewegende Geschichte aus dem Alltag

Mauersegler retten – eine bewegende Geschichte aus dem Alltag
26/27.08.2025
Bayern. An einem warmen Sommernachmittag wurde an der Fassade einer Schule ein hilfloser Vogel entdeckt. Zunächst sah es aus wie ein dunkler Schatten an der Wand – doch schnell erkannten die aufmerksamen Passanten, dass es sich um einen Mauersegler (Apus apus) handelte. Dieser faszinierende Zugvogel, der sein Leben fast ausschließlich in der Luft verbringt, war in großer Gefahr:
26/27.08.2025
- Ein dramatischer Fund an einer Schulmauer
Bayern. An einem warmen Sommernachmittag wurde an der Fassade einer Schule ein hilfloser Vogel entdeckt. Zunächst sah es aus wie ein dunkler Schatten an der Wand – doch schnell erkannten die aufmerksamen Passanten, dass es sich um einen Mauersegler (Apus apus) handelte. Dieser faszinierende Zugvogel, der sein Leben fast ausschließlich in der Luft verbringt, war in großer Gefahr:
- Ein Stück Nylongarn hatte sich um seinen Körper gewickelt und ihn an der Wand festgehalten. Für einen Mauersegler ist das lebensbedrohlich, denn er kann nur starten, wenn er frei in die Luft gleiten kann. Ohne Hilfe wäre er verendet.
Die Rettung – kleine Tat mit großer Wirkung
Die Finder zögerten nicht. Mit ruhiger Hand und viel Geduld lösten sie das dünne Garn Stück für Stück, bis der Vogel endlich befreit war. Noch geschwächt verharrte er kurz, dann regte er seine Flügel, stieß sich ab – und erhob sich in den Himmel.
Ein bewegender Moment: Der Mauersegler, eben noch gefangen und hilflos, zog nun wieder seine Kreise über den Dächern. Diese kleine Rettung zeigt, wie sehr Aufmerksamkeit und Mitgefühl das Leben eines Wildtieres verändern können.
Die Art Mauersegler – Flugkünstler der Lüfte
Der Mauersegler gehört zu den beeindruckendsten Vogelarten Europas. Er wird oft mit Schwalben verwechselt, ist jedoch nicht mit ihnen verwandt. Seine Lebensweise ist einzigartig:
Warum Vogelschutz und Achtsamkeit so wichtig sind
Die Rettungsgeschichte des Mauerseglers ist mehr als ein glücklicher Einzelfall. Sie erinnert uns daran, wie wichtig Naturschutz im Alltag ist. Kunststoffreste, Angelschnüre oder Nylongarn sollten niemals achtlos in die Natur gelangen – für viele Tiere können sie zur tödlichen Falle werden. Gleichzeitig zeigt sie, dass Tierhilfe nicht kompliziert sein muss. Ein kurzer Blick nach oben, ein achtsamer Moment, ein beherztes Eingreifen – und schon ist ein Leben gerettet.
Fazit – gemeinsam für den Schutz der Mauersegler
Der Mauersegler ist ein Symbol für Freiheit, Leichtigkeit und den Rhythmus der Jahreszeiten. Damit er auch in Zukunft unseren Himmel durchzieht, braucht es Aufmerksamkeit, Hilfsbereitschaft und die Bereitschaft, seinen Lebensraum zu schützen.
Jeder von uns kann dazu beitragen: durch umsichtiges Handeln, durch den Erhalt von Nistplätzen an Gebäuden – und manchmal einfach durch das Aufheben eines Fadens vom Boden.
In der Aufnahme von Mario Will
Die Finder zögerten nicht. Mit ruhiger Hand und viel Geduld lösten sie das dünne Garn Stück für Stück, bis der Vogel endlich befreit war. Noch geschwächt verharrte er kurz, dann regte er seine Flügel, stieß sich ab – und erhob sich in den Himmel.
Ein bewegender Moment: Der Mauersegler, eben noch gefangen und hilflos, zog nun wieder seine Kreise über den Dächern. Diese kleine Rettung zeigt, wie sehr Aufmerksamkeit und Mitgefühl das Leben eines Wildtieres verändern können.
Die Art Mauersegler – Flugkünstler der Lüfte
Der Mauersegler gehört zu den beeindruckendsten Vogelarten Europas. Er wird oft mit Schwalben verwechselt, ist jedoch nicht mit ihnen verwandt. Seine Lebensweise ist einzigartig:
- Leben in der Luft: Bis zu zehn Monate im Jahr verbringen Mauersegler ununterbrochen im Flug – sie schlafen, trinken, jagen und paaren sich dort.
- Nahrung: Ihre Beute besteht aus kleinsten Insekten, die sie im Flug fangen.
- Nistplätze: Während der Brutzeit suchen sie Nischen in Mauern, Dachspalten oder Gebäudefassaden.
- Zugverhalten: Jeden Herbst reisen sie in ihre Winterquartiere nach Afrika, bevor sie im Frühjahr zurückkehren.
- Gefährdung: Sanierungen an Gebäuden nehmen ihnen oft Nistmöglichkeiten, hinzu kommen Gefahren wie Plastikabfälle oder Nylonfäden.
Warum Vogelschutz und Achtsamkeit so wichtig sind
Die Rettungsgeschichte des Mauerseglers ist mehr als ein glücklicher Einzelfall. Sie erinnert uns daran, wie wichtig Naturschutz im Alltag ist. Kunststoffreste, Angelschnüre oder Nylongarn sollten niemals achtlos in die Natur gelangen – für viele Tiere können sie zur tödlichen Falle werden. Gleichzeitig zeigt sie, dass Tierhilfe nicht kompliziert sein muss. Ein kurzer Blick nach oben, ein achtsamer Moment, ein beherztes Eingreifen – und schon ist ein Leben gerettet.
Fazit – gemeinsam für den Schutz der Mauersegler
Der Mauersegler ist ein Symbol für Freiheit, Leichtigkeit und den Rhythmus der Jahreszeiten. Damit er auch in Zukunft unseren Himmel durchzieht, braucht es Aufmerksamkeit, Hilfsbereitschaft und die Bereitschaft, seinen Lebensraum zu schützen.
Jeder von uns kann dazu beitragen: durch umsichtiges Handeln, durch den Erhalt von Nistplätzen an Gebäuden – und manchmal einfach durch das Aufheben eines Fadens vom Boden.
In der Aufnahme von Mario Will
- Mauersegler gefangen mit einem Fuß in einem Nylonfaden an der Schulmauer
Artenschutz in Franken®
Die Breite Fliegengrabwespe (Ectemnius lituratus)

Die Breite Fliegengrabwespe (Ectemnius lituratus)
25/26.08.2025
Die Breite Fliegengrabwespe (Ectemnius lituratus) gehört zu den solitären Wespenarten und spielt eine wichtige Rolle im ökologischen Gleichgewicht.
25/26.08.2025
- Ein nützlicher Jäger im Garten
Die Breite Fliegengrabwespe (Ectemnius lituratus) gehört zu den solitären Wespenarten und spielt eine wichtige Rolle im ökologischen Gleichgewicht.
Während die erwachsenen Tiere Blüten besuchen und als Bestäuber wirken, versorgen die Weibchen ihre Larven mit einer beeindruckenden Anzahl an Fliegen. So leisten sie ganz nebenbei einen wertvollen Beitrag zur natürlichen Regulierung von Insektenbeständen.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- Breite Fliegengrabwespe im August 2025
Artenschutz in Franken®
Europäische Gottesanbeterin erstmals in Bergheim nachgewiesen

Europäische Gottesanbeterin erstmals in Bergheim nachgewiesen
24/25.08.2025
Ein Bürger meldete das große Insekt, das an seiner Hauswand saß, an Naturschutzberater Rolf Thiemann vom Naturtreff Bedburg . Dieser bestätigte den Fund und ordnete das Tier als streng geschützte europäische Fangschrecke ein.
24/25.08.2025
- Im Rhein-Erft-Kreis häufen sich derzeit die Meldungen über Funde der Europäischen Gottesanbeterin (Mantis religiosa). Nun wurde erstmals auch in Bergheim ein Tier entdeckt.
Ein Bürger meldete das große Insekt, das an seiner Hauswand saß, an Naturschutzberater Rolf Thiemann vom Naturtreff Bedburg . Dieser bestätigte den Fund und ordnete das Tier als streng geschützte europäische Fangschrecke ein.
Herkunft und Verbreitung
Die Gottesanbeterin stammt ursprünglich aus dem Mittelmeerraum. In den letzten Jahren breitet sie sich zunehmend nach Norden aus. Begünstigt wird diese Entwicklung durch die Klimaerwärmung. In Nordrhein-Westfalen werden seit einigen Jahren vermehrt Nachweise gemeldet.
Merkmale und Lebensweise
Die Haltung der Fangarme erinnert an eine Gebetsgeste – daher rührt der Name „Gottesanbeterin“. Tatsächlich handelt es sich jedoch um einen Lauerjäger, der seine Beute lebend verspeist.
Bedeutung für den Rhein-Erft-Kreis
Die Entdeckung in Bergheim ist der erste Nachweis dieser Art im Stadtgebiet. Insgesamt wurden dem Naturschutzberater in diesem Jahr bereits mehrere Sichtungen aus dem Rhein-Erft-Kreis gemeldet.
Meldung von Funden
Um die weitere Ausbreitung der Gottesanbeterin im Rhein-Erft-Kreis zu dokumentieren, sind Bürgerinnen und Bürger gebeten, Beobachtungen zu melden. Jede Meldung hilft dabei, die Entwicklung der Population wissenschaftlich zu begleiten.
In der Aufnahme von Willy Nußbaum
Die Gottesanbeterin stammt ursprünglich aus dem Mittelmeerraum. In den letzten Jahren breitet sie sich zunehmend nach Norden aus. Begünstigt wird diese Entwicklung durch die Klimaerwärmung. In Nordrhein-Westfalen werden seit einigen Jahren vermehrt Nachweise gemeldet.
Merkmale und Lebensweise
- Größe: bis zu 8 cm
- Färbung: grün oder braun, gute Tarnung in Vegetation
- Ernährung: jagt Insekten mit speziellen Fangarmen, die in Millisekunden zuschnappen
- Fortpflanzung: Weibchen legen bis zu 200 Eier in einer schützenden Schaummasse ab, die den Winter überdauert
- Lebenserwartung: bis zu 12 Monate
Die Haltung der Fangarme erinnert an eine Gebetsgeste – daher rührt der Name „Gottesanbeterin“. Tatsächlich handelt es sich jedoch um einen Lauerjäger, der seine Beute lebend verspeist.
Bedeutung für den Rhein-Erft-Kreis
Die Entdeckung in Bergheim ist der erste Nachweis dieser Art im Stadtgebiet. Insgesamt wurden dem Naturschutzberater in diesem Jahr bereits mehrere Sichtungen aus dem Rhein-Erft-Kreis gemeldet.
Meldung von Funden
Um die weitere Ausbreitung der Gottesanbeterin im Rhein-Erft-Kreis zu dokumentieren, sind Bürgerinnen und Bürger gebeten, Beobachtungen zu melden. Jede Meldung hilft dabei, die Entwicklung der Population wissenschaftlich zu begleiten.
In der Aufnahme von Willy Nußbaum
- Europäische Gottesanbeterin (Mantis religiosa)
Artenschutz in Franken®
Waldbäche im Klimawandel – bedrohte Lebensadern der Natur

Waldbäche im Klimawandel – bedrohte Lebensadern der Natur
23/24.08.2025
Waldbäche zählen zu den sensibelsten und zugleich wichtigsten Strukturelementen unserer Landschaft. Sie fungieren als lineare Biotopverbundachsen, die unterschiedliche Lebensräume miteinander vernetzen. Sie sind Rückzugs- und Brutraum für Amphibien, Insekten und Fische. Sie schaffen kühle, feuchte Mikrohabitate für Moose, Farne und zahlreiche weitere Arten.
Waldbäche sind damit ökologische Schlüsselstrukturen, ohne die ganze Lebensgemeinschaften nicht bestehen können.
Ein Phänomen mit Signalwirkung: Wenn Waldbäche versiegen
23/24.08.2025
- Was macht Waldbäche so wertvoll?
Waldbäche zählen zu den sensibelsten und zugleich wichtigsten Strukturelementen unserer Landschaft. Sie fungieren als lineare Biotopverbundachsen, die unterschiedliche Lebensräume miteinander vernetzen. Sie sind Rückzugs- und Brutraum für Amphibien, Insekten und Fische. Sie schaffen kühle, feuchte Mikrohabitate für Moose, Farne und zahlreiche weitere Arten.
Waldbäche sind damit ökologische Schlüsselstrukturen, ohne die ganze Lebensgemeinschaften nicht bestehen können.
Ein Phänomen mit Signalwirkung: Wenn Waldbäche versiegen
Noch vor wenigen Jahrzehnten schien es unvorstellbar: Waldbäche, die seit Menschengedenken beständig Wasser führten, fallen heute erstmals trocken.
Die Ursachen:
Selbst sogenannte perennierende Fließgewässer – Bäche, die normalerweise ganzjährig Wasser führen – sind inzwischen betroffen.
Folgen für die Ökosysteme
Das Austrocknen hat gravierende Konsequenzen:
Waldbäche sind nicht nur kleine Rinnsale – sie sind unverzichtbare Funktionsräume der Natur.
Warum Wasserentnahmen besonders schädlich sind
Das Abpumpen / Entnahme von Wasser zur Feld- , Gartenbewässerung etc. entzieht einem ohnehin geschwächten System die letzte Lebensgrundlage. Wird die Restwasserführung unterschritten, bricht die ökologische Funktionsfähigkeit zusammen.
Aus diesem Grund ist in vielen Bundesländern die Wasserentnahme aus Oberflächengewässern ohne Genehmigung streng untersagt. Diese Regelungen dienen nicht der Bürokratie, sondern dem Schutz eines Systems, dessen Belastungsgrenzen längst erreicht sind.
Ein bedenklicher Blick in die Zukunft
Wenn die aktuellen Entwicklungen anhalten, müssen wir künftig mit einer deutlichen Verschärfung der Niedrigwasserdynamik rechnen:
Es droht eine ökologische Kipppunkt-Dynamik: Wenn die Quell- und Oberläufe verschwinden, setzt sich der Schaden flussabwärts fort. Die Folgen reichen von unterbrochenen Stoffkreisläufen über den Rückgang der Trinkwasserressourcen bis hin zum Verlust natürlicher Kühlung in heißen Sommern.
Wenn wir jetzt nicht handeln, könnten Waldbäche in wenigen Generationen verschwunden sein – und mit ihnen ein unersetzlicher Teil unserer natürlichen Lebensgrundlage.
Unsere Verantwortung
Der Schutz von Waldbächen ist mehr als Naturschutz. Er ist eine Investition in unsere Zukunft – für stabile Ökosysteme, gesunde Wälder, sauberes Wasser und eine lebenswerte Umwelt für kommende Generationen.
In der Aufnahme
Die Ursachen:
- Klimawandel mit verlängerten Hitze- und Dürreperioden
- steigende Verdunstungsraten (Evapotranspiration)
- rückläufige Grundwasserneubildung
Selbst sogenannte perennierende Fließgewässer – Bäche, die normalerweise ganzjährig Wasser führen – sind inzwischen betroffen.
Folgen für die Ökosysteme
Das Austrocknen hat gravierende Konsequenzen:
- Unterbrechung des hydrologischen Kontinuums: Wandernde Fischarten und Kleinstlebewesen im Sediment (Makrozoobenthos) verlieren ihre Lebensräume.
- Zusammenbruch der Habitatdiversität: Kiesbänke, Totholzstrukturen und beschattete Uferbereiche verlieren ihre Funktion als Refugien.
- Schwächung der Selbstreinigungskraft der Gewässer und Störungen im Nährstoffkreislauf.
Waldbäche sind nicht nur kleine Rinnsale – sie sind unverzichtbare Funktionsräume der Natur.
Warum Wasserentnahmen besonders schädlich sind
Das Abpumpen / Entnahme von Wasser zur Feld- , Gartenbewässerung etc. entzieht einem ohnehin geschwächten System die letzte Lebensgrundlage. Wird die Restwasserführung unterschritten, bricht die ökologische Funktionsfähigkeit zusammen.
Aus diesem Grund ist in vielen Bundesländern die Wasserentnahme aus Oberflächengewässern ohne Genehmigung streng untersagt. Diese Regelungen dienen nicht der Bürokratie, sondern dem Schutz eines Systems, dessen Belastungsgrenzen längst erreicht sind.
Ein bedenklicher Blick in die Zukunft
Wenn die aktuellen Entwicklungen anhalten, müssen wir künftig mit einer deutlichen Verschärfung der Niedrigwasserdynamik rechnen:
- Zunehmend längere Austrocknungsphasen
- geringere Resilienz der Bäche
- Verlust ganzer Lebensgemeinschaften
Es droht eine ökologische Kipppunkt-Dynamik: Wenn die Quell- und Oberläufe verschwinden, setzt sich der Schaden flussabwärts fort. Die Folgen reichen von unterbrochenen Stoffkreisläufen über den Rückgang der Trinkwasserressourcen bis hin zum Verlust natürlicher Kühlung in heißen Sommern.
Wenn wir jetzt nicht handeln, könnten Waldbäche in wenigen Generationen verschwunden sein – und mit ihnen ein unersetzlicher Teil unserer natürlichen Lebensgrundlage.
Unsere Verantwortung
Der Schutz von Waldbächen ist mehr als Naturschutz. Er ist eine Investition in unsere Zukunft – für stabile Ökosysteme, gesunde Wälder, sauberes Wasser und eine lebenswerte Umwelt für kommende Generationen.
- Waldbäche sind ein Schatz. Ihre Bewahrung ist nicht optional, sondern Pflicht.
In der Aufnahme
- „Trocken gefallen: Ein Waldbach verliert durch Klimawandel und Wasserentnahmen seine ökologische Funktion als Lebensraum.“
Artenschutz in Franken®
Warum kleine Feldstreifen nicht reichen – und was wirklich nötig ist

Warum kleine Feldstreifen nicht reichen – und was wirklich nötig ist
22/23.08.2025
Doch so wichtig diese Maßnahmen als Symbol sind – für den echten Schutz unserer Artenvielfalt reichen sie nicht aus.
22/23.08.2025
- Auf den ersten Blick scheinen die schmalen Streifen zwischen landwirtschaftlichen Flächen eine einfache Lösung: ein bisschen Blütenpracht am Feldrand, Rückzugsmöglichkeiten für Insekten und vielleicht ein Lebensraum für Vögel oder Kleinsäuger.
Doch so wichtig diese Maßnahmen als Symbol sind – für den echten Schutz unserer Artenvielfalt reichen sie nicht aus.
Inseln im Meer der Monokulturen
Die meisten dieser Streifen sind nur wenige Meter (wenn überhaupt) breit und bleiben damit ökologische „Inseln“. Für Arten, die wandernde Populationen bilden oder große, zusammenhängende Lebensräume brauchen, sind sie nahezu bedeutungslos. Ohne Anbindung an andere Biotope verarmen sie schnell – und können dem Artenrückgang kaum etwas entgegensetzen.
Belastet statt geschützt
Hinzu kommt, dass viele Feldstreifen unter starkem Druck stehen: Pestizid- und Düngemittelabdrift, Befahrung durch Maschinen oder Mahd zur falschen Zeit machen sie für zahlreiche Arten unbrauchbar. Was auf den ersten Blick wie ein Beitrag zur Biodiversität wirkt, ist oft in Wirklichkeit eine belastete Restfläche ohne echte ökologische Funktion.
Fehlende Vielfalt
Ein gesunder Lebensraum lebt von Strukturen – von Hecken, Feuchtstellen, Wildkrautflächen und Rückzugsorten. Ein schmaler Streifen bietet all das nicht. Er bleibt monoton, artenarm und zerbrechlich. Der Klimawandel verschärft diese Schwäche zusätzlich: Trockenheit oder Extremregen lassen die ohnehin kleinen Flächen schnell kippen.
Was wirklich hilft
Für einen wirksamen Artenschutz braucht es mehr als symbolische Streifen. Notwendig sind:
Was Sie tun können
Auch Sie können dazu beitragen, dass unsere Landschaft wieder lebensfreundlicher wird:
Jede Handlung zählt. Kleine Streifen sind ein Anfang – doch nur gemeinsam können wir daraus ein starkes Netz lebendiger Lebensräume machen. Helfen Sie mit, dass unsere Felder nicht zu stillen Monokulturen verarmen, sondern wieder summen, zirpen und leben.
In der Aufnahme
Die meisten dieser Streifen sind nur wenige Meter (wenn überhaupt) breit und bleiben damit ökologische „Inseln“. Für Arten, die wandernde Populationen bilden oder große, zusammenhängende Lebensräume brauchen, sind sie nahezu bedeutungslos. Ohne Anbindung an andere Biotope verarmen sie schnell – und können dem Artenrückgang kaum etwas entgegensetzen.
Belastet statt geschützt
Hinzu kommt, dass viele Feldstreifen unter starkem Druck stehen: Pestizid- und Düngemittelabdrift, Befahrung durch Maschinen oder Mahd zur falschen Zeit machen sie für zahlreiche Arten unbrauchbar. Was auf den ersten Blick wie ein Beitrag zur Biodiversität wirkt, ist oft in Wirklichkeit eine belastete Restfläche ohne echte ökologische Funktion.
Fehlende Vielfalt
Ein gesunder Lebensraum lebt von Strukturen – von Hecken, Feuchtstellen, Wildkrautflächen und Rückzugsorten. Ein schmaler Streifen bietet all das nicht. Er bleibt monoton, artenarm und zerbrechlich. Der Klimawandel verschärft diese Schwäche zusätzlich: Trockenheit oder Extremregen lassen die ohnehin kleinen Flächen schnell kippen.
Was wirklich hilft
Für einen wirksamen Artenschutz braucht es mehr als symbolische Streifen. Notwendig sind:
- Breite, zusammenhängende Lebensräume die nicht regelmäßig gestört werden.
- Vernetzte Biotopstrukturen, damit Tiere wandern und Populationen stabil bleiben können.
- Extensiv bewirtschaftete Flächen, die auf chemische Belastungen verzichten.
- Hecken, Feuchtstellen und Brachen, die echte Vielfalt und Rückzugsräume schaffen.
Was Sie tun können
Auch Sie können dazu beitragen, dass unsere Landschaft wieder lebensfreundlicher wird:
- Unterstützen Sie landwirtschaftliche Betriebe, die auf nachhaltige, naturnahe Methoden setzen.
- Machen Sie bei regionalen Projekten zum Schutz von Hecken, Feldrainen und Blühflächen mit.
- Bringen Sie das Thema ins Gespräch – in Ihrer Gemeinde, in Vereinen oder im Freundeskreis.
- Nutzen Sie Ihre Stimme: fordern Sie politische Entscheidungen, die echten Naturschutz vor Alibi-Maßnahmen stellen.
Jede Handlung zählt. Kleine Streifen sind ein Anfang – doch nur gemeinsam können wir daraus ein starkes Netz lebendiger Lebensräume machen. Helfen Sie mit, dass unsere Felder nicht zu stillen Monokulturen verarmen, sondern wieder summen, zirpen und leben.
In der Aufnahme
- so wird das nichts mit dem Artenschutz und hier retten wir sicherlich auch keine Biene - ein Streifchen zwischen intensiv bewirtschafteten landwirtschaftlichen Flächen.
Artenschutz in Franken®
Wenn das leise Leben im Wald verstummt ...

Wenn das leise Leben im Wald verstummt – die gefährdete Zukunft unserer Hüpferlinge
21/22.08.2025
Doch ein anderer, unscheinbarer Teil dieses Waldes gerät allzu leicht in Vergessenheit: die kleinsten Bewohner, unsere Amphibienkinder – winzige Frösche, Kröten und Molche, die als „Hüpferlinge“ ihre ersten zaghaften Sprünge ins Leben wagen.
21/22.08.2025
- Wer an einen Sommerwald denkt, hat meist das Rauschen der Blätter, den Duft von Erde und Harz oder das Vogelgezwitscher vor Augen.
Doch ein anderer, unscheinbarer Teil dieses Waldes gerät allzu leicht in Vergessenheit: die kleinsten Bewohner, unsere Amphibienkinder – winzige Frösche, Kröten und Molche, die als „Hüpferlinge“ ihre ersten zaghaften Sprünge ins Leben wagen.
Für sie ist der Wald kein romantisches Bild, sondern Überlebensraum. Jeder Tümpel, jede feuchte Senke ist ein Kinderzimmer, jede Schattenstelle ein Schutzraum. In diesen Wochen verlassen unzählige junge Amphibien das Wasser und beginnen ihre Wanderung ins Land. Was für sie eine kurze und doch entscheidende Etappe ist, wird für uns oft unsichtbar.
Und gerade diese Unsichtbarkeit macht ihre Lage so gefährlich.
Denn gleichzeitig, während die Hüpferlinge unterwegs sind, rollen schwere Maschinen durch unsere Wälder. Die Entnahme von sogenanntem Schadholz ist vielerorts notwendig – um Sturmschäden zu beseitigen, Borkenkäferbefall einzudämmen oder Wege zu sichern. Doch aus Sicht der winzigen Amphibien bedeutet diese Arbeit einen regelrechten Ausnahmezustand.
Eine Forststraße, die für uns nur ein paar Meter Fahrspur bedeutet, ist für ein kaum daumennagelgroßes Lebewesen ein schier endloser Weg. Jeder Reifen, der über die frisch entstandenen Rückegassen rollt, kann hunderte Tiere in einem Augenblick auslöschen.
Nicht sichtbar, nicht hörbar, und doch ein Massensterben in Stille.
Und selbst dort, wo die Maschinen schon längst weitergezogen sind, bleibt Gefahr zurück. Tiefe Fahrspuren verwandeln sich bei Regen in kleine Wasserflächen – verlockend für die winzigen Hüpferlinge, doch in Wahrheit tödliche Fallen: sie trocknen rasch aus oder bieten keinen Ausweg mehr. Aufgerissene Böden verlieren die Feuchtigkeit, die für Amphibien überlebenswichtig ist. Wo einst feuchte Schatten herrschten, finden die Tiere nur trockene, lebensfeindliche Erde.
Über all dem liegt der lange Schatten des Klimawandels. Längere Hitzeperioden lassen die Laichgewässer immer häufiger schon vorzeitig austrocknen. Extreme Regenfälle hingegen spülen die Jungtiere fort oder zerstören ihre empfindlichen Lebensräume. Das Zeitfenster, in dem die Verwandlung vom Kaulquappenstadium zum Landtier gelingt, schrumpft – und mit ihm die Überlebenschancen ganzer Generationen.
So geraten die Hüpferlinge in eine doppelte Zange: Auf der einen Seite der Druck durch forstwirtschaftliche Maßnahmen, auf der anderen Seite die Folgen der Klimakrise.
Sie haben keine Stimme, sie machen sich nicht bemerkbar, sie leiden und sterben im Stillen.
Doch wer genau hinsieht, erkennt: Mit jedem verlorenen Hüpferling geht mehr verloren als nur ein kleines Tier. Amphibien sind unersetzliche Glieder in den Kreisläufen der Natur. Sie fressen Insekten, dienen Vögeln und Säugetieren als Nahrung und sind sensible Indikatoren für die Gesundheit unserer Ökosysteme. Stirbt ihre nächste Generation, verlieren wir nicht nur Artenvielfalt, sondern auch das stille Gleichgewicht des Waldes.
Es liegt in unserer Verantwortung, Wege zu finden, wie Waldpflege und Amphibienschutz zusammengehen können. Schon kleine Veränderungen – etwa eine zeitliche Verschiebung der Holzernte, Rücksichtnahme auf bekannte Laichgebiete oder das Offenhalten von Feuchtstellen – können den Unterschied machen zwischen Leben und Sterben.
Der Wald ist nicht nur Rohstoffquelle. Er ist Lebensraum, Schutzraum und Zukunftsraum – auch für die Kleinsten, die wir kaum sehen. Wenn wir wollen, dass auch kommende Generationen noch das geheimnisvolle Quaken, Zirpen und Plätschern unserer Amphibien erleben können, dann dürfen wir ihr leises Leben nicht länger übersehen.
Die Hüpferlinge brauchen uns – jetzt!
Unsere Wälder sind nicht nur Orte der Erholung und Holzquelle – sie sind auch Kinderstube für unzählige Amphibien. Gerade jetzt, wenn die winzigen Hüpferlinge ihre ersten Schritte ins Leben wagen, sind sie so verletzlich wie nie. Und gerade jetzt treffen die Holzernte, die Aufarbeitung von Schadholz und die Folgen des Klimawandels auf ihre empfindliche Lebensphase.
Die Realität ist erschütternd:
- Jeder Maschinenzug durch Rückegassen kann tausende Tiere das Leben kosten.
- Fahrspuren werden zu tödlichen Fallen – zunächst Wasserlöcher, dann rasch vertrocknete Gruben.
- Trockenperioden lassen Laichgewässer verschwinden, noch bevor die nächste Generation überleben kann.
Das alles geschieht leise, unsichtbar – und doch mit weitreichenden Folgen. Mit jedem Hüpferling, der stirbt, verliert unser Wald ein Stück seines Gleichgewichts. Amphibien sind unverzichtbare Bindeglieder im Netz des Lebens: Sie halten Insektenpopulationen im Zaum, dienen selbst als Nahrung und zeigen uns die Gesundheit unserer Ökosysteme an.
Darum unser Appell:
An die Forstwirtschaft: Achtet bei der Planung der Holzernte auf die Wanderzeiten und Lebensräume der Amphibien. Schon wenige Wochen Rücksicht können unzählige Leben retten.
An die Gemeinden und Behörden: Schafft klare Regelungen, die Amphibienschutz und Waldnutzung zusammenbringen – nicht als Gegensätze, sondern als gemeinsame Aufgabe.
An alle, die den Wald nutzen: Seid aufmerksam! Bleibt auf Wegen, meidet frisch angelegte Rückegassen und schützt die kleinen Tiere, wo immer es möglich ist.
Die Hüpferlinge haben keine Stimme. Doch wir können ihnen unsere leihen. Wir können den Unterschied machen – zwischen einem Wald, der verstummt, und einem Wald, in dem auch in Zukunft das leise Quaken und Rascheln der Amphibien zu hören ist.
Schützen wir sie. Jetzt. Gemeinsam.
In der Aufnahme
- In einer Collage sind die Gefährungen der Hüpferlinge vereint abgebildet
Artenschutz in Franken®
Langsam zum Ziel – Die Weinbergschnecke (Helix pomatia)

Langsam zum Ziel – Die Weinbergschnecke (Helix pomatia)
20/21.08.2025
Die Weinbergschnecke, eine der größten in Mitteleuropa vorkommenden Landlungenschnecken, ist ein Meister der Ruhe und Beständigkeit. Mit Hilfe ihres kräftigen, muskulösen Fußes und einer dünnen Schleimspur erklimmt sie selbst ungewohnte Wege – wie diesen Ast, der ihr eine neue Perspektive auf ihre Umgebung eröffnet.
20/21.08.2025
- Gemächlich zieht sie ihre Bahn, das Gehäuse wie ein kleines, spiralförmiges Haus stets auf dem Rücken.
Die Weinbergschnecke, eine der größten in Mitteleuropa vorkommenden Landlungenschnecken, ist ein Meister der Ruhe und Beständigkeit. Mit Hilfe ihres kräftigen, muskulösen Fußes und einer dünnen Schleimspur erklimmt sie selbst ungewohnte Wege – wie diesen Ast, der ihr eine neue Perspektive auf ihre Umgebung eröffnet.
Erkennungsmerkmale:
Die Weinbergschnecke erreicht eine Gehäusebreite von bis zu fünf Zentimetern. Ihre kalkige, meist hellbraun bis cremefarbene Schale trägt drei bis fünf deutlich sichtbare Windungen. Die Fühler auf ihrem Kopf sind beweglich; an den längeren sitzen die Augen, während die kürzeren als Tast- und Riechorgane dienen.
Lebensweise:
Helix pomatia bevorzugt kalkhaltige, feuchte Lebensräume wie Waldränder, Wiesen und Gärten. Sie ist überwiegend dämmerungs- und nachtaktiv, nutzt jedoch feuchte Tage auch für ausgedehnte Erkundungstouren. Ihre Ernährung besteht vorwiegend aus welken Pflanzenteilen, Blättern und Kräutern – sie spielt somit eine wichtige Rolle beim Abbau organischer Substanz.
Besonderheiten:
Die Weinbergschnecke ist Zwitter, kann also sowohl männliche als auch weibliche Keimzellen produzieren. Bei der Fortpflanzung kommt es zu einem bemerkenswerten Ritual: Beide Partner durchbohren einander mit einem sogenannten Liebespfeil – ein kalkiges Gebilde, das vermutlich hormonelle Effekte hat und die Befruchtungschancen steigert.
Schutzstatus:
In Deutschland steht die Weinbergschnecke unter besonderem Schutz (§ 44 BNatSchG). Sie darf weder gesammelt noch getötet werden, da ihre Bestände regional zurückgegangen sind.
In der Aufnahme
Die Weinbergschnecke erreicht eine Gehäusebreite von bis zu fünf Zentimetern. Ihre kalkige, meist hellbraun bis cremefarbene Schale trägt drei bis fünf deutlich sichtbare Windungen. Die Fühler auf ihrem Kopf sind beweglich; an den längeren sitzen die Augen, während die kürzeren als Tast- und Riechorgane dienen.
Lebensweise:
Helix pomatia bevorzugt kalkhaltige, feuchte Lebensräume wie Waldränder, Wiesen und Gärten. Sie ist überwiegend dämmerungs- und nachtaktiv, nutzt jedoch feuchte Tage auch für ausgedehnte Erkundungstouren. Ihre Ernährung besteht vorwiegend aus welken Pflanzenteilen, Blättern und Kräutern – sie spielt somit eine wichtige Rolle beim Abbau organischer Substanz.
Besonderheiten:
Die Weinbergschnecke ist Zwitter, kann also sowohl männliche als auch weibliche Keimzellen produzieren. Bei der Fortpflanzung kommt es zu einem bemerkenswerten Ritual: Beide Partner durchbohren einander mit einem sogenannten Liebespfeil – ein kalkiges Gebilde, das vermutlich hormonelle Effekte hat und die Befruchtungschancen steigert.
Schutzstatus:
In Deutschland steht die Weinbergschnecke unter besonderem Schutz (§ 44 BNatSchG). Sie darf weder gesammelt noch getötet werden, da ihre Bestände regional zurückgegangen sind.
In der Aufnahme
- Während sie den Halm hinaufgleitet, lässt sich erahnen, wie anpassungsfähig und zugleich verletzlich dieses Tier ist – ein stiller Bewohner unserer Kulturlandschaft, dessen Weg vielleicht langsam erscheint, aber stets zielgerichtet ist.
Artenschutz in Franken®
Die Tänzerin am Wasser – Blaue Federlibelle (Platycnemis pennipes)

Die Tänzerin am Wasser – Blaue Federlibelle (Platycnemis pennipes)
19/20.08.2025
Über dem Ufer eines sanft strömenden Flusses schwebt ein leuchtender Punkt, kaum größer als ein Streichholz – die Blaue Federlibelle. Mit jeder Landung auf einem Grashalm scheint sie eine unsichtbare Partitur zu tanzen, präzise und doch schwerelos.
19/20.08.2025
- An einem windstillen Junitag, wenn die Sonne das Schilf in goldenes Licht taucht, beginnt das Schauspiel.
Über dem Ufer eines sanft strömenden Flusses schwebt ein leuchtender Punkt, kaum größer als ein Streichholz – die Blaue Federlibelle. Mit jeder Landung auf einem Grashalm scheint sie eine unsichtbare Partitur zu tanzen, präzise und doch schwerelos.
Morphologie und Erkennungsmerkmale
Platycnemis pennipes gehört zur Familie der Platycnemididae, einer Gruppe der Kleinlibellen (Zygoptera). Ihre Körperlänge beträgt in der Regel 33–36 mm, die Flügelspannweite rund 45 mm. Das Männchen ist durch seine blassblaue Grundfärbung und die hellen Antehumeralstreifen am Thorax charakterisiert. Auffällig sind die stark verbreiterten Tibien der Hinter- und Mittelbeine, die wie feine „Federbüschel“ wirken – daher der deutsche Name. Diese Strukturen sind nicht behaart, sondern bestehen aus flachen, blattartigen Chitinplatten, die im Sonnenlicht silbrig schimmern.
Die Weibchen zeigen meist ein hellbeiges bis olivbraunes Farbkleid, oft mit schwacher Blaufärbung. Bei beiden Geschlechtern sind die Flügel durchsichtig, mit einer deutlich erkennbaren Pterostigma-Zeichnung nahe der Flügelspitze.
Lebensraum und Habitatbindung
Die Blaue Federlibelle ist stenotop in ihrer Habitatwahl – sie bevorzugt naturnahe, langsam fließende Fließgewässer, Altarme und ufernahe Vegetationszonen. Entscheidende Faktoren sind eine reich strukturierte Ufervegetation, geringe Strömungsgeschwindigkeit und sauberes, nährstoffarmes bis mäßig nährstoffreiches Wasser.
Lebenszyklus und Entwicklung
Der Entwicklungszyklus ist hemimetabol, also ohne vollständige Verwandlung wie bei Schmetterlingen. Aus den von den Weibchen ins Wasser oder an Unterwasserpflanzen abgelegten Eiern schlüpfen nach wenigen Wochen die aquatischen Larven (Nymphen). Diese sind Räuber und ernähren sich von Kleinkrebsen, Insektenlarven und anderen kleinen Wirbellosen.
Die Larvalentwicklung dauert meist ein Jahr, kann in kälteren Gewässern auch zwei Jahre betragen. Das Emergieren – das Schlüpfen des fertigen Imaginaltieres – erfolgt zwischen Mai und August. Dabei klettern die Larven an Halme oder Uferpflanzen, sprengen ihre Larvenhülle (Exuvie) auf und entlassen die flugfähige Libelle.
Verhalten und Ernährung
Die Imagines (erwachsenen Tiere) ernähren sich vor allem von kleinen Fluginsekten wie Mücken (Culicidae), Zuckmücken (Chironomidae) oder Blattläusen (Aphidoidea). Sie sind Ansitzjäger und nutzen die Sonnenwärme für ihre Thermoregulation. Die breite Tibienform wird in der Balz als optisches Signal eingesetzt: Männchen präsentieren im Flug ihre „Federbeine“, um Weibchen anzulocken und Konkurrenten zu beeindrucken.
Ökologische Bedeutung
Die Blaue Federlibelle ist ein sensibler Bioindikator. Ihre Anwesenheit deutet auf ein gut strukturiertes, ökologisch intaktes Gewässer hin. Verschmutzung, Uferverbau oder Verlandung führen rasch zum Rückgang der Population.
Gefährdung und Schutz
In Deutschland gilt die Art derzeit nicht als stark gefährdet, ist jedoch regional rückläufig. Bedrohungen gehen vor allem von Lebensraumverlust, intensiver Gewässerunterhaltung und Klimaveränderungen aus. Schutzmaßnahmen umfassen die Erhaltung naturnaher Fließgewässer, die Förderung von Röhricht- und Ufervegetation sowie das Unterlassen von Gewässerausbaumaßnahmen während der Flugzeit.
Faszination am Ufer
Wer Platycnemis pennipes beobachtet, erkennt schnell, warum sie zu den poetischsten Erscheinungen an unseren Gewässern zählt. Ihre Flügel vibrieren im Sonnenlicht wie hauchdünnes Glas, die breiten „Federbeine“ wirken wie zarte Ornamente – ein Insekt, das nicht nur ein Rädchen im ökologischen Getriebe ist, sondern auch ein Botschafter für die Schönheit intakter Gewässerlandschaften.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
Platycnemis pennipes gehört zur Familie der Platycnemididae, einer Gruppe der Kleinlibellen (Zygoptera). Ihre Körperlänge beträgt in der Regel 33–36 mm, die Flügelspannweite rund 45 mm. Das Männchen ist durch seine blassblaue Grundfärbung und die hellen Antehumeralstreifen am Thorax charakterisiert. Auffällig sind die stark verbreiterten Tibien der Hinter- und Mittelbeine, die wie feine „Federbüschel“ wirken – daher der deutsche Name. Diese Strukturen sind nicht behaart, sondern bestehen aus flachen, blattartigen Chitinplatten, die im Sonnenlicht silbrig schimmern.
Die Weibchen zeigen meist ein hellbeiges bis olivbraunes Farbkleid, oft mit schwacher Blaufärbung. Bei beiden Geschlechtern sind die Flügel durchsichtig, mit einer deutlich erkennbaren Pterostigma-Zeichnung nahe der Flügelspitze.
Lebensraum und Habitatbindung
Die Blaue Federlibelle ist stenotop in ihrer Habitatwahl – sie bevorzugt naturnahe, langsam fließende Fließgewässer, Altarme und ufernahe Vegetationszonen. Entscheidende Faktoren sind eine reich strukturierte Ufervegetation, geringe Strömungsgeschwindigkeit und sauberes, nährstoffarmes bis mäßig nährstoffreiches Wasser.
Lebenszyklus und Entwicklung
Der Entwicklungszyklus ist hemimetabol, also ohne vollständige Verwandlung wie bei Schmetterlingen. Aus den von den Weibchen ins Wasser oder an Unterwasserpflanzen abgelegten Eiern schlüpfen nach wenigen Wochen die aquatischen Larven (Nymphen). Diese sind Räuber und ernähren sich von Kleinkrebsen, Insektenlarven und anderen kleinen Wirbellosen.
Die Larvalentwicklung dauert meist ein Jahr, kann in kälteren Gewässern auch zwei Jahre betragen. Das Emergieren – das Schlüpfen des fertigen Imaginaltieres – erfolgt zwischen Mai und August. Dabei klettern die Larven an Halme oder Uferpflanzen, sprengen ihre Larvenhülle (Exuvie) auf und entlassen die flugfähige Libelle.
Verhalten und Ernährung
Die Imagines (erwachsenen Tiere) ernähren sich vor allem von kleinen Fluginsekten wie Mücken (Culicidae), Zuckmücken (Chironomidae) oder Blattläusen (Aphidoidea). Sie sind Ansitzjäger und nutzen die Sonnenwärme für ihre Thermoregulation. Die breite Tibienform wird in der Balz als optisches Signal eingesetzt: Männchen präsentieren im Flug ihre „Federbeine“, um Weibchen anzulocken und Konkurrenten zu beeindrucken.
Ökologische Bedeutung
Die Blaue Federlibelle ist ein sensibler Bioindikator. Ihre Anwesenheit deutet auf ein gut strukturiertes, ökologisch intaktes Gewässer hin. Verschmutzung, Uferverbau oder Verlandung führen rasch zum Rückgang der Population.
Gefährdung und Schutz
In Deutschland gilt die Art derzeit nicht als stark gefährdet, ist jedoch regional rückläufig. Bedrohungen gehen vor allem von Lebensraumverlust, intensiver Gewässerunterhaltung und Klimaveränderungen aus. Schutzmaßnahmen umfassen die Erhaltung naturnaher Fließgewässer, die Förderung von Röhricht- und Ufervegetation sowie das Unterlassen von Gewässerausbaumaßnahmen während der Flugzeit.
Faszination am Ufer
Wer Platycnemis pennipes beobachtet, erkennt schnell, warum sie zu den poetischsten Erscheinungen an unseren Gewässern zählt. Ihre Flügel vibrieren im Sonnenlicht wie hauchdünnes Glas, die breiten „Federbeine“ wirken wie zarte Ornamente – ein Insekt, das nicht nur ein Rädchen im ökologischen Getriebe ist, sondern auch ein Botschafter für die Schönheit intakter Gewässerlandschaften.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- Das Männchen ist durch seine blassblaue Grundfärbung und die hellen Antehumeralstreifen am Thorax charakterisiert.
Artenschutz in Franken®
Wenn Trockenheit und Hitze zur tödlichen Gefahr werden

Amphibien in Not – Wenn Trockenheit und Hitze zur tödlichen Gefahr werden
18/19.08.2025
Besonders Amphibien, die auf feuchte Lebensräume und Gewässer angewiesen sind, geraten zunehmend in Bedrängnis.
Ein besonders eindrückliches Beispiel ist der Europäische Laubfrosch (Hyla arborea).
18/19.08.2025
- In den letzten Jahren haben sich die Sommer in Deutschland spürbar verändert: lange Hitzeperioden, ausbleibender Regen und sinkende Grundwasserstände setzen nicht nur der Vegetation, sondern auch vielen Tierarten massiv zu.
Besonders Amphibien, die auf feuchte Lebensräume und Gewässer angewiesen sind, geraten zunehmend in Bedrängnis.
Ein besonders eindrückliches Beispiel ist der Europäische Laubfrosch (Hyla arborea).
Dieser kleine, leuchtend grüne Kletterkünstler lebt normalerweise in strukturreichen Feuchtgebieten, an Teichrändern oder in feuchten Wiesen. Hier findet er nicht nur Nahrung, sondern auch die für seine Haut überlebenswichtige Feuchtigkeit. Doch in Zeiten anhaltender Trockenheit verschwinden viele dieser Lebensräume.
Auf der verzweifelten Suche nach Wasser kann es den Laubfrosch bis in die Nähe des Menschen verschlagen – etwa zu Regentonnen in Gärten. Was zunächst nach einer willkommenen Rettung aussieht, entpuppt sich jedoch häufig als tödliche Falle: Die glatten, senkrechten Innenwände der Tonne lassen keinen Halt zu. Ein einmal hineingesprungener oder hineingefallener Frosch kann nicht mehr herausklettern und verendet oft qualvoll durch Erschöpfung oder Ertrinken.
Dieses Schicksal ereilte auch einen Laubfrosch in einem deutschen Garten während der Hitzewelle: Auf der Suche nach Wasser kletterte er an den Rand einer halb gefüllten Regentonne. Er glitt hinein, doch der rettende Rückweg war unmöglich – die Tonnenwand war zu glatt, der Wasserstand zu niedrig. Ohne menschliches Eingreifen endete seine Suche nach Wasser tragisch.
Wie wir helfen können:
Naturnahe Teiche oder Feuchtbiotope anlegen, um dauerhafte Rückzugsorte zu schaffen.
Der Schutz unserer Amphibien erfordert oft nur kleine, einfache Maßnahmen – doch sie können über Leben und Tod entscheiden. Gerade in Zeiten von Klimawandel und Extremwetter liegt es in unserer Verantwortung, den Tieren sichere Lebensräume zu erhalten und gefährliche Fallen zu entschärfen.
Artbeschreibung – Europäischer Laubfrosch (Hyla arborea)
Systematik:
Ordnung: Froschlurche (Anura)
Familie: Laubfrösche (Hylidae)
Gattung: Hyla
Art: Hyla arborea
Aussehen:
Der Europäische Laubfrosch ist ein kleiner, schlanker Froschlurch mit einer Körperlänge von meist 3–5 cm. Seine auffällig glatte Haut schimmert in einem intensiven Grün, kann aber je nach Umgebung und Temperatur auch bräunliche oder graue Farbtöne annehmen (metachromatische Hautanpassung). Charakteristisch ist der schmale, dunkle Streifen, der vom Nasenloch über das Auge bis in den Flankenbereich verläuft. Die Bauchseite ist hell und matt.
An den Enden seiner Zehen trägt der Laubfrosch runde Haftscheiben, die ihm das Klettern an glatten Pflanzenstängeln, Zweigen und sogar Glasflächen ermöglichen – eine Anpassung, die ihn von vielen anderen heimischen Amphibien unterscheidet.
Lebensraum:
Hyla arborea bevorzugt warme, strukturreiche Landschaften mit einer Kombination aus stehenden Gewässern (Laichplätze) und umliegenden Hecken, Gebüschen oder Feuchtwiesen. Besonders wohl fühlt er sich an besonnten Teichen, Gräben oder Altwassern mit reicher Ufervegetation.
Verbreitung:
In Deutschland ist der Europäische Laubfrosch vor allem in wärmebegünstigten Regionen zu finden – etwa im Rheintal, in Teilen Norddeutschlands und im Osten bis Brandenburg und Sachsen. In vielen Gebieten ist er jedoch selten geworden.
Fortpflanzung:
Die Paarungszeit beginnt meist im April, wenn die Wassertemperatur über 10 °C liegt. Männchen locken mit einer lauten, metallisch klingenden Balzrufe, die durch eine auffällige Kehl-Schallblase verstärkt werden und oft schon aus hunderten Metern Entfernung zu hören sind. Die Weibchen legen mehrere Laichballen mit insgesamt bis zu 1.000 Eiern an Pflanzen im Flachwasser ab.
Ernährung:
Der Laubfrosch ist ein opportunistischer Insektenjäger. Er erbeutet Mücken, Fliegen, Käfer und andere kleine Gliederfüßer, die er mit seiner klebrigen Zunge blitzschnell erfasst.
Gefährdung:
Der Europäische Laubfrosch steht in Deutschland auf der Vorwarnliste bzw. in einigen Bundesländern sogar auf der Roten Liste gefährdeter Arten. Hauptbedrohungen sind der Verlust von Laichgewässern, die Zerschneidung von Lebensräumen und klimabedingte Trockenperioden. Auch ökologische Fallen wie ungesicherte Regentonnen stellen ein Risiko dar.
Besonderes:
Dank seiner Haftscheiben und seines ausgeprägten Kletterverhaltens wird der Laubfrosch oft als „kleiner Akrobat“ unter den Amphibien bezeichnet. Sein lauter Ruf kündigt in ländlichen Regionen oft den Beginn lauer Sommernächte an.
In der Aufnahme von V. Greb
Auf der verzweifelten Suche nach Wasser kann es den Laubfrosch bis in die Nähe des Menschen verschlagen – etwa zu Regentonnen in Gärten. Was zunächst nach einer willkommenen Rettung aussieht, entpuppt sich jedoch häufig als tödliche Falle: Die glatten, senkrechten Innenwände der Tonne lassen keinen Halt zu. Ein einmal hineingesprungener oder hineingefallener Frosch kann nicht mehr herausklettern und verendet oft qualvoll durch Erschöpfung oder Ertrinken.
Dieses Schicksal ereilte auch einen Laubfrosch in einem deutschen Garten während der Hitzewelle: Auf der Suche nach Wasser kletterte er an den Rand einer halb gefüllten Regentonne. Er glitt hinein, doch der rettende Rückweg war unmöglich – die Tonnenwand war zu glatt, der Wasserstand zu niedrig. Ohne menschliches Eingreifen endete seine Suche nach Wasser tragisch.
Wie wir helfen können:
- Regentonnen mit feinmaschigen Netzen oder festen Deckeln sichern.
- Kleine „Rampen“ oder Holzleisten in Wasserbehältern anbringen, damit Tiere wieder herausgelangen können.
- In heißen Sommern flache, schattige Wasserschalen im Garten bereitstellen.
Naturnahe Teiche oder Feuchtbiotope anlegen, um dauerhafte Rückzugsorte zu schaffen.
Der Schutz unserer Amphibien erfordert oft nur kleine, einfache Maßnahmen – doch sie können über Leben und Tod entscheiden. Gerade in Zeiten von Klimawandel und Extremwetter liegt es in unserer Verantwortung, den Tieren sichere Lebensräume zu erhalten und gefährliche Fallen zu entschärfen.
Artbeschreibung – Europäischer Laubfrosch (Hyla arborea)
Systematik:
Ordnung: Froschlurche (Anura)
Familie: Laubfrösche (Hylidae)
Gattung: Hyla
Art: Hyla arborea
Aussehen:
Der Europäische Laubfrosch ist ein kleiner, schlanker Froschlurch mit einer Körperlänge von meist 3–5 cm. Seine auffällig glatte Haut schimmert in einem intensiven Grün, kann aber je nach Umgebung und Temperatur auch bräunliche oder graue Farbtöne annehmen (metachromatische Hautanpassung). Charakteristisch ist der schmale, dunkle Streifen, der vom Nasenloch über das Auge bis in den Flankenbereich verläuft. Die Bauchseite ist hell und matt.
An den Enden seiner Zehen trägt der Laubfrosch runde Haftscheiben, die ihm das Klettern an glatten Pflanzenstängeln, Zweigen und sogar Glasflächen ermöglichen – eine Anpassung, die ihn von vielen anderen heimischen Amphibien unterscheidet.
Lebensraum:
Hyla arborea bevorzugt warme, strukturreiche Landschaften mit einer Kombination aus stehenden Gewässern (Laichplätze) und umliegenden Hecken, Gebüschen oder Feuchtwiesen. Besonders wohl fühlt er sich an besonnten Teichen, Gräben oder Altwassern mit reicher Ufervegetation.
Verbreitung:
In Deutschland ist der Europäische Laubfrosch vor allem in wärmebegünstigten Regionen zu finden – etwa im Rheintal, in Teilen Norddeutschlands und im Osten bis Brandenburg und Sachsen. In vielen Gebieten ist er jedoch selten geworden.
Fortpflanzung:
Die Paarungszeit beginnt meist im April, wenn die Wassertemperatur über 10 °C liegt. Männchen locken mit einer lauten, metallisch klingenden Balzrufe, die durch eine auffällige Kehl-Schallblase verstärkt werden und oft schon aus hunderten Metern Entfernung zu hören sind. Die Weibchen legen mehrere Laichballen mit insgesamt bis zu 1.000 Eiern an Pflanzen im Flachwasser ab.
Ernährung:
Der Laubfrosch ist ein opportunistischer Insektenjäger. Er erbeutet Mücken, Fliegen, Käfer und andere kleine Gliederfüßer, die er mit seiner klebrigen Zunge blitzschnell erfasst.
Gefährdung:
Der Europäische Laubfrosch steht in Deutschland auf der Vorwarnliste bzw. in einigen Bundesländern sogar auf der Roten Liste gefährdeter Arten. Hauptbedrohungen sind der Verlust von Laichgewässern, die Zerschneidung von Lebensräumen und klimabedingte Trockenperioden. Auch ökologische Fallen wie ungesicherte Regentonnen stellen ein Risiko dar.
Besonderes:
Dank seiner Haftscheiben und seines ausgeprägten Kletterverhaltens wird der Laubfrosch oft als „kleiner Akrobat“ unter den Amphibien bezeichnet. Sein lauter Ruf kündigt in ländlichen Regionen oft den Beginn lauer Sommernächte an.
In der Aufnahme von V. Greb
- „Europäischer Laubfrosch (Hyla arborea) in Not – nach einem Sturz in eine Regenrinne kämpft er ums Überleben. Ungesicherte Wasser- und Entwässerungsanlagen werden für viele Amphibien zur tödlichen Falle.“
Artenschutz in Franken®
Architekt der Lebensräume und Garant für biologische Vielfalt ...

Das Wildschwein (Sus scrofa) – Architekt der Lebensräume und Garant für biologische Vielfalt
17/18.08.2025
Doch hinter diesem Bild verbirgt sich ein hochkomplexer Akteur im Ökosystem, dessen Verhalten und ökologische Funktionen für den Erhalt der Biodiversität von unschätzbarem Wert sind.
17/18.08.2025
- Oft wird das Wildschwein lediglich als kräftiger Waldbewohner oder landwirtschaftlicher Schadverursacher wahrgenommen.
Doch hinter diesem Bild verbirgt sich ein hochkomplexer Akteur im Ökosystem, dessen Verhalten und ökologische Funktionen für den Erhalt der Biodiversität von unschätzbarem Wert sind.
Als sogenannter Ökosystemingenieur gestaltet das Wildschwein seine Umgebung aktiv um. Mit seiner kräftigen Schnauze und dem ausgeprägten Wühltrieb lockert es den Oberboden, durchmischt organisches Material und schafft eine mosaikartige Mikrostruktur. Diese Bodenbearbeitung führt zu einer verbesserten Bodendurchlüftung und begünstigt den Abbau organischer Substanz, wodurch Nährstoffe mineralisiert und für Pflanzen verfügbar gemacht werden. Das resultierende Mikrorelief bietet keimfreudigen Pionierarten ideale Bedingungen, insbesondere solchen, die auf Störungen angewiesen sind und in geschlossenen Beständen kaum Chancen hätten.
Auch in der Zoochorie – der Verbreitung von Samen durch Tiere – spielt das Wildschwein eine tragende Rolle. Samen bleiben im Fell haften oder passieren unbeschadet den Verdauungstrakt, sodass sie an neuen Standorten ausgebracht werden. Dieser Prozess trägt nicht nur zur genetischen Durchmischung von Pflanzenpopulationen bei, sondern unterstützt auch die Ausbreitung seltener oder konkurrenzschwacher Arten.
Darüber hinaus profitieren zahlreiche Tierarten direkt oder indirekt von den Aktivitäten des Wildschweins. Aufgewühlte Flächen bieten ein Eldorado für wirbellose Bodenfauna wie Regenwürmer, Käferlarven und Springschwänze. Diese bilden wiederum die Nahrungsgrundlage für spezialisierte Vogelarten, Amphibien und Kleinsäuger. Die oft übersehenen Suhlen – flache, wassergefüllte Mulden, die beim Schlammbad entstehen – entwickeln sich zu temporären Feuchtlebensräumen. Sie werden von Insekten wie Libellen, von Amphibien wie Laubfrosch und Erdkröte sowie von wasserliebenden Pflanzenarten besiedelt und erhöhen so die Habitatvielfalt innerhalb eines Waldbiotops.
Ökologisch betrachtet wirkt das Wildschwein damit als Trittsteinbiotop-Erzeuger: Es schafft kleine, kurzlebige Lebensräume, die in einer zunehmend gleichförmigen Kulturlandschaft besonders wichtig sind. Seine Aktivität unterstützt Sukzessionsprozesse und verhindert die Dominanz einzelner konkurrenzstarker Arten, was zu einer höheren alpha- und beta-Diversität führt.
Die Bedeutung dieser Art reicht weit über den Wald hinaus. Auch in Agrarlandschaften, Feuchtgebieten und Küstenregionen sorgt das Wildschwein durch sein vielseitiges Nahrungsspektrum und seine hohe Mobilität für Stoff- und Energieflüsse zwischen verschiedenen Lebensräumen. So fungiert es als Bindeglied in einem komplexen ökologischen Netzwerk, in dem jede Art – ob groß oder klein – voneinander abhängt.
Trotz seiner manchmal konfliktträchtigen Beziehung zum Menschen ist das Wildschwein damit ein Paradebeispiel für die Notwendigkeit, ökologische Funktionen in der Wildtierbewertung stärker zu berücksichtigen. Wer es versteht, die Rolle des Wildschweins nicht nur durch die Brille wirtschaftlicher Interessen, sondern im Kontext seiner ökosystemaren Dienstleistungen zu sehen, erkennt in ihm einen unersetzlichen Verbündeten im Kampf für den Erhalt unserer biologischen Vielfalt.
In der Aufnahme von Johannes Rother
Auch in der Zoochorie – der Verbreitung von Samen durch Tiere – spielt das Wildschwein eine tragende Rolle. Samen bleiben im Fell haften oder passieren unbeschadet den Verdauungstrakt, sodass sie an neuen Standorten ausgebracht werden. Dieser Prozess trägt nicht nur zur genetischen Durchmischung von Pflanzenpopulationen bei, sondern unterstützt auch die Ausbreitung seltener oder konkurrenzschwacher Arten.
Darüber hinaus profitieren zahlreiche Tierarten direkt oder indirekt von den Aktivitäten des Wildschweins. Aufgewühlte Flächen bieten ein Eldorado für wirbellose Bodenfauna wie Regenwürmer, Käferlarven und Springschwänze. Diese bilden wiederum die Nahrungsgrundlage für spezialisierte Vogelarten, Amphibien und Kleinsäuger. Die oft übersehenen Suhlen – flache, wassergefüllte Mulden, die beim Schlammbad entstehen – entwickeln sich zu temporären Feuchtlebensräumen. Sie werden von Insekten wie Libellen, von Amphibien wie Laubfrosch und Erdkröte sowie von wasserliebenden Pflanzenarten besiedelt und erhöhen so die Habitatvielfalt innerhalb eines Waldbiotops.
Ökologisch betrachtet wirkt das Wildschwein damit als Trittsteinbiotop-Erzeuger: Es schafft kleine, kurzlebige Lebensräume, die in einer zunehmend gleichförmigen Kulturlandschaft besonders wichtig sind. Seine Aktivität unterstützt Sukzessionsprozesse und verhindert die Dominanz einzelner konkurrenzstarker Arten, was zu einer höheren alpha- und beta-Diversität führt.
Die Bedeutung dieser Art reicht weit über den Wald hinaus. Auch in Agrarlandschaften, Feuchtgebieten und Küstenregionen sorgt das Wildschwein durch sein vielseitiges Nahrungsspektrum und seine hohe Mobilität für Stoff- und Energieflüsse zwischen verschiedenen Lebensräumen. So fungiert es als Bindeglied in einem komplexen ökologischen Netzwerk, in dem jede Art – ob groß oder klein – voneinander abhängt.
Trotz seiner manchmal konfliktträchtigen Beziehung zum Menschen ist das Wildschwein damit ein Paradebeispiel für die Notwendigkeit, ökologische Funktionen in der Wildtierbewertung stärker zu berücksichtigen. Wer es versteht, die Rolle des Wildschweins nicht nur durch die Brille wirtschaftlicher Interessen, sondern im Kontext seiner ökosystemaren Dienstleistungen zu sehen, erkennt in ihm einen unersetzlichen Verbündeten im Kampf für den Erhalt unserer biologischen Vielfalt.
In der Aufnahme von Johannes Rother
- „Noch kennt das Wildschwein Jungtier nur den Duft des Waldes und das Spiel im Morgentau – doch was, wenn die Welt ihn bald nur als Plage sieht und nicht mehr als Kind der Natur?“
Artenschutz in Franken®
Stele der Biodiversität® - Oberschwappach

Stele der Biodiversität® - Oberschwappach
17/18.08.2025
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutzes in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. sowie der Gemeinde Knetzgau, das unabhängig von der Deutschen Postcode Lotterie, der Petra und Matthias Hanft-Stiftung für Tier- und Naturschutz und der Steuerkanzlei Bauerfeind aus München unterstützt wird.
Oberschwappach / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen, kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
17/18.08.2025
- Montage der Wildbienenwand abgeschlossen
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutzes in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. sowie der Gemeinde Knetzgau, das unabhängig von der Deutschen Postcode Lotterie, der Petra und Matthias Hanft-Stiftung für Tier- und Naturschutz und der Steuerkanzlei Bauerfeind aus München unterstützt wird.
Oberschwappach / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen, kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
In der Aufnahme
- Am 30.07.2025 wurde die Wildbienenwand und die Infoeinheit installiert.
Artenschutz in Franken®
Haus-Feldwespe (Polistes dominula) – Die filigrane Metallarchitektin

Haus-Feldwespe (Polistes dominula) – Die filigrane Metallarchitektin
15/16.08.2025
Die Haus-Feldwespe, Polistes dominula, ist die elegante Minimalistin unter den Wespen – lange Beine, schlanker Körper, schwarz-gelb gekleidet wie für ein Insekten-Gala-Dinner.
Ursprünglich stammt sie aus dem Mittelmeerraum, doch sie hat längst den Norden erobert – von mediterranen Olivenhainen bis zu deutschen Garagenhöfen. Sie baut ihre Nester aus einer papierartigen Masse, die sie aus zerkauten Holzfasern und Speichel formt. Der Bauprozess wirkt wie eine Mischung aus Recyclingprojekt und Hochbaukunst.
Metall – der unerwartete Lieblingsstandort
15/16.08.2025
- Wer im Sommer im Garten sitzt, bekommt es oft nicht mit: Nur wenige Meter entfernt kann eine kleine, schlanke Wespe gerade an ihrem Meisterwerk arbeiten.
Die Haus-Feldwespe, Polistes dominula, ist die elegante Minimalistin unter den Wespen – lange Beine, schlanker Körper, schwarz-gelb gekleidet wie für ein Insekten-Gala-Dinner.
Ursprünglich stammt sie aus dem Mittelmeerraum, doch sie hat längst den Norden erobert – von mediterranen Olivenhainen bis zu deutschen Garagenhöfen. Sie baut ihre Nester aus einer papierartigen Masse, die sie aus zerkauten Holzfasern und Speichel formt. Der Bauprozess wirkt wie eine Mischung aus Recyclingprojekt und Hochbaukunst.
Metall – der unerwartete Lieblingsstandort
Während andere Insekten Holz, Erde oder Pflanzen bevorzugen, scheint die Haus-Feldwespe ein Faible für Metall entwickelt zu haben. Lampenmasten, Briefkästen, Zäune oder Rollladenkästen werden von ihr regelrecht als „Toplage“ gehandelt.
Metall bietet gleich mehrere Vorteile:
Für die Wespenlarven ist das quasi Luxusausbau mit Heizung und Sicherheitsstandard.
Zwischen Respekt und Toleranz
Viele Menschen denken bei einem Wespennest sofort an Gefahr. Dabei ist die Haus-Feldwespe oft deutlich friedlicher als ihre notorischen Verwandten, die Gemeinen Wespen. Sie hilft sogar im Garten – als Jägerin kleiner Insekten und gelegentliche Bestäuberin.
Solange ihr Nest nicht direkt am Kinderzimmerfenster hängt, spricht viel dafür, den kleinen Architektinnen einfach ihr Mietobjekt zu lassen. Es ist kostenloses Naturfernsehen – und vielleicht sogar eine kleine Lektion in friedlicher Koexistenz.
Ein Augenzwinkern zum Schluss
Man könnte sagen: Die Haus-Feldwespe ist die erste Metallbauträgerin der Tierwelt. Sie hat keine Maklerkosten, keine Baugenehmigung – und doch entstehen kleine Meisterwerke. Also, wenn Sie das nächste Mal am Briefkasten ein Wespennest sehen: Vielleicht nicht gleich an Abriss denken. Schließlich ist es nicht irgendein Nest – es ist ein Designerloft aus Speichel und Holzfasern, gebaut mit Herz und Flügeln.
Metall bietet gleich mehrere Vorteile:
- Stabilität – das Nest hängt sicher
- Wärmespeicher – Sonneneinstrahlung heizt den Bau angenehm auf
- Schutz vor Feuchtigkeit – viele Metallflächen sind regengeschützt
Für die Wespenlarven ist das quasi Luxusausbau mit Heizung und Sicherheitsstandard.
Zwischen Respekt und Toleranz
Viele Menschen denken bei einem Wespennest sofort an Gefahr. Dabei ist die Haus-Feldwespe oft deutlich friedlicher als ihre notorischen Verwandten, die Gemeinen Wespen. Sie hilft sogar im Garten – als Jägerin kleiner Insekten und gelegentliche Bestäuberin.
Solange ihr Nest nicht direkt am Kinderzimmerfenster hängt, spricht viel dafür, den kleinen Architektinnen einfach ihr Mietobjekt zu lassen. Es ist kostenloses Naturfernsehen – und vielleicht sogar eine kleine Lektion in friedlicher Koexistenz.
Ein Augenzwinkern zum Schluss
Man könnte sagen: Die Haus-Feldwespe ist die erste Metallbauträgerin der Tierwelt. Sie hat keine Maklerkosten, keine Baugenehmigung – und doch entstehen kleine Meisterwerke. Also, wenn Sie das nächste Mal am Briefkasten ein Wespennest sehen: Vielleicht nicht gleich an Abriss denken. Schließlich ist es nicht irgendein Nest – es ist ein Designerloft aus Speichel und Holzfasern, gebaut mit Herz und Flügeln.
Artenschutz in Franken®
Artenschutz in Franken®
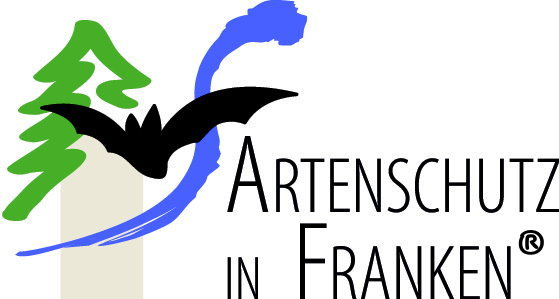
Artenschutz in Franken®
Text ausklappbar...
Artenschutz in Franken®
Aktueller Ordner:
Archiv
Parallele Themen:
2019-11
2019-10
2019-12
2020-01
2020-02
2020-03
2020-04
2020-05
2020-06
2020-07
2020-08
2020-09
2020-10
2020-11
2020-12
2021-01
2021-02
2021-03
2021-04
2021-05
2021-06
2021-07
2021-08
2021-09
2021-10
2021-11
2021-12
2022-01
2022-02
2022-03
2022-04
2022-05
2022-06
2022-07
2022-08
2022-09
2022-10
2022-11
2022-12
2023-01
2023-02
2023-03
2023-04
2023-05
2023-06
2023-07
2023-08
2023-09
2023-10
2023-11
2023-12
2024-01
2024-02
2024-03
2024-04
2024-05
2024-06
2024-07
2024-08
2024-09
2024-10
2024-11
2024-12
2025-01
2025-02
2025-03
2025-04
2025-05
2025-06
2025-07
2025-08
2025-09
2025-10
















