Der Bleichstreuner (Liocranoeca striata) ...

Der Bleichstreuner (Liocranoeca striata) ...
21/22.11.2024
... eine hell gefärbte Art, hier ein Weibchen das 4 - 6 mm lang wird.
Weibchen und Jungtiere sind hell gelbbraun mit kaum ausgeprägter Zeichnung
21/22.11.2024
... eine hell gefärbte Art, hier ein Weibchen das 4 - 6 mm lang wird.
Weibchen und Jungtiere sind hell gelbbraun mit kaum ausgeprägter Zeichnung
Männchen werden als kleiner und dunkler beschrieben Interessant für mich zu sehen wie sich die Spinne auf der Wasseroberfläche bewegt, ohne die die Oberflächenspannung zu durchbrechen.
Aufnahme und Autor Bernhard Schmalisch
Aufnahme und Autor Bernhard Schmalisch
- Weibchen
Artenschutz in Franken®
Luchs Anton ist tot

Luchs Anton ist tot
21/22.11.2024
Der Fundort befand sich etwa 20 Meter entfernt von der Kreisstraße zwischen Arnoldsgrün und Schilbach auf dem angrenzenden Feld. Nach der Daten- und Spurenlage ist er in der Nacht oder am Morgen mit einem LKW kollidiert und erlag später seinen Verletzungen. Das Tier wird am Institut für Zoo- und Wildtierforschung (IZW) Berlin pathologisch untersucht.
21/22.11.2024
- Das etwa anderthalbjährige Luchsmännchen Anton ist heute Vormittag (8. November 2024) in der Nähe von Schöneck im Vogtland tot aufgefunden worden.
Der Fundort befand sich etwa 20 Meter entfernt von der Kreisstraße zwischen Arnoldsgrün und Schilbach auf dem angrenzenden Feld. Nach der Daten- und Spurenlage ist er in der Nacht oder am Morgen mit einem LKW kollidiert und erlag später seinen Verletzungen. Das Tier wird am Institut für Zoo- und Wildtierforschung (IZW) Berlin pathologisch untersucht.
Ein herber Schlag für das Luchsprojekt »ReLynx Sachsen«
Anton wurde am 26. August im Forstbezirk Eibenstock im Westerzgebirge ausgewildert. Bis seine Sendedaten für immer verstummten, hielt er sich vor allem in den Wäldern zwischen Eibenstock und Schöneck auf. Er war gerade dabei, sein eigenes Territorium abzustecken, sammelte zunehmend Jagderfahrung und erbeutete Ende Oktober sein erstes Reh.
Luchse haben sehr große Streifgebiete und müssen zwangsläufig immer wieder Straßen überqueren. Die damit verbundenen Gefahren sind für Wildtiere schwer einzuschätzen. Daher gehören Verkehrsunfälle auch bei Luchsen zu einer der häufigsten Todesursachen.
In der Aufnahme von © Archiv Naturschutz LfULG/ Dirk Schönfelder
Quelle
Sächsische Staatskanzlei
Archivstraße 1
01097 Dresden
Stand
08.11.2024
Anton wurde am 26. August im Forstbezirk Eibenstock im Westerzgebirge ausgewildert. Bis seine Sendedaten für immer verstummten, hielt er sich vor allem in den Wäldern zwischen Eibenstock und Schöneck auf. Er war gerade dabei, sein eigenes Territorium abzustecken, sammelte zunehmend Jagderfahrung und erbeutete Ende Oktober sein erstes Reh.
Luchse haben sehr große Streifgebiete und müssen zwangsläufig immer wieder Straßen überqueren. Die damit verbundenen Gefahren sind für Wildtiere schwer einzuschätzen. Daher gehören Verkehrsunfälle auch bei Luchsen zu einer der häufigsten Todesursachen.
In der Aufnahme von © Archiv Naturschutz LfULG/ Dirk Schönfelder
- Luchs Anton
Quelle
Sächsische Staatskanzlei
Archivstraße 1
01097 Dresden
Stand
08.11.2024
Artenschutz in Franken®
Die Orientzikade (Orientus ishidae)

Hallo, ich bin die Orientzikade (Orientus ishidae), dein neuer, winzig kleiner Nachbar!
21/22.11.2024
Ursprünglich komme ich aus Asien, aber ich habe beschlossen, mir auch in Europa und Nordamerika ein schönes Plätzchen zu suchen. Dank des globalen Handels bin ich quasi ein internationaler Jetsetter – ohne Gepäck, versteht sich.
21/22.11.2024
- Ich bin nur etwa 4 mm groß, aber lass dich von meiner Größe nicht täuschen – ich bin ein echter Weltenbummler!
Ursprünglich komme ich aus Asien, aber ich habe beschlossen, mir auch in Europa und Nordamerika ein schönes Plätzchen zu suchen. Dank des globalen Handels bin ich quasi ein internationaler Jetsetter – ohne Gepäck, versteht sich.
Mein Leben als Orientzikade: Eine Pflanzenparty
Ich liebe Pflanzen, wirklich! Aber nicht nur als hübsche Deko – ich lebe davon. Mit meinem praktischen Saugrüssel schlürfe ich Pflanzensaft direkt aus den Leitungsbahnen der Pflanzen (die heißen Phloem und Xylem, falls du’s genau wissen willst). Aber keine Sorge, ich lasse deine Pflanzen nicht leer laufen – nur ein bisschen angezapft. Ich bin allerdings nicht der größte Held in Sachen „Gute Nachbarschaft“. Manchmal trage ich so fiese Pflanzenerkrankungen mit mir herum, wie zum Beispiel das „Phytoplasma“ – eine Art Pflanzenkrankheit, die die armen Gewächse ganz wirr macht. Ups, mein Fehler!
Meine Hobbys und Superkräfte
Klettern: Egal ob Strauch, Baum oder Weinrebe, ich bin ein hervorragender Kletterer! Mein Ziel ist es, hoch hinauszukommen, um frischen Pflanzensaft zu finden.
Springen: Mit meinen starken Hinterbeinen kann ich richtig weit hüpfen. Manche sagen, ich sei der Michael Jordan unter den Zikaden.
Tarnung: Mit meiner braunen Färbung und den feinen, weißen Streifen sehe ich aus wie ein Stück Baumrinde. Perfekt, um nicht von Vögeln als Snack entdeckt zu werden.
Mein Liebesleben: Ein Sommerflirt
Ich bin ein Sommerkind. In den warmen Monaten suchst du mich am besten in Parks, Gärten oder Weinbergen. Dort triffst du mich auf Blättern, wo ich manchmal mit den Damen meines Lebens „singende“ Vibrationen austausche. Romantisch, oder? Nach einer heißen Sommerromanze legen meine Partnerinnen ihre Eier an Pflanzen ab, wo im nächsten Jahr neue Orientzikaden schlüpfen. Ja, ich denke nachhaltig – ich sorge für die nächste Generation!
Mein Beitrag zum Weltgeschehen
Ich weiß, ich bin nicht der einfachste Gast. Manche Pflanzenfreunde mögen mich nicht so sehr, weil ich mit Krankheiten herumziehe. Und ja, ich bin nicht der Typ, der die Gartenarbeit einfacher macht. Aber hey, ich bin auch ein Teil des Ökosystems – Futter für Vögel, Spinnen und andere hungrige natürliche Beutegreifer.
Fun Fact über mich:
Ich mag Weinberge ganz besonders. Vielleicht weil ich als echte Orientzikade das Flair eines Sommeliers habe? Die verschiedenen Rebsorten schmecken echt interessant, auch wenn ich nicht zwischen „Cabernet Sauvignon“ und „Merlot“ unterscheiden kann.
Ich hoffe, du siehst mich jetzt mit anderen Augen – als kleine, springende Weltbürgerin mit einem Faible für Pflanzen und einem Hauch asiatischen Charmes. Wer weiß, vielleicht treffen wir uns im Garten? Aber keine Sorge, ich bin nicht nachtragend, wenn du mich vom Blatt pusten willst.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
Ich liebe Pflanzen, wirklich! Aber nicht nur als hübsche Deko – ich lebe davon. Mit meinem praktischen Saugrüssel schlürfe ich Pflanzensaft direkt aus den Leitungsbahnen der Pflanzen (die heißen Phloem und Xylem, falls du’s genau wissen willst). Aber keine Sorge, ich lasse deine Pflanzen nicht leer laufen – nur ein bisschen angezapft. Ich bin allerdings nicht der größte Held in Sachen „Gute Nachbarschaft“. Manchmal trage ich so fiese Pflanzenerkrankungen mit mir herum, wie zum Beispiel das „Phytoplasma“ – eine Art Pflanzenkrankheit, die die armen Gewächse ganz wirr macht. Ups, mein Fehler!
Meine Hobbys und Superkräfte
Klettern: Egal ob Strauch, Baum oder Weinrebe, ich bin ein hervorragender Kletterer! Mein Ziel ist es, hoch hinauszukommen, um frischen Pflanzensaft zu finden.
Springen: Mit meinen starken Hinterbeinen kann ich richtig weit hüpfen. Manche sagen, ich sei der Michael Jordan unter den Zikaden.
Tarnung: Mit meiner braunen Färbung und den feinen, weißen Streifen sehe ich aus wie ein Stück Baumrinde. Perfekt, um nicht von Vögeln als Snack entdeckt zu werden.
Mein Liebesleben: Ein Sommerflirt
Ich bin ein Sommerkind. In den warmen Monaten suchst du mich am besten in Parks, Gärten oder Weinbergen. Dort triffst du mich auf Blättern, wo ich manchmal mit den Damen meines Lebens „singende“ Vibrationen austausche. Romantisch, oder? Nach einer heißen Sommerromanze legen meine Partnerinnen ihre Eier an Pflanzen ab, wo im nächsten Jahr neue Orientzikaden schlüpfen. Ja, ich denke nachhaltig – ich sorge für die nächste Generation!
Mein Beitrag zum Weltgeschehen
Ich weiß, ich bin nicht der einfachste Gast. Manche Pflanzenfreunde mögen mich nicht so sehr, weil ich mit Krankheiten herumziehe. Und ja, ich bin nicht der Typ, der die Gartenarbeit einfacher macht. Aber hey, ich bin auch ein Teil des Ökosystems – Futter für Vögel, Spinnen und andere hungrige natürliche Beutegreifer.
Fun Fact über mich:
Ich mag Weinberge ganz besonders. Vielleicht weil ich als echte Orientzikade das Flair eines Sommeliers habe? Die verschiedenen Rebsorten schmecken echt interessant, auch wenn ich nicht zwischen „Cabernet Sauvignon“ und „Merlot“ unterscheiden kann.
Ich hoffe, du siehst mich jetzt mit anderen Augen – als kleine, springende Weltbürgerin mit einem Faible für Pflanzen und einem Hauch asiatischen Charmes. Wer weiß, vielleicht treffen wir uns im Garten? Aber keine Sorge, ich bin nicht nachtragend, wenn du mich vom Blatt pusten willst.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- In Europa wurde die Orientzikade erstmals im Jahr 1998 in Italien gesichtet ... inzwischen ist sie auch im Steigerwald angekommen.
Artenschutz in Franken®
Galläpfel – Naturwunder im Miniaturformat

Galläpfel – Naturwunder im Miniaturformat
20/21.11.2024
Der Baum wird dabei ein bisschen "reingelegt": Die Wespe bringt ihn dazu, eine gallertartige Struktur zu bilden, die wie ein kleiner Apfel aussieht – die Gallapfel. Für die Wespenlarve ist das der perfekte Ort zum Großwerden, quasi ihr eigenes Baum-Airbnb, voll ausgestattet mit Nahrung und Schutz.
20/21.11.2024
- Galläpfel sind kugelige Wucherungen, die von Pflanzen, meistens Eichen, als Reaktion auf bestimmte Insekten – meistens Gallwespen – gebildet werden. Gallwespen sind winzige, clevere Insekten, die ihre Eier in die jungen Knospen oder Blätter der Bäume legen.
Der Baum wird dabei ein bisschen "reingelegt": Die Wespe bringt ihn dazu, eine gallertartige Struktur zu bilden, die wie ein kleiner Apfel aussieht – die Gallapfel. Für die Wespenlarve ist das der perfekte Ort zum Großwerden, quasi ihr eigenes Baum-Airbnb, voll ausgestattet mit Nahrung und Schutz.
Warum sehen wir sie gerade jetzt im Herbst?
Im Herbst gibt’s einen Rauswurf für die Galläpfel:
Da wir im Herbst viel Laub sammeln, fallen die Galläpfel oft besonders auf, weil sie sich kugelrund und robust anfühlen. Und sind wir ehrlich: Wer kann bei einem Blatt, das aussieht, als hätte es ein "Mitbewohner" gehabt, nicht neugierig werden?
Warum sind Galläpfel cool?
Galläpfel sind nicht nur ein Highlight für Naturforscher, sondern auch super nützlich! Früher hat man sie zur Herstellung von Tinte verwendet. Die Tannine (Gerbstoffe) in den Galläpfeln reagieren mit Eisen und ergeben eine tiefschwarze, dauerhafte Tinte. Damit wurden mittelalterliche Manuskripte geschrieben – ohne Galläpfel hätte Harry Potter vermutlich nie seinen Zauberstab-Schriftzug erhalten!
Ein lustiger Vergleich
Stell dir vor, du bist ein Baum. Eine Wespe klopft an und sagt:
Hey, ich hab hier ein Ei, das dringend einen Platz braucht. Kann ich’s in dir abstellen?“
„Ähm, okay...“ (innerlich: Warum nicht, ich bin ein Baum, nett sein kostet nix.)
Was du nicht weißt: Dieses Ei fordert einen VIP-Luxus-Larvenbau. Am Ende siehst du aus, als hättest du Äpfel gezüchtet, obwohl du ein Baum bist, der definitiv keine Obstbäume in der Familie hat!
Jetzt weißt du, warum die Bäume im Herbst solche "veräppelten" Blätter verlieren.
In der Aufnahme
Im Herbst gibt’s einen Rauswurf für die Galläpfel:
- Die Larven haben sich sattgefressen und verlassen ihr „Zuhause“, um sich im Boden zu verpuppen.
- Die Eiche denkt sich: "Jetzt bin ich endlich diesen komischen Ball los!", und wirft die Galläpfel zusammen mit dem Laub ab.
Da wir im Herbst viel Laub sammeln, fallen die Galläpfel oft besonders auf, weil sie sich kugelrund und robust anfühlen. Und sind wir ehrlich: Wer kann bei einem Blatt, das aussieht, als hätte es ein "Mitbewohner" gehabt, nicht neugierig werden?
Warum sind Galläpfel cool?
Galläpfel sind nicht nur ein Highlight für Naturforscher, sondern auch super nützlich! Früher hat man sie zur Herstellung von Tinte verwendet. Die Tannine (Gerbstoffe) in den Galläpfeln reagieren mit Eisen und ergeben eine tiefschwarze, dauerhafte Tinte. Damit wurden mittelalterliche Manuskripte geschrieben – ohne Galläpfel hätte Harry Potter vermutlich nie seinen Zauberstab-Schriftzug erhalten!
Ein lustiger Vergleich
Stell dir vor, du bist ein Baum. Eine Wespe klopft an und sagt:
Hey, ich hab hier ein Ei, das dringend einen Platz braucht. Kann ich’s in dir abstellen?“
„Ähm, okay...“ (innerlich: Warum nicht, ich bin ein Baum, nett sein kostet nix.)
Was du nicht weißt: Dieses Ei fordert einen VIP-Luxus-Larvenbau. Am Ende siehst du aus, als hättest du Äpfel gezüchtet, obwohl du ein Baum bist, der definitiv keine Obstbäume in der Familie hat!
Jetzt weißt du, warum die Bäume im Herbst solche "veräppelten" Blätter verlieren.
In der Aufnahme
- Gallapfel an einem abgefallenen Eicheblatt
Artenschutz in Franken®
Die Schwarzrückige Gemüsewanze oder auch Schmuckwanze (Eurydema ornata)

Schwarzrückige Gemüsewanze oder auch Schmuckwanze (Eurydema ornata)
20/21.11.2024
Hallo! Ich bin Eurydema ornata – aber bitte, nennt mich einfach „Schmuckwanze“.
Manche nennen mich „Schwarzrückige Gemüsewanze“, aber das klingt so... unsexy. Schließlich bin ich nicht nur ein Schädlingskandidat, sondern auch ein modisches Meisterwerk. Schaut euch meine kontrastreiche Zeichnung an: Schwarz, Rot, manchmal sogar ein Hauch von Gelb – ich bin die Definition von auffällig. Und das Beste? Mein Look ist nicht nur hübsch, sondern auch praktisch. Aber dazu später mehr!
20/21.11.2024
- Ein Tag im Leben der Schwarzrückigen Gemüsewanze (Eurydema ornata) ... (aus der Sicht einer stilbewussten Wanze, die weiß, dass sie gut aussieht)
Hallo! Ich bin Eurydema ornata – aber bitte, nennt mich einfach „Schmuckwanze“.
Manche nennen mich „Schwarzrückige Gemüsewanze“, aber das klingt so... unsexy. Schließlich bin ich nicht nur ein Schädlingskandidat, sondern auch ein modisches Meisterwerk. Schaut euch meine kontrastreiche Zeichnung an: Schwarz, Rot, manchmal sogar ein Hauch von Gelb – ich bin die Definition von auffällig. Und das Beste? Mein Look ist nicht nur hübsch, sondern auch praktisch. Aber dazu später mehr!
Mein Lebensraum: Frisch und knackig
Ich liebe die Natur, besonders Pflanzen aus der Familie der Kreuzblütler – Senf, Kohl, Rettich, Rucola... lecker! Diese Pflanzen bieten mir alles, was ich brauche: Nahrung und einen Platz zum Verweilen. Manchmal schaue ich auch in Gemüsegärten vorbei, aber hey, wer kann schon einem saftigen Blumenkohlblatt widerstehen?
Mein Outfit: Tarnung oder Warnung?
Mein farbenfrohes Äußeres ist nicht nur ein Hingucker, sondern eine Botschaft: "Ich bin giftig – lass mich in Ruhe!" Okay, das ist ein bisschen geflunkert. Ich bin nicht wirklich gefährlich, aber Raubtiere wie Vögel wissen oft nicht, dass ich bluffe. Mein Look nennt sich Aposematismus, ein schickes Wort für "Warnfarben". So kann ich genüsslich an Kohlblättern knabbern, während andere in Deckung gehen müssen.
Ein Futterkritiker am Werk
Ich bin ein Spezialist, wenn es ums Essen geht: Mein Stechrüssel ist perfekt, um Pflanzensäfte zu zapfen. Und nein, ich knabbere nicht einfach nur – ich steche gezielt in die Leitungsbahnen der Pflanze, um die leckersten Nährstoffe direkt zu schlürfen.
Menschen regen sich darüber auf, dass ich Löcher hinterlasse, aber hey, ich mache nur meinen Job. Und seien wir ehrlich: Kohl wächst doch sowieso nach.
Unsere Kinderstube: Das grüne Paradies
Ich sorge dafür, dass meine Eier immer auf den besten Blättern landen – eine Art Kinderstube mit Vollpension. Die Eier sind klein und unscheinbar, aber wenn meine Kinder schlüpfen, legen sie sofort los und genießen das Buffet.Wenn sie wachsen, durchlaufen sie mehrere Häutungen, von kleinen graubraunen Nymphen bis hin zu den farbenfrohen Erwachsenen, die ihr von mir kennt. Evolution vom Feinsten!
Ein paar Fun-Facts über mich:
„Multikulti Wanze“:
„Schmuck oder Fluch?“:
Mode-Ikone eben.
„Ich bin kein Einzelkind“:
Was mich einzigartig macht
Ich bin nicht nur hübsch, sondern auch ein Ökosystem-Akteur. Klar, ich nasche an Pflanzen, aber ich bin auch ein wichtiger Teil der Nahrungskette. Raubwanzen, Vögel oder Spinnen müssen schließlich auch etwas essen – und manchmal bin ich das Hauptgericht.
Abschließend
Ich bin Eurydema ornata: ein bisschen gefräßig, sehr stylisch und immer bereit, die Natur bunter zu machen. Also, das nächste Mal, wenn ihr mich auf einem Kohlblatt entdeckt, zückt lieber die Kamera, statt mich zu verscheuchen. Schließlich gibt’s mich nur in schick!
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
Ich liebe die Natur, besonders Pflanzen aus der Familie der Kreuzblütler – Senf, Kohl, Rettich, Rucola... lecker! Diese Pflanzen bieten mir alles, was ich brauche: Nahrung und einen Platz zum Verweilen. Manchmal schaue ich auch in Gemüsegärten vorbei, aber hey, wer kann schon einem saftigen Blumenkohlblatt widerstehen?
Mein Outfit: Tarnung oder Warnung?
Mein farbenfrohes Äußeres ist nicht nur ein Hingucker, sondern eine Botschaft: "Ich bin giftig – lass mich in Ruhe!" Okay, das ist ein bisschen geflunkert. Ich bin nicht wirklich gefährlich, aber Raubtiere wie Vögel wissen oft nicht, dass ich bluffe. Mein Look nennt sich Aposematismus, ein schickes Wort für "Warnfarben". So kann ich genüsslich an Kohlblättern knabbern, während andere in Deckung gehen müssen.
Ein Futterkritiker am Werk
Ich bin ein Spezialist, wenn es ums Essen geht: Mein Stechrüssel ist perfekt, um Pflanzensäfte zu zapfen. Und nein, ich knabbere nicht einfach nur – ich steche gezielt in die Leitungsbahnen der Pflanze, um die leckersten Nährstoffe direkt zu schlürfen.
Menschen regen sich darüber auf, dass ich Löcher hinterlasse, aber hey, ich mache nur meinen Job. Und seien wir ehrlich: Kohl wächst doch sowieso nach.
Unsere Kinderstube: Das grüne Paradies
Ich sorge dafür, dass meine Eier immer auf den besten Blättern landen – eine Art Kinderstube mit Vollpension. Die Eier sind klein und unscheinbar, aber wenn meine Kinder schlüpfen, legen sie sofort los und genießen das Buffet.Wenn sie wachsen, durchlaufen sie mehrere Häutungen, von kleinen graubraunen Nymphen bis hin zu den farbenfrohen Erwachsenen, die ihr von mir kennt. Evolution vom Feinsten!
Ein paar Fun-Facts über mich:
„Multikulti Wanze“:
- Ich bin fast überall in Europa und Asien unterwegs. Und durch den internationalen Gemüsehandel? Tja, jetzt bin ich auch in Nordamerika ein Star.
„Schmuck oder Fluch?“:
- Während Gärtner mich nicht mögen, lieben Naturfotografen mein Design. Ich wurde sogar schon in Insektenkalendern verewigt.
Mode-Ikone eben.
„Ich bin kein Einzelkind“:
- Es gibt viele Wanzen in meiner Familie, aber wir Schmuckwanzen sind die coolsten. Andere Arten sehen entweder langweilig aus oder haben keinen Sinn für die gute Pflanzenküche.
Was mich einzigartig macht
Ich bin nicht nur hübsch, sondern auch ein Ökosystem-Akteur. Klar, ich nasche an Pflanzen, aber ich bin auch ein wichtiger Teil der Nahrungskette. Raubwanzen, Vögel oder Spinnen müssen schließlich auch etwas essen – und manchmal bin ich das Hauptgericht.
Abschließend
Ich bin Eurydema ornata: ein bisschen gefräßig, sehr stylisch und immer bereit, die Natur bunter zu machen. Also, das nächste Mal, wenn ihr mich auf einem Kohlblatt entdeckt, zückt lieber die Kamera, statt mich zu verscheuchen. Schließlich gibt’s mich nur in schick!
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- Schwarzrückige Gemüsewanze
Artenschutz in Franken®
WWF - Pressestatement zum Ermittlungsstand Totfunde Robben vor Rügen
Pressestatement zum Ermittlungsstand Totfunde Robben vor Rügen
19/20.11.2024
Berlin/Stralsund. Seit Anfang Oktober 2024 wurden bis Ende Oktober insgesamt 44 tote Robben an der Ostküste von Rügen gemeldet.
Das Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern hat in einer Pressemitteilung vom 14.11.2024 den Stand der Ermittlungen als immer noch offen dargestellt. Dazu sagt Finn Viehberg, Leiter WWF-Büro Ostsee in Stralsund:
19/20.11.2024
- WWF: Behörden müssen gründlich, aber schneller handeln
Berlin/Stralsund. Seit Anfang Oktober 2024 wurden bis Ende Oktober insgesamt 44 tote Robben an der Ostküste von Rügen gemeldet.
Das Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern hat in einer Pressemitteilung vom 14.11.2024 den Stand der Ermittlungen als immer noch offen dargestellt. Dazu sagt Finn Viehberg, Leiter WWF-Büro Ostsee in Stralsund:
„Der besondere Schutzstatus der Kegelrobben verlangt ein gründliches, aber schnelleres Handeln der Behörden. Gerade weil niemand will, dass eine einzige Reuse die gesamte Küstenfischerei in schlechtes Licht rückt. Ein frühes Schließen der Reuse, freiwillig oder behördlich verordnet, hätte zudem anhaltenden Spekulationen den Nährboden entzogen. Vermehrte Totfunde müssen künftig umgehend ein verstärktes Monitoring der Robbenkolonien durch die Fachbehörden auslösen. Das geschieht dann auch im Interesse des Berufstandes der Küstenfischer.
Die verzögerten Reaktionen haben diesmal zum Tod von 44 Kegelrobben geführt. 2018 wurden die Ermittlungen zu einem vergleichbaren Robbensterben vor der Küste Rügens ergebnislos eingestellt, im Fokus stand dieselbe Reuse. Das darf diesmal nicht passieren.
Für die Zukunft ist es wichtig, in der Küstenfischereiverordnung robbensichere Fanggeräte im gesamten Küstengebiet verpflichtend vorzuschreiben und finanziell zu unterstützen. Kurzfristig sollte das über eine Nebenbestimmung In der Verordnung geschehen.“
Quelle
WWF
Stand
15.11.2024
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung. Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Die verzögerten Reaktionen haben diesmal zum Tod von 44 Kegelrobben geführt. 2018 wurden die Ermittlungen zu einem vergleichbaren Robbensterben vor der Küste Rügens ergebnislos eingestellt, im Fokus stand dieselbe Reuse. Das darf diesmal nicht passieren.
Für die Zukunft ist es wichtig, in der Küstenfischereiverordnung robbensichere Fanggeräte im gesamten Küstengebiet verpflichtend vorzuschreiben und finanziell zu unterstützen. Kurzfristig sollte das über eine Nebenbestimmung In der Verordnung geschehen.“
Quelle
WWF
Stand
15.11.2024
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung. Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Artenschutz in Franken®
Ausgleichsfläche als Abstellplatz von landwirtschaftlichem Equipment

Ausgleichsfläche als Abstellplatz von landwirtschaftlichem Equipment
Da werden Anhänger und Kisten abgestellt und die Naturschutzfläche mit schwerem Gerät befahren. Hier stellt sich uns die Frage:"Warum stellt der Landwirt das nicht auf seinem Feld ab oder auf dem Feld von seinem Kollegen".
- Heute waren wir wieder einmal zu einer unserer Exkursionen unterwegs, auf den Bildern ist zu sehen, dass ein Landwirt keinen Respekt vor einer dem Naturschutz zugeführten Naturfläche hat.
Da werden Anhänger und Kisten abgestellt und die Naturschutzfläche mit schwerem Gerät befahren. Hier stellt sich uns die Frage:"Warum stellt der Landwirt das nicht auf seinem Feld ab oder auf dem Feld von seinem Kollegen".
Daran sieht man mal wieder, dass geschützte Bereiche für Tier und Natur ignoriert werden und dem Eigenzweck untergeordnet werden.
In der Regel sollten solche Fläche mit einem Hinweis hinterlegt werden, das es sich hier um eine dem Naturschutz zugeordenten Fläche handelt, welche bei einem Verstoß dieser Art mit einer darauf folgenden Strafanzeige belegt wird. Auch um mögliche Schäden welche der Fläche zugeführt werden, unverzüglich zu beheben.
Quelle / Aufnahme
Gewässer und Naturschutz im Erftkreis
Flora-Fauna-Artenschutz
Naturschutzökologie
Rolf Thiemann
Naturschutzberater
Eisvogelweg 1
50181 Bedburg
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung. Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
- Das ist halt nur Grünfläche, wo jeder machen kann was er will?
In der Regel sollten solche Fläche mit einem Hinweis hinterlegt werden, das es sich hier um eine dem Naturschutz zugeordenten Fläche handelt, welche bei einem Verstoß dieser Art mit einer darauf folgenden Strafanzeige belegt wird. Auch um mögliche Schäden welche der Fläche zugeführt werden, unverzüglich zu beheben.
Quelle / Aufnahme
Gewässer und Naturschutz im Erftkreis
Flora-Fauna-Artenschutz
Naturschutzökologie
Rolf Thiemann
Naturschutzberater
Eisvogelweg 1
50181 Bedburg
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung. Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Artenschutz in Franken®
Artenschutzmaßnahme Kirchendohle & Co.

Artenschutzmaßnahme Kirchendohle & Co.
18/19.11.2024
Rattelsdorf / Bayern. Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutzes in Franken®, der Pfarrei St. Peter und Paul Rattelsdorf und Turmstationen Deutschland e.V., das von der Deutschen Postcode Lotterie sowie von den Fachbehörden des Naturschutzes und des Denkmalschutzes unterstützt wird.
18/19.11.2024
- Projekt abgeschlossen
Rattelsdorf / Bayern. Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutzes in Franken®, der Pfarrei St. Peter und Paul Rattelsdorf und Turmstationen Deutschland e.V., das von der Deutschen Postcode Lotterie sowie von den Fachbehörden des Naturschutzes und des Denkmalschutzes unterstützt wird.
Die Dohle (Corvus monedula) ist in Bayern aktuell im Bestand bedroht, hauptsächlich aufgrund von Lebensraumverlust und Nistplatzmangel. Diese Vögel nisten bevorzugt in alten Gebäuden oder Baumhöhlen, die durch moderne Bauweisen und Renovierungen seltener geworden sind.
Zusätzlich verschwinden ihre natürlichen Lebensräume wie offene Wiesen und Weiden, da diese Flächen oft landwirtschaftlich intensiv genutzt oder bebaut werden. Der Einsatz von Pestiziden reduziert zudem das Nahrungsangebot der Dohlen, da Insekten und andere Kleintiere, die sie fressen, weniger verfügbar sind. Diese Faktoren führen zusammen zu einem Rückgang der Population.
Mit diesem Kooperationsprojekt möchten wir den kleinen Rabenvögel hier in unserem Land eine nachhaltige Übelebensperspektive bieten
In der Aufnahme
Zusätzlich verschwinden ihre natürlichen Lebensräume wie offene Wiesen und Weiden, da diese Flächen oft landwirtschaftlich intensiv genutzt oder bebaut werden. Der Einsatz von Pestiziden reduziert zudem das Nahrungsangebot der Dohlen, da Insekten und andere Kleintiere, die sie fressen, weniger verfügbar sind. Diese Faktoren führen zusammen zu einem Rückgang der Population.
Mit diesem Kooperationsprojekt möchten wir den kleinen Rabenvögel hier in unserem Land eine nachhaltige Übelebensperspektive bieten
In der Aufnahme
- Im oberen Segmentbereich der Schalllamellenöffnungen wurden spezielle Nisthilfen für Dohlen angebracht.
Artenschutz in Franken®
Die Heide-Wespenbiene (Nomada rufipes)

Heide-Wespenbiene (Nomada rufipes)
18/19.11.2024
Ich bin so eine Art Trickbetrügerin unter den Insekten! Ein bisschen Biene, ein bisschen Wespe, und das alles im Dienst eines ziemlich cleveren Plans. Also schnallt euch an, und ich erzähle euch, wie ich das Spiel der Natur spiele – und wie ich dabei ziemlich gut aussehe, wenn ich das mal so sagen darf.
18/19.11.2024
- Hallo, ich bin die Heide-Wespenbiene, auch bekannt als Nomada rufipes. Aber keine Sorge, trotz meines Namens bin ich weder eine richtige Wespe noch eine echte Biene.
Ich bin so eine Art Trickbetrügerin unter den Insekten! Ein bisschen Biene, ein bisschen Wespe, und das alles im Dienst eines ziemlich cleveren Plans. Also schnallt euch an, und ich erzähle euch, wie ich das Spiel der Natur spiele – und wie ich dabei ziemlich gut aussehe, wenn ich das mal so sagen darf.
Wer bin ich?
Ich bin etwa 6 bis 10 Millimeter groß und habe einen schick gestreiften Körper in Schwarz und Rot. Mein Markenzeichen sind meine leuchtend roten Beine – daher mein Artname rufipes, was so viel bedeutet wie „Rotbein“. Die Menschen verwechseln mich oft mit einer Wespe, weil ich so elegant und wehrhaft wirke. Na ja, das ist auch genau mein Trick: Wespen sind gefürchtet, und ich nutze das schamlos aus!
Mein raffiniertes Geheimnis: Parasitismus
Jetzt kommt das Beste an meiner Lebensweise: Ich bin ein Kuckucksbiene. Klingt niedlich, oder? Im Prinzip heißt das, ich bin eine Biene, die selbst keine Lust hat, ein eigenes Nest zu bauen und Futter zu sammeln. Stattdessen habe ich eine brillante Strategie entwickelt: Ich schleicht mich in die Nester anderer Bienen und lasse die die ganze Arbeit machen! Speziell die Sandbienen (Andrena), die ackern richtig für ihre Brut, und ich bin froh, dass sie das tun.
Operation Nest-Einschleichen
Sobald ich eine fleißige Sandbiene entdeckt habe, die ein hübsches Nest gebaut und mit Pollen und Nektar gefüllt hat, schlage ich zu! Ich warte, bis die Sandbiene das Nest kurz unbeaufsichtigt lässt, und husche dann schnell hinein. Dann lege ich mein eigenes Ei neben ihr sorgsam platziertes Ei und verschwinde. Sobald mein Ei schlüpft, übernimmt mein Nachwuchs das Nest und den Vorrat. Man könnte sagen, mein Nachwuchs ist ein echter „Nestbesetzer“!
„Fressen und gefressen werden“ – mein bescheidener Beitrag zur Natur
Okay, ja, das klingt vielleicht ein bisschen... egoistisch. Aber hey, das ist der Lauf der Natur! Wir Nomada-Bienen sind die Feinschmecker unter den Bienen, wenn es um Parasitismus geht. Übrigens – falls euch das tröstet – auch ich habe Feinde. Meine Färbung soll zwar abschreckend wirken, aber es gibt genug hungrige Vögel und kleine Säugetiere, denen das ziemlich egal ist. Für die bin ich einfach nur ein leckerer Snack.
Der Vorteil des Wespen-Looks
Falls ihr euch fragt, warum ich wie eine Wespe aussehe: Es ist eine clevere Tarnung, um Feinde zu täuschen. Vögel und andere Fressfeinde denken oft: „Oh oh, lieber nicht anrühren, die könnte gefährlich sein!“ So kann ich meine parasitäre Karriere ein wenig sicherer gestalten. Aber keine Sorge, ich kann euch nichts tun – ich habe weder einen Stachel noch irgendwelche Abwehrmittel.
Mein Lebensraum: Die Heide und mehr
Ich liebe sonnige, sandige und warme Orte. Besonders die Heide ist ein prima Fleckchen für mich, wo viele meiner geliebten Sandbienen herumschwirren und fleißig graben. Aber auch in Gärten und offenen Wiesen kann man mich entdecken, solange dort meine potenziellen „Nest-Wirte“ leben.
Und wie geht’s weiter?
Als Heide-Wespenbiene habe ich im Frühling und Sommer alle Hände voll zu tun – na ja, oder eher alle sechs Beine voll zu tun, um meine Eier zu legen und das perfekte Sandbienen-Nest zu finden. Nach getaner Arbeit verschwinde ich dann unauffällig und überlasse die nächste Generation ihrem Schicksal.
Zusammengefasst: Ich bin die charmante Trickbetrügerin des Insektenreichs. Warum selbst arbeiten, wenn andere es für einen tun? Also, wenn ihr das nächste Mal eine kleine, rot-schwarz gestreifte „Wespe“ mit roten Beinen seht – schaut lieber zweimal hin. Vielleicht ist das nicht die aggressive Wespe, die ihr erwartet, sondern nur ich, die Nomada rufipes, auf der Suche nach dem nächsten freien Nest.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
Ich bin etwa 6 bis 10 Millimeter groß und habe einen schick gestreiften Körper in Schwarz und Rot. Mein Markenzeichen sind meine leuchtend roten Beine – daher mein Artname rufipes, was so viel bedeutet wie „Rotbein“. Die Menschen verwechseln mich oft mit einer Wespe, weil ich so elegant und wehrhaft wirke. Na ja, das ist auch genau mein Trick: Wespen sind gefürchtet, und ich nutze das schamlos aus!
Mein raffiniertes Geheimnis: Parasitismus
Jetzt kommt das Beste an meiner Lebensweise: Ich bin ein Kuckucksbiene. Klingt niedlich, oder? Im Prinzip heißt das, ich bin eine Biene, die selbst keine Lust hat, ein eigenes Nest zu bauen und Futter zu sammeln. Stattdessen habe ich eine brillante Strategie entwickelt: Ich schleicht mich in die Nester anderer Bienen und lasse die die ganze Arbeit machen! Speziell die Sandbienen (Andrena), die ackern richtig für ihre Brut, und ich bin froh, dass sie das tun.
Operation Nest-Einschleichen
Sobald ich eine fleißige Sandbiene entdeckt habe, die ein hübsches Nest gebaut und mit Pollen und Nektar gefüllt hat, schlage ich zu! Ich warte, bis die Sandbiene das Nest kurz unbeaufsichtigt lässt, und husche dann schnell hinein. Dann lege ich mein eigenes Ei neben ihr sorgsam platziertes Ei und verschwinde. Sobald mein Ei schlüpft, übernimmt mein Nachwuchs das Nest und den Vorrat. Man könnte sagen, mein Nachwuchs ist ein echter „Nestbesetzer“!
„Fressen und gefressen werden“ – mein bescheidener Beitrag zur Natur
Okay, ja, das klingt vielleicht ein bisschen... egoistisch. Aber hey, das ist der Lauf der Natur! Wir Nomada-Bienen sind die Feinschmecker unter den Bienen, wenn es um Parasitismus geht. Übrigens – falls euch das tröstet – auch ich habe Feinde. Meine Färbung soll zwar abschreckend wirken, aber es gibt genug hungrige Vögel und kleine Säugetiere, denen das ziemlich egal ist. Für die bin ich einfach nur ein leckerer Snack.
Der Vorteil des Wespen-Looks
Falls ihr euch fragt, warum ich wie eine Wespe aussehe: Es ist eine clevere Tarnung, um Feinde zu täuschen. Vögel und andere Fressfeinde denken oft: „Oh oh, lieber nicht anrühren, die könnte gefährlich sein!“ So kann ich meine parasitäre Karriere ein wenig sicherer gestalten. Aber keine Sorge, ich kann euch nichts tun – ich habe weder einen Stachel noch irgendwelche Abwehrmittel.
Mein Lebensraum: Die Heide und mehr
Ich liebe sonnige, sandige und warme Orte. Besonders die Heide ist ein prima Fleckchen für mich, wo viele meiner geliebten Sandbienen herumschwirren und fleißig graben. Aber auch in Gärten und offenen Wiesen kann man mich entdecken, solange dort meine potenziellen „Nest-Wirte“ leben.
Und wie geht’s weiter?
Als Heide-Wespenbiene habe ich im Frühling und Sommer alle Hände voll zu tun – na ja, oder eher alle sechs Beine voll zu tun, um meine Eier zu legen und das perfekte Sandbienen-Nest zu finden. Nach getaner Arbeit verschwinde ich dann unauffällig und überlasse die nächste Generation ihrem Schicksal.
Zusammengefasst: Ich bin die charmante Trickbetrügerin des Insektenreichs. Warum selbst arbeiten, wenn andere es für einen tun? Also, wenn ihr das nächste Mal eine kleine, rot-schwarz gestreifte „Wespe“ mit roten Beinen seht – schaut lieber zweimal hin. Vielleicht ist das nicht die aggressive Wespe, die ihr erwartet, sondern nur ich, die Nomada rufipes, auf der Suche nach dem nächsten freien Nest.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- - Männchen- Nomada rufipes, eine Wespenbiene, ist eine so genannte Kuckucksbiene, wie alle Wespenbienen. Sie parasitiert bei Sandbienen und ist deswegen, wie ihre Wirte, auf Heide- Sand und Brachflächen angewiesen. Diese Aufnahme entstand im Steigerwald.Sie legt ein Ei in ein fertiges Nest der Wirtsbiene und dort frisst die ausschlüpfende Larve das Ei oder tötet die geschlüpfte Wirtslarve.Danach ernährt sie sich von dem Proviant den die Wirtsbiene einbrachte.Selten und auf der Vorwarnliste.
Artenschutz in Franken®
EUDR: EU-Parlament stimmt für ungebremste Waldzerstörung
EUDR: EU-Parlament stimmt für ungebremste Waldzerstörung
17/18.11.2024
Das EU-Parlament hat heute auf Initiative der Europäischen Volkspartei (EVP) für Änderungsanträge gestimmt, die die EU-Anti Entwaldungsverordnung (EUDR) erheblich abschwächen und damit eines der wichtigsten Umweltgesetze der EU ausbremsen. Durch die Einführung einer „Null-Risiko“-Herkunftsländer-Kategorie setzen sich die EVP und Verbündete dafür ein, die weitere Zerstörung von Wäldern sowohl innerhalb als auch außerhalb Europas zu ermöglichen.
„Die Rolle rückwärts der christlichen Parteien ist beschämend. Sie unterminiert nicht nur ein demokratisch zustande gekommenes Gesetz und setzt die Glaubwürdigkeit der EU-Umweltpolitik aufs Spiel. Die EVP verleugnet damit ihre eigenen Wurzeln, die den Schutz der Schöpfung als eine Kernaufgabe sieht,“ sagt Johannes Zahnen, Holzreferent des WWF Deutschland.
17/18.11.2024
- WWF: Bewahrung der Schöpfung – Fehlanzeige! Blankes Entsetzen über die EVP-Fraktion bei EUDR-Abstimmung
Das EU-Parlament hat heute auf Initiative der Europäischen Volkspartei (EVP) für Änderungsanträge gestimmt, die die EU-Anti Entwaldungsverordnung (EUDR) erheblich abschwächen und damit eines der wichtigsten Umweltgesetze der EU ausbremsen. Durch die Einführung einer „Null-Risiko“-Herkunftsländer-Kategorie setzen sich die EVP und Verbündete dafür ein, die weitere Zerstörung von Wäldern sowohl innerhalb als auch außerhalb Europas zu ermöglichen.
„Die Rolle rückwärts der christlichen Parteien ist beschämend. Sie unterminiert nicht nur ein demokratisch zustande gekommenes Gesetz und setzt die Glaubwürdigkeit der EU-Umweltpolitik aufs Spiel. Die EVP verleugnet damit ihre eigenen Wurzeln, die den Schutz der Schöpfung als eine Kernaufgabe sieht,“ sagt Johannes Zahnen, Holzreferent des WWF Deutschland.
Mit dieser „Persilschein“-Kategorie der „Null-Risiko“-Staaten verleugnet die EU, dass auch in Europa illegal Holz geschlagen wird. EU-Drittstaaten werden Regeln auferlegt, die die EU für sich selbst nicht einhalten will. Doch auch in Europa wird Holz in Wäldern geschlagen, in denen die Ökosysteme schwer geschädigt sind. Naturwälder werden gerodet und in Forstplantagen umgewandelt. Daher zielte die EU-Verordnung bislang darauf ab, zusätzlich zu Entwaldung auch Degradierung, also Zustandsverschlechterung, zu stoppen. Dieses Ziel nun auszuhöhlen, ist angesichts der Klimakrise wahnwitzig, die just eine rasche Walderholung und Wiederbewaldung erforderlich macht.
„Es ist nicht mehr so, dass wir die Natur nur nutzen, sondern wir übernutzen sie massiv und bringen damit den gesamten Planeten in Gefahr. Es geht inzwischen um den Erhalt Schöpfung an sich. Doch die von christlich-konservativen Parteien eingebrachten Änderungsvorschläge berücksichtigen nur Wirtschaftsinteressen – eine Rolle, die wir in Deutschland insbesondere von der FDP kannten. Waldschutz wäre damit nicht mehr möglich. Trotz verheerender Waldbrände, Sturmschäden und Trockenheit, mit massiven Waldschäden auch in Deutschland durch den Klimawandel, scheinen die christlichen Parteien die Bewahrung der Schöpfung aus den Augen verloren zu haben“, so Zahnen.
Der WWF fordert nun Kommissionspräsidentin von der Leyen auf, ihren Vorschlag, die Umsetzung des EUDR zu verzögern, zurückzuziehen. Damit würde das Gesetz wie ursprünglich vorgesehen zu Ende des Jahres 2024 in Kraft treten. Zugleich könnte EU-Präsidentin von der Leyen ihre Standfestigkeit beweisen, dass sie die Ziele des Green Deal weiterhin hochhält. Damit würde sie auch die Leistung vieler vorwärts gewandter Unternehmen anerkennen, die sich bereits auf den pünktlichen Geltungsbeginn vorbereitet hatten und die wollen, dass die Verordnung unverändert in Kraft tritt.
Die EU zählt zu den größten Treibern von Waldzerstörung gemäß einer WWF-Studie. 16 Prozent der globalen Tropenabholzung im Zusammenhang mit dem internationalen Handel gehen demnach auf das Konto der EU. Sie liegt damit auf Platz zwei der „Weltrangliste der Waldzerstörer“, hinter China (24 Prozent) und vor Indien (9 Prozent) und den USA (7 Prozent).
Quelle
WWF
Stand
14.11.2024
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung. Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
„Es ist nicht mehr so, dass wir die Natur nur nutzen, sondern wir übernutzen sie massiv und bringen damit den gesamten Planeten in Gefahr. Es geht inzwischen um den Erhalt Schöpfung an sich. Doch die von christlich-konservativen Parteien eingebrachten Änderungsvorschläge berücksichtigen nur Wirtschaftsinteressen – eine Rolle, die wir in Deutschland insbesondere von der FDP kannten. Waldschutz wäre damit nicht mehr möglich. Trotz verheerender Waldbrände, Sturmschäden und Trockenheit, mit massiven Waldschäden auch in Deutschland durch den Klimawandel, scheinen die christlichen Parteien die Bewahrung der Schöpfung aus den Augen verloren zu haben“, so Zahnen.
Der WWF fordert nun Kommissionspräsidentin von der Leyen auf, ihren Vorschlag, die Umsetzung des EUDR zu verzögern, zurückzuziehen. Damit würde das Gesetz wie ursprünglich vorgesehen zu Ende des Jahres 2024 in Kraft treten. Zugleich könnte EU-Präsidentin von der Leyen ihre Standfestigkeit beweisen, dass sie die Ziele des Green Deal weiterhin hochhält. Damit würde sie auch die Leistung vieler vorwärts gewandter Unternehmen anerkennen, die sich bereits auf den pünktlichen Geltungsbeginn vorbereitet hatten und die wollen, dass die Verordnung unverändert in Kraft tritt.
Die EU zählt zu den größten Treibern von Waldzerstörung gemäß einer WWF-Studie. 16 Prozent der globalen Tropenabholzung im Zusammenhang mit dem internationalen Handel gehen demnach auf das Konto der EU. Sie liegt damit auf Platz zwei der „Weltrangliste der Waldzerstörer“, hinter China (24 Prozent) und vor Indien (9 Prozent) und den USA (7 Prozent).
Quelle
WWF
Stand
14.11.2024
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung. Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Artenschutz in Franken®
Der Kleine Dickkopf (Neottiglossa pusilla)

Der Kleine Dickkopf (Neottiglossa pusilla)
17/18.11.2024
Man könnte sagen, ich bin der charmante Winzling unter den harten Käfern, kaum größer als ein kleiner Fingernagel, aber mit einem stolzen Dickkopf, wie der Name schon sagt. Dieser „Dickkopf“ ist übrigens keine Beleidigung—ich trage ihn mit Stolz, denn mein Panzer ist wie eine Ritterrüstung. Ein bisschen härter und kantiger als bei anderen, und ja, auch ein wenig dickköpfig.
17/18.11.2024
- Ich bin der Kleine Dickkopf—auf Latein Neottiglossa pusilla, und ich gehöre zur faszinierenden Familie der Baumwanzen.
Man könnte sagen, ich bin der charmante Winzling unter den harten Käfern, kaum größer als ein kleiner Fingernagel, aber mit einem stolzen Dickkopf, wie der Name schon sagt. Dieser „Dickkopf“ ist übrigens keine Beleidigung—ich trage ihn mit Stolz, denn mein Panzer ist wie eine Ritterrüstung. Ein bisschen härter und kantiger als bei anderen, und ja, auch ein wenig dickköpfig.
Mein Habitat
Man findet mich auf Wiesen, in Gärten und auch an Wegrändern. Die Gräser sind mein Lieblingsplatz. Dort kann ich mich wunderbar tarnen, was äußerst wichtig ist, denn ich bin weder groß noch besonders wehrhaft. Die Tarnung ist dabei mein stärkster Vorteil, vor allem, weil ich in dezenten Braun- und Grautönen glänze—na ja, „glänze“ ist vielleicht das falsche Wort; sagen wir mal, ich bin eher... unauffällig-schick!
Nahrung: Zart, aber durchdringend
Ich bin übrigens ein Phytophage, das heißt, ich ernähre mich gerne von Pflanzensäften. Dabei bohre ich meinen Stechrüssel in die Halme von Gräsern, als wäre ich ein Mini-Vampir. Ich sauge also an Pflanzen, die ja auch nichts dagegen tun können—ich sage immer, das ist eine Art sanfte Methode, sich durchzufuttern. Ohne großes Drama.
Die Kunst des Dickköpfig-Seins
Mein „Dickkopf“ ist allerdings nicht nur ein Panzer. Es gibt da einen Grund für mein Auftreten: Mein Kopf und Körper sind so geformt, dass sie Eindringlinge in die Irre führen sollen. Durch meine Form erscheine ich größer und beeindruckender als ich bin—aber klar, bei einer Größe von gerade mal ein paar Millimetern brauche ich jeden kleinen Vorteil!
Parfum mit Vorsicht genießen
Wusstest du übrigens, dass ich ein paar gut platzierte Duftdrüsen an meinem Panzer habe? Wenn mich ein Vogel anknabbern will oder mich ein Mensch dumm festhält, kann ich einen strengen Duft abgeben, der bei Feinden „Uääääh!“ auslöst. Eine Art kleiner „Stinke-Knall“, wenn du so willst. Und ja, der ist ziemlich wirksam. Die Feinde überlegen es sich meist zweimal, ob sie mir wirklich zu nahe kommen möchten.
Fortpflanzung - Die Mini-Kleinen Dickköpfe
Meine kleinen Dickkopf-Babys (wir nennen sie Larven) sehen schon früh wie Mini-Versionen von mir aus, nur noch ohne den schicken Panzer. Ich und meine Artgenossen legen winzige Eier auf Pflanzen ab. Wir sind auch nicht besonders fürsorglich – nachdem wir die Eier gelegt haben, überlassen wir sie der Natur und den Pflanzen, wo sie dann hoffentlich überleben und groß und stark werden.
Mein Dasein in Kurzfassung
Also, was bin ich? Eine kleine, aber stolze Baumwanze, die durch die Wiesen kriecht, an Pflanzen saugt und sich auf ihre Tarnung verlässt. Man kann sagen, ich bin eine Mischung aus Überlebenskünstler und Dickkopf. Der Trick des Lebens lautet: Immer mit dem Kopf durch die Wand – auch wenn es nur ein Grashalm ist!
Und so krieche ich weiter und hoffe, dass ich nur selten eure Schuhe von unten sehe!
Aufnahme von Bernhard Schmalisch
Man findet mich auf Wiesen, in Gärten und auch an Wegrändern. Die Gräser sind mein Lieblingsplatz. Dort kann ich mich wunderbar tarnen, was äußerst wichtig ist, denn ich bin weder groß noch besonders wehrhaft. Die Tarnung ist dabei mein stärkster Vorteil, vor allem, weil ich in dezenten Braun- und Grautönen glänze—na ja, „glänze“ ist vielleicht das falsche Wort; sagen wir mal, ich bin eher... unauffällig-schick!
Nahrung: Zart, aber durchdringend
Ich bin übrigens ein Phytophage, das heißt, ich ernähre mich gerne von Pflanzensäften. Dabei bohre ich meinen Stechrüssel in die Halme von Gräsern, als wäre ich ein Mini-Vampir. Ich sauge also an Pflanzen, die ja auch nichts dagegen tun können—ich sage immer, das ist eine Art sanfte Methode, sich durchzufuttern. Ohne großes Drama.
Die Kunst des Dickköpfig-Seins
Mein „Dickkopf“ ist allerdings nicht nur ein Panzer. Es gibt da einen Grund für mein Auftreten: Mein Kopf und Körper sind so geformt, dass sie Eindringlinge in die Irre führen sollen. Durch meine Form erscheine ich größer und beeindruckender als ich bin—aber klar, bei einer Größe von gerade mal ein paar Millimetern brauche ich jeden kleinen Vorteil!
Parfum mit Vorsicht genießen
Wusstest du übrigens, dass ich ein paar gut platzierte Duftdrüsen an meinem Panzer habe? Wenn mich ein Vogel anknabbern will oder mich ein Mensch dumm festhält, kann ich einen strengen Duft abgeben, der bei Feinden „Uääääh!“ auslöst. Eine Art kleiner „Stinke-Knall“, wenn du so willst. Und ja, der ist ziemlich wirksam. Die Feinde überlegen es sich meist zweimal, ob sie mir wirklich zu nahe kommen möchten.
Fortpflanzung - Die Mini-Kleinen Dickköpfe
Meine kleinen Dickkopf-Babys (wir nennen sie Larven) sehen schon früh wie Mini-Versionen von mir aus, nur noch ohne den schicken Panzer. Ich und meine Artgenossen legen winzige Eier auf Pflanzen ab. Wir sind auch nicht besonders fürsorglich – nachdem wir die Eier gelegt haben, überlassen wir sie der Natur und den Pflanzen, wo sie dann hoffentlich überleben und groß und stark werden.
Mein Dasein in Kurzfassung
Also, was bin ich? Eine kleine, aber stolze Baumwanze, die durch die Wiesen kriecht, an Pflanzen saugt und sich auf ihre Tarnung verlässt. Man kann sagen, ich bin eine Mischung aus Überlebenskünstler und Dickkopf. Der Trick des Lebens lautet: Immer mit dem Kopf durch die Wand – auch wenn es nur ein Grashalm ist!
Und so krieche ich weiter und hoffe, dass ich nur selten eure Schuhe von unten sehe!
Aufnahme von Bernhard Schmalisch
Artenschutz in Franken®
Amphibien- Todesfalle - ungesicherter Gully und Lichtschacht

Amphibien- Todesfalle - ungesicherter Gully und Lichtschacht
Aus gegebenem Anlass möchten wir daher auf Tiere im Kellerlichtschacht hinweisen. Das Thema ist nicht zu vernachlässigen, denn was da an Tieren vorzufinden ist, ist vielfach beachtlich! Von Mäusen, Insekten, Amphibien und sogar (Vogelküken) Entenküken ist die Rede.
- Am 11.11.2024 mussten wir mehrere Molche und Kröten aus einem Kellerloch befreien.Zum Glück noch lebend.
Aus gegebenem Anlass möchten wir daher auf Tiere im Kellerlichtschacht hinweisen. Das Thema ist nicht zu vernachlässigen, denn was da an Tieren vorzufinden ist, ist vielfach beachtlich! Von Mäusen, Insekten, Amphibien und sogar (Vogelküken) Entenküken ist die Rede.
Amphibien suchen Verstecke und wandern umher. Wenn sie an Straßen oder Hauswänden entlang gehen, fallen sie häufig auch in Gullys, Kellerschachte und Kellerabgänge ec. Die Hauswand oder der Bordstein leiten nicht nur Wasser in den Abfluss, sondern auch die Tiere.
Viele Tiere finden den Tod, weil man sie erst spät entdeckt.
Darum bittet der Naturtreff Bedburg alle Hausbesitzer, einmal im Monat seinen Kellerlichtschacht zu kontrollieren. Wenn Molche oder Kröten gefunden werden bittet Naturschutzberater Rolf Thiemann, die Tiere unter Einhaltung der persönlichen Sicherungsvorgaben in einem Eimer aufzusammeln und am besten an einem geeigneten Laubhaufen oder dichtem Gebüsch wieder freizulassen. Traut man sich nicht die Tiere zu bergen gibt es vielfach bestimmt immer Hilfe in der Nachbarschaft.
Damit in Zukunft keine Tiere mehr in das Kellerloch fallen, kann man ein z.B. Fliegengitter unter das Abdeckgitter legen (hält auch Laub fern) oder ein Brett mit Querrillen als Aufstiegshilfe in das Loch schräg anlegen. Bitte auch den Einbruchschutz beachten und nicht übergehen.
Auch kann man beim Spazierengehen ab und zu mal in einen Kanalgully am Straßenrand schauen.
Sollten da Tiere festzustellen wäre es für die Tiere hilfreich die zuständigen Gemeinden oder Einrichtungen zu informieren. Auch das Ordnungsamt oder die Fachbehörden des Naturschutzes etc. könnten hier sicherlich weiterhelfen.
Autor / Aufnahme
Rolf Thiemann
Gewässer und Naturschutz im Erftkreis
Flora-Fauna-Artenschutz
Naturschutzökologie
Eisvogelweg 1
50181 Bedburg
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung. Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Viele Tiere finden den Tod, weil man sie erst spät entdeckt.
Darum bittet der Naturtreff Bedburg alle Hausbesitzer, einmal im Monat seinen Kellerlichtschacht zu kontrollieren. Wenn Molche oder Kröten gefunden werden bittet Naturschutzberater Rolf Thiemann, die Tiere unter Einhaltung der persönlichen Sicherungsvorgaben in einem Eimer aufzusammeln und am besten an einem geeigneten Laubhaufen oder dichtem Gebüsch wieder freizulassen. Traut man sich nicht die Tiere zu bergen gibt es vielfach bestimmt immer Hilfe in der Nachbarschaft.
Damit in Zukunft keine Tiere mehr in das Kellerloch fallen, kann man ein z.B. Fliegengitter unter das Abdeckgitter legen (hält auch Laub fern) oder ein Brett mit Querrillen als Aufstiegshilfe in das Loch schräg anlegen. Bitte auch den Einbruchschutz beachten und nicht übergehen.
Auch kann man beim Spazierengehen ab und zu mal in einen Kanalgully am Straßenrand schauen.
Sollten da Tiere festzustellen wäre es für die Tiere hilfreich die zuständigen Gemeinden oder Einrichtungen zu informieren. Auch das Ordnungsamt oder die Fachbehörden des Naturschutzes etc. könnten hier sicherlich weiterhelfen.
Autor / Aufnahme
Rolf Thiemann
Gewässer und Naturschutz im Erftkreis
Flora-Fauna-Artenschutz
Naturschutzökologie
Eisvogelweg 1
50181 Bedburg
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung. Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Artenschutz in Franken®
Der Bläulichviolette Tatzenkäfer (Timarcha goettingensis)

Ein Tag im Leben des Bläulichvioletten Tatzenkäfers – aus der Sicht von Timarcha goettingensis
16/17.11.2024
Und ja, der Name ist so groß wie ich! Ich bin der lilafarbene Glanzpunkt auf der Wiese, ein kleiner, kugeliger Käfer mit strahlend bläulich-violetter Rüstung, den man nicht übersehen kann – zumindest nicht, wenn man genau hinschaut. Komm, ich erzähle dir mal von meinem gemütlichen Käferleben und warum ich auf keinen Fall einen Sprint hinlege, nur weil ein Grashalm im Weg ist!
16/17.11.2024
- Hallo, hallo! Ich bin Timarcha goettingensis, besser bekannt als der Bläulichviolette Tatzenkäfer.
Und ja, der Name ist so groß wie ich! Ich bin der lilafarbene Glanzpunkt auf der Wiese, ein kleiner, kugeliger Käfer mit strahlend bläulich-violetter Rüstung, den man nicht übersehen kann – zumindest nicht, wenn man genau hinschaut. Komm, ich erzähle dir mal von meinem gemütlichen Käferleben und warum ich auf keinen Fall einen Sprint hinlege, nur weil ein Grashalm im Weg ist!
Mein Look – Bläulich-violett und schwer zu toppen
Erstmal, guck dir mein schickes Outfit an! Mein Panzer schimmert metallisch bläulich-violett – stylisch, oder? Ich brauche keine wilden Muster oder schrillen Farben. Nein, meine Farbe zeigt meinen Glanz und ist eine wunderbare Tarnung. Denn für viele Feinde sehe ich damit eher ungenießbar aus. Vielleicht bin ich auch ein bisschen eitel, aber hey, wenn man so einen schicken Panzer hat, darf man auch mal ein bisschen stolz sein.
Wo ich lebe – Ein Gourmet unter den Blattkäfern
Du findest mich auf Wiesen, in lichten Wäldern und an sonnigen Wegesrändern in Europa. Hier liebe ich es, zwischen den Blättern herumzuwandern und mich an saftigen Pflanzen zu bedienen, vor allem an den Blättern von Wegerich und Labkraut. Ja, du hast richtig gehört, ich bin ein echter Feinschmecker unter den Blattkäfern! Blätter – das ist mein Ding! Besonders die saftigen und grünen Teile, darauf fahre ich total ab. Ich bin halt ein gemütlicher Käfer; ich muss nicht schnell sein, wenn das Buffet direkt vor mir liegt.
Tatzenkäfer – Was hat es mit den "Tatzen" auf sich?
Warum ich "Tatzenkäfer" heiße? Ganz einfach: Ich habe breite, kleine Füße, die sich fest an die Pflanzen klammern können. Diese „Tatzen“ sind optimal für mein gemächliches Leben. Ich lasse mir nämlich gern Zeit beim Laufen, Essen und Herumklettern – wie ein kleines Käferchen mit Wanderschuhen. Eile? Nicht mein Ding! Ich gehöre zur Entspannungstruppe unter den Käfern und lasse mich durch nichts aus der Ruhe bringen.
Mein Spezialtrick – Das Käfer-Kaugummi
Falls mich doch mal ein Vogel oder anderes neugieriges Tier belästigen will, hab ich eine geniale Verteidigungsstrategie. Ich produziere einen roten Saft, den ich bei Gefahr absondere. Der sieht ein bisschen aus wie Kaugummisaft und schmeckt auch so eklig. Er enthält chemische Stoffe, die meine Feinde abschrecken sollen – und glaub mir, das funktioniert super! Die meisten geben sofort auf, wenn sie nur daran schnuppern. Ich sag's mal so: Mein „Käferkaugummi“ ist nicht besonders lecker, aber extrem effektiv.
Mein Tempo – Das Schneckentempo!
Jetzt verrate ich dir ein kleines Geheimnis: Ich bin vielleicht einer der langsamsten Käfer überhaupt. Schnelligkeit? Keine Chance! Wenn du mich auf einer Wiese herumwandern siehst, dann in aller Gemächlichkeit. Andere Käfer flitzen herum und klettern wie verrückt, aber nicht ich. Mein Motto lautet: „In der Ruhe liegt die Kraft.“ Und, hey, was bringt es mir, wie ein Verrückter loszurennen, wenn das nächste Blatt direkt vor mir wächst? Also geh ich Schritt für Schritt – naja, „Tatz für Tatz“ – und genieße mein Essen in Ruhe.
Familienplanung – Ganz ohne Eile
Wie sieht’s bei uns aus, wenn’s um Nachwuchs geht? Die Weibchen legen ihre Eier in den Boden, und dort bleiben die Kleinen erstmal versteckt. Die Larven sind wie ich – auch sie genießen das Leben in langsamen Zügen und wachsen in ihrem eigenen Tempo heran. Sie bleiben gern in Bodennähe, knabbern fleißig an Pflanzen herum und werden irgendwann genauso kugelrund wie ich. Ein Käferleben in Slow Motion, könnte man sagen!
Ein friedlicher Käfer mit einer wichtigen Mission
Auch wenn ich vielleicht ein bisschen faul wirke, bin ich ein wichtiger Bestandteil der Natur. Als Pflanzenfresser halte ich das Pflanzenwachstum auf den Wiesen im Gleichgewicht. Außerdem bin ich ein beliebter Futterlieferant für kleine Tiere und Vögel (wenn die sich nicht vom Käferkaugummi abschrecken lassen!). So trage ich dazu bei, dass das ganze Ökosystem im Gleichgewicht bleibt.
Also, wenn du das nächste Mal auf einer Wiese bist und einen kleinen, schillernden Käfer siehst, der wie ein lila Edelstein über die Blätter schleicht – das bin wahrscheinlich ich, Timarcha goettingensis. Und wenn du dich kurz hinsetzt und mit mir eine Pause machst, wirst du sehen: Ein bisschen Langsamkeit hat ihren Reiz!
Aufnahme von Bernhard Schmalisch
Erstmal, guck dir mein schickes Outfit an! Mein Panzer schimmert metallisch bläulich-violett – stylisch, oder? Ich brauche keine wilden Muster oder schrillen Farben. Nein, meine Farbe zeigt meinen Glanz und ist eine wunderbare Tarnung. Denn für viele Feinde sehe ich damit eher ungenießbar aus. Vielleicht bin ich auch ein bisschen eitel, aber hey, wenn man so einen schicken Panzer hat, darf man auch mal ein bisschen stolz sein.
Wo ich lebe – Ein Gourmet unter den Blattkäfern
Du findest mich auf Wiesen, in lichten Wäldern und an sonnigen Wegesrändern in Europa. Hier liebe ich es, zwischen den Blättern herumzuwandern und mich an saftigen Pflanzen zu bedienen, vor allem an den Blättern von Wegerich und Labkraut. Ja, du hast richtig gehört, ich bin ein echter Feinschmecker unter den Blattkäfern! Blätter – das ist mein Ding! Besonders die saftigen und grünen Teile, darauf fahre ich total ab. Ich bin halt ein gemütlicher Käfer; ich muss nicht schnell sein, wenn das Buffet direkt vor mir liegt.
Tatzenkäfer – Was hat es mit den "Tatzen" auf sich?
Warum ich "Tatzenkäfer" heiße? Ganz einfach: Ich habe breite, kleine Füße, die sich fest an die Pflanzen klammern können. Diese „Tatzen“ sind optimal für mein gemächliches Leben. Ich lasse mir nämlich gern Zeit beim Laufen, Essen und Herumklettern – wie ein kleines Käferchen mit Wanderschuhen. Eile? Nicht mein Ding! Ich gehöre zur Entspannungstruppe unter den Käfern und lasse mich durch nichts aus der Ruhe bringen.
Mein Spezialtrick – Das Käfer-Kaugummi
Falls mich doch mal ein Vogel oder anderes neugieriges Tier belästigen will, hab ich eine geniale Verteidigungsstrategie. Ich produziere einen roten Saft, den ich bei Gefahr absondere. Der sieht ein bisschen aus wie Kaugummisaft und schmeckt auch so eklig. Er enthält chemische Stoffe, die meine Feinde abschrecken sollen – und glaub mir, das funktioniert super! Die meisten geben sofort auf, wenn sie nur daran schnuppern. Ich sag's mal so: Mein „Käferkaugummi“ ist nicht besonders lecker, aber extrem effektiv.
Mein Tempo – Das Schneckentempo!
Jetzt verrate ich dir ein kleines Geheimnis: Ich bin vielleicht einer der langsamsten Käfer überhaupt. Schnelligkeit? Keine Chance! Wenn du mich auf einer Wiese herumwandern siehst, dann in aller Gemächlichkeit. Andere Käfer flitzen herum und klettern wie verrückt, aber nicht ich. Mein Motto lautet: „In der Ruhe liegt die Kraft.“ Und, hey, was bringt es mir, wie ein Verrückter loszurennen, wenn das nächste Blatt direkt vor mir wächst? Also geh ich Schritt für Schritt – naja, „Tatz für Tatz“ – und genieße mein Essen in Ruhe.
Familienplanung – Ganz ohne Eile
Wie sieht’s bei uns aus, wenn’s um Nachwuchs geht? Die Weibchen legen ihre Eier in den Boden, und dort bleiben die Kleinen erstmal versteckt. Die Larven sind wie ich – auch sie genießen das Leben in langsamen Zügen und wachsen in ihrem eigenen Tempo heran. Sie bleiben gern in Bodennähe, knabbern fleißig an Pflanzen herum und werden irgendwann genauso kugelrund wie ich. Ein Käferleben in Slow Motion, könnte man sagen!
Ein friedlicher Käfer mit einer wichtigen Mission
Auch wenn ich vielleicht ein bisschen faul wirke, bin ich ein wichtiger Bestandteil der Natur. Als Pflanzenfresser halte ich das Pflanzenwachstum auf den Wiesen im Gleichgewicht. Außerdem bin ich ein beliebter Futterlieferant für kleine Tiere und Vögel (wenn die sich nicht vom Käferkaugummi abschrecken lassen!). So trage ich dazu bei, dass das ganze Ökosystem im Gleichgewicht bleibt.
Also, wenn du das nächste Mal auf einer Wiese bist und einen kleinen, schillernden Käfer siehst, der wie ein lila Edelstein über die Blätter schleicht – das bin wahrscheinlich ich, Timarcha goettingensis. Und wenn du dich kurz hinsetzt und mit mir eine Pause machst, wirst du sehen: Ein bisschen Langsamkeit hat ihren Reiz!
Aufnahme von Bernhard Schmalisch
Artenschutz in Franken®
Artenschutz in abgefischten Karpfenteichen?

Artenschutz in abgefischten Karpfenteichen?
15/16.11.2024
Der Herbstputz für den Lebensraum
Wenn der Karpfenteich abgefischt wird, geschieht das üblicherweise im Herbst. Dabei wird das Wasser abgelassen und die Karpfen sowie andere Fische werden eingesammelt.
Klingt erst mal wie eine große „Umräumaktion“ – doch gerade diese Reinigung bringt viele Vorteile für die Natur! Durch das Ablassen des Wassers wird der Teichgrund freigelegt und kann sich regenerieren. Pflanzenreste, abgestorbene Biomasse und Algen werden dabei quasi wie ein Herbstlaub-Haufen entfernt, was den Nährstoffgehalt im Wasser für die nächste Saison reduziert. Weniger Nährstoffe bedeuten bessere Lebensbedingungen für viele heimische Wasserpflanzen und -tiere, da das Wasser nicht mehr so schnell „umkippt“.
15/16.11.2024
- Na klar, ich erkläre es dir so, dass der Artenschutz in abgefischten Karpfenteichen nicht nur logisch, sondern fast schon „karpfig“ klingt!
Der Herbstputz für den Lebensraum
Wenn der Karpfenteich abgefischt wird, geschieht das üblicherweise im Herbst. Dabei wird das Wasser abgelassen und die Karpfen sowie andere Fische werden eingesammelt.
Klingt erst mal wie eine große „Umräumaktion“ – doch gerade diese Reinigung bringt viele Vorteile für die Natur! Durch das Ablassen des Wassers wird der Teichgrund freigelegt und kann sich regenerieren. Pflanzenreste, abgestorbene Biomasse und Algen werden dabei quasi wie ein Herbstlaub-Haufen entfernt, was den Nährstoffgehalt im Wasser für die nächste Saison reduziert. Weniger Nährstoffe bedeuten bessere Lebensbedingungen für viele heimische Wasserpflanzen und -tiere, da das Wasser nicht mehr so schnell „umkippt“.
Karpfen sind die „Bodenwühler“ der Teiche
Karpfen gelten als Bodenschlamm-Wühler, was auf Dauer zu einer starken Aufwirbelung und Trübung des Wassers führt. Wenn man die Karpfen jährlich abfischt, gönnt man anderen Arten eine kleine „Bodenpause“. Beispielsweise können empfindlichere Arten wie Amphibienlarven oder Libellenlarven dann besser überleben, weil sie klareres Wasser und einen stabileren Lebensraum haben. Also: Durch den Abfisch-Eingriff wird die Teichökologie gewissermaßen „feingetunt“, sodass auch die leisen Bewohner wieder die Chance haben, ihre Wasser-Ruheplätze zu genießen.
Der Teich als Vogel-Buffet
Nach dem Abfischen und dem Trockenlegen des Teichs verwandelt sich der Teichboden für Zugvögel in ein wahres Schlaraffenland. Die Vögel lieben den „Schlamm-Restaurant-Teich“ und picken die vielen im Boden verbleibenden Kleintiere auf, etwa Würmer, Schnecken und Insektenlarven. Besonders Zugvögel wie Kraniche und Störche legen auf dem Weg in den Süden gerne einen Zwischenstopp auf dem „Trockengelegten“ ein. Der abgefischte Teich wird so zu einem wichtigen „Biodiversity Drive-Thru“ für viele bedrohte Vogelarten.
Biodiversität durch Artenvielfalt
Wenn sich im Winter der Teichboden eine Zeit lang „ausruhen“ darf, entstehen in den Teichen kleine Tümpel und Pfützen, die für kurzlebige Arten wie bestimmte Molche und Frösche besonders attraktiv sind. Diese kleinen Wasserbereiche bieten den Tieren ideale Laichplätze, da sie vor Fressfeinden wie großen Fischen besser geschützt sind. Der Abfisch-Prozess und die zeitweise Trockenlegung schaffen also kurze, aber wichtige Phasen der „Ruhe vor dem großen Karpfen“ – und das fördert die Vielfalt im Teich.
„Abfischen“ als Win-Win für Mensch und Natur
Nicht zuletzt ist der abgefischte Karpfenteich ein Beispiel für eine nachhaltige, naturnahe Nutzung von Ökosystemen. Durch den jährlichen Rhythmus des Abfischens bleibt der Teich lebendig und das Wasser ist frischer und gesünder – so profitieren die Fischzucht und der Artenschutz gleichzeitig.
In der Aufnahme
Karpfen gelten als Bodenschlamm-Wühler, was auf Dauer zu einer starken Aufwirbelung und Trübung des Wassers führt. Wenn man die Karpfen jährlich abfischt, gönnt man anderen Arten eine kleine „Bodenpause“. Beispielsweise können empfindlichere Arten wie Amphibienlarven oder Libellenlarven dann besser überleben, weil sie klareres Wasser und einen stabileren Lebensraum haben. Also: Durch den Abfisch-Eingriff wird die Teichökologie gewissermaßen „feingetunt“, sodass auch die leisen Bewohner wieder die Chance haben, ihre Wasser-Ruheplätze zu genießen.
Der Teich als Vogel-Buffet
Nach dem Abfischen und dem Trockenlegen des Teichs verwandelt sich der Teichboden für Zugvögel in ein wahres Schlaraffenland. Die Vögel lieben den „Schlamm-Restaurant-Teich“ und picken die vielen im Boden verbleibenden Kleintiere auf, etwa Würmer, Schnecken und Insektenlarven. Besonders Zugvögel wie Kraniche und Störche legen auf dem Weg in den Süden gerne einen Zwischenstopp auf dem „Trockengelegten“ ein. Der abgefischte Teich wird so zu einem wichtigen „Biodiversity Drive-Thru“ für viele bedrohte Vogelarten.
Biodiversität durch Artenvielfalt
Wenn sich im Winter der Teichboden eine Zeit lang „ausruhen“ darf, entstehen in den Teichen kleine Tümpel und Pfützen, die für kurzlebige Arten wie bestimmte Molche und Frösche besonders attraktiv sind. Diese kleinen Wasserbereiche bieten den Tieren ideale Laichplätze, da sie vor Fressfeinden wie großen Fischen besser geschützt sind. Der Abfisch-Prozess und die zeitweise Trockenlegung schaffen also kurze, aber wichtige Phasen der „Ruhe vor dem großen Karpfen“ – und das fördert die Vielfalt im Teich.
„Abfischen“ als Win-Win für Mensch und Natur
Nicht zuletzt ist der abgefischte Karpfenteich ein Beispiel für eine nachhaltige, naturnahe Nutzung von Ökosystemen. Durch den jährlichen Rhythmus des Abfischens bleibt der Teich lebendig und das Wasser ist frischer und gesünder – so profitieren die Fischzucht und der Artenschutz gleichzeitig.
In der Aufnahme
- Abgelassener Fischteich ...temporäre Chance für die Biodiversität
Artenschutz in Franken®
Der Metallgrüne Schenkelkäfer (Chrysanthia viridissima)

Ein Tag im Leben des Metallgrünen Schenkelkäfers – aus der Sicht von Chrysanthia viridissima
15/16.11.2024
Hast du schon mal so ein grün-goldenes Glitzern gesehen? Ich bin quasi der Juwel unter den Käfern und stolz drauf! Komm mit, ich erzähl dir mal von meinem schimmernden Käferleben – mit einem Mix aus Wissenschaft und Spaß.
15/16.11.2024
- Hey du! Ja, du da! Ich bin's, Chrysanthia viridissima, der eine und einzige Metallgrüne Schenkelkäfer.
Hast du schon mal so ein grün-goldenes Glitzern gesehen? Ich bin quasi der Juwel unter den Käfern und stolz drauf! Komm mit, ich erzähl dir mal von meinem schimmernden Käferleben – mit einem Mix aus Wissenschaft und Spaß.
Mein Auftritt – Schillernd und immer top gestylt
Erst mal muss ich sagen, ich seh einfach fantastisch aus. Mein Panzer leuchtet metallisch grün und schimmert, als hätte ich mich in Goldstaub gewälzt. Das kommt von winzig kleinen Strukturen auf meinem Chitinpanzer, die das Licht brechen. Wie ein Regenbogen, aber besser – schließlich bin ich ja ein Käfer mit Stil. Warum bin ich so bunt? Na ja, das ist so eine Art Tarnung und Abschreckung zugleich. Die meisten Feinde denken: "Boah, der glänzt! Der ist bestimmt giftig!" Stimmt zwar nicht, aber hey, ich lass sie das ruhig glauben.
Wo ich lebe – Auf der Suche nach Nektar
Du findest mich meistens in sonnigen Wäldern, Waldrändern und auf blühenden Wiesen in Europa, vor allem von Frühling bis zum Hochsommer. Wenn du mich sehen willst, schau bei den Doldenblütlern vorbei – da hänge ich oft rum. Ich liebe diese Pflanzen, denn sie bieten das beste Nektar-Buffet der Natur. Doldenblütler wie die Wilde Möhre oder der Fenchel haben die leckersten Blütenstände – und die ziehe ich mir gern rein. Ein Leben als Käfer bedeutet für mich: Blüte für Blüte durchsuchen und genießen.
Was esse ich? Naschkatze des Waldes
Als erwachsener Käfer ernähre ich mich hauptsächlich von Pollen und Nektar. So süß und klebrig – einfach lecker! Manchmal bekomme ich sogar ein bisschen was von dem Blütenstaub ins Gesicht. Aber hey, das gehört dazu. Früher, als Larve, habe ich noch Holz gegessen – ja, richtig gehört, ich war ein Holzschredder! Damals lebte ich in verrottendem Holz und habe ordentlich reingehauen. Heute aber genieße ich nur noch Blütenleckereien. Als Erwachsener wird man halt anspruchsvoller.
Lebensweise – Glitzer mit Haltung
Mein Körper ist nicht nur ein Hingucker, sondern auch mein Schutzschild. Und falls mir doch mal jemand zu nahe kommt, habe ich eine kleine Notfallstrategie: Ich lasse mich einfach fallen und spiele tot. Das ist der sogenannte "Schreckstarre-Modus". Funktioniert prima, vor allem wenn man irgendwo hoch oben in einer Blüte sitzt – runterfallen und dann stillhalten. Die meisten Fressfeinde verlieren schnell das Interesse, und ich kann mich heimlich davonmachen.
Familie und Nachwuchs – Ganz schön holzig
Wenn es um die nächste Generation geht, legen wir Schenkelkäfer-Weibchen unsere Eier auf morsches Holz ab, am liebsten in feuchter Umgebung. Die Kleinen, also die Larven, schlüpfen dann und verbringen ihre Zeit im Holz, wo sie sich durch die Fasern futtern. Ein Leben als Larve kann schon mal 1-2 Jahre dauern. Das mag lang erscheinen, aber hey, gutes Käferwerden braucht eben Zeit. Wenn sie sich dann in erwachsene Käfer verwandeln, heißt es ab ins Sonnenlicht und die Welt erobern!
Mein Name – Schenkelkäfer?
Jetzt fragst du dich vielleicht, warum man mich ausgerechnet "Schenkelkäfer" nennt? Gute Frage. Wahrscheinlich, weil ich relativ starke, kräftige Hinterbeine habe – die brauche ich für meinen Käfer-Workout, also um durch die Pflanzen zu klettern und zu flitzen, wenn es nötig ist. Vielleicht hätte man mich besser "Metallgrüner Muskelkäfer" nennen sollen, aber hey, ich hab den Namen ja nicht ausgesucht. Schenkelkäfer klingt auch irgendwie witzig, oder?
Bedrohtes Käferglück – Warum ich auf euch angewiesen bin
Leider werden wir Schenkelkäfer seltener, weil alte Wälder und Totholzplätze immer weniger werden. Manchmal ist es schwierig, genug Verstecke und Nahrungsplätze zu finden. Doch es gibt Hoffnung: Viele Menschen setzen sich dafür ein, dass alte Bäume stehen bleiben und die Natur nicht überall „aufgeräumt“ wird. Schließlich sind wir Käfer auch Teil des Ökosystems – wir bestäuben Blüten und helfen beim Zersetzen von altem Holz. Also, wenn du das nächste Mal in den Wald gehst, lass ein paar alte Bäume stehen, okay?
So, und jetzt entschuldige mich – ich hab noch ein paar Blüten zu naschen!
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
Erst mal muss ich sagen, ich seh einfach fantastisch aus. Mein Panzer leuchtet metallisch grün und schimmert, als hätte ich mich in Goldstaub gewälzt. Das kommt von winzig kleinen Strukturen auf meinem Chitinpanzer, die das Licht brechen. Wie ein Regenbogen, aber besser – schließlich bin ich ja ein Käfer mit Stil. Warum bin ich so bunt? Na ja, das ist so eine Art Tarnung und Abschreckung zugleich. Die meisten Feinde denken: "Boah, der glänzt! Der ist bestimmt giftig!" Stimmt zwar nicht, aber hey, ich lass sie das ruhig glauben.
Wo ich lebe – Auf der Suche nach Nektar
Du findest mich meistens in sonnigen Wäldern, Waldrändern und auf blühenden Wiesen in Europa, vor allem von Frühling bis zum Hochsommer. Wenn du mich sehen willst, schau bei den Doldenblütlern vorbei – da hänge ich oft rum. Ich liebe diese Pflanzen, denn sie bieten das beste Nektar-Buffet der Natur. Doldenblütler wie die Wilde Möhre oder der Fenchel haben die leckersten Blütenstände – und die ziehe ich mir gern rein. Ein Leben als Käfer bedeutet für mich: Blüte für Blüte durchsuchen und genießen.
Was esse ich? Naschkatze des Waldes
Als erwachsener Käfer ernähre ich mich hauptsächlich von Pollen und Nektar. So süß und klebrig – einfach lecker! Manchmal bekomme ich sogar ein bisschen was von dem Blütenstaub ins Gesicht. Aber hey, das gehört dazu. Früher, als Larve, habe ich noch Holz gegessen – ja, richtig gehört, ich war ein Holzschredder! Damals lebte ich in verrottendem Holz und habe ordentlich reingehauen. Heute aber genieße ich nur noch Blütenleckereien. Als Erwachsener wird man halt anspruchsvoller.
Lebensweise – Glitzer mit Haltung
Mein Körper ist nicht nur ein Hingucker, sondern auch mein Schutzschild. Und falls mir doch mal jemand zu nahe kommt, habe ich eine kleine Notfallstrategie: Ich lasse mich einfach fallen und spiele tot. Das ist der sogenannte "Schreckstarre-Modus". Funktioniert prima, vor allem wenn man irgendwo hoch oben in einer Blüte sitzt – runterfallen und dann stillhalten. Die meisten Fressfeinde verlieren schnell das Interesse, und ich kann mich heimlich davonmachen.
Familie und Nachwuchs – Ganz schön holzig
Wenn es um die nächste Generation geht, legen wir Schenkelkäfer-Weibchen unsere Eier auf morsches Holz ab, am liebsten in feuchter Umgebung. Die Kleinen, also die Larven, schlüpfen dann und verbringen ihre Zeit im Holz, wo sie sich durch die Fasern futtern. Ein Leben als Larve kann schon mal 1-2 Jahre dauern. Das mag lang erscheinen, aber hey, gutes Käferwerden braucht eben Zeit. Wenn sie sich dann in erwachsene Käfer verwandeln, heißt es ab ins Sonnenlicht und die Welt erobern!
Mein Name – Schenkelkäfer?
Jetzt fragst du dich vielleicht, warum man mich ausgerechnet "Schenkelkäfer" nennt? Gute Frage. Wahrscheinlich, weil ich relativ starke, kräftige Hinterbeine habe – die brauche ich für meinen Käfer-Workout, also um durch die Pflanzen zu klettern und zu flitzen, wenn es nötig ist. Vielleicht hätte man mich besser "Metallgrüner Muskelkäfer" nennen sollen, aber hey, ich hab den Namen ja nicht ausgesucht. Schenkelkäfer klingt auch irgendwie witzig, oder?
Bedrohtes Käferglück – Warum ich auf euch angewiesen bin
Leider werden wir Schenkelkäfer seltener, weil alte Wälder und Totholzplätze immer weniger werden. Manchmal ist es schwierig, genug Verstecke und Nahrungsplätze zu finden. Doch es gibt Hoffnung: Viele Menschen setzen sich dafür ein, dass alte Bäume stehen bleiben und die Natur nicht überall „aufgeräumt“ wird. Schließlich sind wir Käfer auch Teil des Ökosystems – wir bestäuben Blüten und helfen beim Zersetzen von altem Holz. Also, wenn du das nächste Mal in den Wald gehst, lass ein paar alte Bäume stehen, okay?
So, und jetzt entschuldige mich – ich hab noch ein paar Blüten zu naschen!
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- Metallgrüner Schenkelkäfer (Chrysanthia viridissima)
Artenschutz in Franken®
Wenn Wiesen sterben und zu grünen "Wüsten" werden ...

Wenn Wiesen sterben und zu grünen "Wüsten" werden ...
14/15.11.2024
Es ist, als würde ein dichter Vorhang auf mein Antlitz fallen, und der Atem meiner zarten Pflanzen, der Insekten, die mich umgarnen, wird durch diese schwere Last bedrückt.
14/15.11.2024
- Als Wiese, als ein buntes Mosaik voller Vielfalt, betrachte ich es mit wachsender Sorge, wenn ein Schleier von Gülle auf meinen Boden gelegt wird.
Es ist, als würde ein dichter Vorhang auf mein Antlitz fallen, und der Atem meiner zarten Pflanzen, der Insekten, die mich umgarnen, wird durch diese schwere Last bedrückt.
Die Gülle, die aus Feldern und Ställen stammt, ist reich an Nährstoffen – zu reich für die natürlichen Prozesse, die sich hier über Generationen eingespielt haben. Stickstoff und Phosphor, in einer solchen Menge wie sie in der Gülle vorkommen, sind mächtige Werkzeuge des Wachstums – doch sie sind auch scharf und verändernd. Meine Bodenorganismen, die feinen Pilze und Mikroben, die still und harmonisch in einem komplexen Netz arbeiten, finden sich überfordert. Sie kämpfen mit der plötzlichen Überdosis, und manche beginnen gar, daran zu ersticken.
Mit der Zeit steigen die besonders stickstoffliebenden Pflanzen in ihrer Zahl und Dominanz. Kräftige Gräser, die den zusätzlichen Stickstoff mit einem unstillbaren Hunger aufsaugen, beginnen, die Oberhand zu gewinnen. Kleearten und andere Stickstoff bindende Pflanzen, die früher durch die natürliche Balance eine gewisse Bedeutung hatten, verlieren an Bedeutung – sie werden schlicht überflüssig. Blumen, die empfindlicher sind und deren Wurzeln sich an bescheidenere Nährstoffverhältnisse angepasst haben, verkümmern. Ihre leuchtenden Farben verblassen, ihre zarten Stängel geben nach, und sie verschwinden aus dem Bild, das ich als Wiese einst stolz gezeigt habe.
Ohne die Blumen fehlen auch die Insekten, die ihre Blüten bestäubten und sie beständig umschwirrten. Wildbienen, Schmetterlinge, Käfer und Heuschrecken, die von einer vielfältigen Flora abhängig sind, finden hier keinen Lebensraum mehr. Was bleibt, sind robuste Arten, die sich in der Monokultur ausbreiten können, aber die komplexen Wechselbeziehungen, die das Leben der Wiese einst so reich machten, verlieren an Tiefe und Breite.
Die Wurzeln, die sich tief verzweigten und gemeinsam die Erde festhielten, um den Regen aufzufangen und das Wasser sanft abzugeben, sie weichen einer oberflächlichen Dichte von Gräsern. Der Boden wird anfälliger für Erosion, seine Struktur verliert an Stabilität und Vielfalt, so wie die gesamte Pflanzengesellschaft, die hier einst lebte. Die Wasserspeicherung leidet, und bei starkem Regen rinnt das Wasser ungebremst an die tiefsten Punkte, nimmt Bodenpartikel mit und hinterlässt kahle Stellen.
Und so verändere ich mich. Ich, die einst ein Heim war für unzählige Pflanzen- und Tierarten, ein Bild von Stabilität und Ausgewogenheit. Jetzt bin ich ein Bild der Einfalt, geprägt von einer Handvoll robuster, anspruchsloser Gräser und Kräuter, die in der Lage sind, den Überfluss der Nährstoffe zu überleben, aber nicht die Vielfalt des Lebens zu tragen. Die Gülle, die als Nahrung gedacht war, wurde zu einer Last, die zu schwer war, und ich trage die Narben dieser Überfülle, die für das menschliche Auge vielleicht nicht sichtbar sind, doch für die Lebewesen, die mich einst bewohnten, umso spürbarer.
So verweile ich in dieser Stille – nicht mehr ein Ort der Vielfalt, sondern ein vereinfachtes Abbild dessen, was ich einst war.
In der Aufnahme
Mit der Zeit steigen die besonders stickstoffliebenden Pflanzen in ihrer Zahl und Dominanz. Kräftige Gräser, die den zusätzlichen Stickstoff mit einem unstillbaren Hunger aufsaugen, beginnen, die Oberhand zu gewinnen. Kleearten und andere Stickstoff bindende Pflanzen, die früher durch die natürliche Balance eine gewisse Bedeutung hatten, verlieren an Bedeutung – sie werden schlicht überflüssig. Blumen, die empfindlicher sind und deren Wurzeln sich an bescheidenere Nährstoffverhältnisse angepasst haben, verkümmern. Ihre leuchtenden Farben verblassen, ihre zarten Stängel geben nach, und sie verschwinden aus dem Bild, das ich als Wiese einst stolz gezeigt habe.
Ohne die Blumen fehlen auch die Insekten, die ihre Blüten bestäubten und sie beständig umschwirrten. Wildbienen, Schmetterlinge, Käfer und Heuschrecken, die von einer vielfältigen Flora abhängig sind, finden hier keinen Lebensraum mehr. Was bleibt, sind robuste Arten, die sich in der Monokultur ausbreiten können, aber die komplexen Wechselbeziehungen, die das Leben der Wiese einst so reich machten, verlieren an Tiefe und Breite.
Die Wurzeln, die sich tief verzweigten und gemeinsam die Erde festhielten, um den Regen aufzufangen und das Wasser sanft abzugeben, sie weichen einer oberflächlichen Dichte von Gräsern. Der Boden wird anfälliger für Erosion, seine Struktur verliert an Stabilität und Vielfalt, so wie die gesamte Pflanzengesellschaft, die hier einst lebte. Die Wasserspeicherung leidet, und bei starkem Regen rinnt das Wasser ungebremst an die tiefsten Punkte, nimmt Bodenpartikel mit und hinterlässt kahle Stellen.
Und so verändere ich mich. Ich, die einst ein Heim war für unzählige Pflanzen- und Tierarten, ein Bild von Stabilität und Ausgewogenheit. Jetzt bin ich ein Bild der Einfalt, geprägt von einer Handvoll robuster, anspruchsloser Gräser und Kräuter, die in der Lage sind, den Überfluss der Nährstoffe zu überleben, aber nicht die Vielfalt des Lebens zu tragen. Die Gülle, die als Nahrung gedacht war, wurde zu einer Last, die zu schwer war, und ich trage die Narben dieser Überfülle, die für das menschliche Auge vielleicht nicht sichtbar sind, doch für die Lebewesen, die mich einst bewohnten, umso spürbarer.
So verweile ich in dieser Stille – nicht mehr ein Ort der Vielfalt, sondern ein vereinfachtes Abbild dessen, was ich einst war.
In der Aufnahme
- Was vormals eine artenreiche Wiese war ist nun zu einem braungrünen artenfernen "Grünland" verkommen ...
Artenschutz in Franken®
Der Scharlachrote Plattkäfer (Cucujus cinnaberinus)

Ein Tag im Leben des Scharlachroten Plattkäfers – aus der Sicht von Cucujus cinnaberinus
14/15.11.2024
Manche nennen mich auch den "Karminroten Baumbewohner," aber das klingt doch viel zu förmlich, oder? Hier gebe ich dir mal einen Einblick in mein aufregendes Käferleben, denn bei uns geht es mehr ab, als du vielleicht denkst.
14/15.11.2024
- Hallo! Ja, genau, du siehst richtig: Ich bin knallrot und ziemlich platt. Ein echter Scharlachroter Plattkäfer!
Manche nennen mich auch den "Karminroten Baumbewohner," aber das klingt doch viel zu förmlich, oder? Hier gebe ich dir mal einen Einblick in mein aufregendes Käferleben, denn bei uns geht es mehr ab, als du vielleicht denkst.
Wer bin ich?
Ich bin ein richtiges Unikat – leuchtend rot, maximal 1,5 Zentimeter lang, und wenn ich ehrlich bin, ziemlich dünn. Ja, schlank wie eine Kreditkarte, könnte man sagen, oder zumindest ein halber Daumennagel. Mein knalliges Rot ist keine Modewahl, sondern eine clevere Tarnung: das Rot signalisiert vielen Fressfeinden, dass ich ungenießbar bin. Sie kommen näher, sehen das Scharlachrot und denken: "Oh, lieber nicht!" Ha, funktioniert prima.
Wo lebe ich?
Du findest mich hauptsächlich in Europa, am liebsten in alten Wäldern. Aber keine Sorge, ich suche keine Aussichtspunkte. Ich wohne am liebsten unter der Rinde toter Bäume – vor allem von Eschen, Eichen oder Buchen. Die Rinde ist wie ein kleines Dach für mich, schützt mich vor Regen und Wind, und dort finde ich auch mein Essen.
Was esse ich?
Nun, ich bin zwar rot, aber kein Vegetarier. Auf meiner Speisekarte stehen andere kleine Insekten und Larven, die ich unter der Rinde entdecke. Das ist manchmal wie ein Buffet: Man weiß nie genau, was man findet. Und je nach Jahreszeit wird’s manchmal auch etwas knapper. Aber hey, ich bin ja ein robuster Käfer! Falls ich mal nichts finde, gehe ich einfach ein bisschen schlafen und warte auf bessere Zeiten. Geduld ist meine Stärke.
Ein richtiges Käferwunder: Mein Lebenszyklus
Ach, meine Kindheit! Als Larve war ich – wie soll ich sagen – nicht besonders hübsch. Längliche Form, bräunlich, und ich habe zwei Jahre gebraucht, um mich zum schönen roten Käfer zu verwandeln, der ich heute bin. Meine Larvenzeit verbringe ich ebenfalls unter der Rinde. Dort fresse ich, wachse und verstecke mich, bis ich bereit bin, mich zu verpuppen und schließlich zu einem richtigen Käfer zu werden.Im Frühling krieche ich dann aus meiner Verpuppung, voll ausgefärbt und bereit für die Käferwelt! Ein bisschen wie ein Frühjahrsputz, nur dass ich danach eine neue „Schale“ habe.
Meine Feinde und mein Überlebensstil
Natürlich habe ich auch Feinde. Vögel versuchen manchmal, mich zu erwischen, aber wie gesagt, mein leuchtendes Rot hält viele von ihnen fern. Außerdem bin ich gut getarnt und lebe unter der Rinde – da kommen die meisten Fressfeinde gar nicht hin. Sollte es trotzdem brenzlig werden, habe ich noch eine kleine Geheimwaffe: Ich tue einfach so, als wäre ich tot! Die "Totstellen"-Strategie funktioniert oft hervorragend, um Angreifer zu verwirren.
Die Kunst des Überlebens – Ein Käfer mit Humor
Manchmal muss man das Käferleben auch mit Humor nehmen. Stell dir vor, du versuchst, unter einer Rinde zu krabbeln und bleibst mit deinem "flachen" Körper stecken. Schon vorgekommen! Aber hey, mit etwas Zappeln und Kämpfen schaffe ich es dann meistens wieder heraus. Die Natur hat mich halt perfekt für das Leben unter der Baumrinde gemacht, und das ist eigentlich echt gemütlich.
Einmal, da wollte ein neugieriger Specht an mich heran, doch ich bin einfach wie ein Blatt platt geworden. Der Specht hat mich angeschaut und ist dann enttäuscht abgezogen. Ach, was für ein Abenteuer!
Vom Aussterben bedroht – Kämpfer für die Rinde!
Obwohl ich ziemlich cool bin, ist mein Leben kein Zuckerschlecken. Alte Wälder und Totholz verschwinden zunehmend, und genau diese Bäume brauche ich, um zu überleben. Ich mag es nämlich nur unter abblätternder Rinde, die schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Wenn alte Bäume verschwinden, wird es eng für uns Scharlachrote Plattkäfer. Zum Glück setzen sich manche Menschen für unsere Wälder ein, damit wir weiterhin in Ruhe unter der Rinde hausen können. Ich hoffe, sie retten genug alte Bäume, damit meine Freunde und ich weiterhin unser Rindenleben genießen können.
Also, wenn du mich das nächste Mal siehst, denk daran: Ich bin nicht nur rot, flach und schlank, sondern auch ein echter Kämpfer!
Aufnahme von Klaus Bernhard Schmalisch
Ich bin ein richtiges Unikat – leuchtend rot, maximal 1,5 Zentimeter lang, und wenn ich ehrlich bin, ziemlich dünn. Ja, schlank wie eine Kreditkarte, könnte man sagen, oder zumindest ein halber Daumennagel. Mein knalliges Rot ist keine Modewahl, sondern eine clevere Tarnung: das Rot signalisiert vielen Fressfeinden, dass ich ungenießbar bin. Sie kommen näher, sehen das Scharlachrot und denken: "Oh, lieber nicht!" Ha, funktioniert prima.
Wo lebe ich?
Du findest mich hauptsächlich in Europa, am liebsten in alten Wäldern. Aber keine Sorge, ich suche keine Aussichtspunkte. Ich wohne am liebsten unter der Rinde toter Bäume – vor allem von Eschen, Eichen oder Buchen. Die Rinde ist wie ein kleines Dach für mich, schützt mich vor Regen und Wind, und dort finde ich auch mein Essen.
Was esse ich?
Nun, ich bin zwar rot, aber kein Vegetarier. Auf meiner Speisekarte stehen andere kleine Insekten und Larven, die ich unter der Rinde entdecke. Das ist manchmal wie ein Buffet: Man weiß nie genau, was man findet. Und je nach Jahreszeit wird’s manchmal auch etwas knapper. Aber hey, ich bin ja ein robuster Käfer! Falls ich mal nichts finde, gehe ich einfach ein bisschen schlafen und warte auf bessere Zeiten. Geduld ist meine Stärke.
Ein richtiges Käferwunder: Mein Lebenszyklus
Ach, meine Kindheit! Als Larve war ich – wie soll ich sagen – nicht besonders hübsch. Längliche Form, bräunlich, und ich habe zwei Jahre gebraucht, um mich zum schönen roten Käfer zu verwandeln, der ich heute bin. Meine Larvenzeit verbringe ich ebenfalls unter der Rinde. Dort fresse ich, wachse und verstecke mich, bis ich bereit bin, mich zu verpuppen und schließlich zu einem richtigen Käfer zu werden.Im Frühling krieche ich dann aus meiner Verpuppung, voll ausgefärbt und bereit für die Käferwelt! Ein bisschen wie ein Frühjahrsputz, nur dass ich danach eine neue „Schale“ habe.
Meine Feinde und mein Überlebensstil
Natürlich habe ich auch Feinde. Vögel versuchen manchmal, mich zu erwischen, aber wie gesagt, mein leuchtendes Rot hält viele von ihnen fern. Außerdem bin ich gut getarnt und lebe unter der Rinde – da kommen die meisten Fressfeinde gar nicht hin. Sollte es trotzdem brenzlig werden, habe ich noch eine kleine Geheimwaffe: Ich tue einfach so, als wäre ich tot! Die "Totstellen"-Strategie funktioniert oft hervorragend, um Angreifer zu verwirren.
Die Kunst des Überlebens – Ein Käfer mit Humor
Manchmal muss man das Käferleben auch mit Humor nehmen. Stell dir vor, du versuchst, unter einer Rinde zu krabbeln und bleibst mit deinem "flachen" Körper stecken. Schon vorgekommen! Aber hey, mit etwas Zappeln und Kämpfen schaffe ich es dann meistens wieder heraus. Die Natur hat mich halt perfekt für das Leben unter der Baumrinde gemacht, und das ist eigentlich echt gemütlich.
Einmal, da wollte ein neugieriger Specht an mich heran, doch ich bin einfach wie ein Blatt platt geworden. Der Specht hat mich angeschaut und ist dann enttäuscht abgezogen. Ach, was für ein Abenteuer!
Vom Aussterben bedroht – Kämpfer für die Rinde!
Obwohl ich ziemlich cool bin, ist mein Leben kein Zuckerschlecken. Alte Wälder und Totholz verschwinden zunehmend, und genau diese Bäume brauche ich, um zu überleben. Ich mag es nämlich nur unter abblätternder Rinde, die schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Wenn alte Bäume verschwinden, wird es eng für uns Scharlachrote Plattkäfer. Zum Glück setzen sich manche Menschen für unsere Wälder ein, damit wir weiterhin in Ruhe unter der Rinde hausen können. Ich hoffe, sie retten genug alte Bäume, damit meine Freunde und ich weiterhin unser Rindenleben genießen können.
Also, wenn du mich das nächste Mal siehst, denk daran: Ich bin nicht nur rot, flach und schlank, sondern auch ein echter Kämpfer!
Aufnahme von Klaus Bernhard Schmalisch
- Scharlachroter Plattkäfer (Cucujus cinnaberinus)
Artenschutz in Franken®
Wildschweine wühlen gerne ... Wiesen um ...

Wildschweine wühlen gerne ... Wiesen um ...
13/14.11.2024
Und nein, du suchst hier nicht nach einer simplen Gras-Mahlzeit. Du bist auf der Jagd nach einem wahren Festmahl: nach allem, was sich darunter versteckt. Würmer, Larven, Wurzeln, Käfer – die besten Leckereien verbergen sich unter der Oberfläche. Warum also nicht ein bisschen umgraben?
13/14.11.2024
- Stell dir vor, du bist ein Wildschwein, und du siehst eine grüne, saftige Wiese vor dir. Für dich ist das nicht einfach nur ein bisschen Gras – das ist ein riesiges Buffet!
Und nein, du suchst hier nicht nach einer simplen Gras-Mahlzeit. Du bist auf der Jagd nach einem wahren Festmahl: nach allem, was sich darunter versteckt. Würmer, Larven, Wurzeln, Käfer – die besten Leckereien verbergen sich unter der Oberfläche. Warum also nicht ein bisschen umgraben?
Der Lebensraum eines Gourmets
Wildschweine haben eine richtige Spürnase und einen feinen Geschmack, wenn es um Insekten und kleine Bodenbewohner geht. Diese stecken oft ein paar Zentimeter tief unter der Erde. Deine Schnauze ist dabei das perfekte Werkzeug: Sie ist robust, beweglich und sogar ziemlich stark. Wenn du wühlst, schiebst du die Erde zur Seite und machst dich auf die Suche nach den kleinen Proteinhäppchen, die dich stark und gesund halten. Einem Wildschwein nach zu urteilen, hat so ein Regenwurm durchaus das Zeug zum Gourmet-Snack!
Fitnessprogramm inklusive
Und dann muss man auch daran denken, dass das Graben nicht nur die Speisekammer öffnet, sondern auch ein bisschen Bewegung bringt. Wildschweine sind stämmig, aber sie brauchen trotzdem ihre tägliche Dosis Bewegung. Und da kommt das Graben wie gerufen – es ist quasi ein Full-Body-Workout für die Schweine, das die Muskeln stärkt und das Schwein fit hält. Schließlich braucht man ja Energie, wenn man den ganzen Tag durch die Wälder und Wiesen streift.
Natur als Vorratskammer und Buffet
Aus Wildschwein-Perspektive sieht die Wiese also nicht nur schön aus, sondern sie ist ein Versteck für alles, was sich lohnt zu finden. Die Tatsache, dass sich Menschen manchmal über das Ergebnis der Graberei ärgern, verstehen Wildschweine natürlich nicht. Ein menschlicher Rasen ist für sie einfach die Natur, die leckeres Futter und Abenteuer verspricht.
Die soziale Komponente: Wildschwein trifft Wildschwein
Nicht zu vergessen ist der soziale Aspekt! Ein Wildschwein scharrt selten allein. Oft ist die ganze Rotte unterwegs – von Mama über Onkel Eber bis zu den kleinen Frischlingen, alle machen mit. Wenn einer anfängt zu wühlen, wird es ein regelrechtes Event: "Oh, schau mal, da hat der Hans ein besonders fettes Wurzelstück gefunden!" Da geht's zu wie bei einem Familienessen. Und wenn dann der ein oder andere Regenwurm aus dem Loch guckt, kommt ein neuer Schwung in die Runde.
Fazit aus Wildschwein-Sicht
Das Umgraben ist also quasi wie eine wilde Schnitzeljagd durch den Untergrund. Keine Wiese ist sicher, denn das nächste Festmahl könnte sich genau unter der Grasnarbe befinden. Aus ihrer Sicht tun sie eigentlich nur das, was die Natur ihnen vorgegeben hat: mit Begeisterung, Teamgeist und ordentlich Grunzen der Nase nachgehen.
In der Aufnahme
- Frisch umgegrabene Wiese ... hier hatten einige Wildschweine nach Nahrung gesucht.
Artenschutz in Franken®
Erste Geburten in der Kinderstube Helgoländer Düne

Robbensaison 2024: Erste Geburten in der Kinderstube Helgoländer Düne
13/14.11.2024
Seit der ersten Kegelrobbengeburt im Winter 1996/97 stieg die Geburtenzahl jährlich an. Die letzten Jahre wurden zwischen 700 und 800 Jungtiere geboren. Der unter Naturschutz stehende Kegelrobbenbestand wird auf Helgoland im Rahmen eines Kooperationsvertrages durch den Verein Jordsand e.V. sowie die Gemeinde Helgoland betreut.
13/14.11.2024
- Helgoland, 11.11.2024. Die Wurfsaison der Kegelrobben, Deutschlands größtem Raubtier, auf der Helgoländer Düne hat wie erwartet vor ein paar Tagen begonnen.
Seit der ersten Kegelrobbengeburt im Winter 1996/97 stieg die Geburtenzahl jährlich an. Die letzten Jahre wurden zwischen 700 und 800 Jungtiere geboren. Der unter Naturschutz stehende Kegelrobbenbestand wird auf Helgoland im Rahmen eines Kooperationsvertrages durch den Verein Jordsand e.V. sowie die Gemeinde Helgoland betreut.
Die Wurfzeit der Kegelrobben ist ein Highlight und gleichzeitig eine besondere Herausforderung; es wird seit Jahren daran gearbeitet, das Miteinander zwischen Tier und Mensch für touristische und naturschutzfachliche Belange mehr und mehr in Einklang zu bringen. Besucher sollten weiterhin, auf verantwortungsvolle und sichere Art und Weise, die Möglichkeit haben, an diesem Naturphänomen teilzuhaben. In den ersten Lebenswochen sind die Kegelrobbenjungen besonders anfällig.
Die Jungtiere haben bei der Geburt ein weißes „Babyfell“, das Lanugofell („Wollfell“) und müssen an hochwassergeschützten Strandabschnitten liegen. Dieses Wollfell sorgt an Land für die nötige Wärme, im Wasser jedoch saugt es sich schnell voll und erschwert den Tieren das Schwimmen und auch die Wärmeisolation ist dann nicht mehr gegeben. Einige Kühe führen ihre Kälber für einige Zeit ins Wasser, um sie schon mal an das kalte Nass zu gewöhnen. Sie holen sie jedoch auch rechtzeitig wieder heraus. Die Verbindung zwischen Jung- und Muttertieren ist also wichtig. Durch Störungen kann diese Verbindung abreißen. Eine Flucht ins Wasser würden die Jungen nur kurz überleben.
Die ebenfalls im Winter stattfindende Paarungszeit der Wildtiere auf der Helgoländer Düne ist ein weiteres faszinierendes Naturschauspiel, das über ein innovatives Gästeinformationssystem miterlebt werden kann. Gemeinsam bieten wir den Gästen in den Wintermonaten die Möglichkeit, die Düne und den Wurfplatz der Kegelrobben entlang des bewährten „Wintererlebnispfades“ mit besonderen Aussichtspunkten zu erkunden.
Auf der Landungsbrücke auf Helgoland und in der Hummerbude 35 des Verein Jordsand befinden sich Infostände zum Kegelrobbenwinter. Dort erfährt man aktuelle Besonderheiten zur Kegelrobbensaison und man erhält auch Informationsmaterial zu den Tieren. Auch im Rahmen von Führungen, anhand von Hinweistafeln und im Showroom am Dünenfähranleger haben Dünengäste die Möglichkeit, sich detailliert über die Lebensweise der Kegelrobben zu informieren. Neugierige Blicke auf die Helgoländer Kinderstube vom eigens zu diesem Zweck gebauten Panoramaweg (Bohlenweg) gewähren einen wunderbaren Einblick in die Kinderstube der Kegelrobbe.
Außerdem finden Sie weiterführende Informationen unter:
Weitere Info:
Führungen:
November 2024 bis Januar 2025
täglich (außer montags)
Treffpunkt: 9.45 Uhr, Landungsbrücke
Tickets bitte zuvor in der Hummerbude des Vereins Jordsand oder der Tourist Information erwerben!
Wind und Wetter sowie Änderungen vorbehalten!
Mindestteilnehmerzahl fünf Personen.
November 2024 - März 2025
dienstags 12.00 Uhr
Treffpunkt: 11.45 Uhr, Landungsbrücke
Tickets bitte zuvor in der Tourist Information erwerben!
Weitere mehrtägige Veranstaltungen der Naturakademie Jordsand rund um Robben:
28.11. und 29.11.2024 und 28.12. und 30.12.2024: ZEISS Robben-Aktionstage
Tagesprogramm mit Führung zu den Kegelrobben und Einblicken in angewandten Naturschutz
13.12. - 15.12.2024 Winterkurs "Kegelrobben im Fokus"
Dreitägiges Programm zu den Meeressäugern und Naturschutz auf Helgoland
Anmeldung und Infos unter: naturakademie@jordsand.de
Kontakte:
Verein Jordsand zum Schutz der Seevögel und der Natur e.V.
Damaris Buschhaus, Stationsleitung Helgoland
E-Mail: damaris.buschhaus@jordsand.de
Gemeinde Helgoland/Helgoland Tourismus-Service
Maren Becker, Rangerin
E-Mail: m.becker@helgoland.de
Maja Ziemer, Rangerin
E-Mail: m.ziemer@helgoland.de
In der Aufnahme von © Damaris Buschhaus_Verein Jordsand_Kege
Quelle
Verein Jordsand zum Schutz der Seevögel und der Natur e.V.
Milena Fischer
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0151 70319239
Email: milena.fischer@jordsand.de
Stand
11.11.2024
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung. Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Die Jungtiere haben bei der Geburt ein weißes „Babyfell“, das Lanugofell („Wollfell“) und müssen an hochwassergeschützten Strandabschnitten liegen. Dieses Wollfell sorgt an Land für die nötige Wärme, im Wasser jedoch saugt es sich schnell voll und erschwert den Tieren das Schwimmen und auch die Wärmeisolation ist dann nicht mehr gegeben. Einige Kühe führen ihre Kälber für einige Zeit ins Wasser, um sie schon mal an das kalte Nass zu gewöhnen. Sie holen sie jedoch auch rechtzeitig wieder heraus. Die Verbindung zwischen Jung- und Muttertieren ist also wichtig. Durch Störungen kann diese Verbindung abreißen. Eine Flucht ins Wasser würden die Jungen nur kurz überleben.
Die ebenfalls im Winter stattfindende Paarungszeit der Wildtiere auf der Helgoländer Düne ist ein weiteres faszinierendes Naturschauspiel, das über ein innovatives Gästeinformationssystem miterlebt werden kann. Gemeinsam bieten wir den Gästen in den Wintermonaten die Möglichkeit, die Düne und den Wurfplatz der Kegelrobben entlang des bewährten „Wintererlebnispfades“ mit besonderen Aussichtspunkten zu erkunden.
Auf der Landungsbrücke auf Helgoland und in der Hummerbude 35 des Verein Jordsand befinden sich Infostände zum Kegelrobbenwinter. Dort erfährt man aktuelle Besonderheiten zur Kegelrobbensaison und man erhält auch Informationsmaterial zu den Tieren. Auch im Rahmen von Führungen, anhand von Hinweistafeln und im Showroom am Dünenfähranleger haben Dünengäste die Möglichkeit, sich detailliert über die Lebensweise der Kegelrobben zu informieren. Neugierige Blicke auf die Helgoländer Kinderstube vom eigens zu diesem Zweck gebauten Panoramaweg (Bohlenweg) gewähren einen wunderbaren Einblick in die Kinderstube der Kegelrobbe.
- Die Naturschutzbeauftragten beantworten jederzeit und gerne die Fragen von interessierten Gästen und Anwohnenden.
Außerdem finden Sie weiterführende Informationen unter:
- https://www.helgoland.de/freizeit-gestalten/naturerlebnisse/kegelrobben-und-seehunde-auf-helgoland/
- https://www.jordsand.de/naturakademie/
Weitere Info:
- Die aktuellen Geburtenzahlen können auf Grund der Vielzahl der Geburten nicht mehr tageweise eingesehen werden. Basierend auf landbasierten Zählungen wird es zum Ende der Geburtenzeit eine ungefähre Zahl der Jungtiere geben.
Führungen:
November 2024 bis Januar 2025
täglich (außer montags)
Treffpunkt: 9.45 Uhr, Landungsbrücke
Tickets bitte zuvor in der Hummerbude des Vereins Jordsand oder der Tourist Information erwerben!
Wind und Wetter sowie Änderungen vorbehalten!
Mindestteilnehmerzahl fünf Personen.
November 2024 - März 2025
dienstags 12.00 Uhr
Treffpunkt: 11.45 Uhr, Landungsbrücke
Tickets bitte zuvor in der Tourist Information erwerben!
Weitere mehrtägige Veranstaltungen der Naturakademie Jordsand rund um Robben:
28.11. und 29.11.2024 und 28.12. und 30.12.2024: ZEISS Robben-Aktionstage
Tagesprogramm mit Führung zu den Kegelrobben und Einblicken in angewandten Naturschutz
13.12. - 15.12.2024 Winterkurs "Kegelrobben im Fokus"
Dreitägiges Programm zu den Meeressäugern und Naturschutz auf Helgoland
Anmeldung und Infos unter: naturakademie@jordsand.de
Kontakte:
Verein Jordsand zum Schutz der Seevögel und der Natur e.V.
Damaris Buschhaus, Stationsleitung Helgoland
E-Mail: damaris.buschhaus@jordsand.de
Gemeinde Helgoland/Helgoland Tourismus-Service
Maren Becker, Rangerin
E-Mail: m.becker@helgoland.de
Maja Ziemer, Rangerin
E-Mail: m.ziemer@helgoland.de
In der Aufnahme von © Damaris Buschhaus_Verein Jordsand_Kege
- Kegelrobbenjungtier
Quelle
Verein Jordsand zum Schutz der Seevögel und der Natur e.V.
Milena Fischer
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0151 70319239
Email: milena.fischer@jordsand.de
Stand
11.11.2024
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung. Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Artenschutz in Franken®
Hessen – eine Heimat für Luchse?

Hessen – eine Heimat für Luchse?
12/13.11.2024
Auch im Luchsjahr 2023/24 wurden wieder mehr Luchse in Hessen festgestellt. Insgesamt konnten neun selbständige Luchse und zusätzlich vier Jungtiere im Grenzgebiet zwischen Hessen und Niedersachsen nachgewiesen werden.
Einige dieser Tiere dürften ihr Hauptstreifgebiet in Niedersachen haben, Hessen werden vier bis fünf dieser selbständigen Luchse zugeordnet. Das geht aus dem Luchsbericht 2023/24 hervor, den das Hessische Umweltministerium, das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) und der Arbeitskreis Hessenluchs heute in Wiesbaden vorgestellt haben. Insgesamt konnten von Mai 2023 bis April 2024 82 Luchshinweise dokumentiert werden – sechs mehr als im Vorjahr.
12/13.11.2024
- Luchsbericht 2023/24 dokumentiert leichten Aufwärtstrend
Auch im Luchsjahr 2023/24 wurden wieder mehr Luchse in Hessen festgestellt. Insgesamt konnten neun selbständige Luchse und zusätzlich vier Jungtiere im Grenzgebiet zwischen Hessen und Niedersachsen nachgewiesen werden.
Einige dieser Tiere dürften ihr Hauptstreifgebiet in Niedersachen haben, Hessen werden vier bis fünf dieser selbständigen Luchse zugeordnet. Das geht aus dem Luchsbericht 2023/24 hervor, den das Hessische Umweltministerium, das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) und der Arbeitskreis Hessenluchs heute in Wiesbaden vorgestellt haben. Insgesamt konnten von Mai 2023 bis April 2024 82 Luchshinweise dokumentiert werden – sechs mehr als im Vorjahr.
Staatssekretär Michael Ruhl begrüßt die Entwicklung der größten europäischen Wildkatze: „Die Ergebnisse des aktuellen Luchsberichtes zeigen, dass sich in Hessen eine kleine Teilpopulation etabliert. Die dauerhafte Rückkehr des scheuen Einzelgängers nach Hessen wäre ein Erfolg. Wir danken allen Luchsbeauftragten, die Hinweise in ihren Landkreisen aufgenommen haben, sowie allen Melderinnen und Meldern, ohne die keine Luchsstatistik möglich wäre.“
Thomas Norgall, Naturschutzreferent des hessischen Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und einer der Koordinatoren des Arbeitskreises Hessenluchs, erklärt: „Hessen profitiert nun im zweiten Jahr von der positiven Bestandsentwicklung der Harzpopulation des Luchses. Allerdings wachsen Luchspopulationen nur langsam, und wir haben in Hessen schon erlebt, dass Krankheiten die geringe Individuenzahl drastisch reduzieren können.“
Prof. Dr. Thomas Schmid, Präsident des HLNUG, betont die wichtige Arbeit des Arbeitskreises: „Seit 2007 unterstützt der Arbeitskreis Hessenluchs das HLNUG beim rechtlich vorgeschriebenen Monitoring. Alle Hinweise werden entweder durch die ehrenamtlichen Mitglieder des Arbeitskreises oder durch das HLNUG auf Plausibilität geprüft und nach bundesweit einheitlichen Kriterien ausgewertet. Der jährliche Luchsbericht fügt alle Luchs-Hinweise mit den professionell ermittelten Daten des HLNUG zu einem Gesamtbild zusammen. Damit diese Daten auch in das Bundesmonitoring einfließen können, werden sie vom HLNUG nach Abschluss des entsprechenden Berichtszeitraumes an das Bundesamt für Naturschutz übermittelt.“
Gesicherte Nachweise ausschließlich aus Nord- und Nordosthessen
Ein Großteil der 82 Hinweise auf Luchse konnte als gesichert eingestuft werden. Diese stammen ausschließlich aus Nord- und Nordosthessen und wurden überwiegend durch Fotofallen erbracht. Außerdem gab es genetische Nachweise von zwei weiblichen Luchsen.
Erneut Weibchen mit Jungtieren im Reinhardswald festgestellt
Wie bereits in den Vorjahren 2019/20 und 2022/23 konnte erneut ein Luchsweibchen mit Jungtieren im Reinhardswald festgestellt werden. Die Jungen kamen wahrscheinlich in Hessen zur Welt, könnten aber auch – wie 2019 geschehen – im niedersächsischen Solling geboren worden sein. In jedem Fall wird deutlich, dass sich Weibchen mit Jungen wiederholt im Reinhardswald aufhalten.
Vorkommen von sesshaften Luchsen macht dauerhafte Reproduktionen in Hessen wahrscheinlich
Insgesamt konnten in Hessen vier sesshafte Luchse sicher nachgewiesen werden: das Weibchen mit Jungtieren im Reinhardswald, ein weiteres Weibchen sowie ein Männchen in Nordosthessen und ein Männchen im Bramwald. Dies lässt auf weiteren Luchsnachwuchs hoffen: Denn je mehr Luchse sich in Hessen niederlassen, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie sich auch dauerhaft vermehren. Unterstützt wird dies durch ein Aussetzungsprojekt verschiedener Akteure unter Federführung des BUND Thüringen im Thüringer Wald, welches im Mai 2024 gestartet ist.
Hintergrund
1833 soll im Odenwald der letzte Luchs erlegt worden sein, danach galt die Art in Hessen ausgerottet. Der Arbeitskreis Hessenluchs konstituierte sich im Mai 2004 auf Initiative des Ökologischen Jagdvereins Hessen (ÖJV) und des Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, Landesverband Hessen (BUND). Weitere tragende Organisationen sind die Arbeitsgemeinschaft Naturgemäße Waldwirtschaft Hessen (ANW), der Bund Deutscher Forstleute (BDF), die Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz (HGON), der Naturschutzbund Hessen (NABU) und die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Hessen (SDW) sowie der Landesbetrieb Hessen-Forst.
Seit 2007 erstellt der Arbeitskreis (AK) Hessenluchs jährlich den Luchsbericht im Auftrag des Landes Hessen. Im AK arbeiten Naturschützerinnen und Naturschützer, Forstleute, Jägerinnen und Jäger aus verschiedenen Verbänden zusammen. Ziel ist eine sachgerechte Information über den Luchs in Hessen. Arbeitsgrundlage sind die Belege für das Vorkommen des Luchses in Hessen (Sichtungen, Fährten und andere Nachweise), die vom Arbeitskreis gesammelt, bewertet und in einem hessenweiten Luchsregister zusammengeführt werden.
2011 wurde mit Fotofallen des BUND Hessen im Forstamt Melsungen erstmals wieder Reproduktion nachgewiesen. Durch die in den folgenden Jahren im Auftrag des HLNUG betreuten umfangreichen Fotofallenprojekte gelang die Dokumentation der Reproduktion von Luchsen zwischen 2010 und 2015. 2016 konnte keine Reproduktion festgestellt werden. Seit 2014 führt das HLNUG ein eigenes Fotofallenmonitoring zum Luchs durch, bis zum Jahr 2021 wurde dies im Rahmen eines Kooperationsprojekts mit der Uni Göttingen betrieben.
Die Luchsdatenerfassung ist die primäre Aufgabe der rund 50 regionalen Luchsbeauftragten, die auch Ansprechpersonen für die Bevölkerung bei allen Fragen zum Luchs in ihren Landkreisen sind. Die erfassten Daten fließen im HLNUG in die Gesamtdatenbank ein, wo sie als Teil des Monitorings der streng geschützten Arten der FFH-Richtlinie (Fauna-Flora-Habitatrichtlinie) geprüft und weiterbearbeitet werden.
In der Aufnahme von ©HLNUG-Monitoring
Quelle
Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie
Rheingaustraße 186
D-65203 Wiesbaden
Stand
06.11.2024
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung. Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Thomas Norgall, Naturschutzreferent des hessischen Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und einer der Koordinatoren des Arbeitskreises Hessenluchs, erklärt: „Hessen profitiert nun im zweiten Jahr von der positiven Bestandsentwicklung der Harzpopulation des Luchses. Allerdings wachsen Luchspopulationen nur langsam, und wir haben in Hessen schon erlebt, dass Krankheiten die geringe Individuenzahl drastisch reduzieren können.“
Prof. Dr. Thomas Schmid, Präsident des HLNUG, betont die wichtige Arbeit des Arbeitskreises: „Seit 2007 unterstützt der Arbeitskreis Hessenluchs das HLNUG beim rechtlich vorgeschriebenen Monitoring. Alle Hinweise werden entweder durch die ehrenamtlichen Mitglieder des Arbeitskreises oder durch das HLNUG auf Plausibilität geprüft und nach bundesweit einheitlichen Kriterien ausgewertet. Der jährliche Luchsbericht fügt alle Luchs-Hinweise mit den professionell ermittelten Daten des HLNUG zu einem Gesamtbild zusammen. Damit diese Daten auch in das Bundesmonitoring einfließen können, werden sie vom HLNUG nach Abschluss des entsprechenden Berichtszeitraumes an das Bundesamt für Naturschutz übermittelt.“
Gesicherte Nachweise ausschließlich aus Nord- und Nordosthessen
Ein Großteil der 82 Hinweise auf Luchse konnte als gesichert eingestuft werden. Diese stammen ausschließlich aus Nord- und Nordosthessen und wurden überwiegend durch Fotofallen erbracht. Außerdem gab es genetische Nachweise von zwei weiblichen Luchsen.
Erneut Weibchen mit Jungtieren im Reinhardswald festgestellt
Wie bereits in den Vorjahren 2019/20 und 2022/23 konnte erneut ein Luchsweibchen mit Jungtieren im Reinhardswald festgestellt werden. Die Jungen kamen wahrscheinlich in Hessen zur Welt, könnten aber auch – wie 2019 geschehen – im niedersächsischen Solling geboren worden sein. In jedem Fall wird deutlich, dass sich Weibchen mit Jungen wiederholt im Reinhardswald aufhalten.
Vorkommen von sesshaften Luchsen macht dauerhafte Reproduktionen in Hessen wahrscheinlich
Insgesamt konnten in Hessen vier sesshafte Luchse sicher nachgewiesen werden: das Weibchen mit Jungtieren im Reinhardswald, ein weiteres Weibchen sowie ein Männchen in Nordosthessen und ein Männchen im Bramwald. Dies lässt auf weiteren Luchsnachwuchs hoffen: Denn je mehr Luchse sich in Hessen niederlassen, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie sich auch dauerhaft vermehren. Unterstützt wird dies durch ein Aussetzungsprojekt verschiedener Akteure unter Federführung des BUND Thüringen im Thüringer Wald, welches im Mai 2024 gestartet ist.
Hintergrund
1833 soll im Odenwald der letzte Luchs erlegt worden sein, danach galt die Art in Hessen ausgerottet. Der Arbeitskreis Hessenluchs konstituierte sich im Mai 2004 auf Initiative des Ökologischen Jagdvereins Hessen (ÖJV) und des Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, Landesverband Hessen (BUND). Weitere tragende Organisationen sind die Arbeitsgemeinschaft Naturgemäße Waldwirtschaft Hessen (ANW), der Bund Deutscher Forstleute (BDF), die Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz (HGON), der Naturschutzbund Hessen (NABU) und die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Hessen (SDW) sowie der Landesbetrieb Hessen-Forst.
Seit 2007 erstellt der Arbeitskreis (AK) Hessenluchs jährlich den Luchsbericht im Auftrag des Landes Hessen. Im AK arbeiten Naturschützerinnen und Naturschützer, Forstleute, Jägerinnen und Jäger aus verschiedenen Verbänden zusammen. Ziel ist eine sachgerechte Information über den Luchs in Hessen. Arbeitsgrundlage sind die Belege für das Vorkommen des Luchses in Hessen (Sichtungen, Fährten und andere Nachweise), die vom Arbeitskreis gesammelt, bewertet und in einem hessenweiten Luchsregister zusammengeführt werden.
2011 wurde mit Fotofallen des BUND Hessen im Forstamt Melsungen erstmals wieder Reproduktion nachgewiesen. Durch die in den folgenden Jahren im Auftrag des HLNUG betreuten umfangreichen Fotofallenprojekte gelang die Dokumentation der Reproduktion von Luchsen zwischen 2010 und 2015. 2016 konnte keine Reproduktion festgestellt werden. Seit 2014 führt das HLNUG ein eigenes Fotofallenmonitoring zum Luchs durch, bis zum Jahr 2021 wurde dies im Rahmen eines Kooperationsprojekts mit der Uni Göttingen betrieben.
Die Luchsdatenerfassung ist die primäre Aufgabe der rund 50 regionalen Luchsbeauftragten, die auch Ansprechpersonen für die Bevölkerung bei allen Fragen zum Luchs in ihren Landkreisen sind. Die erfassten Daten fließen im HLNUG in die Gesamtdatenbank ein, wo sie als Teil des Monitorings der streng geschützten Arten der FFH-Richtlinie (Fauna-Flora-Habitatrichtlinie) geprüft und weiterbearbeitet werden.
In der Aufnahme von ©HLNUG-Monitoring
- Luchs in Fotofalle
Quelle
Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie
Rheingaustraße 186
D-65203 Wiesbaden
Stand
06.11.2024
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung. Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Artenschutz in Franken®
Die Haselmaus in Bayern - Nestbau

Die Haselmaus in Bayern
12/13.11.2024
Es ist der Ort, an dem ich mich sicher fühle, schlafe, meine Jungen aufziehe und vor allem – überlebe. Ich erzähle dir hier also ein bisschen über meine Kunst des Nestbaus und meine Familie!
12/13.11.2024
- Hallo! Ich bin eine Haselmaus – oder wie meine Menschenfreunde sagen, Muscardinus avellanarius. In meiner Welt ist das Nest mein ganzes Universum.
Es ist der Ort, an dem ich mich sicher fühle, schlafe, meine Jungen aufziehe und vor allem – überlebe. Ich erzähle dir hier also ein bisschen über meine Kunst des Nestbaus und meine Familie!
Mein Nestbau – Mein Zuhause gestalten
Ich baue mein Nest mit viel Bedacht und Sorgfalt. Wenn du mich dabei beobachten würdest, würdest du sehen, wie ich an Grashalmen, Blättern und weichen Fasern zupfe, um das perfekte Baumaterial zu sammeln. Für uns Haselmäuse ist das Nest mehr als ein Haufen Material; es ist eine sorgfältig arrangierte Schutzburg, die wir oft in Hecken, Gebüschen oder im Unterholz verstecken.
Die Technik des Nestbaus ist nicht nur praktisch, sondern auch ein Stück Lebenskunst. Zuerst schaffe ich eine äußere Schicht aus robusteren Materialien wie Zweigen und Blättern, die das Nest stabil und gut versteckt macht. Der innere Bereich meines Nests ist ein kleines Meisterwerk – weich, warm und gut isoliert. Hierfür verwende ich Gras und Moos, denn diese Materialien halten die Wärme und schützen mich vor kalten Nächten. Im Winter schlafe ich besonders tief (eine Art Winterschlaf), und ein kuscheliges, warmes Nest ist dafür überlebenswichtig.
Ich baue mein Nest häufig in den Büschen, am Boden oder in Baumhöhlen, in denen ich sicher vor Fressfeinden wie Mardern oder Eulen bin. Manchmal nutze ich aber auch Nistkästen, die die Menschen für uns aufhängen, was mir sehr hilft, wenn natürliche Verstecke knapp sind.
Fortpflanzung und Nestpflege – Meine Jungen aufziehen
Für die Fortpflanzung habe ich hohe Ansprüche an mein Nest. Die Geburt meiner Jungen und ihre erste Zeit bei mir im Nest ist eine besonders wichtige Phase. Ein Weibchen wie ich bringt pro Jahr meistens nur einen oder zwei Würfe zur Welt, und in einem Wurf sind etwa drei bis fünf Junge. Die Tragzeit beträgt ungefähr 23 Tage, und wenn die Kleinen dann zur Welt kommen, sind sie winzig, blind und völlig hilflos.
Die ersten Wochen verbringen die Jungen ausschließlich im Nest. Es ist mein sicherster Rückzugsort, wo ich die Kleinen pflege und schütze, bis sie kräftiger und beweglicher sind. Während dieser Zeit verlasse ich das Nest nur, um nach Futter zu suchen, und komme so schnell wie möglich zurück. Ich stille die Jungen, bis sie nach etwa drei bis vier Wochen anfangen, selbst Nahrung zu fressen. Mit etwa fünf Wochen beginnen sie, das Nest zu verlassen und die Umgebung zu erkunden – aber die ersten Schritte sind immer ein bisschen wackelig!
Besonderheiten des Nestbaus und der Jungenaufzucht
Meine Nester sind nicht für die Ewigkeit gebaut, aber ich bin flexibel. Ich kann mehrere Nester in einer Saison bauen und nutze manchmal auch verlassene Nester anderer Tiere, wenn sie sicher und bequem genug sind. Doch beim Nestbau für meine Jungen bin ich besonders wählerisch – schließlich hängt davon das Überleben meiner Familie ab. Der Standort muss gut gewählt sein: geschützt, schwer zugänglich für Feinde und in der Nähe von Nahrungsquellen.
So, das ist mein Leben aus meiner Sicht, einer kleinen Haselmaus! Mein Nest und die Fortpflanzung sind meine wichtigsten Aufgaben, und ich hoffe, du verstehst jetzt besser, wie wichtig mein kleines, aber feines Zuhause für mich ist!
In der Aufnahme von Johannes Hohenegger
- Auch in unserer Region ist die Haselmaus teils sehr selten geworden. Reich strukturierte Laubmischwälder sind der bevorzugte Lebensraum.Bei der Kontrolle der Vogelnisthilfen stoßen wir mehr oder minder regelmäßig auf die Haselmaus.Auch finden in diesen Sekundärhabitaten Fortpflanzungsprozesse statt. Meist sind 3 – 4 Jungtiere erkennbar, die nach einer Tragzeit von etwa 20 Tagen geworfen und nach der doppelten Nestlingszeit nahezu sebständig sind.
- Als Nahrung dienen den erwachsenen Tieren Haselnüsse, jedoch werden auch Insekten und andere Pflanzenteile genommen.Während der Winterruhe die gerne in den Erdhöhlungen stattfindet wird sie hie und da von Schwarzwild verzehrt. Wobei jedoch mehr die Schleiereule und der Waldkauz als Primärprädatoren anzusehen sind.Haselmäuse leiden sehr unter dem Einsatz von pestiziden und Bioziden. Auch die starke Veränderung in ihren typischen Lebensräume lässt die Bestände sichtbar schrumpfen.
Artenschutz in Franken®
Sechs Jahre gemeinsamer Einsatz für die Mopsfledermaus

Sechs Jahre gemeinsamer Einsatz für die Mopsfledermaus
11/12.11.2024
Und sie ist eine der Arten, für die Deutschland in Europa eine besondere Verantwortung trägt. Nach sechs Jahren endet ein Projekt zum Schutz und Förderung der Mopsfledermaus.
11/12.11.2024
- Bonn/Erfurt. Sie ist klein, dunkel gefärbt und für die, die sie zu Gesicht bekommen, putzig anzuschauen – die Mopsfledermaus.
Und sie ist eine der Arten, für die Deutschland in Europa eine besondere Verantwortung trägt. Nach sechs Jahren endet ein Projekt zum Schutz und Förderung der Mopsfledermaus.
Im Rahmen einer Abschlusstagung am 7. und 8. November 2024 in Erfurt stellte das Projektteam von Stiftung Fledermaus, der Naturstiftung David, der NABU-Landesverbände Baden-Württemberg und Niedersachsen sowie der Universität Greifswald neue Erkenntnisse zur aktuellen Situation der gefährdeten Art sowie Maßnahmen zu ihrem Schutz vor. Die Ergebnisse des Projekts "Schutz und Förderung der Mopsfeldermaus" sollen dazu beitragen, dass die seltene Waldfledermaus und mit ihr andere gefährdete Arten des Waldes besser geschützt werden. Die gute Nachricht: Die Zahl der Mopsfledermäuse in Deutschland erholt sich langsam. Trotzdem gilt die Art deutschlandweit weiterhin als stark gefährdet.
Als waldgebundene Fledermausart ist die Mopsfledermaus vor allem auf alte Waldökosysteme angewiesen, die auch Lebensraum weiterer seltener Arten wie beispielsweise Wildkatze, Mittelspecht und Eremit sind. Die Anzahl von Baumquartieren, die Zusammensetzung von Baumarten, das Alter und die Geschlossenheit der Waldbestände sowie vertikale und horizontale Strukturen stellen wichtige Qualitätsmerkmale ihres Lebensraumes dar. Insbesondere die Bewirtschaftung eines Waldes beeinflusst das Angebot an Quartieren für die darin lebenden Tiere.
BfN-Präsidentin Sabine Riewenherm lobte den Vorbildcharakter des Projektes: „Naturschutz braucht Unterstützung und Kooperationen. Das zeigt das Projekt 'Schutz und Förderung der Mopsfledermaus in Deutschland' im Bundesprogramm Biologische Vielfalt. Den Projektbeteiligten ist es gelungen, gemeinsame Interessen von Lebensraumansprüchen der Mopsfledermaus und ökosystemgerechter Waldbewirtschaftung zu identifizieren und ein Bewusstsein für den Schutz der Mopsfledermaus und den Schutz des Lebensraumes Wald zu schaffen. Zusammen mit allen Akteuren der Forstwirtschaft, mit Waldbesitzenden, Behörden und Verbänden konnten Schutzmaßnahmen erfolgreich umgesetzt werden. Mein besonderer Dank gilt den ehrenamtlich engagierten Menschen, die herausragende Arbeit geleistet haben. Das Projekt zeigt einmal mehr, wie sehr Naturschutz das Ehrenamt braucht."
Das Projekt wurde vom BfN seit 2018 im Rahmen des Bundesprogramms Biologische Vielfalt mit Mitteln des BMUV in Höhe von 4,2 Millionen Euro gefördert, dazu kamen Drittmittel aus Thüringen sowie Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen in Höhe von etwa 784.000 Euro.
Quelle
Bundesamt für Naturschutz (BfN)
Konstantinstr. 110
53179 Bonn
Stand
08.11.2024
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung. Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
In der Aufnahme von F.G.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Als waldgebundene Fledermausart ist die Mopsfledermaus vor allem auf alte Waldökosysteme angewiesen, die auch Lebensraum weiterer seltener Arten wie beispielsweise Wildkatze, Mittelspecht und Eremit sind. Die Anzahl von Baumquartieren, die Zusammensetzung von Baumarten, das Alter und die Geschlossenheit der Waldbestände sowie vertikale und horizontale Strukturen stellen wichtige Qualitätsmerkmale ihres Lebensraumes dar. Insbesondere die Bewirtschaftung eines Waldes beeinflusst das Angebot an Quartieren für die darin lebenden Tiere.
BfN-Präsidentin Sabine Riewenherm lobte den Vorbildcharakter des Projektes: „Naturschutz braucht Unterstützung und Kooperationen. Das zeigt das Projekt 'Schutz und Förderung der Mopsfledermaus in Deutschland' im Bundesprogramm Biologische Vielfalt. Den Projektbeteiligten ist es gelungen, gemeinsame Interessen von Lebensraumansprüchen der Mopsfledermaus und ökosystemgerechter Waldbewirtschaftung zu identifizieren und ein Bewusstsein für den Schutz der Mopsfledermaus und den Schutz des Lebensraumes Wald zu schaffen. Zusammen mit allen Akteuren der Forstwirtschaft, mit Waldbesitzenden, Behörden und Verbänden konnten Schutzmaßnahmen erfolgreich umgesetzt werden. Mein besonderer Dank gilt den ehrenamtlich engagierten Menschen, die herausragende Arbeit geleistet haben. Das Projekt zeigt einmal mehr, wie sehr Naturschutz das Ehrenamt braucht."
Das Projekt wurde vom BfN seit 2018 im Rahmen des Bundesprogramms Biologische Vielfalt mit Mitteln des BMUV in Höhe von 4,2 Millionen Euro gefördert, dazu kamen Drittmittel aus Thüringen sowie Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen in Höhe von etwa 784.000 Euro.
Quelle
Bundesamt für Naturschutz (BfN)
Konstantinstr. 110
53179 Bonn
Stand
08.11.2024
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung. Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
In der Aufnahme von F.G.
- Mit einer Kopf - Rumpf Länge von 45 – 58 mm, einem Körpergewicht von bis zu 14 Gramm und einer Spannweite von bis zu 290 mm zählt die Mopsfledermaus zu den kleinen bis mittleren Größengruppen der heimischen Fledermausarten.Die auffällige Mopsfledermaus ist eine Fledermausart, die bevorzugt in Waldreichen Gebirgs- und Mittelgebirgsregionen anzutreffen ist.Die Sommerlebensräume der Mopsfledermäuse befinden sich in Gebäudespalten wobei Fensterläden einen besonderen Anziehungspunkt darstellen.
Wochenstuben welche in der Regel ab Mai bezogen werden, liegen ebenfalls in den im Vorfeld bezeichneten Bereichen. Jedes Muttertier bringt ein bis zwei Nachkömmlinge zur Welt.Die als kälteresistent bekannte Fledermausart liebt gut bewitterte Überwinterungsbereichen in Kellern, Tunneln jedoch auch an Gebäuden oder hinter abstehender Baumrinde.Mopsfledermäuse ernähren sich bevorzugt von Kleinschmetterlingsarten.Sie können ein Alter von bis zu 21 Jahren erreichen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Artenschutz in Franken®
Baumhöhle mit Ausfluss - Fledermausbesatz

Baumhöhle mit Ausfluss - Fledermausbesatz
11/12.11.2024
Der Kotausfluss sind kleine Kotkrümel und Kotflüssigkeit, die sich am Boden unter der Baumhöhle ansammeln und am Stamm nach emzlang nach unten laufen und die für Fledermäuse charakteristisch sind.
11/12.11.2024
- Um festzustellen, ob eine Baumhöhle von Fledermäusen bewohnt wird, kann man verschiedene Anzeichen am sogenannten Kotausfluss erkennen.
Der Kotausfluss sind kleine Kotkrümel und Kotflüssigkeit, die sich am Boden unter der Baumhöhle ansammeln und am Stamm nach emzlang nach unten laufen und die für Fledermäuse charakteristisch sind.
Kotausfluss: Hinweise für Fledermäuse
Aussehen und Lage der Höhlenöffnung
Weitere Hinweise auf Fledermäuse
Sicht der Fledermäuse: Warum Kotausfluss entsteht und wie sie die Höhle nutzen
Zusammengefasst erkennt man die Besiedlung durch Fledermäuse vor allem an den charakteristischen Kotkrümeln unterhalb der Baumhöhle und dem typischen Kotausfluss aus der Baumhöhle, aber auch durch das Verhalten der Tiere bei der Abenddämmerung. Für die Fledermäuse selbst ist eine solche Baumhöhle ein idealer, ungestörter Schlafplatz.
In der Aufnahme
- Fledermauskot ist fein, dunkel und oft bröselig, weil er überwiegend aus Insektenresten besteht. Er unterscheidet sich von Vogel- oder Mäusekot und lässt sich bei näherem Betrachten zerreiben.
- Die Krümel liegen oft direkt unter der Höhlenöffnung und sind durch Wind oder Regen leicht verstreut.
- Bei aktiver Fledermausbesiedlung findet sich fast täglich neuer Kot.
- Auch Flüssigkeiten sind bei starkem Besatz zu finden.
Aussehen und Lage der Höhlenöffnung
- Fledermäuse bevorzugen Höhlen, die gut geschützt und im Inneren warm und ruhig sind.
- Der Eingang ist oft klein und unauffällig – genau richtig für kleine Fledermausarten, aber zu eng für größere Tiere.
Weitere Hinweise auf Fledermäuse
- Fledermäuse sind dämmerungs- und nachtaktiv. Man kann sie oft beobachten, wenn sie bei Sonnenuntergang aus der Höhle fliegen. Sie verlassen ihre Höhle in kleinen Gruppen oder einzeln.
- Fledermäuse sind sehr empfindlich gegenüber Störungen. Wenn sie in einer Baumhöhle leben, achten sie darauf, dass der Standort ruhig ist und sie während des Tages nicht gestört werden.
Sicht der Fledermäuse: Warum Kotausfluss entsteht und wie sie die Höhle nutzen
- Fledermäuse wählen Höhlen, die ihnen tagsüber Schutz und konstante Temperaturen bieten.
- Die Kotkrümel / Flüssigkeit, die unten an der Höhle liegen und am Stamm entlang fließen, stammen von der Verdauung ihrer Nahrung. Da Fledermäuse viel fliegen, können sie große Mengen Insekten vertilgen, was den charakteristischen Kotausfluss verursacht.
- Die Tiere spüren Instinktiv, dass die Baumhöhle einen sicheren Unterschlupf bietet, in dem sie ungestört rasten können.
Zusammengefasst erkennt man die Besiedlung durch Fledermäuse vor allem an den charakteristischen Kotkrümeln unterhalb der Baumhöhle und dem typischen Kotausfluss aus der Baumhöhle, aber auch durch das Verhalten der Tiere bei der Abenddämmerung. Für die Fledermäuse selbst ist eine solche Baumhöhle ein idealer, ungestörter Schlafplatz.
In der Aufnahme
- ein recht einfacher Kontrollmechanismus zum Fledermausbesatz in Baumhöhlen stellt die optische Erfassung von Ausfluss unterhalb der Baumhöhlenöffnung dar. Fledermäuse produzieren Urin und Kot, diese gemischte Flüssigkeit läuft dann als flüssiges Exkrement aus der, von den Ausscheidungen überquellenden Baumhöhlen- Öffnung.
Artenschutz in Franken®
Wildschutzzäune - Gefahr für die Biodiversität ... in unseren Augen ja!

Wildschutzzäune - Gefahr für die Biodiversität ... in unseren Augen ja!
10/11.11.2024
Durch hohe, stabile? Metallgitter oder Kunststoffbarrieren verhindern sie Zusammenstöße zwischen Wildtieren und Fahrzeugen und schützen zugleich landwirtschaftliche Kulturen.
10/11.11.2024
- Ein Wildschutzzaun ist, einfach gesagt, ein Schutzsystem, das entlang von Straßen, Schienen oder land/forstwirtschaftlichen Flächen errichtet wird, um Tiere wie Rehe, Hasen, Wildschweine und Hirsche davon abzuhalten, in menschlich genutzte Gebiete oder den Verkehr zu gelangen.
Durch hohe, stabile? Metallgitter oder Kunststoffbarrieren verhindern sie Zusammenstöße zwischen Wildtieren und Fahrzeugen und schützen zugleich landwirtschaftliche Kulturen.
Funktion und Nutzen des Wildschutzzauns
Wildschutzzäune wirken wie unsichtbare Grenzlinien zwischen zwei Welten: auf der einen Seite die "wilde Natur", auf der anderen die von Menschen intensiv genutzte Landschaft. Sie schützen Menschen und Tiere vor potenziell gefährlichen Begegnungen. Diese Zäune lenken Tiere gezielt in bestimmte Richtungen und sorgen so dafür, dass sie an vorgesehenen, gesicherten Stellen die Straße oder die Bahnstrecke passieren können. Oft sind sie an Wildbrücken und Unterführungen angebracht, um den Tieren eine sichere Überquerung zu ermöglichen.
Eine Perspektive für die Biodiversität: Der "Zaun der Gedanken"
Dennoch kann man sich vorstellen, dass ein solcher Zaun auch aus der Sicht eines Tieres durchaus als "Barriere" empfunden wird. Die Tiere finden sich plötzlich in ihrem angestammten Lebensraum begrenzt, und alte, vertraute Wanderwege werden blockiert. Wanderbewegungen, die ein wichtiger Teil des Lebens vieler Arten sind – um Nahrungsquellen zu finden, den Fortbestand zu sichern oder zu überwintern – werden eingeschränkt.
Das Resultat? Die Populationen werden ggf. voneinander isoliert, und die genetische Vielfalt kann sinken. Das bedeutet, dass Wildpopulationen anfälliger für Krankheiten und klimatische Veränderungen werden, da der genetische Austausch weniger intensiv ist. Junge, unerfahrene Tiere, die versuchen, den Zaun zu umgehen oder unter ihm hindurchzugelangen, verletzen sich häufig oder enden in Gebieten, in denen sie keine Ressourcen finden oder der Mensch sie bedroht. So trägt der Zaun zwar zur Sicherheit bei, wird aber zum stillen Denkanstoß: "Wie viel Raum bleibt uns, und wo wird unsere Freiheit eingeschränkt?"
Wildschutzzäune und Lebensraumverlust: Ein emotionales Dilemma
Aus einer nachdenklichen Perspektive kann man sich den Zaun als eine Art "Kompass der Freiheit" vorstellen. Die Wildtiere – ohne das Wissen um Verkehrssicherheit oder landwirtschaftliche Wertschöpfung – spüren lediglich die verlorene Freiheit. Für einen wandernden Wolf oder einen wandernden Luchs ist jeder Zaun ein weiteres Hindernis, das sie zwingt, in einem kleineren Gebiet zu bleiben, wodurch sie mit anderen Tieren stärker um Nahrung und Lebensraum konkurrieren müssen. Der Zaun zwingt uns Menschen, die Frage zu stellen: Wo endet die Grenze der Natur? Und welche Verantwortung haben wir, Räume zu schaffen, in denen Natur und Mensch harmonisch koexistieren?
Während Wildschutzzäune also Sicherheit bieten, werfen sie gleichzeitig Fragen auf, die uns an die Balance zwischen Fortschritt und Natur erinnern. Wildbrücken und Durchgänge sind zwar ein Anfang, aber vielleicht bleibt der Zaun doch stets ein leises Symbol der Grenze, die die Biodiversität herausfordert und uns zu einer weiseren Koexistenz mahnt.
In der Aufnahme
- Gerade auch für kleine Tiere stellen diese Barrieren ein Risiko dar das auch mit dem Tod dieses enden kann. Zahlreiche Igel konnten wir bereits in den engen Maschen im Fußbereich dieses Zäune entdecken. Die Igel waren beim Versuch diese zu durchqueren einfach stecken geblieben und sind verendet.
Artenschutz in Franken®
Herbst im Tier-Freigelände im Nationalpark Bayerischer Wald
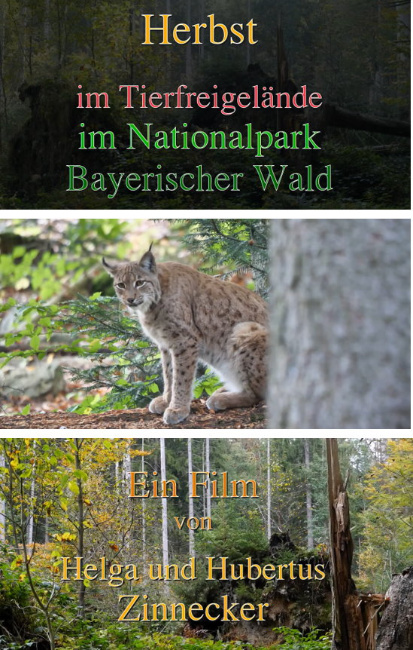
Herbst im Tier-Freigelände im Nationalpark Bayerischer Wald
10/11.11.2024
Von Altschönau kommend haben wir die Volieren der Käuze besucht und sind dann weiter dem Rundweg gefolgt um Auerhühner, Fischotter, Luchs, Wildschweine, Elch, Bär, sowie viele weitere Tiere dieses schönen Nationalparks zu beobachten und zu filmen.
10/11.11.2024
- Ein Film von Helga und Hubertus Zinnecker
Von Altschönau kommend haben wir die Volieren der Käuze besucht und sind dann weiter dem Rundweg gefolgt um Auerhühner, Fischotter, Luchs, Wildschweine, Elch, Bär, sowie viele weitere Tiere dieses schönen Nationalparks zu beobachten und zu filmen.
Artenschutz in Franken®
Bundeswaldgesetz auf dem Holzweg
Bundeswaldgesetz auf dem Holzweg
09/10.11.2024
WWF: Entwurf löst die Probleme nicht
Doch der Entwurf bietet aus WWF-Sicht wenig Neues und bleibt enttäuschend. Die Herausforderungen, vor denen Bundesminister Özdemir steht, sind hoch und der Textvorschlag wird ihnen weitgehend nicht gerecht. „Der Wald ist unser größter Naturraum in Deutschland und das stärkste Schwert, das wir haben, um unsere heimische Biodiversität zu schützen.
Dazu ist er ein entscheidender Pfeiler, auf dem die Klimaschutzziele der Bundesregierung, basieren. Doch dieses Schwert ist stumpf und wird im Kampf gegen den Klimawandel und die Biodiversitätskrise versagen“, kommentiert Dr. Susanne Winter, Programmleitung Wald beim WWF Deutschland.
09/10.11.2024
WWF: Entwurf löst die Probleme nicht
- Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft hat die Länder- und Verbändeanhörung für ein geändertes Bundeswaldgesetz gestartet.
Doch der Entwurf bietet aus WWF-Sicht wenig Neues und bleibt enttäuschend. Die Herausforderungen, vor denen Bundesminister Özdemir steht, sind hoch und der Textvorschlag wird ihnen weitgehend nicht gerecht. „Der Wald ist unser größter Naturraum in Deutschland und das stärkste Schwert, das wir haben, um unsere heimische Biodiversität zu schützen.
Dazu ist er ein entscheidender Pfeiler, auf dem die Klimaschutzziele der Bundesregierung, basieren. Doch dieses Schwert ist stumpf und wird im Kampf gegen den Klimawandel und die Biodiversitätskrise versagen“, kommentiert Dr. Susanne Winter, Programmleitung Wald beim WWF Deutschland.
Im Text schimmert das naive Wunschdenken durch, dass nicht-einheimische Baumarten die Resilienz unseres Waldes erhöhen und Deutschland so zu einem stabilen und gesunden Wald zurückkehren wird. Dass das unter realen Bedingungen nicht funktioniert, ist wissenschaftlich längst belegt. Statt nicht-heimischer Baumarten brauchen wir tragfähige und valide Handlungsoptionen bei Wetterextremen. Das neue Bundeswaldgesetz muss den Bundesländern großflächig ermöglichen, bei Hitze und Dürre den Holzeinschlag landesweit einzuschränken, damit das Waldökosystem sich unter sich verändernden klimatischen Bedingungen besser selber schützen und erhalten kann.
Um Waldbrände zu reduzieren, hilft es, mehr Bäume und insbesondere Laubbäume stehen zu lassen, da der Waldinnenraum dann länger kühler und feuchter bleibt. Auch junge Laubbäume wie Birken, Zitterpappel und Weiden erfüllen durch Beschattung diese Funktion auf geschädigten Flächen und sollten nicht zugunsten der Pflanzung von nicht-heimischen oder Nadel-Baumarten entnommen werden.
Weitere Präzisierung fordert der WWF dringend beim Thema Kahlschlag ein. Derzeit erlaubt der Text Kahlschläge bis ein Hektar genehmigungsfrei. Das allein bewertet der WWF als hochkritisch. Umso ärgerlicher ist es, dass keinerlei Maximalanteil pro Waldfläche, keine Mindestabstände zwischen den leergeräumten Flächen und keine Obergrenze für die genehmigungsfähige maximale Flächengröße definiert werden. „Es sollten maximal zwei Hektar Kahlschlag genehmigungsfähig sein. Im aktuellen Fall könnte eine Behörde genehmigen, geschädigten Wald auf 100 oder gar 1.000 Hektar zu räumen, und so das bereits gestresste lokale Ökosystem auf unverantwortliche Weise weiter zu ruinieren“, sagt Winter.
Realpolitisch scheint Minister Özdemir keinen weiteren Spielraum zu haben, aber es ist eine düstere Zukunftsaussicht, dass der Wald im Entwurf noch immer zuallererst als Wirtschaftsraum gesehen wird und nicht als Ökosystem, das wir für unser Überleben brauchen. Gesunde Wälder sind in ihrer Rolle für Wasserhaushalt, saubere Luft, Erosionsschutz sowie Biodiversität- und Klimaschutz für uns Menschen überlebenswichtig. Diese einfache Wahrheit spiegelt das Gesetz nicht genug wider. „Konservative Forstwirtschaftsverbände, unterstützt von der FDP, wettern mit ihrer aktuellen Kritik gegen jegliche gesellschaftliche und wirtschaftliche Vernunft und stellen kurzsichtige Eigentümer-Partikularinteressen in den Mittelpunkt, statt für uns Menschen die Zukunft sinnvoll und lebenswert zu gestalten“, so Winter.
Quelle
WWF
Stand: 05.11.2024
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung. Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Um Waldbrände zu reduzieren, hilft es, mehr Bäume und insbesondere Laubbäume stehen zu lassen, da der Waldinnenraum dann länger kühler und feuchter bleibt. Auch junge Laubbäume wie Birken, Zitterpappel und Weiden erfüllen durch Beschattung diese Funktion auf geschädigten Flächen und sollten nicht zugunsten der Pflanzung von nicht-heimischen oder Nadel-Baumarten entnommen werden.
Weitere Präzisierung fordert der WWF dringend beim Thema Kahlschlag ein. Derzeit erlaubt der Text Kahlschläge bis ein Hektar genehmigungsfrei. Das allein bewertet der WWF als hochkritisch. Umso ärgerlicher ist es, dass keinerlei Maximalanteil pro Waldfläche, keine Mindestabstände zwischen den leergeräumten Flächen und keine Obergrenze für die genehmigungsfähige maximale Flächengröße definiert werden. „Es sollten maximal zwei Hektar Kahlschlag genehmigungsfähig sein. Im aktuellen Fall könnte eine Behörde genehmigen, geschädigten Wald auf 100 oder gar 1.000 Hektar zu räumen, und so das bereits gestresste lokale Ökosystem auf unverantwortliche Weise weiter zu ruinieren“, sagt Winter.
Realpolitisch scheint Minister Özdemir keinen weiteren Spielraum zu haben, aber es ist eine düstere Zukunftsaussicht, dass der Wald im Entwurf noch immer zuallererst als Wirtschaftsraum gesehen wird und nicht als Ökosystem, das wir für unser Überleben brauchen. Gesunde Wälder sind in ihrer Rolle für Wasserhaushalt, saubere Luft, Erosionsschutz sowie Biodiversität- und Klimaschutz für uns Menschen überlebenswichtig. Diese einfache Wahrheit spiegelt das Gesetz nicht genug wider. „Konservative Forstwirtschaftsverbände, unterstützt von der FDP, wettern mit ihrer aktuellen Kritik gegen jegliche gesellschaftliche und wirtschaftliche Vernunft und stellen kurzsichtige Eigentümer-Partikularinteressen in den Mittelpunkt, statt für uns Menschen die Zukunft sinnvoll und lebenswert zu gestalten“, so Winter.
Quelle
WWF
Stand: 05.11.2024
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung. Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Artenschutz in Franken®
Die Geschichte des Baumpilzes ...

Die Geschichte des Baumpilzes ...
09/10.11.2024
... aus seiner eigenen Sicht und natürlich mit einem Hauch Humor!
Ein sanftes Rauschen geht durch den Wald. Die Sonne scheint durch das Blätterdach, und an der Seite eines alten Baumstammes erscheint ein Baumpilz. Ein leises Kichern ist zu hören, und dann fängt er an, zu erzählen.
09/10.11.2024
... aus seiner eigenen Sicht und natürlich mit einem Hauch Humor!
Ein sanftes Rauschen geht durch den Wald. Die Sonne scheint durch das Blätterdach, und an der Seite eines alten Baumstammes erscheint ein Baumpilz. Ein leises Kichern ist zu hören, und dann fängt er an, zu erzählen.
Ah, hallo! Ja, ja, ich weiß, was du denkst: "Was für ein komisches Ding hängt denn da am Baumstamm?" Nun, das bin ich, der Baumpilz, das hast du schon ganz richtig erkannt. Aber ich bin nicht einfach nur irgendein knubbeliges, halbrundes Etwas an diesem alten Baum hier. Ich habe eine wichtige Aufgabe! Oh ja – stell dir vor, ich bin quasi der "Recycling-Meister" des Waldes. Kein Müllcontainer, kein Abfallsystem kann gegen mich anstinken!
Meine Mission – und die meiner vielen, vielen Pilzfreunde – ist es, Holz zu zersetzen. Das bedeutet: wenn ein Baum alt wird und umkippt oder wenn ein Ast abbricht, dann knabbern wir, die Baumpilze, ihn langsam auf. Für uns sind die Bäume ein köstliches, nährstoffreiches Festmahl – wie für euch Menschen eine gute Pizza oder ein Burger. Und beim Knabbern geben wir all diese Nährstoffe wieder frei in den Waldboden, damit sie von den anderen Pflanzen und Bäumen aufgenommen werden können.
So läuft das ab: Wenn ich mich am Baum ansiedle, durchziehen meine Wurzeln, die Myzelien, den Stamm und lösen die harten Holzfasern auf. Kein Holz ist sicher vor mir – ich habe mich auf Zellulose und Lignin spezialisiert. Klingt kompliziert? Naja, für mich ist das quasi wie das Zerlegen von Kartoffelbrei mit einer Gabel. Manche nennen mich deswegen sogar den „Holzknacker“ des Waldes!
Ich finde das ziemlich witzig, denn weißt du was? Während die meisten anderen Lebewesen Holz nicht verdauen können, knabber ich es einfach weg und mache dabei neue, wertvolle Erde draus. Wer sonst kann das? Stell dir vor, du würdest einen Stuhl essen und daraus Blumenerde machen! Wäre cool, oder?
Meine geheime Superkraft? Ich wirke als „Arzt“ für den Wald. Wenn ein Baum alt wird oder krank ist, helfe ich, ihn friedlich „in die Erde zurückzubringen“. Manchmal siedle ich mich auch auf toten Baumstämmen an und „begleite“ sie auf ihrem Weg zu Erde und Nährstoff. Und während ich das tue, schaffe ich eine Heimat für viele kleine Lebewesen – Insekten, Käfer und sogar kleine Pilzfreunde finden bei mir Unterschlupf. Ich bin quasi ein „Mehrfamilienhaus“ für kleine Waldbewohner! Ach, und in Pilz-Land gibt es keine Mieterhöhung, hehe!
Und wenn es Zeit ist, sich zu vermehren? Dann schieße ich meine Sporen raus, Tausende auf einmal! Das ist wie eine Konfettikanone im Pilzstil. Meine Sporen fliegen durch den Wald, landen irgendwo und wachsen zu neuen Pilzen heran, wenn die Bedingungen gut sind. Also, wenn du das nächste Mal einen Baumpilz siehst, dann überleg dir gut, ob du uns berührst – wer weiß, vielleicht trägst du dann eine Handvoll meiner Babys mit nach Hause!
Also, denk das nächste Mal an mich, wenn du durch den Wald spazierst und uns Baumpilze siehst! Wir sind nicht nur „Dekoration“ an Bäumen. Wir sind die Recycler, Ärzte und Konfettikanonen des Waldes – und das ist doch irgendwie cool, oder?
In der Aufnahme
Meine Mission – und die meiner vielen, vielen Pilzfreunde – ist es, Holz zu zersetzen. Das bedeutet: wenn ein Baum alt wird und umkippt oder wenn ein Ast abbricht, dann knabbern wir, die Baumpilze, ihn langsam auf. Für uns sind die Bäume ein köstliches, nährstoffreiches Festmahl – wie für euch Menschen eine gute Pizza oder ein Burger. Und beim Knabbern geben wir all diese Nährstoffe wieder frei in den Waldboden, damit sie von den anderen Pflanzen und Bäumen aufgenommen werden können.
So läuft das ab: Wenn ich mich am Baum ansiedle, durchziehen meine Wurzeln, die Myzelien, den Stamm und lösen die harten Holzfasern auf. Kein Holz ist sicher vor mir – ich habe mich auf Zellulose und Lignin spezialisiert. Klingt kompliziert? Naja, für mich ist das quasi wie das Zerlegen von Kartoffelbrei mit einer Gabel. Manche nennen mich deswegen sogar den „Holzknacker“ des Waldes!
Ich finde das ziemlich witzig, denn weißt du was? Während die meisten anderen Lebewesen Holz nicht verdauen können, knabber ich es einfach weg und mache dabei neue, wertvolle Erde draus. Wer sonst kann das? Stell dir vor, du würdest einen Stuhl essen und daraus Blumenerde machen! Wäre cool, oder?
Meine geheime Superkraft? Ich wirke als „Arzt“ für den Wald. Wenn ein Baum alt wird oder krank ist, helfe ich, ihn friedlich „in die Erde zurückzubringen“. Manchmal siedle ich mich auch auf toten Baumstämmen an und „begleite“ sie auf ihrem Weg zu Erde und Nährstoff. Und während ich das tue, schaffe ich eine Heimat für viele kleine Lebewesen – Insekten, Käfer und sogar kleine Pilzfreunde finden bei mir Unterschlupf. Ich bin quasi ein „Mehrfamilienhaus“ für kleine Waldbewohner! Ach, und in Pilz-Land gibt es keine Mieterhöhung, hehe!
Und wenn es Zeit ist, sich zu vermehren? Dann schieße ich meine Sporen raus, Tausende auf einmal! Das ist wie eine Konfettikanone im Pilzstil. Meine Sporen fliegen durch den Wald, landen irgendwo und wachsen zu neuen Pilzen heran, wenn die Bedingungen gut sind. Also, wenn du das nächste Mal einen Baumpilz siehst, dann überleg dir gut, ob du uns berührst – wer weiß, vielleicht trägst du dann eine Handvoll meiner Babys mit nach Hause!
Also, denk das nächste Mal an mich, wenn du durch den Wald spazierst und uns Baumpilze siehst! Wir sind nicht nur „Dekoration“ an Bäumen. Wir sind die Recycler, Ärzte und Konfettikanonen des Waldes – und das ist doch irgendwie cool, oder?
In der Aufnahme
- Ein Baumpilz hat den Rest eines von Menschen gefällten Baumes besiedelt und beginnt diesen zu ersetzen ...
Artenschutz in Franken®
Verwerfliche Eingriffe in Eigentumsrechte Dritter / Überschreitung gesetzlicher Vorgaben

Verwerfliche Eingriffe in Eigentumsrechte Dritter / Überschreitung gesetzlicher Vorgaben
08/09.11.2024
Dieses Gesetz dient primär dem Schutz der Natur und der Tierwelt und hat ökologische sowie ethische Gründe.
08/09.11.2024
- Das Entfernen von Feldgehölzen, also Büschen, Sträuchern und kleinen Baumgruppen, ist in Deutschland und in vielen anderen Ländern in der Zeit vom 1. März bis zum 31. Oktober verboten.
Dieses Gesetz dient primär dem Schutz der Natur und der Tierwelt und hat ökologische sowie ethische Gründe.
Schutz der Brut- und Setzzeit
Die Zeit zwischen März und Oktober ist die Hauptbrut- und Setzzeit vieler Vogel- und Kleintierarten. Feldgehölze bieten hier Schutz und Lebensraum für Vögel, wie z.B. Amseln, Meisen und Finken, die in diesen Hecken und Sträuchern ihre Nester bauen und ihre Jungtiere großziehen. Auch Säugetiere wie Igel, Kaninchen und Hasen nutzen diese Gehölze als Unterschlupf und für die Aufzucht ihrer Jungen.
Das Entfernen oder starke Zurückschneiden von Feldgehölzen während dieser Zeit würde diese Tiere massiv stören und gefährden.
Winterquartiere und Nahrungsquellen
Feldgehölze bieten nicht nur Lebensraum zur Brutzeit, sondern auch wichtige Winterquartiere und Nahrungsquellen. In der kalten Jahreszeit finden Tiere dort Deckung vor Feinden und Witterung. Zugleich dienen diese Gehölze als eine wichtige Nahrungsquelle, da sie oft Früchte, Samen und andere Pflanzenreste bieten, die vielen Tieren über den Winter helfen.
Verstoß gegen Eigentumsrechte
Das Entfernen von Gehölzen auf fremdem Grundstück ohne Erlaubnis ist nicht nur ein Eingriff in den Lebensraum von Tieren, sondern auch ein Eingriff in die Eigentumsrechte des Grundstücksbesitzers. Eigentumsrechte besagen, dass nur der Besitzer oder von ihm Beauftragte Veränderungen am Grundstück vornehmen dürfen. Unerlaubtes Entfernen von Pflanzen kann als Sachbeschädigung angesehen werden, da Feldgehölze oft auch eine Schutzfunktion haben (z.B. als Windschutz oder Erosionsschutz).
Negative Auswirkungen auf Tiere durch Entnahme
Tiere leiden unter der Entfernung von Feldgehölzen, da diese Gehölze wichtige ökologische Funktionen erfüllen:
Fazit
Das Entfernen von Feldgehölzen vor dem 1. November ist gesetzlich geregelt, um das Ökosystem und den Lebensraum zahlreicher Tierarten zu schützen. Eingriffe während der Brut- und Setzzeit gefährden das Überleben vieler Jungtiere und stören die ökologische Balance. Zudem ist das Entfernen von Gehölzen auf fremdem Eigentum ohne Einwilligung illegal und respektiert nicht das Eigentumsrecht des
Grundstücksbesitzers.
In der Aufnahme
Die Zeit zwischen März und Oktober ist die Hauptbrut- und Setzzeit vieler Vogel- und Kleintierarten. Feldgehölze bieten hier Schutz und Lebensraum für Vögel, wie z.B. Amseln, Meisen und Finken, die in diesen Hecken und Sträuchern ihre Nester bauen und ihre Jungtiere großziehen. Auch Säugetiere wie Igel, Kaninchen und Hasen nutzen diese Gehölze als Unterschlupf und für die Aufzucht ihrer Jungen.
Das Entfernen oder starke Zurückschneiden von Feldgehölzen während dieser Zeit würde diese Tiere massiv stören und gefährden.
- Bei einer Entfernung vor dem 1. November wird das Brutverhalten der Vögel gestört, und es besteht die Gefahr, dass Jungtiere verhungern oder im Nest zurückbleiben.
- Viele Säugetiere, die sich in Hecken und Sträuchern verstecken, können keine Zufluchtsorte mehr finden, was sie leichter zu Beute für natürliche Beutegreifer macht und ihre Überlebenschancen verringert.
Winterquartiere und Nahrungsquellen
Feldgehölze bieten nicht nur Lebensraum zur Brutzeit, sondern auch wichtige Winterquartiere und Nahrungsquellen. In der kalten Jahreszeit finden Tiere dort Deckung vor Feinden und Witterung. Zugleich dienen diese Gehölze als eine wichtige Nahrungsquelle, da sie oft Früchte, Samen und andere Pflanzenreste bieten, die vielen Tieren über den Winter helfen.
Verstoß gegen Eigentumsrechte
Das Entfernen von Gehölzen auf fremdem Grundstück ohne Erlaubnis ist nicht nur ein Eingriff in den Lebensraum von Tieren, sondern auch ein Eingriff in die Eigentumsrechte des Grundstücksbesitzers. Eigentumsrechte besagen, dass nur der Besitzer oder von ihm Beauftragte Veränderungen am Grundstück vornehmen dürfen. Unerlaubtes Entfernen von Pflanzen kann als Sachbeschädigung angesehen werden, da Feldgehölze oft auch eine Schutzfunktion haben (z.B. als Windschutz oder Erosionsschutz).
- Der Besitz von Feldgehölzen ist eine Form der „biologischen Ressource“ des Grundstückbesitzers, die auch zum Wert eines Grundstücks beitragen kann. Wildtiere gehören zwar niemandem, aber das Habitat, das sie brauchen, ist Teil des Grundstücks.
Negative Auswirkungen auf Tiere durch Entnahme
Tiere leiden unter der Entfernung von Feldgehölzen, da diese Gehölze wichtige ökologische Funktionen erfüllen:
- Schutz und Deckung: Ohne Feldgehölze sind Tiere wie Hasen, Igel und Vögel Feinden ausgeliefert, da sie keine sicheren Verstecke mehr haben.
- Verlust von Brutstätten: Viele Vogelarten und Insekten legen ihre Nester in Hecken und Büschen an. Durch das Entfernen dieser Gehölze verlieren sie ihre Nistplätze, und eventuell bereits bestehende Nester werden zerstört.
- Verlust von Nahrungsquellen: Feldgehölze enthalten Insekten und Pflanzen, die für die Nahrungskette wichtig sind. Wird dieser Lebensraum zerstört, finden die Tiere weniger Futter und müssen größere Distanzen zurücklegen, um Nahrung zu finden.
- Verdrängung: Tiere sind darauf angewiesen, ein Revier zu finden und zu halten. Durch die Vernichtung von Feldgehölzen werden sie gezwungen, sich neue Habitate zu suchen, was in dicht besiedelten oder landwirtschaftlich intensiv genutzten Gebieten oft nicht möglich ist.
Fazit
Das Entfernen von Feldgehölzen vor dem 1. November ist gesetzlich geregelt, um das Ökosystem und den Lebensraum zahlreicher Tierarten zu schützen. Eingriffe während der Brut- und Setzzeit gefährden das Überleben vieler Jungtiere und stören die ökologische Balance. Zudem ist das Entfernen von Gehölzen auf fremdem Eigentum ohne Einwilligung illegal und respektiert nicht das Eigentumsrecht des
Grundstücksbesitzers.
In der Aufnahme
- es erscheint mehr als bedenklich wenn selbsterkannte "Landschaftspfleger", welche häufig noch mit öffentlichen Steuergeldern gestützt werden, egenächtig über Gesetzte hinweg gehen und außerhalb des eigenen Grundstücks, auf öffentlichem Grund und dann auch noch innerhalb gesetztlich geregelter Verbotszonen, Eingriffe tätigen welche das Ökosystem schädigen.
Artenschutz in Franken®
Die Luchs- oder auch Stilettfliege (Cliorismia Rustica) - Weibchen -

Luchs- oder auch Stilettfliege (Cliorismia Rustica)
08/09.11.2024
Ich kann verstehen, wenn ihr mich noch nicht kennt – ich bin ziemlich exklusiv! Lasst euch gesagt sein: Ich bin kein gewöhnlicher Fliegenvertreter. Mit meinem eleganten, schlanken Körper und einem Stilett schärfer als jeder Nagelknipser steche ich aus der Masse hervor. (Wortwörtlich!) Also schnallt euch an und lasst euch von mir, der furchtlosen Luchsfliege, ein wenig über das Leben in meinem Insekten-High-Speed-Lifestyle erzählen.
08/09.11.2024
- Hallo zusammen! Ich bin die Luchsfliege, auch bekannt als Stilettfliege und in der Fachwelt als Cliorismia rustica bekannt.
Ich kann verstehen, wenn ihr mich noch nicht kennt – ich bin ziemlich exklusiv! Lasst euch gesagt sein: Ich bin kein gewöhnlicher Fliegenvertreter. Mit meinem eleganten, schlanken Körper und einem Stilett schärfer als jeder Nagelknipser steche ich aus der Masse hervor. (Wortwörtlich!) Also schnallt euch an und lasst euch von mir, der furchtlosen Luchsfliege, ein wenig über das Leben in meinem Insekten-High-Speed-Lifestyle erzählen.
Mein Aussehen: Ein echter „Fashion Forward“
Zuerst mal zu meinem Look: Ich habe lange, kräftige Beine und bin ziemlich schlank und sportlich gebaut – schließlich bin ich ein Raubinsekt und muss entsprechend agil sein. Meine Beinmuskeln könnten es locker mit einem Profi-Sprinter aufnehmen (jedenfalls im Fliegenreich), und mein Körper ist aerodynamisch designt – elegant und tödlich zugleich, könnte man sagen. Mein „Stilett“, ein kurzer, aber scharfer Saugrüssel, ist mein ganzer Stolz. Damit bin ich bestens ausgerüstet, um meiner Beute (in erster Linie andere Insekten) den letzten „Schliff“ zu geben.
Jäger der Lüfte – und des Bodens
Ihr könnt mich als die kleine Fliegenvariante eines Raubkatzenjägers sehen. Ich patrouilliere in offenen Landschaften, besonders in Sand- und Heidelandschaften, und halte Ausschau nach Beute. Meine Technik: Ich greife blitzschnell an und nutze meine Beine wie kleine Greifzangen, um meine Opfer zu packen und zu betäuben. Da könnten andere Insekten vor Neid erblassen! Anschließend piekse ich sie mit meinem Stilett und sauge sie aus – wie ein kleiner Vampir, der einfach nicht auf Blut steht, sondern auf den Saft anderer Insekten.
Mein Versteck und Revier
Offene und sandige Stellen – das ist mein Ding! Ich bevorzuge Lebensräume, wo ich viel Platz zum Herumfliegen und Landen habe, besonders dort, wo mir die Sonne auf die Flügel scheint. Aber Achtung: Ich bin selten und ziemlich wählerisch mit meinen Wohnorten. Es muss schon exklusiv sein, wenn ich mich niederlasse.
Mein Nachwuchs: Klein, stark und hungrig
Was mein Liebesleben angeht: Nun, ich bin kein allzu fürsorgliches Elternteil. Ich lasse meine Eier in sandigen Böden oder lockerem Substrat und hoffe das Beste. Die Larven, die daraus schlüpfen, sind ebenfalls winzige, aber knallharte Jäger. Sie haben es faustdick hinter den Ohren und ernähren sich selbstständig von kleinen Insektenlarven im Boden. Ihr könnt sagen: Jagd liegt bei uns in der Familie!
Meine Tarnung: Ein Hauch von Mystik
Man sieht mich selten – nicht nur, weil ich klein und geschickt bin, sondern weil ich eine natürliche Tarnung habe. Meine bräunlich-graue Färbung verschmilzt perfekt mit meinem sandigen Umfeld. Ein echter Luchsfliegen-Ninja! Das gibt mir den Vorteil, mich heranzuschleichen und blitzschnell zuzuschlagen. Wer mich also erspäht, hat Glück gehabt – denn meist bin ich nur ein Schatten in der Sonne.
Mein gefährlicher Alltag: Luchsfliege sein ist kein Zuckerschlecken
Ja, ich bin ein Räuber, aber ich habe auch meine eigenen Fressfeinde. Vögel und größere Insekten könnten auf die Idee kommen, mich zu fressen, und das, obwohl ich ja eigentlich nur ein kleiner Räuber bin, der ebenfalls überleben muss! So spielt die Natur – manchmal bin ich die Jägerin, und manchmal... na ja, lande ich eben im Schnabel eines Spatzes.
Zusammengefasst
Ich bin die elegante, räuberische Jägerfliege der offenen Sandlandschaften. Mit meinem Stilett als Waffe und meinen Sprinterbeinen packe ich meine Beute und lebe das wilde Leben der Luchsfliegen. Also, wenn ihr mal eine kleine, mysteriöse Fliege auf der Jagd seht, haltet kurz inne – vielleicht habt ihr gerade die seltene Cliorismia rustica, die Stilettfliege, in Aktion erlebt.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
Zuerst mal zu meinem Look: Ich habe lange, kräftige Beine und bin ziemlich schlank und sportlich gebaut – schließlich bin ich ein Raubinsekt und muss entsprechend agil sein. Meine Beinmuskeln könnten es locker mit einem Profi-Sprinter aufnehmen (jedenfalls im Fliegenreich), und mein Körper ist aerodynamisch designt – elegant und tödlich zugleich, könnte man sagen. Mein „Stilett“, ein kurzer, aber scharfer Saugrüssel, ist mein ganzer Stolz. Damit bin ich bestens ausgerüstet, um meiner Beute (in erster Linie andere Insekten) den letzten „Schliff“ zu geben.
Jäger der Lüfte – und des Bodens
Ihr könnt mich als die kleine Fliegenvariante eines Raubkatzenjägers sehen. Ich patrouilliere in offenen Landschaften, besonders in Sand- und Heidelandschaften, und halte Ausschau nach Beute. Meine Technik: Ich greife blitzschnell an und nutze meine Beine wie kleine Greifzangen, um meine Opfer zu packen und zu betäuben. Da könnten andere Insekten vor Neid erblassen! Anschließend piekse ich sie mit meinem Stilett und sauge sie aus – wie ein kleiner Vampir, der einfach nicht auf Blut steht, sondern auf den Saft anderer Insekten.
Mein Versteck und Revier
Offene und sandige Stellen – das ist mein Ding! Ich bevorzuge Lebensräume, wo ich viel Platz zum Herumfliegen und Landen habe, besonders dort, wo mir die Sonne auf die Flügel scheint. Aber Achtung: Ich bin selten und ziemlich wählerisch mit meinen Wohnorten. Es muss schon exklusiv sein, wenn ich mich niederlasse.
Mein Nachwuchs: Klein, stark und hungrig
Was mein Liebesleben angeht: Nun, ich bin kein allzu fürsorgliches Elternteil. Ich lasse meine Eier in sandigen Böden oder lockerem Substrat und hoffe das Beste. Die Larven, die daraus schlüpfen, sind ebenfalls winzige, aber knallharte Jäger. Sie haben es faustdick hinter den Ohren und ernähren sich selbstständig von kleinen Insektenlarven im Boden. Ihr könnt sagen: Jagd liegt bei uns in der Familie!
Meine Tarnung: Ein Hauch von Mystik
Man sieht mich selten – nicht nur, weil ich klein und geschickt bin, sondern weil ich eine natürliche Tarnung habe. Meine bräunlich-graue Färbung verschmilzt perfekt mit meinem sandigen Umfeld. Ein echter Luchsfliegen-Ninja! Das gibt mir den Vorteil, mich heranzuschleichen und blitzschnell zuzuschlagen. Wer mich also erspäht, hat Glück gehabt – denn meist bin ich nur ein Schatten in der Sonne.
Mein gefährlicher Alltag: Luchsfliege sein ist kein Zuckerschlecken
Ja, ich bin ein Räuber, aber ich habe auch meine eigenen Fressfeinde. Vögel und größere Insekten könnten auf die Idee kommen, mich zu fressen, und das, obwohl ich ja eigentlich nur ein kleiner Räuber bin, der ebenfalls überleben muss! So spielt die Natur – manchmal bin ich die Jägerin, und manchmal... na ja, lande ich eben im Schnabel eines Spatzes.
Zusammengefasst
Ich bin die elegante, räuberische Jägerfliege der offenen Sandlandschaften. Mit meinem Stilett als Waffe und meinen Sprinterbeinen packe ich meine Beute und lebe das wilde Leben der Luchsfliegen. Also, wenn ihr mal eine kleine, mysteriöse Fliege auf der Jagd seht, haltet kurz inne – vielleicht habt ihr gerade die seltene Cliorismia rustica, die Stilettfliege, in Aktion erlebt.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- Eine wunderschöne Luchs- auch Stilettfliege ... sie ähneln den Raubfliegen mit denen sie verwandt sind.Es fiel mir schwer, diese Fliege, zu bestimmen.Der stark bemuskelte Oberkörper ist gewöhnlich Fliegen zu zu schreiben, die sich von anderen Insekten ernähren.
Artenschutz in Franken®
Graureiher-Attrappe zur Vogelabwehr ... Vor- und Nachteile

Graureiher-Attrappe zur Vogelabwehr ... Vor- und Nachteile
07/08.11.2024
Der Grundgedanke hinter der Verwendung einer Graureiher-Attrappe ist, dass Graureiher territorial sind und normalerweise keine anderen Reiher in ihrem Territorium dulden. Durch die Platzierung einer Attrappe sollen andere Reiher glauben, dass dieser Bereich bereits von einem anderen Reiher beansprucht wird, und so weiterziehen.
07/08.11.2024
- Eine Graureiher-Attrappe ist ein künstlich hergestelltes Modell eines Graureihers, das in Gärten, Teichen und Feldern aufgestellt wird, um andere Graureiher und potenziell auch andere Vögel davon abzuhalten, in diesen Bereichen nach Nahrung zu suchen.
Der Grundgedanke hinter der Verwendung einer Graureiher-Attrappe ist, dass Graureiher territorial sind und normalerweise keine anderen Reiher in ihrem Territorium dulden. Durch die Platzierung einer Attrappe sollen andere Reiher glauben, dass dieser Bereich bereits von einem anderen Reiher beansprucht wird, und so weiterziehen.
Funktionsweise einer Graureiher-Attrappe
Vorteile der Graureiher-Attrappe die wir erfassen:
Nachteile der Graureiher-Attrappe die wir erfassen:
Unser Fazit
Die Graureiher-Attrappe ist eine praktische und kostengünstige Methode, die in vielen Fällen für eine begrenzte Zeit gut funktioniert. Die Attrappe kann jedoch langfristig an Wirksamkeit verlieren, wenn sich die Reiher an sie gewöhnen oder sie als harmlos erkennen. Als Teil einer umfassenderen Strategie zur Fischteich- oder Gartensicherung etc. kann die Attrappe effektiv sein, jedoch oft nur in Kombination mit anderen Maßnahmen.
In der Aufnahme
- Territorialverhalten simulieren: Graureiher sind Einzelgänger und verteidigen ihr Revier gegen andere Reiher, besonders wenn es um Nahrung oder Brutplätze geht. Die Attrappe wird so gestaltet, dass sie wie ein echter Graureiher aussieht, idealerweise in einer stehenden oder fischenden Position, die den Eindruck vermittelt, dass der Bereich besetzt ist.
- Visuelle Abschreckung: Ein echter Reiher erkennt die Form und Position der Attrappe und nimmt sie als potenzielle Konkurrenz wahr. Dadurch wird er möglicherweise davon abgehalten, in diesem Bereich zu fischen.
Vorteile der Graureiher-Attrappe die wir erfassen:
- Einfache Installation: Die Attrappe ist leicht aufzustellen und benötigt keine komplizierte Installation oder Wartung. Sie kann einfach am Teichrand oder in einem Garten platziert werden.
- Kostengünstige Lösung: Im Vergleich zu anderen Lösungen wie Netzen oder beweglichen Abschreckungsmethoden sind Attrappen in der Regel preiswert und langlebig.
- Natürliche Abschreckung: Die Attrappe nutzt das natürliche Territorialverhalten des Reihers aus, ohne den Tieren Schaden zuzufügen oder chemische Mittel einzusetzen.
- Umweltfreundlich: Im Gegensatz zu chemischen o.a. Abschreckungsmethoden wird die Umgebung nicht belastet und das Verhalten wird auf natürliche Weise gesteuert.
Nachteile der Graureiher-Attrappe die wir erfassen:
- Gewöhnungseffekt: Graureiher sind intelligente Vögel. Nach einer Weile könnten sie erkennen, dass die Attrappe sich nicht bewegt und keine Gefahr darstellt. Das bedeutet, dass die Attrappe auf Dauer an Wirksamkeit verlieren kann.
- Begrenzte Reichweite: Die Attrappe wirkt nur in einem bestimmten Umfeld, und sobald ein Reiher in den Bereich des Gewässers gelangt, der nicht unmittelbar in Sichtweite der Attrappe liegt, kann sie an Effektivität verlieren.
- Wetteranfälligkeit: Je nach Material und Konstruktion kann die Attrappe durch Witterungseinflüsse beschädigt werden. Wenn sie verblasst oder beschädigt ist, wirkt sie weniger überzeugend und kann ihre Abschreckungsfunktion verlieren.
- Begrenzte Wirksamkeit bei anderen Tieren: Die Attrappe ist in erster Linie gegen Graureiher gedacht und hat keine signifikante Wirkung auf andere Tiere wie Fischotter oder andere natürliche Beutegreifer.
Unser Fazit
Die Graureiher-Attrappe ist eine praktische und kostengünstige Methode, die in vielen Fällen für eine begrenzte Zeit gut funktioniert. Die Attrappe kann jedoch langfristig an Wirksamkeit verlieren, wenn sich die Reiher an sie gewöhnen oder sie als harmlos erkennen. Als Teil einer umfassenderen Strategie zur Fischteich- oder Gartensicherung etc. kann die Attrappe effektiv sein, jedoch oft nur in Kombination mit anderen Maßnahmen.
- Aktuell haben wir 5 dieser Attrappen im Monitoring um deren weiterführende Entwicklung zu dokumentieren.
In der Aufnahme
- Graureiher-Attrappe an einem Fischteich
Artenschutz in Franken®
Bundeswaldgesetz auf dem Holzweg

Bundeswaldgesetz auf dem Holzweg
06/07.11.2024
Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft hat die Länder- und Verbändeanhörung für ein geändertes Bundeswaldgesetz gestartet. Doch der Entwurf bietet aus WWF-Sicht wenig Neues und bleibt enttäuschend.
Die Herausforderungen, vor denen Bundesminister Özdemir steht, sind hoch und der Textvorschlag wird ihnen weitgehend nicht gerecht. „Der Wald ist unser größter Naturraum in Deutschland und das stärkste Schwert, das wir haben, um unsere heimische Biodiversität zu schützen.
Dazu ist er ein entscheidender Pfeiler, auf dem die Klimaschutzziele der Bundesregierung, basieren. Doch dieses Schwert ist stumpf und wird im Kampf gegen den Klimawandel und die Biodiversitätskrise versagen“, kommentiert Dr. Susanne Winter, Programmleitung Wald beim WWF Deutschland.
06/07.11.2024
- WWF: Entwurf löst die Probleme nicht
Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft hat die Länder- und Verbändeanhörung für ein geändertes Bundeswaldgesetz gestartet. Doch der Entwurf bietet aus WWF-Sicht wenig Neues und bleibt enttäuschend.
Die Herausforderungen, vor denen Bundesminister Özdemir steht, sind hoch und der Textvorschlag wird ihnen weitgehend nicht gerecht. „Der Wald ist unser größter Naturraum in Deutschland und das stärkste Schwert, das wir haben, um unsere heimische Biodiversität zu schützen.
Dazu ist er ein entscheidender Pfeiler, auf dem die Klimaschutzziele der Bundesregierung, basieren. Doch dieses Schwert ist stumpf und wird im Kampf gegen den Klimawandel und die Biodiversitätskrise versagen“, kommentiert Dr. Susanne Winter, Programmleitung Wald beim WWF Deutschland.
Im Text schimmert das naive Wunschdenken durch, dass nicht-einheimische Baumarten die Resilienz unseres Waldes erhöhen und Deutschland so zu einem stabilen und gesunden Wald zurückkehren wird. Dass das unter realen Bedingungen nicht funktioniert, ist wissenschaftlich längst belegt.
Statt nicht-heimischer Baumarten brauchen wir tragfähige und valide Handlungsoptionen bei Wetterextremen. Das neue Bundeswaldgesetz muss den Bundesländern großflächig ermöglichen, bei Hitze und Dürre den Holzeinschlag landesweit einzuschränken, damit das Waldökosystem sich unter sich verändernden klimatischen Bedingungen besser selber schützen und erhalten kann.
Um Waldbrände zu reduzieren, hilft es, mehr Bäume und insbesondere Laubbäume stehen zu lassen, da der Waldinnenraum dann länger kühler und feuchter bleibt. Auch junge Laubbäume wie Birken, Zitterpappel und Weiden erfüllen durch Beschattung diese Funktion auf geschädigten Flächen und sollten nicht zugunsten der Pflanzung von nicht-heimischen oder Nadel-Baumarten entnommen werden.
Weitere Präzisierung fordert der WWF dringend beim Thema Kahlschlag ein. Derzeit erlaubt der Text Kahlschläge bis ein Hektar genehmigungsfrei. Das allein bewertet der WWF als hochkritisch. Umso ärgerlicher ist es, dass keinerlei Maximalanteil pro Waldfläche, keine Mindestabstände zwischen den leergeräumten Flächen und keine Obergrenze für die genehmigungsfähige maximale Flächengröße definiert werden. „Es sollten maximal zwei Hektar Kahlschlag genehmigungsfähig sein. Im aktuellen Fall könnte eine Behörde genehmigen, geschädigten Wald auf 100 oder gar 1.000 Hektar zu räumen, und so das bereits gestresste lokale Ökosystem auf unverantwortliche Weise weiter zu ruinieren“, sagt Winter.
Realpolitisch scheint Minister Özdemir keinen weiteren Spielraum zu haben, aber es ist eine düstere Zukunftsaussicht, dass der Wald im Entwurf noch immer zuallererst als Wirtschaftsraum gesehen wird und nicht als Ökosystem, das wir für unser Überleben brauchen. Gesunde Wälder sind in ihrer Rolle für Wasserhaushalt, saubere Luft, Erosionsschutz sowie Biodiversität- und Klimaschutz für uns Menschen überlebenswichtig.
Diese einfache Wahrheit spiegelt das Gesetz nicht genug wider. „Konservative Forstwirtschaftsverbände, unterstützt von der FDP, wettern mit ihrer aktuellen Kritik gegen jegliche gesellschaftliche und wirtschaftliche Vernunft und stellen kurzsichtige Eigentümer-Partikularinteressen in den Mittelpunkt, statt für uns Menschen die Zukunft sinnvoll und lebenswert zu gestalten“, so Winter.
Quelle
WWF
Stand: 05.11.2024
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung. Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
In der Aufnahme von Johannes Rother
- Feuersalamander Weibchen in einem Waldbach- Laichgewässer ... vielfach erkennen wir das bedenkliche Eingriffe in den vornehmlich als Wirtschaftsorst anzusehenden "Wald" auch nachteilige Auswirkungen auf Feuersalamanderpopulationen haben.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Artenschutz in Franken®
Der Kohldistel-Flohkäfer (Neocrepidodera transversa)

Kohldistel-Flohkäfer (Neocrepidodera transversa)
06/07.11.2024
Für manche ein kleiner Störenfried, für mich ein Lebensstil voller feiner Blatt-Aromen und schneller Fluchttechniken.
06/07.11.2024
- Aus meiner Perspektive, dem Kohldistel-Flohkäfer – oder, wie mich die Menschen nennen, Neocrepidodera transversa – bin ich eine Art kleiner Natur-Abenteurer mit einem gewaltigen Sprungtalent und einer Vorliebe für die würzig-bitteren Blätter der Kohldistel.
Für manche ein kleiner Störenfried, für mich ein Lebensstil voller feiner Blatt-Aromen und schneller Fluchttechniken.
Mein Leben als winziger Blattexperte
Ich bin nur etwa 3 Millimeter groß – für euch vielleicht kaum sichtbar, aber in meiner Welt kann ich die Königsdisteln und Kohlpflanzen mit einem Bissen erobern. Als ausgewachsener Flohkäfer (ja, wir nennen uns wirklich so!) finde ich die Blätter meiner Lieblingspflanzen mit unglaublicher Präzision. Meine Fühler sind meine kleinen Sensoren und führen mich direkt zu den besten Stellen, wo ich kleine Löcher in die Blätter knabbern kann. Ein bisschen bitter, ein bisschen saftig – genau mein Geschmack!
Aber halt, bevor ich weiter erzähle: Das "Floh" in Flohkäfer ist kein Zufall. Ich habe Sprungbeine, die mich wie ein kleiner, brillanter Akrobat durch die Luft katapultieren! Wenn Gefahr droht – zum Beispiel ein Vogel oder ein ungeduldiger Mensch – bin ich sofort bereit, einen „Hopser“ in die Freiheit zu machen. Und lasst mich euch sagen, für jemanden meiner Größe sind das gewaltige Sprünge. Ich meine, stellt euch vor, ihr würdet mit einem Sprung das Dreifache eurer Körperlänge schaffen! Beeindruckend, oder?
Mein Alltag auf der Kohldistel und Co.
Ihr Menschen nennt mich oft einen „Schädling“ – dabei bin ich eigentlich nur ein kleiner Genießer! Ich bin spezialisiert auf die Pflanzen der Familie der Korbblütler, besonders auf die Kohldistel (Cirsium oleraceum). Für mich sind ihre Blätter wie die feinen Gourmet-Teller einer noblen Speisekarte. Meine kleinen, halbmondförmigen Knabberspuren können jedoch für manche Pflanzen zu einer echten Herausforderung werden, aber hey, jeder Käfer hat doch seine Schwächen, oder? Und ich trage meinen Titel als „Flohkäfer“ immerhin mit Stolz.
Als Larve lebe ich meist unauffällig in der Erde und ernähre mich von den Wurzeln der Pflanzen. So habe ich auch in meinem jüngeren Leben schon engen Kontakt zur Kohldistel und ihren Verwandten – man könnte sagen, ich bin ein echter Distel-Kenner von der Wurzel bis zum Blatt.
Gefahren und Abenteuer: Mein Flohkäfer-Leben ist kein Zuckerschlecken!
Natürlich ist das Leben als winziger Käfer nicht immer einfach. Mein größter Feind? Jeder, der mich fressen möchte. Und davon gibt es viele: Vögel, Spinnen, und nicht zu vergessen, Menschen, die ihre Pflanzen sorgsam pflegen wollen. Aber ich habe ja meine Sprungkraft! Mit einem kleinen „Boing!“ bin ich in Sicherheit, und das Chaos bleibt zurück. Mein Talent, mich blitzschnell in die Luft zu schießen, ist mein größtes Ass im Ärmel.
Und ja, manchmal lande ich dabei im Gestrüpp oder auf einem anderen Blatt – nicht immer perfekt, aber hey, was wäre das Leben ohne ein bisschen Abenteuer und eine ordentliche Portion Unvorhersehbarkeit?
Ein Leben im Rhythmus der Natur
Ein bisschen Spaß muss sein, aber ich weiß, dass auch meine Lebenszeit begrenzt ist. Ich denke, am Ende bin ich nur ein winziger Teil im großen Kreislauf. In meiner kurzen Lebensspanne trage ich meinen Teil dazu bei, das Gleichgewicht auf den Wiesen und Feldern zu erhalten. Mit meinen Knabberstellen, meinen Larven im Boden und meinen Sprüngen, die euch vielleicht nerven, bin ich eigentlich ein kleiner Spieler im großen Garten der Natur.
Ich springe, knabbere und genieße das Leben – wer weiß, was für Abenteuer der nächste Sprung bringt!
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
Ich bin nur etwa 3 Millimeter groß – für euch vielleicht kaum sichtbar, aber in meiner Welt kann ich die Königsdisteln und Kohlpflanzen mit einem Bissen erobern. Als ausgewachsener Flohkäfer (ja, wir nennen uns wirklich so!) finde ich die Blätter meiner Lieblingspflanzen mit unglaublicher Präzision. Meine Fühler sind meine kleinen Sensoren und führen mich direkt zu den besten Stellen, wo ich kleine Löcher in die Blätter knabbern kann. Ein bisschen bitter, ein bisschen saftig – genau mein Geschmack!
Aber halt, bevor ich weiter erzähle: Das "Floh" in Flohkäfer ist kein Zufall. Ich habe Sprungbeine, die mich wie ein kleiner, brillanter Akrobat durch die Luft katapultieren! Wenn Gefahr droht – zum Beispiel ein Vogel oder ein ungeduldiger Mensch – bin ich sofort bereit, einen „Hopser“ in die Freiheit zu machen. Und lasst mich euch sagen, für jemanden meiner Größe sind das gewaltige Sprünge. Ich meine, stellt euch vor, ihr würdet mit einem Sprung das Dreifache eurer Körperlänge schaffen! Beeindruckend, oder?
Mein Alltag auf der Kohldistel und Co.
Ihr Menschen nennt mich oft einen „Schädling“ – dabei bin ich eigentlich nur ein kleiner Genießer! Ich bin spezialisiert auf die Pflanzen der Familie der Korbblütler, besonders auf die Kohldistel (Cirsium oleraceum). Für mich sind ihre Blätter wie die feinen Gourmet-Teller einer noblen Speisekarte. Meine kleinen, halbmondförmigen Knabberspuren können jedoch für manche Pflanzen zu einer echten Herausforderung werden, aber hey, jeder Käfer hat doch seine Schwächen, oder? Und ich trage meinen Titel als „Flohkäfer“ immerhin mit Stolz.
Als Larve lebe ich meist unauffällig in der Erde und ernähre mich von den Wurzeln der Pflanzen. So habe ich auch in meinem jüngeren Leben schon engen Kontakt zur Kohldistel und ihren Verwandten – man könnte sagen, ich bin ein echter Distel-Kenner von der Wurzel bis zum Blatt.
Gefahren und Abenteuer: Mein Flohkäfer-Leben ist kein Zuckerschlecken!
Natürlich ist das Leben als winziger Käfer nicht immer einfach. Mein größter Feind? Jeder, der mich fressen möchte. Und davon gibt es viele: Vögel, Spinnen, und nicht zu vergessen, Menschen, die ihre Pflanzen sorgsam pflegen wollen. Aber ich habe ja meine Sprungkraft! Mit einem kleinen „Boing!“ bin ich in Sicherheit, und das Chaos bleibt zurück. Mein Talent, mich blitzschnell in die Luft zu schießen, ist mein größtes Ass im Ärmel.
Und ja, manchmal lande ich dabei im Gestrüpp oder auf einem anderen Blatt – nicht immer perfekt, aber hey, was wäre das Leben ohne ein bisschen Abenteuer und eine ordentliche Portion Unvorhersehbarkeit?
Ein Leben im Rhythmus der Natur
Ein bisschen Spaß muss sein, aber ich weiß, dass auch meine Lebenszeit begrenzt ist. Ich denke, am Ende bin ich nur ein winziger Teil im großen Kreislauf. In meiner kurzen Lebensspanne trage ich meinen Teil dazu bei, das Gleichgewicht auf den Wiesen und Feldern zu erhalten. Mit meinen Knabberstellen, meinen Larven im Boden und meinen Sprüngen, die euch vielleicht nerven, bin ich eigentlich ein kleiner Spieler im großen Garten der Natur.
Ich springe, knabbere und genieße das Leben – wer weiß, was für Abenteuer der nächste Sprung bringt!
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- ... Kohldistel-Flohkäfer (Neocrepidodera transversa) in Lebensräumen mit Distelbewuchs.
Artenschutz in Franken®
Stele der Biodiversität® - Burgwindheim / Kötsch

Stele der Biodiversität® - Burgwindheim / Kötsch
04/05.11.2024
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das vom Markt Burgwindheim, dem Bayernwerk der Deutschen Postcode Lotterie und der Steuerkanzlei Bauerfeind unterstützt wird.
Kötsch / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen.
Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
04/05.11.2024
- Installation des virtuellen Rundgangs abgeschlossen
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das vom Markt Burgwindheim, dem Bayernwerk der Deutschen Postcode Lotterie und der Steuerkanzlei Bauerfeind unterstützt wird.
Kötsch / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen.
Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
Denn wenn (selbst in noch geeigneten Nahrungsstrukturen) keine geeigneten Reproduktionsräume vorhanden sind, ist die Erhaltung der Artenvielfalt gelichfalls zum Scheitern verurteilt.
Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das vom Markt Burgwindheim, dem Bayernwerk der Deutschen Postcode Lotterie und der Steuerkanzlei Bauerfeind unterstützt wird, setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.
In der Aufnahme
Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das vom Markt Burgwindheim, dem Bayernwerk der Deutschen Postcode Lotterie und der Steuerkanzlei Bauerfeind unterstützt wird, setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.
In der Aufnahme
- Projektfortschritt am 07.08.2024 ...
Artenschutz in Franken®
Die Binsenschmuckzikade (Cicadella viridis)

Binsenschmuckzikade (Cicadella viridis)
05/06.11.2024
Ich gehöre zur Familie der Cicadellidae und falle durch mein leuchtend grünes Kleid auf, das mich manchmal schützt, manchmal jedoch in Schwierigkeiten bringt. Die Menschen nennen mich eine „Schmuckzikade“, wegen meiner markanten Farben, die so herrlich in der Sonne schimmern. Doch Schönheit ist nicht alles – für uns ist es auch eine Herausforderung, in einer Welt zu leben, die sich ständig verändert.
05/06.11.2024
- Aus meiner Sicht, der Binsenschmuckzikade – Cicadella viridis –, ist die Welt voll von grünen Wundern und verborgenen Gefahren.
Ich gehöre zur Familie der Cicadellidae und falle durch mein leuchtend grünes Kleid auf, das mich manchmal schützt, manchmal jedoch in Schwierigkeiten bringt. Die Menschen nennen mich eine „Schmuckzikade“, wegen meiner markanten Farben, die so herrlich in der Sonne schimmern. Doch Schönheit ist nicht alles – für uns ist es auch eine Herausforderung, in einer Welt zu leben, die sich ständig verändert.
Meine Existenz und mein Lebensraum
Geboren werde ich im Frühling, klein und unscheinbar, ohne die Flügel, die mich später als erwachsenes Tier auszeichnen werden. Meine Larvenzeit verbringe ich meist versteckt in der Nähe von Binsen und Gräsern an feuchten Orten: an Teichrändern, in Sumpfwiesen und entlang von kleinen Wasserläufen. Dort finde ich den Saft der Pflanzen, der mich ernährt und stärkt. Wenn ich dann als erwachsene Zikade heranwachse, entdecke ich die Fähigkeit, nicht nur zu springen, sondern auch zu fliegen. Ein freudiges Gefühl, doch auch mit Unsicherheiten behaftet, denn in der Luft warten Raubvögel und Spinnen darauf, mir nachzustellen.
Mein Leben als Pflanzenjägerin
Mein Leben als Pflanzensaugerin ist still und doch unentbehrlich. Ich durchbohre mit meinem Rüssel das Gewebe der Gräser, um an den nährenden Pflanzensaft zu gelangen. Die Menschen mögen es kaum merken, doch ich habe dabei einen großen Einfluss auf das Gleichgewicht im Ökosystem. Indem ich die Pflanzen ansteche, öffne ich ihre Zellwände, und so können Mikroorganismen in das Innere der Pflanze gelangen. Manche Forscher vermuten, dass ich damit sogar die Verbreitung bestimmter Pilzsporen oder Bakterien unterstütze. Ich selbst denke dabei nur an meinen Hunger – doch vielleicht sind wir alle nur ein Teil eines größeren Kreislaufs, den wir nicht ganz verstehen.
Die Herausforderungen einer veränderten Welt
Manchmal spüre ich die Veränderungen in meinem Lebensraum, die die Menschen verursachen. Das Wasser wird knapper, und die Wiesen, die einst voll von Binsen und Gräsern waren, verschwinden. Für mich bedeutet das, dass ich und viele meiner Artgenossen immer weniger sichere Plätze finden. Doch auch der Klimawandel macht uns zu schaffen: Es gibt Sommer, die heißer und trockener sind als früher, und das schwächt unsere Lebensräume und die Pflanzen, die wir brauchen.
Ich frage mich manchmal: Was wird aus uns, wenn diese Wiesen endgültig verschwinden? Wenn wir keine Pflanzen mehr finden, die uns den Saft geben, den wir brauchen? Ich bin nur eine kleine Zikade, doch auch ich fühle die Erschütterungen, die die großen Entscheidungen der Menschen in meinem kleinen grünen Reich verursachen.
Der leuchtende Schein der Binsenschmuckzikade
Ich frage mich oft, ob die Menschen die Schönheit und Zerbrechlichkeit der Natur überhaupt wahrnehmen – ob sie mich sehen und verstehen, dass mein Leben Teil eines größeren Netzes ist. Ich weiß, dass ich nicht ewig lebe und dass die nächste Generation von Binsenschmuckzikaden erst wieder ihre eigenen Kämpfe führen wird. Doch in diesen kurzen Momenten, in denen ich mit dem Sonnenlicht spiele und mich an den frischen Pflanzensäften laben kann, fühle ich die Verbindung zu allem Lebendigen um mich herum.
Vielleicht ist es das, was uns alle antreibt: der Wunsch, einfach zu existieren, vielleicht gesehen zu werden und den winzigen Teil unseres Wesens für einen kurzen Augenblick zu zeigen, bevor wir vergehen.
In der Aufnhame von Bernhard Schmalisch
- Weibchen
Artenschutz in Franken®
Der Prächtige Blattkäfer / Goldglänzende Blattkäfer (Chrysolina fastuosa)

Prächtiger Blattkäfer (Chrysolina fastuosa)
05/06.11.2024
Mein glitzerndes Aussehen in metallischem Gold, Kupfer und Grün ist nicht nur schön anzusehen, sondern auch ein wichtiger Teil meines Daseins. Aber lasst euch nicht von meinem schillernden Äußeren ablenken, denn ich habe auch einiges auf dem Kasten, was das Überleben und Fressen angeht!“
05/06.11.2024
- „Hallo und herzlich willkommen in meiner schillernden Welt! Ich bin Chrysolina fastuosa, besser bekannt als der Prächtige oder Goldglänzende Blattkäfer – ein Name, der meine äußere Pracht schon recht gut trifft, wenn ich das so sagen darf.
Mein glitzerndes Aussehen in metallischem Gold, Kupfer und Grün ist nicht nur schön anzusehen, sondern auch ein wichtiger Teil meines Daseins. Aber lasst euch nicht von meinem schillernden Äußeren ablenken, denn ich habe auch einiges auf dem Kasten, was das Überleben und Fressen angeht!“
Mein Aussehen: Ein schillerndes Kunstwerk der Natur
„Falls ihr mich noch nie gesehen habt, stellt euch eine kleine, rundliche Käferschönheit vor, die in allen Farben des Regenbogens glänzt. Je nach Lichteinfall schimmere ich in Gold, Kupfer, Grün und manchmal auch Violett. Diese schillernde Pracht habe ich meinem Chitinpanzer zu verdanken, der durch die sogenannte Interferenzfarbe leuchtet – ganz ohne Pigmente. Diese optische Illusion hilft mir dabei, mich in die bunten Blätter und Blüten einzufügen und gleichzeitig zu signalisieren: ‚Achtung, ich bin kein Käfer, den man einfach wegknabbern kann!‘ Manchmal macht mein Farbspiel Fressfeinde skeptisch, und das gibt mir die Chance, in Ruhe weiter an meiner Lieblingsbeschäftigung zu arbeiten.“
Mein Speiseplan: Die Liebe zu Minzen und anderen Lippenblütlern
„Ich bin ein Genießer und habe mich auf Pflanzen spezialisiert, die ihr vielleicht als Wildkräuter kennt. Am liebsten knabbere ich an den Blättern von Minze, Thymian, Ehrenpreis und vielen anderen Lippenblütlern. Für diese Pflanzen habe ich spezielle Verdauungsenzyme entwickelt, die es mir ermöglichen, sie besser zu verwerten. Diese Wildkräuter enthalten bestimmte Stoffe, die für viele andere Tiere unverdaulich oder giftig sind – für mich jedoch nicht! Dank meines robusten Magens und der Anpassung an diese Kräuter lebe ich ein sehr entspanntes Leben, mit einer quasi unendlichen Vorratskammer voller Lieblingsspeisen!“
Mein Lebenszyklus: Vom Ei zur glänzenden Schönheit
„Wie bei allen Käfern beginne ich als Ei, das meine Mutter im Frühjahr auf den Blättern meiner Lieblingspflanzen ablegt. Diese sind gut versteckt und optimal platziert, sodass mein Nachwuchs sofort beim Schlüpfen etwas zu futtern hat. Als Larven sehen wir noch recht unscheinbar aus und verbringen unsere Zeit damit, uns so schnell wie möglich sattzufressen und zu wachsen. Dann verpuppen wir uns und ruhen in einem Kokon, während sich unsere schillernde Gestalt bildet. Einige Wochen später schlüpfen wir als prächtige, glanzvolle Käfer – bereit, die Welt mit unserem Glanz zu verzaubern und die nächste Generation fortzuführen.“
Meine Bedeutung im Ökosystem: Ein kleiner Gourmet mit großem Einfluss
„Zwar halte ich mich für einen Feinschmecker, doch ich habe auch eine wichtige Rolle im Ökosystem. Durch meine Fressgewohnheiten trage ich dazu bei, dass die Populationen meiner Wirtspflanzen im Gleichgewicht bleiben. Manchmal bin ich sogar ein Bio-Indikator, was bedeutet, dass meine Anwesenheit oft auf eine gesunde Umgebung hinweist, da ich in sehr belasteten Gebieten nicht überleben kann. Außerdem diene ich als Nahrungsquelle für einige spezialisierte Räuber und bin so ein kleines, aber wichtiges Teil in der Nahrungskette.“
Ein letztes Wort von der Goldglänzenden Schönheit
„Ich hoffe, ihr seht nun, dass ich mehr bin als ein glänzendes Schmuckstück auf der Wiese. Mit meiner farbenfrohen Erscheinung, meinem Geschmack für besondere Pflanzen und meiner Rolle im Ökosystem bin ich ein kleiner, aber unverzichtbarer Teil der Natur. Wenn ihr das nächste Mal einen prächtigen, metallisch schimmernden Käfer seht, dann nehmt euch einen Moment, um meinen Glanz zu bewundern. Denn ich bin nicht nur ein Käfer – ich bin Chrysolina fastuosa, ein schillerndes Wunder der Natur!“
Aufnahme von Albert Meier
Artenschutz in Franken®
Die Breite Fliegengrabwespe (Ectemnius lituratus)

Breite Fliegengrabwespe (Ectemnius lituratus)
05/06.11.2024
Für euch Menschen mag ich unscheinbar wirken, aber ich bin eine wahre Meisterin im Jagen und Nestbau – und das alles, um meine Brut zu versorgen. Seht euch mein Leben an: effizient, strategisch und ein wenig gruselig, wenn man bedenkt, wie ich meine Beute lagere.“
05/06.11.2024
- „Seid gegrüßt! Ich bin Ectemnius lituratus, die Breite Fliegengrabwespe. Vielleicht habt ihr mich in eurem Garten bemerkt, flink, schwarz-gelb gestreift und auf der Suche nach Fliegen.
Für euch Menschen mag ich unscheinbar wirken, aber ich bin eine wahre Meisterin im Jagen und Nestbau – und das alles, um meine Brut zu versorgen. Seht euch mein Leben an: effizient, strategisch und ein wenig gruselig, wenn man bedenkt, wie ich meine Beute lagere.“
Mein Aussehen: Klein, aber gut ausgestattet
„Mit meinen knappen 10 bis 12 Millimetern bin ich nicht groß, aber gut erkennbar. Mein schwarz-gelber Körper mag an die Farben von Wespen erinnern – und ja, das ist Absicht! Dieses Outfit hält einige meiner Fressfeinde auf Abstand. Mein Kopf ist auffallend groß und kräftig, vor allem für eine Wespe meiner Größe. Denn bei mir geht es ums Greifen und Halten – meine kräftigen Mundwerkzeuge sind perfekt, um meine Beute zu sichern und, nun ja, ihr könnt euch denken, was ich mit den Fliegen mache!“
Die Jagd: Fliegen als Liebhaberinnengabe
„Ich bin eine exzellente Jägerin. Mein Beuteschema? Fliegen! Wenn ich eine passende Fliege entdecke, stürze ich mich blitzschnell auf sie und packe sie mit meinen starken Mandibeln. Aber nein, keine Sorge, ich futtere sie nicht selbst. Die Fliegen, die ich fange, sind für meine zukünftige Brut bestimmt. Für meine Larven bereite ich quasi ein ‚Beute-Buffet‘ vor, das sie in meinem selbstgebauten Nest verspeisen können.“
Nistplatzbau: Handwerk mit Stil
„Beim Nestbau bin ich wählerisch. Ich bevorzuge morsche Baumstämme, Totholz oder sandige, lockere Erde, in die ich meinen Nistplatz grabe. Sobald ich einen geeigneten Platz finde, lege ich los – mit viel Geduld und Detailarbeit. Ich grabe kleine Tunnel und baue darin einzelne Kammern. Jede dieser Kammern wird später das Zuhause für eine Larve sein, und hier kommt der Clou: Jede Kammer fülle ich mit betäubten, aber noch lebenden Fliegen. Frisch und saftig bleiben sie als Futter für meine Nachkommen.“
Warum die Fliegen nur betäuben? Das Geheimnis der Vorratshaltung
„Vielleicht fragt ihr euch, warum ich die Fliegen nicht einfach töte? Ganz einfach – damit sie frisch bleiben! Durch einen gezielten Stich betäube ich meine Beute nur, sodass sie zwar immobil ist, aber nicht sofort verfault. So haben meine Larven später frische Nahrung, wenn sie schlüpfen. Und wenn ihr es makaber findet, dass mein Nachwuchs lebende Vorräte hat – nun, das ist eben Wespenlogik! Es ist ein ausgeklügeltes System, das seit Generationen funktioniert.“
Fortpflanzung und die nächste Generation
„Nach dem Bau und der Befüllung meiner Nistkammern lege ich in jede Kammer ein Ei und verschließe sie sorgfältig. Dann heißt es: Abschied nehmen und weiterziehen. Die Larven schlüpfen kurze Zeit später und haben dank meiner Vorbereitung alles, was sie brauchen, um zu wachsen und zu gedeihen. Sie fressen die bereitgestellten Fliegenvorräte auf, wachsen, verpuppen sich und schlüpfen im nächsten Jahr als neue Generation Breiter Fliegengrabwespen.“
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
„Mit meinen knappen 10 bis 12 Millimetern bin ich nicht groß, aber gut erkennbar. Mein schwarz-gelber Körper mag an die Farben von Wespen erinnern – und ja, das ist Absicht! Dieses Outfit hält einige meiner Fressfeinde auf Abstand. Mein Kopf ist auffallend groß und kräftig, vor allem für eine Wespe meiner Größe. Denn bei mir geht es ums Greifen und Halten – meine kräftigen Mundwerkzeuge sind perfekt, um meine Beute zu sichern und, nun ja, ihr könnt euch denken, was ich mit den Fliegen mache!“
Die Jagd: Fliegen als Liebhaberinnengabe
„Ich bin eine exzellente Jägerin. Mein Beuteschema? Fliegen! Wenn ich eine passende Fliege entdecke, stürze ich mich blitzschnell auf sie und packe sie mit meinen starken Mandibeln. Aber nein, keine Sorge, ich futtere sie nicht selbst. Die Fliegen, die ich fange, sind für meine zukünftige Brut bestimmt. Für meine Larven bereite ich quasi ein ‚Beute-Buffet‘ vor, das sie in meinem selbstgebauten Nest verspeisen können.“
Nistplatzbau: Handwerk mit Stil
„Beim Nestbau bin ich wählerisch. Ich bevorzuge morsche Baumstämme, Totholz oder sandige, lockere Erde, in die ich meinen Nistplatz grabe. Sobald ich einen geeigneten Platz finde, lege ich los – mit viel Geduld und Detailarbeit. Ich grabe kleine Tunnel und baue darin einzelne Kammern. Jede dieser Kammern wird später das Zuhause für eine Larve sein, und hier kommt der Clou: Jede Kammer fülle ich mit betäubten, aber noch lebenden Fliegen. Frisch und saftig bleiben sie als Futter für meine Nachkommen.“
Warum die Fliegen nur betäuben? Das Geheimnis der Vorratshaltung
„Vielleicht fragt ihr euch, warum ich die Fliegen nicht einfach töte? Ganz einfach – damit sie frisch bleiben! Durch einen gezielten Stich betäube ich meine Beute nur, sodass sie zwar immobil ist, aber nicht sofort verfault. So haben meine Larven später frische Nahrung, wenn sie schlüpfen. Und wenn ihr es makaber findet, dass mein Nachwuchs lebende Vorräte hat – nun, das ist eben Wespenlogik! Es ist ein ausgeklügeltes System, das seit Generationen funktioniert.“
Fortpflanzung und die nächste Generation
„Nach dem Bau und der Befüllung meiner Nistkammern lege ich in jede Kammer ein Ei und verschließe sie sorgfältig. Dann heißt es: Abschied nehmen und weiterziehen. Die Larven schlüpfen kurze Zeit später und haben dank meiner Vorbereitung alles, was sie brauchen, um zu wachsen und zu gedeihen. Sie fressen die bereitgestellten Fliegenvorräte auf, wachsen, verpuppen sich und schlüpfen im nächsten Jahr als neue Generation Breiter Fliegengrabwespen.“
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- ... die Weibchen dieser Grabwespen legen in Weichholz ihre Nisthöhlen an und bestücken diese mit erbeuteten mittelgroßen Fliegen.
Artenschutz in Franken®
Der Grüne Sauerampferkäfer (Gastrophysa viridula)

Grüner Sauerampferkäfer (Gastrophysa viridula)
03/04.11.2024
Mit meinem schimmernd grünen Körper – der je nach Licht auch mal ins Bläuliche oder Rötliche schillert – bin ich der Star jeder Sauerampferpflanze. Aber lasst mich euch ein wenig aus meinem Leben erzählen, es gibt einiges zu staunen und vielleicht auch ein bisschen zu lachen!“
03/04.11.2024
- „Na, schön, dass ihr mir endlich Aufmerksamkeit schenkt! Ich bin Gastrophysa viridula, der Grüne Sauerampferkäfer, und ja, ich weiß, ich sehe fantastisch aus!
Mit meinem schimmernd grünen Körper – der je nach Licht auch mal ins Bläuliche oder Rötliche schillert – bin ich der Star jeder Sauerampferpflanze. Aber lasst mich euch ein wenig aus meinem Leben erzählen, es gibt einiges zu staunen und vielleicht auch ein bisschen zu lachen!“
Mein Outfit: Schillernd und spektakulär
„Seht ihr diesen glänzenden Panzer? Nicht schlecht, oder? Meine metallisch-grüne Farbe macht mich nicht nur unverwechselbar, sondern auch ziemlich stilvoll. Wenn die Sonne auf meinen Körper scheint, glitzere ich wie ein kleines Juwel. Aber Achtung: Mein Look ist nicht nur zur Show da! Tatsächlich verschaffe ich mir damit eine gewisse Aufmerksamkeit, die meine Gegner abschreckt – schließlich denken die meisten, dass ein so auffälliges Wesen bestimmt unangenehm schmeckt. Das nenne ich mal einen natürlichen Trick mit Stil!“
Sauerampfer – meine große Liebe und einzige Schwäche
„Ich bin verrückt nach Sauerampfer, wirklich! Die Pflanze ist für mich mehr als nur Nahrung, sie ist Heimat und Lebenselixier in einem. Sobald der Frühling erwacht und die ersten zarten Sauerampferblätter sprießen, fange ich an zu knabbern. Man könnte sagen, dass ich eine Vorliebe für saure Speisen habe. Und wie sich das für einen wahren Gourmet gehört, finde ich auf den Blättern alles, was mein kleines Käferherz begehrt. Schließlich steckt Sauerampfer voller Nährstoffe – und ich muss für den kommenden Nachwuchs gut bei Kräften bleiben.“
Elternfreuden und der Bauchtrick
„Wusstet ihr, dass ich für meine Mutterfähigkeiten berühmt bin? Wenn ich voll von Eiern bin, wird mein Hinterleib so dick, dass er fast wie ein Ballon aussieht – das ist mein ganz persönlicher Bauchtrick! Wenn ihr also einen weiblichen Grünen Sauerampferkäfer mit einem imposanten Hinterteil seht, dann ist das kein Festmahl, das ich gerade genossen habe – das sind meine zukünftigen Babys! Ich lege meine Eier in kleinen Gruppen auf die Unterseite der Sauerampferblätter ab, wo sie gut geschützt und versteckt sind.“
Mein Nachwuchs: Hungrige kleine Minikopien
„Schon bald nach dem Eierlegen schlüpfen meine kleinen Larven, und glaubt mir, sie sind wahre Fressmaschinen! Im Grunde sind sie winzige Versionen von mir, und sie stürzen sich sofort auf die Sauerampferblätter, als hätten sie seit Wochen nichts gegessen. Manchmal fressen sie so intensiv, dass die Pflanze ordentlich durchlöchert wird. Aber hey, was soll ich sagen? Das ist ihr Lebensstil, und schließlich müssen sie stark und groß werden. Wenn sie sich dann nach ein paar Häutungen verpuppen und aus ihren Puppen schlüpfen, haben wir eine ganze neue Generation von glänzenden kleinen Käferstars!“
Die Bedeutung meines Daseins im Naturkreislauf
„Viele denken, ich sei nur ein kleiner, glänzender Käfer, der ein bisschen Grünzeug frisst. Aber haltet ein! Ich bin ein unverzichtbarer Teil des Ökosystems! Erstens sorge ich dafür, dass sich Sauerampfer nicht unkontrolliert ausbreitet – ein bisschen Ordnung muss sein. Zweitens bin ich ein Leckerbissen für Vögel und andere Insektenfresser, die sich wiederum freuen, wenn ich für sie bereitstehe. Ihr seht, ich spiele meine Rolle im großen Kreislauf und halte das natürliche Gleichgewicht.“
Ein paar letzte Worte vom Sauerampferkäfer
„Also, wenn ihr mich das nächste Mal auf einer Sauerampferpflanze schimmern seht, denkt daran: Ich bin kein gewöhnlicher Käfer! Ich bin Gastrophysa viridula, der funkelnde Gourmet und engagierte Elternteil. Mein Leben mag klein erscheinen, aber es steckt voller Glanz, Geschmack und einem Hauch von Humor. Und sollte euch jemals ein dicker, grüner Käfer mit schillerndem Panzer und beeindruckendem Hinterteil begegnen – dann wisst ihr, das bin ich in meinem Element!“
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
„Seht ihr diesen glänzenden Panzer? Nicht schlecht, oder? Meine metallisch-grüne Farbe macht mich nicht nur unverwechselbar, sondern auch ziemlich stilvoll. Wenn die Sonne auf meinen Körper scheint, glitzere ich wie ein kleines Juwel. Aber Achtung: Mein Look ist nicht nur zur Show da! Tatsächlich verschaffe ich mir damit eine gewisse Aufmerksamkeit, die meine Gegner abschreckt – schließlich denken die meisten, dass ein so auffälliges Wesen bestimmt unangenehm schmeckt. Das nenne ich mal einen natürlichen Trick mit Stil!“
Sauerampfer – meine große Liebe und einzige Schwäche
„Ich bin verrückt nach Sauerampfer, wirklich! Die Pflanze ist für mich mehr als nur Nahrung, sie ist Heimat und Lebenselixier in einem. Sobald der Frühling erwacht und die ersten zarten Sauerampferblätter sprießen, fange ich an zu knabbern. Man könnte sagen, dass ich eine Vorliebe für saure Speisen habe. Und wie sich das für einen wahren Gourmet gehört, finde ich auf den Blättern alles, was mein kleines Käferherz begehrt. Schließlich steckt Sauerampfer voller Nährstoffe – und ich muss für den kommenden Nachwuchs gut bei Kräften bleiben.“
Elternfreuden und der Bauchtrick
„Wusstet ihr, dass ich für meine Mutterfähigkeiten berühmt bin? Wenn ich voll von Eiern bin, wird mein Hinterleib so dick, dass er fast wie ein Ballon aussieht – das ist mein ganz persönlicher Bauchtrick! Wenn ihr also einen weiblichen Grünen Sauerampferkäfer mit einem imposanten Hinterteil seht, dann ist das kein Festmahl, das ich gerade genossen habe – das sind meine zukünftigen Babys! Ich lege meine Eier in kleinen Gruppen auf die Unterseite der Sauerampferblätter ab, wo sie gut geschützt und versteckt sind.“
Mein Nachwuchs: Hungrige kleine Minikopien
„Schon bald nach dem Eierlegen schlüpfen meine kleinen Larven, und glaubt mir, sie sind wahre Fressmaschinen! Im Grunde sind sie winzige Versionen von mir, und sie stürzen sich sofort auf die Sauerampferblätter, als hätten sie seit Wochen nichts gegessen. Manchmal fressen sie so intensiv, dass die Pflanze ordentlich durchlöchert wird. Aber hey, was soll ich sagen? Das ist ihr Lebensstil, und schließlich müssen sie stark und groß werden. Wenn sie sich dann nach ein paar Häutungen verpuppen und aus ihren Puppen schlüpfen, haben wir eine ganze neue Generation von glänzenden kleinen Käferstars!“
Die Bedeutung meines Daseins im Naturkreislauf
„Viele denken, ich sei nur ein kleiner, glänzender Käfer, der ein bisschen Grünzeug frisst. Aber haltet ein! Ich bin ein unverzichtbarer Teil des Ökosystems! Erstens sorge ich dafür, dass sich Sauerampfer nicht unkontrolliert ausbreitet – ein bisschen Ordnung muss sein. Zweitens bin ich ein Leckerbissen für Vögel und andere Insektenfresser, die sich wiederum freuen, wenn ich für sie bereitstehe. Ihr seht, ich spiele meine Rolle im großen Kreislauf und halte das natürliche Gleichgewicht.“
Ein paar letzte Worte vom Sauerampferkäfer
„Also, wenn ihr mich das nächste Mal auf einer Sauerampferpflanze schimmern seht, denkt daran: Ich bin kein gewöhnlicher Käfer! Ich bin Gastrophysa viridula, der funkelnde Gourmet und engagierte Elternteil. Mein Leben mag klein erscheinen, aber es steckt voller Glanz, Geschmack und einem Hauch von Humor. Und sollte euch jemals ein dicker, grüner Käfer mit schillerndem Panzer und beeindruckendem Hinterteil begegnen – dann wisst ihr, das bin ich in meinem Element!“
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- Der Grüne Sauerampferkäfer (Gastrophysa viridula)
Artenschutz in Franken®
Die Pflaumen-Gespinstmotte (Yponomeuta padella)

Pflaumen-Gespinstmotte (Yponomeuta padella)
03/04.11.2024
Vielleicht habt ihr schon einmal meine kunstvollen Gespinste gesehen, die die Äste eines Pflaumen- oder Schlehenbaums wie in einen zarten Schleier hüllen. Mein Lebenszyklus ist kurz und intensiv, aber jeder Schritt darin ist wohl überlegt. Kommt mit auf eine Reise durch mein Leben und erfahrt, wie ich in jeder Phase meine eigene Nische im Naturkreislauf gefunden habe.“
03/04.11.2024
- „Oh, wie die Zeit vergeht – und ich, Yponomeuta padella, die Pflaumen-Gespinstmotte, habe jede Phase meines Lebens mit einer besonderen Strategie gemeistert.
Vielleicht habt ihr schon einmal meine kunstvollen Gespinste gesehen, die die Äste eines Pflaumen- oder Schlehenbaums wie in einen zarten Schleier hüllen. Mein Lebenszyklus ist kurz und intensiv, aber jeder Schritt darin ist wohl überlegt. Kommt mit auf eine Reise durch mein Leben und erfahrt, wie ich in jeder Phase meine eigene Nische im Naturkreislauf gefunden habe.“
Ein Nest im Gespinst – meine Kindheit als Raupe
„Beginnen wir im Frühjahr, wenn die ersten warmen Tage mich und meine Geschwister aus den Eiern locken, die unsere Mutter im letzten Jahr an den jungen Trieben abgelegt hat. Wir schlüpfen als kleine Raupen und arbeiten sofort daran, unser charakteristisches Gespinst zu bauen. Dieses Gespinst ist für uns mehr als nur ein Zuhause: Es schützt uns vor hungrigen Vögeln und vor manchen Witterungsbedingungen. Es ist wie ein riesiges, gemeinschaftliches Wohnprojekt, an dem wir alle fleißig arbeiten. Hier im Schutz unserer seidigen Hülle fressen wir uns satt an den Blättern – und was manche für eine „Kahlfraß-Katastrophe“ halten, ist für uns einfach das tägliche Leben und Überleben.“
Die große Verwandlung: Meine Zeit als Puppe
„Sobald wir uns an den Blättern gestärkt und unsere Körper für den nächsten Schritt vorbereitet haben, ist es Zeit für den Wandel. Wir verpuppen uns in kleinen Kokons innerhalb des Gespinstes, und dort ruhen wir, um uns in eine völlig neue Form zu verwandeln. Dieser Puppenzustand ist wie ein Schlaf, ein Innehalten – wir verändern uns im Inneren und bereiten uns darauf vor, als zarte, geflügelte Motten wieder ans Licht zu treten. Und was für ein Wunder das ist! Wer hätte gedacht, dass aus der kleinen, fressenden Raupe eine so elegante, wenn auch schlichte Motte hervorgehen würde?“
Meine kurze Zeit als ausgewachsene Motte – Ein Tanz in der Sommernacht
„Nach etwa drei bis vier Wochen Puppenruhe schlüpfen wir als erwachsene Motten. Mein Körper ist nun mit weißen Flügeln ausgestattet, die mit kleinen, schwarzen Pünktchen verziert sind – mein Markenzeichen. Mein erwachsenes Leben ist kurz, nur etwa zwei Wochen, und meine Mission ist klar: einen Partner finden und Eier für die nächste Generation ablegen. Man findet mich oft bei Dämmerung und in den frühen Abendstunden, wenn ich in stillen, schwebenden Bewegungen durch die Luft gleite. Nahrung brauche ich als erwachsene Motte kaum, das Interesse liegt ganz auf der Fortpflanzung, damit unsere Art erhalten bleibt.“
Die Rolle der Pflaumen-Gespinstmotte im Ökosystem
„Natürlich werde ich oft mit gemischten Gefühlen betrachtet – das ist wohl das Schicksal eines Wesens, das ganze Bäume in schimmernde Gespinste hüllt und sie scheinbar ‚kahl frisst‘. Aber schaut genau hin: Ich bin Teil eines fein abgestimmten Kreislaufs! Indem ich das Laub dezimiere, fördere ich neues Wachstum im kommenden Jahr. Außerdem bin ich, sowohl als Raupe als auch als Motte, eine wertvolle Nahrungsquelle für Vögel, Insekten und kleine Säugetiere. Mein kurzer Lebenszyklus gibt dem Ökosystem die nötige Balance und Dynamik, die es braucht.“
Ein letzter Gedanke von der Pflaumen-Gespinstmotte
„Ich mag klein und unscheinbar sein, doch in meiner kurzen Zeit auf dieser Welt habe ich einen wichtigen Platz im Naturgefüge. Das Gespinst, das für viele wie ein Spuk aussieht, ist für mich und meine Artgenossen ein sicherer Ort zum Wachsen und Verwandeln. Und wenn die Zeit gekommen ist, verlasse ich mein Werk und fliege in die Welt hinaus, bereit, die nächste Generation einzuleiten. Denkt an mich als die kleine Künstlerin, die kurz, aber wirkungsvoll in eure Gärten und Wiesen tritt – ein stiller Akteur im großen Kreislauf des Lebens.“
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- Pflaumen-Gespinstmotte (Yponomeuta padella)
Artenschutz in Franken®
Weltnaturkonferenz endet mit Blamage

Weltnaturkonferenz endet mit Blamage
02/03.11.2024
Die Weltnaturkonferenz ist heute Morgen in Cali mit einer Blamage zu Ende gegangen.
Nach einem zwölfstündigen Schlussplenum musste die Konferenz trotz ausstehender Agendapunkte abrupt beendet werden. Es waren nicht mehr genug Delegierte im Raum, um beschlussfähig zu sein. Viele Vertreter:innen waren bereits abgereist.
Inhaltlich ist das Ergebnis durchwachsen. Einerseits konnten sich 196 Länder erfolgreich darauf einigen, wie Unternehmensprofite aus der Nutzung genetischer Ressourcen aus der Natur in den globalen Süden fließen sollen. Andererseits scheiterten die Staaten daran, die Zukunft des globalen Biodiversitätsfonds zu beschließen. Das trifft das bereits schwer belastete Vertrauensverhältnis zwischen Industriestaaten und den Ländern im globalen Süden empfindlich.
Die Verabschiedung einer Finanzierungsstrategie blieb aus. Und ohne Einigung bei der Finanzierung und wegen der fehlenden Beschlussfähigkeit in halbleerem Raum, flog schließlich auch der Mechanismus aus dem finalen Beschluss, mit dem die Länder ihre Umsetzungsergebnisse messen sollen. Der WWF bewertet das Ende der Konferenz als Blamage.
02/03.11.2024
- Ende der Konferenz ist ein trauriges Sinnbild für den Stand des globalen Biodiversitätserhalts
Die Weltnaturkonferenz ist heute Morgen in Cali mit einer Blamage zu Ende gegangen.
Nach einem zwölfstündigen Schlussplenum musste die Konferenz trotz ausstehender Agendapunkte abrupt beendet werden. Es waren nicht mehr genug Delegierte im Raum, um beschlussfähig zu sein. Viele Vertreter:innen waren bereits abgereist.
Inhaltlich ist das Ergebnis durchwachsen. Einerseits konnten sich 196 Länder erfolgreich darauf einigen, wie Unternehmensprofite aus der Nutzung genetischer Ressourcen aus der Natur in den globalen Süden fließen sollen. Andererseits scheiterten die Staaten daran, die Zukunft des globalen Biodiversitätsfonds zu beschließen. Das trifft das bereits schwer belastete Vertrauensverhältnis zwischen Industriestaaten und den Ländern im globalen Süden empfindlich.
Die Verabschiedung einer Finanzierungsstrategie blieb aus. Und ohne Einigung bei der Finanzierung und wegen der fehlenden Beschlussfähigkeit in halbleerem Raum, flog schließlich auch der Mechanismus aus dem finalen Beschluss, mit dem die Länder ihre Umsetzungsergebnisse messen sollen. Der WWF bewertet das Ende der Konferenz als Blamage.
Florian Titze, Experte für internationale Politik beim WWF Deutschland, kommentiert:
„Wirtschaftszweige wie die Pharmaindustrie, die Kosmetikindustrie und der Agrar- und Ernährungssektor verdienen seit Jahrzehnten Milliarden mit der Natur. Ein neuer Fonds ist ein wichtiger Schritt zur Angleichung der Wettbewerbsbedingungen und der globalen Gerechtigkeit. Er stellt sicher, dass Unternehmen, die von der Natur profitieren, einen fairen Beitrag zur Erhaltung der biologischen Vielfalt leisten. Außerdem lenkt er wichtige Finanzmittel zu den Menschen und Orten, die sie am meisten benötigen.“
Lichtblicke in Cali sind außerdem ein Durchbruch für den Schutz biodiversitätsreicher Meeresgebiete und die stärkere Beteiligung indigener Bevölkerungen, lokaler Gemeinschaften und ihrem traditionellen Wissen in der Konvention. Neue Ergänzungen des Textes beziehen zudem zentrale Wirtschaftssektoren wie Infrastruktur und Finanzen in die Umsetzung des Weltnaturabkommens mit ein und erkennen die Zusammenhänge zwischen Biodiversität und Gesundheit an. Durch bessere Zusammenarbeit zwischen den internationalen Abkommen zu Klimaschutz und Biodiversitätserhalt soll es zukünftig einfacher werden, Klima- und Biodiversitätskrise gleichzeitig entgegenzuwirken.
Dass sich die Staaten aber nicht weiter über die Mechanismen der Finanzierung einig wurden, könnte die Umsetzung des Weltnaturabkommens zurückwerfen. Florian Titze sieht das mit Sorge: „Das Ziel, die Naturzerstörung bis 2030 aufzuhalten und sogar rückgängig zu machen, verbleibt nach dieser Konferenz noch in weiter Ferne. Die Länder haben es auch nicht geschafft final zu klären, wie sie den Fortschritt der Umsetzung überprüfen wollen. Dafür fehlte am Ende das sogenannte Quorum. Zu viele Delegierte waren bereits abgereist, Beschlüsse somit nicht mehr möglich. Ein trauriges Sinnbild für den Stand des globalen Biodiversitätserhalts.“
Der Preis für das unvollständige Ende könnte höher nicht sein.
Hinter den vielen Textpassagen und Verhandlungs-Klammern steht in der Realität der unschätzbare Wert der Natur und ihrer Leistungen, die sie für uns Menschen erbringt. Intakte Ökosysteme liefern sauberes Wasser, fruchtbare Böden, Rohstoffversorgung, Widerstandfähigkeit gegen Krankheiten und Pandemien und geeignete Lebensbedingungen für uns Menschen. All das steht auf dem Spiel, wenn das Weltnaturabkommen nicht umgesetzt wird.
Quelle
WWF
Stand
02.11.2024
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung. Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
In der Aufnahme von Artenschutz in Franken®
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
„Wirtschaftszweige wie die Pharmaindustrie, die Kosmetikindustrie und der Agrar- und Ernährungssektor verdienen seit Jahrzehnten Milliarden mit der Natur. Ein neuer Fonds ist ein wichtiger Schritt zur Angleichung der Wettbewerbsbedingungen und der globalen Gerechtigkeit. Er stellt sicher, dass Unternehmen, die von der Natur profitieren, einen fairen Beitrag zur Erhaltung der biologischen Vielfalt leisten. Außerdem lenkt er wichtige Finanzmittel zu den Menschen und Orten, die sie am meisten benötigen.“
Lichtblicke in Cali sind außerdem ein Durchbruch für den Schutz biodiversitätsreicher Meeresgebiete und die stärkere Beteiligung indigener Bevölkerungen, lokaler Gemeinschaften und ihrem traditionellen Wissen in der Konvention. Neue Ergänzungen des Textes beziehen zudem zentrale Wirtschaftssektoren wie Infrastruktur und Finanzen in die Umsetzung des Weltnaturabkommens mit ein und erkennen die Zusammenhänge zwischen Biodiversität und Gesundheit an. Durch bessere Zusammenarbeit zwischen den internationalen Abkommen zu Klimaschutz und Biodiversitätserhalt soll es zukünftig einfacher werden, Klima- und Biodiversitätskrise gleichzeitig entgegenzuwirken.
Dass sich die Staaten aber nicht weiter über die Mechanismen der Finanzierung einig wurden, könnte die Umsetzung des Weltnaturabkommens zurückwerfen. Florian Titze sieht das mit Sorge: „Das Ziel, die Naturzerstörung bis 2030 aufzuhalten und sogar rückgängig zu machen, verbleibt nach dieser Konferenz noch in weiter Ferne. Die Länder haben es auch nicht geschafft final zu klären, wie sie den Fortschritt der Umsetzung überprüfen wollen. Dafür fehlte am Ende das sogenannte Quorum. Zu viele Delegierte waren bereits abgereist, Beschlüsse somit nicht mehr möglich. Ein trauriges Sinnbild für den Stand des globalen Biodiversitätserhalts.“
Der Preis für das unvollständige Ende könnte höher nicht sein.
Hinter den vielen Textpassagen und Verhandlungs-Klammern steht in der Realität der unschätzbare Wert der Natur und ihrer Leistungen, die sie für uns Menschen erbringt. Intakte Ökosysteme liefern sauberes Wasser, fruchtbare Böden, Rohstoffversorgung, Widerstandfähigkeit gegen Krankheiten und Pandemien und geeignete Lebensbedingungen für uns Menschen. All das steht auf dem Spiel, wenn das Weltnaturabkommen nicht umgesetzt wird.
Quelle
WWF
Stand
02.11.2024
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung. Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
In der Aufnahme von Artenschutz in Franken®
- Als Sinnbild für den Niedergang auch der heimischen Biodiversität stehen Arten wie auch die Haselmaus
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Artenschutz in Franken®
Plagiognathus chrysanthemi

Plagiognathus chrysanthemi
02/03.11.2024
Manch einer übersieht mich, aber in meiner Welt bin ich ein echter Profi, wenn es darum geht, zarte Pflanzen wie Korbblütler (zum Beispiel Chrysanthemen, daher mein Name) zu erkunden und zu nutzen. Seht euch meine faszinierenden Fähigkeiten an, und ihr werdet feststellen, dass ich mehr bin als nur ein winziger Punkt auf euren Pflanzen!“
02/03.11.2024
- „Hallo zusammen! Ich bin Plagiognathus chrysanthemi, die kleine, grünlich-schwarze Weichwanze, die ihr vielleicht schon mal auf einer Sommerwiese oder in einem Garten entdeckt habt – besonders wenn es dort viele Pflanzen gibt.
Manch einer übersieht mich, aber in meiner Welt bin ich ein echter Profi, wenn es darum geht, zarte Pflanzen wie Korbblütler (zum Beispiel Chrysanthemen, daher mein Name) zu erkunden und zu nutzen. Seht euch meine faszinierenden Fähigkeiten an, und ihr werdet feststellen, dass ich mehr bin als nur ein winziger Punkt auf euren Pflanzen!“
Mein Aussehen: Klein, aber fein getarnt
„Mit meinen knapp 4 Millimetern Größe bin ich leicht zu übersehen – und genau das ist mein Vorteil! Meine grünliche bis fast schwarze Färbung hilft mir, perfekt in das Blattwerk einzutauchen, sodass ich beinahe unsichtbar werde. Ein bisschen wie ein kleiner Ninja im Pflanzenreich, könnte man sagen. Dieser Tarn-Look ist besonders nützlich, da ich nicht nur auf Chrysanthemen unterwegs bin, sondern auch auf anderen Wiesenblumen und Stauden. Meine feinen Antennen und die dezent gemusterten Flügel sind meine Werkzeuge, mit denen ich auf Nahrungssuche gehe.“
Die perfekte Nahrungssuche: Pflanzengewebe ist mein Snack
„Manche halten mich für einen ‚Schädling‘, weil ich von den Pflanzen stehle, aber das ist nun mal mein Lebensstil – und den gestalte ich ganz vorsichtig. Mit meinem feinen Stechrüssel durchbohre ich das Blattgewebe und sauge den Pflanzensaft auf. Dieser Pflanzensaft ist meine Hauptnahrungsquelle, und ich wähle die zartesten Pflanzen für die besten Säfte aus. Aber keine Sorge, ich hinterlasse meist nur winzige Einstichstellen; ich bin eine wahre Künstlerin des sanften Saugens! In kleinen Mengen fällt das gar nicht auf, aber wenn wir Weichwanzen in Massen auftreten, können wir schon eine Herausforderung für Pflanzenzüchter sein.“
Meine Rolle im Ökosystem: Kleiner Sauger, große Bedeutung
„Ich bin zwar ein echter Feinschmecker unter den Wanzen, aber das allein macht mich noch nicht aus. Durch meine ständige Wanderung von Pflanze zu Pflanze trage ich auch zur Regulierung der Pflanzenpopulation bei. Auch als Nahrung bin ich wichtig – Vögel und größere Insekten haben mich auf ihrem Speiseplan. Und für manche kleine Wespenarten bin ich sogar der perfekte Wirtskörper für ihre Larven. Sie legen ihre Eier auf oder in mir ab, und ihre Larven nutzen meinen Körper als ersten Lebensraum. Eine beachtliche Symbiose, oder? Es ist ein großes, faszinierendes Spiel im Kreislauf des Lebens, in dem ich eine wichtige Rolle spiele.“
Fortpflanzung und Nachwuchs: Die Zukunft der Wiese sichern
„Sobald der Frühling erwacht, legen wir Weichwanzenweibchen unsere Eier an den Stängeln und Blättern unserer Wirtspflanzen ab. Aus diesen Eiern schlüpfen winzige Nymphen, die bereits wie Miniausgaben von uns aussehen – nur ohne Flügel. Sie durchlaufen mehrere Häutungen, bis sie ihre Flügel entwickeln und zu richtigen, ausgewachsenen Weichwanzen herangereift sind. Jede Nymphe ist voller Tatendrang und bereit, den Lebenszyklus fortzuführen. Ein kleiner Beitrag von uns, um die Wiesen voller Leben zu halten.“
Ein letztes Wort von mir, der Weichwanze
„Ihr seht, Plagiognathus chrysanthemi ist nicht einfach nur ein ‚Schädling‘. Wir Weichwanzen sind winzige Meister der Tarnung und tragen zur Harmonie der Wiesen- und Gartenwelt bei. Ein bisschen List gehört dazu, ein bisschen Geschick, aber am Ende sind wir ein wichtiger Teil des Ganzen. Das nächste Mal, wenn ihr uns auf einer Blume seht, denkt daran, dass auch wir eine wertvolle Rolle im grünen Gefüge spielen – leise, klein und unscheinbar.“
Aufnahme von Bernhard Schmalisch
Artenschutz in Franken®
Schnurfüßer ...

Ah, die Schnurfüßer, sagt ihr?
01/02.11.2024
Wir Schnurfüßer, auch Diplopoda genannt, sind eine faszinierende, wenn auch sehr zurückgezogene Truppe. Ich werde euch alles erzählen, was ihr wissen müsst – und ich verspreche, ich werde mein Bestes geben, dass ihr am Ende ein wenig lächelt. Los geht’s!
01/02.11.2024
- Nun, dann lasst euch von einem wahren Experten berichten – mir selbst!
Wir Schnurfüßer, auch Diplopoda genannt, sind eine faszinierende, wenn auch sehr zurückgezogene Truppe. Ich werde euch alles erzählen, was ihr wissen müsst – und ich verspreche, ich werde mein Bestes geben, dass ihr am Ende ein wenig lächelt. Los geht’s!
Erstmal die Basics: Wir Schnurfüßer stellen uns vor Also, mein voller Name? Diplopoda – das klingt doch gleich ziemlich klug, oder? Ihr nennt mich manchmal Tausendfüßler, aber ich bin tatsächlich ein Schnurfüßer. "Tausend Füße" – das ist übertrieben, Leute! Je nach Art kann ich 30 bis über 400 Beine haben, aber tausend? Nee, das ist eher ein Schnurfüßer-Märchen. Aber wir lassen euch Menschen ruhig in dem Glauben – es klingt ja recht eindrucksvoll!
Lebensraum: Bitte schattig und feucht Wo wir wohnen? Unter eurem Laub, in der feuchten Erde und überall dort, wo uns niemand stört. Wir sind die kleinen Pioniere des Bodens, wahre Recycling-Experten, wenn es um verrottendes Material geht. Feuchtigkeit ist uns besonders wichtig. Ein Sonnenbad? Oh, nein danke! Wir mögen's schattig und kühl, sonst trocknen wir aus wie eine alte Weintraube. Deshalb seht ihr uns tagsüber kaum, aber nachts – da erwachen wir zum Leben und machen uns über die Blätter her!
Essen – nur das Beste vom Boden Unser Menü? Alles, was schön zersetzt ist. Blätter, kleine Holzstücke, abgestorbenes Pflanzenmaterial – köstlich! Wir verdauen das Zeug und machen daraus Humus. Ihr habt vielleicht gedacht, ihr Menschen seid die einzigen, die Recycling erfunden haben? Ha! Wir machen das seit Jahrmillionen! Und ohne uns wäre der Boden ziemlich leer. Ich sage immer: „Wir Schnurfüßer sind die Boden-Gärtner der Natur.“ Ein kleiner, stiller Held, aber keine Sorge, Applaus brauchen wir nicht.
Anatomie: Mein bezaubernder Körper Ja, ja, ich weiß, ich bin ein echter Blickfang! Mit meinem langen, zylinderförmigen Körper und all den kleinen Beinchen, die sich in perfektem Rhythmus bewegen – das hat schon was! Tatsächlich haben wir so viele Beine, dass wir wie eine kleine Raupe im Rhythmus kriechen. Jedes Segment meines Körpers trägt zwei Paar Beine, und das macht uns Schnurfüßer zu den einzigen echten Diplopoden – jeder Schritt ein Wunderwerk der Koordination!
Mein großes Talent: Ruhig Blut bewahren Ihr fragt euch, was ich mache, wenn Gefahr droht? Na, einfach einrollen! Das ist sozusagen mein Schutzschild. Zusammengekauert sehe ich aus wie eine kleine Spirale oder ein winziger Armadillo, und glaubt mir, das hilft oft gegen neugierige Räuber. Ein Igel des Bodens, könnte man sagen. Andere Schnurfüßer-Arten haben sogar eine geheime Waffe: Sie können ein übelriechendes Sekret abgeben, das Feinde fernhält. Tss! Ein Tropfen reicht, und jeder Angreifer zieht Leine. Ein Schnurfüßer-Geheimnis, das uns den Boden als sicheren Ort erhält.
Unsere Fortpflanzung: Diskretion bitte! Wir Schnurfüßer legen Eier, und das meist tief in der Erde. Die Kleinen schlüpfen winzig und ohne all die schönen Beine, die ich habe. Sie müssen sich erst "hocharbeiten", um meine elegante Gestalt und Beweglichkeit zu erreichen. Wir kümmern uns diskret um unsere Familienplanung, kein großes Tamtam.
Freunde und Feinde: Na ja, man kann nicht jeden mögen Von Freundschaften unter uns Schnurfüßern könnt ihr euch nicht viel erwarten – wir sind Einzelgänger. Unsere größten Feinde? Frösche, Vögel und sogar manche Käfer, die ein bisschen zu neugierig werden, was wir da so treiben. Aber hey, wenn sie unseren Wert erkennen würden, hätten sie vielleicht Respekt vor uns, den Recycling-Champions des Bodens. Ohne uns gäbe es überall nur vergammelndes Material. Wer will das schon?
Mein Beitrag zur Welt
Ohne uns wäre das Leben auf diesem Planeten anders. Wir bauen die Nährstoffe auf, die eure Pflanzen brauchen. So gesehen könnte man uns Schnurfüßer als heimliche Bodenschätze bezeichnen. Wir sind bescheiden, wollen keine Preise gewinnen, aber ein bisschen Anerkennung? Na gut, ein kleines Lob schadet nie.
Also, falls ihr uns jemals unter einem Stein entdeckt, denkt an alles, was ihr jetzt wisst, und gönnt uns den Rückzug in die Dunkelheit. Wir haben unsere Arbeit zu erledigen – still, gründlich und unermüdlich.
Bis zum nächsten Blätterhaufen!
Und bitte kein Licht, wir sehen uns lieber im Dunkeln.
In der Aufnahme / Autor von © Bernhard Schmalisch
Lebensraum: Bitte schattig und feucht Wo wir wohnen? Unter eurem Laub, in der feuchten Erde und überall dort, wo uns niemand stört. Wir sind die kleinen Pioniere des Bodens, wahre Recycling-Experten, wenn es um verrottendes Material geht. Feuchtigkeit ist uns besonders wichtig. Ein Sonnenbad? Oh, nein danke! Wir mögen's schattig und kühl, sonst trocknen wir aus wie eine alte Weintraube. Deshalb seht ihr uns tagsüber kaum, aber nachts – da erwachen wir zum Leben und machen uns über die Blätter her!
Essen – nur das Beste vom Boden Unser Menü? Alles, was schön zersetzt ist. Blätter, kleine Holzstücke, abgestorbenes Pflanzenmaterial – köstlich! Wir verdauen das Zeug und machen daraus Humus. Ihr habt vielleicht gedacht, ihr Menschen seid die einzigen, die Recycling erfunden haben? Ha! Wir machen das seit Jahrmillionen! Und ohne uns wäre der Boden ziemlich leer. Ich sage immer: „Wir Schnurfüßer sind die Boden-Gärtner der Natur.“ Ein kleiner, stiller Held, aber keine Sorge, Applaus brauchen wir nicht.
Anatomie: Mein bezaubernder Körper Ja, ja, ich weiß, ich bin ein echter Blickfang! Mit meinem langen, zylinderförmigen Körper und all den kleinen Beinchen, die sich in perfektem Rhythmus bewegen – das hat schon was! Tatsächlich haben wir so viele Beine, dass wir wie eine kleine Raupe im Rhythmus kriechen. Jedes Segment meines Körpers trägt zwei Paar Beine, und das macht uns Schnurfüßer zu den einzigen echten Diplopoden – jeder Schritt ein Wunderwerk der Koordination!
Mein großes Talent: Ruhig Blut bewahren Ihr fragt euch, was ich mache, wenn Gefahr droht? Na, einfach einrollen! Das ist sozusagen mein Schutzschild. Zusammengekauert sehe ich aus wie eine kleine Spirale oder ein winziger Armadillo, und glaubt mir, das hilft oft gegen neugierige Räuber. Ein Igel des Bodens, könnte man sagen. Andere Schnurfüßer-Arten haben sogar eine geheime Waffe: Sie können ein übelriechendes Sekret abgeben, das Feinde fernhält. Tss! Ein Tropfen reicht, und jeder Angreifer zieht Leine. Ein Schnurfüßer-Geheimnis, das uns den Boden als sicheren Ort erhält.
Unsere Fortpflanzung: Diskretion bitte! Wir Schnurfüßer legen Eier, und das meist tief in der Erde. Die Kleinen schlüpfen winzig und ohne all die schönen Beine, die ich habe. Sie müssen sich erst "hocharbeiten", um meine elegante Gestalt und Beweglichkeit zu erreichen. Wir kümmern uns diskret um unsere Familienplanung, kein großes Tamtam.
Freunde und Feinde: Na ja, man kann nicht jeden mögen Von Freundschaften unter uns Schnurfüßern könnt ihr euch nicht viel erwarten – wir sind Einzelgänger. Unsere größten Feinde? Frösche, Vögel und sogar manche Käfer, die ein bisschen zu neugierig werden, was wir da so treiben. Aber hey, wenn sie unseren Wert erkennen würden, hätten sie vielleicht Respekt vor uns, den Recycling-Champions des Bodens. Ohne uns gäbe es überall nur vergammelndes Material. Wer will das schon?
Mein Beitrag zur Welt
Ohne uns wäre das Leben auf diesem Planeten anders. Wir bauen die Nährstoffe auf, die eure Pflanzen brauchen. So gesehen könnte man uns Schnurfüßer als heimliche Bodenschätze bezeichnen. Wir sind bescheiden, wollen keine Preise gewinnen, aber ein bisschen Anerkennung? Na gut, ein kleines Lob schadet nie.
Also, falls ihr uns jemals unter einem Stein entdeckt, denkt an alles, was ihr jetzt wisst, und gönnt uns den Rückzug in die Dunkelheit. Wir haben unsere Arbeit zu erledigen – still, gründlich und unermüdlich.
Bis zum nächsten Blätterhaufen!
Und bitte kein Licht, wir sehen uns lieber im Dunkeln.
In der Aufnahme / Autor von © Bernhard Schmalisch
- Hier ist ein Lebewesen, das auch gerne unter Totholz und Steinen aktiv ist ... Stigmatogaster subterranea ...Im Garten sollte halt auch Totholz vorhanden sein, ist oft sogar ziemlich dekorativ ... an jedem Körpersegment dieses Tieres befindet sich ein Beinpaar. Wer mit offenen Augen im Garten zu Gange ist der wird eine Vielzahl interessanter Individuen finden ... der Schnurfüsser gehört da sicher auch dazu ... Meines Wissens nach der längste "Tausendfüßler" bei uns
Artenschutz in Franken®
Die Rinderfliege oder Mittagsfliege (Mesembrina meridiana)

Rinderfliege oder Mittagsfliege (Mesembrina meridiana)
01/02.11.2024
Ich bin eine Fliege, die das Leben genießt. Ihr findet mich oft in der Sonne faulenzen, speziell an warmen Herbsttagen. Aber lasst euch nicht täuschen: Hinter meiner entspannten Haltung steckt ein kluger Überlebenskünstler, der genau weiß, wie man im Bauernhof und Weideland lebt und gedeiht.“
01/02.11.2024
- „Ah, wie herrlich – willkommen im Alltag einer Rinderfliege! Oder wie man mich auch nennt: die Mittagsfliege, Mesembrina meridiana.
Ich bin eine Fliege, die das Leben genießt. Ihr findet mich oft in der Sonne faulenzen, speziell an warmen Herbsttagen. Aber lasst euch nicht täuschen: Hinter meiner entspannten Haltung steckt ein kluger Überlebenskünstler, der genau weiß, wie man im Bauernhof und Weideland lebt und gedeiht.“
Schwarz und schimmernd – mein edler Look
„Ja, ich gebe es zu: Mein Aussehen ist bemerkenswert. Mit meinem glänzenden, schwarzen Körper und meinen orangefarbenen Flecken an den Flügelbasen, falle ich einfach auf – und ich finde, das steht mir! Diese Farbenpracht ist typisch für unsere Art, aber nicht zu verwechseln mit irgendeiner gemeinen Stubenfliege. Nein, ich bin größer und habe ein etwas „bissigeres“ Auftreten. Nicht zu übersehen ist mein samtig-schwarzer Panzer, der in der Sonne fast wie poliertes Ebenholz glänzt. Diese Farbe ist nicht nur für die Show, sondern auch funktional – sie hilft mir, die Wärme der Sonne aufzunehmen, besonders an kühlen Herbsttagen.“
Mein bevorzugter Lebensraum: Wo die Rinder grasen
„Wo ich lebe? Wo es frisches, duftendes Kuhdung gibt! Ich fühle mich dort pudelwohl, und es gibt kaum einen besseren Ort für uns Mittagsfliegen, um Eier abzulegen. Die Weiden und Bauernhöfe, wo die Rinder grasen, bieten alles, was ich brauche: Nahrung, Wärme und einen herrlichen Platz für meine Nachkommen. Wenn die Sonne am höchsten steht – also zur Mittagszeit, daher auch mein zweiter Name – bin ich besonders aktiv und genieße das Leben in vollen Zügen.“
Fortpflanzung und Entwicklung – ein perfekt durchdachter Kreislauf
„Für die nächste Generation sorge ich strategisch: Ich lege meine Eier auf frischem Dung ab, der nicht nur als Schutz, sondern auch als direkte Nahrungsquelle für die Larven dient. Die frisch geschlüpften Larven fressen sich dann durch den Dung, wo sie eine Fülle an organischen Stoffen finden – das ist wie ein Festmahl für sie. Die Larven wachsen dort sicher heran, um sich schließlich im Boden zu verpuppen und im kommenden Frühjahr als ausgewachsene Rinderfliegen zurückzukehren.“
Meine Rolle im Ökosystem: Saubermacher der Weiden
„Vielleicht denkt ihr, Dung sei eklig, aber ich sage euch: Für mich und meine Artgenossen ist er lebenswichtig! Wir tragen durch unsere Vorliebe für diesen Rohstoff erheblich zum ökologischen Gleichgewicht auf der Weide bei. Indem wir die Dungfladen durchwühlen und verarbeiten, helfen wir bei der Zersetzung und Rückführung wertvoller Nährstoffe in den Boden. So halten wir den Boden gesund und die Weiden fruchtbar. Ein kleiner, aber wichtiger Dienst, den wir Fliegen für das Wohl des gesamten Graslands leisten. Ohne uns wäre die Natur ein wenig aus dem Gleichgewicht!“
Ein paar letzte Worte von der Rinderfliege
„Ja, ich mag die Sonne, den Dung und die Wärme, aber am liebsten mag ich das einfache Leben auf der Weide, mit einer klaren Aufgabe im natürlichen Kreislauf. Man mag uns Fliegen oft nicht – aber wisst ihr was? Wir spielen eine wertvolle Rolle. Und wenn ihr mich das nächste Mal auf einer Weide seht, könnt ihr an all die versteckten Dienste denken, die ich leiste. Denn ich, die Mittagsfliege, bin mehr als nur ein schwarzer Punkt in der Sonne.“
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- Mesembrina meridiana fliegt inzwischen bis in den Oktober auf den Pferdekoppeln und auf Viehweiden. Weibchen legen die Eier primär in Dungfladen, wohl auch in den Kot anderer Säuger. Nachwuchs, also die Larven entwickeln sich sehr schnell, nach einer Woche können sie schon schlüpfen.Sie sind wichtig im Naturkreislauf bei der Zersetzung.Die Fliegen selber ernähren sich von Pollen und Nektar.
Artenschutz in Franken®
Der Scharlachrote Feuerkäfer (Pyrochroa coccinea)

Scharlachroter Feuerkäfer (Pyrochroa coccinea)
31.10/01.11.2024
Man nennt uns auch ‚Feuerkäfer‘, und wir schimmern so lebendig rot, dass man uns kaum übersehen kann. Doch hinter meiner auffälligen Fassade steckt weit mehr als nur schönes Aussehen – ich habe mein Lebensumfeld perfekt angepasst und trage zum Gleichgewicht des Waldes bei. Also hört gut zu, während ich ein wenig mehr über mein glamouröses Leben erzähle.“
31.10/01.11.2024
- „Also gut, hier bin ich: Der scharlachrote Feuerkäfer, Pyrochroa coccinea, in meinem strahlend roten Panzer und tiefschwarzen Fühlern – unverkennbar und ein bisschen majestätisch, oder?
Man nennt uns auch ‚Feuerkäfer‘, und wir schimmern so lebendig rot, dass man uns kaum übersehen kann. Doch hinter meiner auffälligen Fassade steckt weit mehr als nur schönes Aussehen – ich habe mein Lebensumfeld perfekt angepasst und trage zum Gleichgewicht des Waldes bei. Also hört gut zu, während ich ein wenig mehr über mein glamouröses Leben erzähle.“
Der scharlachrote Panzer: Funktion und Stil zugleich
„Ja, ich weiß – ich bin ein echter Hingucker! Mein roter Panzer mag auf den ersten Blick modisch erscheinen, aber er ist mehr als nur eine optische Spielerei. Diese Farbe dient zur Warnung. In der Natur bedeutet ‚rot‘ oft ‚Achtung, giftig‘, auch wenn ich selbst eigentlich keine Gifte produziere. Mit diesem ‚Schwindel‘ trickse ich meine Fressfeinde gekonnt aus – wer sich an mir vergreifen will, wird es sich dreimal überlegen. Ein bisschen List gehört schließlich zum Überlebenskampf dazu, oder?“
Der Lebensstil eines Meisterjägers: Auf Jagd nach Larven
„Als Erwachsener esse ich am liebsten gar nicht, ich lebe hauptsächlich für den großen Plan: die Fortpflanzung. Aber als Larve war ich eine ganz andere Nummer! Damals war ich ein eifriger Raubkäfer, stets auf der Suche nach anderen Insektenlarven im morschen Holz. Ja, wir Feuerkäfer-Larven können durchaus bedrohlich wirken, zumindest aus der Sicht anderer kleiner Krabbeltiere. Manche sagen, ich sehe aus wie ein Miniatur-Drache – stark gepanzert und ausgestattet mit beeindruckenden Mundwerkzeugen, die meine Beute durchbohren können. Ein bisschen furchteinflößend? Absolut! Aber hey, so habe ich meinen Platz im Wald erobert.“
Vom Holz bewohnt: Die bevorzugte Heimat
„Ich habe mein Herz an den Wald verloren, speziell an tote und verrottende Bäume. Dort finden sich die besten Plätze, um meine Eier abzulegen. Sobald diese schlüpfen, schieben sich die kleinen Drachen – also meine Nachwuchs-Larven – tief ins Holz, wo sie Nahrung und Schutz finden. Diese zersetzten Holzbereiche sind also für uns wie ein schickes Appartement: gemütlich, voll mit kleinen Snacks und relativ ruhig. Am Ende meiner Larvenzeit verpuppe ich mich im morschen Holz und erwache dann als prachtvoller, roter Erwachsener, bereit für die nächste Generation.“
Meine Rolle im großen Kreislauf des Waldes
„So unscheinbar der Job eines Käfers im morschen Holz klingen mag, er ist ein wichtiger Dienst am Ökosystem! Indem ich andere Insektenlarven jage und zersetze, helfe ich, das natürliche Gleichgewicht zu erhalten und trage zur Verrottung von Holz bei. Ohne uns Käfer und andere Insektenlarven könnten sich einige Schädlinge zu schnell verbreiten und der Wald wäre … nun ja, etwas weniger gesund. Also könnt ihr mich als eine Art Holzpolizist betrachten – mit einer Vorliebe für rotes Outfit, versteht sich.“
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
„Ja, ich weiß – ich bin ein echter Hingucker! Mein roter Panzer mag auf den ersten Blick modisch erscheinen, aber er ist mehr als nur eine optische Spielerei. Diese Farbe dient zur Warnung. In der Natur bedeutet ‚rot‘ oft ‚Achtung, giftig‘, auch wenn ich selbst eigentlich keine Gifte produziere. Mit diesem ‚Schwindel‘ trickse ich meine Fressfeinde gekonnt aus – wer sich an mir vergreifen will, wird es sich dreimal überlegen. Ein bisschen List gehört schließlich zum Überlebenskampf dazu, oder?“
Der Lebensstil eines Meisterjägers: Auf Jagd nach Larven
„Als Erwachsener esse ich am liebsten gar nicht, ich lebe hauptsächlich für den großen Plan: die Fortpflanzung. Aber als Larve war ich eine ganz andere Nummer! Damals war ich ein eifriger Raubkäfer, stets auf der Suche nach anderen Insektenlarven im morschen Holz. Ja, wir Feuerkäfer-Larven können durchaus bedrohlich wirken, zumindest aus der Sicht anderer kleiner Krabbeltiere. Manche sagen, ich sehe aus wie ein Miniatur-Drache – stark gepanzert und ausgestattet mit beeindruckenden Mundwerkzeugen, die meine Beute durchbohren können. Ein bisschen furchteinflößend? Absolut! Aber hey, so habe ich meinen Platz im Wald erobert.“
Vom Holz bewohnt: Die bevorzugte Heimat
„Ich habe mein Herz an den Wald verloren, speziell an tote und verrottende Bäume. Dort finden sich die besten Plätze, um meine Eier abzulegen. Sobald diese schlüpfen, schieben sich die kleinen Drachen – also meine Nachwuchs-Larven – tief ins Holz, wo sie Nahrung und Schutz finden. Diese zersetzten Holzbereiche sind also für uns wie ein schickes Appartement: gemütlich, voll mit kleinen Snacks und relativ ruhig. Am Ende meiner Larvenzeit verpuppe ich mich im morschen Holz und erwache dann als prachtvoller, roter Erwachsener, bereit für die nächste Generation.“
Meine Rolle im großen Kreislauf des Waldes
„So unscheinbar der Job eines Käfers im morschen Holz klingen mag, er ist ein wichtiger Dienst am Ökosystem! Indem ich andere Insektenlarven jage und zersetze, helfe ich, das natürliche Gleichgewicht zu erhalten und trage zur Verrottung von Holz bei. Ohne uns Käfer und andere Insektenlarven könnten sich einige Schädlinge zu schnell verbreiten und der Wald wäre … nun ja, etwas weniger gesund. Also könnt ihr mich als eine Art Holzpolizist betrachten – mit einer Vorliebe für rotes Outfit, versteht sich.“
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- Ab etwa Mitte Mai ist er auch im Steigerwald recht häufig bei seiner Jagd nach anderen Insekten entdecken, den etwa 18 mm großen, scharlachroten Feuerkäfer.Schwerpunktmäßig sahen wir den schlanken Käfer hierbei an Pflanzen die sich an Wegrändern unweit laubholzreicher Waldsektoren befanden. Hier ein Weibchen, die Männchen haben gefiederte Fühler, damit sie auch jedes Geruchsmolekül der Weibchen auffangen können.
Artenschutz in Franken®
Totes Holz? ... welch "irreführende" Aussage!

Stell dir vor, ich bin ein Stück Totholz – alt, ruhig und vielleicht ein wenig verfallen.
30/31.10.2024
Also lehne dich zurück, und lass mich dir erzählen, warum ich als Totholz für das Leben um mich herum so bedeutsam bin und warum ein Wirtschaftsforst nie meine volle Bedeutung ersetzen kann.
30/31.10.2024
- Doch lass dich von meinem äußeren Schein nicht täuschen! Ich habe eine wichtige Rolle in unserem Ökosystem, vor allem für die Förderung der Biodiversität.
Also lehne dich zurück, und lass mich dir erzählen, warum ich als Totholz für das Leben um mich herum so bedeutsam bin und warum ein Wirtschaftsforst nie meine volle Bedeutung ersetzen kann.
Mein Leben nach dem Tod: Ein Zuhause für viele
Wenn ein Baum stirbt, endet das Leben nicht. Im Gegenteil: Es beginnt eine neue, artenreiche Epoche. Ich werde zur Heimat für Pilze, Moose, Flechten, Insekten, Vögel und sogar kleine Säugetiere. Über 1.300 Käferarten allein in Deutschland sind direkt auf mich angewiesen, weil sie in meinen Ritzen und Spalten nisten oder von meinen faserigen Überresten leben. Auch seltene Pilze wie der Zunderschwamm und der Eichen-Wirrschichtling benötigen meine besondere Struktur und den langsamen Zerfall als Nährboden.
Für Spechte bin ich ein beliebter Nistplatz, und andere Vögel und Säugetiere nutzen die Spechthöhlen später als Unterschlupf. So biete ich Jahr für Jahr Lebensraum für Hunderte von Arten, die ohne mich verschwinden würden. Die Biodiversität, die ich fördere, ist ein wertvolles Netzwerk des Lebens.
Ein wichtiger Baustein für den Boden und das Klima
Ich trage auch zur Regeneration und zum Erhalt des Bodens bei. Meine zerfallenden Fasern reichern den Boden mit Nährstoffen an und bieten Mikroorganismen und kleinen Wirbellosen wie Asseln und Regenwürmern Nahrung. Diese zersetzen mich langsam, sodass meine Nährstoffe Stück für Stück zurück in den Boden gelangen. Ein nährstoffreicher Boden, der Leben fördert, kann wiederum junge Pflanzen, Bäume und Gräser wachsen lassen – ein endloser Kreislauf.
Dabei speichere ich Kohlenstoff, und das selbst dann, wenn ich bereits im Verfall bin. Das ist wichtig, um den CO₂-Gehalt in der Atmosphäre zu senken. Ein naturbelassener Wald mit viel Totholz hat also eine weitaus größere Fähigkeit, das Klima zu stabilisieren, als ein Forst, in dem mein Verbleib selten geduldet wird.
Warum der Wirtschaftsforst meine Bedeutung nicht erreicht
In einem Wirtschaftsforst steht die Holzproduktion im Vordergrund, und viele abgestorbene Bäume werden dort gezielt entfernt, um den Wald „sauber“ zu halten und den Baumbestand zu schützen. Auch werden viele Bäume bereits im jungen Alter geerntet, bevor sie überhaupt altern und sterben können. Ohne mich und andere tote Bäume fehlt es dort jedoch an Nist- und Rückzugsmöglichkeiten für spezialisierte Arten.
Wirtschaftsforste können auch nicht die Vielfalt an Baumarten und Altersstufen bieten, die ein naturbelassener Wald hat. Diese Vielfalt ist wichtig, weil sich viele Lebewesen an bestimmte Baumarten oder bestimmte Stadien der Holzverrottung angepasst haben. So bleibt der Wirtschaftsforst oft ärmer an Arten und kann meine ökologischen Leistungen nur in geringem Maße erfüllen.
Wieviel Totholz sollte ein gesunder Wald haben?
Um meine Rolle als Totholz für die Biodiversität bestmöglich zu erfüllen, sind wird vielfach mit 20 bis 30 Kubikmeter Totholz pro Hektar argumentiert. Naturbelassene Wälder erreichen diese Menge meist problemlos, während in vielen Wirtschaftswäldern nur ein bis zwei Kubikmeter vorhanden sind. In Naturwäldern finden sich häufig über 100 Kubikmeter und in Urwäldern können sogar über mehrere hundert Kubikmeter pro Hektar erreicht werden, ein wahrer Schatz für die Biodiversität.
Fazit: Warum ich für die Artenvielfalt unverzichtbar bin
Ohne Totholz wäre der Wald kein vollwertiges Ökosystem. Ich bin der Lebensraum, die Nahrung und der Bodenbildner für viele Arten, die sonst keinen Platz in einem Wirtschaftsforst finden würden. Ein naturbelassener Wald mit reichlich Totholz fördert die Biodiversität, stabilisiert das Klima und bietet vielfältige Nischen für unzählige Lebewesen. Nur so kann ein Wald in seiner ganzen ökologischen Kraft erstrahlen – und dafür bin ich als Totholz unverzichtbar.
Blick in den Oberen Steigerwald
Wenn ein Baum stirbt, endet das Leben nicht. Im Gegenteil: Es beginnt eine neue, artenreiche Epoche. Ich werde zur Heimat für Pilze, Moose, Flechten, Insekten, Vögel und sogar kleine Säugetiere. Über 1.300 Käferarten allein in Deutschland sind direkt auf mich angewiesen, weil sie in meinen Ritzen und Spalten nisten oder von meinen faserigen Überresten leben. Auch seltene Pilze wie der Zunderschwamm und der Eichen-Wirrschichtling benötigen meine besondere Struktur und den langsamen Zerfall als Nährboden.
Für Spechte bin ich ein beliebter Nistplatz, und andere Vögel und Säugetiere nutzen die Spechthöhlen später als Unterschlupf. So biete ich Jahr für Jahr Lebensraum für Hunderte von Arten, die ohne mich verschwinden würden. Die Biodiversität, die ich fördere, ist ein wertvolles Netzwerk des Lebens.
Ein wichtiger Baustein für den Boden und das Klima
Ich trage auch zur Regeneration und zum Erhalt des Bodens bei. Meine zerfallenden Fasern reichern den Boden mit Nährstoffen an und bieten Mikroorganismen und kleinen Wirbellosen wie Asseln und Regenwürmern Nahrung. Diese zersetzen mich langsam, sodass meine Nährstoffe Stück für Stück zurück in den Boden gelangen. Ein nährstoffreicher Boden, der Leben fördert, kann wiederum junge Pflanzen, Bäume und Gräser wachsen lassen – ein endloser Kreislauf.
Dabei speichere ich Kohlenstoff, und das selbst dann, wenn ich bereits im Verfall bin. Das ist wichtig, um den CO₂-Gehalt in der Atmosphäre zu senken. Ein naturbelassener Wald mit viel Totholz hat also eine weitaus größere Fähigkeit, das Klima zu stabilisieren, als ein Forst, in dem mein Verbleib selten geduldet wird.
Warum der Wirtschaftsforst meine Bedeutung nicht erreicht
In einem Wirtschaftsforst steht die Holzproduktion im Vordergrund, und viele abgestorbene Bäume werden dort gezielt entfernt, um den Wald „sauber“ zu halten und den Baumbestand zu schützen. Auch werden viele Bäume bereits im jungen Alter geerntet, bevor sie überhaupt altern und sterben können. Ohne mich und andere tote Bäume fehlt es dort jedoch an Nist- und Rückzugsmöglichkeiten für spezialisierte Arten.
Wirtschaftsforste können auch nicht die Vielfalt an Baumarten und Altersstufen bieten, die ein naturbelassener Wald hat. Diese Vielfalt ist wichtig, weil sich viele Lebewesen an bestimmte Baumarten oder bestimmte Stadien der Holzverrottung angepasst haben. So bleibt der Wirtschaftsforst oft ärmer an Arten und kann meine ökologischen Leistungen nur in geringem Maße erfüllen.
Wieviel Totholz sollte ein gesunder Wald haben?
Um meine Rolle als Totholz für die Biodiversität bestmöglich zu erfüllen, sind wird vielfach mit 20 bis 30 Kubikmeter Totholz pro Hektar argumentiert. Naturbelassene Wälder erreichen diese Menge meist problemlos, während in vielen Wirtschaftswäldern nur ein bis zwei Kubikmeter vorhanden sind. In Naturwäldern finden sich häufig über 100 Kubikmeter und in Urwäldern können sogar über mehrere hundert Kubikmeter pro Hektar erreicht werden, ein wahrer Schatz für die Biodiversität.
Fazit: Warum ich für die Artenvielfalt unverzichtbar bin
Ohne Totholz wäre der Wald kein vollwertiges Ökosystem. Ich bin der Lebensraum, die Nahrung und der Bodenbildner für viele Arten, die sonst keinen Platz in einem Wirtschaftsforst finden würden. Ein naturbelassener Wald mit reichlich Totholz fördert die Biodiversität, stabilisiert das Klima und bietet vielfältige Nischen für unzählige Lebewesen. Nur so kann ein Wald in seiner ganzen ökologischen Kraft erstrahlen – und dafür bin ich als Totholz unverzichtbar.
Blick in den Oberen Steigerwald
- Mehr Totholz als in manch anderem Wirtschaftsforst, doch an einen Wald der nach unserer Auffassung auch den Namen Wald verdient reicht dieser noch lange nicht heran. Auch wenn "hie und da einige Tothölzer stehen und liegen bleiben dürfen".
Artenschutz in Franken®
Prosena siberita

Aus der Sicht der Prosena siberita, der grauen Raupenfliege:
30/31.10.2024
Ja, ich mag keine prächtigen Farben haben wie manche Schmetterlinge, aber wer braucht schon solch auffälliges Gepose? Mein wahres Talent liegt nicht im Aussehen, sondern in meinem faszinierenden Lebensstil – und ich bin eine Meisterin im Überleben!“
30/31.10.2024
- „Grüß euch! Ich bin Prosena siberita, die charmante graue Raupenfliege – obwohl einige mich wohl eher ‚unauffällig‘ nennen würden.
Ja, ich mag keine prächtigen Farben haben wie manche Schmetterlinge, aber wer braucht schon solch auffälliges Gepose? Mein wahres Talent liegt nicht im Aussehen, sondern in meinem faszinierenden Lebensstil – und ich bin eine Meisterin im Überleben!“
Überleben ist (k)eine Kunst – Meine Strategie als Parasit
„Seht, ich habe einen raffinierten Plan für meine Nachkommen: Die Eier, die ich sorgfältig ablege, sind mehr als nur kleine Pünktchen auf Pflanzen. Ich habe ein echtes Gespür dafür, die perfekten Wirte zu finden, nämlich Raupen! Die kleinen Eier landen auf ihrer Haut, und dort, sozusagen ‚unauffällig‘, bohren sich die winzigen Larven meiner Brut in den Körper der Raupen ein. Klingt vielleicht etwas grob, aber es ist genial! Die Raupe dient meinen Larven als lebendige Vorratskammer. Sie wachsen dort sicher heran, geschützt und gut genährt.“
„Manche mögen es seltsam finden, dass ich einen solch ‚parasitischen‘ Ansatz wähle, aber hey, das ist die Natur! Und für mich, Prosena siberita, ist das der optimale Weg, um meine Familie zu versorgen.“
Mein Aussehen: Grau, aber elegant und unauffällig
„Okay, ich geb’s zu: Mit meinem grauen Körper und den schlichten, unauffälligen Haaren wirke ich auf den ersten Blick vielleicht nicht wie eine Sensation. Aber das ist genau mein Vorteil! Ich passe mich blendend an die Umgebung an und kann mich frei bewegen, ohne viel Aufsehen zu erregen. Während meine bunten Freunde wie Schwebfliegen und Schmetterlinge um Aufmerksamkeit buhlen, kann ich in Ruhe meine kleinen Meisterwerke in Form von Eiern platzieren. Diskretion ist eben auch eine Form von Eleganz.“
Mein Zyklus: Die nächste Generation sichert das Überleben
„Sobald meine Larven genug Zeit in der Raupe verbracht haben und die Nährstoffe optimal genutzt wurden, verlassen sie ihren unfreiwilligen Gastgeber und verpuppen sich im Boden. Dort ruhen sie, bis sie als ausgewachsene Raupenfliegen wieder ans Licht kommen. Ich denke oft, dass die Welt uns Raupenfliegen unterschätzt. Denn obwohl wir so unscheinbar erscheinen, sichern wir das natürliche Gleichgewicht. Immerhin tragen wir dazu bei, dass nicht zu viele Raupen die Pflanzenwelt überfrachten – ein ökologischer Dienst, gewissermaßen.“
Ein letztes Wort von mir, Prosena siberita
„Nun, ich hoffe, ich konnte euch eine neue Perspektive auf meine graue Schönheit geben! Ich, Prosena siberita, die graue Raupenfliege, bin ein Meister der Tarnung, eine Expertin der Überlebenskunst, und zwar ohne großes Aufsehen. Das Leben mag unscheinbar wirken, doch wir alle haben unsere wichtige Rolle im großen Kreislauf der Natur. Also, wenn ihr das nächste Mal eine kleine graue Fliege seht, denkt daran: Vielleicht bin ich es, die charmante Prosena siberita, auf einer wichtigen Mission!“
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- Graue Raupenfliege mit rötlichen Beinen und sehr langem, leicht nach unten gebogenen Rüssel. Die Larven sind Parasitoiden von diversen Engerlingen. Kratzdisteln sind eine tolle Insektennährpflanze .. es gibt zu wenig Brachflächen auf denen diese Disteln wachsen dürfen.
Artenschutz in Franken®
Eumenes coarctatus – Ein Tag im Leben der Töpferwespe

Eumenes coarctatus – Ein Tag im Leben der Töpferwespe
29/30.10.2024
Ihr wollt wissen, wie das Leben einer kleinen Töpferwespe so aussieht? Setzt euch hin und haltet euch an euren Pflanzenstängeln fest!“
29/30.10.2024
- „Guten Nachmittag, Insektenwelt! Ich bin Eumenes coarctatus – für Freunde einfach Eumenes – und ich lebe, um Töpfe zu bauen, meine Nachkommen zu versorgen und gelegentlich eine lästige Spinne zu erschrecken.
Ihr wollt wissen, wie das Leben einer kleinen Töpferwespe so aussieht? Setzt euch hin und haltet euch an euren Pflanzenstängeln fest!“
Ich – Die Architektin der Wildnis
„Das Erste, was ihr über mich wissen solltet, ist, dass ich eine wahre Baumeisterin bin. Andere Insekten machen Löcher oder kratzen sich Höhlen in irgendwelche Hölzer – ich baue kleine Kunstwerke. Ja, Töpfe! Und zwar nicht mit den Händen, sondern mit meinem eigenen Kopf und Speichel! Ich mixe Sand, Erde und Speichel zu einem stabilen Baumaterial und forme daraus kleine kugelige Töpfchen, die wie Miniaturvulkane aussehen. Und nein, ich brauche keine Schule oder Bauanleitung dafür! Instinkt und Naturtalent, sage ich nur.“*
Eine Mutter mit gutem Geschmack (zumindest aus Wespenperspektive)
„In diesen Töpfen wächst dann mein Nachwuchs auf. Aber halt! Ich lasse sie nicht einfach hungrig zurück. Stattdessen packe ich jedem meiner zukünftigen Mini-Me’s ein paar leckere Raupen als Lunchpaket ein. Das ist genau wie bei euch, wenn ihr euer Mittagessen für die Arbeit vorbereitet. Nur dass meine Mahlzeiten... nun, etwas lebendig bleiben.“ „Ja, ihr habt richtig gehört. Bevor ich die Raupen in den Topf lege, lähme ich sie mit einem gezielten Stich. Sie bleiben also frisch, lebendig und saftig, bis meine Larve soweit ist, sie zu verspeisen. Die Larve muss also keine alte, harte Mahlzeit essen, sondern kann die saftige Raupe genießen. Praktisch, oder?“
Mein Platz in der Ökologie – klein, aber fein!
„Ihr fragt euch, was ich für die Welt tue? Nun, außer dass ich eine furchtlose Jägerin bin, die schädliche Raupen in Schach hält, trage ich auch zur Biodiversität bei. Mein Topfbau ist ein faszinierendes Beispiel dafür, wie kreativ wir Insekten im Überlebenskampf werden können.“
Gerücht: „Wespen sind aggressiv!“ … Wirklich?
„Diese schlechten PR-Nachrichten über uns Wespen finde ich echt unfair. Sicher, manche meiner entfernten Cousins mögen stechen, wenn ihr zu nahekommt. Aber ich bin eine Solitärwespe. Ich suche keinen Streit und habe es eher auf meine Beute abgesehen, nicht auf euch! Die meisten meiner Artgenossen sind zu beschäftigt mit Töpfern und Jagen, um sich mit Menschenproblemen herumzuschlagen.“
Mein Tipp an die Menschen: Genießt die Kunst der Natur!
„Wenn ihr mich und meine Töpfchen irgendwann in eurem Garten entdeckt, schaut einfach genau hin und genießt die Show. Wir machen nichts kaputt, sondern tragen sogar zur Schädlingsbekämpfung bei! Und für alle, die es wagen, meine Töpfe zu inspizieren: Keine Sorge, ich bin mehr damit beschäftigt, meinen Nachwuchs zu sichern, als euch einen Stachel zu verpassen.“
Zusammenfassung aus der Sicht von Eumenes coarctatus:
Als kleine Künstlerin der Natur baue ich kleine Töpfchen, in denen ich meinen Nachwuchs mit frischem Essen versorge – in Form einer lebenden Raupe. Ich halte die Umwelt im Gleichgewicht und werde dabei nie aggressiv. Also grüßt mich freundlich, und lasst euch inspirieren von meinem Talent!
Eumenes coarctatus – winzig, geschickt und definitiv eine der coolsten Architektinnen der Insektenwelt.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
„Das Erste, was ihr über mich wissen solltet, ist, dass ich eine wahre Baumeisterin bin. Andere Insekten machen Löcher oder kratzen sich Höhlen in irgendwelche Hölzer – ich baue kleine Kunstwerke. Ja, Töpfe! Und zwar nicht mit den Händen, sondern mit meinem eigenen Kopf und Speichel! Ich mixe Sand, Erde und Speichel zu einem stabilen Baumaterial und forme daraus kleine kugelige Töpfchen, die wie Miniaturvulkane aussehen. Und nein, ich brauche keine Schule oder Bauanleitung dafür! Instinkt und Naturtalent, sage ich nur.“*
Eine Mutter mit gutem Geschmack (zumindest aus Wespenperspektive)
„In diesen Töpfen wächst dann mein Nachwuchs auf. Aber halt! Ich lasse sie nicht einfach hungrig zurück. Stattdessen packe ich jedem meiner zukünftigen Mini-Me’s ein paar leckere Raupen als Lunchpaket ein. Das ist genau wie bei euch, wenn ihr euer Mittagessen für die Arbeit vorbereitet. Nur dass meine Mahlzeiten... nun, etwas lebendig bleiben.“ „Ja, ihr habt richtig gehört. Bevor ich die Raupen in den Topf lege, lähme ich sie mit einem gezielten Stich. Sie bleiben also frisch, lebendig und saftig, bis meine Larve soweit ist, sie zu verspeisen. Die Larve muss also keine alte, harte Mahlzeit essen, sondern kann die saftige Raupe genießen. Praktisch, oder?“
Mein Platz in der Ökologie – klein, aber fein!
„Ihr fragt euch, was ich für die Welt tue? Nun, außer dass ich eine furchtlose Jägerin bin, die schädliche Raupen in Schach hält, trage ich auch zur Biodiversität bei. Mein Topfbau ist ein faszinierendes Beispiel dafür, wie kreativ wir Insekten im Überlebenskampf werden können.“
Gerücht: „Wespen sind aggressiv!“ … Wirklich?
„Diese schlechten PR-Nachrichten über uns Wespen finde ich echt unfair. Sicher, manche meiner entfernten Cousins mögen stechen, wenn ihr zu nahekommt. Aber ich bin eine Solitärwespe. Ich suche keinen Streit und habe es eher auf meine Beute abgesehen, nicht auf euch! Die meisten meiner Artgenossen sind zu beschäftigt mit Töpfern und Jagen, um sich mit Menschenproblemen herumzuschlagen.“
Mein Tipp an die Menschen: Genießt die Kunst der Natur!
„Wenn ihr mich und meine Töpfchen irgendwann in eurem Garten entdeckt, schaut einfach genau hin und genießt die Show. Wir machen nichts kaputt, sondern tragen sogar zur Schädlingsbekämpfung bei! Und für alle, die es wagen, meine Töpfe zu inspizieren: Keine Sorge, ich bin mehr damit beschäftigt, meinen Nachwuchs zu sichern, als euch einen Stachel zu verpassen.“
Zusammenfassung aus der Sicht von Eumenes coarctatus:
Als kleine Künstlerin der Natur baue ich kleine Töpfchen, in denen ich meinen Nachwuchs mit frischem Essen versorge – in Form einer lebenden Raupe. Ich halte die Umwelt im Gleichgewicht und werde dabei nie aggressiv. Also grüßt mich freundlich, und lasst euch inspirieren von meinem Talent!
Eumenes coarctatus – winzig, geschickt und definitiv eine der coolsten Architektinnen der Insektenwelt.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- Eumenes coarctatus
Artenschutz in Franken®
Die Gelbband-Langhornmotte (Nemophora degeerella)

Gelbband-Langhornmotte (Nemophora degeerella)
29/30.10.2024
Ihr Menschen kennt mich vielleicht als winziges Wesen mit einem auffälligen Look und beneidenswerten langen "Antennen". Diese Dinger an meinem Kopf sind eigentlich meine Fühler, aber klar, ihr könnt sie gern "Hörner" nennen – klingt ja schon ziemlich majestätisch, oder?
Die Männchen wie ich haben Fühler, die dreimal so lang sind wie unser Körper! Damit kann ich sicher einiges angeben, während die Weibchen kürzere Antennen haben, um sich beim Fliegen nicht ständig zu verheddern (die haben es praktisch einfacher, aber wo bleibt der Spaß dabei?).
29/30.10.2024
- Hallo! Ich bin die Gelbband-Langhornmotte (Nemophora degeerella) – auch bekannt als kleine Prachtmotte.
Ihr Menschen kennt mich vielleicht als winziges Wesen mit einem auffälligen Look und beneidenswerten langen "Antennen". Diese Dinger an meinem Kopf sind eigentlich meine Fühler, aber klar, ihr könnt sie gern "Hörner" nennen – klingt ja schon ziemlich majestätisch, oder?
Die Männchen wie ich haben Fühler, die dreimal so lang sind wie unser Körper! Damit kann ich sicher einiges angeben, während die Weibchen kürzere Antennen haben, um sich beim Fliegen nicht ständig zu verheddern (die haben es praktisch einfacher, aber wo bleibt der Spaß dabei?).
Lebensstil: Nicht nur ein hübsches Gesicht
Ich bin eine kleine Motte, aber ich gehöre zur Familie der Adelidae – klingt schick, oder? Mein gelbes Band auf den Flügeln ist mein Markenzeichen, das mir den Namen "Gelbband-Langhornmotte" verpasst hat. Ich trage mein Muster so stolz, als wäre ich die Fashion-Ikone des Waldes!
Wie verbringe ich meinen Tag? Morgens mag ich es, wenn das Sonnenlicht durch das Geäst fällt und meine schimmernden Flügel zur Geltung kommen. Mein bevorzugtes Zuhause sind lichte Wälder und Hecken, und ich mag es gern nah am Boden. Ihr müsst wissen, ich bin ein "Tänzer"! Um Weibchen zu beeindrucken, tanze ich in Gruppen mit meinen Kumpels in der Luft herum – wir nennen das "Schwirrbalz"! Da bleibt kein Flügel ungeschwungen.
Meine Ernährung – Gourmets unter den Schmetterlingen
Als Raupe bin ich ziemlich bescheiden und nicht wählerisch – Blätter und verwelkte Pflanzenreste schmecken mir super. Sobald ich ein ausgewachsenes Prachtexemplar bin, nasche ich am liebsten Nektar. Meistens findet ihr mich bei Skabiosen oder Knoblauchrauke, aber ich bin für jede Blume zu haben, die mir was Süßes bietet.
Gefahren im Leben einer Gelbband-Langhornmotte
Das Leben ist nicht nur ein Schmetterlings-Ball! Auch wenn ich klein und schillernd bin, muss ich auf der Hut sein. Vögel und andere Räuber haben ein Auge auf mich geworfen, und manchmal sind es auch Menschen, die meinen, sie müssten uns für wissenschaftliche Sammlungen fangen. Aber hey, ich gebe mein Bestes, mit meiner geschickten Flugweise und den langen Fühlern zu entkommen!
Fortpflanzung und Nachwuchs – Langhorn-Nachwuchs auf die Welt bringen
Als stolzer Tänzer weiß ich, wie man das Herz einer Motten-Dame erobert. Unsere Flugschau beeindruckt die Weibchen, und wenn es dann klappt, legen sie die Eier auf Pflanzen ab, die unser Nachwuchs später futtern kann. Die kleinen Raupen schlüpfen und bereiten sich dann auf ihr eigenes Leben als Glanzstück des Waldes vor – bis auch sie in voller Pracht tanzen können.
Lustiges zum Schluss – Motte mit Stil
Manche von euch Menschen meinen ja, dass ich mit meinen Fühlern ein wenig komisch aussehe, so als hätte ich zwei Angelruten auf dem Kopf! Andere nennen mich liebevoll den "Waldhippie" wegen meines eleganten Schwebens und des Glanzes auf meinen Flügeln. Na ja, das Leben ist kurz, vor allem für uns kleine Motten – also lasst uns tanzen, schimmern und glitzern, solange die Sonne scheint!
Also, das war’s von mir, eurer Gelbband-Langhornmotte! Vielleicht sehen wir uns ja mal im Wald – aber bitte, keine schnellen Bewegungen, ja?
Aufnahme von Bernhard Schmalisch
Ich bin eine kleine Motte, aber ich gehöre zur Familie der Adelidae – klingt schick, oder? Mein gelbes Band auf den Flügeln ist mein Markenzeichen, das mir den Namen "Gelbband-Langhornmotte" verpasst hat. Ich trage mein Muster so stolz, als wäre ich die Fashion-Ikone des Waldes!
Wie verbringe ich meinen Tag? Morgens mag ich es, wenn das Sonnenlicht durch das Geäst fällt und meine schimmernden Flügel zur Geltung kommen. Mein bevorzugtes Zuhause sind lichte Wälder und Hecken, und ich mag es gern nah am Boden. Ihr müsst wissen, ich bin ein "Tänzer"! Um Weibchen zu beeindrucken, tanze ich in Gruppen mit meinen Kumpels in der Luft herum – wir nennen das "Schwirrbalz"! Da bleibt kein Flügel ungeschwungen.
Meine Ernährung – Gourmets unter den Schmetterlingen
Als Raupe bin ich ziemlich bescheiden und nicht wählerisch – Blätter und verwelkte Pflanzenreste schmecken mir super. Sobald ich ein ausgewachsenes Prachtexemplar bin, nasche ich am liebsten Nektar. Meistens findet ihr mich bei Skabiosen oder Knoblauchrauke, aber ich bin für jede Blume zu haben, die mir was Süßes bietet.
Gefahren im Leben einer Gelbband-Langhornmotte
Das Leben ist nicht nur ein Schmetterlings-Ball! Auch wenn ich klein und schillernd bin, muss ich auf der Hut sein. Vögel und andere Räuber haben ein Auge auf mich geworfen, und manchmal sind es auch Menschen, die meinen, sie müssten uns für wissenschaftliche Sammlungen fangen. Aber hey, ich gebe mein Bestes, mit meiner geschickten Flugweise und den langen Fühlern zu entkommen!
Fortpflanzung und Nachwuchs – Langhorn-Nachwuchs auf die Welt bringen
Als stolzer Tänzer weiß ich, wie man das Herz einer Motten-Dame erobert. Unsere Flugschau beeindruckt die Weibchen, und wenn es dann klappt, legen sie die Eier auf Pflanzen ab, die unser Nachwuchs später futtern kann. Die kleinen Raupen schlüpfen und bereiten sich dann auf ihr eigenes Leben als Glanzstück des Waldes vor – bis auch sie in voller Pracht tanzen können.
Lustiges zum Schluss – Motte mit Stil
Manche von euch Menschen meinen ja, dass ich mit meinen Fühlern ein wenig komisch aussehe, so als hätte ich zwei Angelruten auf dem Kopf! Andere nennen mich liebevoll den "Waldhippie" wegen meines eleganten Schwebens und des Glanzes auf meinen Flügeln. Na ja, das Leben ist kurz, vor allem für uns kleine Motten – also lasst uns tanzen, schimmern und glitzern, solange die Sonne scheint!
Also, das war’s von mir, eurer Gelbband-Langhornmotte! Vielleicht sehen wir uns ja mal im Wald – aber bitte, keine schnellen Bewegungen, ja?
Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- ... bei Motten denke ich immer an die Tierchen die meine schöne eingelagerte Jacke zum fressen gerne hatten.In der Familie gibt es aber wunderschöne Exemplare.Diese Langhornmotten Männchen erfreuen uns mit ihrem flatternden Kunstflügen mit denen sie versuchen die Weibchen zu beeindrucken.Der Name Langhornmotte ist bezeichnend, die Fühler dieses Männchens sind nur zu einem geringen Teil abgebildet, sie sind 3 bis 4 mal so lang wie der Körper
Artenschutz in Franken®
Der Wiesen-Champignon (Agaricus campestris)

Wiesen-Champignon (Agaricus campestris)
29/30.10.2024
Er gehört zur Familie der Champignonverwandten (Agaricaceae) und ist leicht an seinem weißen bis leicht bräunlichen Hut, den rosafarbenen bis dunkelbraunen Lamellen und dem angenehmen, pilzig-süßen Duft zu erkennen. Der Wiesen-Champignon gilt als beliebter Speisepilz und ist mit dem gezüchteten Zucht-Champignon verwandt, den man aus dem Supermarkt kennt.
29/30.10.2024
- Der Wiesen-Champignon, Agaricus campestris, ist ein schmackhafter und vielseitiger Pilz, der vor allem in offenen Wiesen, Weiden und grasbewachsenen Flächen wächst.
Er gehört zur Familie der Champignonverwandten (Agaricaceae) und ist leicht an seinem weißen bis leicht bräunlichen Hut, den rosafarbenen bis dunkelbraunen Lamellen und dem angenehmen, pilzig-süßen Duft zu erkennen. Der Wiesen-Champignon gilt als beliebter Speisepilz und ist mit dem gezüchteten Zucht-Champignon verwandt, den man aus dem Supermarkt kennt.
Warum der Wiesen-Champignon seltener wird
In den letzten Jahrzehnten hat die Population des Wiesen-Champignons deutlich abgenommen. Es gibt mehrere Gründe für diesen Rückgang:
Maßnahmen zur Erholung des Bestandes
Um die Bestände des Wiesen-Champignons wieder zu stärken, sind einige Maßnahmen erforderlich, die seine natürlichen Lebensräume und Wachstumsbedingungen unterstützen:
Mit diesen Maßnahmen kann die Population des Wiesen-Champignons stabilisiert und langfristig wieder erhöht werden. Indem wir natürliche Wiesenflächen schützen und die Bodenverhältnisse naturnah pflegen, fördern wir nicht nur das Überleben des Wiesen-Champignons, sondern auch die Vielfalt der gesamten Pflanzen- und Pilzwelt.
In der Aufnahme von Hannelore Kramer-Siegel
In den letzten Jahrzehnten hat die Population des Wiesen-Champignons deutlich abgenommen. Es gibt mehrere Gründe für diesen Rückgang:
- Intensivierung der Landwirtschaft: Wiesen und Weiden, die früher extensiv bewirtschaftet wurden, werden heute häufig intensiv landwirtschaftlich genutzt. Die Verwendung von Düngemitteln, Pestiziden und die Umwandlung von artenreichen Wiesen in monotone Weide- oder Ackerflächen schädigen das natürliche Ökosystem, das der Wiesen-Champignon zum Wachsen benötigt. Chemikalien stören den Bodenhaushalt und können das feine Geflecht des Myzels (Pilzgeflecht im Boden) schädigen, das für die Fruchtkörperproduktion entscheidend ist.
- Flächenverlust durch Bebauung und Zersiedelung: Viele natürliche Wiesen verschwinden, weil sie bebaut oder in Weideland für intensive Tierhaltung umgewandelt werden. Dadurch fehlt der Pilzflora der Lebensraum. Der Wiesen-Champignon ist auf offene, unverbaute Flächen angewiesen und findet in solchen Landschaften nur schwer geeignete Bedingungen.
- Verschmutzung und Bodenverdichtung: Die Böden sind vielerorts stark verdichtet und mit Abgasen und Schadstoffen belastet, was die Durchlüftung und den Wasserhaushalt beeinträchtigt. Pilze wie der Wiesen-Champignon benötigen jedoch einen lockeren und durchlässigen Boden, um optimal gedeihen zu können. Verdichtete Böden behindern die Ausbreitung des Myzels.
- Klimawandel: Der Wiesen-Champignon bevorzugt gemäßigte, feuchte Bedingungen und wächst besonders gut in Regionen mit typischen Niederschlagsmustern und gemäßigten Sommern. Durch den Klimawandel ändern sich jedoch die Wetterbedingungen; trockene Sommer und ein verschobenes Niederschlagsmuster erschweren dem Wiesen-Champignon das Überleben.
Maßnahmen zur Erholung des Bestandes
Um die Bestände des Wiesen-Champignons wieder zu stärken, sind einige Maßnahmen erforderlich, die seine natürlichen Lebensräume und Wachstumsbedingungen unterstützen:
- Erhalt von artenreichen Wiesen und extensiven Weiden: Schutz und Pflege von extensiv bewirtschafteten Wiesen, die ohne chemische Dünger und Pestizide auskommen, sind entscheidend. Wiesen, die nur ein- bis zweimal im Jahr gemäht werden und auf denen der Boden nicht intensiv bearbeitet wird, bieten dem Wiesen-Champignon eine gute Wachstumsgrundlage.
- Förderung naturnaher Landwirtschaft: Landwirtschaftliche Betriebe können durch Förderprogramme unterstützt werden, die auf naturnahe und ökologische Bewirtschaftungsformen abzielen. Verzicht auf chemische Dünger und Pestizide, die Förderung von Mischkulturen und eine umweltschonende Bodenbearbeitung tragen zur Erholung der Bodenflora und -fauna bei und unterstützen damit auch den Wiesen-Champignon.
- Schutz vor Bodenverdichtung und Erosion: Durch eine gezielte Bodenpflege kann die Struktur des Bodens verbessert werden. Regelmäßige Lockerung und Renaturierung verdichteter Flächen – beispielsweise durch die Anpflanzung bodenlockernder Pflanzen oder durch das Reduzieren schwerer Maschinen auf Wiesenflächen – können helfen, die natürlichen Bodenverhältnisse zu bewahren.
- Anlegen von Schutzflächen: Das Einrichten von speziellen Pilzschutzgebieten, in denen auf chemische Eingriffe und intensive Nutzung verzichtet wird, kann Pilzarten wie dem Wiesen-Champignon zugutekommen. Solche Schutzflächen ermöglichen es dem Myzel, sich ungestört auszubreiten und die für den Pilz wichtigen Fruchtkörper zu bilden.
- Bewusstsein schaffen und auf Sammelbegrenzungen achten: Sensibilisierung der Bevölkerung ist wichtig, um zu verhindern, dass die Pilzbestände durch übermäßiges Sammeln beeinträchtigt werden. Der verantwortungsvolle Umgang mit Pilzen in der Natur sowie das Einhalten von Sammelbegrenzungen können den Bestand schützen.
Mit diesen Maßnahmen kann die Population des Wiesen-Champignons stabilisiert und langfristig wieder erhöht werden. Indem wir natürliche Wiesenflächen schützen und die Bodenverhältnisse naturnah pflegen, fördern wir nicht nur das Überleben des Wiesen-Champignons, sondern auch die Vielfalt der gesamten Pflanzen- und Pilzwelt.
In der Aufnahme von Hannelore Kramer-Siegel
- Wiesen-Champignon (Agaricus campestris)
Artenschutz in Franken®
Der Hornissenherbst

Hornissenherbst ... Aus der Sicht der Hornissenkönigin:
29/30.10.2024
Unsere Zeit hier geht zu Ende. Aber das ist unser Kreislauf, der Zyklus des Lebens – ich, die Königin, habe noch eine wichtige Aufgabe vor mir. Aber lassen wir die Erinnerungen an die vergangenen Monate kurz Revue passieren!“
29/30.10.2024
- „Ach, der Herbst ist da … Man merkt es in der Luft. Es ist kühler, die Tage werden kürzer, und mein geliebtes Volk bereitet sich auf die letzte Phase des Jahres vor.
Unsere Zeit hier geht zu Ende. Aber das ist unser Kreislauf, der Zyklus des Lebens – ich, die Königin, habe noch eine wichtige Aufgabe vor mir. Aber lassen wir die Erinnerungen an die vergangenen Monate kurz Revue passieren!“
- Der Untergang des Volkes – Warum die Hornissenvölker im Herbst sterben
„Ach, meine kleinen Helferinnen … So viele habe ich im Sommer heranwachsen sehen, und nun? Jede gibt ihr Leben, um diesen Kreislauf am Leben zu halten. Es ist fast poetisch, wenn man es so betrachtet.“
Winterruhe – Wo und wie die Königin den Winter überlebt
Die Hornissenkönigin ist klug. Sie hat den Sommer genutzt, um Fettreserven anzulegen. In den letzten Tagen ihres Volkes verabschiedet sie sich still und sucht sich ein neues Versteck. Ein geschützter, dunkler Ort ist ideal – unter einem Stück Rinde, in einem alten Holzstapel oder sogar in einer Mauerritze. Dort, tief in ihrem Versteck, geht sie in die Winterruhe. Ihr Herzschlag und ihre Atmung verlangsamen sich, ihr Körper reduziert seine Aktivität auf das Nötigste. Hier kann sie monatelang ausharren, ohne zu fressen, im Schutz der Natur.
„So kalt hier draußen … Aber ich habe mich vorbereitet. Die Zeit des Winterschlafes hat ihre eigene, stille Magie. Ich träume von warmen Tagen und neuen, frischen Flügeln, die im Frühling für mich arbeiten werden.“
Die Vorbereitung auf das nächste Jahr – Ein neues Hornissenvolk
Im Frühling, sobald die Temperaturen steigen und die Sonne ihre Strahlen auf die Welt wirft, erwacht die Königin. Sie reckt sich und streckt sich, klopft den Winter aus ihren Flügeln und sucht nach einem geeigneten Ort für ihr neues Nest. Vielleicht ist es ein hohler Baum, vielleicht auch der Dachboden eines Menschen – wichtig ist, dass es dort sicher ist und Platz für ein großes Volk bietet. Sobald sie das perfekte Fleckchen gefunden hat, beginnt sie, die ersten Zellen zu bauen und legt Eier. Aus diesen schlüpfen die ersten Arbeiterinnen, die bald die Arbeit übernehmen, damit die Königin sich wieder voll und ganz auf das Eierlegen konzentrieren kann.
„So fängt es also wieder an! Ein neues Jahr, ein neues Volk. Es ist ein wunderbarer Gedanke, dass jede meiner Töchter und deren Töchter wiederum eines Tages ihr eigenes Nest bauen werden. Man könnte sagen, ich bin eine Mutter voller Stolz – eine, die den Kreislauf des Lebens mitgestaltet.“
Die alte Königin kann also, mit einem gewissen Augenzwinkern, auf die kommende Generation blicken. Und so geht das Leben der Hornissen Jahr für Jahr weiter – ein Kreislauf voller Hingabe, voller Opfer, aber auch voller Hoffnung und neuen Anfängen.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch vom 26.10.2024
... die Völker sterben, die Nester verwaisen un werden nächstes Jahr nicht mehr bezogen ...teilweise werden die Reste der Brut nicht mehr versorgt und stirbt ebenfalls. Einzelne Tiere holen sich an Früchten noch kohlehydratreiche Nahrung Die geschlüpften Königinnen suchen sich eine frostsichere Bleibe.Hier eine Hornisse und eine Schlupfwespe.
Artenschutz in Franken®
Verleihung des Deutschen Umweltpreises durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU)

Steinmeier setzt auf Stärke der Demokratie beim Klima- und Umweltschutz
28/29.10.2024
Osnabrück/Mainz. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat angesichts der Herausforderungen beim Klima- und Umweltschutz ein vehementes Plädoyer für die „Stärke der Demokratie“ gehalten. „Dieser Ansatz wird dem Populismus und der Willkür einer Autokratie immer überlegen bleiben!“, sagte Steinmeier heute (Sonntag) bei der Verleihung des Deutschen Umweltpreises durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) in Mainz.
Die DBU vergibt die Auszeichnung in Höhe von insgesamt 500.000 Euro einmal jährlich. Sie zählt zu den höchstdotierten Umwelt-Auszeichnungen Europas. Dieses Jahr teilen sich Moorforscherin Dr. Franziska Tanneberger und E-Mobilität-Wegbereiter Diplom-Ingenieur Thomas Speidel den Preis.
28/29.10.2024
- Deutscher Umweltpreis der DBU an Tanneberger und Speidel
Osnabrück/Mainz. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat angesichts der Herausforderungen beim Klima- und Umweltschutz ein vehementes Plädoyer für die „Stärke der Demokratie“ gehalten. „Dieser Ansatz wird dem Populismus und der Willkür einer Autokratie immer überlegen bleiben!“, sagte Steinmeier heute (Sonntag) bei der Verleihung des Deutschen Umweltpreises durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) in Mainz.
Die DBU vergibt die Auszeichnung in Höhe von insgesamt 500.000 Euro einmal jährlich. Sie zählt zu den höchstdotierten Umwelt-Auszeichnungen Europas. Dieses Jahr teilen sich Moorforscherin Dr. Franziska Tanneberger und E-Mobilität-Wegbereiter Diplom-Ingenieur Thomas Speidel den Preis.
Bonde: Es geht schlicht um den Erhalt unserer Lebensgrundlagen
DBU-Generalsekretär Alexander Bonde forderte, sich trotz multipler Kriege und Krisen weltweit „mutig mit Tatkraft und Tag für Tag weiter für den Schutz von Klima, Umwelt, Ressourcen und Biodiversität starkzumachen. Es geht schlicht um den Erhalt der Lebensgrundlagen für Menschen, aber natürlich auch für Tiere und Pflanzen.“ Bonde weiter: „Wirtschaft und Wissenschaft sind immer wieder Ursprung pfiffiger und innovativer Ideen, um diese Zukunftsaufgabe zu bewältigen. Solche Erkenntnisse und Vorbilder haben wiederum das Zeug, andere Menschen zu wegweisenden Einfällen zu inspirieren.“ In Zeiten zunehmender Falsch-Nachrichten zu Klima- und Umweltthemen seien solche Mutmacher umso wichtiger, „damit wir beim Klima- und Umweltschutz nicht nachlassen“.
„Der klassische Verbrennungsmotor wird an sein Ende kommen“
An die Adresse von Thomas Speidel und mit Blick auf dessen Wirken bezog der Bundespräsident unter Verweis auf Carl Benz und Gottlieb Daimler als „zwei der visionärsten deutschen Erfinder“, die wie Speidel aus dem deutschen Südwesten stammten und „der ganzen Welt eine individuelle Mobilität“ ermöglicht hätten, klar Position. Steinmeier: „Der klassische Verbrennungsmotor, auf dem diese Mobilität beruhte, wird an sein Ende kommen.“ Wegen der „klimaverändernden“ Emissionen des Treibhausgases Kohlendioxid (CO2) „durch Pkw- und Lkw-Verkehr kann daran kein vernünftiger Zweifel bestehen“. Aber wie schnell E-Mobilität flächendeckend Wirklichkeit werde, hänge davon ab, „ob wir Mittel und Wege finden, die noch bestehenden technischen und faktischen Hindernisse im Alltag zu überwinden“. Genau hier liegt laut Steinmeier „die Stärke der Demokratie“: Denn sie ermögliche, „Sackgassen, Schwachpunkte, Fehler, die auf dem unbekannten Weg zu einem umfassenden und nachhaltig wirksamen Klima- und Umweltschutz unvermeidlich sind, immer wieder zu korrigieren“. Allein in einer Demokratie sei auszuhandeln, „wie schnell und wie entschieden wir diesen oder jenen Weg gehen wollen – oder genauer gesagt: gehen müssen“. Ebenso wichtig sei, „welcher Ausgleich fairerweise für diejenigen notwendig ist, die vor gravierenden Umbrüchen stehen und diese eben nicht so leicht stemmen können wie andere“. Preisträger Speidel etwa habe eine Lösung für neue Wege in der Elektromobilität gefunden: Wie nämlich ein E-Auto in kürzester Zeit auch an Orten aufzuladen ist, wo ein ausgebautes Stromnetz für die Ladeinfrastruktur fehlt.
Intakte Moore bedeutend für ein gutes Klima und die Biodiversität
Moorforscherin Tanneberger, die unter anderem am ersten globalen Moor-Zustandsbericht mitgewirkt hat, wird von der DBU mit dem Deutschen Umweltpreis ausgezeichnet, weil sie laut Bonde „als treibende Kraft die Revitalisierung von Mooren vorangebracht und es zugleich geschafft hat, Brücken zwischen Wissenschaft, Politik und Landwirtschaft zu bauen“. Tannebergers Leistung würdigte der Bundespräsident ebenfalls mit klarer Haltung – inklusive eines rhetorischen Ausflugs in die Dichtung. Das Moor sei „oft wenig geschätzte Landschaft“ gewesen, so Steinmeier. Unter anderem habe dies dazu geführt, „dass die Moore wenig wertgeschätzt, leichthin geopfert, trockengelegt und der landwirtschaftlichen Nutzung zugeführt wurden“. Trockengelegte Moore haben zur Folge, dass in großen Mengen klimaschädliches Treibhausgas entweicht. Nach Steinmeiers Worten ist Moor in Erzählungen, Romanen, Liedern und Lyrik kaum Thema – und wenn, dann eher in düsteren Varianten wie etwa bei der westfälischen Dichterin Annette von Droste-Hülshoff. Tanneberger sei es jedoch gelungen, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, „wie bedeutend intakte Moore für ein gutes Klima und auch für die Biodiversität sind“.
Radikale Transformation gewagt: vom Ausrüster für Verbrennungsmotoren zum Vorreiter der E-Mobilität
Elektrotechnik-Ingenieur Thomas Speidel (57) ist Geschäftsführer des mittlerweile an der Börse gelisteten Unternehmens ads-tec Energy in Nürtingen bei Stuttgart mit weiteren Standorten unter anderem in Klipphausen bei Dresden und Auburn im US-Bundesstaat Alabama. In seinem Portfolio sind mehr als 60 deutsche und internationale Patentanmeldungen. Die DBU zeichnet ihn mit dem Deutschen Umweltpreis einerseits aus, weil er mit seinen Innovationen von batteriegepufferten Schnellladesystemen namens ChargeBox und ChargePost das Stromtanken von E-Fahrzeugen minutenschnell statt stundenlang ermöglicht und damit für mehr Tempo beim Ausbau der Elektromobilität sorgt. Andererseits, weil er mit seinem Betrieb selbst eine radikale Transformation gewagt hat: vom Ausrüster für Verbrennungsmotoren zu einem Vorreiter der E-Mobilität. Moorforscherin Tanneberger (46) wiederum ist Co-Leiterin des Greifswald Moor Centrums und setzt sich unermüdlich für die Wiedervernässung von Mooren ein. Ihre Stimme hat national und international großes Gewicht, etwa auf der Weltklimakonferenz 2023 in Dubai. Dabei sind Moorschutz und Moornutzung für sie kein Widerspruch. Tanneberger habe es geschafft, „für besseren Schutz von Klima und Biodiversität Bäuerinnen und Bauern ins Boot zu holen, weil man Moore nämlich auch nass nutzen kann“, so DBU-Generalsekretär Bonde.
Hintergrund:
Mit dem 2024 zum 32. Mal verliehenen Deutschen Umweltpreis der DBU werden Leistungen von Menschen ausgezeichnet, die vorbildlich zum Schutz und Erhalt der Umwelt beitragen. Kandidatinnen und Kandidaten werden der DBU vorgeschlagen. Berechtigt dazu sind etwa Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften, Kirchen, Umwelt- und Naturschutzverbände, wissenschaftliche Vereinigungen und Forschungsgemeinschaften, Medien, das Handwerk und Wirtschaftsverbände. Selbstvorschläge sind nicht möglich. Eine vom DBU-Kuratorium ernannte Jury unabhängiger Fachleute aus Wirtschaft, Wissenschaft, Technik und gesellschaftlichen Gruppen empfiehlt dem DBU-Kuratorium Preisträgerinnen und Preisträger für das jeweilige Jahr. Das DBU-Kuratorium fällt die endgültige Entscheidung. Infos zum Deutschen Umweltpreis und Ausgezeichneten: https://www.dbu.de/umweltpreis.
In der Aufnahme von © Peter Himsel/DBU
Quelle
Deutsche Bundesstiftung Umwelt
An der Bornau 2
49090 Osnabrück
Stand
27.10.2024
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung.Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
DBU-Generalsekretär Alexander Bonde forderte, sich trotz multipler Kriege und Krisen weltweit „mutig mit Tatkraft und Tag für Tag weiter für den Schutz von Klima, Umwelt, Ressourcen und Biodiversität starkzumachen. Es geht schlicht um den Erhalt der Lebensgrundlagen für Menschen, aber natürlich auch für Tiere und Pflanzen.“ Bonde weiter: „Wirtschaft und Wissenschaft sind immer wieder Ursprung pfiffiger und innovativer Ideen, um diese Zukunftsaufgabe zu bewältigen. Solche Erkenntnisse und Vorbilder haben wiederum das Zeug, andere Menschen zu wegweisenden Einfällen zu inspirieren.“ In Zeiten zunehmender Falsch-Nachrichten zu Klima- und Umweltthemen seien solche Mutmacher umso wichtiger, „damit wir beim Klima- und Umweltschutz nicht nachlassen“.
„Der klassische Verbrennungsmotor wird an sein Ende kommen“
An die Adresse von Thomas Speidel und mit Blick auf dessen Wirken bezog der Bundespräsident unter Verweis auf Carl Benz und Gottlieb Daimler als „zwei der visionärsten deutschen Erfinder“, die wie Speidel aus dem deutschen Südwesten stammten und „der ganzen Welt eine individuelle Mobilität“ ermöglicht hätten, klar Position. Steinmeier: „Der klassische Verbrennungsmotor, auf dem diese Mobilität beruhte, wird an sein Ende kommen.“ Wegen der „klimaverändernden“ Emissionen des Treibhausgases Kohlendioxid (CO2) „durch Pkw- und Lkw-Verkehr kann daran kein vernünftiger Zweifel bestehen“. Aber wie schnell E-Mobilität flächendeckend Wirklichkeit werde, hänge davon ab, „ob wir Mittel und Wege finden, die noch bestehenden technischen und faktischen Hindernisse im Alltag zu überwinden“. Genau hier liegt laut Steinmeier „die Stärke der Demokratie“: Denn sie ermögliche, „Sackgassen, Schwachpunkte, Fehler, die auf dem unbekannten Weg zu einem umfassenden und nachhaltig wirksamen Klima- und Umweltschutz unvermeidlich sind, immer wieder zu korrigieren“. Allein in einer Demokratie sei auszuhandeln, „wie schnell und wie entschieden wir diesen oder jenen Weg gehen wollen – oder genauer gesagt: gehen müssen“. Ebenso wichtig sei, „welcher Ausgleich fairerweise für diejenigen notwendig ist, die vor gravierenden Umbrüchen stehen und diese eben nicht so leicht stemmen können wie andere“. Preisträger Speidel etwa habe eine Lösung für neue Wege in der Elektromobilität gefunden: Wie nämlich ein E-Auto in kürzester Zeit auch an Orten aufzuladen ist, wo ein ausgebautes Stromnetz für die Ladeinfrastruktur fehlt.
Intakte Moore bedeutend für ein gutes Klima und die Biodiversität
Moorforscherin Tanneberger, die unter anderem am ersten globalen Moor-Zustandsbericht mitgewirkt hat, wird von der DBU mit dem Deutschen Umweltpreis ausgezeichnet, weil sie laut Bonde „als treibende Kraft die Revitalisierung von Mooren vorangebracht und es zugleich geschafft hat, Brücken zwischen Wissenschaft, Politik und Landwirtschaft zu bauen“. Tannebergers Leistung würdigte der Bundespräsident ebenfalls mit klarer Haltung – inklusive eines rhetorischen Ausflugs in die Dichtung. Das Moor sei „oft wenig geschätzte Landschaft“ gewesen, so Steinmeier. Unter anderem habe dies dazu geführt, „dass die Moore wenig wertgeschätzt, leichthin geopfert, trockengelegt und der landwirtschaftlichen Nutzung zugeführt wurden“. Trockengelegte Moore haben zur Folge, dass in großen Mengen klimaschädliches Treibhausgas entweicht. Nach Steinmeiers Worten ist Moor in Erzählungen, Romanen, Liedern und Lyrik kaum Thema – und wenn, dann eher in düsteren Varianten wie etwa bei der westfälischen Dichterin Annette von Droste-Hülshoff. Tanneberger sei es jedoch gelungen, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, „wie bedeutend intakte Moore für ein gutes Klima und auch für die Biodiversität sind“.
Radikale Transformation gewagt: vom Ausrüster für Verbrennungsmotoren zum Vorreiter der E-Mobilität
Elektrotechnik-Ingenieur Thomas Speidel (57) ist Geschäftsführer des mittlerweile an der Börse gelisteten Unternehmens ads-tec Energy in Nürtingen bei Stuttgart mit weiteren Standorten unter anderem in Klipphausen bei Dresden und Auburn im US-Bundesstaat Alabama. In seinem Portfolio sind mehr als 60 deutsche und internationale Patentanmeldungen. Die DBU zeichnet ihn mit dem Deutschen Umweltpreis einerseits aus, weil er mit seinen Innovationen von batteriegepufferten Schnellladesystemen namens ChargeBox und ChargePost das Stromtanken von E-Fahrzeugen minutenschnell statt stundenlang ermöglicht und damit für mehr Tempo beim Ausbau der Elektromobilität sorgt. Andererseits, weil er mit seinem Betrieb selbst eine radikale Transformation gewagt hat: vom Ausrüster für Verbrennungsmotoren zu einem Vorreiter der E-Mobilität. Moorforscherin Tanneberger (46) wiederum ist Co-Leiterin des Greifswald Moor Centrums und setzt sich unermüdlich für die Wiedervernässung von Mooren ein. Ihre Stimme hat national und international großes Gewicht, etwa auf der Weltklimakonferenz 2023 in Dubai. Dabei sind Moorschutz und Moornutzung für sie kein Widerspruch. Tanneberger habe es geschafft, „für besseren Schutz von Klima und Biodiversität Bäuerinnen und Bauern ins Boot zu holen, weil man Moore nämlich auch nass nutzen kann“, so DBU-Generalsekretär Bonde.
- Daten, Zahlen, Fakten auch im DBU-Umweltpreis-Blog: https://www.dbu.de/umweltpreis/umweltpreis-blog/
Hintergrund:
Mit dem 2024 zum 32. Mal verliehenen Deutschen Umweltpreis der DBU werden Leistungen von Menschen ausgezeichnet, die vorbildlich zum Schutz und Erhalt der Umwelt beitragen. Kandidatinnen und Kandidaten werden der DBU vorgeschlagen. Berechtigt dazu sind etwa Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften, Kirchen, Umwelt- und Naturschutzverbände, wissenschaftliche Vereinigungen und Forschungsgemeinschaften, Medien, das Handwerk und Wirtschaftsverbände. Selbstvorschläge sind nicht möglich. Eine vom DBU-Kuratorium ernannte Jury unabhängiger Fachleute aus Wirtschaft, Wissenschaft, Technik und gesellschaftlichen Gruppen empfiehlt dem DBU-Kuratorium Preisträgerinnen und Preisträger für das jeweilige Jahr. Das DBU-Kuratorium fällt die endgültige Entscheidung. Infos zum Deutschen Umweltpreis und Ausgezeichneten: https://www.dbu.de/umweltpreis.
In der Aufnahme von © Peter Himsel/DBU
- In einem feierlichen Festakt hat die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) mit Sitz in Osnabrück heute (Sonntag) den diesjährigen Deutschen Umweltpreis in Höhe von gesamt 500.000 Euro in Mainz vergeben. Überreicht wurden die Preise von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Das Foto zeigt (von links): Rheinland-Pfalz-Ministerpräsident Alexander Schweitzer, Moorforscherin Dr. Franziska Tanneberger, DBU-Kuratoriumsvorsitzenden Kai Niebert, den Bundespräsidenten, DBU-Generalsekretär Alexander Bonde und Thomas Speidel, Geschäftsführer von ads-tec Energy.
Quelle
Deutsche Bundesstiftung Umwelt
An der Bornau 2
49090 Osnabrück
Stand
27.10.2024
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung.Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Artenschutz in Franken®
Die Grüne Kräuselspinne (Nigma walckenaeri)

Grüne Kräuselspinne (Nigma walckenaeri)
28/29.10.2024
Klein und zart bin ich, kaum 4 bis 5 Millimeter groß, und dennoch eine meisterhafte Architektin und Jägerin. Mein Körper glänzt in einem hellen, frischen Grün, was mich besonders macht – selbst unter den vielen anderen Spinnenarten. Die roten Augenpunkte, die vorne auf meinem Kopf angeordnet sind, geben mir ein einzigartiges Gesicht und einen intensiven Blick, der viele fasziniert. Doch das Äußere ist nur ein Teil meines Wesens.
28/29.10.2024
- Ich bin die Grüne Kräuselspinne, oder wie die Menschen mich nennen: Nigma walckenaeri.
Klein und zart bin ich, kaum 4 bis 5 Millimeter groß, und dennoch eine meisterhafte Architektin und Jägerin. Mein Körper glänzt in einem hellen, frischen Grün, was mich besonders macht – selbst unter den vielen anderen Spinnenarten. Die roten Augenpunkte, die vorne auf meinem Kopf angeordnet sind, geben mir ein einzigartiges Gesicht und einen intensiven Blick, der viele fasziniert. Doch das Äußere ist nur ein Teil meines Wesens.
Mein Revier und Lebensraum
Ich bevorzuge Sträucher, Büsche und Laubbäume als mein Zuhause. Besonders wohl fühle ich mich an sonnigen Standorten, denn Wärme ist entscheidend für meine Aktivitäten und mein Wachstum. Vor allem in wärmeren Regionen wie dem Mittelmeerraum, aber auch in einigen Teilen Mitteleuropas, findet ihr mich, solange die Bedingungen stimmen. Dort setze ich mein kunstvolles Netzwerk um – ganz fein und präzise.
Mein Jagdnetz und mein Jagdverhalten
Wie viele Spinnen baue ich mein Netz für den Fang meiner Beute, doch mein Stil ist speziell: Ich spinne eine Art Haftnetz, das sich über Blätter oder kleine Äste spannt. Wenn Insekten – wie kleine Fliegen oder Blattläuse – über mein Netz laufen, bleiben sie an den winzigen Fäden haften. Durch kleine Ruckbewegungen schaffe ich es, sie in meinen Fäden zu verstricken, und mit einem schnellen Biss injiziere ich ihnen mein Gift, das sie lähmt.
Diese Netze baue ich mit besonderer Hingabe und feinen Techniken. Meine Fäden sind fein und kaum zu erkennen, aber sie sind perfekt für meine Bedürfnisse. Ich benutze sie nicht wie die Radnetzspinnen, die ihre Netze groß und weit spannen; mein Netz ist kompakt und strategisch platziert. Die Kunst liegt darin, dass es eng am Blatt anliegt, sodass es für meine Beute schwer zu erkennen ist.
Überlebensstrategien und Tarnung
Meine grüne Färbung ist kein Zufall. Sie verschmilzt perfekt mit den Blättern und schützt mich vor Fressfeinden. Doch nicht nur das: Diese Farbe spielt auch eine Rolle bei der Wärmeregulation, da sie es mir ermöglicht, sowohl die Sonne als auch den Schatten zu nutzen, ohne zu sehr aufzufallen. Tagsüber halte ich mich oft an der Blattunterseite auf, wo ich vor den Blicken vieler Vögel geschützt bin. Nachts, wenn die Gefahr geringer ist, bewege ich mich freier.
Fortpflanzung und Nachwuchs
Mein Fortpflanzungsverhalten ist simpel, aber effektiv. Männchen und Weibchen treffen sich meist im Frühling zur Paarung. Sobald ich Weibchen befruchtet bin, lege ich meine Eier auf einem Blatt ab und sichere sie mit einem seidigen Gespinst. Nach einiger Zeit schlüpfen die Jungspinnen, die erst auf dem Blatt verbleiben und sich an das Überleben anpassen müssen. Sie bauen bald ihre eigenen Netze, lernen zu jagen und tarnen sich so wie ich – nur die Stärksten überleben.
Bedrohungen und Anpassungsfähigkeiten
Trotz meiner ausgeklügelten Tarnung bin ich nicht ohne Feinde. Vögel und größere Insektenjäger lauern überall. Glücklicherweise habe ich mein kleines Netzwerk perfektioniert, und durch meine Bewegungen kann ich schnell in Deckung gehen. Der Klimawandel macht uns Spinnen in Europa zu schaffen, aber ich habe mich an schwankende Temperaturen und extreme Wetterbedingungen angepasst. Wer weiß, vielleicht werde ich bald in Gegenden gesichtet, die man bisher nicht mit meiner Art in Verbindung gebracht hat.
So lebe ich also – als Grüne Kräuselspinne – mitten unter euch Menschen, fast unsichtbar und doch voller Leben und Raffinesse. Mein Alltag mag unscheinbar erscheinen, aber er ist voller Strategien, Farben und kleinen Erfolgen.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
Ich bevorzuge Sträucher, Büsche und Laubbäume als mein Zuhause. Besonders wohl fühle ich mich an sonnigen Standorten, denn Wärme ist entscheidend für meine Aktivitäten und mein Wachstum. Vor allem in wärmeren Regionen wie dem Mittelmeerraum, aber auch in einigen Teilen Mitteleuropas, findet ihr mich, solange die Bedingungen stimmen. Dort setze ich mein kunstvolles Netzwerk um – ganz fein und präzise.
Mein Jagdnetz und mein Jagdverhalten
Wie viele Spinnen baue ich mein Netz für den Fang meiner Beute, doch mein Stil ist speziell: Ich spinne eine Art Haftnetz, das sich über Blätter oder kleine Äste spannt. Wenn Insekten – wie kleine Fliegen oder Blattläuse – über mein Netz laufen, bleiben sie an den winzigen Fäden haften. Durch kleine Ruckbewegungen schaffe ich es, sie in meinen Fäden zu verstricken, und mit einem schnellen Biss injiziere ich ihnen mein Gift, das sie lähmt.
Diese Netze baue ich mit besonderer Hingabe und feinen Techniken. Meine Fäden sind fein und kaum zu erkennen, aber sie sind perfekt für meine Bedürfnisse. Ich benutze sie nicht wie die Radnetzspinnen, die ihre Netze groß und weit spannen; mein Netz ist kompakt und strategisch platziert. Die Kunst liegt darin, dass es eng am Blatt anliegt, sodass es für meine Beute schwer zu erkennen ist.
Überlebensstrategien und Tarnung
Meine grüne Färbung ist kein Zufall. Sie verschmilzt perfekt mit den Blättern und schützt mich vor Fressfeinden. Doch nicht nur das: Diese Farbe spielt auch eine Rolle bei der Wärmeregulation, da sie es mir ermöglicht, sowohl die Sonne als auch den Schatten zu nutzen, ohne zu sehr aufzufallen. Tagsüber halte ich mich oft an der Blattunterseite auf, wo ich vor den Blicken vieler Vögel geschützt bin. Nachts, wenn die Gefahr geringer ist, bewege ich mich freier.
Fortpflanzung und Nachwuchs
Mein Fortpflanzungsverhalten ist simpel, aber effektiv. Männchen und Weibchen treffen sich meist im Frühling zur Paarung. Sobald ich Weibchen befruchtet bin, lege ich meine Eier auf einem Blatt ab und sichere sie mit einem seidigen Gespinst. Nach einiger Zeit schlüpfen die Jungspinnen, die erst auf dem Blatt verbleiben und sich an das Überleben anpassen müssen. Sie bauen bald ihre eigenen Netze, lernen zu jagen und tarnen sich so wie ich – nur die Stärksten überleben.
Bedrohungen und Anpassungsfähigkeiten
Trotz meiner ausgeklügelten Tarnung bin ich nicht ohne Feinde. Vögel und größere Insektenjäger lauern überall. Glücklicherweise habe ich mein kleines Netzwerk perfektioniert, und durch meine Bewegungen kann ich schnell in Deckung gehen. Der Klimawandel macht uns Spinnen in Europa zu schaffen, aber ich habe mich an schwankende Temperaturen und extreme Wetterbedingungen angepasst. Wer weiß, vielleicht werde ich bald in Gegenden gesichtet, die man bisher nicht mit meiner Art in Verbindung gebracht hat.
So lebe ich also – als Grüne Kräuselspinne – mitten unter euch Menschen, fast unsichtbar und doch voller Leben und Raffinesse. Mein Alltag mag unscheinbar erscheinen, aber er ist voller Strategien, Farben und kleinen Erfolgen.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- Nigma walckenaeri, die Grüne Kräuselspinne auf ihrem Blattgespinnst.
Artenschutz in Franken®
30 Jahre BUND-Auenzentrum

30 Jahre BUND-Auenzentrum: Erfolge für Arten-, Klima- und Hochwasserschutz
28/29.10.2024
Seit der Gründung auf Burg Lenzen/Elbe hat das BUND-Auenzentrum einen bedeutenden Beitrag zur Renaturierung der Flussauen sowohl im UNESCO Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe als auch deutschlandweit geleistet.
28/29.10.2024
- Bonn/Berlin/Lenzen Das Auenzentrum des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) feiert heute die erfolgreiche Arbeit der vergangenen 30 Jahre.
Seit der Gründung auf Burg Lenzen/Elbe hat das BUND-Auenzentrum einen bedeutenden Beitrag zur Renaturierung der Flussauen sowohl im UNESCO Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe als auch deutschlandweit geleistet.
Die Präsidentin des Bundesamtes für Naturschutz (BfN), Sabine Riewenherm, und die Umweltminister Brandenburgs und Niedersachsens, Axel Vogel und Christian Meyer und Sachsen-Anhalts Umweltstaatsekretär Steffen Eichner würdigen die bisherigen Erfolge und diskutieren mit dem BUND Chancen und Visionen für die Zukunft der Elbe.
Der BUND hat an der Elbe zwei der vier größten Deichrückverlegungen in Deutschland umgesetzt und so 20 Prozent der Überschwemmungsflächen und naturnahen Auen geschaffen, die seit 2009 an deutschen Flüssen wieder entstanden sind. Beide Vorhaben förderte das BfN mit Mitteln des Bundesumweltministeriums aus dem Bundesnaturschutzfonds. BfN-Präsidentin Sabine Riewenherm erklärt: „Die Geschichte des BUND hier an der Elbe ist eine echte Erfolgsgeschichte: Das BUND Auenzentrum feiert sein 30-jähriges Bestehen. Aber mehr als das: Der BUND hat in den vergangenen Jahren eine Reihe von Projekten umgesetzt und eindrücklich gezeigt: Ansprüche von Naturschutz, Verkehr und Wasserwirtschaft lassen sich vereinen und gleichzeitig profitiert die nachhaltige Entwicklung der Region davon.“
Das Naturschutzgroßprojekt im Förderprogramm chance.natur mit der Deichrückverlegung ‚Lenzener Elbtalaue‘ (2002 – 2011) war deutschlandweit das erste große Vorhaben dieser Art. Die Elbe erhielt 420 Hektar ihrer ehemaligen Überschwemmungsfläche zurück, auf der ein lebendiges Mosaik aus Auenwald, Tümpeln und Offenland für viele seltene Arten wie Schwarzstorch, Fischotter, Biber oder Braunkehlchen entstanden ist. Beim Jahrhunderthochwasser 2013 hat diese Fläche maßgeblich zur Entlastung in der Region beigetragen und den Wasserspiegel spürbar abgesenkt, lokal sogar um fast 50 Zentimeter. Außerdem ist das Gebiet zu einem wichtigen Besucher*innenmagnet in der Region geworden.
Weitere 420 Hektar konnte das BUND-Auenzentrum in dem Gebiet ‚Hohe Garbe‘ im Rahmen des im Bundesprogramm Biologische Vielfalt geförderten Vorhabens „Lebendige Auen für die Elbe“ (2012-2021) zu einer naturnahen Aue entwickeln, den wertvollsten Auenwald der Region erhalten und auch hier wichtige Habitate für bedrohte Pflanzen und Tiere schaffen.
„Ich bin stolz darauf, dass es mit den Menschen vor Ort gelungen ist, die vielfältigen Interessen auszugleichen und gemeinsam diese Auen-Juwele zu entwickeln“, sagt Olaf Bandt, Vorsitzender des BUND. „Dafür haben wir das BUND-Auenzentrum auf Burg Lenzen gegründet und bedanke ich mich bei allen Beteiligten und Unterstützer*innen! Zusammen haben wir hier an der Elbe etwas sehr Wertvolles geschaffen.“
Naturnahe Auen sind die artenreichsten und seltensten Lebensräume Mitteleuropas. Sie sind unverzichtbar für den ökologischen Hochwasserschutz, da sie bei Fluten große Wassermengen zurückhalten. Außerdem sind sie wichtig für die Anpassung an den Klimawandel und den Klimaschutz. Denn bei Trockenheit geben sie gespeichertes Wasser langsam an die Umgebung ab und sie speichern große Mengen des klimaschädlichen CO2. Dies gilt insbesondere für den wertvollen Auenwald: Mit Pflanzung von über 150.000 Bäumen und Sträuchern hat das BUND-Auenzentrum daher diesen seltenen Lebensraum kontinuierlich entwickelt und über 50 Flusskilometer hinweg miteinander vernetzt.
Um die erfolgreiche Arbeit fortzusetzen, startet heute das nächste Projekt, für das die Leiterin des BUND-Auenzentrums, Meike Kleinwächter, den Förderbescheid in Empfang genommen hat: Das BfN unterstützt im Bundesprogramm Blaues Band, das gemeinsam vom Bundesumwelt- und das Bundesverkehrsministerium finanziert wird, die Voruntersuchung zur „Auenentwicklung in der brandenburgischen Elbtalaue“ mit rund 410.000 Euro. Das Projekt kombiniert die Ansprüche des Hochwasserschutzes mit der Entwicklung von Auwäldern und bringt sie in Einklang. Ziel ist es auch bei diesem Projekt, Ansätze zu entwickeln, die länderübergreifend und für andere Flussgebiete wichtige Impulse liefern können.
In der Aufnahme von © Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe - Brandenburg
Quelle
Bundesamt für Naturschutz
Konstantinstraße 110
53179 Bonn
Stand
25.10.2024
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung.Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Der BUND hat an der Elbe zwei der vier größten Deichrückverlegungen in Deutschland umgesetzt und so 20 Prozent der Überschwemmungsflächen und naturnahen Auen geschaffen, die seit 2009 an deutschen Flüssen wieder entstanden sind. Beide Vorhaben förderte das BfN mit Mitteln des Bundesumweltministeriums aus dem Bundesnaturschutzfonds. BfN-Präsidentin Sabine Riewenherm erklärt: „Die Geschichte des BUND hier an der Elbe ist eine echte Erfolgsgeschichte: Das BUND Auenzentrum feiert sein 30-jähriges Bestehen. Aber mehr als das: Der BUND hat in den vergangenen Jahren eine Reihe von Projekten umgesetzt und eindrücklich gezeigt: Ansprüche von Naturschutz, Verkehr und Wasserwirtschaft lassen sich vereinen und gleichzeitig profitiert die nachhaltige Entwicklung der Region davon.“
Das Naturschutzgroßprojekt im Förderprogramm chance.natur mit der Deichrückverlegung ‚Lenzener Elbtalaue‘ (2002 – 2011) war deutschlandweit das erste große Vorhaben dieser Art. Die Elbe erhielt 420 Hektar ihrer ehemaligen Überschwemmungsfläche zurück, auf der ein lebendiges Mosaik aus Auenwald, Tümpeln und Offenland für viele seltene Arten wie Schwarzstorch, Fischotter, Biber oder Braunkehlchen entstanden ist. Beim Jahrhunderthochwasser 2013 hat diese Fläche maßgeblich zur Entlastung in der Region beigetragen und den Wasserspiegel spürbar abgesenkt, lokal sogar um fast 50 Zentimeter. Außerdem ist das Gebiet zu einem wichtigen Besucher*innenmagnet in der Region geworden.
Weitere 420 Hektar konnte das BUND-Auenzentrum in dem Gebiet ‚Hohe Garbe‘ im Rahmen des im Bundesprogramm Biologische Vielfalt geförderten Vorhabens „Lebendige Auen für die Elbe“ (2012-2021) zu einer naturnahen Aue entwickeln, den wertvollsten Auenwald der Region erhalten und auch hier wichtige Habitate für bedrohte Pflanzen und Tiere schaffen.
„Ich bin stolz darauf, dass es mit den Menschen vor Ort gelungen ist, die vielfältigen Interessen auszugleichen und gemeinsam diese Auen-Juwele zu entwickeln“, sagt Olaf Bandt, Vorsitzender des BUND. „Dafür haben wir das BUND-Auenzentrum auf Burg Lenzen gegründet und bedanke ich mich bei allen Beteiligten und Unterstützer*innen! Zusammen haben wir hier an der Elbe etwas sehr Wertvolles geschaffen.“
Naturnahe Auen sind die artenreichsten und seltensten Lebensräume Mitteleuropas. Sie sind unverzichtbar für den ökologischen Hochwasserschutz, da sie bei Fluten große Wassermengen zurückhalten. Außerdem sind sie wichtig für die Anpassung an den Klimawandel und den Klimaschutz. Denn bei Trockenheit geben sie gespeichertes Wasser langsam an die Umgebung ab und sie speichern große Mengen des klimaschädlichen CO2. Dies gilt insbesondere für den wertvollen Auenwald: Mit Pflanzung von über 150.000 Bäumen und Sträuchern hat das BUND-Auenzentrum daher diesen seltenen Lebensraum kontinuierlich entwickelt und über 50 Flusskilometer hinweg miteinander vernetzt.
Um die erfolgreiche Arbeit fortzusetzen, startet heute das nächste Projekt, für das die Leiterin des BUND-Auenzentrums, Meike Kleinwächter, den Förderbescheid in Empfang genommen hat: Das BfN unterstützt im Bundesprogramm Blaues Band, das gemeinsam vom Bundesumwelt- und das Bundesverkehrsministerium finanziert wird, die Voruntersuchung zur „Auenentwicklung in der brandenburgischen Elbtalaue“ mit rund 410.000 Euro. Das Projekt kombiniert die Ansprüche des Hochwasserschutzes mit der Entwicklung von Auwäldern und bringt sie in Einklang. Ziel ist es auch bei diesem Projekt, Ansätze zu entwickeln, die länderübergreifend und für andere Flussgebiete wichtige Impulse liefern können.
In der Aufnahme von © Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe - Brandenburg
- Rühstädter Vorland bei Hochwasser
Quelle
Bundesamt für Naturschutz
Konstantinstraße 110
53179 Bonn
Stand
25.10.2024
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung.Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Artenschutz in Franken®
Das Waldbrettspiel (Pararge aegeria)

Waldbrettspiel (Pararge aegeria)
26/27.10.2024
Guten Tag, mein Name ist Pararge aegeria, oder wie ihr mich nennt: das Waldbrettspiel. Ich bin ein Schmetterling, der in den Wäldern Europas zuhause ist, besonders dort, wo die Sonne durch die Baumkronen flirrt und die Wärme auf den Waldboden fällt. Meine Flügel sind bräunlich-gelb mit kleinen Augenflecken – diese dienen dazu, mich vor Fressfeinden zu schützen, indem sie Vögel verwirren oder abschrecken.
26/27.10.2024
- Ich, das Waldbrettspiel (Pararge aegeria): Ein Tag in meinem Leben und Gedanken über meine Welt
Guten Tag, mein Name ist Pararge aegeria, oder wie ihr mich nennt: das Waldbrettspiel. Ich bin ein Schmetterling, der in den Wäldern Europas zuhause ist, besonders dort, wo die Sonne durch die Baumkronen flirrt und die Wärme auf den Waldboden fällt. Meine Flügel sind bräunlich-gelb mit kleinen Augenflecken – diese dienen dazu, mich vor Fressfeinden zu schützen, indem sie Vögel verwirren oder abschrecken.
Mein Lebensraum: Ein empfindliches Gleichgewicht
Wenn ich durch den Wald fliege, halte ich Ausschau nach lichtdurchfluteten Stellen, denn dort wärmt sich meine zarte Haut. Ich benötige den Wechsel aus Schatten und Sonne, um mein Wohlbefinden zu regulieren. Leider wird mein Zuhause, der Wald, immer kleiner. Abholzung und das Schrumpfen natürlicher Waldflächen zerstören die Balance, die ich so dringend brauche.Besonders im Frühjahr, wenn ich meine Eier ablege, achte ich darauf, dass es genug Kräuter und Gräser gibt, auf denen meine Raupen später fressen können. Brennnesseln oder verschiedene Süßgräser bieten ihnen Nahrung. Aber auch das wird knapper, da Wiesen intensiv bewirtschaftet werden und Wildpflanzen, die für meine Nachkommen wichtig sind, immer mehr verdrängt werden.
Bedrohungen für mich: Zerstörung und Klimawandel
Mein größter Feind ist nicht nur der Vogel, der mich jagen könnte. Es sind die Menschen, die meinen Lebensraum zerstören. Der Wald, den ich als Heimat brauche, wird durch Straßenbau, Landwirtschaft und Urbanisierung zerteilt. Doch auch der Klimawandel ist eine Gefahr: Er verändert die Temperaturen und das Wetter in meinen Wäldern. Heiße Sommer können dazu führen, dass ich nicht genug Feuchtigkeit finde, um mich zu erholen. Übermäßige Regenfälle hingegen können meine Brutplätze überfluten. Ein anderer Punkt, der mich nachdenklich macht, ist das Insektensterben. Ich sehe, wie andere Arten um mich herum verschwinden. Weniger Insekten bedeutet weniger Nahrung für die Tiere, die mich jagen, und es verändert das gesamte ökologische Gleichgewicht. Was, wenn ich eines Tages nicht mehr genug finde, um meine Nachkommen zu ernähren?
Schutzmaßnahmen: Was ihr tun könnt, um mir zu helfen
Ihr Menschen habt die Macht, mich zu schützen, und es gibt einige Dinge, die ihr tun könnt:
Ein nachdenklicher Moment: Was, wenn ich verschwinde?
Manchmal frage ich mich, was passiert, wenn ich eines Tages nicht mehr durch die Wälder flattere. Ich bin ein Teil eines größeren Ganzen, ein Zahnrad im ökologischen Uhrwerk. Mein Verschwinden würde eine Kettenreaktion auslösen – Vögel hätten weniger Nahrung, Pflanzen würden nicht mehr bestäubt, und der Kreislauf des Lebens würde gestört werden.Ihr Menschen seid ebenfalls Teil dieses Kreislaufs. Euer Wohlstand hängt von der Gesundheit der Natur ab. Wenn der Wald stirbt, sterbt ihr mit ihm – vielleicht nicht sofort, aber allmählich. In einer Welt ohne Schmetterlinge, ohne summende Bienen und zwitschernde Vögel, wäre auch euer Leben ärmer, weniger erfüllt.
Ein Appell an euch: Achtet auf mich, denn ich achte auf euch
Denkt daran, dass ich nicht nur ein kleiner Schmetterling bin. Ich bin ein Bote der Natur, der euch zeigt, wie es um die Gesundheit eurer Wälder und Felder steht. Wenn ihr mich fliegen seht, dann bedeutet das, dass noch Hoffnung besteht, dass die Natur um euch herum im Gleichgewicht ist. Wenn ich aber verschwinde, dann schwindet auch diese Hoffnung. Schützt mich, indem ihr meine Heimat respektiert und bewahrt. Nur so können wir beide – ihr und ich – in einer gesunden und florierenden Welt weiterleben.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
Wenn ich durch den Wald fliege, halte ich Ausschau nach lichtdurchfluteten Stellen, denn dort wärmt sich meine zarte Haut. Ich benötige den Wechsel aus Schatten und Sonne, um mein Wohlbefinden zu regulieren. Leider wird mein Zuhause, der Wald, immer kleiner. Abholzung und das Schrumpfen natürlicher Waldflächen zerstören die Balance, die ich so dringend brauche.Besonders im Frühjahr, wenn ich meine Eier ablege, achte ich darauf, dass es genug Kräuter und Gräser gibt, auf denen meine Raupen später fressen können. Brennnesseln oder verschiedene Süßgräser bieten ihnen Nahrung. Aber auch das wird knapper, da Wiesen intensiv bewirtschaftet werden und Wildpflanzen, die für meine Nachkommen wichtig sind, immer mehr verdrängt werden.
Bedrohungen für mich: Zerstörung und Klimawandel
Mein größter Feind ist nicht nur der Vogel, der mich jagen könnte. Es sind die Menschen, die meinen Lebensraum zerstören. Der Wald, den ich als Heimat brauche, wird durch Straßenbau, Landwirtschaft und Urbanisierung zerteilt. Doch auch der Klimawandel ist eine Gefahr: Er verändert die Temperaturen und das Wetter in meinen Wäldern. Heiße Sommer können dazu führen, dass ich nicht genug Feuchtigkeit finde, um mich zu erholen. Übermäßige Regenfälle hingegen können meine Brutplätze überfluten. Ein anderer Punkt, der mich nachdenklich macht, ist das Insektensterben. Ich sehe, wie andere Arten um mich herum verschwinden. Weniger Insekten bedeutet weniger Nahrung für die Tiere, die mich jagen, und es verändert das gesamte ökologische Gleichgewicht. Was, wenn ich eines Tages nicht mehr genug finde, um meine Nachkommen zu ernähren?
Schutzmaßnahmen: Was ihr tun könnt, um mir zu helfen
Ihr Menschen habt die Macht, mich zu schützen, und es gibt einige Dinge, die ihr tun könnt:
- Schaffung von Waldrändern und Waldlichtungen: Wenn ihr den Wald so gestaltet, dass es genügend sonnige Lichtungen und Waldränder gibt, bleibt mein Lebensraum intakt. Auch der Verzicht auf intensive Forstwirtschaft in bestimmten Gebieten hilft, den Wald naturnah zu erhalten.
- Weniger Einsatz von Pestiziden: Pestizide schaden mir und meinen Raupen. Wenn ihr auf den Einsatz von Chemikalien in der Landwirtschaft und im Gartenbau verzichtet, haben meine Kinder eine bessere Überlebenschance.
- Förderung der biologischen Vielfalt: Wenn ihr in Gärten und Parks mehr Wildblumen anpflanzt und diese wachsen lasst, helft ihr nicht nur mir, sondern auch anderen Insekten. Je vielfältiger die Pflanzenwelt ist, desto besser für uns alle.
- Schutz von Grünflächen und Wäldern: Ihr könnt euch dafür einsetzen, dass mehr Wälder unter Naturschutz gestellt werden. So bleibt mein Zuhause intakt. Auch der Kampf gegen den Klimawandel ist wichtig, denn nur so können die Bedingungen für meine Art stabil bleiben.
Ein nachdenklicher Moment: Was, wenn ich verschwinde?
Manchmal frage ich mich, was passiert, wenn ich eines Tages nicht mehr durch die Wälder flattere. Ich bin ein Teil eines größeren Ganzen, ein Zahnrad im ökologischen Uhrwerk. Mein Verschwinden würde eine Kettenreaktion auslösen – Vögel hätten weniger Nahrung, Pflanzen würden nicht mehr bestäubt, und der Kreislauf des Lebens würde gestört werden.Ihr Menschen seid ebenfalls Teil dieses Kreislaufs. Euer Wohlstand hängt von der Gesundheit der Natur ab. Wenn der Wald stirbt, sterbt ihr mit ihm – vielleicht nicht sofort, aber allmählich. In einer Welt ohne Schmetterlinge, ohne summende Bienen und zwitschernde Vögel, wäre auch euer Leben ärmer, weniger erfüllt.
Ein Appell an euch: Achtet auf mich, denn ich achte auf euch
Denkt daran, dass ich nicht nur ein kleiner Schmetterling bin. Ich bin ein Bote der Natur, der euch zeigt, wie es um die Gesundheit eurer Wälder und Felder steht. Wenn ihr mich fliegen seht, dann bedeutet das, dass noch Hoffnung besteht, dass die Natur um euch herum im Gleichgewicht ist. Wenn ich aber verschwinde, dann schwindet auch diese Hoffnung. Schützt mich, indem ihr meine Heimat respektiert und bewahrt. Nur so können wir beide – ihr und ich – in einer gesunden und florierenden Welt weiterleben.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- bei Spaziergängen sehe ich die Männchen manchmal an und neben den Wegen sitzen, sie beobachten und sind territorial Versuchen andere Männchen zu vertreiben. Sind gut getarnt u. werden meist erst wahr genommen, wenn sie auffliegen. Meines Wissens sind sie auch die einzigen Falter die mitten im Wald zu finden sind, wenn lichte Stellen vorhanden sind.
- Ein Edelfalter, Tagfalter aus der Unterfamilie der Augenfalter. Er ist an Wegen u. auf Lichtungen im lichten Wald, oder in der Nähe des Waldes zu finden. Hier ein Weibchen, sie sind etwas größer u. die Augenzeichnungen sind kräftiger, ausgeprägter. Außerdem sind fast alle Falter durch den runderen Hinterleib der Weibchen unterscheidbar. Bei Männchen geht das Abdomen (Hinterleib) in der Regel gerade nach hinten
Artenschutz in Franken®
Ich bin die Wanderratte (Rattus norvegicus) ... Teil II

Wanderratte (Rattus norvegicus) -- der Nachwuchs ist eingetroffen ... über 30 neue Aufnahmen zu diesem Thema im Laufe dieses Tages hier auf unserer Internetpräsenz!
24/25.10.2024
Wusstest du, dass wir Wanderratten die Cousins der Hausratte sind? Aber im Gegensatz zu den zarten Hausratten, die eher Höhenflüge machen und gerne auf Dachböden wohnen, bin ich eine richtige Abenteurerin des Untergrunds! Ich bin überall dort, wo es dunkel, feucht und gemütlich ist - also in Kanalisationen, Kellern und Müllhalden. Klingt nicht glamourös? Na, dann warte ab!
24/25.10.2024
- Hallo! Ich bin die Wanderratte (Rattus norvegicus) - besser bekannt als "Wanderratte", obwohl ich eigentlich gar nicht so viel wandere.
Wusstest du, dass wir Wanderratten die Cousins der Hausratte sind? Aber im Gegensatz zu den zarten Hausratten, die eher Höhenflüge machen und gerne auf Dachböden wohnen, bin ich eine richtige Abenteurerin des Untergrunds! Ich bin überall dort, wo es dunkel, feucht und gemütlich ist - also in Kanalisationen, Kellern und Müllhalden. Klingt nicht glamourös? Na, dann warte ab!
Mein Aussehen und Stil
Ich bin ein echter Kraftprotz, ungefähr 20 bis 30 cm lang, und dann kommt noch mein beeindruckender Schwanz dazu. Der ist fast genauso lang! Im Gegensatz zu den schicken Farbratten, die manchmal bei euch Menschen wohnen und in allen möglichen Farben daherkommen, halte ich es eher klassisch: Braun bis Grau, mit einem Hauch von Understatement.Und ja, manche sagen, mein Schwanz sieht ein bisschen eklig aus – haarlos und schuppig. Aber ehrlich, ohne ihn wäre ich ein richtiges Balance-Desaster. Er hilft mir dabei, auf den schmalsten Rohren zu balancieren und enge Kurven zu nehmen, wenn ich vor Gefahr flüchte.
Unsere Vorliebe für Abenteuer (und Snacks!)
Warum nennen mich Menschen eine "Wanderratte"? Wahrscheinlich, weil wir immer auf der Suche nach dem nächsten Abenteuer sind – oder besser gesagt: dem nächsten leckeren Snack! Wir sind echte Gourmets: Müll, Abfälle, Getreide, Früchte, Insekten, sogar mal ein bisschen Fleisch – alles ist auf meiner Speisekarte! Ihr nennt es "Müll", wir nennen es Buffet. Meine Freunde und ich können uns an fast jedes Umfeld anpassen. Egal, ob Stadt oder Land, feuchte Keller oder trockene Felder – wir sind überall, wo es was zu fressen gibt. Wusstest du, dass wir in Großstädten wie Berlin oder New York die wahren Herrscher der Kanalisation sind? Ja, ihr Menschen denkt vielleicht, die Stadt gehört euch, aber da unten sind wir die Chefs.
Unser Sozialleben – Mehr als nur „Rattenschwanz“
Wir sind sehr soziale Tiere, ja wirklich! Wir leben in Gruppen, die sich sogenannte Kolonien nennen. Da gibt es klare Regeln und Strukturen, ähnlich wie in eurer menschlichen Gesellschaft. Wir kümmern uns umeinander, teilen Futter, und manchmal kuscheln wir sogar zusammen, um uns warmzuhalten. Zugegeben, wir sind vielleicht nicht die besten Mitbewohner – wir haben ein bisschen die Angewohnheit, Kabel anzuknabbern und Löcher in Wände zu nagen, aber hey, man kann nicht alles haben, oder?
Schneller, schlauer, stärker – die Superkräfte der Wanderratte
Du denkst vielleicht, wir sind klein und schwach, aber wir haben echte Superkräfte! Erstens, ich bin eine Schwimm-Meisterin. Ich kann kilometerweit durch Abwasserrohre schwimmen und unter Wasser meinen Atem mehrere Minuten anhalten. Wenn wir schwimmen, sieht das vielleicht nicht so elegant aus wie bei einem Delfin, aber hey, wir schaffen’s ans Ziel. Dann sind wir auch noch wahre Sprungtalente! Ich kann bis zu einem Meter hochspringen. Das ist so, als würde ein Mensch mal eben auf das Dach eines Hauses hüpfen. Und schließlich bin ich eine Weltmeisterin im Nagen: Mit meinen kräftigen Zähnen kann ich mich durch Holz, Plastik und sogar Beton beißen – kein Wunder, dass wir uns oft unbeliebt machen. Aber wenn man Hunger hat, muss man eben kreativ werden!
Die Liebe und das Leben – Ratting mit Herz
Eine kleine Anekdote: Wanderratten sind romantischer, als man denkt. Ein Pärchen bleibt oft sein ganzes Leben zusammen und zieht gemeinsam die Jungen auf. Und Junge, da sind wir produktiv! Ein Weibchen kann bis zu 7 Mal im Jahr Nachwuchs bekommen, mit jeweils 6 bis 12 Babys. Richtig gerechnet? Ja, das sind über 80 Rattenkinder pro Jahr – wir sind also eine wahre Großfamilie!
Die Sache mit den Krankheiten...
Okay, jetzt ein ernstes Thema: Ja, wir sind bekannt dafür, manchmal Krankheiten zu übertragen. Die Geschichte mit der Pest ist zwar schon ziemlich alt (und das waren hauptsächlich unsere Verwandten, die Schwarzen Ratten!), aber wir wissen, dass Menschen bei uns vorsichtig sind. Aber wir sind doch keine Ungeheuer! Wenn ihr einfach euren Müll sicher entsorgt und nicht alles liegen lasst, gibt’s auch weniger Probleme zwischen uns.
Ratten und Menschen – Eine lange Geschichte
Am Ende des Tages bin ich eigentlich stolz darauf, dass wir so erfolgreich überlebt haben – trotz aller menschlichen Versuche, uns loszuwerden. Manche von euch mögen uns nicht, aber wir sind eben anpassungsfähig und clever. In gewisser Weise sind wir und die Menschen sich sehr ähnlich: Wir lieben Gesellschaft, wir suchen nach Ressourcen, und wir sind bereit, für unser Überleben alles zu tun.
Also, das nächste Mal, wenn du eine von uns siehst – denk daran, wir sind mehr als nur „Ungeziefer“. Wir sind Überlebenskünstler mit einem großen Appetit auf Abenteuer! Bis bald (vielleicht unter deinem Müllcontainer)!
In der Aufnahme von Helga Zinnecker
Ich bin ein echter Kraftprotz, ungefähr 20 bis 30 cm lang, und dann kommt noch mein beeindruckender Schwanz dazu. Der ist fast genauso lang! Im Gegensatz zu den schicken Farbratten, die manchmal bei euch Menschen wohnen und in allen möglichen Farben daherkommen, halte ich es eher klassisch: Braun bis Grau, mit einem Hauch von Understatement.Und ja, manche sagen, mein Schwanz sieht ein bisschen eklig aus – haarlos und schuppig. Aber ehrlich, ohne ihn wäre ich ein richtiges Balance-Desaster. Er hilft mir dabei, auf den schmalsten Rohren zu balancieren und enge Kurven zu nehmen, wenn ich vor Gefahr flüchte.
Unsere Vorliebe für Abenteuer (und Snacks!)
Warum nennen mich Menschen eine "Wanderratte"? Wahrscheinlich, weil wir immer auf der Suche nach dem nächsten Abenteuer sind – oder besser gesagt: dem nächsten leckeren Snack! Wir sind echte Gourmets: Müll, Abfälle, Getreide, Früchte, Insekten, sogar mal ein bisschen Fleisch – alles ist auf meiner Speisekarte! Ihr nennt es "Müll", wir nennen es Buffet. Meine Freunde und ich können uns an fast jedes Umfeld anpassen. Egal, ob Stadt oder Land, feuchte Keller oder trockene Felder – wir sind überall, wo es was zu fressen gibt. Wusstest du, dass wir in Großstädten wie Berlin oder New York die wahren Herrscher der Kanalisation sind? Ja, ihr Menschen denkt vielleicht, die Stadt gehört euch, aber da unten sind wir die Chefs.
Unser Sozialleben – Mehr als nur „Rattenschwanz“
Wir sind sehr soziale Tiere, ja wirklich! Wir leben in Gruppen, die sich sogenannte Kolonien nennen. Da gibt es klare Regeln und Strukturen, ähnlich wie in eurer menschlichen Gesellschaft. Wir kümmern uns umeinander, teilen Futter, und manchmal kuscheln wir sogar zusammen, um uns warmzuhalten. Zugegeben, wir sind vielleicht nicht die besten Mitbewohner – wir haben ein bisschen die Angewohnheit, Kabel anzuknabbern und Löcher in Wände zu nagen, aber hey, man kann nicht alles haben, oder?
Schneller, schlauer, stärker – die Superkräfte der Wanderratte
Du denkst vielleicht, wir sind klein und schwach, aber wir haben echte Superkräfte! Erstens, ich bin eine Schwimm-Meisterin. Ich kann kilometerweit durch Abwasserrohre schwimmen und unter Wasser meinen Atem mehrere Minuten anhalten. Wenn wir schwimmen, sieht das vielleicht nicht so elegant aus wie bei einem Delfin, aber hey, wir schaffen’s ans Ziel. Dann sind wir auch noch wahre Sprungtalente! Ich kann bis zu einem Meter hochspringen. Das ist so, als würde ein Mensch mal eben auf das Dach eines Hauses hüpfen. Und schließlich bin ich eine Weltmeisterin im Nagen: Mit meinen kräftigen Zähnen kann ich mich durch Holz, Plastik und sogar Beton beißen – kein Wunder, dass wir uns oft unbeliebt machen. Aber wenn man Hunger hat, muss man eben kreativ werden!
Die Liebe und das Leben – Ratting mit Herz
Eine kleine Anekdote: Wanderratten sind romantischer, als man denkt. Ein Pärchen bleibt oft sein ganzes Leben zusammen und zieht gemeinsam die Jungen auf. Und Junge, da sind wir produktiv! Ein Weibchen kann bis zu 7 Mal im Jahr Nachwuchs bekommen, mit jeweils 6 bis 12 Babys. Richtig gerechnet? Ja, das sind über 80 Rattenkinder pro Jahr – wir sind also eine wahre Großfamilie!
Die Sache mit den Krankheiten...
Okay, jetzt ein ernstes Thema: Ja, wir sind bekannt dafür, manchmal Krankheiten zu übertragen. Die Geschichte mit der Pest ist zwar schon ziemlich alt (und das waren hauptsächlich unsere Verwandten, die Schwarzen Ratten!), aber wir wissen, dass Menschen bei uns vorsichtig sind. Aber wir sind doch keine Ungeheuer! Wenn ihr einfach euren Müll sicher entsorgt und nicht alles liegen lasst, gibt’s auch weniger Probleme zwischen uns.
Ratten und Menschen – Eine lange Geschichte
Am Ende des Tages bin ich eigentlich stolz darauf, dass wir so erfolgreich überlebt haben – trotz aller menschlichen Versuche, uns loszuwerden. Manche von euch mögen uns nicht, aber wir sind eben anpassungsfähig und clever. In gewisser Weise sind wir und die Menschen sich sehr ähnlich: Wir lieben Gesellschaft, wir suchen nach Ressourcen, und wir sind bereit, für unser Überleben alles zu tun.
Also, das nächste Mal, wenn du eine von uns siehst – denk daran, wir sind mehr als nur „Ungeziefer“. Wir sind Überlebenskünstler mit einem großen Appetit auf Abenteuer! Bis bald (vielleicht unter deinem Müllcontainer)!
In der Aufnahme von Helga Zinnecker
- Wanderratten Nachwuchs an der Vogel Futterstelle ..
Artenschutz in Franken®
Der Minzblattkäfer (Chrysolina herbacea)

Der Minzblattkäfer erzählt seine Geschichte
27/28.10.2024
Ich lebe am liebsten auf Minzpflanzen. Die haben so leckere Blätter, saftig und erfrischend, das ist mein absolutes Lieblingsessen! Eigentlich esse ich fast den ganzen Tag. Mit meinem kräftigen Kiefer kann ich die Blätter wunderbar zerkleinern. Dabei lasse ich Löcher in den Blättern, das sieht vielleicht nicht so schön aus, aber für mich ist es perfekt.
27/28.10.2024
- Hallo, ich bin der Minzblattkäfer – aber du kannst mich einfach „Chrysolina herbacea“ nennen, wenn du magst. Ich bin gar nicht so groß, etwa 6 bis 8 Millimeter lang, aber in der Welt der Blätter bin ich ein echter Star. Besonders die Minze – oh, die liebe ich!
Ich lebe am liebsten auf Minzpflanzen. Die haben so leckere Blätter, saftig und erfrischend, das ist mein absolutes Lieblingsessen! Eigentlich esse ich fast den ganzen Tag. Mit meinem kräftigen Kiefer kann ich die Blätter wunderbar zerkleinern. Dabei lasse ich Löcher in den Blättern, das sieht vielleicht nicht so schön aus, aber für mich ist es perfekt.
- In einem interessanten Gespräch zwischen einem Kind und seinen Eltern möchten wir euch und Ihnen diese Art mal etwas näher bringen und auch der Minzblattkäfer schaltet sich in das Gespräch hie und da mit ein ... viel Spaß
Kind: "Mama, Papa, schaut mal, dieser glänzende Käfer auf der Minze! Er sieht aus wie ein Edelstein!"
Eltern: "Ja, das ist ein Minzblattkäfer. Sein Panzer ist metallisch grün bis golden, manchmal auch blau – ganz schillernd in der Sonne."
Kind: "Was macht er da? Er frisst die Blätter! Das ist doch nicht gut für unsere Minze, oder?"
Eltern: "Stimmt, er frisst die Blätter, weil Minze sein Lieblingsessen ist. Er gehört zu den Blattkäfern und hat sich ganz auf diese Pflanze spezialisiert."
Minzblattkäfer, der plötzlich mitredet: „Ja, genau! Minze ist einfach das Beste für mich. Ich brauche sie, um mich stark zu fühlen und meine Eier zu legen. Ich bin gar nicht so böse, wie ihr vielleicht denkt. Ohne Minze kann ich gar nicht überleben!“ Weißt du, wie ich es schaffe, in so glänzenden Farben zu leuchten?
Mein Panzer hat eine besondere Struktur, die das Licht in alle möglichen Farben bricht. Für dich sehe ich vielleicht wie ein kleiner Edelstein aus, aber eigentlich ist das ein Trick, um Fressfeinde zu verwirren! Wenn ein Vogel mich sieht, denkt er vielleicht, ich sei kein gutes Futter, sondern nur ein schillernder Fleck. Und übrigens – nicht nur ich liebe Minze. Meine Larven, die kleinen Babys, tun es auch. Die schlüpfen aus den Eiern, die ich sorgfältig auf die Blätter der Minze lege, und fressen dann ebenfalls die zarten Blätter, bis sie groß und stark werden.
Kind: "Und schadet das der Minze sehr? Können wir den Käfer einfach wegnehmen?"
Eltern: "Ja, der Käfer kann Minzpflanzen schwächen, besonders wenn es viele von ihnen gibt. Aber er gehört zur Natur dazu, und wenn wir unsere Minze pflegen und sie stark bleibt, kann sie das schon aushalten. Käfer wie er spielen eine wichtige Rolle im Ökosystem."
Minzblattkäfer: "Genau! Ich bin nicht hier, um eure ganze Minze zu zerstören, sondern nur, um meinen Lebenszyklus zu leben. In der Natur ist alles verbunden – was ich esse, hilft anderen Lebewesen, und vielleicht fressen manche mich wiederum. So ist das Leben!"
Und während ich weiter an einem frischen Minzblatt knabbere, flüstere ich dir noch ein Geheimnis zu: Manchmal, wenn es für mich zu viele Feinde gibt oder die Pflanze zu wenig Nahrung hat, kann ich mir einen anderen Platz suchen. Aber meistens bleibe ich dort, wo die Minze besonders lecker ist. Also, wenn du mich auf deiner Pflanze siehst, denk daran, ich bin einfach nur ein kleines Wesen, das versucht, zu überleben – genau wie du!
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- Minzblattkäfer (Chrysolina herbacea)
Artenschutz in Franken®
Vom Trafohaus zur Stele der Biodiversität®

Vom Trafohaus zur Stele der Biodiversität®
26/27.10.2024
Burgwindheim / Bayern. Stelen bundesdeutscher Biodiversität, so der zugegeben etwas sperrige Titel für ein in dieser Form einmaliges Entwicklungskonzept des Artenschutzes in Franken®. Im Fokus stehen dabei Bauwerke, die viele Jahre für den Menschen unverzichtbar waren, jedoch meist ein Schattendasein führten, obwohl diese voller Energie steckten. Trafotürme oder auch Trafohäuser wurden sie landläufig genannt.
26/27.10.2024
- Ein bislang in dieser Form in Deutschland wohl einzigartiges Konzept stellt sich in einer kurzen Feierstunde projektausgerichtet erneut der breiten Öffentlichkeit vor.
Burgwindheim / Bayern. Stelen bundesdeutscher Biodiversität, so der zugegeben etwas sperrige Titel für ein in dieser Form einmaliges Entwicklungskonzept des Artenschutzes in Franken®. Im Fokus stehen dabei Bauwerke, die viele Jahre für den Menschen unverzichtbar waren, jedoch meist ein Schattendasein führten, obwohl diese voller Energie steckten. Trafotürme oder auch Trafohäuser wurden sie landläufig genannt.
Oasen des (Über) – Lebens
Doch gerade in den vergangenen Jahren verloren diese Kulturgüter mehr und mehr an Bedeutung. Technische Änderungen führten dazu, dass zahlreiche der Gebäude abgerissen wurden und es auch heute noch immer werden. Mit jedem Abbruch verlieren wir auch ein unwiederbringliches Zeitzeugnis, unserer urbanen Lebensweise. Hier und da standen die Häuschen in Strukturen, die mit ihnen in einen langen, gemeinsamen Dornröschenschlaf verfielen. Im eigentlichen Sinn bilden diese Kleinbaukörper, bei einer entsprechend durchdachten und durchgeplanten Nutzungsänderung, wiederkehrend hochwertige Ökosysteme inmitten zunehmend strukturarmer Bereiche ab.
Gemeinsam für mehr sichtbaren Artenschutz und Umweltbildung.
Artenschutz in Franken®, Bayernwerk AG, Markt Burgwindheim, Turmstationen Deutschland e.V., Steuerkanzlei Bauerfeind und Deutsche Postcode Lotterie erweckten vor wenigen Tagen ein altes, vormaliges Trafohaus in der Gemeinde Burgwindheim GT-Kötsch aus seinem (ökologischen) Ruhezustand. In den vergangenen zwei Monaten wurde, nach einer über einjährigen Vorbereitungsphase, der Baukörper großzügig umgestaltet und so zu einer „Stele der Biodiversität®“ umfunktioniert. Ausgestattet mit speziellen, teilweise eigenentwickelten Sekundärhabitaten, die in und auf die Fassade, sowie in den Dachstuhl des Gebäudes integriert wurden, bietet das Gebäude nun nachhaltig hochwertige Lebens- und Fortpflanzungsräume, auch für im Bestand gefährdete Tierarten. Vornehmlich für Spezies welche den Menschen gar seit vielen Jahrhunderten als sogenannte Kulturfolger eng begleiten. Diese Koexistenz kündigt der Mensch seit geraumer Zeit auf. Mit diesem erschreckenden Vorgang verlieren diese gleichfalls unsere Gesellschaftsform prägenden Kulturfolger ihre Lebensgrundlage, da überlebensrelevante Fortpflanzungs- und Nahrungsbereiche verschwinden. Wir als „Gattung“ Mensch verlieren damit ebenfalls den direkten Kontakt zur Umwelt sowie zu unseren Mitgeschöpfen, die ein wichtiger Teil unseres Lebensbereiches sind. Im Detail konnten hier, am vormals artenfern strukturierten „Türmchen“, vielfältige (Überlebens) - Strukturen geschaffen werden um beispielsweise Fledermäusen, Turmfalken, Mehlschwalben oder auch Mauerseglern geeignete, bewusst reproduktionszugeordnete Strukturen anzubieten. Wie begehrt diese Einrichtungen sind, zeigt die teilweise Besiedlung dergleichen bereits während der Umgestaltungsphase.
Umweltbildung vermitteln.
Der ehemalige Trafoturm informiert ferner durch eine multimediale Projektinformation, die am Bauwerk angebracht ist, weiterführend über wichtige Projektinhalte. Über ein „Get-it“ System, sowie der entsprechenden Internetanbindung soll es auch gelingen, die „Smartphone- und Tablet-Generation“ für den Erhalt der ökologischen und kulturellen Vielfalt zu begeistern. An Standorten wie diesem hier in Stegaurach kann es der Aktuellen, jedoch auch der uns nachfolgenden Generation noch möglich sein, Wildtiere in ihren natürlichen, kulturfolgenden Verhaltensmustern zu erleben.
Eye Catcher – grafische Baukörpergestaltung
Als wahrer Eye Catcher stellt sich die Stele der Biodiversität® durch die künstlerische Baukörpergestaltung dar. Die Fassade des Bauwerks wurde aufwendig grafisch gestaltet und taucht in eine ganz eigene Welt ein, gerade um die Fantasie der Kinder anzuregen. Für Erwachsene bieten sich gleichfalls nicht alltägliche Perspektiven. Mit der hier gewählten Gestaltungsform möchten wir den Baukörper jedoch auch als Mahnmal verstanden wissen. Denn mit unserem Wirken tragen wir als Gesellschaft unmittelbar zum Niedergang der Biodiversität bei. Was wir alles Verlieren erkennen wir teilweise auf der Baukörperfassade und so kann dieser Ansatz auch einen wichtigen Beitrag leisten uns zunehmend um die Erhaltung der Artenvielfalt, im ureigenen Interesse zu bemühen.
Ein Netz der Biodiversität legt sich über das Land.
Das Projekt Stelen der Biodiversität®, dass durch die vollkommen ehrenamtlich agierende Organisation Artenschutz in Franken® federführend betreut wird, hat es sich zum Ziel gesetzt, ein Netz dieses Projektansatzes über das Land zu legen. Und so reiht sich das Projekt in eine Aufeinanderfolge von erfolgreichen Projektbausteinen ein, die sich bereits an anderer Stelle in Bayern, sowie in zahlreichen anderen Bundesländer Deutschlands wiederfinden.
Als offizielles Projekt der UN Dekade Biologische Vielfalt mehrfach ausgezeichnet, wird der hohen inhaltlichen Qualität des Konzepts Rechnung getragen.
In der Aufnahme
- Nachdem der Baukörper vom Außen- Schutz- und Montagegerüst befreit wurde, konnte die spezielle Schleiereulen - Turmfalkennisthilfe im Baukörperinnenraum eingebaut werden, ... hierzu wurde ein Innengerüst benötigt!
Artenschutz in Franken®
Die Ameisenwanze (Myrmecoris gracilis)

Aus der möglichen Perspektive einer Ameisenwanze geschrieben ...
27/28.10.2024
Stell dir vor, du gehst auf eine Party, alle sind als Superhelden verkleidet, und du kommst als Ameise. Genau so lebt diese Wanze ihren Alltag. Sie ist schlank und bewegt sich mit einem geheimen Plan durch das Ameisenvolk, ohne dass jemand wirklich merkt, dass sie anders ist – zumindest für eine Weile.
27/28.10.2024
- Die Ameisenwanze (Myrmecoris gracilis) ist wie ein kleiner Wicht, der sich für eine Ameise hält, aber eigentlich eine verkleidete Wanze ist.
Stell dir vor, du gehst auf eine Party, alle sind als Superhelden verkleidet, und du kommst als Ameise. Genau so lebt diese Wanze ihren Alltag. Sie ist schlank und bewegt sich mit einem geheimen Plan durch das Ameisenvolk, ohne dass jemand wirklich merkt, dass sie anders ist – zumindest für eine Weile.
Warum tut sie das? Weil Ameisen harte Arbeiter sind, im Team leben, und sie geben einem das Gefühl, Teil einer coolen Gang zu sein. „Hey, schaut mich an, ich bin auch so fleißig wie ihr!“ Aber in Wirklichkeit hat die Ameisenwanze einen Trick auf Lager: Sie ist ein Opportunist, ein kleiner "Schlawiner", der die Vorteile des Ameisenlebens nutzt, ohne wirklich mitzumachen.
Aber hier kommt der nachdenkliche Teil: Die Ameisenwanze ist ein Meister des Überlebens. Sie lebt in einer Welt, die oft gnadenlos und gefährlich ist. Ameisenstämme sind stark und gut organisiert, und wenn man so klein und wehrlos ist wie die Ameisenwanze, hilft es, sich ein wenig anzupassen – ein bisschen Tarnung hier, ein bisschen Ameisen-Imitation dort.
Das Leben ist manchmal wie ein Ameisenhaufen, in dem wir alle aufeinanderhocken und versuchen, uns durchzuschlagen. Manchmal machen wir mit, manchmal tun wir nur so, als ob wir dazugehören. Die Ameisenwanze erinnert uns daran, dass man auch dann klug überleben kann, wenn man nicht der Stärkste oder Schnellste ist – manchmal reicht es, sich einfach anzupassen, mit ein wenig List und einem unschuldigen Gesichtsausdruck.
Und wer weiß, vielleicht haben wir alle ein bisschen Ameisenwanze in uns: Manchmal fühlen wir uns, als müssten wir uns verstecken oder eine Rolle spielen, um nicht aus dem Ameisenhaufen geworfen zu werden. Aber am Ende geht es darum, schlau zu sein und das Beste aus dem Leben zu machen, selbst wenn man sich in einer Ameisenwelt befindet.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
Aber hier kommt der nachdenkliche Teil: Die Ameisenwanze ist ein Meister des Überlebens. Sie lebt in einer Welt, die oft gnadenlos und gefährlich ist. Ameisenstämme sind stark und gut organisiert, und wenn man so klein und wehrlos ist wie die Ameisenwanze, hilft es, sich ein wenig anzupassen – ein bisschen Tarnung hier, ein bisschen Ameisen-Imitation dort.
Das Leben ist manchmal wie ein Ameisenhaufen, in dem wir alle aufeinanderhocken und versuchen, uns durchzuschlagen. Manchmal machen wir mit, manchmal tun wir nur so, als ob wir dazugehören. Die Ameisenwanze erinnert uns daran, dass man auch dann klug überleben kann, wenn man nicht der Stärkste oder Schnellste ist – manchmal reicht es, sich einfach anzupassen, mit ein wenig List und einem unschuldigen Gesichtsausdruck.
Und wer weiß, vielleicht haben wir alle ein bisschen Ameisenwanze in uns: Manchmal fühlen wir uns, als müssten wir uns verstecken oder eine Rolle spielen, um nicht aus dem Ameisenhaufen geworfen zu werden. Aber am Ende geht es darum, schlau zu sein und das Beste aus dem Leben zu machen, selbst wenn man sich in einer Ameisenwelt befindet.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- Ameisenwanze (Myrmecoris gracilis)
Artenschutz in Franken®
Die Wacholderdrossel (Turdus pilaris)

Wacholderdrossel (Turdus pilaris)
25/26.10.2024
Ich bin ein Vogel, der in den Wäldern und Gärten Europas und Asiens zu Hause ist. Mit meinem grau-braunen Gefieder und meinem auffälligen gelb-schwarz gesprenkelten Brustbereich falle ich vielleicht nicht sofort auf, aber glaubt mir, ich habe Charisma – und ich bin ein echter Teamplayer.
Wir Drosseln sind nämlich sehr gesellig und bewegen uns oft in großen Trupps. Was soll ich sagen? Es macht eben mehr Spaß, gemeinsam durch die Gegend zu ziehen und die besten Futterstellen abzugrasen!
25/26.10.2024
- Hallo, ich bin die Wacholderdrossel (Turdus pilaris) und ich erzähle euch ein bisschen über mich!
Ich bin ein Vogel, der in den Wäldern und Gärten Europas und Asiens zu Hause ist. Mit meinem grau-braunen Gefieder und meinem auffälligen gelb-schwarz gesprenkelten Brustbereich falle ich vielleicht nicht sofort auf, aber glaubt mir, ich habe Charisma – und ich bin ein echter Teamplayer.
Wir Drosseln sind nämlich sehr gesellig und bewegen uns oft in großen Trupps. Was soll ich sagen? Es macht eben mehr Spaß, gemeinsam durch die Gegend zu ziehen und die besten Futterstellen abzugrasen!
Fachlich und Kulturell: Ein Steckbrief von mir
Ich gehöre zur Familie der Drosseln (Turdidae) und liebe es, in Wiesen, Feldern und Wäldern nach Nahrung zu suchen. Mein lateinischer Name Turdus pilaris klingt ein bisschen wie ein Zauberspruch, nicht wahr? Vielleicht liegt das daran, dass ich im Frühling und Sommer gerne durch die Lüfte schwebe und ein bisschen Magie verbreite.Ich habe ein vielseitiges Menü: Im Frühling und Sommer bin ich ein Insektenjäger, im Winter freue ich mich über Beeren, besonders Wacholderbeeren – da kommt auch mein Name her.
Diese leckeren Beeren sind nicht nur gesund, sondern geben mir auch ordentlich Energie für die kalte Jahreszeit. Man könnte sagen, sie sind mein "Superfood". In der Vergangenheit wurde ich sogar in der Kunst und Kultur verewigt. Zum Beispiel tauche ich in manchen europäischen Volksmärchen als ein cleverer und widerstandsfähiger Vogel auf, der sich gegen widrige Umstände durchsetzt – ob das nun Raubvögel, Jäger oder kalte Winter sind. Ihr müsst wissen, wir sind ziemlich hart im Nehmen und trotzen dem Wetter. Selbst wenn der Schnee fällt, bleibe ich tapfer auf der Suche nach meinem nächsten Snack.
Meine lustige Seite: Die Kunst der "Kacke"
Jetzt, wo wir uns ein bisschen besser kennen, erzähle ich euch noch etwas Lustiges über mich und meine Freunde. Wir Wacholderdrosseln haben eine besondere Verteidigungsstrategie gegen Raubtiere, insbesondere gegen größere Vögel wie Krähen. Wir spucken ihnen quasi ins Gesicht – okay, genauer gesagt kacken wir auf sie! Wenn ein Feind uns oder unsere Nester angreift, starten wir einen koordinierten Angriff und werfen unseren Kot in die Richtung des Eindringlings.
Eine klebrige Überraschung! Das vertreibt nicht nur die Angreifer, sondern verschafft uns auch den Ruf als ziemlich schlaue (und vielleicht ein bisschen freche) Vögel.
Diese "Bombardement-Taktik" ist unter Vogelfreunden schon fast legendär. Manchmal bekomme ich das Gefühl, dass wir Drosseln uns damit brüsten. Stell dir vor: "Hey, gestern hab ich eine Elster getroffen und sie hat sich nicht mehr eingekriegt – treffsicher wie ich bin, hab ich sie voll erwischt!"
Mein Nest: Heimatgefühl mit Stil
Ein weiteres spannendes Detail: Ich baue meine Nester mit viel Liebe und Geschick. Meistens suche ich mir hohe Bäume oder dichte Sträucher, um mein Nest zu errichten. Und wenn ich eine gute Stelle gefunden habe, dann geht's los: Mit Gras, Zweigen und Moos baue ich ein gemütliches Zuhause für meine Familie. Besonders stolz bin ich, wenn meine Jungen im Frühjahr schlüpfen und ihre ersten Flügelschläge wagen – das ist ein wahrhaft magischer Moment!
So, nun kennt ihr ein paar meiner Geheimnisse. Ich bin nicht nur ein einfacher Vogel, sondern ein kleines Naturwunder mit einer Menge Tricks im Schnabel. Wenn ihr das nächste Mal eine Wacholderdrossel seht, denkt an mich und mein stolzes Dasein – und bleibt auf der Hut, ich könnte euch sonst mit einem kleinen Geschenk überraschen!
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
Ich gehöre zur Familie der Drosseln (Turdidae) und liebe es, in Wiesen, Feldern und Wäldern nach Nahrung zu suchen. Mein lateinischer Name Turdus pilaris klingt ein bisschen wie ein Zauberspruch, nicht wahr? Vielleicht liegt das daran, dass ich im Frühling und Sommer gerne durch die Lüfte schwebe und ein bisschen Magie verbreite.Ich habe ein vielseitiges Menü: Im Frühling und Sommer bin ich ein Insektenjäger, im Winter freue ich mich über Beeren, besonders Wacholderbeeren – da kommt auch mein Name her.
Diese leckeren Beeren sind nicht nur gesund, sondern geben mir auch ordentlich Energie für die kalte Jahreszeit. Man könnte sagen, sie sind mein "Superfood". In der Vergangenheit wurde ich sogar in der Kunst und Kultur verewigt. Zum Beispiel tauche ich in manchen europäischen Volksmärchen als ein cleverer und widerstandsfähiger Vogel auf, der sich gegen widrige Umstände durchsetzt – ob das nun Raubvögel, Jäger oder kalte Winter sind. Ihr müsst wissen, wir sind ziemlich hart im Nehmen und trotzen dem Wetter. Selbst wenn der Schnee fällt, bleibe ich tapfer auf der Suche nach meinem nächsten Snack.
Meine lustige Seite: Die Kunst der "Kacke"
Jetzt, wo wir uns ein bisschen besser kennen, erzähle ich euch noch etwas Lustiges über mich und meine Freunde. Wir Wacholderdrosseln haben eine besondere Verteidigungsstrategie gegen Raubtiere, insbesondere gegen größere Vögel wie Krähen. Wir spucken ihnen quasi ins Gesicht – okay, genauer gesagt kacken wir auf sie! Wenn ein Feind uns oder unsere Nester angreift, starten wir einen koordinierten Angriff und werfen unseren Kot in die Richtung des Eindringlings.
Eine klebrige Überraschung! Das vertreibt nicht nur die Angreifer, sondern verschafft uns auch den Ruf als ziemlich schlaue (und vielleicht ein bisschen freche) Vögel.
Diese "Bombardement-Taktik" ist unter Vogelfreunden schon fast legendär. Manchmal bekomme ich das Gefühl, dass wir Drosseln uns damit brüsten. Stell dir vor: "Hey, gestern hab ich eine Elster getroffen und sie hat sich nicht mehr eingekriegt – treffsicher wie ich bin, hab ich sie voll erwischt!"
Mein Nest: Heimatgefühl mit Stil
Ein weiteres spannendes Detail: Ich baue meine Nester mit viel Liebe und Geschick. Meistens suche ich mir hohe Bäume oder dichte Sträucher, um mein Nest zu errichten. Und wenn ich eine gute Stelle gefunden habe, dann geht's los: Mit Gras, Zweigen und Moos baue ich ein gemütliches Zuhause für meine Familie. Besonders stolz bin ich, wenn meine Jungen im Frühjahr schlüpfen und ihre ersten Flügelschläge wagen – das ist ein wahrhaft magischer Moment!
So, nun kennt ihr ein paar meiner Geheimnisse. Ich bin nicht nur ein einfacher Vogel, sondern ein kleines Naturwunder mit einer Menge Tricks im Schnabel. Wenn ihr das nächste Mal eine Wacholderdrossel seht, denkt an mich und mein stolzes Dasein – und bleibt auf der Hut, ich könnte euch sonst mit einem kleinen Geschenk überraschen!
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- Wacholderdrossel (Turdus pilaris)
Artenschutz in Franken®
Ein Welterbe für den Mauersegler - Luitpoldstraße 51 Bamberg -

Ein Welterbe für den Mauersegler
25/26.10.2024
Bamberg / Bayern. Wie auch in anderen Städten der Republik erkennen wir seit geraumer Zeit einen elementaren Rückgang der Vogelart Mauersegler. Neben Nahrungsmangel sind es vornehmlich fehlende Fortpflanzungsstätten die es den Tieren zunehmend schwerer machen sich einer erfolgreichen Arterhaltung zu widmen.
25/26.10.2024
- Ein innovatives Gemeinschaftsprojekt engagiert sich für die Erhaltung der letzten Mauersegler in der Stadt Bamberg.
Bamberg / Bayern. Wie auch in anderen Städten der Republik erkennen wir seit geraumer Zeit einen elementaren Rückgang der Vogelart Mauersegler. Neben Nahrungsmangel sind es vornehmlich fehlende Fortpflanzungsstätten die es den Tieren zunehmend schwerer machen sich einer erfolgreichen Arterhaltung zu widmen.
Artenschutz in Franken® und Stadt Bamberg – Umweltamt möchten dem Verlust der Biodiversität mit einem konkreten, regionalem Schutzprojekt entgegenwirken. Gefördert wird das Projekt durch das Bundesamt für Naturschutz (BfN) mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV).
Mit der Installation einer Nisthilfenkette wurden vor wenigen Tagen neue Mauersegler Reproduktionsmöglichkeiten geschaffen. An einer geeigneten Bauwerkfassade des Umweltamtes in der Luitpoldstraße in Bamberg, konnten spzielle 10 Nistplätze mit einem Hubsteiger montiert werden.
Diese Niststätten bieten kulturfolgenden Kleinvogelarten wie z. B. dem Mauersegler nun geeignete, prädatorensichere Reproduktionsmöglichkeiten. Auch klimatische Faktoren waren Bestandteil des Projekts, denn mehr und mehr (auch traditionelle) Brutplätze verlieren aufgrund des Klimawandels ihre Funktionalität und damit verenden viele Jungtiere, bereits in überhitzen Brutnischen ohne jemals einen ersten Flügelschlag im freien Luftraum erleben zu dürfen.
Die nun hier installierten Nisthilfen wurden neben einer Ansitzschräge die natürliche Fressfeinde, die an den Reproduktionsstandorten in Erscheinung treten könnten, davon abhalten, sich hier niederzulassen, mit Maßnahmen zur Reduzierung einer Brutplatzüberhitzung ausgestattet. Selbstredend das die Nisthilfen in einer nachhaltigen Konzeption ausgeführt wurden, um nach einer Annahme auch viele Jahrzehnte ihrer wertvollen Aufgabe nachkommen zu können.
In der Aufnahme
Mit der Installation einer Nisthilfenkette wurden vor wenigen Tagen neue Mauersegler Reproduktionsmöglichkeiten geschaffen. An einer geeigneten Bauwerkfassade des Umweltamtes in der Luitpoldstraße in Bamberg, konnten spzielle 10 Nistplätze mit einem Hubsteiger montiert werden.
Diese Niststätten bieten kulturfolgenden Kleinvogelarten wie z. B. dem Mauersegler nun geeignete, prädatorensichere Reproduktionsmöglichkeiten. Auch klimatische Faktoren waren Bestandteil des Projekts, denn mehr und mehr (auch traditionelle) Brutplätze verlieren aufgrund des Klimawandels ihre Funktionalität und damit verenden viele Jungtiere, bereits in überhitzen Brutnischen ohne jemals einen ersten Flügelschlag im freien Luftraum erleben zu dürfen.
Die nun hier installierten Nisthilfen wurden neben einer Ansitzschräge die natürliche Fressfeinde, die an den Reproduktionsstandorten in Erscheinung treten könnten, davon abhalten, sich hier niederzulassen, mit Maßnahmen zur Reduzierung einer Brutplatzüberhitzung ausgestattet. Selbstredend das die Nisthilfen in einer nachhaltigen Konzeption ausgeführt wurden, um nach einer Annahme auch viele Jahrzehnte ihrer wertvollen Aufgabe nachkommen zu können.
In der Aufnahme
- Montierte Nisthilfenkette mit installierter Ansitzschräge die auch einen Traufkörper imitiert.
Artenschutz in Franken®
Phaonia subventa

Phaonia subventa
24/25.10.2024
Klar, ich bin keine Berühmtheit wie die allseits bekannte Stubenfliege, aber dafür habe ich meinen ganz eigenen Stil. Manche nennen mich vielleicht „unscheinbar“, aber hey, das gibt mir den Vorteil, mich unauffällig durch die Wiesen und Wälder zu bewegen. Lass mich dir ein bisschen erzählen, wie das Leben als Phaonia subventa so läuft – es ist aufregender, als du vielleicht denkst!
24/25.10.2024
- Oh, hallo! Willkommen in meiner Welt! Ich bin Phaonia subventa, eine kleine, aber feine Fliege aus der Familie der Echten Fliegen (Muscidae).
Klar, ich bin keine Berühmtheit wie die allseits bekannte Stubenfliege, aber dafür habe ich meinen ganz eigenen Stil. Manche nennen mich vielleicht „unscheinbar“, aber hey, das gibt mir den Vorteil, mich unauffällig durch die Wiesen und Wälder zu bewegen. Lass mich dir ein bisschen erzählen, wie das Leben als Phaonia subventa so läuft – es ist aufregender, als du vielleicht denkst!
Mein Look: Minimalistisch, aber stilvoll
Klar, ich bin nicht bunt wie ein Schmetterling oder glänzend wie eine Libelle, aber ich finde, dass Understatement auch seinen Reiz hat. Mein Körper ist schlank und dezent bräunlich-grau gefärbt, perfekt, um im Gras oder auf dem Waldboden unterzutauchen. Meine Beine sind wie kleine schwarze Stiefel – praktisch und schick zugleich. Meine Flügel sind transparent, und sie schimmern im richtigen Licht fast wie feines Glas.
Eleganz ist eben auch eine Frage der Perspektive, nicht wahr?
Und dann wären da noch meine großen roten Augen. Ja, ja, ich weiß, viele sagen, dass das „typisch Fliege“ ist, aber bei mir hat es schon Stil! Diese Augen sind perfekt für die Orientierung und geben mir den Überblick – ich sehe mehr als du denkst! Stell dir das mal vor: Ich kann fast alles um mich herum wahrnehmen, selbst wenn ich zur Seite schaue. Ein kleiner Radar auf zwei Beinen – oder Flügeln!
Mein Tagesablauf: Abenteuer zwischen Laub und Blüten
Was mache ich den ganzen Tag? Nun, ich bin eine Entdeckerin – mein ganzes Leben lang. Ich fliege umher, mal hierhin, mal dorthin, immer auf der Suche nach Futter und Abenteuern. Besonders mag ich feuchte und schattige Orte, wie Wiesen und Wälder. Ich bin quasi der kleine Walddetektiv unter den Fliegen – immer auf der Suche nach dem nächsten Leckerbissen oder einem Platz zum Ausruhen.
Meine Ernährung?
Ein feiner Mix! Anders als die Party-Fliegen, die ständig um deinen Obstteller kreisen, stehe ich eher auf den natürlichen Kram – Pflanzenreste, abgestorbene Blätter, und manchmal auch ein bisschen Blütennektar. Die Natur bietet eben eine breite Speisekarte! Man könnte sagen, ich bin eine umweltfreundliche Gourmet-Fliege. Und das Beste: Während ich futtere, verteile ich ganz nebenbei Pollen und helfe bei der Bestäubung. Das ist wie Mülltrennung und Gartenarbeit in einem – ich bin der Bio-Kreislauf in Person!
Die Kunst der Tarnung und Flucht
Jetzt fragst du dich vielleicht, ob ich viele Feinde habe. Oh ja, jede Menge! Vögel, Frösche, und sogar andere Insekten haben es manchmal auf mich abgesehen. Aber zum Glück bin ich flink und wendig. Meine Flügel bringen mich blitzschnell aus der Gefahrenzone. Ich schwirre einfach von Blatt zu Blatt oder verstecke mich im Gras – und schon bin ich wieder in Sicherheit.
Aber ich will ehrlich sein: Es ist nicht immer einfach, sich durchzuschlagen. Manchmal, wenn ich den ganzen Tag durch die Wälder geflogen bin und mich ständig vor hungrigen Räubern retten musste, frage ich mich schon, warum ich mir das alles antue. Aber dann denke ich daran, wie wichtig meine Aufgabe im Ökosystem ist, und schwupps, bin ich wieder motiviert. Denn hey, ohne mich und meine Artgenossen wären die Wälder nicht so sauber, die Pflanzen nicht so bestäubt, und die Kreisläufe der Natur wären ziemlich aus dem Gleichgewicht. Wir sind also quasi die kleinen Helden im Verborgenen!
Partnersuche auf Fliegenart: Ein Tanz um das Glück
Und wenn es um die Liebe geht, wird es bei uns auch spannend! Wir Phaonia subventa-Fliegen sind wählerisch. Wir finden uns nicht einfach so – es braucht schon eine gute Choreografie. Wenn ich einen potenziellen Partner entdecke, dann fliegen wir ein Tänzchen durch die Luft, um uns gegenseitig zu beeindrucken. Es ist ein kleines Luftballett – leicht, elegant und voller Schwung. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Aber so ist das eben im Leben einer Fliege – ein ewiges Auf und Ab, ein ständiges Schwingen von Flügel zu Flügel.
Fazit: Klein, aber voller Leben
Das Leben als Phaonia subventa ist kein Zuckerschlecken, aber es ist voller Momente, die es wert sind. Ich surr' durch die Welt, immer auf der Suche nach neuen Abenteuern, immer mit den Augen offen für Gefahren – und ab und zu gönne ich mir eine Pause auf einer schönen Blüte. Auch wenn ich vielleicht nicht die auffälligste Fliege bin, so bin ich doch ein wichtiger Teil der Natur – und darauf bin ich stolz!
Also, wenn du das nächste Mal eine kleine, graubraune Fliege siehst, die elegant über eine Waldlichtung schwirrt, denk an mich. Vielleicht bin ich gerade auf Entdeckungstour oder tanze meinen nächsten Fliegentango. Und wer weiß – vielleicht kreuzen sich unsere Wege wieder!
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch.
Klar, ich bin nicht bunt wie ein Schmetterling oder glänzend wie eine Libelle, aber ich finde, dass Understatement auch seinen Reiz hat. Mein Körper ist schlank und dezent bräunlich-grau gefärbt, perfekt, um im Gras oder auf dem Waldboden unterzutauchen. Meine Beine sind wie kleine schwarze Stiefel – praktisch und schick zugleich. Meine Flügel sind transparent, und sie schimmern im richtigen Licht fast wie feines Glas.
Eleganz ist eben auch eine Frage der Perspektive, nicht wahr?
Und dann wären da noch meine großen roten Augen. Ja, ja, ich weiß, viele sagen, dass das „typisch Fliege“ ist, aber bei mir hat es schon Stil! Diese Augen sind perfekt für die Orientierung und geben mir den Überblick – ich sehe mehr als du denkst! Stell dir das mal vor: Ich kann fast alles um mich herum wahrnehmen, selbst wenn ich zur Seite schaue. Ein kleiner Radar auf zwei Beinen – oder Flügeln!
Mein Tagesablauf: Abenteuer zwischen Laub und Blüten
Was mache ich den ganzen Tag? Nun, ich bin eine Entdeckerin – mein ganzes Leben lang. Ich fliege umher, mal hierhin, mal dorthin, immer auf der Suche nach Futter und Abenteuern. Besonders mag ich feuchte und schattige Orte, wie Wiesen und Wälder. Ich bin quasi der kleine Walddetektiv unter den Fliegen – immer auf der Suche nach dem nächsten Leckerbissen oder einem Platz zum Ausruhen.
Meine Ernährung?
Ein feiner Mix! Anders als die Party-Fliegen, die ständig um deinen Obstteller kreisen, stehe ich eher auf den natürlichen Kram – Pflanzenreste, abgestorbene Blätter, und manchmal auch ein bisschen Blütennektar. Die Natur bietet eben eine breite Speisekarte! Man könnte sagen, ich bin eine umweltfreundliche Gourmet-Fliege. Und das Beste: Während ich futtere, verteile ich ganz nebenbei Pollen und helfe bei der Bestäubung. Das ist wie Mülltrennung und Gartenarbeit in einem – ich bin der Bio-Kreislauf in Person!
Die Kunst der Tarnung und Flucht
Jetzt fragst du dich vielleicht, ob ich viele Feinde habe. Oh ja, jede Menge! Vögel, Frösche, und sogar andere Insekten haben es manchmal auf mich abgesehen. Aber zum Glück bin ich flink und wendig. Meine Flügel bringen mich blitzschnell aus der Gefahrenzone. Ich schwirre einfach von Blatt zu Blatt oder verstecke mich im Gras – und schon bin ich wieder in Sicherheit.
Aber ich will ehrlich sein: Es ist nicht immer einfach, sich durchzuschlagen. Manchmal, wenn ich den ganzen Tag durch die Wälder geflogen bin und mich ständig vor hungrigen Räubern retten musste, frage ich mich schon, warum ich mir das alles antue. Aber dann denke ich daran, wie wichtig meine Aufgabe im Ökosystem ist, und schwupps, bin ich wieder motiviert. Denn hey, ohne mich und meine Artgenossen wären die Wälder nicht so sauber, die Pflanzen nicht so bestäubt, und die Kreisläufe der Natur wären ziemlich aus dem Gleichgewicht. Wir sind also quasi die kleinen Helden im Verborgenen!
Partnersuche auf Fliegenart: Ein Tanz um das Glück
Und wenn es um die Liebe geht, wird es bei uns auch spannend! Wir Phaonia subventa-Fliegen sind wählerisch. Wir finden uns nicht einfach so – es braucht schon eine gute Choreografie. Wenn ich einen potenziellen Partner entdecke, dann fliegen wir ein Tänzchen durch die Luft, um uns gegenseitig zu beeindrucken. Es ist ein kleines Luftballett – leicht, elegant und voller Schwung. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Aber so ist das eben im Leben einer Fliege – ein ewiges Auf und Ab, ein ständiges Schwingen von Flügel zu Flügel.
Fazit: Klein, aber voller Leben
Das Leben als Phaonia subventa ist kein Zuckerschlecken, aber es ist voller Momente, die es wert sind. Ich surr' durch die Welt, immer auf der Suche nach neuen Abenteuern, immer mit den Augen offen für Gefahren – und ab und zu gönne ich mir eine Pause auf einer schönen Blüte. Auch wenn ich vielleicht nicht die auffälligste Fliege bin, so bin ich doch ein wichtiger Teil der Natur – und darauf bin ich stolz!
Also, wenn du das nächste Mal eine kleine, graubraune Fliege siehst, die elegant über eine Waldlichtung schwirrt, denk an mich. Vielleicht bin ich gerade auf Entdeckungstour oder tanze meinen nächsten Fliegentango. Und wer weiß – vielleicht kreuzen sich unsere Wege wieder!
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch.
- Phaonia subventa ist eine Fliegenart aus der Familie der Fleischfliegen (Muscidae). Diese Insekten sind etwa 5 bis 8 mm groß und zeichnen sich durch eine graubraune Körperfarbe aus. Sie sind in Europa verbreitet und bevorzugen feuchte Lebensräume wie Uferbereiche von Gewässern.
Artenschutz in Franken®
Ich bin die Wanderratte (Rattus norvegicus) ...

Wanderratte (Rattus norvegicus)
24/25.10.2024
Wusstest du, dass wir Wanderratten die Cousins der Hausratte sind? Aber im Gegensatz zu den zarten Hausratten, die eher Höhenflüge machen und gerne auf Dachböden wohnen, bin ich eine richtige Abenteurerin des Untergrunds! Ich bin überall dort, wo es dunkel, feucht und gemütlich ist - also in Kanalisationen, Kellern und Müllhalden. Klingt nicht glamourös? Na, dann warte ab!
24/25.10.2024
- Hallo! Ich bin die Wanderratte (Rattus norvegicus) - besser bekannt als "Wanderratte", obwohl ich eigentlich gar nicht so viel wandere.
Wusstest du, dass wir Wanderratten die Cousins der Hausratte sind? Aber im Gegensatz zu den zarten Hausratten, die eher Höhenflüge machen und gerne auf Dachböden wohnen, bin ich eine richtige Abenteurerin des Untergrunds! Ich bin überall dort, wo es dunkel, feucht und gemütlich ist - also in Kanalisationen, Kellern und Müllhalden. Klingt nicht glamourös? Na, dann warte ab!
Mein Aussehen und Stil
Ich bin ein echter Kraftprotz, ungefähr 20 bis 30 cm lang, und dann kommt noch mein beeindruckender Schwanz dazu. Der ist fast genauso lang! Im Gegensatz zu den schicken Farbratten, die manchmal bei euch Menschen wohnen und in allen möglichen Farben daherkommen, halte ich es eher klassisch: Braun bis Grau, mit einem Hauch von Understatement.Und ja, manche sagen, mein Schwanz sieht ein bisschen eklig aus – haarlos und schuppig. Aber ehrlich, ohne ihn wäre ich ein richtiges Balance-Desaster. Er hilft mir dabei, auf den schmalsten Rohren zu balancieren und enge Kurven zu nehmen, wenn ich vor Gefahr flüchte.
Unsere Vorliebe für Abenteuer (und Snacks!)
Warum nennen mich Menschen eine "Wanderratte"? Wahrscheinlich, weil wir immer auf der Suche nach dem nächsten Abenteuer sind – oder besser gesagt: dem nächsten leckeren Snack! Wir sind echte Gourmets: Müll, Abfälle, Getreide, Früchte, Insekten, sogar mal ein bisschen Fleisch – alles ist auf meiner Speisekarte! Ihr nennt es "Müll", wir nennen es Buffet. Meine Freunde und ich können uns an fast jedes Umfeld anpassen. Egal, ob Stadt oder Land, feuchte Keller oder trockene Felder – wir sind überall, wo es was zu fressen gibt. Wusstest du, dass wir in Großstädten wie Berlin oder New York die wahren Herrscher der Kanalisation sind? Ja, ihr Menschen denkt vielleicht, die Stadt gehört euch, aber da unten sind wir die Chefs.
Unser Sozialleben – Mehr als nur „Rattenschwanz“
Wir sind sehr soziale Tiere, ja wirklich! Wir leben in Gruppen, die sich sogenannte Kolonien nennen. Da gibt es klare Regeln und Strukturen, ähnlich wie in eurer menschlichen Gesellschaft. Wir kümmern uns umeinander, teilen Futter, und manchmal kuscheln wir sogar zusammen, um uns warmzuhalten. Zugegeben, wir sind vielleicht nicht die besten Mitbewohner – wir haben ein bisschen die Angewohnheit, Kabel anzuknabbern und Löcher in Wände zu nagen, aber hey, man kann nicht alles haben, oder?
Schneller, schlauer, stärker – die Superkräfte der Wanderratte
Du denkst vielleicht, wir sind klein und schwach, aber wir haben echte Superkräfte! Erstens, ich bin eine Schwimm-Meisterin. Ich kann kilometerweit durch Abwasserrohre schwimmen und unter Wasser meinen Atem mehrere Minuten anhalten. Wenn wir schwimmen, sieht das vielleicht nicht so elegant aus wie bei einem Delfin, aber hey, wir schaffen’s ans Ziel. Dann sind wir auch noch wahre Sprungtalente! Ich kann bis zu einem Meter hochspringen. Das ist so, als würde ein Mensch mal eben auf das Dach eines Hauses hüpfen. Und schließlich bin ich eine Weltmeisterin im Nagen: Mit meinen kräftigen Zähnen kann ich mich durch Holz, Plastik und sogar Beton beißen – kein Wunder, dass wir uns oft unbeliebt machen. Aber wenn man Hunger hat, muss man eben kreativ werden!
Die Liebe und das Leben – Ratting mit Herz
Eine kleine Anekdote: Wanderratten sind romantischer, als man denkt. Ein Pärchen bleibt oft sein ganzes Leben zusammen und zieht gemeinsam die Jungen auf. Und Junge, da sind wir produktiv! Ein Weibchen kann bis zu 7 Mal im Jahr Nachwuchs bekommen, mit jeweils 6 bis 12 Babys. Richtig gerechnet? Ja, das sind über 80 Rattenkinder pro Jahr – wir sind also eine wahre Großfamilie!
Die Sache mit den Krankheiten...
Okay, jetzt ein ernstes Thema: Ja, wir sind bekannt dafür, manchmal Krankheiten zu übertragen. Die Geschichte mit der Pest ist zwar schon ziemlich alt (und das waren hauptsächlich unsere Verwandten, die Schwarzen Ratten!), aber wir wissen, dass Menschen bei uns vorsichtig sind. Aber wir sind doch keine Ungeheuer! Wenn ihr einfach euren Müll sicher entsorgt und nicht alles liegen lasst, gibt’s auch weniger Probleme zwischen uns.
Ratten und Menschen – Eine lange Geschichte
Am Ende des Tages bin ich eigentlich stolz darauf, dass wir so erfolgreich überlebt haben – trotz aller menschlichen Versuche, uns loszuwerden. Manche von euch mögen uns nicht, aber wir sind eben anpassungsfähig und clever. In gewisser Weise sind wir und die Menschen sich sehr ähnlich: Wir lieben Gesellschaft, wir suchen nach Ressourcen, und wir sind bereit, für unser Überleben alles zu tun.
Also, das nächste Mal, wenn du eine von uns siehst – denk daran, wir sind mehr als nur „Ungeziefer“. Wir sind Überlebenskünstler mit einem großen Appetit auf Abenteuer! Bis bald (vielleicht unter deinem Müllcontainer)!
In der Aufnahme von Helga Zinnecker
Ich bin ein echter Kraftprotz, ungefähr 20 bis 30 cm lang, und dann kommt noch mein beeindruckender Schwanz dazu. Der ist fast genauso lang! Im Gegensatz zu den schicken Farbratten, die manchmal bei euch Menschen wohnen und in allen möglichen Farben daherkommen, halte ich es eher klassisch: Braun bis Grau, mit einem Hauch von Understatement.Und ja, manche sagen, mein Schwanz sieht ein bisschen eklig aus – haarlos und schuppig. Aber ehrlich, ohne ihn wäre ich ein richtiges Balance-Desaster. Er hilft mir dabei, auf den schmalsten Rohren zu balancieren und enge Kurven zu nehmen, wenn ich vor Gefahr flüchte.
Unsere Vorliebe für Abenteuer (und Snacks!)
Warum nennen mich Menschen eine "Wanderratte"? Wahrscheinlich, weil wir immer auf der Suche nach dem nächsten Abenteuer sind – oder besser gesagt: dem nächsten leckeren Snack! Wir sind echte Gourmets: Müll, Abfälle, Getreide, Früchte, Insekten, sogar mal ein bisschen Fleisch – alles ist auf meiner Speisekarte! Ihr nennt es "Müll", wir nennen es Buffet. Meine Freunde und ich können uns an fast jedes Umfeld anpassen. Egal, ob Stadt oder Land, feuchte Keller oder trockene Felder – wir sind überall, wo es was zu fressen gibt. Wusstest du, dass wir in Großstädten wie Berlin oder New York die wahren Herrscher der Kanalisation sind? Ja, ihr Menschen denkt vielleicht, die Stadt gehört euch, aber da unten sind wir die Chefs.
Unser Sozialleben – Mehr als nur „Rattenschwanz“
Wir sind sehr soziale Tiere, ja wirklich! Wir leben in Gruppen, die sich sogenannte Kolonien nennen. Da gibt es klare Regeln und Strukturen, ähnlich wie in eurer menschlichen Gesellschaft. Wir kümmern uns umeinander, teilen Futter, und manchmal kuscheln wir sogar zusammen, um uns warmzuhalten. Zugegeben, wir sind vielleicht nicht die besten Mitbewohner – wir haben ein bisschen die Angewohnheit, Kabel anzuknabbern und Löcher in Wände zu nagen, aber hey, man kann nicht alles haben, oder?
Schneller, schlauer, stärker – die Superkräfte der Wanderratte
Du denkst vielleicht, wir sind klein und schwach, aber wir haben echte Superkräfte! Erstens, ich bin eine Schwimm-Meisterin. Ich kann kilometerweit durch Abwasserrohre schwimmen und unter Wasser meinen Atem mehrere Minuten anhalten. Wenn wir schwimmen, sieht das vielleicht nicht so elegant aus wie bei einem Delfin, aber hey, wir schaffen’s ans Ziel. Dann sind wir auch noch wahre Sprungtalente! Ich kann bis zu einem Meter hochspringen. Das ist so, als würde ein Mensch mal eben auf das Dach eines Hauses hüpfen. Und schließlich bin ich eine Weltmeisterin im Nagen: Mit meinen kräftigen Zähnen kann ich mich durch Holz, Plastik und sogar Beton beißen – kein Wunder, dass wir uns oft unbeliebt machen. Aber wenn man Hunger hat, muss man eben kreativ werden!
Die Liebe und das Leben – Ratting mit Herz
Eine kleine Anekdote: Wanderratten sind romantischer, als man denkt. Ein Pärchen bleibt oft sein ganzes Leben zusammen und zieht gemeinsam die Jungen auf. Und Junge, da sind wir produktiv! Ein Weibchen kann bis zu 7 Mal im Jahr Nachwuchs bekommen, mit jeweils 6 bis 12 Babys. Richtig gerechnet? Ja, das sind über 80 Rattenkinder pro Jahr – wir sind also eine wahre Großfamilie!
Die Sache mit den Krankheiten...
Okay, jetzt ein ernstes Thema: Ja, wir sind bekannt dafür, manchmal Krankheiten zu übertragen. Die Geschichte mit der Pest ist zwar schon ziemlich alt (und das waren hauptsächlich unsere Verwandten, die Schwarzen Ratten!), aber wir wissen, dass Menschen bei uns vorsichtig sind. Aber wir sind doch keine Ungeheuer! Wenn ihr einfach euren Müll sicher entsorgt und nicht alles liegen lasst, gibt’s auch weniger Probleme zwischen uns.
Ratten und Menschen – Eine lange Geschichte
Am Ende des Tages bin ich eigentlich stolz darauf, dass wir so erfolgreich überlebt haben – trotz aller menschlichen Versuche, uns loszuwerden. Manche von euch mögen uns nicht, aber wir sind eben anpassungsfähig und clever. In gewisser Weise sind wir und die Menschen sich sehr ähnlich: Wir lieben Gesellschaft, wir suchen nach Ressourcen, und wir sind bereit, für unser Überleben alles zu tun.
Also, das nächste Mal, wenn du eine von uns siehst – denk daran, wir sind mehr als nur „Ungeziefer“. Wir sind Überlebenskünstler mit einem großen Appetit auf Abenteuer! Bis bald (vielleicht unter deinem Müllcontainer)!
In der Aufnahme von Helga Zinnecker
- Wanderratten Weibchen an einer Vogel Futterstelle
Artenschutz in Franken®
Aktueller Ordner:
Archiv
Parallele Themen:
2019-11
2019-10
2019-12
2020-01
2020-02
2020-03
2020-04
2020-05
2020-06
2020-07
2020-08
2020-09
2020-10
2020-11
2020-12
2021-01
2021-02
2021-03
2021-04
2021-05
2021-06
2021-07
2021-08
2021-09
2021-10
2021-11
2021-12
2022-01
2022-02
2022-03
2022-04
2022-05
2022-06
2022-07
2022-08
2022-09
2022-10
2022-11
2022-12
2023-01
2023-02
2023-03
2023-04
2023-05
2023-06
2023-07
2023-08
2023-09
2023-10
2023-11
2023-12
2024-01
2024-02
2024-03
2024-04
2024-05
2024-06
2024-07
2024-08
2024-09
2024-10
2024-11
2024-12
2025-01
2025-02
2025-03
2025-04
2025-05
2025-06
2025-07
2025-08
2025-09
2025-10
2025-11
2025-12
















