Neue Voliere für kleine Patienten

Neue Voliere für kleine Patienten
21/22.03.2025
"Der Ansitzbaum – Das Fünf-Sterne-Hotel für piepsende VIPs"
„Na, du willst also wissen, was ein Ansitzbaum ist? Tja, das ist quasi der Wellness- und Freizeitpark für meine gefiederten Kollegen und mich – ein richtig schicker Platz zum Chillen, Flirten und Federn lockern!
21/22.03.2025
"Der Ansitzbaum – Das Fünf-Sterne-Hotel für piepsende VIPs"
„Na, du willst also wissen, was ein Ansitzbaum ist? Tja, das ist quasi der Wellness- und Freizeitpark für meine gefiederten Kollegen und mich – ein richtig schicker Platz zum Chillen, Flirten und Federn lockern!
Stell dir einen stylischen Baumstamm oder ein paar robuste Äste vor, schön verzweigt und stabil. Hier können wir Vögel unsere Show abziehen: Klettern, Hüpfen, Flattern – alles inbegriffen. Für uns ist das wie ein Fitnessstudio und ein Sofa in einem.
Das Beste daran? Die Aussicht! Vom höchsten Ast aus kann man prima beobachten, was die anderen so treiben. 'Oh, guck mal, Klaus putzt schon wieder sein Gefieder – der Typ nimmt’s echt genau!‘ Oder: 'Ha! Gisela hat schon wieder den besten Platz beim Futter ergattert!'
Natürlich hat ein guter Ansitzbaum auch Abwechslung zu bieten: Mal eine schräge Astgabel für waghalsige Klettermanöver, mal ein knorriger Zweig, an dem man genüsslich den Schnabel wetzen kann. Und wenn irgendwo noch ein Spielzeug baumelt – Jackpot!
Kurz gesagt: Ein Ansitzbaum ist unser persönlicher Lieblingsplatz. Hier wird geschnäbelt, geflirtet und auch mal energisch gestritten – aber hey, das gehört zum Showbiz dazu.
Also, wenn du für deine gefiederten Freunde einen Ansitzbaum baust, denk dran: Stabil, vielseitig und mit Panoramablick – dann sind wir happy! Und vielleicht schenken wir dir dann sogar ein kleines Konzert als Dankeschön.“
Tschilp-tschirp – wir sehen uns im Baumhotel!
In der Aufnahme
Das Beste daran? Die Aussicht! Vom höchsten Ast aus kann man prima beobachten, was die anderen so treiben. 'Oh, guck mal, Klaus putzt schon wieder sein Gefieder – der Typ nimmt’s echt genau!‘ Oder: 'Ha! Gisela hat schon wieder den besten Platz beim Futter ergattert!'
Natürlich hat ein guter Ansitzbaum auch Abwechslung zu bieten: Mal eine schräge Astgabel für waghalsige Klettermanöver, mal ein knorriger Zweig, an dem man genüsslich den Schnabel wetzen kann. Und wenn irgendwo noch ein Spielzeug baumelt – Jackpot!
Kurz gesagt: Ein Ansitzbaum ist unser persönlicher Lieblingsplatz. Hier wird geschnäbelt, geflirtet und auch mal energisch gestritten – aber hey, das gehört zum Showbiz dazu.
Also, wenn du für deine gefiederten Freunde einen Ansitzbaum baust, denk dran: Stabil, vielseitig und mit Panoramablick – dann sind wir happy! Und vielleicht schenken wir dir dann sogar ein kleines Konzert als Dankeschön.“
Tschilp-tschirp – wir sehen uns im Baumhotel!
In der Aufnahme
- Am 12.03.2025 wurde der Ansitzbaum vormontiert ...
Artenschutz in Franken®
Der Star (Sturnus vulgaris)

"Mein Leben als Star – der glänzende Alleskönner"
20/21.03.2025
Das bin ich – der Star, der wahre Künstler der Lüfte und der Klangakrobat der Bäume. Man nennt mich Sturnus vulgaris, aber hey – an mir ist nichts ‚vulgaris‘ (gewöhnlich)!
20/21.03.2025
- „Tschilp-tschilp-pfiff-trillerrrr! Hörst du das?
Das bin ich – der Star, der wahre Künstler der Lüfte und der Klangakrobat der Bäume. Man nennt mich Sturnus vulgaris, aber hey – an mir ist nichts ‚vulgaris‘ (gewöhnlich)!
Schau mich an! Mein Gefieder funkelt wie poliertes Metall – im Sonnenlicht schimmere ich grün, violett und bronze. Und diese weißen Tupfen im Winterkleid? Pure Eleganz! Wenn du mich aus der Nähe siehst, wirst du merken: Ich bin ein echter Hingucker.
Mein Talent? Die Stimme! Ich bin ein Meister der Imitation. Drossel, Bussard, Handy-Klingelton? Kein Problem – ich kriege das alles hin. Wenn ich mit meinen Freunden in den Bäumen sitze, liefern wir uns richtige Gesangswettbewerbe.
Tagsüber durchstreife ich Wiesen und Felder, immer auf der Suche nach Leckerbissen. Würmer, Insekten, Früchte – ich bin nicht wählerisch. Im Herbst geht’s an die Beeren – die Holundersträucher lieben mich (oder hassen mich, je nach Perspektive).
Das Beste kommt aber noch: unsere Flüge! Wenn wir uns zu Tausenden am Himmel versammeln und in perfekten Formationen durch die Luft wirbeln – wow, da staunen sogar die Greifvögel. Wir Stare bewegen uns wie eine riesige schwarze Wolke, die tanzt und pulsiert – als würden wir den Wind dirigieren.
Im Frühjahr baue ich mein Nest am liebsten in Höhlen oder Nischen – Dachziegel, Baumhöhlen oder sogar Laternenpfähle sind mir recht. Hauptsache, mein Revier ist sicher und gemütlich.
Ein kleiner Tipp von mir: Unterschätze nie die Gemeinschaft der Stare! Wir sind clevere Teamplayer, immer gut organisiert und mit einem unschlagbaren Gesang auf den Lippen.
Also, wenn du das nächste Mal eine schillernde Wolke von Vögeln am Himmel tanzen siehst – wink ruhig mal hoch. Wahrscheinlich bin ich irgendwo da oben und singe gerade deine Lieblingsmelodie nach.“
Tschilp-pfiff-trillerrrr!
Aufnahme von Helga Zinnecker
Mein Talent? Die Stimme! Ich bin ein Meister der Imitation. Drossel, Bussard, Handy-Klingelton? Kein Problem – ich kriege das alles hin. Wenn ich mit meinen Freunden in den Bäumen sitze, liefern wir uns richtige Gesangswettbewerbe.
Tagsüber durchstreife ich Wiesen und Felder, immer auf der Suche nach Leckerbissen. Würmer, Insekten, Früchte – ich bin nicht wählerisch. Im Herbst geht’s an die Beeren – die Holundersträucher lieben mich (oder hassen mich, je nach Perspektive).
Das Beste kommt aber noch: unsere Flüge! Wenn wir uns zu Tausenden am Himmel versammeln und in perfekten Formationen durch die Luft wirbeln – wow, da staunen sogar die Greifvögel. Wir Stare bewegen uns wie eine riesige schwarze Wolke, die tanzt und pulsiert – als würden wir den Wind dirigieren.
Im Frühjahr baue ich mein Nest am liebsten in Höhlen oder Nischen – Dachziegel, Baumhöhlen oder sogar Laternenpfähle sind mir recht. Hauptsache, mein Revier ist sicher und gemütlich.
Ein kleiner Tipp von mir: Unterschätze nie die Gemeinschaft der Stare! Wir sind clevere Teamplayer, immer gut organisiert und mit einem unschlagbaren Gesang auf den Lippen.
Also, wenn du das nächste Mal eine schillernde Wolke von Vögeln am Himmel tanzen siehst – wink ruhig mal hoch. Wahrscheinlich bin ich irgendwo da oben und singe gerade deine Lieblingsmelodie nach.“
Tschilp-pfiff-trillerrrr!
Aufnahme von Helga Zinnecker
- Star (Sturnus vulgaris)
Artenschutz in Franken®
Der Mittelspecht (Dendrocopos medius)

"Mein Leben als Mittelspecht"
19/20.03.2025
Du kennst vielleicht meinen größeren Cousin, den Buntspecht, aber lass dich nicht täuschen – ich bin der wahre Kenner der Baumrisse und Rindenspalten.
19/20.03.2025
- „Tock-tock-tock! Ich bin’s, der Mittelspecht – König der alten Eichenwälder und Meister der morschen Rinde.
Du kennst vielleicht meinen größeren Cousin, den Buntspecht, aber lass dich nicht täuschen – ich bin der wahre Kenner der Baumrisse und Rindenspalten.
Ich bin etwa so groß wie eine Amsel, mit meinem eleganten roten Scheitel – ein unverkennbares Markenzeichen. Mein Gefieder? Schwarz und weiß, mit hübsch gebänderten Flügeln und einer cremefarbenen Brust. Ich trage meine Farben mit Stolz.
Mein Lebensraum? Am liebsten wohne ich in alten Laubwäldern, besonders dort, wo knorrige Eichen stehen. In deren rauer, rissiger Rinde finde ich alles, was mein Specht-Herz begehrt: Käferlarven, Spinnen und andere Leckerbissen. Im Gegensatz zu meinen Verwandten haue ich aber nicht wie ein Berserker auf die Baumrinde ein – nein, ich bin ein Feingeist. Mit meinem spezialisierten Schnabel kratze und stochere ich vorsichtig nach Nahrung.
Was die Brutzeit angeht – da geht’s rund! Im Frühling klopfe ich meine Reviere ab und melde mich lautstark zu Wort. Mein Trommeln klingt zwar nicht ganz so energisch wie das meines großen Cousins, aber es reicht, um den Damen zu imponieren. Gemeinsam mit meiner Partnerin zimmern wir unsere Nisthöhle – meistens in weichem, morschem Holz. Da bin ich wählerisch – nur das Beste für meinen Nachwuchs!
Ach ja, und mein Flugstil? Wellenschlagartig – elegant und schwungvoll, als würde ich Wellen in die Luft zeichnen.
Leider habe ich es heutzutage nicht leicht. Viele meiner geliebten alten Wälder weichen jungen Forsten – zu ordentlich, zu aufgeräumt für meinen Geschmack. Dabei sind es gerade die toten Äste und morschen Bäume, die mein Zuhause und meine Speisekammer ausmachen.
Aber solange es knorrige Eichen und verwitterte Rinde gibt, wirst du mich hören – tock-tock-tock – der Mittelspecht, der Meister der Baumritzen.“
In der Aufnahme von Helga Zinnecker
Mein Lebensraum? Am liebsten wohne ich in alten Laubwäldern, besonders dort, wo knorrige Eichen stehen. In deren rauer, rissiger Rinde finde ich alles, was mein Specht-Herz begehrt: Käferlarven, Spinnen und andere Leckerbissen. Im Gegensatz zu meinen Verwandten haue ich aber nicht wie ein Berserker auf die Baumrinde ein – nein, ich bin ein Feingeist. Mit meinem spezialisierten Schnabel kratze und stochere ich vorsichtig nach Nahrung.
Was die Brutzeit angeht – da geht’s rund! Im Frühling klopfe ich meine Reviere ab und melde mich lautstark zu Wort. Mein Trommeln klingt zwar nicht ganz so energisch wie das meines großen Cousins, aber es reicht, um den Damen zu imponieren. Gemeinsam mit meiner Partnerin zimmern wir unsere Nisthöhle – meistens in weichem, morschem Holz. Da bin ich wählerisch – nur das Beste für meinen Nachwuchs!
Ach ja, und mein Flugstil? Wellenschlagartig – elegant und schwungvoll, als würde ich Wellen in die Luft zeichnen.
Leider habe ich es heutzutage nicht leicht. Viele meiner geliebten alten Wälder weichen jungen Forsten – zu ordentlich, zu aufgeräumt für meinen Geschmack. Dabei sind es gerade die toten Äste und morschen Bäume, die mein Zuhause und meine Speisekammer ausmachen.
Aber solange es knorrige Eichen und verwitterte Rinde gibt, wirst du mich hören – tock-tock-tock – der Mittelspecht, der Meister der Baumritzen.“
In der Aufnahme von Helga Zinnecker
- Mittelspecht an Vogelfütterung
Artenschutz in Franken®
Stele der Biodiversität® - Theinheim

Stele der Biodiversität® - Theinheim
27/28.02.2025
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutzes in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V., das von der Gemeinde Rauhenebrach, der Steuerkanzlei Bauerfeind aus München, der Deutschen Postcode Lotterie und weiteren Partern unabhängig voneinander unterstützt wird.
27/28.02.2025
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutzes in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V., das von der Gemeinde Rauhenebrach, der Steuerkanzlei Bauerfeind aus München, der Deutschen Postcode Lotterie und weiteren Partern unabhängig voneinander unterstützt wird.
Theinheim / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen, kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
In der Aufnahme
In der Aufnahme
- In dieser Aufnahme wird der Unterschied der verschmutzten Fassade (unten) zur bereits gereinigten Fassade sehr gut sichtbar ..
Artenschutz in Franken®
Gefährdung von Betreuerinnen und Betreuern an Amphibienübergängen

Gefährdung von Betreuerinnen und Betreuern an Amphibienübergängen: Eine Analyse der Risiken
17/18.03.2025
Diese Übergänge werden von engagierten Betreuerinnen und Betreuern betreut, die dafür sorgen, dass die Amphibien sicher die Straßen überqueren können. Trotz ihrer wichtigen Rolle stehen diese Helfer oft vor erheblichen Gefahren, insbesondere durch Fahrzeuge, die die Amphibienzäune niederfahren oder beschädigen.
17/18.03.2025
- Amphibienübergänge sind entscheidend für den Schutz von Amphibienpopulationen während ihrer Wanderungen zwischen Laichgewässern und ihren Lebensräumen.
Diese Übergänge werden von engagierten Betreuerinnen und Betreuern betreut, die dafür sorgen, dass die Amphibien sicher die Straßen überqueren können. Trotz ihrer wichtigen Rolle stehen diese Helfer oft vor erheblichen Gefahren, insbesondere durch Fahrzeuge, die die Amphibienzäune niederfahren oder beschädigen.
Die Bedeutung der Amphibienübergänge
Amphibien wie Frösche, Kröten und Molche unternehmen während der Fortpflanzungszeit oft weite Wanderungen zu ihren Laichgewässern. Dabei müssen sie häufig Straßen überqueren, was sie erheblichen Gefahren aussetzt. Um das Massensterben durch den Straßenverkehr zu verringern, werden Amphibienübergänge eingerichtet. Diese bestehen aus Zäunen, die die Amphibien entlang der Straße leiten, sowie Eimern oder Tunneln, die den Tieren ermöglichen, sicher unter der Straße hindurchzukommen.
Risiken für die Betreuerinnen und Betreuer
Die Betreuerinnen und Betreuer spielen eine entscheidende Rolle bei der Überwachung und Unterstützung dieser Wanderungen. Sie kontrollieren regelmäßig die Zäune, um sicherzustellen, dass sie intakt sind und ordnungsgemäß funktionieren. Dies ist jedoch keine ungefährliche Aufgabe. Insbesondere das Überprüfen und Reparieren der Zäune stellt die Betreuerinnen und Betreuer oft vor Risiken, da sie sich in unmittelbarer Nähe zur Straße befinden, wo Fahrzeuge mit hoher Geschwindigkeit unterwegs sind.
Gefahr durch Fahrzeuge
Die größte Gefahr für die Betreuerinnen und Betreuer besteht darin, dass Fahrzeuge die Amphibienzäune niederfahren oder beschädigen. Oftmals sind diese Zäune aus Kunststoff oder anderen Materialien gefertigt, die bei Kollisionen leicht beschädigt werden können. Ein beschädigter Zaun kann dazu führen, dass Amphibien die Straße überqueren und von Fahrzeugen überfahren werden, was nicht nur eine ökologische Tragödie darstellt, sondern auch die Sicherheit der Betreuerinnen und Betreuer gefährdet.
Maßnahmen zur Minimierung der Gefahren
Um die Sicherheit der Betreuerinnen und Betreuer zu gewährleisten, sind verschiedene Maßnahmen erforderlich:
Fazit
Die Arbeit der Betreuerinnen und Betreuer an Amphibienübergängen ist von unschätzbarem Wert für den Schutz gefährdeter Amphibienpopulationen. Trotz der Herausforderungen und Gefahren, insbesondere durch Fahrzeuge, die die Zäune beschädigen können, engagieren sich diese Menschen leidenschaftlich für den Erhalt der natürlichen Lebensräume und die Sicherheit der Tiere. Durch angemessene Sicherheitsmaßnahmen und die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten können wir die Risiken minimieren und den Erfolg dieser wichtigen Naturschutzmaßnahmen sicherstellen.
In der Aufnahme
Amphibien wie Frösche, Kröten und Molche unternehmen während der Fortpflanzungszeit oft weite Wanderungen zu ihren Laichgewässern. Dabei müssen sie häufig Straßen überqueren, was sie erheblichen Gefahren aussetzt. Um das Massensterben durch den Straßenverkehr zu verringern, werden Amphibienübergänge eingerichtet. Diese bestehen aus Zäunen, die die Amphibien entlang der Straße leiten, sowie Eimern oder Tunneln, die den Tieren ermöglichen, sicher unter der Straße hindurchzukommen.
Risiken für die Betreuerinnen und Betreuer
Die Betreuerinnen und Betreuer spielen eine entscheidende Rolle bei der Überwachung und Unterstützung dieser Wanderungen. Sie kontrollieren regelmäßig die Zäune, um sicherzustellen, dass sie intakt sind und ordnungsgemäß funktionieren. Dies ist jedoch keine ungefährliche Aufgabe. Insbesondere das Überprüfen und Reparieren der Zäune stellt die Betreuerinnen und Betreuer oft vor Risiken, da sie sich in unmittelbarer Nähe zur Straße befinden, wo Fahrzeuge mit hoher Geschwindigkeit unterwegs sind.
Gefahr durch Fahrzeuge
Die größte Gefahr für die Betreuerinnen und Betreuer besteht darin, dass Fahrzeuge die Amphibienzäune niederfahren oder beschädigen. Oftmals sind diese Zäune aus Kunststoff oder anderen Materialien gefertigt, die bei Kollisionen leicht beschädigt werden können. Ein beschädigter Zaun kann dazu führen, dass Amphibien die Straße überqueren und von Fahrzeugen überfahren werden, was nicht nur eine ökologische Tragödie darstellt, sondern auch die Sicherheit der Betreuerinnen und Betreuer gefährdet.
Maßnahmen zur Minimierung der Gefahren
Um die Sicherheit der Betreuerinnen und Betreuer zu gewährleisten, sind verschiedene Maßnahmen erforderlich:
- Schutzkleidung und Sicherheitsvorkehrungen: Betreuerinnen und Betreuer sollten angemessene Schutzausrüstung tragen, einschließlich reflektierender Kleidung und Helmen, um ihre Sichtbarkeit zu erhöhen und Verletzungen durch Kollisionen zu minimieren.
- Regelmäßige Überprüfung der Zäune: Eine regelmäßige Inspektion der Amphibienzäune ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass sie in gutem Zustand sind und funktionieren. Beschädigte Zäune sollten sofort repariert werden, um das Risiko für die Amphibien und die Betreuerinnen und Betreuer zu reduzieren.
- Zusammenarbeit mit Behörden und Verkehrsteilnehmern: Es ist wichtig, dass die Betreuerinnen und Betreuer mit örtlichen Behörden und Verkehrsteilnehmern zusammenarbeiten, um das Bewusstsein für die Gefahren zu schärfen und sicherere Bedingungen für die Amphibienübergänge zu schaffen.
Fazit
Die Arbeit der Betreuerinnen und Betreuer an Amphibienübergängen ist von unschätzbarem Wert für den Schutz gefährdeter Amphibienpopulationen. Trotz der Herausforderungen und Gefahren, insbesondere durch Fahrzeuge, die die Zäune beschädigen können, engagieren sich diese Menschen leidenschaftlich für den Erhalt der natürlichen Lebensräume und die Sicherheit der Tiere. Durch angemessene Sicherheitsmaßnahmen und die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten können wir die Risiken minimieren und den Erfolg dieser wichtigen Naturschutzmaßnahmen sicherstellen.
In der Aufnahme
- Auf mehrern metern wurde die Amphibien- Leiteinrichtung von einem LKW Anhänger niedergefahren. Wären an dieser Stelle Betreuer*innen gewesen es würde zu Todesfällen kommen!
Artenschutz in Franken®
Signale für den Artenschutz … aus der Sicht unserer Kinder

Signale für den Artenschutz … aus der Sicht unserer Kinder
16/17.03.2025
Eines Tages, als der Frühling gerade begonnen hatte und die Tage wärmer wurden, hörten sie von einer besonderen Reise, die in ihrem Dorf jedes Jahr stattfand: die große Amphibienwanderung.
16/17.03.2025
- Einmal, in einem kleinen Dorf, lebten zwei beste Freunde namens Max und Lena. Sie waren immer draußen in der Natur unterwegs, auf der Suche nach Abenteuern.
Eines Tages, als der Frühling gerade begonnen hatte und die Tage wärmer wurden, hörten sie von einer besonderen Reise, die in ihrem Dorf jedes Jahr stattfand: die große Amphibienwanderung.
Die Amphibien, wie Frösche, Kröten und Molche, machten sich jedes Jahr auf den Weg zu einem nahen gelegenen Teich, um dort ihre Eier zu legen. Doch auf ihrem Weg dorthin mussten sie eine viel befahrene Straße überqueren. Max und Lena waren besorgt, dass die kleinen Tiere von Autos überfahren werden könnten, besonders wenn es dunkel war und die Tiere schwer zu sehen waren.
Also beschlossen sie, etwas zu tun. Sie setzten sich zusammen und überlegten, wie sie den Amphibien helfen könnten. Lena hatte die Idee, kleine Leuchtschilder zu basteln, diese Schilder wollten sie dann an den Seiten der Straße aufstellen, um die Autofahrer zu warnen, dass sie vorsichtig fahren sollten.
Also machten sich Max und Lena an die Arbeit. Sie sammelten bunte Pappe und Stöcke, schnitten und gestalteten die Schilder mit viel Liebe zum Detail. Bald waren sie bereit, ihre selbst gemachten Warnsignale an den Straßenrändern aufzustellen.
Als die Nacht der großen Wanderung kam, postierten sich Max und Lena an verschiedenen Stellen entlang der Straße. Sie steckten ihre fluoreszierenden Schilder auf die Wiese am Übergang, damit die Autofahrer sie sehen konnten. Die ganze Nacht über hielten sie Wache und freuten sich, wenn sie sahen, dass die Autos langsamer fuhren, um den Tieren Platz zu machen.
Am nächsten Morgen, als die Sonne aufging, sahen Max und Lena Hunderte von Fröschen und Kröten sicher den Weg zum Teich überqueren. Sie strahlten vor Stolz und wussten, dass sie etwas Gutes getan hatten, um den kleinen Tieren zu helfen.
Seitdem haben Max und Lena jedes Frühjahr ihre bunten Schilder und Fahnen wieder aufgestellt, um sicherzustellen, dass die Amphibien sicher den Weg über die Straße finden. Und das kleine Dorf war bekannt dafür, wie gut seine Kinder auf die Natur aufpassten und wie sie sich um die kleinen Bewohner kümmerten, die auf ihrem Weg zum Teich waren.
In der Aufnahme
Also beschlossen sie, etwas zu tun. Sie setzten sich zusammen und überlegten, wie sie den Amphibien helfen könnten. Lena hatte die Idee, kleine Leuchtschilder zu basteln, diese Schilder wollten sie dann an den Seiten der Straße aufstellen, um die Autofahrer zu warnen, dass sie vorsichtig fahren sollten.
Also machten sich Max und Lena an die Arbeit. Sie sammelten bunte Pappe und Stöcke, schnitten und gestalteten die Schilder mit viel Liebe zum Detail. Bald waren sie bereit, ihre selbst gemachten Warnsignale an den Straßenrändern aufzustellen.
Als die Nacht der großen Wanderung kam, postierten sich Max und Lena an verschiedenen Stellen entlang der Straße. Sie steckten ihre fluoreszierenden Schilder auf die Wiese am Übergang, damit die Autofahrer sie sehen konnten. Die ganze Nacht über hielten sie Wache und freuten sich, wenn sie sahen, dass die Autos langsamer fuhren, um den Tieren Platz zu machen.
Am nächsten Morgen, als die Sonne aufging, sahen Max und Lena Hunderte von Fröschen und Kröten sicher den Weg zum Teich überqueren. Sie strahlten vor Stolz und wussten, dass sie etwas Gutes getan hatten, um den kleinen Tieren zu helfen.
Seitdem haben Max und Lena jedes Frühjahr ihre bunten Schilder und Fahnen wieder aufgestellt, um sicherzustellen, dass die Amphibien sicher den Weg über die Straße finden. Und das kleine Dorf war bekannt dafür, wie gut seine Kinder auf die Natur aufpassten und wie sie sich um die kleinen Bewohner kümmerten, die auf ihrem Weg zum Teich waren.
In der Aufnahme
- An einem der von uns betreuten Amphibienübergängen haben Kinder kleine fluoreszierenden Schilder aufgestellt um Autofahrer auf diesen sensiblen Bereich aufmerksam zu machen
Artenschutz in Franken®
Neue Voliere für kleine Patienten

Neue Voliere für kleine Patienten
15/16.03 2025
In einer Welt, in der die Natur immer stärker unter Druck gerät, ist es unsere Verantwortung, den verletzlichsten Lebewesen eine Stimme zu geben. Mit großer Freude verkünden wir die Anschaffung einer neuen Wildvogelvoliere – ein Ort der Heilung und Hoffnung für kleine gefiederte Patienten.
15/16.03 2025
- Eine neue Chance für kleine Patienten – Unsere neue Wildvogelvoliere
In einer Welt, in der die Natur immer stärker unter Druck gerät, ist es unsere Verantwortung, den verletzlichsten Lebewesen eine Stimme zu geben. Mit großer Freude verkünden wir die Anschaffung einer neuen Wildvogelvoliere – ein Ort der Heilung und Hoffnung für kleine gefiederte Patienten.
Diese speziell gestaltete Voliere dient als temporäre Unterkunft für Wildvögel, die verletzt, geschwächt oder krank gefunden werden. Hier finden sie Schutz und die nötige Pflege, um ihre Flügel erneut zu stärken und ihre natürliche Freiheit zurückzugewinnen. Jeder Flügelschlag, den wir unterstützen, bringt uns näher an das, was die Natur uns lehrt: Mitgefühl, Geduld und die Kraft der Wiederherstellung.
Die Voliere wurde mit Bedacht entworfen, um die Bedürfnisse unterschiedlichster Wildvogelarten zu erfüllen – jeder Gast wird hier artgerecht untergebracht. Durch die Integration natürlicher Elemente wie Äste, Gräser und Wasserstellen schaffen wir eine Umgebung, die den Vögeln Sicherheit und Wohlbefinden bietet.
Doch es geht nicht nur um den Schutzraum. Diese Voliere symbolisiert die Chance auf einen Neuanfang. Sobald die gefiederten Patienten wieder flugfähig sind, dürfen sie zurück in die Freiheit – dorthin, wo sie hingehören. Jeder Moment des Abschieds ist ein stiller Triumph, der uns daran erinnert, warum diese Arbeit so wichtig ist.
Hinter diesem Projekt stehen unzählige helfende Hände: Tierärzte, Pfleger und engagierte Freiwillige, die Tag für Tag ihr Herzblut in die Rettung der Wildvögel investieren. Doch auch Sie, unsere Unterstützer, sind Teil dieser Mission. Mit Ihrer Hilfe können wir sicherstellen, dass diese Voliere nicht nur ein sicherer Ort bleibt, sondern auch ein Symbol für den Respekt gegenüber der Natur.
Die ersten Gäste haben bereits Einzug gehalten, und der Anblick ihrer Genesung erfüllt uns mit tiefer Dankbarkeit. Wir freuen uns auf viele weitere Geschichten, die hier ihren Anfang nehmen – und auf die magischen Momente, wenn die Türen der Voliere sich öffnen und ein Vogel in die Freiheit fliegt.
Gemeinsam geben wir den Wildvögeln ihre Flügel zurück.
In der Aufnahme
Die Voliere wurde mit Bedacht entworfen, um die Bedürfnisse unterschiedlichster Wildvogelarten zu erfüllen – jeder Gast wird hier artgerecht untergebracht. Durch die Integration natürlicher Elemente wie Äste, Gräser und Wasserstellen schaffen wir eine Umgebung, die den Vögeln Sicherheit und Wohlbefinden bietet.
Doch es geht nicht nur um den Schutzraum. Diese Voliere symbolisiert die Chance auf einen Neuanfang. Sobald die gefiederten Patienten wieder flugfähig sind, dürfen sie zurück in die Freiheit – dorthin, wo sie hingehören. Jeder Moment des Abschieds ist ein stiller Triumph, der uns daran erinnert, warum diese Arbeit so wichtig ist.
Hinter diesem Projekt stehen unzählige helfende Hände: Tierärzte, Pfleger und engagierte Freiwillige, die Tag für Tag ihr Herzblut in die Rettung der Wildvögel investieren. Doch auch Sie, unsere Unterstützer, sind Teil dieser Mission. Mit Ihrer Hilfe können wir sicherstellen, dass diese Voliere nicht nur ein sicherer Ort bleibt, sondern auch ein Symbol für den Respekt gegenüber der Natur.
Die ersten Gäste haben bereits Einzug gehalten, und der Anblick ihrer Genesung erfüllt uns mit tiefer Dankbarkeit. Wir freuen uns auf viele weitere Geschichten, die hier ihren Anfang nehmen – und auf die magischen Momente, wenn die Türen der Voliere sich öffnen und ein Vogel in die Freiheit fliegt.
Gemeinsam geben wir den Wildvögeln ihre Flügel zurück.
In der Aufnahme
- Am 07. März konnten wir die Montage der Voliere abschließen ...
Artenschutz in Franken®
Umgelenkt und dann? ...

Von Erfahrungen mit Amphibien - Umlenk-U´s
23.03.2014 / 2025
Bayern. Alljährlich spielt sich (nicht nur) auf manch Bundesdeutschen Straßen ein wahres Dilemma ab. Viele tausend Amphibien kommen hier zu Tode. Beim Versuch die Trassen der menschlichen Mobilität zu queren, werden sie überrollt.
Abhilfe können neben mobilen, auch dauerhafte Amphibien-Schutzanlagen bieten. Aber nur dann wenn diese nach vorheriger Untersuchung entsprechend professionell geplant und auch installiert wurden.Dauerhafte Schutzanlagen werden meist entlang an der Straßen fest eingebracht. Für den Laien sehen die Schutzeinrichtungen wie Leitplanken aus, die jedoch Bodennah aufgestellt wurden. Als Material werden meist Stahl oder Beton ausgewählt.
23.03.2014 / 2025
Bayern. Alljährlich spielt sich (nicht nur) auf manch Bundesdeutschen Straßen ein wahres Dilemma ab. Viele tausend Amphibien kommen hier zu Tode. Beim Versuch die Trassen der menschlichen Mobilität zu queren, werden sie überrollt.
Abhilfe können neben mobilen, auch dauerhafte Amphibien-Schutzanlagen bieten. Aber nur dann wenn diese nach vorheriger Untersuchung entsprechend professionell geplant und auch installiert wurden.Dauerhafte Schutzanlagen werden meist entlang an der Straßen fest eingebracht. Für den Laien sehen die Schutzeinrichtungen wie Leitplanken aus, die jedoch Bodennah aufgestellt wurden. Als Material werden meist Stahl oder Beton ausgewählt.
Im besten Fall münden die Leiteinrichtungen dann in eine unter der Straße hindurchführende Röhre, die es Amphiben ermöglicht sicher auf die andere Straßenseite zu gelangen. Auf dieser wiederum steht gleichfalls eine Leiteinrichtung welche die Amphibien die nach erfolgter Fortpflanzung zurück in die Sommerlebensräume wandern, sicher zurückleitet. Was sich auf den ersten Blick so gelungen darstellt zeigt bei näherem Hinsehen vielfach jedoch auch elementare Schwachstellen auf. In der Regel findet bei diesen Übergängen keine Kontrolle durch Menschen mehr statt. Somit bleiben Problemstellungen immer wieder im Dunkeln.
Der festen Überzeugung das die Amphibienpopulationen nun gesichert sind, gehen dennoch zahlreiche Populationen zugrunde.
Ein Beispiel das Amphibienleiteinrichtungen nur eingeschränkt funktionieren kann Artenschutz in Franken seit einigen Jahren sehr gut dokumentieren. Entlang einer Wegtrasse wurde eine rund 400 Meter lange (eigentlich viel zu kurze - benötigt würden 700-900 Meter) Leiteinrichtung installiert.
Doch der Name ist eigentlich falsch gewählt denn leiten kann die Einrichtung die Tiere nur sehr eingeschränkt. Denn die Einrichtung endet an beiden Endabschnitten in der Form eines "U". Dieses verläuft rund 3-4 Meter zurück und hat den Sinn die Amphibien dazu anzuregen sich wieder dorthin zu begeben woher diese gekommen sind.
Artenschutz in Franken kontrolliert die Funktionalität dieser Endstücke im Monitoring.
In der Aufnahme
Der festen Überzeugung das die Amphibienpopulationen nun gesichert sind, gehen dennoch zahlreiche Populationen zugrunde.
Ein Beispiel das Amphibienleiteinrichtungen nur eingeschränkt funktionieren kann Artenschutz in Franken seit einigen Jahren sehr gut dokumentieren. Entlang einer Wegtrasse wurde eine rund 400 Meter lange (eigentlich viel zu kurze - benötigt würden 700-900 Meter) Leiteinrichtung installiert.
Doch der Name ist eigentlich falsch gewählt denn leiten kann die Einrichtung die Tiere nur sehr eingeschränkt. Denn die Einrichtung endet an beiden Endabschnitten in der Form eines "U". Dieses verläuft rund 3-4 Meter zurück und hat den Sinn die Amphibien dazu anzuregen sich wieder dorthin zu begeben woher diese gekommen sind.
Artenschutz in Franken kontrolliert die Funktionalität dieser Endstücke im Monitoring.
In der Aufnahme
- In 2025 möchten wir eine Versuchsreihe starten bei der wir den Schutzmechanismus von Amphibien- Umlenk "U`s" überprüfen möchten ... mit der Installation der Leitkomponenten setzen wir ein erstes gemeinsames Zeichen ... hier einige Impressionen kurz nach der Montage der Leiteinheiten ...
Artenschutz in Franken®
Die Bedeutung der Amphibien-Rücklaufsicherung ...

Die Bedeutung der Amphibien-Rücklaufsicherung im Vergleich zur Zulaufsicherung
13/14.03.2025
Allerdings ist die Rücklaufsicherung genauso essenziell, da sie sicherstellt, dass die Amphibien nach einer Umleitung oder Durchquerung eines Hindernisses nicht in gefährdete Bereiche zurückkehren.
13/14.03.2025
- Bei Schutzmaßnahmen für Amphibienwanderungen stehen oft Zulaufsicherungen im Vordergrund, die verhindern, dass Tiere unkontrolliert auf Straßen oder in gefährliche Bereiche gelangen.
Allerdings ist die Rücklaufsicherung genauso essenziell, da sie sicherstellt, dass die Amphibien nach einer Umleitung oder Durchquerung eines Hindernisses nicht in gefährdete Bereiche zurückkehren.
Zulaufsicherung – Lenkung der Amphibienbewegung
Die Zulaufsicherung dient primär dazu, wandernde Amphibien von Gefahrenzonen wie Straßen oder Bahntrassen fernzuhalten. Sie erfolgt meist durch:
Diese Maßnahmen sind notwendig, da viele Amphibien ihrem Instinkt folgen und immer denselben Wanderweg nutzen. Ohne eine effektive Zulaufsicherung würden sie Straßen überqueren und durch Fahrzeuge getötet oder in unüberwindbaren Hindernissen gefangen werden.
Rücklaufsicherung – Schutz vor tödlicher Umkehrbewegung
Die Rücklaufsicherung verhindert, dass die Tiere nach dem Überwinden eines Hindernisses in den Gefahrenbereich zurückkehren. Dies ist genauso wichtig, weil:
Typische Rücklaufsicherungen umfassen:
Zusammenwirken beider Systeme für einen optimalen Schutz
Ohne eine Rücklaufsicherung bleibt eine Zulaufsicherung unvollständig, da die Tiere in Gefahr geraten könnten, sobald sie versuchen, den Rückweg anzutreten. Nur wenn beide Systeme gemeinsam funktionieren, ist eine umfassende und nachhaltige Schutzmaßnahme gegeben.
Insgesamt sind Amphibienschutzanlagen dann am effektivsten, wenn sie die gesamte Wanderbewegung berücksichtigen – sowohl beim Hinweg zur Laichstätte als auch auf dem Rückweg in die Sommerhabitate.
In der Aufnahme
Die Zulaufsicherung dient primär dazu, wandernde Amphibien von Gefahrenzonen wie Straßen oder Bahntrassen fernzuhalten. Sie erfolgt meist durch:
- Amphibienleitzäune, die die Tiere zu Durchlässen oder Fangeimern führen.
- Stopprinnen, die Amphibien daran hindern, gefährliche Bereiche zu überqueren.
- Führungsstrukturen, die sie zu sicheren Übergängen wie Tunneln oder Brücken leiten.
Diese Maßnahmen sind notwendig, da viele Amphibien ihrem Instinkt folgen und immer denselben Wanderweg nutzen. Ohne eine effektive Zulaufsicherung würden sie Straßen überqueren und durch Fahrzeuge getötet oder in unüberwindbaren Hindernissen gefangen werden.
Rücklaufsicherung – Schutz vor tödlicher Umkehrbewegung
Die Rücklaufsicherung verhindert, dass die Tiere nach dem Überwinden eines Hindernisses in den Gefahrenbereich zurückkehren. Dies ist genauso wichtig, weil:
- Viele Amphibien desorientiert sind und nach einer Umleitung instinktiv versuchen, den gewohnten Weg zurückzugehen.
- Tiere nach der Laichzeit eine Rückwanderung antreten, wodurch eine erneute Gefährdung entsteht.
- Schutzanlagen ohne Rücklaufsicherung ineffektiv werden, da ein Teil der Population trotz der Maßnahmen sterben könnte.
Typische Rücklaufsicherungen umfassen:
- Schräge oder überhängende Barrieren, die den Tieren den Weg zurück versperren.
- Einseitig begehbare Stopprinnen, die das Überqueren in eine Richtung erlauben, aber die Rückkehr verhindern.
- Leiteinrichtungen mit Rückflusskontrolle, die den natürlichen Bewegungsablauf steuern.
Zusammenwirken beider Systeme für einen optimalen Schutz
Ohne eine Rücklaufsicherung bleibt eine Zulaufsicherung unvollständig, da die Tiere in Gefahr geraten könnten, sobald sie versuchen, den Rückweg anzutreten. Nur wenn beide Systeme gemeinsam funktionieren, ist eine umfassende und nachhaltige Schutzmaßnahme gegeben.
Insgesamt sind Amphibienschutzanlagen dann am effektivsten, wenn sie die gesamte Wanderbewegung berücksichtigen – sowohl beim Hinweg zur Laichstätte als auch auf dem Rückweg in die Sommerhabitate.
In der Aufnahme
- Rücklaufsicherung an einem Amphibien-Laichgewässer ... Artenschutz in Franken® installiert viele hundert Meter dieser Komponenten um einen bestmöglichen Amphibienschutz in dem von uns betreuten Bereich zu garantieren!
Artenschutz in Franken®
Der Gartenbaumläufer (Certhia brachydactyla)

Der Gartenbaumläufer (Certhia brachydactyla) – Ein spezialisierter Kletterkünstler der Wälder
12/13.03.2025
Diese Art, die vornehmlich in gemäßigten und mediterranen Wäldern Europas und Nordwestafrikas vorkommt, zeichnet sich durch ein komplexes Zusammenspiel aus morphologischen, ethologischen und ökologischen Besonderheiten aus.
12/13.03.2025
- Der Gartenbaumläufer (Certhia brachydactyla), ein Vertreter der Familie der Baumläufer (Certhiidae), ist eine hochgradig spezialisierte Vogelart, die durch ihre einzigartige Anpassung an das vertikale Leben auf Baumstämmen und Ästen charakterisiert ist.
Diese Art, die vornehmlich in gemäßigten und mediterranen Wäldern Europas und Nordwestafrikas vorkommt, zeichnet sich durch ein komplexes Zusammenspiel aus morphologischen, ethologischen und ökologischen Besonderheiten aus.
Morphologische Merkmale und Anpassungen
Der Gartenbaumläufer ist mit einer Körperlänge von etwa 12,5 cm und einem Gewicht von 7 bis 10 g ein zierlicher Vogel, dessen Tarnfärbung ihn nahezu unsichtbar an Baumrinden erscheinen lässt. Sein bräunlich gemustertes Obergefieder mit feinen weißen Flecken dient der optimalen Tarnung, während die hell cremefarbene Unterseite ihn optisch an das diffuse Lichtspiel der Waldumgebung anpasst.
Die wohl auffälligste Anpassung ist der lange, dünn gebogene Schnabel, der perfekt für das Sondieren von Rindenritzen nach Insektenlarven, Spinnen und anderen Kleintieren geeignet ist. Die auffallend langen, steifen Schwanzfedern wirken als Stütze beim vertikalen Klettern und erinnern funktionell an das Stützschwanzprinzip der Spechte (Picidae). Ergänzend dazu verfügen die kräftigen Zehen mit scharfen, gebogenen Krallen über eine außergewöhnliche Greiffähigkeit, was dem Gartenbaumläufer eine nahezu mühelose Fortbewegung an Baumstämmen ermöglicht.
Lebensraum und Verbreitung
Der Gartenbaumläufer bevorzugt alte, strukturreiche Laub- und Mischwälder, in denen ein hoher Anteil an rauhborkigen Bäumen (z. B. Eichen, Ulmen, Platanen) vorkommt. Sein Verbreitungsgebiet erstreckt sich von Süd- und Mitteleuropa über den Westbalkan bis nach Nordwestafrika. Die Höhenverbreitung variiert stark, wobei er in südlichen Regionen auch in niedrigeren Lagen (< 100 m ü. NN) anzutreffen ist, während er in Mittelgebirgen bis zu 1800 m vorkommt.
Ein markanter Aspekt ist die Habitatselektion, die den Gartenbaumläufer von seinem nahen Verwandten, dem Waldbaumläufer (Certhia familiaris), unterscheidet. Während letzterer stärker an Nadelwälder gebunden ist, bevorzugt C. brachydactyla wärmere Regionen mit Laubwaldbeständen, insbesondere mit einer hohen Dichte an Bäumen mit tief gefurchter Rinde.
Verhalten und Fortpflanzung
Sein charakteristisches Fortbewegungsmuster besteht aus einer spiralförmigen Aufwärtsbewegung entlang von Baumstämmen, wobei er sich durch kurze Flugsprünge von einem Baum zum nächsten bewegt. Im Gegensatz zu Spechten klettert er niemals kopfüber nach unten, sondern beginnt nach jedem erklommenen Baum von neuem am Stammfuß.
Die Brutzeit erstreckt sich von März bis Juni, wobei der Nestbau bevorzugt in Rindenspalten, hinter abstehenden Baumrinden oder in Nischen stattfindet. Das Nest besteht aus feinen Zweigen, Gras und Federn und wird mit einer gut isolierenden Polsterung ausgekleidet. Die Gelege umfassen 4 bis 6 Eier, die vom Weibchen über einen Zeitraum von 13 bis 15 Tagen bebrütet werden. Die Nestlingszeit beträgt etwa 15 bis 17 Tage, während die Jungvögel noch mehrere Wochen von den Eltern betreut werden.
Kommunikation und Lautäußerungen
Akustisch zeichnet sich der Gartenbaumläufer durch seinen hohen, feinen und melodischen Gesang aus, der sich deutlich von dem seines Verwandten, des Waldbaumläufers, unterscheidet. Während die Rufe aus feinen, hohen "tsee" oder "sit" Lauten bestehen, ist der Gesang eine komplexe, variabel ansteigende Tonfolge, die oft in kurzen Intervallen wiederholt wird.
Ökologische Bedeutung und Schutzstatus
Als insektivorer Baumrindenbewohner erfüllt der Gartenbaumläufer eine bedeutende Funktion im Ökosystem, indem er Schadinsekten reguliert und damit zur Gesundheit der Wälder beiträgt. Trotz einer gewissen Anpassungsfähigkeit an Parks und Gärten mit altem Baumbestand ist die Art sensibel gegenüber Habitatverlusten durch intensive Forstwirtschaft, Monokulturen und das Entfernen von Totholz, welches als wichtiger Lebensraum für seine Nahrung dient.
Aufgrund seines vergleichsweise stabilen Bestandes wird Certhia brachydactyla derzeit von der IUCN als nicht gefährdet (Least Concern) eingestuft. Dennoch erfordert der Schutz naturnaher Laubwälder sowie eine nachhaltige Waldbewirtschaftung langfristige Maßnahmen, um stabile Populationen zu gewährleisten.
Fazit
Der Gartenbaumläufer ist ein eindrucksvolles Beispiel für die evolutionäre Spezialisierung an ein Leben in der vertikalen Baumrindenwelt. Seine morphologischen Anpassungen, sein einzigartiges Kletterverhalten und seine ökologische Bedeutung als Prädator von Baumrindeninsekten unterstreichen seinen Stellenwert in mitteleuropäischen Wäldern. Die Sicherstellung geeigneter Habitate bleibt jedoch essenziell, um den Fortbestand dieser faszinierenden Vogelart langfristig zu gewährleisten.
In der Aufnahme von Helga Zinnecker
- Gartenbaumläufer an Futterstelle
Artenschutz in Franken®
Die Bedeutung von Amphibienstopprinnen zum Schutz von Lebensräumen

Die Bedeutung von Amphibienstopprinnen zum Schutz von Lebensräumen
11/12.03.2025
Diese Wanderungen sind entscheidend für ihre Fortpflanzung und das Überleben ihrer Populationen. Eine wichtige Maßnahme zur Reduzierung der Schäden an Einrichtungen während dieser Wanderungen sind Amphibienstopprinnen.
11/12.03.2025
- Amphibien sind faszinierende Lebewesen, die während ihrer jährlichen Wanderungen oft auf Hindernisse stoßen, die ihre Bewegungen behindern oder sogar gefährden können.
Diese Wanderungen sind entscheidend für ihre Fortpflanzung und das Überleben ihrer Populationen. Eine wichtige Maßnahme zur Reduzierung der Schäden an Einrichtungen während dieser Wanderungen sind Amphibienstopprinnen.
Amphibienstopprinnen sind speziell gestaltete Vorrichtungen, die entlang von Straßen oder anderen Barrieren installiert werden, um Amphibien zu helfen, sicher zu wandern, ohne von Fahrzeugen überfahren oder anderweitig verletzt zu werden. Diese Einrichtungen bestehen oft aus Barrieren, die Amphibien dazu bewegen, in Leiteinrichtungen zu gelangen, die sie dann sicher unter oder über Straßen führen, ohne die Gefahr von Unfällen.
Die Notwendigkeit solcher Vorkehrungen wird besonders deutlich, wenn man die potenziellen Schäden betrachtet, die Amphibienwanderungen an Einrichtungen verursachen können. Ohne Schutzmaßnahmen könnten sie sich auf Straßen und anderen menschlichen Infrastrukturen sammeln, was zu Verkehrsstörungen, Unfällen und erheblichen Mortalitätsraten führen könnte.
Amphibienstopprinnen tragen nicht nur zur Sicherheit der Amphibien bei, sondern auch zur Erhaltung der Biodiversität. Indem sie den Lebensraum dieser Tiere schützen, helfen sie indirekt auch anderen Arten, die von den Ökosystemen abhängig sind, die Amphibien bewohnen.
In der Zukunft ist es entscheidend, diese Maßnahmen weiter zu erforschen und zu verbessern, um die Effizienz und Wirksamkeit von Amphibienstopprinnen zu maximieren. Dies erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern, Naturschutzorganisationen und Regierungsbehörden, um Lösungen zu finden, die sowohl die Bedürfnisse der Amphibien als auch die der menschlichen Gemeinschaften berücksichtigen.
Fazit
Insgesamt spielen Amphibienstopprinnen eine entscheidende Rolle beim Schutz dieser faszinierenden Tiere und bei der Minimierung der menschlichen Einflüsse auf ihre Lebensräume während ihrer Wanderungen. Sie sind ein lebendiges Beispiel für die Möglichkeiten, wie wir durch gezielte Maßnahmen zur Kollisionsvermeidung eine nachhaltigere Koexistenz zwischen Mensch und Natur fördern können.
In der Aufnahme
Die Notwendigkeit solcher Vorkehrungen wird besonders deutlich, wenn man die potenziellen Schäden betrachtet, die Amphibienwanderungen an Einrichtungen verursachen können. Ohne Schutzmaßnahmen könnten sie sich auf Straßen und anderen menschlichen Infrastrukturen sammeln, was zu Verkehrsstörungen, Unfällen und erheblichen Mortalitätsraten führen könnte.
Amphibienstopprinnen tragen nicht nur zur Sicherheit der Amphibien bei, sondern auch zur Erhaltung der Biodiversität. Indem sie den Lebensraum dieser Tiere schützen, helfen sie indirekt auch anderen Arten, die von den Ökosystemen abhängig sind, die Amphibien bewohnen.
In der Zukunft ist es entscheidend, diese Maßnahmen weiter zu erforschen und zu verbessern, um die Effizienz und Wirksamkeit von Amphibienstopprinnen zu maximieren. Dies erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern, Naturschutzorganisationen und Regierungsbehörden, um Lösungen zu finden, die sowohl die Bedürfnisse der Amphibien als auch die der menschlichen Gemeinschaften berücksichtigen.
Fazit
Insgesamt spielen Amphibienstopprinnen eine entscheidende Rolle beim Schutz dieser faszinierenden Tiere und bei der Minimierung der menschlichen Einflüsse auf ihre Lebensräume während ihrer Wanderungen. Sie sind ein lebendiges Beispiel für die Möglichkeiten, wie wir durch gezielte Maßnahmen zur Kollisionsvermeidung eine nachhaltigere Koexistenz zwischen Mensch und Natur fördern können.
In der Aufnahme
- Außerhalb der Amphibienwanderung werden die Rinnen mit speziellen Abdeckungen versehen um das Einfallen von Schmutz,sowie Beschädigungen an den Gittern zu vermeiden. Dennoch kommt es immer wieder vor das Fahrzeuge (in der Regel Maschinen aus der industriell geführten Land-und Forstwirtschaft) diese höchst robusten Komponenten beschädigen. Da kann man sich sehr gut vorstellen was erst mit zarten Amphibien geschieht wenn diese auf solche Fahrzeuge treffen.
Artenschutz in Franken®
Der Niedergang der Kiebitzbestände in Deutschland ...

Der Niedergang der Kiebitzbestände in Deutschland ...
10/11.03.2025
... ist tatsächlich besorgniserregend.
Diese Vögel sind typischerweise auf feuchten Wiesen und Weiden anzutreffen, wo sie brüten. Die Hauptgründe für ihren Rückgang sind die Intensivierung der Landwirtschaft, Verlust und Fragmentierung ihres Lebensraums sowie der Einsatz von Pestiziden, die ihre Nahrungsgrundlage verringern.
10/11.03.2025
... ist tatsächlich besorgniserregend.
Diese Vögel sind typischerweise auf feuchten Wiesen und Weiden anzutreffen, wo sie brüten. Die Hauptgründe für ihren Rückgang sind die Intensivierung der Landwirtschaft, Verlust und Fragmentierung ihres Lebensraums sowie der Einsatz von Pestiziden, die ihre Nahrungsgrundlage verringern.
Es gibt jedoch Hoffnung für ihre Bestandserholung. Naturschutzmaßnahmen wie die Schaffung von Schutzgebieten, die Förderung extensiver Landwirtschaftsmethoden und gezielte Brutplatzsicherungen haben positive Effekte gezeigt. Auch Initiativen zur Aufklärung und Sensibilisierung der Landwirte können helfen, die Lebensbedingungen für Kiebitze zu verbessern.
Ein entscheidender Faktor ist die Zusammenarbeit zwischen Naturschutzorganisationen, Landwirten und der Politik, um nachhaltige Lösungen zu entwickeln. Trotz der Herausforderungen gibt es also durchaus Möglichkeiten, den Bestand der Kiebitze langfristig zu stabilisieren und hoffentlich wieder zu vermehren.
Aufnahme von Klaus Sanwald
Ein entscheidender Faktor ist die Zusammenarbeit zwischen Naturschutzorganisationen, Landwirten und der Politik, um nachhaltige Lösungen zu entwickeln. Trotz der Herausforderungen gibt es also durchaus Möglichkeiten, den Bestand der Kiebitze langfristig zu stabilisieren und hoffentlich wieder zu vermehren.
Aufnahme von Klaus Sanwald
- Der Kiebitz (Vanellus vanellus)
Artenschutz in Franken®
Illegale Müllentsorgung: Eine Umweltgefahr und moralische Verfehlung

Illegale Müllentsorgung: Eine Umweltgefahr und moralische Verfehlung
09/10.03.2025
Trotz strenger Vorschriften zur Abfallentsorgung werden vielerorts Abfälle unsachgemäß in Wäldern, an Straßenrändern oder in Gewässern entsorgt. Dieses Verhalten ist nicht nur gesetzeswidrig, sondern auch eine massive Belastung für Natur und Mensch.
09/10.03.2025
- Die illegale Müllentsorgung stellt ein gravierendes Umweltproblem dar, das sowohl ökologische als auch gesellschaftliche Folgen hat.
Trotz strenger Vorschriften zur Abfallentsorgung werden vielerorts Abfälle unsachgemäß in Wäldern, an Straßenrändern oder in Gewässern entsorgt. Dieses Verhalten ist nicht nur gesetzeswidrig, sondern auch eine massive Belastung für Natur und Mensch.
Umweltauswirkungen der illegalen Müllentsorgung
Illegale Abfallentsorgung führt zu gravierenden Umweltproblemen. Gefahrenstoffe können in den Boden und das Grundwasser gelangen, wodurch Trinkwasserquellen kontaminiert werden. Plastikmüll zerfällt in Mikroplastikpartikel, die von Tieren aufgenommen werden und letztendlich über die Nahrungskette auch den Menschen erreichen. Zudem beeinträchtigen wilde Mülldeponien das Landschaftsbild und senken die Lebensqualität.
Gesellschaftliche und wirtschaftliche Folgen
Neben den ökologischen Folgen hat illegale Müllentsorgung auch erhebliche wirtschaftliche Konsequenzen. Kommunen und Umweltbehörden müssen hohe Kosten für die Beseitigung der illegalen Ablagerungen aufbringen, die letztendlich von der Allgemeinheit getragen werden. Auch der Tourismus leidet unter verschmutzten Landschaften, was wirtschaftliche Einbußen zur Folge hat.
Missbrauch von Kunststoffsäcken mit dem "Blauen Engel"
Besonders verwerflich ist die Verwendung von Kunststoffmüllsäcken mit dem Umweltzeichen "Blauer Engel" für illegale Entsorgungen. Das Siegel steht für ressourcenschonende, umweltfreundliche Produkte, die bei sachgemäßer Nutzung zur Reduzierung von Umweltbelastungen beitragen sollen. Wenn jedoch mit solchen Säcken illegal Abfälle in der Natur entsorgt werden, wird das Umweltzeichen ad absurdum geführt. Statt zur umweltgerechten Abfallentsorgung beizutragen, werden die positiven Eigenschaften dieser Säcke in einen negativen Kontext gestellt und missbraucht.
Notwendige Maßnahmen gegen illegale Müllentsorgung
Um die Problematik der illegalen Müllentsorgung einzudämmen, sind umfassende Maßnahmen erforderlich:
Fazit
Illegale Müllentsorgung ist ein schwerwiegendes Umweltvergehen mit langfristigen Konsequenzen. Besonders der Missbrauch von umweltfreundlich deklarierten Produkten wie den mit dem "Blauen Engel" ausgezeichneten Müllsäcken zeigt, wie leicht das Umweltbewusstsein durch fahrlässiges Verhalten untergraben werden kann. Die Gesellschaft muss gemeinsam gegen Umweltverschmutzung vorgehen, um Natur und Lebensqualität für kommende Generationen zu bewahren.
In der Aufnahme
Illegale Abfallentsorgung führt zu gravierenden Umweltproblemen. Gefahrenstoffe können in den Boden und das Grundwasser gelangen, wodurch Trinkwasserquellen kontaminiert werden. Plastikmüll zerfällt in Mikroplastikpartikel, die von Tieren aufgenommen werden und letztendlich über die Nahrungskette auch den Menschen erreichen. Zudem beeinträchtigen wilde Mülldeponien das Landschaftsbild und senken die Lebensqualität.
Gesellschaftliche und wirtschaftliche Folgen
Neben den ökologischen Folgen hat illegale Müllentsorgung auch erhebliche wirtschaftliche Konsequenzen. Kommunen und Umweltbehörden müssen hohe Kosten für die Beseitigung der illegalen Ablagerungen aufbringen, die letztendlich von der Allgemeinheit getragen werden. Auch der Tourismus leidet unter verschmutzten Landschaften, was wirtschaftliche Einbußen zur Folge hat.
Missbrauch von Kunststoffsäcken mit dem "Blauen Engel"
Besonders verwerflich ist die Verwendung von Kunststoffmüllsäcken mit dem Umweltzeichen "Blauer Engel" für illegale Entsorgungen. Das Siegel steht für ressourcenschonende, umweltfreundliche Produkte, die bei sachgemäßer Nutzung zur Reduzierung von Umweltbelastungen beitragen sollen. Wenn jedoch mit solchen Säcken illegal Abfälle in der Natur entsorgt werden, wird das Umweltzeichen ad absurdum geführt. Statt zur umweltgerechten Abfallentsorgung beizutragen, werden die positiven Eigenschaften dieser Säcke in einen negativen Kontext gestellt und missbraucht.
Notwendige Maßnahmen gegen illegale Müllentsorgung
Um die Problematik der illegalen Müllentsorgung einzudämmen, sind umfassende Maßnahmen erforderlich:
- Strengere Kontrollen und höhere Strafen: Nur wenn Verstöße konsequent verfolgt und sanktioniert werden, kann eine abschreckende Wirkung erzielt werden.
- Bessere Aufklärung und Sensibilisierung: Bildungsprogramme und Kampagnen sollten das Bewusstsein für die Folgen illegaler Müllentsorgung schärfen.
- Erweiterung von Entsorgungsmöglichkeiten: Der Ausbau von kostenlosen oder kostengünstigen Entsorgungsmöglichkeiten für Sperr- und Sondermüll kann illegale Ablagerungen reduzieren.
- Bürgerbeteiligung und Meldesysteme: Apps und Hotlines, über die illegale Ablagerungen gemeldet werden können, unterstützen eine schnellere Beseitigung und Ahndung von Umweltstraftaten.
Fazit
Illegale Müllentsorgung ist ein schwerwiegendes Umweltvergehen mit langfristigen Konsequenzen. Besonders der Missbrauch von umweltfreundlich deklarierten Produkten wie den mit dem "Blauen Engel" ausgezeichneten Müllsäcken zeigt, wie leicht das Umweltbewusstsein durch fahrlässiges Verhalten untergraben werden kann. Die Gesellschaft muss gemeinsam gegen Umweltverschmutzung vorgehen, um Natur und Lebensqualität für kommende Generationen zu bewahren.
In der Aufnahme
- Zynischer geht es wohl kaum noch .. illegale Müllentsorgung unter missbräuchlicher Verwendung eines Umweltlogos!
Artenschutz in Franken®
Vom Steigerforst zum Klimaforst ...

Vom Steigerforst zum Klimaforst ...
08/09.03.2025
Diese Anpassung erfolgt in Bezug auf Temperatur, Niederschlag, Bodenbeschaffenheit und andere ökologische Faktoren. Ziel des Umbaus von Wäldern zu Klimawäldern ist es, diese Ökosysteme widerstandsfähiger gegen die zunehmenden Auswirkungen des Klimawandels zu machen, wie z.B. häufigere Extremwetterereignisse und veränderte klimatische Bedingungen.
08/09.03.2025
- Ein Klimawald ist ein Waldökosystem, das durch seine spezifische Struktur und Zusammensetzung an die klimatischen Bedingungen eines bestimmten Gebiets angepasst ist.
Diese Anpassung erfolgt in Bezug auf Temperatur, Niederschlag, Bodenbeschaffenheit und andere ökologische Faktoren. Ziel des Umbaus von Wäldern zu Klimawäldern ist es, diese Ökosysteme widerstandsfähiger gegen die zunehmenden Auswirkungen des Klimawandels zu machen, wie z.B. häufigere Extremwetterereignisse und veränderte klimatische Bedingungen.
Jedoch ist es wichtig, diesen Umbau mit Vorsicht zu behandeln, insbesondere im Hinblick auf die Biodiversität. Biodiversität bezeichnet die Vielfalt und die Vielzahl der Arten in einem Ökosystem. Durch den gezielten Umbau könnten bestimmte Arten bevorzugt oder benachteiligt werden. Zum Beispiel könnten schnell wachsende, klimatolerante Baumarten bevorzugt gepflanzt werden, während langsam wachsende Arten oder solche, die an spezielle Mikrohabitate angepasst sind, verdrängt werden könnten. Dies könnte zu einem Verlust an genetischer Vielfalt und zur Reduzierung der Artenvielfalt führen.
Zusätzlich müssen bei der Umwandlung von Wäldern zu Klimawäldern auch andere ökologische Aspekte berücksichtigt werden, wie die Veränderung von Nahrungsnetzen, Lebensraumverluste für bestimmte Tierarten und die Auswirkungen auf Bodenorganismen. Daher ist eine ausgewogene Herangehensweise erforderlich, die sowohl die Anpassung an den Klimawandel als auch den Erhalt der Biodiversität berücksichtigt.
In der Aufnahme
Zusätzlich müssen bei der Umwandlung von Wäldern zu Klimawäldern auch andere ökologische Aspekte berücksichtigt werden, wie die Veränderung von Nahrungsnetzen, Lebensraumverluste für bestimmte Tierarten und die Auswirkungen auf Bodenorganismen. Daher ist eine ausgewogene Herangehensweise erforderlich, die sowohl die Anpassung an den Klimawandel als auch den Erhalt der Biodiversität berücksichtigt.
In der Aufnahme
- Auch der Steigerforst wird an der einen oder anderen Stelle "vorsichtig und nachhaltig" zu einem "artenreichen Klimawald" umgestaltet ... die Aufnahme signalisiert wohl dieses Prinzip!
Artenschutz in Franken®
Elstern - natürliche Indikatoren

Elstern - natürliche Indikatoren
07/08.03.2025
Eine viel zu intensive Landwirtschaft mit all ihren negativen Folgen für zahllose Wildtiere, Flächenversiegelungen, Vergrämung, Vergiftungen und auch Abschüsse sowie weitere negative Aspekte verdrängen diese Tiere aus ihrem angestammten Biotop.
07/08.03.2025
- Elstern geraten in urbanen Bereichen vermehrt in den Fokus des Menschen, auch deshalb, weil ihr Lebensraum in der freien Feldflur mehr und mehr zerstört wird.
Eine viel zu intensive Landwirtschaft mit all ihren negativen Folgen für zahllose Wildtiere, Flächenversiegelungen, Vergrämung, Vergiftungen und auch Abschüsse sowie weitere negative Aspekte verdrängen diese Tiere aus ihrem angestammten Biotop.
Die Tiere, die ausweichen können, weichen aus und erschließen Sekundärhabitate mehr oder minder erfolgreich. So auch die Elster die sich zunehmend dem Lebensraum Stadt zuwendet, da dieser für diese Art zunehmend attraktiver wird. Oder sollen wir besser formulieren, ein Bereich vorhanden ist der ihnen ein effektiveres Überleben eröffnet.
Elstern sind somit auch Indikatoren welche uns, konkret aufzeigen welche Fehler wir Menschen in ihrer und unserer Umwelt machen. Wäre es nicht dringlich an der Zeit Primärhabitate erneut in eine auch für die Elstern attraktive Form zu bringen, anstatt über Tiere zu schimpfen, die letztendlich nichts anderes tun als den Versuch, der Arterhaltung zu starten.
Eine Überpopulation ist in einem sich selbst regulierenden, natürlichen Ökosystem nicht möglich das hier vielfältige Akteure zusammenwirken. Auch Elstern haben natürliche Fressfeinde, die in einem funktionierenden Ökosystem vorhanden sind.
In der Aufnahme von Helga Zinnecker
Elstern sind somit auch Indikatoren welche uns, konkret aufzeigen welche Fehler wir Menschen in ihrer und unserer Umwelt machen. Wäre es nicht dringlich an der Zeit Primärhabitate erneut in eine auch für die Elstern attraktive Form zu bringen, anstatt über Tiere zu schimpfen, die letztendlich nichts anderes tun als den Versuch, der Arterhaltung zu starten.
Eine Überpopulation ist in einem sich selbst regulierenden, natürlichen Ökosystem nicht möglich das hier vielfältige Akteure zusammenwirken. Auch Elstern haben natürliche Fressfeinde, die in einem funktionierenden Ökosystem vorhanden sind.
In der Aufnahme von Helga Zinnecker
- Elstermännchen
Artenschutz in Franken®
Neue Voliere für kleine Patienten

Neue Voliere für kleine Patienten
06/07.03 2025
In einer Welt, in der die Natur immer stärker unter Druck gerät, ist es unsere Verantwortung, den verletzlichsten Lebewesen eine Stimme zu geben. Mit großer Freude verkünden wir die Anschaffung einer neuen Wildvogelvoliere – ein Ort der Heilung und Hoffnung für kleine gefiederte Patienten.
06/07.03 2025
- Eine neue Chance für kleine Patienten – Unsere neue Wildvogelvoliere
In einer Welt, in der die Natur immer stärker unter Druck gerät, ist es unsere Verantwortung, den verletzlichsten Lebewesen eine Stimme zu geben. Mit großer Freude verkünden wir die Anschaffung einer neuen Wildvogelvoliere – ein Ort der Heilung und Hoffnung für kleine gefiederte Patienten.
Diese speziell gestaltete Voliere dient als temporäre Unterkunft für Wildvögel, die verletzt, geschwächt oder krank gefunden werden. Hier finden sie Schutz und die nötige Pflege, um ihre Flügel erneut zu stärken und ihre natürliche Freiheit zurückzugewinnen. Jeder Flügelschlag, den wir unterstützen, bringt uns näher an das, was die Natur uns lehrt: Mitgefühl, Geduld und die Kraft der Wiederherstellung.
Die Voliere wurde mit Bedacht entworfen, um die Bedürfnisse unterschiedlichster Wildvogelarten zu erfüllen – jeder Gast wird hier artgerecht untergebracht. Durch die Integration natürlicher Elemente wie Äste, Gräser und Wasserstellen schaffen wir eine Umgebung, die den Vögeln Sicherheit und Wohlbefinden bietet.
Doch es geht nicht nur um den Schutzraum. Diese Voliere symbolisiert die Chance auf einen Neuanfang. Sobald die gefiederten Patienten wieder flugfähig sind, dürfen sie zurück in die Freiheit – dorthin, wo sie hingehören. Jeder Moment des Abschieds ist ein stiller Triumph, der uns daran erinnert, warum diese Arbeit so wichtig ist.
Hinter diesem Projekt stehen unzählige helfende Hände: Tierärzte, Pfleger und engagierte Freiwillige, die Tag für Tag ihr Herzblut in die Rettung der Wildvögel investieren. Doch auch Sie, unsere Unterstützer, sind Teil dieser Mission. Mit Ihrer Hilfe können wir sicherstellen, dass diese Voliere nicht nur ein sicherer Ort bleibt, sondern auch ein Symbol für den Respekt gegenüber der Natur.
Die ersten Gäste haben bereits Einzug gehalten, und der Anblick ihrer Genesung erfüllt uns mit tiefer Dankbarkeit. Wir freuen uns auf viele weitere Geschichten, die hier ihren Anfang nehmen – und auf die magischen Momente, wenn die Türen der Voliere sich öffnen und ein Vogel in die Freiheit fliegt.
Gemeinsam geben wir den Wildvögeln ihre Flügel zurück.
In der Aufnahme
Die Voliere wurde mit Bedacht entworfen, um die Bedürfnisse unterschiedlichster Wildvogelarten zu erfüllen – jeder Gast wird hier artgerecht untergebracht. Durch die Integration natürlicher Elemente wie Äste, Gräser und Wasserstellen schaffen wir eine Umgebung, die den Vögeln Sicherheit und Wohlbefinden bietet.
Doch es geht nicht nur um den Schutzraum. Diese Voliere symbolisiert die Chance auf einen Neuanfang. Sobald die gefiederten Patienten wieder flugfähig sind, dürfen sie zurück in die Freiheit – dorthin, wo sie hingehören. Jeder Moment des Abschieds ist ein stiller Triumph, der uns daran erinnert, warum diese Arbeit so wichtig ist.
Hinter diesem Projekt stehen unzählige helfende Hände: Tierärzte, Pfleger und engagierte Freiwillige, die Tag für Tag ihr Herzblut in die Rettung der Wildvögel investieren. Doch auch Sie, unsere Unterstützer, sind Teil dieser Mission. Mit Ihrer Hilfe können wir sicherstellen, dass diese Voliere nicht nur ein sicherer Ort bleibt, sondern auch ein Symbol für den Respekt gegenüber der Natur.
Die ersten Gäste haben bereits Einzug gehalten, und der Anblick ihrer Genesung erfüllt uns mit tiefer Dankbarkeit. Wir freuen uns auf viele weitere Geschichten, die hier ihren Anfang nehmen – und auf die magischen Momente, wenn die Türen der Voliere sich öffnen und ein Vogel in die Freiheit fliegt.
Gemeinsam geben wir den Wildvögeln ihre Flügel zurück.
In der Aufnahme
- Ende Februar starten wir mit den Erdarbeiten .. doch noch ist das Erdreich zu feucht ... wir entnehmen daher ersteinmal die Grasnarbe ...
Artenschutz in Franken®
Stele der Biodiversität® - Umweltpoint: Dorsten – Wulfen

Stele der Biodiversität® - Umweltpoint: Dorsten – Wulfen
05/06.03 2025
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutzes in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Deutschen Postcode Lotterie und weiteren Partern unabhängig voneinander unterstützt wird.
05/06.03 2025
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutzes in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Deutschen Postcode Lotterie und weiteren Partern unabhängig voneinander unterstützt wird.
Dorsten GT-Wulfen / Nordrhein - Westfalen. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen, kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Baukörper gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper und auch deren Umfeld zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
Wenn auch noch die Umweltbildung einen wichtigen Projektaspekt vereinnahmt, dann sind wir der festen Überzeugung, hier einigen wertvollen Beitrag für gerade die uns nachfolgende Generation zu leisten!
In dieser Aufnahme
Wenn auch noch die Umweltbildung einen wichtigen Projektaspekt vereinnahmt, dann sind wir der festen Überzeugung, hier einigen wertvollen Beitrag für gerade die uns nachfolgende Generation zu leisten!
In dieser Aufnahme
- Mit der Installation eines zukünftig lebendigen Ökosystem - Industriezaun - werden wir neue Maßstäbe des Artenschutzes setzen ..
Artenschutz in Franken®
Rettet die Insekten ... so aber sicherlich nicht!

Rettet die Insekten ... so aber sicherlich nicht!
04/05.03.2025
Doch im sogenannten „Tagesgeschäft“, also im praktischen landwirtschaftlichen und kommunalen Umgang mit Naturschutzmaßnahmen, zeigt sich, dass die Umsetzung oft nur eingeschränkt zum gewünschten Ergebnis führt. Ein besonders kritisches Problem entsteht, wenn zuvor angelegte Blühflächen durch Umackern oder andere Maßnahmen unbeabsichtigt zu Todesfallen für Insekten werden.
04/05.03.2025
- Eine Kampagne hat in den letzten Jahren viel Aufmerksamkeit erhalten und zweifellos zu einem gestiegenen Bewusstsein für den Schutz von Bestäubern beigetragen.
Doch im sogenannten „Tagesgeschäft“, also im praktischen landwirtschaftlichen und kommunalen Umgang mit Naturschutzmaßnahmen, zeigt sich, dass die Umsetzung oft nur eingeschränkt zum gewünschten Ergebnis führt. Ein besonders kritisches Problem entsteht, wenn zuvor angelegte Blühflächen durch Umackern oder andere Maßnahmen unbeabsichtigt zu Todesfallen für Insekten werden.
Blühflächen als zweischneidiges Schwert
Blühflächen sind ein beliebtes Mittel zur Förderung der Artenvielfalt, da sie bestäubenden Insekten wie Bienen, Hummeln und Schmetterlingen Nahrung und Lebensraum bieten. Landwirte, Kommunen und Umweltinitiativen legen sie oft als freiwillige Maßnahme oder im Rahmen von Agrarförderprogrammen an. Doch genau hier beginnt das Problem: Diese Flächen sind in der Regel nicht dauerhaft geschützt, sondern unterliegen wirtschaftlichen und agrarpolitischen Zwängen.
Das Problem des Umackerns und der Mahd
Viele Blühflächen werden nach wenigen Jahren wieder umgepflügt oder gemäht – oft zu ungünstigen Zeitpunkten. Dies führt zu mehreren Problemen:
Wirtschaftliche Zwänge und Agrarförderung als Hindernis
Viele Landwirte legen Blühstreifen an, weil sie dafür finanzielle Anreize aus Agrarförderprogrammen erhalten. Allerdings sind diese Förderungen oft zeitlich begrenzt (z. B. fünf Jahre), danach wird die Fläche meist wieder in produktive Nutzung überführt. So kann eine ehemals sichere Insektenoase plötzlich zur Todeszone werden.
Ein weiteres Problem sind ökonomische Zwänge: Blühflächen bedeuten für Landwirte oft einen Ertragsverlust. Wenn Subventionen auslaufen oder wirtschaftliche Bedingungen sich ändern, wird die Fläche wieder umgeackert – mit den oben genannten fatalen Folgen für Insekten.
Kommunale Fehlentscheidungen und mangelnde Sensibilisierung
Auch Kommunen tragen unbeabsichtigt zur Problematik bei. Häufig werden innerstädtische oder straßenbegleitende Blühstreifen aus ästhetischen oder verkehrstechnischen Gründen zu früh oder zu oft gemäht, wodurch Bienen und andere Insekten unnötig geschädigt werden.
Ein weiteres Problem ist der oft starre Fokus auf Honigbienen, während Wildbienen und andere Bestäuber weniger Beachtung finden. Dabei sind es gerade die Wildbienen, die besonders auf stabile, dauerhafte Lebensräume angewiesen sind.
Lösungsansätze für einen nachhaltigeren Bienenschutz
Um das ursprüngliche Ziel der Kampagne konsequenter zu verfolgen, wären nach unserer Auffassung folgende Maßnahmen notwendig:
Fazit
Die gute Absicht hinter der Kampagne wird im Tagesgeschäft oft durch kurzfristige wirtschaftliche Interessen, agrarpolitische Rahmenbedingungen und mangelnde Sensibilisierung eingeschränkt. Besonders das Umackern vormals blütenreicher Flächen macht deutlich, dass scheinbar sinnvolle Maßnahmen langfristig sogar kontraproduktiv sein können. Ein wirksamer Schutz der Bestäuber erfordert daher eine langfristige, strukturierte und vor allem ökologisch durchdachte Strategie – und nicht nur gut gemeinte, aber zeitlich begrenzte Blühflächen.
In der Aufnahme
Blühflächen sind ein beliebtes Mittel zur Förderung der Artenvielfalt, da sie bestäubenden Insekten wie Bienen, Hummeln und Schmetterlingen Nahrung und Lebensraum bieten. Landwirte, Kommunen und Umweltinitiativen legen sie oft als freiwillige Maßnahme oder im Rahmen von Agrarförderprogrammen an. Doch genau hier beginnt das Problem: Diese Flächen sind in der Regel nicht dauerhaft geschützt, sondern unterliegen wirtschaftlichen und agrarpolitischen Zwängen.
Das Problem des Umackerns und der Mahd
Viele Blühflächen werden nach wenigen Jahren wieder umgepflügt oder gemäht – oft zu ungünstigen Zeitpunkten. Dies führt zu mehreren Problemen:
- Zerstörung von Nestern und Überwinterungsplätzen: Viele Wildbienenarten nisten im Boden oder in abgestorbenen Pflanzenteilen. Durch das Umackern werden diese Lebensräume unwiederbringlich zerstört.
- Tod durch Maschinen: Schmetterlingsraupen, Käfer und andere bestäubende Insekten leben in der Vegetation. Wenn Blühflächen im Sommer oder Herbst umgepflügt oder gemäht werden, sterben viele Tiere direkt.
- Verlust der Nahrungsquelle: Gerade wenn andere Blühflächen in der Umgebung fehlen, bricht mit dem Umpflügen eine wichtige Nahrungsquelle für Bienen und Hummeln abrupt weg.
Wirtschaftliche Zwänge und Agrarförderung als Hindernis
Viele Landwirte legen Blühstreifen an, weil sie dafür finanzielle Anreize aus Agrarförderprogrammen erhalten. Allerdings sind diese Förderungen oft zeitlich begrenzt (z. B. fünf Jahre), danach wird die Fläche meist wieder in produktive Nutzung überführt. So kann eine ehemals sichere Insektenoase plötzlich zur Todeszone werden.
Ein weiteres Problem sind ökonomische Zwänge: Blühflächen bedeuten für Landwirte oft einen Ertragsverlust. Wenn Subventionen auslaufen oder wirtschaftliche Bedingungen sich ändern, wird die Fläche wieder umgeackert – mit den oben genannten fatalen Folgen für Insekten.
Kommunale Fehlentscheidungen und mangelnde Sensibilisierung
Auch Kommunen tragen unbeabsichtigt zur Problematik bei. Häufig werden innerstädtische oder straßenbegleitende Blühstreifen aus ästhetischen oder verkehrstechnischen Gründen zu früh oder zu oft gemäht, wodurch Bienen und andere Insekten unnötig geschädigt werden.
Ein weiteres Problem ist der oft starre Fokus auf Honigbienen, während Wildbienen und andere Bestäuber weniger Beachtung finden. Dabei sind es gerade die Wildbienen, die besonders auf stabile, dauerhafte Lebensräume angewiesen sind.
Lösungsansätze für einen nachhaltigeren Bienenschutz
Um das ursprüngliche Ziel der Kampagne konsequenter zu verfolgen, wären nach unserer Auffassung folgende Maßnahmen notwendig:
- Längerfristiger Schutz von Blühflächen: Anstelle befristeter Förderprogramme sollte es langfristige Schutzmaßnahmen für Blühflächen geben.
- Bessere Berücksichtigung der ökologischen Folgen beim Umackern: Vor der Umwandlung von Blühflächen sollte geprüft werden, ob alternative Bewirtschaftungsmethoden möglich sind.
- Sensibilisierung und bessere Mahd-Strategien: Die Mahd sollte insektenfreundlich erfolgen, beispielsweise abschnittsweise oder mit insektenschonenden Mähmethoden.
- Förderung von dauerhaften Lebensräumen: Hecken, strukturreiche Wiesen und ungenutzte Flächen sind für Wildbienen noch wichtiger als temporäre Blühstreifen.
Fazit
Die gute Absicht hinter der Kampagne wird im Tagesgeschäft oft durch kurzfristige wirtschaftliche Interessen, agrarpolitische Rahmenbedingungen und mangelnde Sensibilisierung eingeschränkt. Besonders das Umackern vormals blütenreicher Flächen macht deutlich, dass scheinbar sinnvolle Maßnahmen langfristig sogar kontraproduktiv sein können. Ein wirksamer Schutz der Bestäuber erfordert daher eine langfristige, strukturierte und vor allem ökologisch durchdachte Strategie – und nicht nur gut gemeinte, aber zeitlich begrenzte Blühflächen.
In der Aufnahme
- Eine mehrjährige Blühfläche wird umgebrochen ... die an den Planzen lebenden Tiere (Nachwuchs etc. ) werden bei lebendigen Leib unter die Erde gebracht und verenden kläglich. Auf solche "Schutzprojekte" die auch vielfach mit Förderitteln unterstützt werden können wir getrost verzichten!
Artenschutz in Franken®
Amphibienwanderung 2025 - Vorbereitungen laufen!

Amphibienwanderung 2025 - Vorbereitungen laufen!
03/04.03.2025
Diese Zäune werden entlang bekannter Wanderwege aufgestellt, um Amphibien daran zu hindern, Straßen zu überqueren, wo sie oft Opfer des Verkehrs werden. Das Engagement der Betreuer, die diese Zäune installieren und warten, ist von entscheidender Bedeutung für den Erhalt vieler Arten.
03/04.03.2025
- Amphibienzäune spielen eine entscheidende Rolle im Schutz und Erhalt bedrohter Amphibienarten während ihrer Wanderungen zu den Laichplätzen.
Diese Zäune werden entlang bekannter Wanderwege aufgestellt, um Amphibien daran zu hindern, Straßen zu überqueren, wo sie oft Opfer des Verkehrs werden. Das Engagement der Betreuer, die diese Zäune installieren und warten, ist von entscheidender Bedeutung für den Erhalt vieler Arten.
Amphibien wie Frösche, Kröten und Molche unternehmen jedes Jahr oft gefährliche Wanderungen zu ihren Laichgewässern. Diese Routen sind jedoch oft mit Straßen durchzogen, die eine erhebliche Bedrohung darstellen. Durch das Aufstellen von Amphibienzäunen entlang dieser Routen wird den Tieren eine sichere Passage ermöglicht. Diese Zäune führen die Amphibien zu speziellen Eimern oder Tunneln, wo sie aufgenommen, geführt und sicher über die Straße geleitet werden können.
Das Engagement der Betreuer erstreckt sich vielfach über mehrere Bereiche. Sie überwachen die Wanderungen der Amphibien, reparieren und warten die Zäune regelmäßig, organisieren Freiwillige für Rettungsaktionen und führen Bildungsprogramme durch, um die Öffentlichkeit über die Bedeutung des Schutzes dieser Tiere aufzuklären. Ihre Arbeit ist nicht nur physisch anstrengend, sondern erfordert auch ein tiefes Verständnis der ökologischen Bedürfnisse der Amphibien und der lokalen Umwelt.
Ohne diese Zäune und das Engagement der Betreuer wären viele Amphibienarten einem noch höheren Risiko ausgesetzt, insbesondere angesichts der zunehmenden Fragmentierung und Zerstörung ihrer Lebensräume. Der Einsatz für den Schutz der Wanderwege und Laichplätze dieser Tiere trägt nicht nur zum Erhalt der Artenvielfalt bei, sondern auch zum Verständnis für die empfindlichen Ökosysteme, in denen sie leben.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Amphibienzäune und das engagierte Handeln ihrer Betreuer eine unverzichtbare Rolle im Naturschutz spielen. Sie sind ein lebendiges Beispiel für die positiven Auswirkungen lokaler Initiativen auf den Schutz bedrohter Arten und die Förderung eines harmonischen Zusammenlebens von Mensch und Natur.
In der Aufnahme
Das Engagement der Betreuer erstreckt sich vielfach über mehrere Bereiche. Sie überwachen die Wanderungen der Amphibien, reparieren und warten die Zäune regelmäßig, organisieren Freiwillige für Rettungsaktionen und führen Bildungsprogramme durch, um die Öffentlichkeit über die Bedeutung des Schutzes dieser Tiere aufzuklären. Ihre Arbeit ist nicht nur physisch anstrengend, sondern erfordert auch ein tiefes Verständnis der ökologischen Bedürfnisse der Amphibien und der lokalen Umwelt.
Ohne diese Zäune und das Engagement der Betreuer wären viele Amphibienarten einem noch höheren Risiko ausgesetzt, insbesondere angesichts der zunehmenden Fragmentierung und Zerstörung ihrer Lebensräume. Der Einsatz für den Schutz der Wanderwege und Laichplätze dieser Tiere trägt nicht nur zum Erhalt der Artenvielfalt bei, sondern auch zum Verständnis für die empfindlichen Ökosysteme, in denen sie leben.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Amphibienzäune und das engagierte Handeln ihrer Betreuer eine unverzichtbare Rolle im Naturschutz spielen. Sie sind ein lebendiges Beispiel für die positiven Auswirkungen lokaler Initiativen auf den Schutz bedrohter Arten und die Förderung eines harmonischen Zusammenlebens von Mensch und Natur.
In der Aufnahme
- Kunststoffbahnen sichern an zahlreichen Standorten prekäre Situationen ab. Artenschutz in Franken® bringt sich seit über 25 Jahren für die Erhaltung heimischer Amphibien ein!
Artenschutz in Franken®
Winzling mit Potenzial - Waldbirkenmaus ist Schirmart für gefährdete Artenvielfalt

Winzling mit Potenzial - Waldbirkenmaus ist Schirmart für gefährdete Artenvielfalt
02/03.03.2025
Dies kommt einer Vielzahl anderer hochgradig gefährdeter Arten wie Hochmoor-Laufkäfer und Randring-Perlmuttfalter zugute.
02/03.03.2025
- Ein neues Artenschutzprojekt des Bund Naturschutz (BN) will die Waldbirkenmaus-Lebensräume und deren Vernetzung am Grünen Band im Bayerischen Wald verbessern.
Dies kommt einer Vielzahl anderer hochgradig gefährdeter Arten wie Hochmoor-Laufkäfer und Randring-Perlmuttfalter zugute.
Die Waldbirkenmaus benötigt Moore, Hochstaudenfluren, kurzrasige Bereiche aber auch alte Bäume und Gebüsche zum Überleben. Damit ist sie eine sogenannte „Schirmart“ für insekten- und strukturreiche, naturnahe Feuchtgebiete, die in Bayern bis auf kleine Reste zurückgegangen sind. Geht es der Waldbirkenmaus gut, profitieren auch andere hochgradig gefährdete Arten. Beate Rutkowski, stellvertretende Vorsitzender des BN: „Mit dem gestarteten Projekt können wir einen Beitrag zum dringenden Erhalt der heimischen Artenvielfalt leisten und die wichtige Funktion des Grünen Bandes als Lebensraumverbund stärken. Vor dem Hintergrund des massiven Artensterbens und der fortschreitenden Zerschneidung der Lebensräume ist die Förderung umfassender Naturschutzmaßnahmen notwendiger denn je.“
Beim ersten Treffen der begleitenden Fachgruppe, die sich aus zahlreichen Expert*innen und lokalen Akteur*innen zusammensetzt, wurden im Landratsamt in Freyung erste konkrete Schritte diskutiert. „Um den Biotopverbund in den Landkreisen Freyung-Grafenau und Passau zu verbessern, sollen Feuchtgebiete und Moore aufgewertet und miteinander vernetzt werden. Außerdem wollen wir mehr über die seltene Waldbirkenmaus erfahren. Denn bisher ist nur sehr wenig über die Lebensweise der kleinen Maus bekannt. Fotofallen und weitere Erfassungen sollen helfen, Wissenslücken zu schließen, um die Art besser zu schützen“, so Tobias Windmaißer, BN-Projektleiter vor Ort.
In Bayern kommt die Waldbirkenmaus nur im Oberallgäu und im Bayerischen Wald vor, deutschlandweit nur noch an einem weiteren Standort in Schleswig-Holstein. Bayern hat damit eine besondere Verantwortung für den Erhalt dieser Art. Ihr wichtigstes Verbreitungsgebiet in Deutschland hat sie entlang des Grünen Bands an der bayerisch-tschechischen Grenze.
Das Projekt „Optimierung und modelhafte Umsetzung von Renaturierungsmaßnahmen zur Förderung der Waldbirkenmaus am Grünen Band in den Landkreisen Freyung-Grafenau und Passau im Kontext des grenzübergreifenden Biotopverbundes“ wird von Oktober 2024 bis Dezember 2028 durch das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbrauschutz (StMUV) gefördert und von der Europäischen Union (EFRE IBW Programm Bayern 2021-2027) kofinanziert.
Die Waldbirkenmaus (Sicista betulina) zählt mit rund 60 Millimetern Körperlänge und einem Gewicht von fünf bis zehn Gramm zu den kleinsten Säugetieren Europas. Sie gehört zu den Springmäusen und ist mit Mäusen oder Wühlmäusen nicht näher verwandt. Charakteristisch ist ihr schwarzer Aalstrich und der mehr als körperlange Schwanz. Ihre bevorzugten Lebensräume sind extensiv genutztes feuchtes bis nasses, strukturreiches Offenland sowie Moore und Bachränder. Nach europäischem und nationalem Naturschutzrecht zählt die Waldbirkenmaus zu den besonders geschützten Arten. In der Roten Liste Bayerns ist sie als stark gefährdet eingestuft.
Das 343 Kilometer lange Grüne Band Bayern-Tschechien ist Teil des über 12.500 Kilometer langen Grünen Bandes Europa - dem Lebensraumverbund entlang des ehemaligen Eisernen Vorhangs vom Eismeer bis zum Schwarzen Meer – und ist eine Schatzkammer der Artenvielfalt. Hier haben gefährdete Arten wie Waldbirkenmaus, Kreuzotter, Goldener Scheckenfalter, Flussperlmuschel oder Arnika letzte Überlebensräume gefunden.
Der BUND Naturschutz (BN), setzt sich seit 1989 für den Schutz des innerdeutschen Grünen Bandes ein sowie seit den frühen 1990er Jahren für das Grüne Band Bayern-Tschechien. Er hat 2002 ein Grünes Band durch Europa vorgeschlagen und ist damit ein Initiator der Grüne Band Europa Initiative. In der paneuropäischen Initiative arbeiten Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen aus 24 Anrainerstaaten zusammen. Das Nationale BUND Kompetenzzentrum Grünes Band ist seit 2004 Regionalkoordinator für den zentraleuropäischen Abschnitt von der Ostsee bis zur Adria.
In der Aufnahmevon (Foto: Richard Kraft)
Quelle
BUND NATURSCHUTZ IN BAYERN E.V. (BN)
Dr.-Johann-Maier-Straße 4
93049 Regensburg
Stand
27.02.205
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung. Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Beim ersten Treffen der begleitenden Fachgruppe, die sich aus zahlreichen Expert*innen und lokalen Akteur*innen zusammensetzt, wurden im Landratsamt in Freyung erste konkrete Schritte diskutiert. „Um den Biotopverbund in den Landkreisen Freyung-Grafenau und Passau zu verbessern, sollen Feuchtgebiete und Moore aufgewertet und miteinander vernetzt werden. Außerdem wollen wir mehr über die seltene Waldbirkenmaus erfahren. Denn bisher ist nur sehr wenig über die Lebensweise der kleinen Maus bekannt. Fotofallen und weitere Erfassungen sollen helfen, Wissenslücken zu schließen, um die Art besser zu schützen“, so Tobias Windmaißer, BN-Projektleiter vor Ort.
In Bayern kommt die Waldbirkenmaus nur im Oberallgäu und im Bayerischen Wald vor, deutschlandweit nur noch an einem weiteren Standort in Schleswig-Holstein. Bayern hat damit eine besondere Verantwortung für den Erhalt dieser Art. Ihr wichtigstes Verbreitungsgebiet in Deutschland hat sie entlang des Grünen Bands an der bayerisch-tschechischen Grenze.
Das Projekt „Optimierung und modelhafte Umsetzung von Renaturierungsmaßnahmen zur Förderung der Waldbirkenmaus am Grünen Band in den Landkreisen Freyung-Grafenau und Passau im Kontext des grenzübergreifenden Biotopverbundes“ wird von Oktober 2024 bis Dezember 2028 durch das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbrauschutz (StMUV) gefördert und von der Europäischen Union (EFRE IBW Programm Bayern 2021-2027) kofinanziert.
Die Waldbirkenmaus (Sicista betulina) zählt mit rund 60 Millimetern Körperlänge und einem Gewicht von fünf bis zehn Gramm zu den kleinsten Säugetieren Europas. Sie gehört zu den Springmäusen und ist mit Mäusen oder Wühlmäusen nicht näher verwandt. Charakteristisch ist ihr schwarzer Aalstrich und der mehr als körperlange Schwanz. Ihre bevorzugten Lebensräume sind extensiv genutztes feuchtes bis nasses, strukturreiches Offenland sowie Moore und Bachränder. Nach europäischem und nationalem Naturschutzrecht zählt die Waldbirkenmaus zu den besonders geschützten Arten. In der Roten Liste Bayerns ist sie als stark gefährdet eingestuft.
Das 343 Kilometer lange Grüne Band Bayern-Tschechien ist Teil des über 12.500 Kilometer langen Grünen Bandes Europa - dem Lebensraumverbund entlang des ehemaligen Eisernen Vorhangs vom Eismeer bis zum Schwarzen Meer – und ist eine Schatzkammer der Artenvielfalt. Hier haben gefährdete Arten wie Waldbirkenmaus, Kreuzotter, Goldener Scheckenfalter, Flussperlmuschel oder Arnika letzte Überlebensräume gefunden.
Der BUND Naturschutz (BN), setzt sich seit 1989 für den Schutz des innerdeutschen Grünen Bandes ein sowie seit den frühen 1990er Jahren für das Grüne Band Bayern-Tschechien. Er hat 2002 ein Grünes Band durch Europa vorgeschlagen und ist damit ein Initiator der Grüne Band Europa Initiative. In der paneuropäischen Initiative arbeiten Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen aus 24 Anrainerstaaten zusammen. Das Nationale BUND Kompetenzzentrum Grünes Band ist seit 2004 Regionalkoordinator für den zentraleuropäischen Abschnitt von der Ostsee bis zur Adria.
In der Aufnahmevon (Foto: Richard Kraft)
- Waldbirkenmäuse sind geschickte Kletterer.
Quelle
BUND NATURSCHUTZ IN BAYERN E.V. (BN)
Dr.-Johann-Maier-Straße 4
93049 Regensburg
Stand
27.02.205
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung. Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Artenschutz in Franken®
Rotmilan (Milvus milvus)

Der Rotmilan (Milvus milvus)
01/02.03.2025
Wir Rotmilane gehören zur Familie der Habichtartigen und sind besonders in Europa verbreitet. Unser Erscheinungsbild zeichnet sich durch ein charakteristisches rostbraunes Gefieder aus, das am Bauch heller und an den Enden der Flügel schwarz gefärbt ist. Unsere Flügelspannweite kann bis zu 1,5 Meter betragen, was uns zu imposanten Segelfliegern macht.
01/02.03.2025
- Als Rotmilan (Milvus milvus) betrachte ich meine Art aus einer umfassenden Perspektive.
Wir Rotmilane gehören zur Familie der Habichtartigen und sind besonders in Europa verbreitet. Unser Erscheinungsbild zeichnet sich durch ein charakteristisches rostbraunes Gefieder aus, das am Bauch heller und an den Enden der Flügel schwarz gefärbt ist. Unsere Flügelspannweite kann bis zu 1,5 Meter betragen, was uns zu imposanten Segelfliegern macht.
Wir bevorzugen offene Landschaften mit ausreichend großen Waldgebieten, da wir uns von kleinen Säugetieren, Vögeln, Insekten und gelegentlich auch von Aas ernähren. Unser Jagdverhalten ist durch das Kreisen in großen Höhen gekennzeichnet, wobei wir unsere scharfen Augen nutzen, um Beute am Boden zu erspähen. Dabei können wir unglaublich präzise im Sturzflug zuschlagen.
In Bezug auf unser Sozialverhalten sind wir meist Einzelgänger außerhalb der Brutzeit, wenn wir eine feste Paarbindung eingehen. Unsere Nester bauen wir hoch in Bäumen, gerne in Nadel- oder Laubbäumen, oft in der Nähe von Gewässern oder in lichten Wäldern.
Unsere Art ist durch Habitatverlust und Vergiftungen leider stark gefährdet, weshalb Schutzmaßnahmen wie der Erhalt und die Schaffung geeigneter Lebensräume und die Reduzierung von Pestiziden von großer Bedeutung sind, um unser Überleben langfristig zu sichern.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
In Bezug auf unser Sozialverhalten sind wir meist Einzelgänger außerhalb der Brutzeit, wenn wir eine feste Paarbindung eingehen. Unsere Nester bauen wir hoch in Bäumen, gerne in Nadel- oder Laubbäumen, oft in der Nähe von Gewässern oder in lichten Wäldern.
Unsere Art ist durch Habitatverlust und Vergiftungen leider stark gefährdet, weshalb Schutzmaßnahmen wie der Erhalt und die Schaffung geeigneter Lebensräume und die Reduzierung von Pestiziden von großer Bedeutung sind, um unser Überleben langfristig zu sichern.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
- Rotmilan (Milvus milvus)
Artenschutz in Franken®
Abschied vom Wegbereiter des Nationalparks
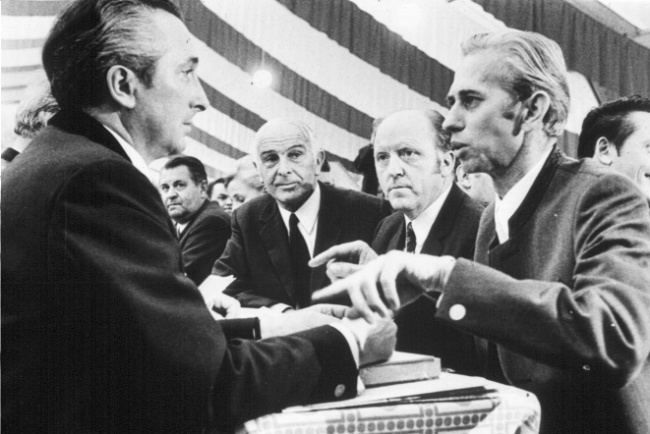
Abschied vom Wegbereiter des Nationalparks
01/02.03.2025
Grafenau. Er setzte sich Zeit seines Lebens für die Philosophie „Natur Natur sein lassen“ ein und war ein glühender Verfechter der Nationalparkidee: Dr. Hans Bibelriether. Als am längsten amtierender Leiter des Nationalparks Bayerischer Wald ist er aus der Geschichte des bayerischen und deutschen Naturschutzes nicht wegzudenken. Nun ist das letzte Kapitel seines Lebens geschrieben, am 18. Februar starb Hans Bibelriether im Alter von 91 Jahren.
01/02.03.2025
- Ehemaliger Leiter Dr. Hans Bibelriether im Alter von 91 Jahren verstorben
Grafenau. Er setzte sich Zeit seines Lebens für die Philosophie „Natur Natur sein lassen“ ein und war ein glühender Verfechter der Nationalparkidee: Dr. Hans Bibelriether. Als am längsten amtierender Leiter des Nationalparks Bayerischer Wald ist er aus der Geschichte des bayerischen und deutschen Naturschutzes nicht wegzudenken. Nun ist das letzte Kapitel seines Lebens geschrieben, am 18. Februar starb Hans Bibelriether im Alter von 91 Jahren.
Was er sagte, das meinte er auch so. Und was er tat, dahinter stand er kompromisslos. Vor allem, wenn es darum ging, den Nationalpark voranzubringen. Schon bei der Gründung war es Bibelriether wichtig, dass die Region vom Nationalpark profitiert. In seiner Dienstzeit wurden unter anderem das Hans-Eisenmann-Haus oder das Waldspielgelände bei Spiegelau gebaut, auch die Inbetriebnahme der Igelbusse in den 1990er Jahren hat er unterstützt.
Bibelriether förderte schon früh die Umweltbildung im Nationalpark
Darüber hinaus sollte der Nationalpark aber auch ein Schutzgebiet werden, auf dem sich der Mensch auf einem Großteil der Fläche zurücknimmt und sich die Natur nach ihren ureigenen Gesetzen entwickeln darf. Ein großes Anliegen war es Bibelriether, der ab 1969 Leiter des Nationalparkamtes und ab Dezember 1979 Leiter der Nationalparkverwaltung war, dabei aber auch, die Menschen über die Prozesse des natürlichen Werdens und Vergehens zu informieren, sie zu sensibilisieren und letztendlich dafür zu begeistern. Bei Kindern und Erwachsenen gleichermaßen Freude am Wald und an der Natur zu wecken, darum ging es Bibelriether schon in den 1970er Jahren. Mit dem Begriff „Umweltbildung“ konnten viele zunächst wenig anfangen. Heute ist es eine wesentliche Aufgabe des Nationalparks.
Genauso wie Natur- und Prozessschutz. Dies zu etablieren, erforderte deutlich mehr Kraftanstrengungen von Bibelriether. Als 1972 ein Herbststurm 5000 Fichten zu Boden riss, setzte er es durch, dass auf einer Fläche an der Graupsäge nahe Waldhäuser 30 Fichten liegengelassen wurden. Dort war schon nach wenigen Jahren zu sehen, dass ein junger, vitaler und strukturreicher Wald nachwächst – ganz ohne das Zutun des Menschen. Dieser kleine Windwurf war das ausschlaggebende Argument, dass der damalige Minister Dr. Hans Eisenmann über zehn Jahre später eine weichenstellende Entscheidung traf. Nachdem 1983 ein Herbststurm auf einer Fläche von 87 Hektar rund 30.000 Festmeter Fichten zwischen Rachel und Lusen zu Fall brachte, fiel der Beschluss, die Windwürfe liegenzulassen, damit daraus ein Urwald für „unsere Kinder und Kindeskinder“ wird.
Große Errungenschaften in Zeiten mit viel Nationalpark-Kritik
Diese neue Vorgehensweise durchzusetzen, brachte Bibelriether vor allem in den 1990er Jahren große Diskussionen und Konfrontationen ein, als es darum ging, den Nationalpark im Zwieseler Bereich zu erweitern. Angesichts des Borkenkäfergeschehens im ursprünglichen Teil des Nationalparks organisierten sich Nationalparkgegner in einer Bürgerbewegung. Bei öffentlichen Demonstrationen und Kundgebungen wurde gefordert, das Schutzgebiet nicht zu vergrößern. Bibelriether stand als Hauptakteur in der Kritik. Letztendlich bekamen die Nationalparkbefürworter Recht, die Erweiterung wurde 1997 rechtskräftig. 1998, nur kurze Zeit später, trat Bibelriether in den Ruhestand ein.
Mit Dr. Hans Bibelriether verliert die Belegschaft der Nationalparkverwaltung rund um die Leiterin Ursula Schuster eine Persönlichkeit, die in der Entwicklung des Schutzgebietes über Jahrzehnte hinweg eine prägende Rolle innehatte. „Hans Bibelriether hat in einer Zeit, in der die Akzeptanz für den Nationalpark noch nicht annähernd so groß war wie heute, große Errungenschaften erzielt und bedeutende Weichen für die Entwicklung des Schutzgebietes gestellt“, so Ursula Schuster. Doch nicht nur sein Wirken in der Region könne nicht hoch genug geschätzt werden. „Bibelriether hat auch über die Grenzen Bayerns und Deutschlands hinweg mit einer großen Überzeugungskraft für die Nationalparkidee geworben, wovon zahlreiche Nationalparke profitiert haben.“
Internationales Engagement und Bundesverdienstkreuz am Bande
Dies spiegelt sich in den vielen Ämtern nieder, die er übernommen hatte. Von 1984 bis 1995 war er Vizepräsident und Generalsekretär der „Föderation der Natur- und Nationalparke Europas“, der heutigen EUROPARC Federation. Von 1986 bis 1994 übernahm er das Amt des Vice-Chairman für Europa der Nationalparkkommission der Internationalen Union zum Schutz der Natur (IUCN). Auch zahlreiche Ehrungen wurden Bibelriether zu teil, beispielsweise erhielt er 1989 die Alexander-von-Humboldt-Medaille in Gold sowie das Bundesverdienstkreuz am Bande, 1998 wurde er mit der Staatsmedaille in Silber des Freistaates Bayern ausgezeichnet.
In der Aufnahme von Archiv Nationalpark Bayerischer Wald
Quelle
Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald
Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Freyunger Straße 2
94481 Grafenau
Datum: 28.02.2025
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung. Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Bibelriether förderte schon früh die Umweltbildung im Nationalpark
Darüber hinaus sollte der Nationalpark aber auch ein Schutzgebiet werden, auf dem sich der Mensch auf einem Großteil der Fläche zurücknimmt und sich die Natur nach ihren ureigenen Gesetzen entwickeln darf. Ein großes Anliegen war es Bibelriether, der ab 1969 Leiter des Nationalparkamtes und ab Dezember 1979 Leiter der Nationalparkverwaltung war, dabei aber auch, die Menschen über die Prozesse des natürlichen Werdens und Vergehens zu informieren, sie zu sensibilisieren und letztendlich dafür zu begeistern. Bei Kindern und Erwachsenen gleichermaßen Freude am Wald und an der Natur zu wecken, darum ging es Bibelriether schon in den 1970er Jahren. Mit dem Begriff „Umweltbildung“ konnten viele zunächst wenig anfangen. Heute ist es eine wesentliche Aufgabe des Nationalparks.
Genauso wie Natur- und Prozessschutz. Dies zu etablieren, erforderte deutlich mehr Kraftanstrengungen von Bibelriether. Als 1972 ein Herbststurm 5000 Fichten zu Boden riss, setzte er es durch, dass auf einer Fläche an der Graupsäge nahe Waldhäuser 30 Fichten liegengelassen wurden. Dort war schon nach wenigen Jahren zu sehen, dass ein junger, vitaler und strukturreicher Wald nachwächst – ganz ohne das Zutun des Menschen. Dieser kleine Windwurf war das ausschlaggebende Argument, dass der damalige Minister Dr. Hans Eisenmann über zehn Jahre später eine weichenstellende Entscheidung traf. Nachdem 1983 ein Herbststurm auf einer Fläche von 87 Hektar rund 30.000 Festmeter Fichten zwischen Rachel und Lusen zu Fall brachte, fiel der Beschluss, die Windwürfe liegenzulassen, damit daraus ein Urwald für „unsere Kinder und Kindeskinder“ wird.
Große Errungenschaften in Zeiten mit viel Nationalpark-Kritik
Diese neue Vorgehensweise durchzusetzen, brachte Bibelriether vor allem in den 1990er Jahren große Diskussionen und Konfrontationen ein, als es darum ging, den Nationalpark im Zwieseler Bereich zu erweitern. Angesichts des Borkenkäfergeschehens im ursprünglichen Teil des Nationalparks organisierten sich Nationalparkgegner in einer Bürgerbewegung. Bei öffentlichen Demonstrationen und Kundgebungen wurde gefordert, das Schutzgebiet nicht zu vergrößern. Bibelriether stand als Hauptakteur in der Kritik. Letztendlich bekamen die Nationalparkbefürworter Recht, die Erweiterung wurde 1997 rechtskräftig. 1998, nur kurze Zeit später, trat Bibelriether in den Ruhestand ein.
Mit Dr. Hans Bibelriether verliert die Belegschaft der Nationalparkverwaltung rund um die Leiterin Ursula Schuster eine Persönlichkeit, die in der Entwicklung des Schutzgebietes über Jahrzehnte hinweg eine prägende Rolle innehatte. „Hans Bibelriether hat in einer Zeit, in der die Akzeptanz für den Nationalpark noch nicht annähernd so groß war wie heute, große Errungenschaften erzielt und bedeutende Weichen für die Entwicklung des Schutzgebietes gestellt“, so Ursula Schuster. Doch nicht nur sein Wirken in der Region könne nicht hoch genug geschätzt werden. „Bibelriether hat auch über die Grenzen Bayerns und Deutschlands hinweg mit einer großen Überzeugungskraft für die Nationalparkidee geworben, wovon zahlreiche Nationalparke profitiert haben.“
Internationales Engagement und Bundesverdienstkreuz am Bande
Dies spiegelt sich in den vielen Ämtern nieder, die er übernommen hatte. Von 1984 bis 1995 war er Vizepräsident und Generalsekretär der „Föderation der Natur- und Nationalparke Europas“, der heutigen EUROPARC Federation. Von 1986 bis 1994 übernahm er das Amt des Vice-Chairman für Europa der Nationalparkkommission der Internationalen Union zum Schutz der Natur (IUCN). Auch zahlreiche Ehrungen wurden Bibelriether zu teil, beispielsweise erhielt er 1989 die Alexander-von-Humboldt-Medaille in Gold sowie das Bundesverdienstkreuz am Bande, 1998 wurde er mit der Staatsmedaille in Silber des Freistaates Bayern ausgezeichnet.
In der Aufnahme von Archiv Nationalpark Bayerischer Wald
- Dr. Hans Bibelriether (r.) mit Staatsminister Dr. Hans Eisenmann (l.) bei der Eröffnungsfeier des Nationalparks 1970.
Quelle
Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald
Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Freyunger Straße 2
94481 Grafenau
Datum: 28.02.2025
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung. Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Artenschutz in Franken®
Stele der Biodiversität® - Umweltpoint: Dorsten – Wulfen

Stele der Biodiversität® - Umweltpoint: Dorsten – Wulfen
28.02 / 01.03 2025
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutzes in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Deutschen Postcode Lotterie und weiteren Partern unabhängig voneinander unterstützt wird.
28.02 / 01.03 2025
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutzes in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Deutschen Postcode Lotterie und weiteren Partern unabhängig voneinander unterstützt wird.
Dorsten GT-Wulfen / Nordrhein - Westfalen. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen, kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Baukörper gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper und auch deren Umfeld zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
Wenn auch noch die Umweltbildung einen wichtigen Projektaspekt vereinnahmt, dann sind wir der festen Überzeugung, hier einigen wertvollen Beitrag für gerade die uns nachfolgende Generation zu leisten!
In dieser Aufnahme
Wenn auch noch die Umweltbildung einen wichtigen Projektaspekt vereinnahmt, dann sind wir der festen Überzeugung, hier einigen wertvollen Beitrag für gerade die uns nachfolgende Generation zu leisten!
In dieser Aufnahme
- Vor wenigen Tagen konnten wir mit der Entwicklung der Außenfläche starten.
Artenschutz in Franken®
Stele der Biodiversität® - Neuhausen

Stele der Biodiversität® - Neuhausen
27/28.02.2025
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutzes in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V., das von der Gemeinde Rauhenebrach, der Steuerkanzlei Bauerfeind aus München, der Deutschen Postcode Lotterie und weiteren Partern unabhängig voneinander unterstützt wird.
27/28.02.2025
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutzes in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V., das von der Gemeinde Rauhenebrach, der Steuerkanzlei Bauerfeind aus München, der Deutschen Postcode Lotterie und weiteren Partern unabhängig voneinander unterstützt wird.
Theinheim / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen, kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
In der Aufnahme
In der Aufnahme
- Am 20.02.2025 wurde der Pflanzenmantel der den Baukörper umgab und dessen Bausubstanz zunehmend beeinträchtigte entfernt. Zum Vorschein kam die ein interessanter Baukörper ... in den kommenden Tagen wird dessen Fassade nun gereinigt um mit den eigentlichen Artenschutzmaßnahmen starten zu können
Artenschutz in Franken®
Holunder (Sambucus)

Der Holunder (Sambucus)
26/27.02.2025
Zunächst einmal bin ich ziemlich robust und wachse in vielen verschiedenen Klimazonen auf der ganzen Welt. Mein lateinischer Name ist Sambucus, und ich gehöre zur Familie der Moschuskrautgewächse.
26/27.02.2025
- Als Holunder könnte ich mir vorstellen, dass ich eine ziemlich interessante Pflanze bin!
Zunächst einmal bin ich ziemlich robust und wachse in vielen verschiedenen Klimazonen auf der ganzen Welt. Mein lateinischer Name ist Sambucus, und ich gehöre zur Familie der Moschuskrautgewächse.
Meine Blüten sind cremeweiß und duften herrlich aromatisch, was viele Insekten anzieht, besonders Bienen. Diese Blüten sind auch die Vorläufer meiner beliebten Holunderbeeren, die in vielen kulinarischen Anwendungen verwendet werden, von Sirup bis zu Gelee.
Als Strauch oder kleiner Baum kann ich ziemlich groß werden, und meine Rinde ist glatt und grau. In einigen Kulturen gilt meine Pflanze als symbolisch und wird mit verschiedenen mythologischen und kulturellen Bedeutungen verbunden.
In der Aufnahme von Albert Meier
Als Strauch oder kleiner Baum kann ich ziemlich groß werden, und meine Rinde ist glatt und grau. In einigen Kulturen gilt meine Pflanze als symbolisch und wird mit verschiedenen mythologischen und kulturellen Bedeutungen verbunden.
In der Aufnahme von Albert Meier
- Holunderstrauch mit Blüten besetzt
Artenschutz in Franken®
Elch (Alces alces)

Der Elch (Alces alces)
25/26.02.2025
Mein Reich erstreckt sich von den tiefen Wäldern Skandinaviens bis zu den weiten Ebenen Kanadas. Ich bin ein Wanderer, ein Überlebender, geformt durch Jahrtausende der Anpassung an ein Leben in kalten, wilden Landschaften.
25/26.02.2025
- Ich bin der Elch (Alces alces), der König der Wälder, groß, mächtig und doch leise durch die Sümpfe und Wälder des Nordens streifend.
Mein Reich erstreckt sich von den tiefen Wäldern Skandinaviens bis zu den weiten Ebenen Kanadas. Ich bin ein Wanderer, ein Überlebender, geformt durch Jahrtausende der Anpassung an ein Leben in kalten, wilden Landschaften.
Mein Körper – Ein Meisterwerk der Natur
Meine langen Beine tragen mich mühelos durch Sümpfe, dichte Wälder und selbst tiefen Schnee. Kein Hindernis ist zu groß für mich. Mein Geweih, das ich jeden Herbst abwerfe und neu wachsen lasse, ist nicht nur eine Waffe im Kampf um die Weibchen – es ist ein Symbol meiner Stärke. Je älter und erfahrener ich werde, desto größer und beeindruckender wächst es.
Mein Fell schützt mich vor eisiger Kälte und stechenden Insekten. Mein massiver Körper speichert Wärme, während mein starkes Herz mich durch lange Winter trägt. Und meine breite, weiche Schnauze? Sie hilft mir, selbst im tiefsten Schnee noch Nahrung zu finden – junge Triebe, Baumrinde und Moose.
Mein Leben – Ein ständiger Balanceakt
Ich bin meist allein unterwegs, außer zur Brunftzeit, wenn mein Ruf über die Wälder hallt und ich meine Rivalen herausfordere. Doch jeder Kampf ist eine Entscheidung – lohnt es sich, meine Energie aufs Spiel zu setzen? Oder warte ich auf meine Zeit?
Im Frühjahr bringe ich neues Leben in die Welt. Die Elchkühe, die wahren Hüterinnen unserer Art, gebären Kälber, die innerhalb weniger Stunden stehen können. Sie lehren ihre Jungen, Gefahren zu erkennen – denn wir sind nicht unbesiegbar.
Meine Feinde – Nicht nur natürliche Beutegreifer
Wölfe jagen mich, Bären lauern auf meine Jungen. Doch meine wahre Bedrohung trägt kein Fell – sie fährt auf Straßen aus Asphalt, fällt meine Wälder und teilt mein Land mit Lärm und Zäunen. Menschen dringen immer tiefer in meine Welt ein, und mit jedem verlorenen Hektar Wald wird mein Leben schwerer.
Mein Ruf an die Welt
Ich bin mehr als ein Tier. Ich bin ein Hüter der Wildnis, ein Symbol der ungezähmten Natur. Ich diene dem Gleichgewicht der Wälder, schaffe Lichtungen für neues Leben, forme mit meinen Schritten die Landschaft.
Doch ich frage mich – wie lange noch? Wird die Welt mich weiterhin achten? Oder werde ich eines Tages nur noch eine Legende sein, ein Flüstern im Wind zwischen den kahlen Bäumen, wo einst meine Heimat war?
In der Aufnahme von Caspar von Zimmermann
Meine langen Beine tragen mich mühelos durch Sümpfe, dichte Wälder und selbst tiefen Schnee. Kein Hindernis ist zu groß für mich. Mein Geweih, das ich jeden Herbst abwerfe und neu wachsen lasse, ist nicht nur eine Waffe im Kampf um die Weibchen – es ist ein Symbol meiner Stärke. Je älter und erfahrener ich werde, desto größer und beeindruckender wächst es.
Mein Fell schützt mich vor eisiger Kälte und stechenden Insekten. Mein massiver Körper speichert Wärme, während mein starkes Herz mich durch lange Winter trägt. Und meine breite, weiche Schnauze? Sie hilft mir, selbst im tiefsten Schnee noch Nahrung zu finden – junge Triebe, Baumrinde und Moose.
Mein Leben – Ein ständiger Balanceakt
Ich bin meist allein unterwegs, außer zur Brunftzeit, wenn mein Ruf über die Wälder hallt und ich meine Rivalen herausfordere. Doch jeder Kampf ist eine Entscheidung – lohnt es sich, meine Energie aufs Spiel zu setzen? Oder warte ich auf meine Zeit?
Im Frühjahr bringe ich neues Leben in die Welt. Die Elchkühe, die wahren Hüterinnen unserer Art, gebären Kälber, die innerhalb weniger Stunden stehen können. Sie lehren ihre Jungen, Gefahren zu erkennen – denn wir sind nicht unbesiegbar.
Meine Feinde – Nicht nur natürliche Beutegreifer
Wölfe jagen mich, Bären lauern auf meine Jungen. Doch meine wahre Bedrohung trägt kein Fell – sie fährt auf Straßen aus Asphalt, fällt meine Wälder und teilt mein Land mit Lärm und Zäunen. Menschen dringen immer tiefer in meine Welt ein, und mit jedem verlorenen Hektar Wald wird mein Leben schwerer.
Mein Ruf an die Welt
Ich bin mehr als ein Tier. Ich bin ein Hüter der Wildnis, ein Symbol der ungezähmten Natur. Ich diene dem Gleichgewicht der Wälder, schaffe Lichtungen für neues Leben, forme mit meinen Schritten die Landschaft.
Doch ich frage mich – wie lange noch? Wird die Welt mich weiterhin achten? Oder werde ich eines Tages nur noch eine Legende sein, ein Flüstern im Wind zwischen den kahlen Bäumen, wo einst meine Heimat war?
In der Aufnahme von Caspar von Zimmermann
- Ein ausgewachsenes Weibchen ... im Gegensatz zum Reh- oder Rotwild führen Elche ein mehr oder minder Einzelgängerisches Leben.
Artenschutz in Franken®
Braunbär (Ursus arctos)

Der Braunbär (Ursus arctos)
24/25.02.2025
Über Jahrhunderte hinweg wurden diese Tiere von unserer Spezies gnadenlos verfolgt, bis auch der letzte Braunbär niedergestreckt wurde!
24/25.02.2025
- Wie zahlreichen anderen Prädatoren gleich widerfuhr auch dem Europäischen Braunbären das „Schicksal“ in Deutschland in „Freier Wildbahn“ durch den Menschen ausgerottet zu werden.
Über Jahrhunderte hinweg wurden diese Tiere von unserer Spezies gnadenlos verfolgt, bis auch der letzte Braunbär niedergestreckt wurde!
In Bayern wurde der letzte Braunbär 1835 bei Ruhpolding erschossen – doch halt nicht ganz denn nach rund 170 bärenlosen Jahren tauchte im Freistaat Bayern wieder ein Braunbär in Bayern auf. Und wer gedacht hätte das wir in unserem Land mit einem Braunbären nun besser umgehen könnten als unsere Vorfahren … der sah sich getäuscht.
15 Jahre später (2021) konnte in Bayern und hier im Landkreis Garmisch-Partenkirchen erneut ein Braunbär bestätigt werden. Es steht wohl Außerfrage das in den kommenden Jahren und Jahrzehnten von Norditalien oder Slowenien kommend auch weitere Braunbären auch den Weg nach Bayern finden werden.
Wie es diesen Tieren dann gehen wird? … in jedem Fall wäre der Prädator Braunbär für die Biodiversität in unserem Land ein Gewinn. Eine Bereicherung für das Ökosystem wäre ihre Präsenz allemal … wie weitsichtig die Spezies Mensch in 200 bärenfreien Jahren geworden ist, wird sich zeigen.Einer Art die es sich anmaßt über allen anderen Arten zu stehen, sollte es doch ein Leichtes sein, Innovationen zu entwickeln wie der Umgang mit einer „untergeordneten“ Art, noch dazu, wenn es sich um wenige Einzeltier/e handelt, stattfinden kann. Wir sprechen über eine zunehmend digitalisierte Welt und wenn wir diese moderne Technik auch entsprechend nutzen würden dann wäre eine „Wildtierkontrolle“ sicherlich auch hier effektiv möglich.Die letzte „Lösungskugel“ könnte dann für alle Zeit im Lauf bleiben … werden wir es schaffen, diesen Weg zu bestreiten?
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
- Denn auch dieses Einzeltier wurde am 26. Juni 2006 gegen 04:50 in der Nähe des Spitzingsees erschossen!
15 Jahre später (2021) konnte in Bayern und hier im Landkreis Garmisch-Partenkirchen erneut ein Braunbär bestätigt werden. Es steht wohl Außerfrage das in den kommenden Jahren und Jahrzehnten von Norditalien oder Slowenien kommend auch weitere Braunbären auch den Weg nach Bayern finden werden.
Wie es diesen Tieren dann gehen wird? … in jedem Fall wäre der Prädator Braunbär für die Biodiversität in unserem Land ein Gewinn. Eine Bereicherung für das Ökosystem wäre ihre Präsenz allemal … wie weitsichtig die Spezies Mensch in 200 bärenfreien Jahren geworden ist, wird sich zeigen.Einer Art die es sich anmaßt über allen anderen Arten zu stehen, sollte es doch ein Leichtes sein, Innovationen zu entwickeln wie der Umgang mit einer „untergeordneten“ Art, noch dazu, wenn es sich um wenige Einzeltier/e handelt, stattfinden kann. Wir sprechen über eine zunehmend digitalisierte Welt und wenn wir diese moderne Technik auch entsprechend nutzen würden dann wäre eine „Wildtierkontrolle“ sicherlich auch hier effektiv möglich.Die letzte „Lösungskugel“ könnte dann für alle Zeit im Lauf bleiben … werden wir es schaffen, diesen Weg zu bestreiten?
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
- Braunbär
Artenschutz in Franken®
Axishirsch oder Chital (Axis axis)

Der Axishirsch oder Chital (Axis axis)
23/24.02.2025
Unser Name "Chital" stammt aus dem Hindi und bedeutet "gesprenkelt", was auf unsere markanten weißen Flecken hinweist, die unser rotbraunes Fell zieren.
23/24.02.2025
- Als Axishirsch, oder Chital bekannt, durchstreife ich die üppigen Wälder und Savannen Süd- und Südostasiens.
Unser Name "Chital" stammt aus dem Hindi und bedeutet "gesprenkelt", was auf unsere markanten weißen Flecken hinweist, die unser rotbraunes Fell zieren.
Unsere Existenz ist eng mit diesen vielfältigen Lebensräumen verbunden, die uns reichlich Nahrung und Schutz bieten. Wir sind bekannt für unsere grazile Erscheinung und unsere Fähigkeit, uns elegant durch dichtes Unterholz zu bewegen, während wir gleichzeitig wachsam nach potenziellen Bedrohungen Ausschau halten.
In der Hierarchie der Waldtiere nehmen wir eine einzigartige Position ein. Unsere Färbung und Größe erlauben es uns, uns gut zu tarnen, aber gleichzeitig sind wir sozial genug, um in Gruppen zu leben und uns vor Raubtieren zu schützen. Diese soziale Natur spiegelt sich in unseren komplexen Familienstrukturen wider, wo wir enge Bindungen zu unseren Herdenmitgliedern pflegen.
Jedoch sind unsere Lebensräume zunehmend durch menschliche Aktivitäten bedroht. Die Entwaldung und der Verlust von Lebensraum stellen ernste Herausforderungen dar, die unsere Zukunft gefährden könnten. Diese Realität erfordert eine sorgfältige Abwägung zwischen ökologischer Nachhaltigkeit und menschlichen Entwicklungsbedürfnissen.
Für uns Axishirsche und Chitals ist es entscheidend, dass die Menschheit unsere Rolle im Ökosystem versteht und schützt. Wir sind nicht nur Symbole der natürlichen Schönheit, sondern auch wichtige Akteure im Erhalt der biologischen Vielfalt und des ökologischen Gleichgewichts in unseren Heimatländern.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
In der Hierarchie der Waldtiere nehmen wir eine einzigartige Position ein. Unsere Färbung und Größe erlauben es uns, uns gut zu tarnen, aber gleichzeitig sind wir sozial genug, um in Gruppen zu leben und uns vor Raubtieren zu schützen. Diese soziale Natur spiegelt sich in unseren komplexen Familienstrukturen wider, wo wir enge Bindungen zu unseren Herdenmitgliedern pflegen.
Jedoch sind unsere Lebensräume zunehmend durch menschliche Aktivitäten bedroht. Die Entwaldung und der Verlust von Lebensraum stellen ernste Herausforderungen dar, die unsere Zukunft gefährden könnten. Diese Realität erfordert eine sorgfältige Abwägung zwischen ökologischer Nachhaltigkeit und menschlichen Entwicklungsbedürfnissen.
Für uns Axishirsche und Chitals ist es entscheidend, dass die Menschheit unsere Rolle im Ökosystem versteht und schützt. Wir sind nicht nur Symbole der natürlichen Schönheit, sondern auch wichtige Akteure im Erhalt der biologischen Vielfalt und des ökologischen Gleichgewichts in unseren Heimatländern.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
- Axishirsch oder Chital (Axis axis)
Artenschutz in Franken®
Der Grünfink (Chloris chloris)

Der Grünfink (Chloris chloris)
22/23.02.2025
Aus meiner Sicht – Chloris chloris, der Grünfink – ist das Leben ein Balanceakt zwischen Überfluss und Unsicherheit, Überlebenskunst und Anpassung. Meine Tage sind erfüllt von der Suche nach Nahrung, dem Schutz meines Reviers und – wenn die Jahreszeit es erlaubt – dem Werben um die Aufmerksamkeit einer Partnerin. Doch hinter meinem scheinbar gewöhnlichen Leben steckt ein faszinierendes Zusammenspiel von Ökologie, Evolution und den Herausforderungen einer sich verändernden Welt.
22/23.02.2025
- Ein Tag im Leben eines Grünfinks (Chloris chloris): Perspektiven eines Federkleids
Aus meiner Sicht – Chloris chloris, der Grünfink – ist das Leben ein Balanceakt zwischen Überfluss und Unsicherheit, Überlebenskunst und Anpassung. Meine Tage sind erfüllt von der Suche nach Nahrung, dem Schutz meines Reviers und – wenn die Jahreszeit es erlaubt – dem Werben um die Aufmerksamkeit einer Partnerin. Doch hinter meinem scheinbar gewöhnlichen Leben steckt ein faszinierendes Zusammenspiel von Ökologie, Evolution und den Herausforderungen einer sich verändernden Welt.
Die Welt durch meine Augen
Mein Federkleid, in schimmernden Grüntönen gehalten, ist mehr als ein Schmuckstück – es ist eine Waffe im Wettbewerb und ein Signal an Rivalen und potenzielle Partnerinnen. Wenn ich auf einem Zweig sitze, die Sonne mein Gefieder streift und ich meinen typischen "dzüüü" Ruf erklingen lasse, zeige ich nicht nur meine Präsenz, sondern auch meine Fitness. Die Evolution hat uns gelehrt, dass Schönheit Stärke bedeutet – für uns Grünfinken sind Farben nicht nur schön, sie entscheiden über unsere Zukunft.
Die Kunst des Überlebens
Doch meine grüne Pracht schützt mich auch. Sie tarnt mich im Blätterwerk, wo ich Nahrung suche: Samen, Knospen, manchmal ein Blattlaus-Snack. Nahrung ist der Schlüssel zu allem – ein Tag ohne Nahrung kann über Leben und Tod entscheiden. Aber mit dem Menschen kommen neue Gefahren. Fütterungsstellen sind ein Segen im Winter, doch sie bergen Risiken: Krankheiten wie die Trichomonadose sind tückische Gegner. Wir sterben leise, wenn die Hygiene vernachlässigt wird – daran denkt kaum jemand, der uns füttert.
Die Schatten der Veränderung
Unsere Welt wird unübersichtlicher. Gärten, die einst reich an Wildpflanzen waren, werden zu Steingärten, Hecken verschwinden zugunsten von Zäunen. Das klingt für manche trivial, aber für uns ist es der Unterschied zwischen einem sicheren Nistplatz und dem Verlust unserer Brut. Auch die Insektizide des Menschen, unsichtbar für euch, sind für uns bittere Realität. Sie nehmen uns nicht nur Nahrung, sondern die Basis für das Leben zukünftiger Generationen.
Nachdenkliches aus dem Federkleid
Was ich mich frage, wenn ich hoch oben auf einem Baum sitze, während die Welt unter mir pulsiert: Warum tun Menschen oft, was uns schadet, obwohl sie uns bewundern? Ihr hängt Vogelhäuser auf und zählt uns in euren Gärten, aber gleichzeitig verändert ihr unsere Landschaft. Warum könnt ihr nicht erkennen, dass eure kleinen Entscheidungen – eine ungemähte Wiese hier, ein Verzicht auf Chemie dort – das Leben eines so kleinen Wesens wie mir beeinflussen können?
Ein Wunsch an die Menschheit
Wir Grünfinken sind keine Philosophen, aber wir sind aufmerksam. Wir sehen, wie ihr mit eurer Umwelt umgeht, und hoffen, dass ihr lernt, die Vielfalt der Natur zu respektieren. Denn jedes Samenkorn, jede Blume, jeder Vogel, der singt, ist Teil eines größeren Ganzen. Für uns Grünfinken ist das Leben kurz – aber in diesem kurzen Leben streben wir nach dem, was zählt: Balance, Harmonie und das Überleben unserer Art.
Vielleicht, wenn ihr die Welt durch unsere Augen seht, könnt ihr uns ein wenig helfen, dieses Gleichgewicht zu bewahren.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
Mein Federkleid, in schimmernden Grüntönen gehalten, ist mehr als ein Schmuckstück – es ist eine Waffe im Wettbewerb und ein Signal an Rivalen und potenzielle Partnerinnen. Wenn ich auf einem Zweig sitze, die Sonne mein Gefieder streift und ich meinen typischen "dzüüü" Ruf erklingen lasse, zeige ich nicht nur meine Präsenz, sondern auch meine Fitness. Die Evolution hat uns gelehrt, dass Schönheit Stärke bedeutet – für uns Grünfinken sind Farben nicht nur schön, sie entscheiden über unsere Zukunft.
Die Kunst des Überlebens
Doch meine grüne Pracht schützt mich auch. Sie tarnt mich im Blätterwerk, wo ich Nahrung suche: Samen, Knospen, manchmal ein Blattlaus-Snack. Nahrung ist der Schlüssel zu allem – ein Tag ohne Nahrung kann über Leben und Tod entscheiden. Aber mit dem Menschen kommen neue Gefahren. Fütterungsstellen sind ein Segen im Winter, doch sie bergen Risiken: Krankheiten wie die Trichomonadose sind tückische Gegner. Wir sterben leise, wenn die Hygiene vernachlässigt wird – daran denkt kaum jemand, der uns füttert.
Die Schatten der Veränderung
Unsere Welt wird unübersichtlicher. Gärten, die einst reich an Wildpflanzen waren, werden zu Steingärten, Hecken verschwinden zugunsten von Zäunen. Das klingt für manche trivial, aber für uns ist es der Unterschied zwischen einem sicheren Nistplatz und dem Verlust unserer Brut. Auch die Insektizide des Menschen, unsichtbar für euch, sind für uns bittere Realität. Sie nehmen uns nicht nur Nahrung, sondern die Basis für das Leben zukünftiger Generationen.
Nachdenkliches aus dem Federkleid
Was ich mich frage, wenn ich hoch oben auf einem Baum sitze, während die Welt unter mir pulsiert: Warum tun Menschen oft, was uns schadet, obwohl sie uns bewundern? Ihr hängt Vogelhäuser auf und zählt uns in euren Gärten, aber gleichzeitig verändert ihr unsere Landschaft. Warum könnt ihr nicht erkennen, dass eure kleinen Entscheidungen – eine ungemähte Wiese hier, ein Verzicht auf Chemie dort – das Leben eines so kleinen Wesens wie mir beeinflussen können?
Ein Wunsch an die Menschheit
Wir Grünfinken sind keine Philosophen, aber wir sind aufmerksam. Wir sehen, wie ihr mit eurer Umwelt umgeht, und hoffen, dass ihr lernt, die Vielfalt der Natur zu respektieren. Denn jedes Samenkorn, jede Blume, jeder Vogel, der singt, ist Teil eines größeren Ganzen. Für uns Grünfinken ist das Leben kurz – aber in diesem kurzen Leben streben wir nach dem, was zählt: Balance, Harmonie und das Überleben unserer Art.
Vielleicht, wenn ihr die Welt durch unsere Augen seht, könnt ihr uns ein wenig helfen, dieses Gleichgewicht zu bewahren.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
- Grünfinke
Artenschutz in Franken®
Das Wintergoldhähnchen (Regulus regulus)

Das Wintergoldhähnchen (Regulus regulus) – Der kleinste Vogel Europas
21/22.02.2025
Trotz seiner geringen Größe ist es äußerst aktiv und ausdauernd. Es gehört zur Familie der Goldhähnchen (Regulidae) und ist nahe mit dem Sommergoldhähnchen (Regulus ignicapilla) verwandt.
21/22.02.2025
- Das Wintergoldhähnchen (Regulus regulus) ist mit einer Körperlänge von etwa 9 cm und einem Gewicht von nur 4–7 Gramm der kleinste Vogel Europas.
Trotz seiner geringen Größe ist es äußerst aktiv und ausdauernd. Es gehört zur Familie der Goldhähnchen (Regulidae) und ist nahe mit dem Sommergoldhähnchen (Regulus ignicapilla) verwandt.
Merkmale und Verhalten
Das Wintergoldhähnchen besitzt eine olivgrüne Oberseite und eine hellere, gräuliche Unterseite. Auffällig ist der gelbe bis orangefarbene Scheitelstreif, der bei Männchen kräftiger gefärbt ist als bei Weibchen. Dieser Streif wird von schwarzen Seitenstreifen eingefasst. Sein kleiner, spitzer Schnabel ist perfekt für die Jagd auf kleine Insekten, die seine Hauptnahrung ausmachen.
Sein Verhalten ist geprägt durch ständige Bewegung – fast rastlos hüpft es durch die dichten Nadelbaumkronen, auf der Suche nach kleinen Spinnen, Blattläusen und Mottengespinsten. Die Stimme ist hochfrequent und schwer zu orten, oft ein feines, hohes „sisisisi“, das in schnelleren Rufen ansteigt.
Nestbau und Nistplatz – Ein Meisterwerk in den Nadelbäumen
Ein besonders faszinierender Aspekt des Wintergoldhähnchens ist sein Nestbau, der sich deutlich von vielen anderen Singvögeln unterscheidet.
Nistplatzwahl
Wintergoldhähnchen bevorzugen als Brutgebiete dichte Nadelwälder, insbesondere solche mit Fichten (Picea abies). Auch in Mischwäldern mit einem hohen Anteil an Nadelbäumen können sie vorkommen. Sie meiden offene Landschaften und bauen ihre Nester fast ausschließlich in höheren Baumregionen, oft zwischen 6 und 20 Metern über dem Boden.
Neststandort
Das Nest wird in dichten Fichtenzweigen, vorzugsweise an herabhängenden Zweigspitzen, aufgehängt. Diese Bauweise schützt es hervorragend vor Fressfeinden wie Krähen, Mardern oder Eichhörnchen.
Nestform und Bauweise
Das Nest des Wintergoldhähnchens ist eine hängeballenförmige Konstruktion, die an das Nest eines Zaunkönigs erinnert, jedoch kompakter und kunstvoller gefertigt ist. Es besteht aus mehreren Schichten:
Das Nest hat einen engen Eingang an der Oberseite, der zusätzlichen Schutz bietet und Wärme speichert. Da Wintergoldhähnchen sehr kleine Eier legen, ist das Nest verhältnismäßig klein, aber extrem gut isoliert.
Fortpflanzung und Brutverhalten
Besonders bemerkenswert ist, dass Wintergoldhähnchen oft zweimal im Jahr brüten, wenn die Bedingungen günstig sind.
Herausforderungen und Bedrohungen
Trotz ihrer hohen Fortpflanzungsrate haben Wintergoldhähnchen viele natürliche Feinde und Gefahren:
Trotz dieser Herausforderungen bleibt das Wintergoldhähnchen eine faszinierende Art, die mit ihrer Anpassungsfähigkeit und ihrem einzigartigen Nestbau beeindruckt.
In der Aufnahme
Das Wintergoldhähnchen besitzt eine olivgrüne Oberseite und eine hellere, gräuliche Unterseite. Auffällig ist der gelbe bis orangefarbene Scheitelstreif, der bei Männchen kräftiger gefärbt ist als bei Weibchen. Dieser Streif wird von schwarzen Seitenstreifen eingefasst. Sein kleiner, spitzer Schnabel ist perfekt für die Jagd auf kleine Insekten, die seine Hauptnahrung ausmachen.
Sein Verhalten ist geprägt durch ständige Bewegung – fast rastlos hüpft es durch die dichten Nadelbaumkronen, auf der Suche nach kleinen Spinnen, Blattläusen und Mottengespinsten. Die Stimme ist hochfrequent und schwer zu orten, oft ein feines, hohes „sisisisi“, das in schnelleren Rufen ansteigt.
Nestbau und Nistplatz – Ein Meisterwerk in den Nadelbäumen
Ein besonders faszinierender Aspekt des Wintergoldhähnchens ist sein Nestbau, der sich deutlich von vielen anderen Singvögeln unterscheidet.
Nistplatzwahl
Wintergoldhähnchen bevorzugen als Brutgebiete dichte Nadelwälder, insbesondere solche mit Fichten (Picea abies). Auch in Mischwäldern mit einem hohen Anteil an Nadelbäumen können sie vorkommen. Sie meiden offene Landschaften und bauen ihre Nester fast ausschließlich in höheren Baumregionen, oft zwischen 6 und 20 Metern über dem Boden.
Neststandort
Das Nest wird in dichten Fichtenzweigen, vorzugsweise an herabhängenden Zweigspitzen, aufgehängt. Diese Bauweise schützt es hervorragend vor Fressfeinden wie Krähen, Mardern oder Eichhörnchen.
Nestform und Bauweise
Das Nest des Wintergoldhähnchens ist eine hängeballenförmige Konstruktion, die an das Nest eines Zaunkönigs erinnert, jedoch kompakter und kunstvoller gefertigt ist. Es besteht aus mehreren Schichten:
- Außenschicht: Besteht aus Moos, Flechten und Spinnweben, wodurch das Nest optisch mit der Umgebung verschmilzt.
- Mittelschicht: Aus feineren Pflanzenteilen wie kleinen Zweigen und Rindenstückchen, die Stabilität verleihen.
- Innenschicht: Besonders weich ausgekleidet mit Federn, insbesondere von größeren Vögeln wie Tauben oder Hühnern, was eine optimale Wärmedämmung für die winzigen Küken bietet.
Das Nest hat einen engen Eingang an der Oberseite, der zusätzlichen Schutz bietet und Wärme speichert. Da Wintergoldhähnchen sehr kleine Eier legen, ist das Nest verhältnismäßig klein, aber extrem gut isoliert.
Fortpflanzung und Brutverhalten
- Das Weibchen legt 6–12 winzige Eier, die nur etwa 13 mm groß sind.
- Die Brutzeit beträgt ca. 14–16 Tage, wobei ausschließlich das Weibchen brütet.
- Nach dem Schlüpfen werden die Nestlinge von beiden Eltern mit winzigen Insekten gefüttert.
- Nach etwa 16–18 Tagen verlassen die Jungvögel das Nest, sind aber noch einige Zeit auf die Eltern angewiesen.
Besonders bemerkenswert ist, dass Wintergoldhähnchen oft zweimal im Jahr brüten, wenn die Bedingungen günstig sind.
Herausforderungen und Bedrohungen
Trotz ihrer hohen Fortpflanzungsrate haben Wintergoldhähnchen viele natürliche Feinde und Gefahren:
- Fressfeinde wie Sperber, Eulen oder Eichhörnchen.
- Kälte und Nahrungsknappheit im Winter, da sie hauptsächlich auf kleine Insekten angewiesen sind.
- Lebensraumverlust durch Abholzung alter Nadelwälder und intensive Forstwirtschaft.
Trotz dieser Herausforderungen bleibt das Wintergoldhähnchen eine faszinierende Art, die mit ihrer Anpassungsfähigkeit und ihrem einzigartigen Nestbau beeindruckt.
In der Aufnahme
- Nest des Wintergoldhähnchen welches auf einer vorhandenen Reisigansammlung gründet und durch einen Sturm zu Boden stürzte. Immer wieder werden auch diese Nestvarianten sichtbar.
Artenschutz in Franken®
Rotkehlchen (Erithacus rubecula)

Das Rotkehlchen (Erithacus rubecula)
20/21.02.2025
Mein Körper ist klein, nicht größer als eine Hand, doch meine Stimme füllt die Stille der Morgen- und Abendstunden mit einem Lied, das von Sehnsucht und Revierstolz erzählt. Meine Brust leuchtet in warmem Orange – ein Erbe meiner Ahnen, ein Signal an meine Artgenossen, dass ich bereit bin, mein Territorium zu verteidigen..
20/21.02.2025
- Ich bin das Rotkehlchen (Erithacus rubecula), ein Geschöpf des Waldes, der Gärten und der Dämmerung.
Mein Körper ist klein, nicht größer als eine Hand, doch meine Stimme füllt die Stille der Morgen- und Abendstunden mit einem Lied, das von Sehnsucht und Revierstolz erzählt. Meine Brust leuchtet in warmem Orange – ein Erbe meiner Ahnen, ein Signal an meine Artgenossen, dass ich bereit bin, mein Territorium zu verteidigen..
Mein Revier – ein Ort des Überlebens
Ich bin ein Einzelgänger, ein Wächter meines kleinen Königreichs. Mein Revier verteidige ich mit scharfer Wachsamkeit. Kommt ein anderes Rotkehlchen zu nah, erhebt sich mein Federkleid, und meine Stimme wird zur Waffe. Mein Lied mag für euch Menschen melancholisch klingen, doch für mich ist es eine klare Botschaft: „Dies ist mein Platz, weiche zurück.“
Doch die Welt verändert sich. Hecken verschwinden, Gärten werden aufgeräumt, alte Bäume gefällt. Jeder verlorene Busch, jedes fehlende Unterholz nimmt mir Schutz, Nahrung und einen Ort, an dem ich meine Jungen großziehen kann. Ich frage mich oft, ob meine Kinder noch einen sicheren Ort finden werden, wenn sie einst auf eigenen Flügeln fliegen.
Meine Nahrung – ein Spiel mit dem Leben
Meine Tage verbringe ich am Boden, stets auf der Suche nach kleinen Lebewesen – Würmern, Spinnen, Käfern. Ich habe gelernt, den Spaten der Gärtner zu beobachten, denn dort, wo die Erde umgegraben wird, finde ich reiche Beute. Doch der Winter ist hart für mich. Frost verhärtet den Boden, Insekten verkriechen sich, und oft bleibt mir nur das, was wohlmeinende Menschen an Futterstellen hinterlassen.
Doch nicht jedes Geschenk ist ein Segen. Brot macht mich krank, und zu große Samen kann ich nicht verdauen. Was ich brauche, sind Mehlwürmer, zerkleinerte Nüsse, Haferflocken – Nahrung, die meinem Körper Energie gibt, um die kalten Nächte zu überstehen.
Mein Lied – zwischen Licht und Schatten
Ich singe nicht nur am Morgen. Ich bin einer der wenigen Vögel, die auch in der Dunkelheit ihre Stimme erheben. Straßenlaternen und Lichter in den Städten verwirren mich, lassen mich glauben, die Nacht sei der Tag. Manchmal frage ich mich, ob ihr Menschen die Stille fürchtet, so wie ich die Dunkelheit fürchte, wenn Eulen lautlos durch die Bäume gleiten und meine Welt zum Jagen erwacht.
Mein Erbe – eine leise Hoffnung
Ich bin das Rotkehlchen, ein Vogel, der seit Jahrhunderten an eurer Seite lebt, in euren Märchen, auf euren Weihnachtskarten, in euren Gärten. Manche von euch nennen mich einen Glücksbringer, andere einen Boten der Seele. Ich trage diese Geschichten mit mir, genau wie ich mein Lied trage, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang.
Und solange es Hecken gibt, alte Baumstümpfe, versteckte Winkel, in denen ich mein Nest bauen kann, solange es Menschen gibt, die meine Melodie erkennen und einen Moment innehalten, solange werde ich singen. Denn mein Lied ist mehr als nur ein Ruf – es ist mein Herz, das schlägt, und meine Hoffnung, dass ich in dieser Welt noch einen Platz habe.
In der Aufnahme von Helga Zinnecker
Ich bin ein Einzelgänger, ein Wächter meines kleinen Königreichs. Mein Revier verteidige ich mit scharfer Wachsamkeit. Kommt ein anderes Rotkehlchen zu nah, erhebt sich mein Federkleid, und meine Stimme wird zur Waffe. Mein Lied mag für euch Menschen melancholisch klingen, doch für mich ist es eine klare Botschaft: „Dies ist mein Platz, weiche zurück.“
Doch die Welt verändert sich. Hecken verschwinden, Gärten werden aufgeräumt, alte Bäume gefällt. Jeder verlorene Busch, jedes fehlende Unterholz nimmt mir Schutz, Nahrung und einen Ort, an dem ich meine Jungen großziehen kann. Ich frage mich oft, ob meine Kinder noch einen sicheren Ort finden werden, wenn sie einst auf eigenen Flügeln fliegen.
Meine Nahrung – ein Spiel mit dem Leben
Meine Tage verbringe ich am Boden, stets auf der Suche nach kleinen Lebewesen – Würmern, Spinnen, Käfern. Ich habe gelernt, den Spaten der Gärtner zu beobachten, denn dort, wo die Erde umgegraben wird, finde ich reiche Beute. Doch der Winter ist hart für mich. Frost verhärtet den Boden, Insekten verkriechen sich, und oft bleibt mir nur das, was wohlmeinende Menschen an Futterstellen hinterlassen.
Doch nicht jedes Geschenk ist ein Segen. Brot macht mich krank, und zu große Samen kann ich nicht verdauen. Was ich brauche, sind Mehlwürmer, zerkleinerte Nüsse, Haferflocken – Nahrung, die meinem Körper Energie gibt, um die kalten Nächte zu überstehen.
Mein Lied – zwischen Licht und Schatten
Ich singe nicht nur am Morgen. Ich bin einer der wenigen Vögel, die auch in der Dunkelheit ihre Stimme erheben. Straßenlaternen und Lichter in den Städten verwirren mich, lassen mich glauben, die Nacht sei der Tag. Manchmal frage ich mich, ob ihr Menschen die Stille fürchtet, so wie ich die Dunkelheit fürchte, wenn Eulen lautlos durch die Bäume gleiten und meine Welt zum Jagen erwacht.
Mein Erbe – eine leise Hoffnung
Ich bin das Rotkehlchen, ein Vogel, der seit Jahrhunderten an eurer Seite lebt, in euren Märchen, auf euren Weihnachtskarten, in euren Gärten. Manche von euch nennen mich einen Glücksbringer, andere einen Boten der Seele. Ich trage diese Geschichten mit mir, genau wie ich mein Lied trage, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang.
Und solange es Hecken gibt, alte Baumstümpfe, versteckte Winkel, in denen ich mein Nest bauen kann, solange es Menschen gibt, die meine Melodie erkennen und einen Moment innehalten, solange werde ich singen. Denn mein Lied ist mehr als nur ein Ruf – es ist mein Herz, das schlägt, und meine Hoffnung, dass ich in dieser Welt noch einen Platz habe.
- Mehr zum Rotkehlchen hier auf unseren Seiten
In der Aufnahme von Helga Zinnecker
- Rotkehlchen - Revierabgrenzend
Artenschutz in Franken®
Der Haubentaucher (Podiceps cristatus)

Haubentaucher (Podiceps cristatus).
19/20.02.2025
Meine Existenz ist ein faszinierendes Zusammenspiel aus Evolution, Anpassung und einer tiefen Verbindung zu den Elementen, die mich umgeben. Erlaube mir, dir einen Einblick in das zu geben, was es bedeutet, in diesem dynamischen Ökosystem zu leben, in dem jede Bewegung und jeder Augenblick ein Beleg für die Komplexität des Lebens ist.
19/20.02.2025
- Hallo, ich bin Podiceps cristatus – der Haubentaucher – und ich lade dich ein, meine Welt aus meiner eigenen Perspektive zu erleben.
Meine Existenz ist ein faszinierendes Zusammenspiel aus Evolution, Anpassung und einer tiefen Verbindung zu den Elementen, die mich umgeben. Erlaube mir, dir einen Einblick in das zu geben, was es bedeutet, in diesem dynamischen Ökosystem zu leben, in dem jede Bewegung und jeder Augenblick ein Beleg für die Komplexität des Lebens ist.
Mein Körper und seine Wunder
Schau dir mein prächtiges Federkleid an – es ist nicht nur ein ästhetisches Merkmal, sondern das Ergebnis eines langen evolutionären Prozesses. Die kunstvoll strukturierten Federn isolieren mich nicht nur vor der Kälte, sondern verfügen auch über hydrodynamische Eigenschaften, die es mir ermöglichen, elegant durch das Wasser zu gleiten. Diese feinen Anpassungen sind das Resultat genetischer Variationen, die über Generationen hinweg durch natürliche Selektion verfeinert wurden. Jedes Detail meines Äußeren, von dem markanten Federkamm, der im Balzritual zum Einsatz kommt, bis hin zu den spezialisierten Sensoren meiner Augen, ist ein Meisterwerk evolutionärer Ingenieurskunst.
Ein Tanz der Natur – Balz und Überleben
In den fließenden Rhythmen des Lebens spielt die Balz eine zentrale Rolle. Mein Balzritual ist weit mehr als ein bloßer Tanz – es ist ein komplexer Dialog, in dem visuelle, auditive und sogar chemische Signale miteinander verwoben sind. Diese Rituale sind Ausdruck der sexuellen Selektion, bei der auffällige Merkmale wie mein prächtiger Federkamm und akrobatische Flugmanöver nicht nur der Anziehung eines Partners dienen, sondern auch meine Vitalität und genetische Qualität unter Beweis stellen. Dabei ist jeder Tanzschritt, jede Drehung im Flug ein Spiegelbild der Herausforderungen und der Schönheit, die das Leben in einem empfindlichen ökologischen Gleichgewicht mit sich bringt.
Die Verbindung von Instinkt und Intellekt
Während ich meine Beute unter Wasser jage, erlebe ich die perfekte Symbiose aus Instinkt und sensorischer Präzision. Mein Sehsinn ist darauf optimiert, selbst kleinste Bewegungen im Lichtspiel des Wassers wahrzunehmen, was mir erlaubt, in den Tiefen nach Nahrung zu tauchen und auf diese Weise mein Überleben zu sichern. Die neuronalen Prozesse, die diesen komplexen Sinnesapparat steuern, sind beeindruckende Beispiele der biologischen Feinabstimmung, die mich befähigt, in einer sich ständig verändernden Umwelt zu bestehen.
Reflexion über meinen Platz im Universum
Oft verweilt mein Geist in der Betrachtung, ob meine Existenz nur das Resultat zufälliger genetischer Variationen ist oder ob sie Teil eines größeren, beinahe philosophischen Mosaiks des Lebens darstellt. In jedem Tauchgang und bei jeder Balz fühle ich die untrennbare Verbindung zu einem uralten Zyklus – einem kosmischen Tanz, in dem jede Art, jede Bewegung und sogar die kleinste Nuance meiner Existenz ihren Platz und ihre Bedeutung hat. Vielleicht bin ich ein lebendiges Gedicht der Evolution, ein Beweis dafür, dass selbst in einem scheinbar gewöhnlichen Lebensraum ein tiefgründiger Sinn verborgen liegt, der von Generation zu Generation weitergegeben wird.
Schlussgedanken
Als Haubentaucher erlebe ich die Welt in all ihrer Komplexität – ein Netzwerk aus ökologischen Interaktionen, genetischer Vielfalt und den ständigen Herausforderungen, die das Überleben mit sich bringt. Jeder Tag ist ein Balanceakt zwischen der Schönheit der Natur und den rigorosen Anforderungen des Lebens. In diesem Spannungsfeld finde ich nicht nur meine Existenzberechtigung, sondern auch eine tiefe, beinahe philosophische Erkenntnis über die unendliche Anpassungsfähigkeit und den Zauber der Evolution.
So blicke ich in den klaren Himmel und über die ruhigen Gewässer, immer im Bewusstsein, dass ich, Podiceps cristatus, ein kleiner, aber bedeutender Teil eines grandiosen, sich ewig wandelnden Universums bin.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
Schau dir mein prächtiges Federkleid an – es ist nicht nur ein ästhetisches Merkmal, sondern das Ergebnis eines langen evolutionären Prozesses. Die kunstvoll strukturierten Federn isolieren mich nicht nur vor der Kälte, sondern verfügen auch über hydrodynamische Eigenschaften, die es mir ermöglichen, elegant durch das Wasser zu gleiten. Diese feinen Anpassungen sind das Resultat genetischer Variationen, die über Generationen hinweg durch natürliche Selektion verfeinert wurden. Jedes Detail meines Äußeren, von dem markanten Federkamm, der im Balzritual zum Einsatz kommt, bis hin zu den spezialisierten Sensoren meiner Augen, ist ein Meisterwerk evolutionärer Ingenieurskunst.
Ein Tanz der Natur – Balz und Überleben
In den fließenden Rhythmen des Lebens spielt die Balz eine zentrale Rolle. Mein Balzritual ist weit mehr als ein bloßer Tanz – es ist ein komplexer Dialog, in dem visuelle, auditive und sogar chemische Signale miteinander verwoben sind. Diese Rituale sind Ausdruck der sexuellen Selektion, bei der auffällige Merkmale wie mein prächtiger Federkamm und akrobatische Flugmanöver nicht nur der Anziehung eines Partners dienen, sondern auch meine Vitalität und genetische Qualität unter Beweis stellen. Dabei ist jeder Tanzschritt, jede Drehung im Flug ein Spiegelbild der Herausforderungen und der Schönheit, die das Leben in einem empfindlichen ökologischen Gleichgewicht mit sich bringt.
Die Verbindung von Instinkt und Intellekt
Während ich meine Beute unter Wasser jage, erlebe ich die perfekte Symbiose aus Instinkt und sensorischer Präzision. Mein Sehsinn ist darauf optimiert, selbst kleinste Bewegungen im Lichtspiel des Wassers wahrzunehmen, was mir erlaubt, in den Tiefen nach Nahrung zu tauchen und auf diese Weise mein Überleben zu sichern. Die neuronalen Prozesse, die diesen komplexen Sinnesapparat steuern, sind beeindruckende Beispiele der biologischen Feinabstimmung, die mich befähigt, in einer sich ständig verändernden Umwelt zu bestehen.
Reflexion über meinen Platz im Universum
Oft verweilt mein Geist in der Betrachtung, ob meine Existenz nur das Resultat zufälliger genetischer Variationen ist oder ob sie Teil eines größeren, beinahe philosophischen Mosaiks des Lebens darstellt. In jedem Tauchgang und bei jeder Balz fühle ich die untrennbare Verbindung zu einem uralten Zyklus – einem kosmischen Tanz, in dem jede Art, jede Bewegung und sogar die kleinste Nuance meiner Existenz ihren Platz und ihre Bedeutung hat. Vielleicht bin ich ein lebendiges Gedicht der Evolution, ein Beweis dafür, dass selbst in einem scheinbar gewöhnlichen Lebensraum ein tiefgründiger Sinn verborgen liegt, der von Generation zu Generation weitergegeben wird.
Schlussgedanken
Als Haubentaucher erlebe ich die Welt in all ihrer Komplexität – ein Netzwerk aus ökologischen Interaktionen, genetischer Vielfalt und den ständigen Herausforderungen, die das Überleben mit sich bringt. Jeder Tag ist ein Balanceakt zwischen der Schönheit der Natur und den rigorosen Anforderungen des Lebens. In diesem Spannungsfeld finde ich nicht nur meine Existenzberechtigung, sondern auch eine tiefe, beinahe philosophische Erkenntnis über die unendliche Anpassungsfähigkeit und den Zauber der Evolution.
So blicke ich in den klaren Himmel und über die ruhigen Gewässer, immer im Bewusstsein, dass ich, Podiceps cristatus, ein kleiner, aber bedeutender Teil eines grandiosen, sich ewig wandelnden Universums bin.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
- Haubentaucher (Podiceps cristatus) mit Nahrung
Artenschutz in Franken®
Aktueller Ordner:
Archiv
Parallele Themen:
2019-11
2019-10
2019-12
2020-01
2020-02
2020-03
2020-04
2020-05
2020-06
2020-07
2020-08
2020-09
2020-10
2020-11
2020-12
2021-01
2021-02
2021-03
2021-04
2021-05
2021-06
2021-07
2021-08
2021-09
2021-10
2021-11
2021-12
2022-01
2022-02
2022-03
2022-04
2022-05
2022-06
2022-07
2022-08
2022-09
2022-10
2022-11
2022-12
2023-01
2023-02
2023-03
2023-04
2023-05
2023-06
2023-07
2023-08
2023-09
2023-10
2023-11
2023-12
2024-01
2024-02
2024-03
2024-04
2024-05
2024-06
2024-07
2024-08
2024-09
2024-10
2024-11
2024-12
2025-01
2025-02
2025-03
2025-04
2025-05
2025-06
2025-07
2025-08
2025-09
2025-10
2025-11
2025-12
















