Die Ringelnatter (Natrix natrix)

Ringelnatter (Natrix natrix)
21/22.08.2024
Sie ist in Europa und Teilen Asiens weit verbreitet und bewohnt eine Vielzahl von Lebensräumen, einschließlich Feuchtgebiete, Wälder, Wiesen und sogar städtische Umgebungen.
21/22.08.2024
- Die Ringelnatter (Natrix natrix) ist eine nicht giftige Schlangenart, die zur Familie der Nattern (Colubridae) gehört.
Sie ist in Europa und Teilen Asiens weit verbreitet und bewohnt eine Vielzahl von Lebensräumen, einschließlich Feuchtgebiete, Wälder, Wiesen und sogar städtische Umgebungen.
Anatomisch betrachtet ist die Ringelnatter schlank und langgestreckt mit einer durchschnittlichen Länge von 60 bis 100 Zentimetern, obwohl einige Individuen bis zu 150 Zentimeter lang werden können. Ihre Körperfärbung variiert je nach Lebensraum und kann von olivgrün bis graubraun reichen, oft mit dunklen Flecken oder Streifen entlang des Rückens und der Seiten. Die Unterseite ist in der Regel heller und kann gelblich oder orange gefärbt sein.
Ringelnattern sind semi-aquatisch und ausgezeichnete Schwimmer. Sie ernähren sich hauptsächlich von Amphibien wie Fröschen, Kröten und Molchen, aber auch von kleinen Fischen und gelegentlich kleinen Säugetieren oder Vögeln. Ihr Jagdverhalten ist typisch für Schlangen: Sie lauern ihrer Beute auf, schleichen sich an sie heran und greifen dann blitzschnell an, um sie zu ergreifen.
Fortpflanzungstechnisch sind Ringelnattern ovovivipar, was bedeutet, dass die Eier im Körper der Mutter ausgebrütet werden und sie lebende Jungschlangen zur Welt bringt. Die Paarung erfolgt im Frühjahr, und die Weibchen bringen im Spätsommer oder Herbst normalerweise eine Vielzahl von Jungschlangen zur Welt.
Aus ökologischer Sicht spielen Ringelnattern eine wichtige Rolle in ihren Ökosystemen, sowohl als Prädatoren von kleinen Wirbeltieren als auch als Beute für größere Raubtiere. Sie helfen, das Gleichgewicht in den Populationen ihrer Beutetiere zu regulieren, und dienen als Indikator für die Gesundheit von Feuchtgebieten und anderen Lebensräumen, in denen sie vorkommen.
Insgesamt ist die Ringelnatter eine faszinierende Schlangenart, die gut an ihre Umgebung angepasst ist und eine wichtige Rolle in den Ökosystemen Europas und Asiens spielt.
Aufnahme von Klaus Sanwald
Ringelnattern sind semi-aquatisch und ausgezeichnete Schwimmer. Sie ernähren sich hauptsächlich von Amphibien wie Fröschen, Kröten und Molchen, aber auch von kleinen Fischen und gelegentlich kleinen Säugetieren oder Vögeln. Ihr Jagdverhalten ist typisch für Schlangen: Sie lauern ihrer Beute auf, schleichen sich an sie heran und greifen dann blitzschnell an, um sie zu ergreifen.
Fortpflanzungstechnisch sind Ringelnattern ovovivipar, was bedeutet, dass die Eier im Körper der Mutter ausgebrütet werden und sie lebende Jungschlangen zur Welt bringt. Die Paarung erfolgt im Frühjahr, und die Weibchen bringen im Spätsommer oder Herbst normalerweise eine Vielzahl von Jungschlangen zur Welt.
Aus ökologischer Sicht spielen Ringelnattern eine wichtige Rolle in ihren Ökosystemen, sowohl als Prädatoren von kleinen Wirbeltieren als auch als Beute für größere Raubtiere. Sie helfen, das Gleichgewicht in den Populationen ihrer Beutetiere zu regulieren, und dienen als Indikator für die Gesundheit von Feuchtgebieten und anderen Lebensräumen, in denen sie vorkommen.
Insgesamt ist die Ringelnatter eine faszinierende Schlangenart, die gut an ihre Umgebung angepasst ist und eine wichtige Rolle in den Ökosystemen Europas und Asiens spielt.
Aufnahme von Klaus Sanwald
- Ringelnatter
Artenschutz in Franken®
Das sich Sammeln der Schwalben 2024

Das sich Sammeln der Schwalben
21/22.08.2024
21/22.08.2024
- Mehlschwalben und Rauchschwalben sind Vogelarten, die für ihr Verhalten bekannt sind, sich an bestimmten Sammelplätzen zu versammeln, bevor sie gemeinsam in ihre Winterquartiere aufbrechen.
- Diese Sammelplätze sind oft Telegrafen- oder Stromleitungen, aber es gibt mehrere Gründe, warum sie diese nicht unbedingt benötigen:
- Soziales Verhalten und Kommunikation: Schwalben sind gesellige Vögel, die stark auf soziale Signale und Kommunikation untereinander angewiesen sind. Die Wahl eines Sammelplatzes wie einer Stromleitung könnte darauf zurückzuführen sein, dass es ein gut sichtbarer Ort ist, an dem sie leicht zusammenkommen können, um sich zu versammeln und Informationen auszutauschen.
- Natürliche Sammelpunkte: In der Natur gibt es andere natürliche Erhebungen oder Strukturen wie Bäume, Felsen oder Gebäude, die ähnliche Funktionen erfüllen können wie Stromleitungen. Diese dienen den Schwalben als Orientierungspunkte und erleichtern es ihnen, sich zu sammeln, bevor sie ihre Zugreise antreten.
- Instinktives Verhalten: Schwalben haben ein stark ausgeprägtes Zugverhalten, das genetisch bedingt ist. Sie folgen oft traditionellen Zugrouten, die über Generationen hinweg entwickelt wurden. Die Wahl des Sammelplatzes könnte daher auch teilweise auf diesen instinktiven Zugtrieb zurückzuführen sein.
Fachlich betrachtet können diese Aspekte durch Studien zur Ethologie (Verhaltensforschung) und Ornithologie (Vogelkunde) erklärt werden. Forscher haben beobachtet, wie Schwalben kommunizieren und welche Faktoren ihre Sammelplätze bestimmen. Diese Erkenntnisse helfen dabei zu verstehen, warum Schwalben bestimmte Strukturen für ihre Zugvorbereitungen nutzen, ohne dass diese zwingend menschliche Einrichtungen wie Stromleitungen sein müssen.
In der Aufnahme vom 11.08.2024
- Rauch- und Mehlschwalben sammeln sich auf Stromleitungen ..
Artenschutz in Franken®
Das Reh (Capreolus capreolus)
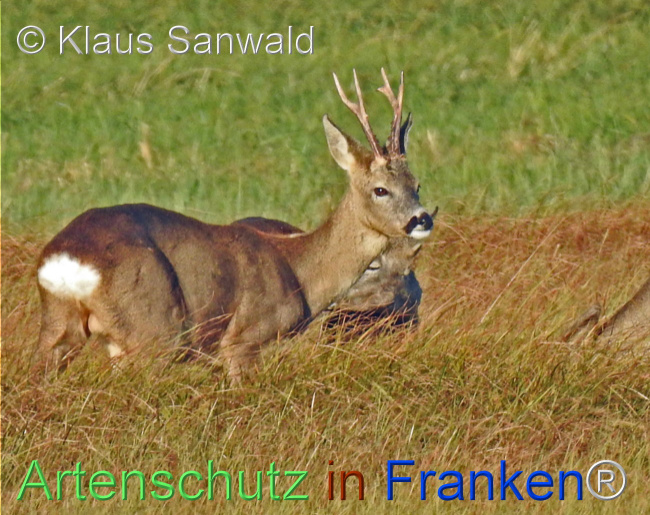
Reh (Capreolus capreolus)
20/21.08.2024
Ich lebe hauptsächlich in Wäldern, aber ich finde mich auch gut in Feldlandschaften zurecht, besonders dort, wo es eine Mischung aus Wald, Wiesen und Feldern gibt. Diese Lebensräume bieten mir Schutz, Nahrung und die Möglichkeit, mich zurückzuziehen, wenn Gefahr droht. Meine Sinne sind sehr scharf: Mein Gehör und mein Geruchssinn sind besonders gut ausgeprägt, was mir hilft, Feinde frühzeitig zu bemerken.
20/21.08.2024
- Hallo! Ich bin ein Reh, genauer gesagt Capreolus capreolus, wie die Menschen uns nennen. Lass mich dir ein wenig über mein Leben und meine Sicht auf die Welt erzählen.
Ich lebe hauptsächlich in Wäldern, aber ich finde mich auch gut in Feldlandschaften zurecht, besonders dort, wo es eine Mischung aus Wald, Wiesen und Feldern gibt. Diese Lebensräume bieten mir Schutz, Nahrung und die Möglichkeit, mich zurückzuziehen, wenn Gefahr droht. Meine Sinne sind sehr scharf: Mein Gehör und mein Geruchssinn sind besonders gut ausgeprägt, was mir hilft, Feinde frühzeitig zu bemerken.
Meine Nahrung besteht hauptsächlich aus Gräsern, Kräutern, jungen Trieben und Blättern von Bäumen und Sträuchern. Im Sommer finde ich in den Wäldern und auf den Feldern eine Fülle von frischen Pflanzen, die ich gerne fresse. Im Winter hingegen, wenn das Nahrungsangebot knapper ist, wechsele ich zu Rinde, Knospen und abgestorbenen Pflanzenteilen. Ich bin also ein Pflanzenfresser, und mein Verdauungssystem ist darauf ausgelegt, diese faserreiche Kost effizient zu verwerten.
Ich bin ein ziemlich kleines Tier, vor allem im Vergleich zu anderen Hirscharten. Meine schlanke, anmutige Gestalt hilft mir, mich schnell und leise durch das Dickicht zu bewegen. Meine rotbraune Fellfarbe im Sommer passt sich hervorragend dem dichten Grün des Waldes an, während ich im Winter ein graubraunes Fell trage, das mich in der kahlen Winterlandschaft gut tarnt. Das Fell wechsle ich zweimal im Jahr, um mich den Jahreszeiten anzupassen.
Meine größte Sorge ist, immer wachsam zu bleiben. Es gibt viele Gefahren in meinem Lebensraum – vom Menschen, der mich jagt, bis hin zu natürlichen Feinden wie dem Wolf oder dem Luchs. Mein Instinkt sagt mir, immer auf der Hut zu sein, denn ich weiß, dass ich nur durch schnelle Reaktion überleben kann. Wenn ich Gefahr wittere, bin ich in der Lage, blitzschnell zu flüchten, dabei springe ich in hohen Bögen, was mich für Feinde schwerer greifbar macht.
Im Frühling und Sommer, wenn die Paarungszeit beginnt, ändert sich mein Verhalten. Dann werde ich mutiger und verlasse mein gewohnte Heim häufiger. Während der Brunft, die im Juli und August stattfindet, laufe ich weite Strecken, um ein Weibchen zu finden. Nach der Paarung trägt das Weibchen die Jungtiere bis zum nächsten Frühjahr aus. Die Rehkitze werden im Mai oder Juni geboren. Sie sind zuerst gut getarnt mit einem gefleckten Fell, das sie vor Feinden schützt, während sie im hohen Gras liegen und auf ihre Mutter warten, die sie regelmäßig säugt.
Als Mutter bin ich sehr beschützend. Ich verstecke meine Kitze gut, und sie wissen, dass sie sich ruhig verhalten müssen, wenn ich nicht in der Nähe bin. Nach einigen Wochen folgen sie mir und lernen, was sie fressen können und wie sie sich verhalten müssen, um sicher zu bleiben.
Leider ist mein Lebensraum oft bedroht. Straßen zerschneiden die Wälder, und der Verkehr wird für viele meiner Artgenossen zur tödlichen Falle. Auch intensive Landwirtschaft nimmt uns wichtige Rückzugsgebiete und Nahrungsquellen weg. Dennoch bin ich anpassungsfähig und finde oft Wege, mich auch in von Menschen geprägten Landschaften zurechtzufinden.
So lebe ich, wachsam und geschickt, in den Wäldern und Feldern. Ich hoffe, dass ich und meine Artgenossen weiterhin die Freiheit und den Schutz finden, die wir brauchen, um zu überleben. Das ist mein Leben – das Leben eines Rehs.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
Ich bin ein ziemlich kleines Tier, vor allem im Vergleich zu anderen Hirscharten. Meine schlanke, anmutige Gestalt hilft mir, mich schnell und leise durch das Dickicht zu bewegen. Meine rotbraune Fellfarbe im Sommer passt sich hervorragend dem dichten Grün des Waldes an, während ich im Winter ein graubraunes Fell trage, das mich in der kahlen Winterlandschaft gut tarnt. Das Fell wechsle ich zweimal im Jahr, um mich den Jahreszeiten anzupassen.
Meine größte Sorge ist, immer wachsam zu bleiben. Es gibt viele Gefahren in meinem Lebensraum – vom Menschen, der mich jagt, bis hin zu natürlichen Feinden wie dem Wolf oder dem Luchs. Mein Instinkt sagt mir, immer auf der Hut zu sein, denn ich weiß, dass ich nur durch schnelle Reaktion überleben kann. Wenn ich Gefahr wittere, bin ich in der Lage, blitzschnell zu flüchten, dabei springe ich in hohen Bögen, was mich für Feinde schwerer greifbar macht.
Im Frühling und Sommer, wenn die Paarungszeit beginnt, ändert sich mein Verhalten. Dann werde ich mutiger und verlasse mein gewohnte Heim häufiger. Während der Brunft, die im Juli und August stattfindet, laufe ich weite Strecken, um ein Weibchen zu finden. Nach der Paarung trägt das Weibchen die Jungtiere bis zum nächsten Frühjahr aus. Die Rehkitze werden im Mai oder Juni geboren. Sie sind zuerst gut getarnt mit einem gefleckten Fell, das sie vor Feinden schützt, während sie im hohen Gras liegen und auf ihre Mutter warten, die sie regelmäßig säugt.
Als Mutter bin ich sehr beschützend. Ich verstecke meine Kitze gut, und sie wissen, dass sie sich ruhig verhalten müssen, wenn ich nicht in der Nähe bin. Nach einigen Wochen folgen sie mir und lernen, was sie fressen können und wie sie sich verhalten müssen, um sicher zu bleiben.
Leider ist mein Lebensraum oft bedroht. Straßen zerschneiden die Wälder, und der Verkehr wird für viele meiner Artgenossen zur tödlichen Falle. Auch intensive Landwirtschaft nimmt uns wichtige Rückzugsgebiete und Nahrungsquellen weg. Dennoch bin ich anpassungsfähig und finde oft Wege, mich auch in von Menschen geprägten Landschaften zurechtzufinden.
So lebe ich, wachsam und geschickt, in den Wäldern und Feldern. Ich hoffe, dass ich und meine Artgenossen weiterhin die Freiheit und den Schutz finden, die wir brauchen, um zu überleben. Das ist mein Leben – das Leben eines Rehs.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
- Reh
Artenschutz in Franken®
Artenschutz in Franken® -- Extensive Wiesenbewirtschaftung

Artenschutz in Franken® -- Extensive Wiesenbewirtschaftung
20/21.08.2024
Eine extensiv bewirtschaftete Wiese, die nur einmal pro Jahr nach dem 1. August gemäht wird, spielt nach unsererer Auffassung eine entscheidende Rolle im ökologischen Gleichgewicht.
Diese Art der Bewirtschaftung hat nach unserer festen Überzeugung zahlreiche positive Effekte auf die Biodiversität, den Boden, das Mikroklima und die allgemeine Gesundheit des Ökosystems.
20/21.08.2024
- All unsere Fläche werden nach dieser intern von unserer Seite implementierten Vorgabe bewirtschaftet ...
Eine extensiv bewirtschaftete Wiese, die nur einmal pro Jahr nach dem 1. August gemäht wird, spielt nach unsererer Auffassung eine entscheidende Rolle im ökologischen Gleichgewicht.
Diese Art der Bewirtschaftung hat nach unserer festen Überzeugung zahlreiche positive Effekte auf die Biodiversität, den Boden, das Mikroklima und die allgemeine Gesundheit des Ökosystems.
1. Biodiversität
Eine solche Wiese fördert die Artenvielfalt erheblich. Durch das späte Mähen nach dem 1. August haben Pflanzen ausreichend Zeit, zu blühen und Samen zu bilden. Dies sichert nicht nur das Überleben der Pflanzenarten, sondern auch die Nahrung für eine Vielzahl von Insekten, wie Schmetterlinge, Bienen und Käfer. Diese Insekten sind wiederum wichtige Bestäuber und Nahrung für Vögel und andere Tiere.
2. Lebensraum für Tiere
Extensive Wiesen bieten Lebensraum für viele Tierarten. Bodenbrütende Vögel, wie der Feldlerche, finden hier Schutz für ihre Nester. Auch kleine Säugetiere wie Feldhasen und Igel nutzen die Wiesen als Rückzugsort. Der Verzicht auf häufiges Mähen minimiert zudem die Störung dieser Tiere.
3. Erhalt seltener Pflanzenarten
Durch die extensive Bewirtschaftung können sich seltene und empfindliche Pflanzenarten etablieren, die in intensiver genutzten Agrarlandschaften oft verdrängt werden. Dazu gehören beispielsweise Orchideen oder bestimmte Gräser, die auf nährstoffarme Böden angewiesen sind, die durch weniger Düngung und seltenes Mähen erhalten bleiben.
4. Bodengesundheit
Extensiv bewirtschaftete Wiesen tragen zur Erhaltung und Verbesserung der Bodengesundheit bei. Die Pflanzenwurzeln stabilisieren den Boden und fördern die Humusbildung, was wiederum die Wasserhaltekapazität und die Nährstoffverfügbarkeit im Boden verbessert. Durch den späten Schnitt bleibt zudem der Großteil der Biomasse auf der Wiese und dient als Mulch, der den Boden vor Erosion schützt und als Lebensraum für Mikroorganismen dient.
5. Kohlenstoffspeicherung
Solche Wiesen tragen auch zur Kohlenstoffspeicherung bei. Durch die dichte Vegetationsdecke und die Humusbildung wird Kohlenstoff im Boden gebunden, was zur Minderung des Klimawandels beiträgt.
6. Förderung des Mikroklimas
Die dichte und vielfältige Vegetation beeinflusst das Mikroklima positiv. Die Wiesen kühlen ihre Umgebung, indem sie Feuchtigkeit speichern und langsam an die Luft abgeben. Sie wirken somit als natürliche „Klimaanlagen“ in der Landschaft.
7. Wasserhaushalt
Extensiv bewirtschaftete Wiesen fördern die Versickerung von Regenwasser und reduzieren die Oberflächenabflüsse. Dies hilft, Hochwasserspitzen abzufedern und trägt zur Grundwasserneubildung bei.
Fazit
Die ökologische Bedeutung einer extensiv bewirtschafteten Wiese, die nur einmal im Jahr nach dem 1. August gemäht wird, liegt in ihrer Funktion als Hotspot der Biodiversität, als Lebensraum für viele spezialisierte Arten, in der Erhaltung seltener Pflanzenarten, in der Bodengesundheit, der Kohlenstoffspeicherung, der Förderung des Mikroklimas und im Beitrag zum natürlichen Wasserhaushalt. Diese Wiesen sind ein wichtiger Bestandteil nachhaltiger Landschaftsökosysteme und tragen maßgeblich zur Stabilität und Gesundheit unserer Umwelt bei.
In der Aufnahme
Artenschutz in Franken®
Eine solche Wiese fördert die Artenvielfalt erheblich. Durch das späte Mähen nach dem 1. August haben Pflanzen ausreichend Zeit, zu blühen und Samen zu bilden. Dies sichert nicht nur das Überleben der Pflanzenarten, sondern auch die Nahrung für eine Vielzahl von Insekten, wie Schmetterlinge, Bienen und Käfer. Diese Insekten sind wiederum wichtige Bestäuber und Nahrung für Vögel und andere Tiere.
2. Lebensraum für Tiere
Extensive Wiesen bieten Lebensraum für viele Tierarten. Bodenbrütende Vögel, wie der Feldlerche, finden hier Schutz für ihre Nester. Auch kleine Säugetiere wie Feldhasen und Igel nutzen die Wiesen als Rückzugsort. Der Verzicht auf häufiges Mähen minimiert zudem die Störung dieser Tiere.
3. Erhalt seltener Pflanzenarten
Durch die extensive Bewirtschaftung können sich seltene und empfindliche Pflanzenarten etablieren, die in intensiver genutzten Agrarlandschaften oft verdrängt werden. Dazu gehören beispielsweise Orchideen oder bestimmte Gräser, die auf nährstoffarme Böden angewiesen sind, die durch weniger Düngung und seltenes Mähen erhalten bleiben.
4. Bodengesundheit
Extensiv bewirtschaftete Wiesen tragen zur Erhaltung und Verbesserung der Bodengesundheit bei. Die Pflanzenwurzeln stabilisieren den Boden und fördern die Humusbildung, was wiederum die Wasserhaltekapazität und die Nährstoffverfügbarkeit im Boden verbessert. Durch den späten Schnitt bleibt zudem der Großteil der Biomasse auf der Wiese und dient als Mulch, der den Boden vor Erosion schützt und als Lebensraum für Mikroorganismen dient.
5. Kohlenstoffspeicherung
Solche Wiesen tragen auch zur Kohlenstoffspeicherung bei. Durch die dichte Vegetationsdecke und die Humusbildung wird Kohlenstoff im Boden gebunden, was zur Minderung des Klimawandels beiträgt.
6. Förderung des Mikroklimas
Die dichte und vielfältige Vegetation beeinflusst das Mikroklima positiv. Die Wiesen kühlen ihre Umgebung, indem sie Feuchtigkeit speichern und langsam an die Luft abgeben. Sie wirken somit als natürliche „Klimaanlagen“ in der Landschaft.
7. Wasserhaushalt
Extensiv bewirtschaftete Wiesen fördern die Versickerung von Regenwasser und reduzieren die Oberflächenabflüsse. Dies hilft, Hochwasserspitzen abzufedern und trägt zur Grundwasserneubildung bei.
Fazit
Die ökologische Bedeutung einer extensiv bewirtschafteten Wiese, die nur einmal im Jahr nach dem 1. August gemäht wird, liegt in ihrer Funktion als Hotspot der Biodiversität, als Lebensraum für viele spezialisierte Arten, in der Erhaltung seltener Pflanzenarten, in der Bodengesundheit, der Kohlenstoffspeicherung, der Förderung des Mikroklimas und im Beitrag zum natürlichen Wasserhaushalt. Diese Wiesen sind ein wichtiger Bestandteil nachhaltiger Landschaftsökosysteme und tragen maßgeblich zur Stabilität und Gesundheit unserer Umwelt bei.
In der Aufnahme
- Am Beispiel einer unserer Fläche wird das Prinzip deutlich ... wir lassen unsere Wiesen immer nach dem 01.August einmalig pro Jahr mähen ... hier eine Aufnahme vom 10.08.2024
Artenschutz in Franken®
Artenschutz in Franken®
Der Triel (Burhinus oedicnemus)

Hallo! Ich bin ein Triel, wissenschaftlich als Burhinus oedicnemus bekannt.
19/20.08.2024
Ich bin ein eher ungewöhnlicher Vogel, der in offenen Landschaften lebt, besonders in trockenen, steinigen oder sandigen Gebieten, oft mit spärlicher Vegetation. Man findet mich in verschiedenen Teilen Europas, Asiens und Nordafrikas, wo ich mich am wohlsten fühle, wenn der Boden hart und trocken ist. Ich bevorzuge diese Umgebung, weil sie mir hilft, mich zu tarnen und meine Nahrung leicht zu finden.
19/20.08.2024
- Lass mich dir erzählen, wie ich die Welt aus meiner Perspektive sehe.
Ich bin ein eher ungewöhnlicher Vogel, der in offenen Landschaften lebt, besonders in trockenen, steinigen oder sandigen Gebieten, oft mit spärlicher Vegetation. Man findet mich in verschiedenen Teilen Europas, Asiens und Nordafrikas, wo ich mich am wohlsten fühle, wenn der Boden hart und trocken ist. Ich bevorzuge diese Umgebung, weil sie mir hilft, mich zu tarnen und meine Nahrung leicht zu finden.
Mit meinen großen, gelben Augen sehe ich auch bei schwachem Licht sehr gut. Das ist wichtig für mich, da ich ein dämmerungs- und nachtaktiver Vogel bin. Am Tag halte ich mich ruhig und unauffällig, oft still auf dem Boden sitzend, wo ich mich perfekt in die Umgebung einfüge. Meine graubraune Gefiederfärbung mit dunklen Streifen und Flecken ist ideal, um mich zu tarnen, sodass ich für Feinde fast unsichtbar bin, wenn ich mich nicht bewege.
Ich ernähre mich hauptsächlich von Insekten und anderen kleinen Wirbellosen, die ich geschickt im Boden aufspüre. Aber ich scheue mich auch nicht davor, kleinere Wirbeltiere wie Eidechsen oder Nagetiere zu fressen, wenn ich die Gelegenheit dazu habe. Mein kräftiger Schnabel hilft mir dabei, diese Beute zu fangen und zu zerkleinern.
Meine Flügel sind lang und haben markante weiße Bänder, die man besonders gut sieht, wenn ich fliege. Obwohl ich lieber am Boden bleibe, bin ich ein starker Flieger und kann lange Strecken zurücklegen, wenn es nötig ist. Besonders im Winter ziehe ich manchmal in wärmere Regionen, um der Kälte zu entkommen und ausreichend Nahrung zu finden.
Ich lege großen Wert auf mein Territorium. In der Brutzeit, die im Frühjahr beginnt, lege ich meine Eier direkt auf den Boden, oft in eine flache Mulde, die kaum als Nest erkennbar ist. Diese Strategie hat sich bewährt, da meine Eier so gut getarnt sind, dass sie fast unsichtbar für Raubtiere bleiben. Ich lege normalerweise zwei Eier, und sowohl mein Partner als auch ich kümmern uns um das Brüten und die Aufzucht der Küken.
Meine Küken sind Nestflüchter, das heißt, sie verlassen das Nest schon kurz nach dem Schlüpfen und folgen uns, während sie das Jagen und Überleben lernen. Ich bin sehr wachsam und beschütze meine Familie mit aller Kraft. Sollte Gefahr drohen, werde ich durch Rufe und Ablenkungsmanöver versuchen, Eindringlinge von meinem Nest wegzulocken.
Trotz meiner Anpassungsfähigkeit stehe ich vor einigen Herausforderungen. Landwirtschaftliche Veränderungen, die Zerstörung meiner Lebensräume und der Klimawandel machen es mir zunehmend schwerer, geeignete Brutplätze zu finden. Zum Glück gibt es Naturschutzprojekte, die sich um den Erhalt meiner Lebensräume bemühen.
Ich hoffe, dass ich noch lange in meinen bevorzugten Lebensräumen überleben kann, um weiterhin meine besonderen Fähigkeiten und meine einzigartige Lebensweise zu leben. Das ist meine Welt – die Welt des Triels.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
Ich ernähre mich hauptsächlich von Insekten und anderen kleinen Wirbellosen, die ich geschickt im Boden aufspüre. Aber ich scheue mich auch nicht davor, kleinere Wirbeltiere wie Eidechsen oder Nagetiere zu fressen, wenn ich die Gelegenheit dazu habe. Mein kräftiger Schnabel hilft mir dabei, diese Beute zu fangen und zu zerkleinern.
Meine Flügel sind lang und haben markante weiße Bänder, die man besonders gut sieht, wenn ich fliege. Obwohl ich lieber am Boden bleibe, bin ich ein starker Flieger und kann lange Strecken zurücklegen, wenn es nötig ist. Besonders im Winter ziehe ich manchmal in wärmere Regionen, um der Kälte zu entkommen und ausreichend Nahrung zu finden.
Ich lege großen Wert auf mein Territorium. In der Brutzeit, die im Frühjahr beginnt, lege ich meine Eier direkt auf den Boden, oft in eine flache Mulde, die kaum als Nest erkennbar ist. Diese Strategie hat sich bewährt, da meine Eier so gut getarnt sind, dass sie fast unsichtbar für Raubtiere bleiben. Ich lege normalerweise zwei Eier, und sowohl mein Partner als auch ich kümmern uns um das Brüten und die Aufzucht der Küken.
Meine Küken sind Nestflüchter, das heißt, sie verlassen das Nest schon kurz nach dem Schlüpfen und folgen uns, während sie das Jagen und Überleben lernen. Ich bin sehr wachsam und beschütze meine Familie mit aller Kraft. Sollte Gefahr drohen, werde ich durch Rufe und Ablenkungsmanöver versuchen, Eindringlinge von meinem Nest wegzulocken.
Trotz meiner Anpassungsfähigkeit stehe ich vor einigen Herausforderungen. Landwirtschaftliche Veränderungen, die Zerstörung meiner Lebensräume und der Klimawandel machen es mir zunehmend schwerer, geeignete Brutplätze zu finden. Zum Glück gibt es Naturschutzprojekte, die sich um den Erhalt meiner Lebensräume bemühen.
Ich hoffe, dass ich noch lange in meinen bevorzugten Lebensräumen überleben kann, um weiterhin meine besonderen Fähigkeiten und meine einzigartige Lebensweise zu leben. Das ist meine Welt – die Welt des Triels.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
- Triel (Burhinus oedicnemus)
Artenschutz in Franken®
Mäuse - Projekt 2024 - 2025

Mäuse - Projekt 2024 - 2025
19/20.08.2024
Regelmäßig erreichen uns Anfragen ob es möglich ist Mäuse auch mittels Mechanismen zu treiben ohne dass diese getötet werden. Immer wieder tauchen hierbei auch Fragen zum Bornavirus oder dem Hantavirus auf, da Mäuse und deren Hinterlassenschaften als Überträger identifiziert wurden.
Diesem Thema haben wir uns angenommen und starten ab dem 01. Juni 2024 eine einjährige Untersuchungsreihe an Standorten an welchen wir mit Sicherheit auf Kleinsäuger (Haus-Rötel-Gelbhals-Feldspitz- und Hausspitzmaus) treffen, diese Bereiche wurden in den vergangenen 6 Monaten intensiv von uns bewertet und sowohl die Lauf-Ruhe- und Fraßplätze der Tiere entsprechend nachdrücklich kartiert.
Ferner haben wir hier Räume mit unterschiedlichen Hauptmaterialien wie Holz-Metall- Kunststoff/Stein in den Fokus genommen, um erkennen zu können, ob und wie etwaige Unterschiede der Effektivität sichtbar werden.
19/20.08.2024
- AiF - Pilotprojekt Nagervergrämung ... die Julizahlen sind da ...
Regelmäßig erreichen uns Anfragen ob es möglich ist Mäuse auch mittels Mechanismen zu treiben ohne dass diese getötet werden. Immer wieder tauchen hierbei auch Fragen zum Bornavirus oder dem Hantavirus auf, da Mäuse und deren Hinterlassenschaften als Überträger identifiziert wurden.
Diesem Thema haben wir uns angenommen und starten ab dem 01. Juni 2024 eine einjährige Untersuchungsreihe an Standorten an welchen wir mit Sicherheit auf Kleinsäuger (Haus-Rötel-Gelbhals-Feldspitz- und Hausspitzmaus) treffen, diese Bereiche wurden in den vergangenen 6 Monaten intensiv von uns bewertet und sowohl die Lauf-Ruhe- und Fraßplätze der Tiere entsprechend nachdrücklich kartiert.
Ferner haben wir hier Räume mit unterschiedlichen Hauptmaterialien wie Holz-Metall- Kunststoff/Stein in den Fokus genommen, um erkennen zu können, ob und wie etwaige Unterschiede der Effektivität sichtbar werden.
Der Einsatz der Ultraschallgeräte findet in einer natürlichen Umgebung, mit etwas über den Vorgaben der ausgewählten Hersteller angegebenen Geräteanzahl pro Raum und Raumgröße statt. Es wurde darauf geachtet, dass es keine Bereiche mit Ultraschallschatten gibt.
Erst nach Abschluss dieser Untersuchungsreihe können wir von unserer Seite eine belastbare Information über die Wirkungsweise dieser Geräte sichtbar werden lassen.Doch stellen wir bis dahin selbstverständlich regelmäßig Ergebnisse zur Projektentwicklung vor, um unsere Eindrücke temporär zu kommunizieren.
Wir starten am: 31.05.2024 mit der Aktivierungsphase der ausgewählten Geräte und konnten hier bewusst auf batteriebetriebene Geräte zurückgreifen.
Objekte:
3 gleichgroße 30 Quadratmeter umfassende Räume
Bestehen vornehmlich aus:
1., Holz (Verschalung)
2., Metall (Edelstahlverblendung)
3., Stein (Mauerwerk)
Ausstattung:
Jeweils mit 3 Geräten ausgestattet
Wir setzen in den Objekten zusätzlich Maus- Lebendfallen ein und kontrollieren diese mindestens 3mal am Tag auf Besatz um hier eine in unseren Augen sicheren Aussage zur Wirksamkeit treffen zu können. Wir sind gespannt …
Hier noch einige Informationen zum Einsatz von einigen Mausefallentypen und deren mögliche Vor- und Nachteile:
Mäusefallen als Totschlagfallen
Beschreibung:
Totschlagfallen sind sogenannte mechanische Vorrichtungen, die darauf abzielen, Mäuse durch einen schnellen, kräftigen Schlag sofort und unmittelbar zu töten. Es gibt verschiedene Arten von Totschlagfallen, darunter traditionelle Schnappfallen, jedoch auch moderne elektronische Fallen etc.
Mögliche AiF - Vorteile
1. Effektivität: Totschlagfallen sind (meist) sehr effektiv und töten Mäuse in der Regel (jedoch nicht immer wie wir auch selbst erkannten) sofort.
2. Schnell: Mäuse werden (häufig – jedoch sicherlich nicht immer) schnell getötet, was das Leiden minimiert.
3. Kosten: Diese Fallen sind oft relativ preiswert und leicht verfügbar.
4. Wiederverwendbar: Viele Totschlagfallen können mehrfach verwendet werden, jedoch gilt es hier nach unserer Auffassung dringlich auch hygienische Aspekte zu beachten!
5. Kein Gift: Es werden keine Chemikalien oder Gifte verwendet, was sie aus dieser Perspektive gesehen sicherer für den Haushalt macht.
Mögliche AiF - Nachteile
1. Grausamkeit: Die Tötung der Maus kann als grausam empfunden werden, und manchmal sind die Mäuse auch nicht sofort tot, was zu (vermeidbarem) Leiden führt.
2. Sicherheitsrisiken: Für Menschen und Haustiere besteht ein potentielles Verletzungsrisiko, wenn sie versehentlich in die Falle geraten.
3. Entsorgung: Tote Mäuse müssen manuell und fachgerecht entsorgt werden, was für einige Menschen unangenehm sein kann.
4. Nicht selektiv: Diese Fallen unterscheiden nicht zwischen Mäusen und anderen kleinen Tieren.
Maus-Lebendfallen
Beschreibung:
Maus-Lebendfallen sind in der Regel Vorrichtungen, die darauf abzielen, Mäuse lebend zu fangen, ohne sie zu töten oder zu verletzen. Diese Fallen werden nach unserer Auffassung sehr oft aus ethischen Gründen oder auch für wissenschaftliche Zwecke verwendet, um die lebenden Tiere später wieder in die Freiheit zu entlassen. Lebendfallen funktionieren durch verschiedene Mechanismen, welche die Maus in einen geschlossenen Raum locken, aus dem sie nicht (im Idealfall) entkommen kann.
Mögliche AiF - Vorteile
1. Humanität: Mäuse werden lebend gefangen und können bei entsprechender Handhabe in der Regel unversehrt freigelassen werden.
2. Sicherheit: Reduzierte Gefahr für Menschen und Haustiere, da keine tödlichen Mechanismen oder Gifte verwendet werden. Viren könnten jedoch ggf. übertragen werden, deshalb immer Vorsicht.
3. Wiederverwendbar: Die meisten Lebendfallen sind tatsächlich robust und können daher auch mehrfach verwendet werden.
4. Umweltfreundlich: Keine chemischen Rückstände oder toten Tiere, die entsorgt werden müssen, dennoch setzen die Tiere nach unseren langjährigen Erfahrungen immer wieder Kot und Urin ab, deshalb sind hygienische Aspekte relevant!
Mögliche AiF - Nachteile
1. Aufwand: Gefangene Mäuse, oder besser die Fallen müssen immer und mehrfach am Tag regelmäßig kontrolliert und an tatsächlich geeigneten Orten freigelassen werden.
2. Stress für die Maus: Obwohl die Falle die Maus in der Regel nicht verletzt, kann das Fangen und Eingesperrt sein sehr stressig für das Tier sein.
3. Wiederbefall: Wenn die gefangenen Mäuse nicht weit genug vom Fundort entfernt freigelassen werden, können und werden sie meist auch (eigene Erfahrungen) zurückkehren.
4. Begrenzte Effektivität: In stark befallenen Gebieten kann die Fangrate zu gering sein, um das Problem effektiv und nachhaltig zu lösen.
"Mäusefallen / Abwehr" als Ultraschallgeräte
Beschreibung:
Ultraschallgeräte zur Mäuseabwehr senden hochfrequente Schallwellen aus, die für Menschen (meist) nicht hörbar sind, aber für Mäuse und andere Nagetiere nach uns vorliegenden Informationen äußerst unangenehm sein sollen. Diese Geräte sollen die Mäuse vertreiben, ohne sie zu töten.
Mögliche AiF - Vorteile
1. Humanität: Mäuse werden somit durch diesen Einsatz nicht getötet, sondern nur vertrieben.
2. Sicherheit: (Mutmaßlich) Keine Gefahr für Menschen und Haustiere, da keine mechanischen Teile oder Gifte verwendet werden. – dieses werden wir gleichfalls in der Handhabung bewerten.
3. Einfachheit: Sehr einfach in der Anwendung – das Gerät muss lediglich eingesteckt werden – dieses werden wir gleichfalls in der Handhabung bewerten.
4. Wartungsarm: Keine Notwendigkeit, Fallen neu zu stellen oder tote Tiere zu entsorgen. – dieses werden wir gleichfalls in der Handhabung bewerten.
Mögliche AiF – Nachteile
1. Wirksamkeit: Die Wirksamkeit dieser Geräte wird häufig infrage gestellt. Nicht alle Mäuse reagieren wohl auf Ultraschall, und einige können sich wohl daran gewöhnen.
2. Reichweite: Die Effektivität kann wohl durch Hindernisse wie Möbel und Wände beeinträchtigt werden, wodurch wohl mehrere Geräte in verschiedenen Räumen notwendig werden.
3. Störgeräusche: Einige Menschen und Haustiere können wohl die hochfrequenten Geräusche hören, was wohl zu Unbehagen führen kann.
4. Energieverbrauch: Diese Geräte müssen wohl ständig an eine Stromquelle angeschlossen sein, was einen kontinuierlichen Energieverbrauch bedeutet.
Ein erstes AiF - Fazit
Die Wahl zwischen Totschlag- Lebendfallen und Ultraschallgeräten hängt wohl stark von den individuellen Bedürfnissen und ethischen Überzeugungen ab. Totschlagfallen sind wohl meist effektiv und günstig, können jedoch wohl als grausam angesehen werden. Lebendfallen setzen eine hohe und zuverlässige Kontrolleinheit voraus. Ultraschallgeräte bieten wohl eine humane Alternative, deren Effektivität wohl jedoch variieren kann. Es kann wohl ggf. sinnvoll sein, verschiedene Methoden zu kombinieren, um das wohl beste Ergebnis zu erzielen.
Wir werden sehen und berichten sehr objektiv ...
In der Aufnahme von Johannes Rother
Erst nach Abschluss dieser Untersuchungsreihe können wir von unserer Seite eine belastbare Information über die Wirkungsweise dieser Geräte sichtbar werden lassen.Doch stellen wir bis dahin selbstverständlich regelmäßig Ergebnisse zur Projektentwicklung vor, um unsere Eindrücke temporär zu kommunizieren.
Wir starten am: 31.05.2024 mit der Aktivierungsphase der ausgewählten Geräte und konnten hier bewusst auf batteriebetriebene Geräte zurückgreifen.
Objekte:
3 gleichgroße 30 Quadratmeter umfassende Räume
Bestehen vornehmlich aus:
1., Holz (Verschalung)
2., Metall (Edelstahlverblendung)
3., Stein (Mauerwerk)
Ausstattung:
Jeweils mit 3 Geräten ausgestattet
Wir setzen in den Objekten zusätzlich Maus- Lebendfallen ein und kontrollieren diese mindestens 3mal am Tag auf Besatz um hier eine in unseren Augen sicheren Aussage zur Wirksamkeit treffen zu können. Wir sind gespannt …
Hier noch einige Informationen zum Einsatz von einigen Mausefallentypen und deren mögliche Vor- und Nachteile:
Mäusefallen als Totschlagfallen
Beschreibung:
Totschlagfallen sind sogenannte mechanische Vorrichtungen, die darauf abzielen, Mäuse durch einen schnellen, kräftigen Schlag sofort und unmittelbar zu töten. Es gibt verschiedene Arten von Totschlagfallen, darunter traditionelle Schnappfallen, jedoch auch moderne elektronische Fallen etc.
Mögliche AiF - Vorteile
1. Effektivität: Totschlagfallen sind (meist) sehr effektiv und töten Mäuse in der Regel (jedoch nicht immer wie wir auch selbst erkannten) sofort.
2. Schnell: Mäuse werden (häufig – jedoch sicherlich nicht immer) schnell getötet, was das Leiden minimiert.
3. Kosten: Diese Fallen sind oft relativ preiswert und leicht verfügbar.
4. Wiederverwendbar: Viele Totschlagfallen können mehrfach verwendet werden, jedoch gilt es hier nach unserer Auffassung dringlich auch hygienische Aspekte zu beachten!
5. Kein Gift: Es werden keine Chemikalien oder Gifte verwendet, was sie aus dieser Perspektive gesehen sicherer für den Haushalt macht.
Mögliche AiF - Nachteile
1. Grausamkeit: Die Tötung der Maus kann als grausam empfunden werden, und manchmal sind die Mäuse auch nicht sofort tot, was zu (vermeidbarem) Leiden führt.
2. Sicherheitsrisiken: Für Menschen und Haustiere besteht ein potentielles Verletzungsrisiko, wenn sie versehentlich in die Falle geraten.
3. Entsorgung: Tote Mäuse müssen manuell und fachgerecht entsorgt werden, was für einige Menschen unangenehm sein kann.
4. Nicht selektiv: Diese Fallen unterscheiden nicht zwischen Mäusen und anderen kleinen Tieren.
Maus-Lebendfallen
Beschreibung:
Maus-Lebendfallen sind in der Regel Vorrichtungen, die darauf abzielen, Mäuse lebend zu fangen, ohne sie zu töten oder zu verletzen. Diese Fallen werden nach unserer Auffassung sehr oft aus ethischen Gründen oder auch für wissenschaftliche Zwecke verwendet, um die lebenden Tiere später wieder in die Freiheit zu entlassen. Lebendfallen funktionieren durch verschiedene Mechanismen, welche die Maus in einen geschlossenen Raum locken, aus dem sie nicht (im Idealfall) entkommen kann.
Mögliche AiF - Vorteile
1. Humanität: Mäuse werden lebend gefangen und können bei entsprechender Handhabe in der Regel unversehrt freigelassen werden.
2. Sicherheit: Reduzierte Gefahr für Menschen und Haustiere, da keine tödlichen Mechanismen oder Gifte verwendet werden. Viren könnten jedoch ggf. übertragen werden, deshalb immer Vorsicht.
3. Wiederverwendbar: Die meisten Lebendfallen sind tatsächlich robust und können daher auch mehrfach verwendet werden.
4. Umweltfreundlich: Keine chemischen Rückstände oder toten Tiere, die entsorgt werden müssen, dennoch setzen die Tiere nach unseren langjährigen Erfahrungen immer wieder Kot und Urin ab, deshalb sind hygienische Aspekte relevant!
Mögliche AiF - Nachteile
1. Aufwand: Gefangene Mäuse, oder besser die Fallen müssen immer und mehrfach am Tag regelmäßig kontrolliert und an tatsächlich geeigneten Orten freigelassen werden.
2. Stress für die Maus: Obwohl die Falle die Maus in der Regel nicht verletzt, kann das Fangen und Eingesperrt sein sehr stressig für das Tier sein.
3. Wiederbefall: Wenn die gefangenen Mäuse nicht weit genug vom Fundort entfernt freigelassen werden, können und werden sie meist auch (eigene Erfahrungen) zurückkehren.
4. Begrenzte Effektivität: In stark befallenen Gebieten kann die Fangrate zu gering sein, um das Problem effektiv und nachhaltig zu lösen.
"Mäusefallen / Abwehr" als Ultraschallgeräte
Beschreibung:
Ultraschallgeräte zur Mäuseabwehr senden hochfrequente Schallwellen aus, die für Menschen (meist) nicht hörbar sind, aber für Mäuse und andere Nagetiere nach uns vorliegenden Informationen äußerst unangenehm sein sollen. Diese Geräte sollen die Mäuse vertreiben, ohne sie zu töten.
Mögliche AiF - Vorteile
1. Humanität: Mäuse werden somit durch diesen Einsatz nicht getötet, sondern nur vertrieben.
2. Sicherheit: (Mutmaßlich) Keine Gefahr für Menschen und Haustiere, da keine mechanischen Teile oder Gifte verwendet werden. – dieses werden wir gleichfalls in der Handhabung bewerten.
3. Einfachheit: Sehr einfach in der Anwendung – das Gerät muss lediglich eingesteckt werden – dieses werden wir gleichfalls in der Handhabung bewerten.
4. Wartungsarm: Keine Notwendigkeit, Fallen neu zu stellen oder tote Tiere zu entsorgen. – dieses werden wir gleichfalls in der Handhabung bewerten.
Mögliche AiF – Nachteile
1. Wirksamkeit: Die Wirksamkeit dieser Geräte wird häufig infrage gestellt. Nicht alle Mäuse reagieren wohl auf Ultraschall, und einige können sich wohl daran gewöhnen.
2. Reichweite: Die Effektivität kann wohl durch Hindernisse wie Möbel und Wände beeinträchtigt werden, wodurch wohl mehrere Geräte in verschiedenen Räumen notwendig werden.
3. Störgeräusche: Einige Menschen und Haustiere können wohl die hochfrequenten Geräusche hören, was wohl zu Unbehagen führen kann.
4. Energieverbrauch: Diese Geräte müssen wohl ständig an eine Stromquelle angeschlossen sein, was einen kontinuierlichen Energieverbrauch bedeutet.
Ein erstes AiF - Fazit
Die Wahl zwischen Totschlag- Lebendfallen und Ultraschallgeräten hängt wohl stark von den individuellen Bedürfnissen und ethischen Überzeugungen ab. Totschlagfallen sind wohl meist effektiv und günstig, können jedoch wohl als grausam angesehen werden. Lebendfallen setzen eine hohe und zuverlässige Kontrolleinheit voraus. Ultraschallgeräte bieten wohl eine humane Alternative, deren Effektivität wohl jedoch variieren kann. Es kann wohl ggf. sinnvoll sein, verschiedene Methoden zu kombinieren, um das wohl beste Ergebnis zu erzielen.
Wir werden sehen und berichten sehr objektiv ...
In der Aufnahme von Johannes Rother
- Erdmaus
Artenschutz in Franken®
Die Blaumerle (Monticola solitarius)

Blaumerle (Monticola solitarius)
18/19.08.2024
Als Blaumerle möchte ich dir meine Perspektive auf meine Art und einige fachliche Komponenten näherbringen:
18/19.08.2024
- Die Blaumerle, wissenschaftlich bekannt als Monticola solitarius, ist eine kleine Singvogelart aus der Familie der Fliegenschnäpper (Muscicapidae).
Als Blaumerle möchte ich dir meine Perspektive auf meine Art und einige fachliche Komponenten näherbringen:
Beschreibung und Aussehen:
- Als Blaumerle bin ich ein kleiner Vogel, etwa 14-16 Zentimeter lang. Männliche Blaumerlen haben ein auffälliges, kontrastreiches Gefieder: Der Kopf und der obere Teil des Rückens sind kräftig blau gefärbt, während der Bauch und die Flanken eher weißlich sind. Die Weibchen sind dagegen weniger auffällig gefärbt und haben ein bräunliches Gefieder mit dunkleren Streifen.
Lebensraum und Verbreitung:
- Wir Blaumerlen bevorzugen felsige Gebiete, insbesondere in bergigen oder hügeligen Regionen. Man findet uns vor allem in Südeuropa, Nordafrika und Teilen Asiens. Dort bewohnen wir Felsschluchten, Gebirgstäler und Weinberge, wo wir Nistplätze und Nahrung finden.
Verhalten und Ernährung:
- Wir sind agile Vögel, die gerne auf Felsen und Mauern klettern, um nach Insekten zu suchen. Unsere Nahrung besteht hauptsächlich aus kleinen Wirbellosen wie Käfern, Fliegen und Spinnen, die wir geschickt aus der Luft oder direkt von Steinen picken.
Fortpflanzung und Brutpflege:
- In der Brutzeit bauen wir Nester aus Gräsern und Zweigen in Felsspalten oder Mauerlöchern. Die Weibchen legen typischerweise 3-5 Eier, die sie alleine überwachen und ausbrüten. Nach dem Schlüpfen der Jungen füttern sowohl Männchen als auch Weibchen die Nestlinge mit Insekten.
Gesang und Kommunikation:
- Männliche Blaumerlen sind für ihren melodischen Gesang bekannt, der oft von hohen Felsen oder Mauern aus erklingt. Unser Gesang dient dazu, Reviergrenzen zu markieren und um Weibchen anzulocken. Die Melodie ist vielfältig und kann aus schnellen Trillern und klaren Pfeiftönen bestehen.
Schutzstatus und Bedrohungen:
- Obwohl wir nicht zu den stark gefährdeten Arten gehören, sind wir empfindlich gegenüber Veränderungen in unserem Lebensraum. Verluste an natürlichen Lebensräumen durch menschliche Aktivitäten wie Landwirtschaft, Urbanisierung und Tourismus können unsere Populationen beeinträchtigen.
Die Blaumerle ist also nicht nur ein schöner Vogel mit markanter Färbung, sondern auch ein faszinierendes Beispiel für die Anpassung von Vögeln an felsige Lebensräume und deren Herausforderungen.
In der Aufnahme von Helga Zinnecker
- Blaumerle (Monticola solitarius)
Artenschutz in Franken®
Stele der Biodiversität® - Stegaurach / Dellern

Stele der Biodiversität® - Stegaurach / Dellern
18/19.08.2024
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.
Stegaurach / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
18/19.08.2024
- Die grafische Gestaltung ... Stimmungen an der Stele der Biodiversität®
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.
Stegaurach / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
Denn wenn (selbst in noch geeigneten Nahrungsstrukturen) keine geeigneten Reproduktionsräume vorhanden sind, ist die Erhaltung der Artenvielfalt gelichfalls zum Scheitern verurteilt.
Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird., setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.
In der Aufnahme
Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird., setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.
In der Aufnahme
- Abendliche Eindrücke vom 09.08.2024 ...
Artenschutz in Franken®
Die Perleidechse (Timon lepidus)

Hallo! Ich bin eine Perleidechse, auch bekannt als Timon lepidus.
17/18.08.2024
Ich lebe in sonnigen, trockenen Gegenden, vor allem in Südwest-Europa. Meine Heimat erstreckt sich über Spanien, Portugal und den Süden Frankreichs. Ich bevorzuge warme und felsige Lebensräume, wo ich mich gut verstecken kann, aber auch offene Bereiche, wo ich mich sonnen kann, sind mir wichtig. Meine Umgebung ist mein Schutz, und ich habe im Laufe der Zeit gelernt, mich perfekt an meine Umgebung anzupassen.
17/18.08.2024
- Ich erzähle dir gerne ein wenig über mich aus meiner eigenen Sicht.
Ich lebe in sonnigen, trockenen Gegenden, vor allem in Südwest-Europa. Meine Heimat erstreckt sich über Spanien, Portugal und den Süden Frankreichs. Ich bevorzuge warme und felsige Lebensräume, wo ich mich gut verstecken kann, aber auch offene Bereiche, wo ich mich sonnen kann, sind mir wichtig. Meine Umgebung ist mein Schutz, und ich habe im Laufe der Zeit gelernt, mich perfekt an meine Umgebung anzupassen.
Meine Haut ist nicht nur irgendeine Haut; sie ist mit wunderschönen, leuchtend grünen Schuppen bedeckt, die mit schwarzen Flecken verziert sind. Diese Muster geben mir meinen Namen: Perleidechse. Ich bin ziemlich groß für eine Eidechse und kann eine Länge von bis zu 90 cm erreichen, wobei mein Schwanz fast zwei Drittel meiner Gesamtlänge ausmacht. Mein Schwanz ist für mich extrem wichtig; nicht nur zur Balance, sondern auch als Waffe, um mich zu verteidigen oder Angreifer zu vertreiben.
Tagsüber liebe ich es, mich in der Sonne zu wärmen. Als wechselwarmes Tier brauche ich die Sonne, um meine Körpertemperatur zu regulieren. In der Morgensonne hole ich mir die Energie, die ich brauche, um auf Nahrungssuche zu gehen. Ich bin ein Allesfresser, und meine Mahlzeiten bestehen aus Insekten, kleinen Wirbeltieren, Früchten und Pflanzen. Gelegentlich gehe ich sogar auf die Jagd nach kleineren Eidechsen oder Mäusen.
Meine Augen sind scharf, und ich kann Bewegungen gut wahrnehmen. Das ist wichtig für mich, um sowohl Beute zu entdecken als auch Feinde rechtzeitig zu erkennen. Wenn Gefahr droht, bin ich flink und kann schnell wegrennen oder mich in einem Versteck zurückziehen. Meine scharfen Zähne helfen mir, meine Nahrung zu zerkleinern, aber sie sind auch nützlich, wenn ich mich verteidigen muss.
Zur Fortpflanzung suche ich mir im Frühling ein Weibchen. Nach der Paarung legt das Weibchen ihre Eier in einen selbst gegrabenen, gut versteckten Bau. Diese Eier sind meine Zukunft, und nach einigen Monaten schlüpfen kleine Perleidechsen, die sofort unabhängig sind.
Ich bin stolz auf meine Fähigkeit, zu überleben, und ich schätze meine Freiheit sehr. Leider sind meine Lebensräume durch menschliche Eingriffe bedroht, und manchmal werde ich auch von Menschen gejagt oder illegal als Haustier gefangen. Trotzdem bleibe ich stark und hoffe, dass meine Art weiterhin in diesen schönen, sonnigen Gegenden existieren kann.
So, das ist meine Geschichte. Ich hoffe, du verstehst jetzt besser, wie ich lebe und was mich als Perleidechse so besonders macht.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
Tagsüber liebe ich es, mich in der Sonne zu wärmen. Als wechselwarmes Tier brauche ich die Sonne, um meine Körpertemperatur zu regulieren. In der Morgensonne hole ich mir die Energie, die ich brauche, um auf Nahrungssuche zu gehen. Ich bin ein Allesfresser, und meine Mahlzeiten bestehen aus Insekten, kleinen Wirbeltieren, Früchten und Pflanzen. Gelegentlich gehe ich sogar auf die Jagd nach kleineren Eidechsen oder Mäusen.
Meine Augen sind scharf, und ich kann Bewegungen gut wahrnehmen. Das ist wichtig für mich, um sowohl Beute zu entdecken als auch Feinde rechtzeitig zu erkennen. Wenn Gefahr droht, bin ich flink und kann schnell wegrennen oder mich in einem Versteck zurückziehen. Meine scharfen Zähne helfen mir, meine Nahrung zu zerkleinern, aber sie sind auch nützlich, wenn ich mich verteidigen muss.
Zur Fortpflanzung suche ich mir im Frühling ein Weibchen. Nach der Paarung legt das Weibchen ihre Eier in einen selbst gegrabenen, gut versteckten Bau. Diese Eier sind meine Zukunft, und nach einigen Monaten schlüpfen kleine Perleidechsen, die sofort unabhängig sind.
Ich bin stolz auf meine Fähigkeit, zu überleben, und ich schätze meine Freiheit sehr. Leider sind meine Lebensräume durch menschliche Eingriffe bedroht, und manchmal werde ich auch von Menschen gejagt oder illegal als Haustier gefangen. Trotzdem bleibe ich stark und hoffe, dass meine Art weiterhin in diesen schönen, sonnigen Gegenden existieren kann.
So, das ist meine Geschichte. Ich hoffe, du verstehst jetzt besser, wie ich lebe und was mich als Perleidechse so besonders macht.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
- Perleidechse (Timon lepidus)
Artenschutz in Franken®
Wer rettet die Bienen?

Wer rettet die Bienen?
17/18.08.2024
Mit welchen Hoffnungen und welcher Euphorie war vor wenigen Jahren ein Volksbegehren gestartet und zugegeben auch wir vom Artenschutz in Franken® hatten darauf gesetzt, das hier auf breiter Basis endlich die Erkenntnis reift, das wir alle Anstrengungen benötigen um den zunehmenden Verlust der Biodiversität in unserem Bundesland konsequent einzudämmen.
17/18.08.2024
Mit welchen Hoffnungen und welcher Euphorie war vor wenigen Jahren ein Volksbegehren gestartet und zugegeben auch wir vom Artenschutz in Franken® hatten darauf gesetzt, das hier auf breiter Basis endlich die Erkenntnis reift, das wir alle Anstrengungen benötigen um den zunehmenden Verlust der Biodiversität in unserem Bundesland konsequent einzudämmen.
Doch bereits nach relativ kurzer Zeit war uns klar, das wird wohl nichts … Anstatt nun gemeinsam nach vorne, in die mit möglichst großer Artenvielfalt ausgestatteter Zukunft zu schreiten, um den uns nachfolgenden Generationen eine lebenswerte Welt zu hinterlassen, empfinden wir täglich Stagnation, es finden sich gar Rückschritte.
Es scheint tatsächlich so, dass an vielen, auch zentralen Stellen immer noch nicht erkannt wird, was hier in unserem Land eigentlich passiert. Wir setzen ohne Not wohl unsere sowie die Zukunft unserer Kinder und Enkel aufs Spiel, denn der Schutz der Insekten die hier ursächlich waren, sind ein gesellschaftliches Spiegelbild für das, was auf uns noch zukommen mag.
Wir haben die Hoffnung aufgegeben, dass hier von entscheidender Stelle wirklich noch viel kommt, es wird nach unserer Auffassung lediglich viel (schön) geredet und viel (schön) geschrieben … viel Positives geschehen ist wohl nichts, denn der Rückgang der Biodiversität ist noch immer an mannigfachen Stellen erkennbar. Wir erleben diesen fast täglich aufs Neue … es bedarf lediglich offener Augen und Ohren um diese Erfahrung auch selbst wahrnehmen zu dürfen.
Wenn wir als Gesellschaft tatsächlich etwas für die uns nachfolgende Generation in diesem Zusammenhang erreichen möchten, sollten wir ein neues Begehren anstrengen und dieses in eine Form gießen lassen, die verpflichtenden Charakter besitzt. Ansonsten können wir hier eigentlich stoppen und dem vollständigen Niedergang der Artenvielfalt mit offenen Augen entgegensehen.
Das Gerede von Ideologie können wir nicht mehr hören, denn es ist keine Ideologie, die hier angesprochen wird, sondern es ist die Realität, die von manchen eben nicht wahrgenommen wird oder wahrgenommen werden will / kann. Ob so oder so, im Ergebnis steht der Niedergang der Artenvielfalt, davon sind wir gänzlich überzeugt.
In der Aufnahme
Es scheint tatsächlich so, dass an vielen, auch zentralen Stellen immer noch nicht erkannt wird, was hier in unserem Land eigentlich passiert. Wir setzen ohne Not wohl unsere sowie die Zukunft unserer Kinder und Enkel aufs Spiel, denn der Schutz der Insekten die hier ursächlich waren, sind ein gesellschaftliches Spiegelbild für das, was auf uns noch zukommen mag.
Wir haben die Hoffnung aufgegeben, dass hier von entscheidender Stelle wirklich noch viel kommt, es wird nach unserer Auffassung lediglich viel (schön) geredet und viel (schön) geschrieben … viel Positives geschehen ist wohl nichts, denn der Rückgang der Biodiversität ist noch immer an mannigfachen Stellen erkennbar. Wir erleben diesen fast täglich aufs Neue … es bedarf lediglich offener Augen und Ohren um diese Erfahrung auch selbst wahrnehmen zu dürfen.
Wenn wir als Gesellschaft tatsächlich etwas für die uns nachfolgende Generation in diesem Zusammenhang erreichen möchten, sollten wir ein neues Begehren anstrengen und dieses in eine Form gießen lassen, die verpflichtenden Charakter besitzt. Ansonsten können wir hier eigentlich stoppen und dem vollständigen Niedergang der Artenvielfalt mit offenen Augen entgegensehen.
Das Gerede von Ideologie können wir nicht mehr hören, denn es ist keine Ideologie, die hier angesprochen wird, sondern es ist die Realität, die von manchen eben nicht wahrgenommen wird oder wahrgenommen werden will / kann. Ob so oder so, im Ergebnis steht der Niedergang der Artenvielfalt, davon sind wir gänzlich überzeugt.
In der Aufnahme
- Niedergemulcht ... tausendfacher Insektentod auch an den Rändern einer zunehmend industriell ausgerichteten Landwirtschaft.
Artenschutz in Franken®
Die Rötelschwalbe (Cecropis daurica)

Ich bin die Rötelschwalbe
16/17.08.2024
Ich bin eine stolze Schwalbe, die sich durch meinen eleganten Flug, meine auffälligen Farben und meinen Lebensstil von anderen Vögeln unterscheidet.Wenn du mich in der Luft siehst, dann erkennst du mich vielleicht an meinen langen, tief gegabelten Schwanzfedern, die mein Flugbild so charakteristisch machen. Aber lass mich dir mehr über mich erzählen, aus meiner Sicht und mit ein paar fachlichen Details.
16/17.08.2024
- Weitere Aufnahmen eingestellt
Ich bin eine stolze Schwalbe, die sich durch meinen eleganten Flug, meine auffälligen Farben und meinen Lebensstil von anderen Vögeln unterscheidet.Wenn du mich in der Luft siehst, dann erkennst du mich vielleicht an meinen langen, tief gegabelten Schwanzfedern, die mein Flugbild so charakteristisch machen. Aber lass mich dir mehr über mich erzählen, aus meiner Sicht und mit ein paar fachlichen Details.
Meine Erscheinung
Ich bin etwas größer als meine Verwandte, die Mehlschwalbe (Delichon urbicum), aber kleiner als die Rauchschwalbe (Hirundo rustica). Mein Gefieder ist auf dem Rücken glänzend blauschwarz, während meine Unterseite in einem warmen, rostbraunen Ton leuchtet. Besonders stolz bin ich auf meinen rostfarbenen Nackenkragen, der mir auch meinen Namen „Rötelschwalbe“ eingebracht hat.
Mein Lebensraum und Verbreitung
Ursprünglich stamme ich aus Asien, aber ich habe meine Flügel weit ausgebreitet und bin inzwischen auch in Europa und Afrika heimisch. Besonders gerne mag ich warme, offene Landschaften wie steinige Hügel, Felshänge und manchmal sogar menschliche Siedlungen. Wenn du genau hinsiehst, entdeckst du mein Nest oft unter Brücken, an Felsen oder in verlassenen Gebäuden.
Mein Nestbau
Wenn ich ein Nest baue, wähle ich den Ort sorgfältig aus. Mein Nest ist ein wahres Meisterwerk aus Lehm und Schlamm, den ich sorgfältig mit Speichel mische, um eine stabile Struktur zu schaffen. Im Gegensatz zu anderen Schwalben baue ich es oft an geschützten Stellen wie in Höhlen oder unter Vorsprüngen. Das Innere meines Nests polstere ich mit weichen Materialien aus, um es gemütlich für meine Jungen zu machen.
Ernährung und Jagdverhalten
Ich bin ein Insektenfresser, und mein Tag ist erfüllt von der Jagd nach Fluginsekten. Mit meinen schnellen, wendigen Flugmanövern fange ich Fliegen, Mücken und andere kleine Insekten direkt aus der Luft. Mein scharfer Schnabel und meine großen Augen helfen mir dabei, auch die kleinsten Beutetiere zu erspähen und im Flug zu erbeuten. Ich fliege oft in großen Höhen, aber auch knapp über dem Boden, wo ich die Insekten aus dem Gras aufscheuche.
Mein Verhalten und Sozialleben
Ich bin ein sozialer Vogel, und obwohl ich oft mit meiner Familie oder in kleinen Gruppen unterwegs bin, schätze ich auch die Gesellschaft anderer Schwalbenarten. Wir leben oft in Kolonien zusammen, wo wir unsere Nester dicht nebeneinander bauen und gemeinsam unsere Jungen aufziehen. Während der Brutzeit bin ich besonders wachsam und beschütze mein Nest und meine Jungen vehement vor Eindringlingen.
Meine Wanderungen
Wie viele meiner Verwandten bin auch ich ein Zugvogel. Im Herbst verlasse ich meine Brutgebiete in Europa und fliege in den Süden nach Afrika, wo ich den Winter verbringe. Im Frühjahr kehre ich dann wieder zurück, um zu brüten und meine Jungen großzuziehen. Diese langen Wanderungen sind anstrengend, aber mein Körper ist perfekt an diese Herausforderung angepasst. Ich habe starke Flügel und einen außergewöhnlichen Orientierungssinn, der mich immer wieder sicher zu meinem Brutplatz führt.
Mein Beitrag zum Ökosystem
Ich spiele eine wichtige Rolle im Ökosystem. Durch das Fressen von Insekten helfe ich, die Populationen von Schädlingen zu kontrollieren. In menschlichen Siedlungen trage ich dazu bei, die Anzahl der Fliegen und Mücken zu reduzieren, was sowohl für Menschen als auch für Tiere von Vorteil ist. Darüber hinaus bin ich ein Indikator für die Gesundheit meines Lebensraums: Geht es mir gut, bedeutet das, dass die Umwelt intakt ist.
Meine Herausforderungen
Trotz meiner Anpassungsfähigkeit stehe ich vor Herausforderungen. Der Verlust von geeigneten Lebensräumen, Pestizide, die meine Nahrungsquellen vergiften, und der Klimawandel, der meine Wanderungsrouten beeinflusst, setzen mir zu. Doch ich bin ein Überlebenskünstler, und mit deiner Hilfe – indem du meinen Lebensraum schützt und auf chemische Pestizide verzichtest – habe ich eine gute Chance, weiterhin durch die Lüfte zu fliegen und meine Lieder in die Welt zu tragen.
Das bin ich, die Rötelschwalbe, eine kleine, aber bedeutende Bewohnerin unserer Erde. Ich lade dich ein, mich zu beobachten und mehr über mein Leben zu lernen – und vielleicht kannst du auch ein wenig dazu beitragen, dass mein Lebensraum erhalten bleibt.
Aufnahme aus 2024 von Helga Zinnecker
Ich bin etwas größer als meine Verwandte, die Mehlschwalbe (Delichon urbicum), aber kleiner als die Rauchschwalbe (Hirundo rustica). Mein Gefieder ist auf dem Rücken glänzend blauschwarz, während meine Unterseite in einem warmen, rostbraunen Ton leuchtet. Besonders stolz bin ich auf meinen rostfarbenen Nackenkragen, der mir auch meinen Namen „Rötelschwalbe“ eingebracht hat.
Mein Lebensraum und Verbreitung
Ursprünglich stamme ich aus Asien, aber ich habe meine Flügel weit ausgebreitet und bin inzwischen auch in Europa und Afrika heimisch. Besonders gerne mag ich warme, offene Landschaften wie steinige Hügel, Felshänge und manchmal sogar menschliche Siedlungen. Wenn du genau hinsiehst, entdeckst du mein Nest oft unter Brücken, an Felsen oder in verlassenen Gebäuden.
Mein Nestbau
Wenn ich ein Nest baue, wähle ich den Ort sorgfältig aus. Mein Nest ist ein wahres Meisterwerk aus Lehm und Schlamm, den ich sorgfältig mit Speichel mische, um eine stabile Struktur zu schaffen. Im Gegensatz zu anderen Schwalben baue ich es oft an geschützten Stellen wie in Höhlen oder unter Vorsprüngen. Das Innere meines Nests polstere ich mit weichen Materialien aus, um es gemütlich für meine Jungen zu machen.
Ernährung und Jagdverhalten
Ich bin ein Insektenfresser, und mein Tag ist erfüllt von der Jagd nach Fluginsekten. Mit meinen schnellen, wendigen Flugmanövern fange ich Fliegen, Mücken und andere kleine Insekten direkt aus der Luft. Mein scharfer Schnabel und meine großen Augen helfen mir dabei, auch die kleinsten Beutetiere zu erspähen und im Flug zu erbeuten. Ich fliege oft in großen Höhen, aber auch knapp über dem Boden, wo ich die Insekten aus dem Gras aufscheuche.
Mein Verhalten und Sozialleben
Ich bin ein sozialer Vogel, und obwohl ich oft mit meiner Familie oder in kleinen Gruppen unterwegs bin, schätze ich auch die Gesellschaft anderer Schwalbenarten. Wir leben oft in Kolonien zusammen, wo wir unsere Nester dicht nebeneinander bauen und gemeinsam unsere Jungen aufziehen. Während der Brutzeit bin ich besonders wachsam und beschütze mein Nest und meine Jungen vehement vor Eindringlingen.
Meine Wanderungen
Wie viele meiner Verwandten bin auch ich ein Zugvogel. Im Herbst verlasse ich meine Brutgebiete in Europa und fliege in den Süden nach Afrika, wo ich den Winter verbringe. Im Frühjahr kehre ich dann wieder zurück, um zu brüten und meine Jungen großzuziehen. Diese langen Wanderungen sind anstrengend, aber mein Körper ist perfekt an diese Herausforderung angepasst. Ich habe starke Flügel und einen außergewöhnlichen Orientierungssinn, der mich immer wieder sicher zu meinem Brutplatz führt.
Mein Beitrag zum Ökosystem
Ich spiele eine wichtige Rolle im Ökosystem. Durch das Fressen von Insekten helfe ich, die Populationen von Schädlingen zu kontrollieren. In menschlichen Siedlungen trage ich dazu bei, die Anzahl der Fliegen und Mücken zu reduzieren, was sowohl für Menschen als auch für Tiere von Vorteil ist. Darüber hinaus bin ich ein Indikator für die Gesundheit meines Lebensraums: Geht es mir gut, bedeutet das, dass die Umwelt intakt ist.
Meine Herausforderungen
Trotz meiner Anpassungsfähigkeit stehe ich vor Herausforderungen. Der Verlust von geeigneten Lebensräumen, Pestizide, die meine Nahrungsquellen vergiften, und der Klimawandel, der meine Wanderungsrouten beeinflusst, setzen mir zu. Doch ich bin ein Überlebenskünstler, und mit deiner Hilfe – indem du meinen Lebensraum schützt und auf chemische Pestizide verzichtest – habe ich eine gute Chance, weiterhin durch die Lüfte zu fliegen und meine Lieder in die Welt zu tragen.
Das bin ich, die Rötelschwalbe, eine kleine, aber bedeutende Bewohnerin unserer Erde. Ich lade dich ein, mich zu beobachten und mehr über mein Leben zu lernen – und vielleicht kannst du auch ein wenig dazu beitragen, dass mein Lebensraum erhalten bleibt.
Aufnahme aus 2024 von Helga Zinnecker
Artenschutz in Franken®
Stele der Biodiversität® - Stegaurach / Dellern

Stele der Biodiversität® - Stegaurach / Dellern
16/17.08.2024
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.
Stegaurach / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
16/17.08.2024
- Die grafische Gestaltung ... Stimmungen an der Stele der Biodiversität®
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.
Stegaurach / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
Denn wenn (selbst in noch geeigneten Nahrungsstrukturen) keine geeigneten Reproduktionsräume vorhanden sind, ist die Erhaltung der Artenvielfalt gelichfalls zum Scheitern verurteilt.
Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird., setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.
In der Aufnahme
Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird., setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.
In der Aufnahme
- Abendliche Eindrücke vom 07.08.2024 ...
Artenschutz in Franken®
Der Baum-Weißling (Aporia crataegi) .... leider sehr selten geworden ...

Baum-Weißling (Aporia crataegi)
15/16.08.2024
Mein wissenschaftlicher Name, Aporia crataegi, deutet auf meine enge Verbindung zu bestimmten Pflanzenarten hin, insbesondere zu Weißdorn (Crataegus), deren Blätter ich als Raupen fresse.
15/16.08.2024
- Als Baum-Weißling (Aporia crataegi) betrachte ich die Welt aus einer einzigartigen Perspektive, angepasst an meine Umgebung und Lebensweise.
Mein wissenschaftlicher Name, Aporia crataegi, deutet auf meine enge Verbindung zu bestimmten Pflanzenarten hin, insbesondere zu Weißdorn (Crataegus), deren Blätter ich als Raupen fresse.
Als Schmetterling gehöre ich zur Familie der Weißlinge (Pieridae), und mein Aussehen ist typisch für viele dieser Arten: Ich habe weiße Flügel mit zarten schwarzen Adern und schwarze Flecken an den Flügelspitzen. Diese Färbung dient als Tarnung vor Fressfeinden und hilft mir, mich gut in blühenden Landschaften zu verstecken.
Mein Lebenszyklus ist geprägt von Metamorphose. Als Ei lege ich mich auf Weißdornblättern ab, wo ich als Raupe schlüpfe und mich von den Blättern ernähre. Diese Pflanzen sind meine Hauptnahrungsquelle während meiner Entwicklung. Während dieser Phase passe ich mich gut an die Umgebung an und vermeide es, von Vögeln oder anderen Raubtieren entdeckt zu werden.
Sobald ich genug Nahrung aufgenommen habe, verpuppe ich mich und durchlaufe eine Ruhephase, in der sich mein Körper stark verändert. Nach einigen Wochen schlüpfe ich als fertiger Baum-Weißling aus meiner Puppe. In dieser Phase bin ich ein geschickter Flieger, der sich von Nektar ernährt und dabei hilft, Blüten zu bestäuben.
Mein Lebensraum erstreckt sich über weite Teile Europas und Asiens, insbesondere in Gebieten, wo Weißdorn häufig vorkommt. Meine Populationen unterliegen jedoch verschiedenen Umweltbedrohungen, wie z.B. der Zerstörung natürlicher Lebensräume oder dem Einsatz von Pestiziden, die meine Nahrungsquellen gefährden können.
In der Natur spielen Baum-Weißlinge eine wichtige Rolle im Ökosystem, indem sie als Bestäuber und Beute für verschiedene Tierarten dienen. Ihre Anwesenheit ist ein Zeichen für das Gleichgewicht und die Vielfalt der Lebensräume, in denen sie vorkommen.
Aufnahme von Helga Zinncker
Mein Lebenszyklus ist geprägt von Metamorphose. Als Ei lege ich mich auf Weißdornblättern ab, wo ich als Raupe schlüpfe und mich von den Blättern ernähre. Diese Pflanzen sind meine Hauptnahrungsquelle während meiner Entwicklung. Während dieser Phase passe ich mich gut an die Umgebung an und vermeide es, von Vögeln oder anderen Raubtieren entdeckt zu werden.
Sobald ich genug Nahrung aufgenommen habe, verpuppe ich mich und durchlaufe eine Ruhephase, in der sich mein Körper stark verändert. Nach einigen Wochen schlüpfe ich als fertiger Baum-Weißling aus meiner Puppe. In dieser Phase bin ich ein geschickter Flieger, der sich von Nektar ernährt und dabei hilft, Blüten zu bestäuben.
Mein Lebensraum erstreckt sich über weite Teile Europas und Asiens, insbesondere in Gebieten, wo Weißdorn häufig vorkommt. Meine Populationen unterliegen jedoch verschiedenen Umweltbedrohungen, wie z.B. der Zerstörung natürlicher Lebensräume oder dem Einsatz von Pestiziden, die meine Nahrungsquellen gefährden können.
In der Natur spielen Baum-Weißlinge eine wichtige Rolle im Ökosystem, indem sie als Bestäuber und Beute für verschiedene Tierarten dienen. Ihre Anwesenheit ist ein Zeichen für das Gleichgewicht und die Vielfalt der Lebensräume, in denen sie vorkommen.
Aufnahme von Helga Zinncker
- Baum-Weißling (Aporia crataegi)
Artenschutz in Franken®
Stele der Biodiversität® - Burgwindheim / Kötsch

Stele der Biodiversität® - Burgwindheim / Kötsch
15/16.08.2024
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das vom Markt Burgwindheim, dem Bayernwerk der Deutschen Postcode Lotterie und der Steuerkanzlei Bauerfeind unterstützt wird.
Kötsch / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen.
Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
15/16.08.2024
- Einbringung der Sekundärhabitate ist fast abgeschlossen.
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das vom Markt Burgwindheim, dem Bayernwerk der Deutschen Postcode Lotterie und der Steuerkanzlei Bauerfeind unterstützt wird.
Kötsch / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen.
Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
Denn wenn (selbst in noch geeigneten Nahrungsstrukturen) keine geeigneten Reproduktionsräume vorhanden sind, ist die Erhaltung der Artenvielfalt gelichfalls zum Scheitern verurteilt.
Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das vom Markt Burgwindheim, dem Bayernwerk der Deutschen Postcode Lotterie und der Steuerkanzlei Bauerfeind unterstützt wird, setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.
In der Aufnahme
Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das vom Markt Burgwindheim, dem Bayernwerk der Deutschen Postcode Lotterie und der Steuerkanzlei Bauerfeind unterstützt wird, setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.
In der Aufnahme
- Projektfortschritt am 07.08.2024 ...
Artenschutz in Franken®
Die Totenkopfschwebfliege / Gemeine Dolden-Schwebfliege (Myathropa florea)

Totenkopfschwebfliege / Gemeine Dolden-Schwebfliege
14/15.08.2024
Ich sehe vielleicht ein bisschen aus wie eine Mini-Biene, aber ich bin eine Schwebfliege. Weißt du, was Schwebfliegen können? Wir können wie echte Helikopter in der Luft stehen! Zzzzzzz... einfach so! Cool, oder? Das ist, als ob du in der Luft stehen und dabei ein Eis essen könntest, ohne runterzufallen.
14/15.08.2024
- Hallo! Weißt du, wer ich bin? Ich bin die Totenkopfschwebfliege, aber du kannst mich einfach "Totti" nennen! Klingt gruselig, oder? Keine Sorge, ich bin total nett und gar nicht unheimlich.
Ich sehe vielleicht ein bisschen aus wie eine Mini-Biene, aber ich bin eine Schwebfliege. Weißt du, was Schwebfliegen können? Wir können wie echte Helikopter in der Luft stehen! Zzzzzzz... einfach so! Cool, oder? Das ist, als ob du in der Luft stehen und dabei ein Eis essen könntest, ohne runterzufallen.
Auf meinem Rücken trage ich ein besonderes Muster, das aussieht wie ein Totenkopf. Das ist mein Superheldenkostüm! Damit denken Raubtiere, ich wäre gefährlich, und lassen mich in Ruhe. Aber psst, mein Geheimnis: Ich bin überhaupt nicht gefährlich. Ich habe nicht einmal einen Stachel!
Ich liebe es, von Blume zu Blume zu fliegen und Nektar zu schlürfen. Das ist wie eine Party, bei der es nur Süßigkeiten gibt. Und weißt du was? Während ich das mache, helfe ich den Blumen, Babys zu bekommen! Ja, wirklich! Wenn ich von Blume zu Blume fliege, nehme ich Pollen mit, und das hilft den Blumen, neue Samen zu machen. Das ist, als würde ich ihnen helfen, ihre eigene Blumenfamilie zu gründen.
Und das Beste? Wenn ich auf Blättern oder Blüten lande, kitzelt das so schön an meinen Füßchen! Hihihi!
Also, wenn du das nächste Mal eine Totenkopfschwebfliege siehst, denk an mich, Totti, den freundlichen Luftakrobaten, der Blumen hilft und gerne in der Sonne tanzt. Zzzzzzzz...!
Aufnahme von Bernhard Schmalisch
Ich liebe es, von Blume zu Blume zu fliegen und Nektar zu schlürfen. Das ist wie eine Party, bei der es nur Süßigkeiten gibt. Und weißt du was? Während ich das mache, helfe ich den Blumen, Babys zu bekommen! Ja, wirklich! Wenn ich von Blume zu Blume fliege, nehme ich Pollen mit, und das hilft den Blumen, neue Samen zu machen. Das ist, als würde ich ihnen helfen, ihre eigene Blumenfamilie zu gründen.
Und das Beste? Wenn ich auf Blättern oder Blüten lande, kitzelt das so schön an meinen Füßchen! Hihihi!
Also, wenn du das nächste Mal eine Totenkopfschwebfliege siehst, denk an mich, Totti, den freundlichen Luftakrobaten, der Blumen hilft und gerne in der Sonne tanzt. Zzzzzzzz...!
Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- Totenkopfschwebfliege / Gemeine Dolden-Schwebfliege (Myathropa florea)
Artenschutz in Franken®
Stele der Biodiversität® - Stegaurach / Dellern

Stele der Biodiversität® - Stegaurach / Dellern
14/15.08.2024
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.
Stegaurach / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
14/15.08.2024
- Die grafische Gestaltung ... Stimmungen an der Stele der Biodiversität®
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.
Stegaurach / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
Denn wenn (selbst in noch geeigneten Nahrungsstrukturen) keine geeigneten Reproduktionsräume vorhanden sind, ist die Erhaltung der Artenvielfalt gelichfalls zum Scheitern verurteilt.
Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird., setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.
In der Aufnahme
Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird., setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.
In der Aufnahme
- Abendliche Eindrücke vom 06.08.2024 ...
Artenschutz in Franken®
Die Igelfliege (Tachina fera)

Igelfliege (Tachina fera)
13/14.08.2024
Lebenszyklus und Fortpflanzung:
"Ich bin eine Igelfliege, ein Parasit, der seine Nachkommen in anderen Insekten entwickelt. Mein Hauptziel ist es, einen geeigneten Wirt zu finden, damit meine Larven überleben und wachsen können. (...)
13/14.08.2024
- Aus der Perspektive der Igelfliege (Tachina fera) sieht das Leben wie folgt aus:
Lebenszyklus und Fortpflanzung:
"Ich bin eine Igelfliege, ein Parasit, der seine Nachkommen in anderen Insekten entwickelt. Mein Hauptziel ist es, einen geeigneten Wirt zu finden, damit meine Larven überleben und wachsen können. (...)
Ich lege meine Eier auf die Larven von Schmetterlingen oder Käfern ab, vorzugsweise solche, die an Pflanzen fressen. Wenn meine Larven schlüpfen, bohren sie sich in den Wirt und beginnen, ihn von innen heraus zu konsumieren. Es mag brutal erscheinen, aber es ist die beste Strategie, um sicherzustellen, dass meine Nachkommen genug Nahrung haben, um zu überleben und sich zu entwickeln."
Ernährung und Lebensweise:
"Als erwachsene Igelfliege bin ich kein Jäger. Stattdessen ernähre ich mich von Nektar und anderen süßen Flüssigkeiten, die ich auf Blüten finde. Während ich auf Nahrungssuche bin, fliege ich von Pflanze zu Pflanze und sorge dafür, dass ich genug Energie habe, um meinen Fortpflanzungszyklus zu vollenden. Ich bin außerdem ein wichtiges Glied im Ökosystem, da ich zur Bestäubung beitrage, auch wenn dies nicht mein Hauptziel ist."
Körperliche Merkmale und Tarnung:
"Meine stacheligen Borsten und mein robustes Erscheinungsbild schützen mich vor Fressfeinden und machen mich weniger attraktiv für Vögel und andere Raubtiere. Mein Körper ist stark behaart, was mir nicht nur hilft, mich vor Feinden zu schützen, sondern auch bei der Eiablage, indem ich mich an Pflanzen oder anderen Oberflächen gut festhalten kann."
Ökologische Rolle:
"Obwohl meine Lebensweise grausam erscheinen mag, spiele ich eine wichtige Rolle im natürlichen Gleichgewicht. Durch die Parasitierung auf Schmetterlings- und Käferlarven helfe ich, ihre Populationen zu kontrollieren. Dies verhindert, dass sie überhandnehmen und zu viele Pflanzen fressen, was das Gleichgewicht der Ökosysteme stören könnte. Ich bin Teil eines komplexen Netzes von Beziehungen, in dem jedes Lebewesen eine Rolle spielt, um das Ökosystem stabil zu halten."
Fachliche Komponenten:
Aus entomologischer Sicht ist die Igelfliege ein faszinierendes Beispiel für eine spezialisierte parasitäre Lebensweise. Der Parasitismus der Igelfliege ist eine ausgeklügelte Strategie, die sich über viele Generationen entwickelt hat. Ihre Anpassungen, wie die Fähigkeit, Wirte gezielt zu parasitieren und die Larvenentwicklung sicherzustellen, zeigen die enge Verbindung zwischen verschiedenen Arten in einem Ökosystem. Igelfliegen sind auch ein Beispiel für die Komplexität und manchmal brutale Realität der Natur, in der Überleben und Fortpflanzung oberste Priorität haben.
Aufnahme von Bernhard Schmalisch
Ernährung und Lebensweise:
"Als erwachsene Igelfliege bin ich kein Jäger. Stattdessen ernähre ich mich von Nektar und anderen süßen Flüssigkeiten, die ich auf Blüten finde. Während ich auf Nahrungssuche bin, fliege ich von Pflanze zu Pflanze und sorge dafür, dass ich genug Energie habe, um meinen Fortpflanzungszyklus zu vollenden. Ich bin außerdem ein wichtiges Glied im Ökosystem, da ich zur Bestäubung beitrage, auch wenn dies nicht mein Hauptziel ist."
Körperliche Merkmale und Tarnung:
"Meine stacheligen Borsten und mein robustes Erscheinungsbild schützen mich vor Fressfeinden und machen mich weniger attraktiv für Vögel und andere Raubtiere. Mein Körper ist stark behaart, was mir nicht nur hilft, mich vor Feinden zu schützen, sondern auch bei der Eiablage, indem ich mich an Pflanzen oder anderen Oberflächen gut festhalten kann."
Ökologische Rolle:
"Obwohl meine Lebensweise grausam erscheinen mag, spiele ich eine wichtige Rolle im natürlichen Gleichgewicht. Durch die Parasitierung auf Schmetterlings- und Käferlarven helfe ich, ihre Populationen zu kontrollieren. Dies verhindert, dass sie überhandnehmen und zu viele Pflanzen fressen, was das Gleichgewicht der Ökosysteme stören könnte. Ich bin Teil eines komplexen Netzes von Beziehungen, in dem jedes Lebewesen eine Rolle spielt, um das Ökosystem stabil zu halten."
Fachliche Komponenten:
Aus entomologischer Sicht ist die Igelfliege ein faszinierendes Beispiel für eine spezialisierte parasitäre Lebensweise. Der Parasitismus der Igelfliege ist eine ausgeklügelte Strategie, die sich über viele Generationen entwickelt hat. Ihre Anpassungen, wie die Fähigkeit, Wirte gezielt zu parasitieren und die Larvenentwicklung sicherzustellen, zeigen die enge Verbindung zwischen verschiedenen Arten in einem Ökosystem. Igelfliegen sind auch ein Beispiel für die Komplexität und manchmal brutale Realität der Natur, in der Überleben und Fortpflanzung oberste Priorität haben.
Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- Igelfliege (Tachina fera)
Artenschutz in Franken®
Neue Nistplätze für die „Steigerwald- Schwalben“

Neue Nistplätze für die „Steigerwald- Schwalben“
13/14.08.2024
Burgwindheim / Bayern. Ein Projekt des Artenschutz in Franken®, welches von der Gemeinde Burgwindheim unterstützt wurde, möchte angestammte Mehlschwalbenlebensräume sichern helfen.
Auch heute in unserer schnelllebig gewordenen Zeit, fasziniert die alljährliche Rückkehr der Schwalben viele Mitmenschen.
13/14.08.2024
- Ein Kontrollbesuch ...
Burgwindheim / Bayern. Ein Projekt des Artenschutz in Franken®, welches von der Gemeinde Burgwindheim unterstützt wurde, möchte angestammte Mehlschwalbenlebensräume sichern helfen.
Auch heute in unserer schnelllebig gewordenen Zeit, fasziniert die alljährliche Rückkehr der Schwalben viele Mitmenschen.
Denn wie bei kaum einer anderen Spezies wird ihr Erscheinen im April direkt mit den bevorstehenden Sommermonaten in Verbindung gebracht. Selbst als Glücksbringer galt der Vogel vor allem in der bäuerlich geprägten Kulturlandschaft. So soll sie dem Volksglauben nach Mensch und Vieh vor Krankheiten und anderem Schaden bewahren. Ursprüngliche Reproduktionsorte an steilen Felswänden wurden mit dem Auftauchen des Menschen und der damit einher gehenden Bauaktivität gegen Nistplätzen an und ihn Gebäuden ausgetauscht. So konnten sich diese sympathischen Tiere, als so genannter Kulturfolger sehr lange Zeit an die von uns veränderten Lebensräume anpassen und davon nachhaltig profitieren.
Alle Schwalbenarten Mitteleuropas nisten heute bis auf wenige Ausnahmen in der Nähe des Menschen.
Heute jedoch sind Flächenversiegelung, Aufgabe der Stallungen damit verbundener Nahrungsmangel, extreme Veränderungen in den Lebensräumen mit ursächlich für teils erhebliche Bestandsrückgänge unserer heimischen Schwalbenarten. So steht eine, wohl die bekannteste Vertreterin unserer Schwalbenarten die Mehlschwalbe , die als so genannte Gebäudebrüter in die Kategorie der besonders schützenswerten Arten fällt, nicht ohne Grund seit 2002 auf der Vorwarnliste bedrohter Vogelarten.
Ihre Lehmnester klebt sie im Gegensatz zu der anderen bekannten Schwalbenart, der Rauchschwalbe die in Gebäuden brütet, an Gebäudefassaden.
Dies stört in der modernen Zeit viele Menschen ist doch hier, vor allem während der Fütterungszeit mit „Schwalbendreck“ zu rechnen. Um dies zu vermeiden, werden Drähte gespannt und „Flatterbänder“ angebracht. Anders verhielt es sich an der Burgwindheimer Gemeindescheune. Hier erbrüteten 5 – 7 gern gesehene Mehlschwalbenpaare lange Zeit ihren Nachwuchs. Der Nistbereich liegt hier an frei unterständigen Holzbalken, an welchen die Schwalben ihre Nester anklebten.
In den vergangenen Jahren konnte erkannt werden, dass diese Lehmnester regelmäßig förmlich von den Balken abbrachen.
Die kleinen Mehlschwalben die zu dieser Zeit bereits in den Nestern das Licht der Welt erblickt hatten, verendeten durch diesen Sturz hierbei kläglich. So wurde jüngst kurzerhand ein Projekt auf den Weg gebracht das den Burgwindheimer Glücksbringern in Zukunft „unter die Flügel“ greifen wird. Die Montage spezieller, auf die Vorliebe der zur Koloniebildung neigender Mehlschwalben, ausgelegten Kunstnester. Durch Schrauben fest an die Holzbalken der Gemeindescheune montiert werden sie zukünftig die kleinen „Steigerwald“ Mehlschwalben davor bewahren in den Tod zu stürzen. So zeigt dieses Projekt auf, wie übergreifende Artenschutzprojekte in einer intakten ländlichen Umgebung
In der Aufnahme
Alle Schwalbenarten Mitteleuropas nisten heute bis auf wenige Ausnahmen in der Nähe des Menschen.
Heute jedoch sind Flächenversiegelung, Aufgabe der Stallungen damit verbundener Nahrungsmangel, extreme Veränderungen in den Lebensräumen mit ursächlich für teils erhebliche Bestandsrückgänge unserer heimischen Schwalbenarten. So steht eine, wohl die bekannteste Vertreterin unserer Schwalbenarten die Mehlschwalbe , die als so genannte Gebäudebrüter in die Kategorie der besonders schützenswerten Arten fällt, nicht ohne Grund seit 2002 auf der Vorwarnliste bedrohter Vogelarten.
Ihre Lehmnester klebt sie im Gegensatz zu der anderen bekannten Schwalbenart, der Rauchschwalbe die in Gebäuden brütet, an Gebäudefassaden.
Dies stört in der modernen Zeit viele Menschen ist doch hier, vor allem während der Fütterungszeit mit „Schwalbendreck“ zu rechnen. Um dies zu vermeiden, werden Drähte gespannt und „Flatterbänder“ angebracht. Anders verhielt es sich an der Burgwindheimer Gemeindescheune. Hier erbrüteten 5 – 7 gern gesehene Mehlschwalbenpaare lange Zeit ihren Nachwuchs. Der Nistbereich liegt hier an frei unterständigen Holzbalken, an welchen die Schwalben ihre Nester anklebten.
In den vergangenen Jahren konnte erkannt werden, dass diese Lehmnester regelmäßig förmlich von den Balken abbrachen.
Die kleinen Mehlschwalben die zu dieser Zeit bereits in den Nestern das Licht der Welt erblickt hatten, verendeten durch diesen Sturz hierbei kläglich. So wurde jüngst kurzerhand ein Projekt auf den Weg gebracht das den Burgwindheimer Glücksbringern in Zukunft „unter die Flügel“ greifen wird. Die Montage spezieller, auf die Vorliebe der zur Koloniebildung neigender Mehlschwalben, ausgelegten Kunstnester. Durch Schrauben fest an die Holzbalken der Gemeindescheune montiert werden sie zukünftig die kleinen „Steigerwald“ Mehlschwalben davor bewahren in den Tod zu stürzen. So zeigt dieses Projekt auf, wie übergreifende Artenschutzprojekte in einer intakten ländlichen Umgebung
In der Aufnahme
- Eine Auswahlreihe unterschiedlicher, sekundärer Habittastrukturen bietet Mehlschwalben grundsätzlich interessante Reproduktionsmöglichkeiten. Ebenfalls möchten wir hier im Zwanzig- Jahresmonitoring ermitteln welche dieser Nistmöglichkeiten am besten für diese Tiere in der Reproduktionausbringung geeignet sind und welche diesen Ansatz nicht forcieren.
Artenschutz in Franken®
Wegwespen (Pompilidae)

Die Wegwespen (Pompilidae) sind eine Familie von Grabwespen, die weltweit vorkommt und bekannt dafür ist, dass sie andere Insekten als Nahrung für ihre Larven sammeln.
12/13.08.2024
12/13.08.2024
- Hier haben wir einige fachliche Komponenten und Details zu den Wegwespen zusammengestellt:
Taxonomie und Klassifikation:
- Die Wegwespen gehören zur Ordnung der Hautflügler (Hymenoptera) und innerhalb dieser Ordnung zur Überfamilie der Apoidea.
- Die Familie Pompilidae umfasst mehrere Unterfamilien und zahlreiche Gattungen und Arten.
Lebensweise und Verhalten:
- Wegwespen sind Solitärbienen, das bedeutet, sie leben einzelgängerisch und nicht in Kolonien wie Honigbienen.
- Sie sind bekannt für ihr ausgeprägtes Jagdverhalten, bei dem sie Spinnen oder andere Insekten als Nahrung für ihre Larven erbeuten.
- Die Jagdstrategie variiert je nach Art und kann sowohl eine Verfolgung zu Fuß als auch eine strategische Annäherung umfassen, um Beute zu überraschen.
Fortpflanzung und Entwicklung:
- Nachdem eine Wegwespe eine Beute (typischerweise eine Spinne) erlegt hat, paralysiert sie diese mit einem Giftstich.
- Anschließend wird die gelähmte Beute in ein vorbereitetes Nest gebracht, wo ein Ei auf oder nahe der Beute abgelegt wird.
- Die Larve schlüpft aus dem Ei und ernährt sich von der lebenden, aber gelähmten Beute, bis sie sich verpuppt und sich schließlich als ausgewachsene Wegwespe entwickelt.
Ökologische Bedeutung:
- Wegwespen spielen eine wichtige Rolle im Ökosystem, da sie zur Regulierung von Spinnenpopulationen beitragen können.
- Indem sie Spinnen fangen, beeinflussen sie indirekt auch andere Teile der Nahrungskette, insbesondere in Bereichen, wo Spinnen eine bedeutende Rolle als Räuber spielen.
Anpassungen und Evolution:
- Im Laufe der Evolution haben Wegwespen verschiedene Anpassungen entwickelt, um erfolgreich zu jagen und ihre Nachkommen zu schützen.
- Dazu gehören anatomische Merkmale wie kräftige Kiefer für die Beuteerfassung und spezialisierte Giftapparate zur Betäubung der Beute.
Zusammenfassend sind Wegwespen faszinierende Insekten, die durch ihr Jagdverhalten und ihre Lebensweise gut an ihre ökologische Nische angepasst sind. Ihre Rolle als effiziente Jäger von Spinnen und anderen Insekten macht sie zu wichtigen Akteuren im natürlichen Gleichgewicht vieler Ökosysteme.
Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- ... ewa 12 mm lange Wegwespe ... Artbestimmung am Foto meist nicht sicher möglich ... sehr unstet auf der Suche nach Beute... selten eine Wespe gesehen die sich in kleinen Radien so schnell bewegt.
Artenschutz in Franken®
Nistplatzsicherung der Großen Wiesenameise

Große Wiesenameise (Formica pratensis) - Nistplatzoptimierung
12/13.08.2024
Widmen wir uns jedoch erst einmal der Beschreibung der Großen Wiesenameise:
12/13.08.2024
- Die Große Wiesenameise (Formica pratensis) ist eine auffällige und sehr bedeutende Ameisenart, die in Europa weit (noch) verbreitet ist. Hier haben wir weitere Details über diese prägnante Art sowie Möglichkeiten, sie intensiv zu schützen zusammengestellt.
Widmen wir uns jedoch erst einmal der Beschreibung der Großen Wiesenameise:
Aussehen:
Die Große Wiesenameise hat eine Körperlänge von etwa 4-9 mm. Sie ist durch ihre rot-schwarze Färbung recht gut zu erkennen. Der Kopf und das Hinterteil (Gaster) sind schwarz, während der mittlere Teil des Körpers (Thorax) rot ist.
Lebensraum:
Diese Ameisen bevorzugen in der Regel offene, sonnige Habitate wie Wiesen, Waldränder und Lichtungen. Sie bauen normalerweise große Hügelnester aus Erde und auch verschiedenem Pflanzenmaterial.
Verhalten:
Sie sind territorial und verteidigen ihr Nest recht aggressiv. Die Große Wiesenameise ist eine prioritäre Art für das uns umfassende Ökosystem, da sie untre anderem zur Belüftung des Bodens beiträgt und als natürlicher Beutegreifer von „Schädlingen“ dient.
Nun möchten wir einige Schutzmaßnahmen aufzeigen.
Um die Große Wiesenameise effektiv zu schützen, sind verschiedene Maßnahmen notwendig, die sowohl temporär als auch intensiv sein können. Hier haben wir einige Optionen/ Möglichkeiten zusammengeführt:
Erhalt und Pflege der Lebensräume:
Schaffung neuer Lebensräume:
Monitoring und Forschung:
Sensibilisierung und Bildung:
Bedeutung für die Biodiversität
Die Große Wiesenameise spielt eine wichtige Rolle im Ökosystem. Sie trägt konkret zur Biodiversität bei, indem sie:
Durch diese vielfältigen Ökosystemdienstleistungen hilft die Große Wiesenameise, die Biodiversität nachhaltig zu fördern und zu erhalten. Daher ist ihr Schutz nicht nur für die Art selbst, sondern auch für das gesamte Ökosystem in unseren Augen von großer Bedeutung.
In der Aufnahme
Die Große Wiesenameise hat eine Körperlänge von etwa 4-9 mm. Sie ist durch ihre rot-schwarze Färbung recht gut zu erkennen. Der Kopf und das Hinterteil (Gaster) sind schwarz, während der mittlere Teil des Körpers (Thorax) rot ist.
Lebensraum:
Diese Ameisen bevorzugen in der Regel offene, sonnige Habitate wie Wiesen, Waldränder und Lichtungen. Sie bauen normalerweise große Hügelnester aus Erde und auch verschiedenem Pflanzenmaterial.
Verhalten:
Sie sind territorial und verteidigen ihr Nest recht aggressiv. Die Große Wiesenameise ist eine prioritäre Art für das uns umfassende Ökosystem, da sie untre anderem zur Belüftung des Bodens beiträgt und als natürlicher Beutegreifer von „Schädlingen“ dient.
Nun möchten wir einige Schutzmaßnahmen aufzeigen.
Um die Große Wiesenameise effektiv zu schützen, sind verschiedene Maßnahmen notwendig, die sowohl temporär als auch intensiv sein können. Hier haben wir einige Optionen/ Möglichkeiten zusammengeführt:
Erhalt und Pflege der Lebensräume:
- (Intensive) Pflege von Wiesen und Waldrändern: Regelmäßiges Mähen der Wiesen in aber angemessenen Intervallen fördert das Wachstum von Pflanzen und deren Begleitarten, die für diese Ameisen auch lebenswichtig sind. Wichtig ist dabei, die Wiesen nicht zu oft zu mähen, um den Ameisen ausreichend Zeit zur Erholung zu geben.
- Temporäre Schutzmaßnahmen: Temporäre Zäune oder andere Barrieren können unter Umständen, jedoch mit großer Sorgfalt, verwendet werden, um die Nester vor menschlichen Eingriffen oder dem Weidetritt zu schützen. Die Kennzeichnung dieser Nester wird von unserer Seite präferiert um die Umwelt überhaupt erst einmal mit deren Anwesenheit zu konfrontieren.
Schaffung neuer Lebensräume:
- Biodiversität fördern: Die Schaffung von durchdachten Blühstreifen und die Aussaat von Wildblumenwiesen erhöhen die Biodiversität und bieten auch den Ameisen zusätzliche Nahrungsquellen und Nistmöglichkeiten.
- Temporäre Schutzgebiete: Temporäre Schutzgebiete können eingerichtet werden, um die Ameisenpopulationen in kritischen Zeiten, wie während der Brut- und Schwärmzeit, vor Störungen zu bewahren. Das erscheint tatsächlich von großer Bedeutung und wird von unserer Seite unterstützt.
Monitoring und Forschung:
- Intensive Forschung und Überwachung: Regelmäßige Studien zur Populationsdynamik und zur Gesundheit der Ameisenvölker helfen, Bedrohungen frühzeitig zu erkennen und Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Nicht ohne Grund bringen wir uns auch hier ein.
- Temporäre Maßnahmen zur Bedarfsanpassung: Wenn Forschungsergebnisse tatsächlich zeigen, dass bestimmte Populationen oder Nistplätze gefährdet sind, können temporär ausgewählte Maßnahmen ergriffen werden, um diese zu stabilisieren, beispielsweise durch das gezielte Anpflanzen von Nahrungspflanzen uvm.
Sensibilisierung und Bildung:
- Intensive Bildungsprogramme: Durch intensive Bildungsprogramme in Schulen, Kitas, Gemeinden etc. kann das Bewusstsein für die Bedeutung der Großen Wiesenameise und die Notwendigkeit ihres Schutzes übergreifend gestärkt werden.
- Temporäre Kampagnen: Temporäre Informationskampagnen in den Medien oder vor Ort in den betroffenen Gebieten können kurzfristig viel Aufmerksamkeit erzeugen und so zum Schutz beitragen. Jedoch gilt es hier immer abzuwägen was Sinn macht oder was lieber zu unterlassen ist.
Bedeutung für die Biodiversität
Die Große Wiesenameise spielt eine wichtige Rolle im Ökosystem. Sie trägt konkret zur Biodiversität bei, indem sie:
- Als Prädator von „Schädlingen“ und anderen Insekten dient.
- Samen verbreitet und somit zur konkreten Pflanzenausbreitung beiträgt.
Durch diese vielfältigen Ökosystemdienstleistungen hilft die Große Wiesenameise, die Biodiversität nachhaltig zu fördern und zu erhalten. Daher ist ihr Schutz nicht nur für die Art selbst, sondern auch für das gesamte Ökosystem in unseren Augen von großer Bedeutung.
In der Aufnahme
- ... mehr und mehr Nistplätze der Großen Wiesenameisennester gehen hier bei uns auch in Bayern "verloren" ... Die Große Wiesenameise und ihre Nester sind in Deutschland besonders geschützt (BArtSchV), die Art steht ferner auf der Vorwarnliste bedrohter Arten, in Bayern wird sie im Status "Gefährdet" geführt. Die industriell geführte Landbewirtschaftung spielt dabei in unseren Augen eine mit entscheidende Rolle. Da vielfach im "Hygienewahn" auch die Randstreifen der Felder (die häufig den Landwirten gar nicht gehören und der Allgemeinkeit, da kommunaler Besitz, zugeordnet werden) mit abgemulcht werden, zerstören diese Maßnahmen eine im Bestand zunehmend gefährdete Art!
Artenschutz in Franken®
Die Rötelschwalbe (Cecropis daurica)

Ich bin die Rötelschwalbe
11/12.08.2024
Wenn du mich in der Luft siehst, dann erkennst du mich vielleicht an meinen langen, tief gegabelten Schwanzfedern, die mein Flugbild so charakteristisch machen. Aber lass mich dir mehr über mich erzählen, aus meiner Sicht und mit ein paar fachlichen Details.
11/12.08.2024
- Ich bin eine stolze Schwalbe, die sich durch meinen eleganten Flug, meine auffälligen Farben und meinen Lebensstil von anderen Vögeln unterscheidet.
Wenn du mich in der Luft siehst, dann erkennst du mich vielleicht an meinen langen, tief gegabelten Schwanzfedern, die mein Flugbild so charakteristisch machen. Aber lass mich dir mehr über mich erzählen, aus meiner Sicht und mit ein paar fachlichen Details.
Meine Erscheinung
Ich bin etwas größer als meine Verwandte, die Mehlschwalbe (Delichon urbicum), aber kleiner als die Rauchschwalbe (Hirundo rustica). Mein Gefieder ist auf dem Rücken glänzend blauschwarz, während meine Unterseite in einem warmen, rostbraunen Ton leuchtet. Besonders stolz bin ich auf meinen rostfarbenen Nackenkragen, der mir auch meinen Namen „Rötelschwalbe“ eingebracht hat.
Mein Lebensraum und Verbreitung
Ursprünglich stamme ich aus Asien, aber ich habe meine Flügel weit ausgebreitet und bin inzwischen auch in Europa und Afrika heimisch. Besonders gerne mag ich warme, offene Landschaften wie steinige Hügel, Felshänge und manchmal sogar menschliche Siedlungen. Wenn du genau hinsiehst, entdeckst du mein Nest oft unter Brücken, an Felsen oder in verlassenen Gebäuden.
Mein Nestbau
Wenn ich ein Nest baue, wähle ich den Ort sorgfältig aus. Mein Nest ist ein wahres Meisterwerk aus Lehm und Schlamm, den ich sorgfältig mit Speichel mische, um eine stabile Struktur zu schaffen. Im Gegensatz zu anderen Schwalben baue ich es oft an geschützten Stellen wie in Höhlen oder unter Vorsprüngen. Das Innere meines Nests polstere ich mit weichen Materialien aus, um es gemütlich für meine Jungen zu machen.
Ernährung und Jagdverhalten
Ich bin ein Insektenfresser, und mein Tag ist erfüllt von der Jagd nach Fluginsekten. Mit meinen schnellen, wendigen Flugmanövern fange ich Fliegen, Mücken und andere kleine Insekten direkt aus der Luft. Mein scharfer Schnabel und meine großen Augen helfen mir dabei, auch die kleinsten Beutetiere zu erspähen und im Flug zu erbeuten. Ich fliege oft in großen Höhen, aber auch knapp über dem Boden, wo ich die Insekten aus dem Gras aufscheuche.
Mein Verhalten und Sozialleben
Ich bin ein sozialer Vogel, und obwohl ich oft mit meiner Familie oder in kleinen Gruppen unterwegs bin, schätze ich auch die Gesellschaft anderer Schwalbenarten. Wir leben oft in Kolonien zusammen, wo wir unsere Nester dicht nebeneinander bauen und gemeinsam unsere Jungen aufziehen. Während der Brutzeit bin ich besonders wachsam und beschütze mein Nest und meine Jungen vehement vor Eindringlingen.
Meine Wanderungen
Wie viele meiner Verwandten bin auch ich ein Zugvogel. Im Herbst verlasse ich meine Brutgebiete in Europa und fliege in den Süden nach Afrika, wo ich den Winter verbringe. Im Frühjahr kehre ich dann wieder zurück, um zu brüten und meine Jungen großzuziehen. Diese langen Wanderungen sind anstrengend, aber mein Körper ist perfekt an diese Herausforderung angepasst. Ich habe starke Flügel und einen außergewöhnlichen Orientierungssinn, der mich immer wieder sicher zu meinem Brutplatz führt.
Mein Beitrag zum Ökosystem
Ich spiele eine wichtige Rolle im Ökosystem. Durch das Fressen von Insekten helfe ich, die Populationen von Schädlingen zu kontrollieren. In menschlichen Siedlungen trage ich dazu bei, die Anzahl der Fliegen und Mücken zu reduzieren, was sowohl für Menschen als auch für Tiere von Vorteil ist. Darüber hinaus bin ich ein Indikator für die Gesundheit meines Lebensraums: Geht es mir gut, bedeutet das, dass die Umwelt intakt ist.
Meine Herausforderungen
Trotz meiner Anpassungsfähigkeit stehe ich vor Herausforderungen. Der Verlust von geeigneten Lebensräumen, Pestizide, die meine Nahrungsquellen vergiften, und der Klimawandel, der meine Wanderungsrouten beeinflusst, setzen mir zu. Doch ich bin ein Überlebenskünstler, und mit deiner Hilfe – indem du meinen Lebensraum schützt und auf chemische Pestizide verzichtest – habe ich eine gute Chance, weiterhin durch die Lüfte zu fliegen und meine Lieder in die Welt zu tragen.
Das bin ich, die Rötelschwalbe, eine kleine, aber bedeutende Bewohnerin unserer Erde. Ich lade dich ein, mich zu beobachten und mehr über mein Leben zu lernen – und vielleicht kannst du auch ein wenig dazu beitragen, dass mein Lebensraum erhalten bleibt.
Aufnahme aus 2024 von Helga Zinnecker
Ich bin etwas größer als meine Verwandte, die Mehlschwalbe (Delichon urbicum), aber kleiner als die Rauchschwalbe (Hirundo rustica). Mein Gefieder ist auf dem Rücken glänzend blauschwarz, während meine Unterseite in einem warmen, rostbraunen Ton leuchtet. Besonders stolz bin ich auf meinen rostfarbenen Nackenkragen, der mir auch meinen Namen „Rötelschwalbe“ eingebracht hat.
Mein Lebensraum und Verbreitung
Ursprünglich stamme ich aus Asien, aber ich habe meine Flügel weit ausgebreitet und bin inzwischen auch in Europa und Afrika heimisch. Besonders gerne mag ich warme, offene Landschaften wie steinige Hügel, Felshänge und manchmal sogar menschliche Siedlungen. Wenn du genau hinsiehst, entdeckst du mein Nest oft unter Brücken, an Felsen oder in verlassenen Gebäuden.
Mein Nestbau
Wenn ich ein Nest baue, wähle ich den Ort sorgfältig aus. Mein Nest ist ein wahres Meisterwerk aus Lehm und Schlamm, den ich sorgfältig mit Speichel mische, um eine stabile Struktur zu schaffen. Im Gegensatz zu anderen Schwalben baue ich es oft an geschützten Stellen wie in Höhlen oder unter Vorsprüngen. Das Innere meines Nests polstere ich mit weichen Materialien aus, um es gemütlich für meine Jungen zu machen.
Ernährung und Jagdverhalten
Ich bin ein Insektenfresser, und mein Tag ist erfüllt von der Jagd nach Fluginsekten. Mit meinen schnellen, wendigen Flugmanövern fange ich Fliegen, Mücken und andere kleine Insekten direkt aus der Luft. Mein scharfer Schnabel und meine großen Augen helfen mir dabei, auch die kleinsten Beutetiere zu erspähen und im Flug zu erbeuten. Ich fliege oft in großen Höhen, aber auch knapp über dem Boden, wo ich die Insekten aus dem Gras aufscheuche.
Mein Verhalten und Sozialleben
Ich bin ein sozialer Vogel, und obwohl ich oft mit meiner Familie oder in kleinen Gruppen unterwegs bin, schätze ich auch die Gesellschaft anderer Schwalbenarten. Wir leben oft in Kolonien zusammen, wo wir unsere Nester dicht nebeneinander bauen und gemeinsam unsere Jungen aufziehen. Während der Brutzeit bin ich besonders wachsam und beschütze mein Nest und meine Jungen vehement vor Eindringlingen.
Meine Wanderungen
Wie viele meiner Verwandten bin auch ich ein Zugvogel. Im Herbst verlasse ich meine Brutgebiete in Europa und fliege in den Süden nach Afrika, wo ich den Winter verbringe. Im Frühjahr kehre ich dann wieder zurück, um zu brüten und meine Jungen großzuziehen. Diese langen Wanderungen sind anstrengend, aber mein Körper ist perfekt an diese Herausforderung angepasst. Ich habe starke Flügel und einen außergewöhnlichen Orientierungssinn, der mich immer wieder sicher zu meinem Brutplatz führt.
Mein Beitrag zum Ökosystem
Ich spiele eine wichtige Rolle im Ökosystem. Durch das Fressen von Insekten helfe ich, die Populationen von Schädlingen zu kontrollieren. In menschlichen Siedlungen trage ich dazu bei, die Anzahl der Fliegen und Mücken zu reduzieren, was sowohl für Menschen als auch für Tiere von Vorteil ist. Darüber hinaus bin ich ein Indikator für die Gesundheit meines Lebensraums: Geht es mir gut, bedeutet das, dass die Umwelt intakt ist.
Meine Herausforderungen
Trotz meiner Anpassungsfähigkeit stehe ich vor Herausforderungen. Der Verlust von geeigneten Lebensräumen, Pestizide, die meine Nahrungsquellen vergiften, und der Klimawandel, der meine Wanderungsrouten beeinflusst, setzen mir zu. Doch ich bin ein Überlebenskünstler, und mit deiner Hilfe – indem du meinen Lebensraum schützt und auf chemische Pestizide verzichtest – habe ich eine gute Chance, weiterhin durch die Lüfte zu fliegen und meine Lieder in die Welt zu tragen.
Das bin ich, die Rötelschwalbe, eine kleine, aber bedeutende Bewohnerin unserer Erde. Ich lade dich ein, mich zu beobachten und mehr über mein Leben zu lernen – und vielleicht kannst du auch ein wenig dazu beitragen, dass mein Lebensraum erhalten bleibt.
Aufnahme aus 2024 von Helga Zinnecker
Artenschutz in Franken®
Stele der Biodiversität® - Burgwindheim / Kötsch

Stele der Biodiversität® - Burgwindheim / Kötsch
11/12.08.2024
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das vom Markt Burgwindheim, dem Bayernwerk der Deutschen Postcode Lotterie und der Steuerkanzlei Bauerfeind unterstützt wird.
Kötsch / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen.
Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
11/12.08.2024
- Einbringung der Sekundärhabitate ist fast abgeschlossen.
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das vom Markt Burgwindheim, dem Bayernwerk der Deutschen Postcode Lotterie und der Steuerkanzlei Bauerfeind unterstützt wird.
Kötsch / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen.
Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
Denn wenn (selbst in noch geeigneten Nahrungsstrukturen) keine geeigneten Reproduktionsräume vorhanden sind, ist die Erhaltung der Artenvielfalt gelichfalls zum Scheitern verurteilt.
Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das vom Markt Burgwindheim, dem Bayernwerk der Deutschen Postcode Lotterie und der Steuerkanzlei Bauerfeind unterstützt wird, setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.
In der Aufnahme
Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das vom Markt Burgwindheim, dem Bayernwerk der Deutschen Postcode Lotterie und der Steuerkanzlei Bauerfeind unterstützt wird, setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.
In der Aufnahme
- Impression vom 03.08.2024
Artenschutz in Franken®
Der Teichfrosch (Pelophylax kl. esculentus)

Der Teichfrosch (Pelophylax kl. esculentus) ist eine Hybridart, die aus der Kreuzung des Wasserfrosches (Pelophylax lessonae) und des Seefrosches (Pelophylax ridibundus) entstanden ist.
10/11.08.2024
10/11.08.2024
- Hier ist eine Darstellung des Lebens und Verhaltens des Teichfrosches aus seiner eigenen Sicht, mit fachlichen Komponenten eingebunden:
Lebenszyklus und Verhalten aus der Sicht des Teichfrosches
Geburt und Larvenstadium:
Als Teichfrosch beginne ich mein Leben als kleines Ei, das im Frühjahr in einem Gewässer abgelegt wird. Meine Eltern, die selbst Hybriden sind, haben mich zusammen mit vielen anderen Eiern in einem flachen Teich oder einem langsam fließenden Gewässer abgelegt. Diese Umgebung bietet mir Schutz vor Fressfeinden und optimale Bedingungen für meine Entwicklung.Sobald ich aus dem Ei schlüpfe, beginne ich mein Leben als Kaulquappe. In diesem Stadium bin ich vollständig aquatisch und atme durch Kiemen. Meine Ernährung besteht hauptsächlich aus Algen und kleinen organischen Partikeln, die ich im Wasser finde. Meine Entwicklung verläuft über mehrere Wochen, während der ich durch Metamorphose verschiedene Stadien durchlaufe: Ich entwickle Hinterbeine, dann Vorderbeine, und schließlich verwandeln sich meine Kiemen in Lungen, sodass ich an Land atmen kann.
Jugend- und Erwachsenenstadium:
Als ich meine Metamorphose abgeschlossen habe, verlasse ich das Wasser und beginne mein Leben als junger Frosch an Land. Nun bin ich ein Fleischfresser und ernähre mich von Insekten, Spinnen und anderen kleinen Wirbellosen, die ich mit meiner klebrigen Zunge fange.Während ich wachse, entwickle ich eine grüne bis bräunliche Färbung mit schwarzen Flecken, die mir hilft, mich in meiner Umgebung zu tarnen. Mein Körperbau ist schlank und meine Hinterbeine sind stark, was mir erlaubt, weit zu springen und schnell zu schwimmen.
Fortpflanzung:
Im Frühjahr, wenn die Temperaturen steigen und die Tage länger werden, kehre ich zum Wasser zurück, um mich fortzupflanzen. Ich singe laut, um Weibchen anzulocken. Mein Ruf, ein lautes Quaken, dient dazu, meine Anwesenheit zu verkünden und Rivalen fernzuhalten. Weibchen, die von meinen Rufen angezogen werden, nähern sich mir, und wir paaren uns im Wasser. Während der Paarung halte ich das Weibchen in der sogenannten "Amplexus"-Position, bei der ich sie mit meinen Vorderbeinen umklammere. Sie legt ihre Eier ins Wasser, und ich befruchte sie extern. Nach der Eiablage kehren wir beide ins Wasser zurück, um unsere Eier zu bewachen und Fressfeinde abzuschrecken.
Ökologische und genetische Aspekte:
Als Teichfrosch bin ich ein Hybrid, was bedeutet, dass ich genetische Merkmale sowohl vom Wasserfrosch als auch vom Seefrosch in mir trage. Diese Hybridisierung verleiht mir bestimmte Vorteile, wie eine größere Anpassungsfähigkeit an verschiedene Umweltbedingungen. Allerdings gibt es auch Herausforderungen, da meine Nachkommen nicht immer fertile Nachkommen hervorbringen können. Dies ist ein Phänomen, das als "Hybridsterilität" bekannt ist und bedeutet, dass einige meiner Nachkommen nicht in der Lage sind, sich weiter fortzupflanzen.
Umwelt und Ökologie:
Ich bevorzuge warme, sonnige Plätze am Rand von Teichen, Seen und langsam fließenden Gewässern. Diese Habitate bieten mir nicht nur Nahrung und Schutz, sondern auch geeignete Orte für die Fortpflanzung. Meine Anwesenheit in einem Ökosystem ist ein Indikator für gute Wasserqualität, da ich empfindlich auf Umweltverschmutzung reagiere. Durch meine Aktivitäten trage ich zur Kontrolle von Insektenpopulationen bei und diene gleichzeitig als Beute für größere Tiere wie Vögel und Schlangen. Dadurch spiele ich eine wichtige Rolle im Nahrungskreislauf meines Ökosystems.
Zusammengefasst lebe ich als Teichfrosch ein komplexes Leben, das eng mit meinem aquatischen und terrestrischen Lebensraum verbunden ist. Meine hybriden Ursprünge verleihen mir besondere Anpassungsfähigkeiten, aber auch spezifische Herausforderungen, die mein Überleben und meine Fortpflanzung beeinflussen.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
Geburt und Larvenstadium:
Als Teichfrosch beginne ich mein Leben als kleines Ei, das im Frühjahr in einem Gewässer abgelegt wird. Meine Eltern, die selbst Hybriden sind, haben mich zusammen mit vielen anderen Eiern in einem flachen Teich oder einem langsam fließenden Gewässer abgelegt. Diese Umgebung bietet mir Schutz vor Fressfeinden und optimale Bedingungen für meine Entwicklung.Sobald ich aus dem Ei schlüpfe, beginne ich mein Leben als Kaulquappe. In diesem Stadium bin ich vollständig aquatisch und atme durch Kiemen. Meine Ernährung besteht hauptsächlich aus Algen und kleinen organischen Partikeln, die ich im Wasser finde. Meine Entwicklung verläuft über mehrere Wochen, während der ich durch Metamorphose verschiedene Stadien durchlaufe: Ich entwickle Hinterbeine, dann Vorderbeine, und schließlich verwandeln sich meine Kiemen in Lungen, sodass ich an Land atmen kann.
Jugend- und Erwachsenenstadium:
Als ich meine Metamorphose abgeschlossen habe, verlasse ich das Wasser und beginne mein Leben als junger Frosch an Land. Nun bin ich ein Fleischfresser und ernähre mich von Insekten, Spinnen und anderen kleinen Wirbellosen, die ich mit meiner klebrigen Zunge fange.Während ich wachse, entwickle ich eine grüne bis bräunliche Färbung mit schwarzen Flecken, die mir hilft, mich in meiner Umgebung zu tarnen. Mein Körperbau ist schlank und meine Hinterbeine sind stark, was mir erlaubt, weit zu springen und schnell zu schwimmen.
Fortpflanzung:
Im Frühjahr, wenn die Temperaturen steigen und die Tage länger werden, kehre ich zum Wasser zurück, um mich fortzupflanzen. Ich singe laut, um Weibchen anzulocken. Mein Ruf, ein lautes Quaken, dient dazu, meine Anwesenheit zu verkünden und Rivalen fernzuhalten. Weibchen, die von meinen Rufen angezogen werden, nähern sich mir, und wir paaren uns im Wasser. Während der Paarung halte ich das Weibchen in der sogenannten "Amplexus"-Position, bei der ich sie mit meinen Vorderbeinen umklammere. Sie legt ihre Eier ins Wasser, und ich befruchte sie extern. Nach der Eiablage kehren wir beide ins Wasser zurück, um unsere Eier zu bewachen und Fressfeinde abzuschrecken.
Ökologische und genetische Aspekte:
Als Teichfrosch bin ich ein Hybrid, was bedeutet, dass ich genetische Merkmale sowohl vom Wasserfrosch als auch vom Seefrosch in mir trage. Diese Hybridisierung verleiht mir bestimmte Vorteile, wie eine größere Anpassungsfähigkeit an verschiedene Umweltbedingungen. Allerdings gibt es auch Herausforderungen, da meine Nachkommen nicht immer fertile Nachkommen hervorbringen können. Dies ist ein Phänomen, das als "Hybridsterilität" bekannt ist und bedeutet, dass einige meiner Nachkommen nicht in der Lage sind, sich weiter fortzupflanzen.
Umwelt und Ökologie:
Ich bevorzuge warme, sonnige Plätze am Rand von Teichen, Seen und langsam fließenden Gewässern. Diese Habitate bieten mir nicht nur Nahrung und Schutz, sondern auch geeignete Orte für die Fortpflanzung. Meine Anwesenheit in einem Ökosystem ist ein Indikator für gute Wasserqualität, da ich empfindlich auf Umweltverschmutzung reagiere. Durch meine Aktivitäten trage ich zur Kontrolle von Insektenpopulationen bei und diene gleichzeitig als Beute für größere Tiere wie Vögel und Schlangen. Dadurch spiele ich eine wichtige Rolle im Nahrungskreislauf meines Ökosystems.
Zusammengefasst lebe ich als Teichfrosch ein komplexes Leben, das eng mit meinem aquatischen und terrestrischen Lebensraum verbunden ist. Meine hybriden Ursprünge verleihen mir besondere Anpassungsfähigkeiten, aber auch spezifische Herausforderungen, die mein Überleben und meine Fortpflanzung beeinflussen.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
- Wasserfrösche erreichen bei den Männchen bis etwa 9cm und bei den Weibchen bis etwa 11 cm Körperlänge.Oberseitig grün oder grüngrau oft mit undeutlichem schwarzen Fleckenmuster, Unterseitig häufig grauweiß dabei leicht gefleckt. Der Teichfrosch ist ein Hybrid also eine Kreuzung zwischen Arten. ( Seefrosch und kleiner Wasserfrosch ) Im Mai ist der Teichfrosch häufig in großer Zahl an ( Flach )- Gewässern anzutreffen wo er seine Laichballen in warme Sektoren absetzt.
Artenschutz in Franken®
Der Rallenreiher (Ardeola ralloides)

Rallenreiher (Ardeola ralloides)
10/11.08.2024
Ich gehöre zur Familie der Reiher und bin ein mittelgroßer Watvogel, der in verschiedenen Lebensräumen wie Feuchtgebieten, Sümpfen und Seen anzutreffen ist. Mein wissenschaftlicher Name, Ardeola ralloides, leitet sich von meiner Ähnlichkeit zu anderen Arten der Gattung Ardeola ab, obwohl ich mich durch einige spezifische Merkmale unterscheide.
10/11.08.2024
- Als Rallenreiher, auch bekannt als Ardeola ralloides, kann ich dir aus meiner Sicht einiges über meine Art erzählen.
Ich gehöre zur Familie der Reiher und bin ein mittelgroßer Watvogel, der in verschiedenen Lebensräumen wie Feuchtgebieten, Sümpfen und Seen anzutreffen ist. Mein wissenschaftlicher Name, Ardeola ralloides, leitet sich von meiner Ähnlichkeit zu anderen Arten der Gattung Ardeola ab, obwohl ich mich durch einige spezifische Merkmale unterscheide.
Meine Körperlänge beträgt normalerweise zwischen 45 und 50 Zentimetern. Ich habe eine schlanke Statur mit langen Beinen, die mir helfen, im flachen Wasser nach Nahrung zu suchen. Meine Flügelspannweite liegt typischerweise zwischen 80 und 100 Zentimetern. Mein Gefieder ist meistens weiß, während meine Kopf- und Halspartie im Brutkleid auffällig kastanienbraun gefärbt ist. Außerhalb der Brutzeit verblasst diese Färbung jedoch deutlich.
In Bezug auf mein Verhalten bin ich ein geschickter Jäger. Ich ernähre mich hauptsächlich von kleinen Fischen, Amphibien, Insekten und anderen Wassertieren, die ich mit einem schnellen Schnabelstich fange. Meine Jagdtechnik ist oft eine geduldige und langsame Annäherung an Beute, gefolgt von einem blitzschnellen Stoß.
Im Laufe eines Jahres ziehe ich häufig zwischen meinen Brutgebieten im südlichen Europa, Nordafrika und Westasien und meinen Überwinterungsgebieten in tropischen und subtropischen Regionen Afrikas hin und her. Mein Zugverhalten ist an die Verfügbarkeit von Nahrung und geeigneten Brutplätzen gebunden.
In Bezug auf meinen Lebensraum bevorzuge ich flache Gewässer mit reichlichem Bewuchs oder wenigstens Strukturen, die mir als Jagdplätze dienen können. Ich bin oft in Gesellschaft anderer Wasservögel anzutreffen, insbesondere während der Brutzeit, wenn wir in Kolonien nisten.
Mein Fortpflanzungsverhalten ist ebenfalls interessant. Während der Brutzeit baue ich gemeinsam mit meiner Partnerin ein einfaches Nest aus Zweigen und Pflanzenresten in Bäumen oder Büschen über oder in der Nähe des Wassers. Dort legen wir zwei bis vier Eier, die beide Eltern abwechselnd bebrüten und später die Jungen gemeinsam aufziehen.
Insgesamt bin ich als Rallenreiher eine faszinierende Vogelart, die durch ihre Anpassungsfähigkeit an verschiedene Lebensräume und ihre eleganten Jagdtechniken gekennzeichnet ist. Mein Überleben und Wohlbefinden hängen stark von intakten Feuchtgebieten und einem ausreichenden Nahrungsangebot ab, weshalb der Schutz meiner Lebensräume von großer Bedeutung ist.
In der Aufnahme von Helga Zinnecker
In Bezug auf mein Verhalten bin ich ein geschickter Jäger. Ich ernähre mich hauptsächlich von kleinen Fischen, Amphibien, Insekten und anderen Wassertieren, die ich mit einem schnellen Schnabelstich fange. Meine Jagdtechnik ist oft eine geduldige und langsame Annäherung an Beute, gefolgt von einem blitzschnellen Stoß.
Im Laufe eines Jahres ziehe ich häufig zwischen meinen Brutgebieten im südlichen Europa, Nordafrika und Westasien und meinen Überwinterungsgebieten in tropischen und subtropischen Regionen Afrikas hin und her. Mein Zugverhalten ist an die Verfügbarkeit von Nahrung und geeigneten Brutplätzen gebunden.
In Bezug auf meinen Lebensraum bevorzuge ich flache Gewässer mit reichlichem Bewuchs oder wenigstens Strukturen, die mir als Jagdplätze dienen können. Ich bin oft in Gesellschaft anderer Wasservögel anzutreffen, insbesondere während der Brutzeit, wenn wir in Kolonien nisten.
Mein Fortpflanzungsverhalten ist ebenfalls interessant. Während der Brutzeit baue ich gemeinsam mit meiner Partnerin ein einfaches Nest aus Zweigen und Pflanzenresten in Bäumen oder Büschen über oder in der Nähe des Wassers. Dort legen wir zwei bis vier Eier, die beide Eltern abwechselnd bebrüten und später die Jungen gemeinsam aufziehen.
Insgesamt bin ich als Rallenreiher eine faszinierende Vogelart, die durch ihre Anpassungsfähigkeit an verschiedene Lebensräume und ihre eleganten Jagdtechniken gekennzeichnet ist. Mein Überleben und Wohlbefinden hängen stark von intakten Feuchtgebieten und einem ausreichenden Nahrungsangebot ab, weshalb der Schutz meiner Lebensräume von großer Bedeutung ist.
In der Aufnahme von Helga Zinnecker
- Rallenreiher (Ardeola ralloides)
Artenschutz in Franken®
Paarung der Azurjungfern

Paarung der Azurjungfern
09/10.08.2024
Paarung
Die Paarung der Azurjungfern ist ein komplexer Prozess, der mehrere Schritte umfasst:
09/10.08.2024
- Die Azurjungfern (Coenagrion) sind eine Gattung von Kleinlibellen, die zur Familie der Schlanklibellen (Coenagrionidae) gehören. Ihre Fortpflanzungsstrategien zeigen interessante Verhaltensweisen, die typisch für Libellen sind und stark mit ihrem aquatischen Lebensraum verbunden sind.
Paarung
Die Paarung der Azurjungfern ist ein komplexer Prozess, der mehrere Schritte umfasst:
- Balz: Männliche Azurjungfern beginnen oft mit einer Balzflugsequenz, bei der sie um ein Weibchen herum fliegen und verschiedene Flugmanöver zeigen, um ihre Fitness zu demonstrieren. Dieser Balzflug dient auch dazu, andere Männchen von der Nähe des Weibchens fernzuhalten.
- Griff und Kopulation: Nach erfolgreicher Balz greift das Männchen das Weibchen mit seinen Genitalien, die als "Hamulus" bezeichnet werden. Dies geschieht im sogenannten "Kopulationsrad", bei dem das Weibchen ihren Hinterleib nach vorne biegt, um die Spermatophore des Männchens aufzunehmen.
- Spermaübertragung: Während der Kopulation überträgt das Männchen Sperma in das Weibchen. Die Spermatophore, die im männlichen Genitaltrakt gebildet wird, enthält das Sperma und wird während der Paarung übergeben.
Eiablage
Die Eiwablage der Azurjungfern ist eng mit ihrem aquatischen Lebenszyklus verbunden:
- Suche nach einem geeigneten Gewässer: Nach der Paarung suchen die Weibchen aktiv nach einem geeigneten Gewässer, um ihre Eier abzulegen. Sie bevorzugen flache, stehende oder langsam fließende Gewässer wie Teiche, Tümpel oder langsam fließende Bäche.
- Eiablage: Das Weibchen verwendet einen speziellen, messerartigen Legeapparat, um ihre Eier in Pflanzenstängel oder andere strukturelle Elemente unter Wasser zu legen. Dabei platziert sie die Eier häufig nahe der Wasseroberfläche, damit die Larven, die als Nymphen bekannt sind, nach dem Schlüpfen leicht Zugang zur Oberfläche haben.
- Schlupf der Larven: Die Eier entwickeln sich zu Larven, die im Wasser leben. Diese Larven durchlaufen mehrere Häutungen, bevor sie sich schließlich verpuppen und als ausgewachsene Libellen aus dem Wasser schlüpfen.
Fachliche Komponenten
- Reproduktionsverhalten: Das Paarungsverhalten der Azurjungfern ist ein Beispiel für sexuelle Selektion und Anpassung an aquatische Lebensräume.
- Anatomie und Physiologie: Die Anatomie der Genitalien, insbesondere der Hamulus beim männlichen Geschlecht, ist speziell angepasst, um die Kopulation zu erleichtern und das Sperma zu übertragen.
- Ökologische Anpassungen: Die Wahl des Eiablageortes zeigt die Anpassung der Azurjungfern an aquatische Ökosysteme und ihre Abhängigkeit von spezifischen Habitaten für die Fortpflanzung und Entwicklung.
Zusammengefasst zeigen die Fortpflanzungsstrategien der Azurjungfern sowohl evolutionäre Anpassungen als auch komplexe Verhaltensweisen, die ihre Überlebensfähigkeit in aquatischen Umgebungen unterstützen.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
- Paarung / Eiablage der Azurjungfer
Artenschutz in Franken®
Erstmals Tonerdhummel-Königin in Deutschland nachgewiesen

Erstmals Tonerdhummel-Königin in Deutschland nachgewiesen
09/10.08.2024
Eine Königin hat nun offensichtlich den Sprung über die Alpen geschafft. Ob sich die auffällige Hummelart dauerhaft in Deutschland ansiedelt, müssen weitere Studien zeigen.
09/10.08.2024
- Bisher waren die Alpen eine natürliche Barriere für die Wildbienenart Bombus argillaceus aus dem südlichen Europa.
Eine Königin hat nun offensichtlich den Sprung über die Alpen geschafft. Ob sich die auffällige Hummelart dauerhaft in Deutschland ansiedelt, müssen weitere Studien zeigen.
Wissenschaftlicher Erfolg für das Citizen-Science-Projekt Hummel-Challenge: Während der bundesweiten Challenge wurde erstmals eine Tonerdhummel (Bombus argillaceus) in Deutschland nachgewiesen. Der BUND Naturschutz in Bayern und das Thünen-Institut hatten auch in diesem Jahr gemeinsam bundesweit dazu aufgerufen, Hummeln über die kostenlose Bestimmungs-App ObsIdentify zu melden.
Die Tonerdhummel ist eine wärmeliebende Hummelart. Das bisherige Verbreitungsgebiet der Tonerdhummel erstreckt sich über die Mittelmeerländer und Schwarzmeeranrainerstaaten wie der Ukraine bis hin zum Iran. Bereits seit längerem wurde aufgrund von Sichtungen in den Nachbarländern Österreich und Schweiz vermutet, dass die Tonerdhummel den Sprung über die Alpen nach Deutschland machen könnte.
Veränderte Verbreitungsgebiete können ein Hinweis auf die Folgen des Klimawandels sein
„Die Entdeckung könnte auf eine Veränderung des Verbreitungsgebietes über die Alpen hinweisen. Das Gebirge ist für viele Arten eine natürliche Barriere. Dauerhafte Zuwanderungen von Arten aus wärmeren Regionen können mit dem Klimawandel in Zusammenhang stehen“, erklärt Dr. Sophie Ogan, Projektverantwortliche am Thünen-Institut. Obwohl der Nachweis der Tonerdhummel-Königin ein erster Hinweis auf eine mögliche Ausbreitung ist, bleibt abzuwarten, ob sich die Art dauerhaft in Deutschland etabliert. „Entwicklungstrends von Populationen lassen sich erst anhand langfristiger Daten erkennen, die über einen Zeitraum von mehreren Jahren oder Jahrzehnten erhoben werden“, erläutert Ogan.
Erstmeldung im Rahmen der bundesweiten Hummel-Challenge
Die Königin wurde von Thomas Guggemoos, langjähriges BN-Mitglied, im Rahmen der Hummel-Challenge in Ohlstadt im oberbayerischen Landkreis Garmisch-Partenkirchen fotografiert. Bombus argillaceus zeichnet sich durch zwei auffällig gelbe Querbinden auf dem Thorax und ein vollständig schwarzes Abdomen (Hinterleib) bei den Königinnen aus. Diese Eigenschaften unterscheiden sich deutlich von den Merkmalen ähnlicher Arten wie der Garten-, Feld- oder Unterirdischen Hummel.
„Dass durch die Hummel-Challenge 2024 ein Erstnachweis der Tonerdhummel-Königin gelungen ist, zeigt einmal mehr die Relevanz von Citizen-Science-Projekten für die Wissenschaft. Die Wahrscheinlichkeit für solche Funde erhöht sich, je mehr Menschen mitmachen. Deshalb freuen wir uns, dass bei der Hummel-Challenge im Sommer dieses Jahr etwa 3.500 Teilnehmer*innen Hummeln gemeldet haben“, sagt Martina Gehret, Projektverantwortliche des BUND Naturschutz.
Nun gilt herauszufinden, ob es sich um einen Einzelfund handelt oder es weitere, bisher nicht publizierte Meldungen der Tonerdhummel in Deutschland gibt. Eine wissenschaftliche Publikation zum Erstnachweis ist derzeit in Arbeit und wird in Kürze in der "Ampulex" (www.ampulex.de) erscheinen.
Zum Hintergrund: Citizen-Science-Projekt Hummel-Challenge
Die Hummel-Challenge ist ein Gemeinschaftsprojekt des Thünen Instituts, Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald und Fischerei, dem BUND Naturschutz in Bayern (BN) und Observation.org. Sie findet jährlich im Frühjahr und im Sommer statt. Der Projektzeitraum für die Challenge im Sommer war der 20. Juni bis 3. Juli 2024. Zusammen wollen die Partner ein Bewusstsein für Hummeln schaffen und mehr über Verbreitung und Vorkommen verschiedener Arten herausfinden. Mitmachen kann jede*r über die kostenlose App ObsIdentify oder über die Webseite der Naturbeobachtungsplattform Observation.org. Ziel ist es, Fotos von möglichst vielen verschiedenen Hummeln auf unterschiedlichen Pflanzen zu machen.
In der Aufnahme von Foto: ©Thomas Guggemoos
Quelle
BUND NATURSCHUTZ IN BAYERN E.V. (BN)
Dr.-Johann-Maier-Straße 4
93049 Regensburg
Stand
31.07.2024
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung.Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Die Tonerdhummel ist eine wärmeliebende Hummelart. Das bisherige Verbreitungsgebiet der Tonerdhummel erstreckt sich über die Mittelmeerländer und Schwarzmeeranrainerstaaten wie der Ukraine bis hin zum Iran. Bereits seit längerem wurde aufgrund von Sichtungen in den Nachbarländern Österreich und Schweiz vermutet, dass die Tonerdhummel den Sprung über die Alpen nach Deutschland machen könnte.
Veränderte Verbreitungsgebiete können ein Hinweis auf die Folgen des Klimawandels sein
„Die Entdeckung könnte auf eine Veränderung des Verbreitungsgebietes über die Alpen hinweisen. Das Gebirge ist für viele Arten eine natürliche Barriere. Dauerhafte Zuwanderungen von Arten aus wärmeren Regionen können mit dem Klimawandel in Zusammenhang stehen“, erklärt Dr. Sophie Ogan, Projektverantwortliche am Thünen-Institut. Obwohl der Nachweis der Tonerdhummel-Königin ein erster Hinweis auf eine mögliche Ausbreitung ist, bleibt abzuwarten, ob sich die Art dauerhaft in Deutschland etabliert. „Entwicklungstrends von Populationen lassen sich erst anhand langfristiger Daten erkennen, die über einen Zeitraum von mehreren Jahren oder Jahrzehnten erhoben werden“, erläutert Ogan.
Erstmeldung im Rahmen der bundesweiten Hummel-Challenge
Die Königin wurde von Thomas Guggemoos, langjähriges BN-Mitglied, im Rahmen der Hummel-Challenge in Ohlstadt im oberbayerischen Landkreis Garmisch-Partenkirchen fotografiert. Bombus argillaceus zeichnet sich durch zwei auffällig gelbe Querbinden auf dem Thorax und ein vollständig schwarzes Abdomen (Hinterleib) bei den Königinnen aus. Diese Eigenschaften unterscheiden sich deutlich von den Merkmalen ähnlicher Arten wie der Garten-, Feld- oder Unterirdischen Hummel.
„Dass durch die Hummel-Challenge 2024 ein Erstnachweis der Tonerdhummel-Königin gelungen ist, zeigt einmal mehr die Relevanz von Citizen-Science-Projekten für die Wissenschaft. Die Wahrscheinlichkeit für solche Funde erhöht sich, je mehr Menschen mitmachen. Deshalb freuen wir uns, dass bei der Hummel-Challenge im Sommer dieses Jahr etwa 3.500 Teilnehmer*innen Hummeln gemeldet haben“, sagt Martina Gehret, Projektverantwortliche des BUND Naturschutz.
Nun gilt herauszufinden, ob es sich um einen Einzelfund handelt oder es weitere, bisher nicht publizierte Meldungen der Tonerdhummel in Deutschland gibt. Eine wissenschaftliche Publikation zum Erstnachweis ist derzeit in Arbeit und wird in Kürze in der "Ampulex" (www.ampulex.de) erscheinen.
Zum Hintergrund: Citizen-Science-Projekt Hummel-Challenge
Die Hummel-Challenge ist ein Gemeinschaftsprojekt des Thünen Instituts, Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald und Fischerei, dem BUND Naturschutz in Bayern (BN) und Observation.org. Sie findet jährlich im Frühjahr und im Sommer statt. Der Projektzeitraum für die Challenge im Sommer war der 20. Juni bis 3. Juli 2024. Zusammen wollen die Partner ein Bewusstsein für Hummeln schaffen und mehr über Verbreitung und Vorkommen verschiedener Arten herausfinden. Mitmachen kann jede*r über die kostenlose App ObsIdentify oder über die Webseite der Naturbeobachtungsplattform Observation.org. Ziel ist es, Fotos von möglichst vielen verschiedenen Hummeln auf unterschiedlichen Pflanzen zu machen.
In der Aufnahme von Foto: ©Thomas Guggemoos
- Tonerdhummel (Bombus argillaceus)
Quelle
BUND NATURSCHUTZ IN BAYERN E.V. (BN)
Dr.-Johann-Maier-Straße 4
93049 Regensburg
Stand
31.07.2024
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung.Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Artenschutz in Franken®
Der Kleine Blaupfeil (Orthetrum coerulescens)

Kleiner Blaupfeil (Orthetrum coerulescens)
08/09.08.2024
Hallo! Ich bin ein Kleiner Blaupfeil, wissenschaftlich bekannt als Orthetrum coerulescens. Lass mich dir aus meiner Perspektive ein bisschen über mich erzählen, mit einigen fachlichen Details.
08/09.08.2024
Hallo! Ich bin ein Kleiner Blaupfeil, wissenschaftlich bekannt als Orthetrum coerulescens. Lass mich dir aus meiner Perspektive ein bisschen über mich erzählen, mit einigen fachlichen Details.
Mein Aussehen und Lebenszyklus
Ich bin eine Libelle und gehöre zur Familie der Segellibellen (Libellulidae). Meine Männchen sind leicht an ihrer bläulichen Färbung zu erkennen, während die Weibchen und die Jungtiere eine gelbbraune bis olivgrüne Farbe haben. Meine Körperlänge beträgt etwa 35 bis 40 mm, was mich zu einer relativ kleinen Libelle macht.
Ich durchlaufe mehrere Entwicklungsstadien, beginnend als Ei, das im Wasser abgelegt wird. Nach dem Schlüpfen entwickle ich mich zur Larve, die einige Monate bis zu zwei Jahre im Wasser lebt und sich von kleinen Wasserorganismen ernährt. Schließlich verlasse ich das Wasser und verwandle mich in ein flugfähiges Insekt, was man als
Metamorphose bezeichnet.
Mein Lebensraum
Ich bevorzuge sonnige, flache Gewässer wie Teiche, kleine Seen oder langsam fließende Bäche mit viel Vegetation. Diese Lebensräume bieten mir nicht nur Nahrung, sondern auch Schutz vor Fressfeinden. Die Ufervegetation ist für mich besonders wichtig, da ich dort meine Eier ablegen kann.
Mein Verhalten
Ich bin ein tagaktives Insekt und verbringe viel Zeit damit, auf Pflanzen oder Steinen zu sitzen und nach Beute Ausschau zu halten. Meine Nahrung besteht hauptsächlich aus kleineren Insekten, die ich im Flug fange. Mein Sehsinn ist hervorragend, da ich komplexe Facettenaugen habe, die mir helfen, Bewegungen und Farben wahrzunehmen.
Fortpflanzung
Während der Paarungszeit patrouilliere ich als Männchen häufig an Gewässern entlang und verteidige mein Revier gegen Rivalen. Wenn ich ein Weibchen finde, halte ich sie im Flug mit meinen speziellen Greiforganen am Hinterleib fest, und wir bilden ein Paarungsrad. Nach der Paarung legt das Weibchen ihre Eier ins Wasser, oft in der Nähe von Wasserpflanzen, wo die schlüpfenden Larven sich gut verstecken können.
Herausforderungen
Trotz meiner Anpassungsfähigkeit bin ich auf saubere und intakte Lebensräume angewiesen. Verschmutzung, Habitatverlust und Klimawandel sind Bedrohungen, die mein Überleben gefährden. Veränderungen im Wasserhaushalt und der Einsatz von Pestiziden können ebenfalls negative Auswirkungen auf meine Populationen haben.
Fazit
Als Kleiner Blaupfeil trage ich zur Gesundheit der Ökosysteme bei, in denen ich lebe, indem ich als Räuber von kleinen Insekten und als Beute für Vögel und andere Tiere diene. Meine Anwesenheit ist oft ein Zeichen für ein gesundes Gewässerökosystem.
Ich hoffe, ich konnte dir einen guten Einblick in mein Leben und meine Bedeutung in der Natur geben. Danke, dass du dich für mich interessierst!
Aufnahme von Klaus Sanwald
Ich bin eine Libelle und gehöre zur Familie der Segellibellen (Libellulidae). Meine Männchen sind leicht an ihrer bläulichen Färbung zu erkennen, während die Weibchen und die Jungtiere eine gelbbraune bis olivgrüne Farbe haben. Meine Körperlänge beträgt etwa 35 bis 40 mm, was mich zu einer relativ kleinen Libelle macht.
Ich durchlaufe mehrere Entwicklungsstadien, beginnend als Ei, das im Wasser abgelegt wird. Nach dem Schlüpfen entwickle ich mich zur Larve, die einige Monate bis zu zwei Jahre im Wasser lebt und sich von kleinen Wasserorganismen ernährt. Schließlich verlasse ich das Wasser und verwandle mich in ein flugfähiges Insekt, was man als
Metamorphose bezeichnet.
Mein Lebensraum
Ich bevorzuge sonnige, flache Gewässer wie Teiche, kleine Seen oder langsam fließende Bäche mit viel Vegetation. Diese Lebensräume bieten mir nicht nur Nahrung, sondern auch Schutz vor Fressfeinden. Die Ufervegetation ist für mich besonders wichtig, da ich dort meine Eier ablegen kann.
Mein Verhalten
Ich bin ein tagaktives Insekt und verbringe viel Zeit damit, auf Pflanzen oder Steinen zu sitzen und nach Beute Ausschau zu halten. Meine Nahrung besteht hauptsächlich aus kleineren Insekten, die ich im Flug fange. Mein Sehsinn ist hervorragend, da ich komplexe Facettenaugen habe, die mir helfen, Bewegungen und Farben wahrzunehmen.
Fortpflanzung
Während der Paarungszeit patrouilliere ich als Männchen häufig an Gewässern entlang und verteidige mein Revier gegen Rivalen. Wenn ich ein Weibchen finde, halte ich sie im Flug mit meinen speziellen Greiforganen am Hinterleib fest, und wir bilden ein Paarungsrad. Nach der Paarung legt das Weibchen ihre Eier ins Wasser, oft in der Nähe von Wasserpflanzen, wo die schlüpfenden Larven sich gut verstecken können.
Herausforderungen
Trotz meiner Anpassungsfähigkeit bin ich auf saubere und intakte Lebensräume angewiesen. Verschmutzung, Habitatverlust und Klimawandel sind Bedrohungen, die mein Überleben gefährden. Veränderungen im Wasserhaushalt und der Einsatz von Pestiziden können ebenfalls negative Auswirkungen auf meine Populationen haben.
Fazit
Als Kleiner Blaupfeil trage ich zur Gesundheit der Ökosysteme bei, in denen ich lebe, indem ich als Räuber von kleinen Insekten und als Beute für Vögel und andere Tiere diene. Meine Anwesenheit ist oft ein Zeichen für ein gesundes Gewässerökosystem.
Ich hoffe, ich konnte dir einen guten Einblick in mein Leben und meine Bedeutung in der Natur geben. Danke, dass du dich für mich interessierst!
Aufnahme von Klaus Sanwald
- Kleiner Blaupfeil (Orthetrum coerulescens)
Artenschutz in Franken®
Stele der Biodiversität® - Stegaurach / Dellern

Stele der Biodiversität® - Stegaurach / Dellern
25/26.08.2024
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.
Stegaurach / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
25/26.08.2024
- Die grafische Gestaltung ... Stimmungen an der Stele der Biodiversität®
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.
Stegaurach / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
Denn wenn (selbst in noch geeigneten Nahrungsstrukturen) keine geeigneten Reproduktionsräume vorhanden sind, ist die Erhaltung der Artenvielfalt gelichfalls zum Scheitern verurteilt.
Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird., setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.
In der Aufnahme
Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird., setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.
In der Aufnahme
- Eindrücke vom 15.08.2024 ... der Turmfalke hat "Platz genommen" ...
Artenschutz in Franken®
„Wilde Bienchen“ freuen sich über neues Zuhause

„Wilde Bienchen“ freuen sich über neues Zuhause
08/09.08.2024
Windheim. Noch ist es relativ ruhig auf der Streuobstwiese gegenüber der ehrwürdigen Windheimer Pfarrkirche. Doch schon bald soll es auf dem idyllischen Grundstück summen und brummen was das Zeug hält.
In Kooperation des örtlichen Obst- und Gartenbauvereins (OGV) und des Katholischen Kindergartens St. Nikolaus Windheim mit dem „Artenschutz in Franken“ sowie den von der Deutschen Postcode Lotterie unterstützten Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld in Rhede wurde hier eine moderne, langlebige Wildbienenwand errichtet. Die „Zimmer" sind so eingerichtet, dass sich verschiedene Wildbienenarten darin wohlfühlen und in Ruhe um ihren Nachwuchs kümmern können. „Getauft“ wurde das „Exklusiv-Hotel“ auf den schönen Namen „Die Wilden Bienchen von Windheim“ – und das aus gutem Grund.
08/09.08.2024
- Seit Kurzem findet sich auf der Streuobstwiese des OGV Windheim eine große Wildbienenwand. Pate ist der örtliche Kindergarten. Bei einer kleinen Einweihungsfeier erfuhren die Kinder, warum auch das wilde Pendant zur Honigbiene so wichtig ist.
Windheim. Noch ist es relativ ruhig auf der Streuobstwiese gegenüber der ehrwürdigen Windheimer Pfarrkirche. Doch schon bald soll es auf dem idyllischen Grundstück summen und brummen was das Zeug hält.
In Kooperation des örtlichen Obst- und Gartenbauvereins (OGV) und des Katholischen Kindergartens St. Nikolaus Windheim mit dem „Artenschutz in Franken“ sowie den von der Deutschen Postcode Lotterie unterstützten Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld in Rhede wurde hier eine moderne, langlebige Wildbienenwand errichtet. Die „Zimmer" sind so eingerichtet, dass sich verschiedene Wildbienenarten darin wohlfühlen und in Ruhe um ihren Nachwuchs kümmern können. „Getauft“ wurde das „Exklusiv-Hotel“ auf den schönen Namen „Die Wilden Bienchen von Windheim“ – und das aus gutem Grund.
Wildbienen - die unbekannten Bestäuber
„Bei Bienen denkt man zunächst an die Honigbiene, die uns den Honig liefert“, erklärte die 1. OGV-Vorsitzende Gaby Kotschenreuther bei der Einweihungsfeier den jungen Paten aus dem örtlichen Kindergarten. Kaum jemand wisse, dass es in Deutschland 560 Wildbienenarten gebe und diese Pflanzenbestäuber in der Natur genauso nützlich seien wie ihre domestizierten Verwandten. Durch die Zerstörung ihrer Lebensräume stehe jedoch leider rund die Hälfe von ihnen kurz vor dem Aussterben. Um den für den ökologischen Kreislauf so wichtigen Nützlingen eine Nisthilfe zu bieten, wurde auf der Streuobstwiese eine auf deren Bedürfnisse ausgerichtete 2,5 Meter hohe Wildbienenwand errichtet. Die hochwertige Konstruktion mit einem Wert von sage und schreibe 20.000 Euro besteht aus atmungsaktiven Naturmaterialien wie Schilf und Lehm in Kombination mit langlebigem Metall und Acryl. Pflanzenstängel, Steine mit Hohlräumen sowie Holz bieten den emsigen Tierchen beste Bedingungen, um zu nisten, den Nachwuchs großzuziehen und zu überwintern.
Auf das innovative Artenschutz- und Umweltbildungsprojekt war die 1. Vorsitzende über den Illustrator Michael Horn aufmerksam geworden. Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des OGV Windheim hatte dieser vor zwei Jahren die Außenfassade des Vereinshäuschens an der Hauptstraße in ein wahres Schmuckstück verwandelt. Die aufgemalten Motive, darunter auch gefährdete Tiere und Pflanzen, sollen zum Nachahmen im eigenen Garten und in der Flur anregen und gleichzeitig aufzeigen, wie diese geschützt werden können. Das gleiche Ziel verfolge auch das neue Projekt. Dass man hierfür - als bislang einziger Verein im Landkreis Kronach - den Zuschlag erhalten habe, erfülle sie auch angesichts des enormen materiellen Werts mit Dankbarkeit und Stolz. Ihr Dank galt daher allen, die zur Realisation beigetragen haben; insbesondere dem 1. Vorsitzenden „Artenschutz in Franken“, Thomas Artur Köhler, der hauptverantwortlich für das Zustandekommen des Schenkungsvertrags zeichnet.
„Wir werden mit den Kindern regelmäßig an der Wildbienenwand vorbeischauen, um zu sehen, was sich dort tut und welche Bienenarten bereits eingezogen sind", versicherte die Erzieherin Babsi Schirmer, die zugleich auch die OGV-Kindergruppe „Die Igel“ mit leitet. Der Kindergarten freue sich schon sehr auf Live-Einblicke vor Ort, zumal man das Thema Bienen auch derzeit behandele. Daher wussten auch die „wilden Bienchen“ der Kita schon selbst vieles über Leben und Nutzen ihrer emsigen „Freunde“ zu berichten, zu deren Ehren sie auch ein Bienenlied anstimmten und dazu tanzten.
So klein und doch so ungemein wichtig
Natürlich sollen aber nicht nur die Jüngsten die tüchtigen Pflanzenbestäuber beobachten und deren Lebensraum anschaulich kennenlernen, sondern auch alle anderen großen und kleinen Tierfreunde; befindet sich doch beispielsweise die Mittelschule ebenfalls in unmittelbarer Nähe. Ideal ist der Standort auch deshalb, da hier die Wildbienen bereits beste Bedingungen - sprich Blüten und Pollen - vorfinden. 2009 hatten die Gartler auf dem Grundstück mit Erlaubnis des Eigentümers, der katholischen Kirchenstiftung Windheim, eine Streuobstwiese angelegt, die mittlerweile16 Obstbäume und drei kleinkronige Laubbäume zieren.
„Das ist eine sehr wertvolle Geschichte“, würdigte Steinbachs Bürgermeister Thomas Löffler; leiste doch das Projekt einen pädagogisch wertvollen Beitrag zur Umweltbildung und stelle auch optisch eine große Bereicherung für die gesamte Gemeinde dar. Von einer „ganz tollen Aktion“ sprach Kreisfachberaterin Beate Singhartinger auch namens des 1. Vorsitzenden des Kreisverbands für Gartenbau und Landespflege Kronach, Fritz Pohl, der leider nicht anwesend sein konnte. Die Zerstörung ihrer Lebensräume, ein zu hoher Einsatz von Pestiziden oder auch fehlende Fortpflanzungs-Möglichkeiten seien mit ursächlich, dass die Anzahl der Wildbienen immer mehr zurückgehe. Dem entgegenwirken könne man, indem man Gärten möglichst vielfältig gestalte und viele Strukturen anbiete. Die Glückwünsche der katholischen Kirchenstiftung Windheim übermittelte Wendelin Vetter. Neben ihm nahmen auch die weiteren OGV-Ehrenmitglieder Hans Vetter und Heinz Büttner sowie Beirat Stefan Büttner an der kleinen Feier teil.
Sicherlich freuen sich auch die Bienen über ihr neues Zuhause; wird es doch für sie immer schwieriger, geeignete Nistplätze zu finden. Übrigens sind die kleinen Insekten überhaupt nicht aggressiv und neigen überhaupt nicht dazu zu stechen - Beste Voraussetzungen also, um sie gespannt beobachten können. Viele weitere Informationen zu den Tierchen und zum Projekt finden sich direkt an der Wildbienenwand. Ein Besuch lohnt also auf jeden Fall!
In der Aufnahme des © OGV Windheim
• 1. OGV-Vorsitzende Gaby Kotschenreuther erzählte den jungen Paten des örtlichen Kindergartens vieles über Wildbienen und deren Nutzen für den Menschen.
Artenschutz in Franken®
Die Blaumeise (Cyanistes caeruleus)

Die Blaumeise (Cyanistes caeruleus): Ein faszinierender Singvogel Europas
07/08.08.2024
In dieser Infoinheit werden die Merkmale, der Lebensraum, das Verhalten, die Ernährung und die Fortpflanzung der Blaumeise genauer betrachtet.
07/08.08.2024
- Die Blaumeise (Cyanistes caeruleus) ist ein kleiner, farbenfroher Singvogel, der in weiten Teilen Europas verbreitet ist. Mit ihrem auffälligen Federkleid und ihrem lebhaften Verhalten ist sie ein beliebter Vogel bei Naturfreunden und Vogelliebhabern.
In dieser Infoinheit werden die Merkmale, der Lebensraum, das Verhalten, die Ernährung und die Fortpflanzung der Blaumeise genauer betrachtet.
Merkmale
Die Blaumeise ist etwa 11 bis 12 Zentimeter lang und wiegt zwischen 9 und 12 Gramm. Ihr charakteristisches Aussehen macht sie leicht erkennbar: Der Kopf ist blau, das Gesicht weiß mit einem schwarzen Augenstreifen, der wie eine Maske aussieht. Die Flügel und der Schwanz sind ebenfalls blau, während der Rücken grünlich und die Unterseite gelb ist. Diese auffällige Färbung macht die Blaumeise zu einem der buntesten Vögel in unseren Gärten und Wäldern.
Lebensraum
Blaumeisen bevorzugen Laub- und Mischwälder, sind aber auch häufig in Parks und Gärten zu finden. Sie benötigen Gebiete mit vielen Bäumen und Sträuchern, die ihnen sowohl Nahrung als auch Nistmöglichkeiten bieten. Durch ihre Anpassungsfähigkeit kommen sie auch in Siedlungsnähe gut zurecht und nutzen gerne von Menschen angebrachte Nistkästen.
Verhalten
Diese kleinen Vögel sind äußerst aktiv und beweglich. Sie klettern geschickt an Ästen und Baumstämmen entlang und können sogar kopfüber hängen. Blaumeisen sind neugierig und mutig, was ihnen hilft, neue Nahrungsquellen zu entdecken. Ihr Gesang ist vielseitig und dient zur Reviermarkierung sowie zur Anlockung eines Partners. Besonders im Frühling kann man ihre fröhlichen Rufe hören.
Ernährung
Die Nahrung der Blaumeise besteht hauptsächlich aus kleinen Insekten und Spinnen. Diese proteinreiche Kost ist besonders während der Brutzeit wichtig, um die Jungvögel zu füttern. Im Winter, wenn weniger Insekten verfügbar sind, ernähren sich Blaumeisen auch von Samen, Beeren und Nüssen. An Futterstellen nehmen sie gerne Sonnenblumenkerne und Erdnüsse an, was ihnen hilft, in den kalten Monaten zu überleben.
Fortpflanzung
Im Frühling beginnt die Brutzeit der Blaumeise. Das Weibchen baut das Nest in Baumhöhlen, Nistkästen oder anderen geschützten Orten. Das Nest besteht aus Moos, Gras, Federn und Tierhaaren. Ein Gelege umfasst durchschnittlich 8 bis 12 Eier, die weiß mit rötlichen Flecken sind. Die Brutdauer beträgt etwa 13 bis 15 Tage. Beide Elternteile beteiligen sich an der Fütterung der Küken, die nach etwa 16 bis 22 Tagen flügge werden und das Nest verlassen.
Schutzstatus und Bedrohungen
Die Blaumeise ist aktuell nicht gefährdet und wird von der International Union for Conservation of Nature (IUCN) als "Least Concern" eingestuft. Trotzdem können Faktoren wie Lebensraumverlust, Klimawandel und der Einsatz von Pestiziden lokale Populationen beeinträchtigen. Schutzmaßnahmen wie die Erhaltung geeigneter Lebensräume und das Anbringen von Nistkästen können dazu beitragen, die Populationen der Blaumeise zu unterstützen.
Fazit
Die Blaumeise (Cyanistes caeruleus) ist ein beeindruckender Vogel, der aufgrund seiner Anpassungsfähigkeit und seines farbenfrohen Erscheinungsbildes eine wichtige Rolle in unseren Ökosystemen spielt. Durch Schutzmaßnahmen und die Bereitstellung von Lebensräumen können wir sicherstellen, dass diese faszinierende Art auch in Zukunft in unseren Wäldern, Parks und Gärten zu beobachten ist. Ihr fröhlicher Gesang und ihr lebhaftes Verhalten bereichern die Natur und machen sie zu einem beliebten Vogel bei Jung und Alt.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
Die Blaumeise ist etwa 11 bis 12 Zentimeter lang und wiegt zwischen 9 und 12 Gramm. Ihr charakteristisches Aussehen macht sie leicht erkennbar: Der Kopf ist blau, das Gesicht weiß mit einem schwarzen Augenstreifen, der wie eine Maske aussieht. Die Flügel und der Schwanz sind ebenfalls blau, während der Rücken grünlich und die Unterseite gelb ist. Diese auffällige Färbung macht die Blaumeise zu einem der buntesten Vögel in unseren Gärten und Wäldern.
Lebensraum
Blaumeisen bevorzugen Laub- und Mischwälder, sind aber auch häufig in Parks und Gärten zu finden. Sie benötigen Gebiete mit vielen Bäumen und Sträuchern, die ihnen sowohl Nahrung als auch Nistmöglichkeiten bieten. Durch ihre Anpassungsfähigkeit kommen sie auch in Siedlungsnähe gut zurecht und nutzen gerne von Menschen angebrachte Nistkästen.
Verhalten
Diese kleinen Vögel sind äußerst aktiv und beweglich. Sie klettern geschickt an Ästen und Baumstämmen entlang und können sogar kopfüber hängen. Blaumeisen sind neugierig und mutig, was ihnen hilft, neue Nahrungsquellen zu entdecken. Ihr Gesang ist vielseitig und dient zur Reviermarkierung sowie zur Anlockung eines Partners. Besonders im Frühling kann man ihre fröhlichen Rufe hören.
Ernährung
Die Nahrung der Blaumeise besteht hauptsächlich aus kleinen Insekten und Spinnen. Diese proteinreiche Kost ist besonders während der Brutzeit wichtig, um die Jungvögel zu füttern. Im Winter, wenn weniger Insekten verfügbar sind, ernähren sich Blaumeisen auch von Samen, Beeren und Nüssen. An Futterstellen nehmen sie gerne Sonnenblumenkerne und Erdnüsse an, was ihnen hilft, in den kalten Monaten zu überleben.
Fortpflanzung
Im Frühling beginnt die Brutzeit der Blaumeise. Das Weibchen baut das Nest in Baumhöhlen, Nistkästen oder anderen geschützten Orten. Das Nest besteht aus Moos, Gras, Federn und Tierhaaren. Ein Gelege umfasst durchschnittlich 8 bis 12 Eier, die weiß mit rötlichen Flecken sind. Die Brutdauer beträgt etwa 13 bis 15 Tage. Beide Elternteile beteiligen sich an der Fütterung der Küken, die nach etwa 16 bis 22 Tagen flügge werden und das Nest verlassen.
Schutzstatus und Bedrohungen
Die Blaumeise ist aktuell nicht gefährdet und wird von der International Union for Conservation of Nature (IUCN) als "Least Concern" eingestuft. Trotzdem können Faktoren wie Lebensraumverlust, Klimawandel und der Einsatz von Pestiziden lokale Populationen beeinträchtigen. Schutzmaßnahmen wie die Erhaltung geeigneter Lebensräume und das Anbringen von Nistkästen können dazu beitragen, die Populationen der Blaumeise zu unterstützen.
Fazit
Die Blaumeise (Cyanistes caeruleus) ist ein beeindruckender Vogel, der aufgrund seiner Anpassungsfähigkeit und seines farbenfrohen Erscheinungsbildes eine wichtige Rolle in unseren Ökosystemen spielt. Durch Schutzmaßnahmen und die Bereitstellung von Lebensräumen können wir sicherstellen, dass diese faszinierende Art auch in Zukunft in unseren Wäldern, Parks und Gärten zu beobachten ist. Ihr fröhlicher Gesang und ihr lebhaftes Verhalten bereichern die Natur und machen sie zu einem beliebten Vogel bei Jung und Alt.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
- Blaumeise
Artenschutz in Franken®
Der Olivgrüne Hummelschwärmer (Hemaris croatica)

Olivgrüner Hummelschwärmer (Hemaris croatica)
07/08.08.2024
07/08.08.2024
- Hallo! Ich bin der Olivgrüne Hummelschwärmer, auch bekannt als Hemaris croatica. Lass mich dir ein wenig über mein Leben und meine Eigenschaften erzählen.
Mein Aussehen und meine Merkmale
Ich bin ein mittelgroßer Schwärmer mit einer Flügelspannweite von etwa 40-50 Millimetern. Meine Flügel sind teilweise durchsichtig, da die meisten meiner Schuppen abgerieben sind, wenn ich das Puppenstadium verlasse. Das gibt meinen Flügeln ein hummelähnliches Aussehen. Meine Vorderflügel sind olivgrün bis bräunlich, was mir hilft, mich in meiner Umgebung zu tarnen. Die Hinterflügel sind meist orange bis gelb. Mein Körper ist ebenfalls olivgrün bis braun mit einem breiten, pelzigen Band in der Mitte, was mich wirklich wie eine Hummel aussehen lässt.
Mein Lebensraum und Verhalten
Ich lebe in verschiedenen Teilen Europas, einschließlich der Balkanregion, wo ich mich in warmen und sonnigen Hängen, offenen Wäldern und in der Nähe von Wiesen aufhalte. Mein bevorzugter Lebensraum sind Orte mit vielen Blütenpflanzen, da ich Nektar liebe! Während des Tages fliege ich von Blüte zu Blüte, ähnlich wie eine Hummel, um meinen Nektar zu sammeln. Das nennt man tagaktive Lebensweise, was bei Schwärmern eher ungewöhnlich ist.
Mein Lebenszyklus
Ich durchlaufe eine vollständige Metamorphose, die vier Hauptstadien umfasst: Ei, Larve, Puppe und erwachsener Falter.
Meine ökologische Rolle und Bedeutung
Ich spiele eine wichtige Rolle in meinem Ökosystem als Bestäuber. Indem ich Nektar von Blüte zu Blüte sammle, helfe ich vielen Pflanzen, sich fortzupflanzen. Meine Aktivität trägt zur Gesundheit und Vielfalt der Pflanzenwelt bei, die wiederum vielen anderen Tieren Nahrung und Lebensraum bietet.
Herausforderungen und Schutz
Wie viele meiner Artgenossen stehe ich vor Herausforderungen durch den Verlust meines Lebensraums und den Einsatz von Pestiziden. Die Zerstörung von Wiesen und offenen Wäldern reduziert die Verfügbarkeit meiner Futterpflanzen und geeigneter Lebensräume für meine Larven und mich. Der Schutz und die Erhaltung natürlicher Lebensräume sind entscheidend für mein Überleben.
So, jetzt kennst du ein bisschen mehr über mich, den Olivgrünen Hummelschwärmer. Ich hoffe, du siehst mich beim nächsten Spaziergang durch die Natur mit neuen Augen!
Aufnahme von Helga Zinnecker in 2024
Ich bin ein mittelgroßer Schwärmer mit einer Flügelspannweite von etwa 40-50 Millimetern. Meine Flügel sind teilweise durchsichtig, da die meisten meiner Schuppen abgerieben sind, wenn ich das Puppenstadium verlasse. Das gibt meinen Flügeln ein hummelähnliches Aussehen. Meine Vorderflügel sind olivgrün bis bräunlich, was mir hilft, mich in meiner Umgebung zu tarnen. Die Hinterflügel sind meist orange bis gelb. Mein Körper ist ebenfalls olivgrün bis braun mit einem breiten, pelzigen Band in der Mitte, was mich wirklich wie eine Hummel aussehen lässt.
Mein Lebensraum und Verhalten
Ich lebe in verschiedenen Teilen Europas, einschließlich der Balkanregion, wo ich mich in warmen und sonnigen Hängen, offenen Wäldern und in der Nähe von Wiesen aufhalte. Mein bevorzugter Lebensraum sind Orte mit vielen Blütenpflanzen, da ich Nektar liebe! Während des Tages fliege ich von Blüte zu Blüte, ähnlich wie eine Hummel, um meinen Nektar zu sammeln. Das nennt man tagaktive Lebensweise, was bei Schwärmern eher ungewöhnlich ist.
Mein Lebenszyklus
Ich durchlaufe eine vollständige Metamorphose, die vier Hauptstadien umfasst: Ei, Larve, Puppe und erwachsener Falter.
- Ei: Meine Mutter legt die Eier einzeln auf die Futterpflanzen meiner Larven ab. Dazu gehören insbesondere Pflanzen der Gattung Rubus (Brombeeren) und Lonicera (Geißblatt).
- Larve: Sobald ich als Larve schlüpfe, bin ich erst klein und grün mit gelben Streifen. Während ich wachse, wechsele ich meine Haut mehrmals. Ich habe auch ein auffälliges hornartiges Anhängsel am Hinterende meines Körpers, das man als Analhorn bezeichnet.
- Puppe: Nach der letzten Häutung verpuppere ich mich im Boden oder unter Moos. Die Puppenruhe dauert je nach Witterung mehrere Wochen bis Monate.
- Erwachsener Falter: Als erwachsener Falter schlüpfe ich schließlich aus der Puppe und bin bereit, meine eigene Nahrung zu suchen und mich fortzupflanzen.
Meine ökologische Rolle und Bedeutung
Ich spiele eine wichtige Rolle in meinem Ökosystem als Bestäuber. Indem ich Nektar von Blüte zu Blüte sammle, helfe ich vielen Pflanzen, sich fortzupflanzen. Meine Aktivität trägt zur Gesundheit und Vielfalt der Pflanzenwelt bei, die wiederum vielen anderen Tieren Nahrung und Lebensraum bietet.
Herausforderungen und Schutz
Wie viele meiner Artgenossen stehe ich vor Herausforderungen durch den Verlust meines Lebensraums und den Einsatz von Pestiziden. Die Zerstörung von Wiesen und offenen Wäldern reduziert die Verfügbarkeit meiner Futterpflanzen und geeigneter Lebensräume für meine Larven und mich. Der Schutz und die Erhaltung natürlicher Lebensräume sind entscheidend für mein Überleben.
So, jetzt kennst du ein bisschen mehr über mich, den Olivgrünen Hummelschwärmer. Ich hoffe, du siehst mich beim nächsten Spaziergang durch die Natur mit neuen Augen!
Aufnahme von Helga Zinnecker in 2024
- Olivgrüner Hummelschwärmer (Hemaris croatica)
Artenschutz in Franken®
Späte Großstirnschwebfliege (Scaeva pyrastri)

Die Späte Großstirnschwebfliege (Scaeva pyrastri)
06/07.08.2024
Lass mich dir einen Einblick in mein Leben geben.
06/07.08.2024
- Hallo! Ich bin eine Späte Großstirnschwebfliege, oder wie die Wissenschaftler mich nennen, Scaeva pyrastri.
Lass mich dir einen Einblick in mein Leben geben.
Mein Aussehen
Ich bin eine mittelgroße Schwebfliege, etwa 10-12 mm lang. Mein Körper ist schwarz mit auffälligen weißen oder gelblichen Bändern auf meinem Rücken, die sich in Bögen wölben. Diese Zeichnung sieht aus wie ein „V“ und hilft mir, mich als wehrhaftes Insekt zu tarnen, um Raubtiere abzuschrecken.
Lebensraum und Verbreitung
Ich bin weit verbreitet, von Europa bis Nordafrika und Asien. Meine Art ist besonders in offenen Landschaften zu finden, wie Wiesen, Gärten und Waldränder. Diese Vielfalt an Lebensräumen bietet mir reichlich Nahrung und Möglichkeiten zur Fortpflanzung.
Ernährung
In meinem Erwachsenenstadium ernähre ich mich von Nektar und Pollen. Besonders ziehe ich Blüten von Doldenblütlern an, aber auch andere blühende Pflanzen sind willkommen. Nektar gibt mir die nötige Energie für den Flug, während Pollen eine wichtige Proteinquelle darstellt.
Fortpflanzung
Als Weibchen lege ich meine Eier bevorzugt in der Nähe von Blattlauskolonien ab, da meine Larven sich von Blattläusen ernähren. Diese Nahrungsquelle ist reich an Proteinen und Fetten, die für das Wachstum meiner Nachkommen unerlässlich sind. Eine einzelne Larve kann im Laufe ihres Lebens mehrere hundert Blattläuse vertilgen.
Metamorphose
Ich durchlaufe einen vollständigen Metamorphoseprozess: Ei, Larve, Puppe und schließlich das adulte Insekt. Die Larvenphase ist für mich besonders wichtig, da ich in dieser Zeit die meisten meiner Nährstoffe aufnehme. Nach der Puppenphase schlüpfe ich als ausgewachsene Schwebfliege und beginne den Kreislauf von neuem.
Verhalten und Schutzmechanismen
Ich bin ein geschickter Flieger und kann in der Luft stehen bleiben, ähnlich wie ein Hubschrauber. Dieses Verhalten hilft mir nicht nur bei der Nahrungssuche, sondern auch, um Feinden zu entkommen. Mein Aussehen spielt ebenfalls eine wichtige Rolle beim Schutz: Durch meine schwarz-weiße Zeichnung sehe ich vielen wehrhaften Wespenarten ähnlich, was Fressfeinde abschreckt.
Bedeutung für das Ökosystem
Als Bestäuber spiele ich eine wichtige Rolle im Ökosystem. Durch das Besuchen von Blüten trage ich zur Bestäubung bei, was für viele Pflanzenarten essenziell ist. Außerdem trage ich zur biologischen Schädlingsbekämpfung bei, indem meine Larven Blattläuse dezimieren, die ansonsten große Schäden an Pflanzen verursachen könnten.
Ich hoffe, du hast nun einen guten Eindruck von meinem Leben und meiner Bedeutung in der Natur gewonnen. Jetzt musst du mir verzeihen, ich habe noch einige Blüten zu besuchen!
Aufnahme von Bernhard Schmalisch
Ich bin eine mittelgroße Schwebfliege, etwa 10-12 mm lang. Mein Körper ist schwarz mit auffälligen weißen oder gelblichen Bändern auf meinem Rücken, die sich in Bögen wölben. Diese Zeichnung sieht aus wie ein „V“ und hilft mir, mich als wehrhaftes Insekt zu tarnen, um Raubtiere abzuschrecken.
Lebensraum und Verbreitung
Ich bin weit verbreitet, von Europa bis Nordafrika und Asien. Meine Art ist besonders in offenen Landschaften zu finden, wie Wiesen, Gärten und Waldränder. Diese Vielfalt an Lebensräumen bietet mir reichlich Nahrung und Möglichkeiten zur Fortpflanzung.
Ernährung
In meinem Erwachsenenstadium ernähre ich mich von Nektar und Pollen. Besonders ziehe ich Blüten von Doldenblütlern an, aber auch andere blühende Pflanzen sind willkommen. Nektar gibt mir die nötige Energie für den Flug, während Pollen eine wichtige Proteinquelle darstellt.
Fortpflanzung
Als Weibchen lege ich meine Eier bevorzugt in der Nähe von Blattlauskolonien ab, da meine Larven sich von Blattläusen ernähren. Diese Nahrungsquelle ist reich an Proteinen und Fetten, die für das Wachstum meiner Nachkommen unerlässlich sind. Eine einzelne Larve kann im Laufe ihres Lebens mehrere hundert Blattläuse vertilgen.
Metamorphose
Ich durchlaufe einen vollständigen Metamorphoseprozess: Ei, Larve, Puppe und schließlich das adulte Insekt. Die Larvenphase ist für mich besonders wichtig, da ich in dieser Zeit die meisten meiner Nährstoffe aufnehme. Nach der Puppenphase schlüpfe ich als ausgewachsene Schwebfliege und beginne den Kreislauf von neuem.
Verhalten und Schutzmechanismen
Ich bin ein geschickter Flieger und kann in der Luft stehen bleiben, ähnlich wie ein Hubschrauber. Dieses Verhalten hilft mir nicht nur bei der Nahrungssuche, sondern auch, um Feinden zu entkommen. Mein Aussehen spielt ebenfalls eine wichtige Rolle beim Schutz: Durch meine schwarz-weiße Zeichnung sehe ich vielen wehrhaften Wespenarten ähnlich, was Fressfeinde abschreckt.
Bedeutung für das Ökosystem
Als Bestäuber spiele ich eine wichtige Rolle im Ökosystem. Durch das Besuchen von Blüten trage ich zur Bestäubung bei, was für viele Pflanzenarten essenziell ist. Außerdem trage ich zur biologischen Schädlingsbekämpfung bei, indem meine Larven Blattläuse dezimieren, die ansonsten große Schäden an Pflanzen verursachen könnten.
Ich hoffe, du hast nun einen guten Eindruck von meinem Leben und meiner Bedeutung in der Natur gewonnen. Jetzt musst du mir verzeihen, ich habe noch einige Blüten zu besuchen!
Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- Späte Großstirnschwebfliege (Scaeva pyrastri) - Männchen
Artenschutz in Franken®
Nistplatzsicherung der Großen Wiesenameise

Große Wiesenameise (Formica pratensis) - Nistplatzoptimierung
06/07.08.2024
Widmen wir uns jedoch erst einmal der Beschreibung der Großen Wiesenameise:
06/07.08.2024
- Die Große Wiesenameise (Formica pratensis) ist eine auffällige und sehr bedeutende Ameisenart, die in Europa weit (noch) verbreitet ist. Hier haben wir weitere Details über diese prägnante Art sowie Möglichkeiten, sie intensiv zu schützen zusammengestellt.
Widmen wir uns jedoch erst einmal der Beschreibung der Großen Wiesenameise:
Aussehen:
Die Große Wiesenameise hat eine Körperlänge von etwa 4-9 mm. Sie ist durch ihre rot-schwarze Färbung recht gut zu erkennen. Der Kopf und das Hinterteil (Gaster) sind schwarz, während der mittlere Teil des Körpers (Thorax) rot ist.
Lebensraum:
Diese Ameisen bevorzugen in der Regel offene, sonnige Habitate wie Wiesen, Waldränder und Lichtungen. Sie bauen normalerweise große Hügelnester aus Erde und auch verschiedenem Pflanzenmaterial.
Verhalten:
Sie sind territorial und verteidigen ihr Nest recht aggressiv. Die Große Wiesenameise ist eine prioritäre Art für das uns umfassende Ökosystem, da sie untre anderem zur Belüftung des Bodens beiträgt und als natürlicher Beutegreifer von „Schädlingen“ dient.
Nun möchten wir einige Schutzmaßnahmen aufzeigen.
Um die Große Wiesenameise effektiv zu schützen, sind verschiedene Maßnahmen notwendig, die sowohl temporär als auch intensiv sein können. Hier haben wir einige Optionen/ Möglichkeiten zusammengeführt:
Erhalt und Pflege der Lebensräume:
Schaffung neuer Lebensräume:
Monitoring und Forschung:
Sensibilisierung und Bildung:
Bedeutung für die Biodiversität
Die Große Wiesenameise spielt eine wichtige Rolle im Ökosystem. Sie trägt konkret zur Biodiversität bei, indem sie:
Durch diese vielfältigen Ökosystemdienstleistungen hilft die Große Wiesenameise, die Biodiversität nachhaltig zu fördern und zu erhalten. Daher ist ihr Schutz nicht nur für die Art selbst, sondern auch für das gesamte Ökosystem in unseren Augen von großer Bedeutung.
In der Aufnahme
Auch das "Überwachsen" der Nester ist ein großes Problem ... doch hier kann ohne Probleme nachgesteuert werden ...
Die Große Wiesenameise hat eine Körperlänge von etwa 4-9 mm. Sie ist durch ihre rot-schwarze Färbung recht gut zu erkennen. Der Kopf und das Hinterteil (Gaster) sind schwarz, während der mittlere Teil des Körpers (Thorax) rot ist.
Lebensraum:
Diese Ameisen bevorzugen in der Regel offene, sonnige Habitate wie Wiesen, Waldränder und Lichtungen. Sie bauen normalerweise große Hügelnester aus Erde und auch verschiedenem Pflanzenmaterial.
Verhalten:
Sie sind territorial und verteidigen ihr Nest recht aggressiv. Die Große Wiesenameise ist eine prioritäre Art für das uns umfassende Ökosystem, da sie untre anderem zur Belüftung des Bodens beiträgt und als natürlicher Beutegreifer von „Schädlingen“ dient.
Nun möchten wir einige Schutzmaßnahmen aufzeigen.
Um die Große Wiesenameise effektiv zu schützen, sind verschiedene Maßnahmen notwendig, die sowohl temporär als auch intensiv sein können. Hier haben wir einige Optionen/ Möglichkeiten zusammengeführt:
Erhalt und Pflege der Lebensräume:
- (Intensive) Pflege von Wiesen und Waldrändern: Regelmäßiges Mähen der Wiesen in aber angemessenen Intervallen fördert das Wachstum von Pflanzen und deren Begleitarten, die für diese Ameisen auch lebenswichtig sind. Wichtig ist dabei, die Wiesen nicht zu oft zu mähen, um den Ameisen ausreichend Zeit zur Erholung zu geben.
- Temporäre Schutzmaßnahmen: Temporäre Zäune oder andere Barrieren können unter Umständen, jedoch mit großer Sorgfalt, verwendet werden, um die Nester vor menschlichen Eingriffen oder dem Weidetritt zu schützen. Die Kennzeichnung dieser Nester wird von unserer Seite präferiert um die Umwelt überhaupt erst einmal mit deren Anwesenheit zu konfrontieren.
Schaffung neuer Lebensräume:
- Biodiversität fördern: Die Schaffung von durchdachten Blühstreifen und die Aussaat von Wildblumenwiesen erhöhen die Biodiversität und bieten auch den Ameisen zusätzliche Nahrungsquellen und Nistmöglichkeiten.
- Temporäre Schutzgebiete: Temporäre Schutzgebiete können eingerichtet werden, um die Ameisenpopulationen in kritischen Zeiten, wie während der Brut- und Schwärmzeit, vor Störungen zu bewahren. Das erscheint tatsächlich von großer Bedeutung und wird von unserer Seite unterstützt.
Monitoring und Forschung:
- Intensive Forschung und Überwachung: Regelmäßige Studien zur Populationsdynamik und zur Gesundheit der Ameisenvölker helfen, Bedrohungen frühzeitig zu erkennen und Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Nicht ohne Grund bringen wir uns auch hier ein.
- Temporäre Maßnahmen zur Bedarfsanpassung: Wenn Forschungsergebnisse tatsächlich zeigen, dass bestimmte Populationen oder Nistplätze gefährdet sind, können temporär ausgewählte Maßnahmen ergriffen werden, um diese zu stabilisieren, beispielsweise durch das gezielte Anpflanzen von Nahrungspflanzen uvm.
Sensibilisierung und Bildung:
- Intensive Bildungsprogramme: Durch intensive Bildungsprogramme in Schulen, Kitas, Gemeinden etc. kann das Bewusstsein für die Bedeutung der Großen Wiesenameise und die Notwendigkeit ihres Schutzes übergreifend gestärkt werden.
- Temporäre Kampagnen: Temporäre Informationskampagnen in den Medien oder vor Ort in den betroffenen Gebieten können kurzfristig viel Aufmerksamkeit erzeugen und so zum Schutz beitragen. Jedoch gilt es hier immer abzuwägen was Sinn macht oder was lieber zu unterlassen ist.
Bedeutung für die Biodiversität
Die Große Wiesenameise spielt eine wichtige Rolle im Ökosystem. Sie trägt konkret zur Biodiversität bei, indem sie:
- Als Prädator von „Schädlingen“ und anderen Insekten dient.
- Samen verbreitet und somit zur konkreten Pflanzenausbreitung beiträgt.
Durch diese vielfältigen Ökosystemdienstleistungen hilft die Große Wiesenameise, die Biodiversität nachhaltig zu fördern und zu erhalten. Daher ist ihr Schutz nicht nur für die Art selbst, sondern auch für das gesamte Ökosystem in unseren Augen von großer Bedeutung.
In der Aufnahme
- ... mehr und mehr Nistplätze der Großen Wiesenameisennester gehen hier bei uns auch in Bayern "verloren" ... Die Große Wiesenameise und ihre Nester sind in Deutschland besonders geschützt (BArtSchV), die Art steht ferner auf der Vorwarnliste bedrohter Arten, in Bayern wird sie im Status "Gefährdet" geführt. Die industriell geführte Landbewirtschaftung spielt dabei in unseren Augen eine mit entscheidende Rolle. Da vielfach im "Hygienewahn" auch die Randstreifen der Felder (die häufig den Landwirten gar nicht gehören und der Allgemeinkeit, da kommunaler Besitz, zugeordnet werden) mit abgemulcht werden, zerstören diese Maßnahmen eine im Bestand zunehmend gefährdete Art!
Auch das "Überwachsen" der Nester ist ein großes Problem ... doch hier kann ohne Probleme nachgesteuert werden ...
Artenschutz in Franken®
Stele der Biodiversität® - Burgwindheim / Kötsch

Stele der Biodiversität® - Burgwindheim / Kötsch
05/06.08.2024
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das vom Markt Burgwindheim, dem Bayernwerk der Deutschen Postcode Lotterie und der Steuerkanzlei Bauerfeind unterstützt wird.
Kötsch / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen.
Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
05/06.08.2024
- Die Dacharbeiten starten ... die Folie ist "drauf"
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das vom Markt Burgwindheim, dem Bayernwerk der Deutschen Postcode Lotterie und der Steuerkanzlei Bauerfeind unterstützt wird.
Kötsch / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen.
Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
Denn wenn (selbst in noch geeigneten Nahrungsstrukturen) keine geeigneten Reproduktionsräume vorhanden sind, ist die Erhaltung der Artenvielfalt gelichfalls zum Scheitern verurteilt.
Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das vom Markt Burgwindheim, dem Bayernwerk der Deutschen Postcode Lotterie und der Steuerkanzlei Bauerfeind unterstützt wird, setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.
In der Aufnahme
Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das vom Markt Burgwindheim, dem Bayernwerk der Deutschen Postcode Lotterie und der Steuerkanzlei Bauerfeind unterstützt wird, setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.
In der Aufnahme
- Impression vom 31.07.2024
Artenschutz in Franken®
Die Mistbiene (Eristalis tenax)

Mistbiene (Eristalis tenax)
05/06.08.2024
Sie gehört zur Familie der Schwebfliegen (Syrphidae) und ist aufgrund ihres Aussehens oft mit Bienen zu verwechseln, daher der Name "Mistbiene". Diese Fliegenart besitzt eine faszinierende ökologische Rolle und weist interessante biologische Merkmale auf.
05/06.08.2024
- Die Mistbiene oder Scheinbienen-Keilfleckschwebfliege, auch bekannt als Drohnenfliege (Eristalis tenax), ist eine bemerkenswerte Spezies innerhalb der Ordnung der Zweiflügler (Diptera).
Sie gehört zur Familie der Schwebfliegen (Syrphidae) und ist aufgrund ihres Aussehens oft mit Bienen zu verwechseln, daher der Name "Mistbiene". Diese Fliegenart besitzt eine faszinierende ökologische Rolle und weist interessante biologische Merkmale auf.
Ökologische Rolle:
Die Mistbiene spielt eine wichtige Rolle als Bestäuber von Blüten. Obwohl sie nicht direkt Pollen sammelt wie Bienen, sondern hauptsächlich Nektar, überträgt sie beim Besuch von Blüten unabsichtlich Pollen von einer Blume zur nächsten. Dies ist entscheidend für die Fortpflanzung vieler Pflanzenarten und trägt zur Erhaltung der biologischen Vielfalt bei.
Lebensweise und Verhalten:
Die Larven der Mistbiene entwickeln sich in Gewässern, die organische Substanz enthalten, wie z.B. in faulenden Pflanzenresten oder in Gülle. Dies erklärt den Ursprung ihres umgangssprachlichen Namens "Mistbiene". Die erwachsenen Fliegen ernähren sich von Nektar und sind oft in der Nähe von Blüten anzutreffen, wo sie durch ihre gelb-schwarze Färbung und ihr brummendes Fluggeräusch an Bienen erinnern.
Morphologische Merkmale:
Die Mistbiene hat ein bienenähnliches Aussehen mit einem robusten Körper und auffälligen gelben und schwarzen Streifen auf dem Hinterleib. Diese Mimikry gegenüber Bienen könnte dazu dienen, potenzielle Fressfeinde abzuschrecken, da viele Tiere Bienen wegen ihres Stichs meiden.
Anpassungen an den Lebensraum:
Eristalis tenax ist anpassungsfähig und kann in einer Vielzahl von Lebensräumen gedeihen, solange genügend Nahrungsquellen und geeignete Bedingungen für die Larvalentwicklung vorhanden sind. Sie sind häufig in Gärten, an Waldlichtungen, auf Wiesen und in der Nähe von Gewässern zu finden, wo sie ihre Bestäubungsaufgaben wahrnehmen können.
Insgesamt ist die Mistbiene eine bemerkenswerte Schwebfliegenart, die nicht nur ökologisch wertvoll ist, sondern auch interessante biologische Anpassungen und Verhaltensweisen zeigt, die sie zu einem faszinierenden Studienobjekt für Biologen machen.
Aufnahme / Autor Bernhard Schmalisch ... Aufnahme vom 03.08.2024
Die Mistbiene spielt eine wichtige Rolle als Bestäuber von Blüten. Obwohl sie nicht direkt Pollen sammelt wie Bienen, sondern hauptsächlich Nektar, überträgt sie beim Besuch von Blüten unabsichtlich Pollen von einer Blume zur nächsten. Dies ist entscheidend für die Fortpflanzung vieler Pflanzenarten und trägt zur Erhaltung der biologischen Vielfalt bei.
Lebensweise und Verhalten:
Die Larven der Mistbiene entwickeln sich in Gewässern, die organische Substanz enthalten, wie z.B. in faulenden Pflanzenresten oder in Gülle. Dies erklärt den Ursprung ihres umgangssprachlichen Namens "Mistbiene". Die erwachsenen Fliegen ernähren sich von Nektar und sind oft in der Nähe von Blüten anzutreffen, wo sie durch ihre gelb-schwarze Färbung und ihr brummendes Fluggeräusch an Bienen erinnern.
Morphologische Merkmale:
Die Mistbiene hat ein bienenähnliches Aussehen mit einem robusten Körper und auffälligen gelben und schwarzen Streifen auf dem Hinterleib. Diese Mimikry gegenüber Bienen könnte dazu dienen, potenzielle Fressfeinde abzuschrecken, da viele Tiere Bienen wegen ihres Stichs meiden.
Anpassungen an den Lebensraum:
Eristalis tenax ist anpassungsfähig und kann in einer Vielzahl von Lebensräumen gedeihen, solange genügend Nahrungsquellen und geeignete Bedingungen für die Larvalentwicklung vorhanden sind. Sie sind häufig in Gärten, an Waldlichtungen, auf Wiesen und in der Nähe von Gewässern zu finden, wo sie ihre Bestäubungsaufgaben wahrnehmen können.
Insgesamt ist die Mistbiene eine bemerkenswerte Schwebfliegenart, die nicht nur ökologisch wertvoll ist, sondern auch interessante biologische Anpassungen und Verhaltensweisen zeigt, die sie zu einem faszinierenden Studienobjekt für Biologen machen.
Aufnahme / Autor Bernhard Schmalisch ... Aufnahme vom 03.08.2024
- ... für mich sind auch die gewaltigen saisonalen Flugleistungen dieser Keilfleckschwebfliege interessant.Auch die Entwicklung der Larven, in von anderen Insekten kaum genutzten Nischen, in teilweise anaerobem Wasser, ist wissenswert. Oft auch in biologisch (nicht chemisch) verschmutzten Gewässern nähe der bäuerlichen Misthaufen.
Artenschutz in Franken®
Der Stahlblaue Grillenjäger (Isodontia mexicana)

Stahlblauer Grillenjäger (Isodontia mexicana)
04/05.08.2024
Ich gehöre zur Familie der Sphecidae, den Grabwespen. Mein auffälliges, metallisch-blaues bis schwarzes Exoskelett verleiht mir meinen Namen. Mit einer Länge von etwa 15 bis 25 Millimetern bin ich eine mittelgroße Wespe. Mein schlanker Körperbau und meine langen Beine ermöglichen es mir, geschickt und schnell zu fliegen.
04/05.08.2024
- Ich bin der Stahlblaue Grillenjäger, wissenschaftlich bekannt als Isodontia mexicana. Lass mich dir aus meiner Perspektive erzählen, wer ich bin und was mich ausmacht.
Ich gehöre zur Familie der Sphecidae, den Grabwespen. Mein auffälliges, metallisch-blaues bis schwarzes Exoskelett verleiht mir meinen Namen. Mit einer Länge von etwa 15 bis 25 Millimetern bin ich eine mittelgroße Wespe. Mein schlanker Körperbau und meine langen Beine ermöglichen es mir, geschickt und schnell zu fliegen.
Mein Lebensraum erstreckt sich über verschiedene Regionen, ursprünglich aus Nord- und Mittelamerika stammend, bin ich mittlerweile auch in Europa anzutreffen. Ich bevorzuge offene, sonnige Lebensräume wie Wiesen, Gärten und Waldränder, wo ich meine Nester bauen und jagen kann.
In Bezug auf mein Jagdverhalten bin ich spezialisiert auf Grillen und Heuschrecken, die Hauptnahrung meiner Larven. Mit meinem kräftigen Kiefer packe ich die Beute und lähme sie durch gezielte Stiche mit meinem Gift. Anschließend transportiere ich die gelähmte, aber noch lebende Beute in mein Nest, wo sie als Frischfleischvorrat für meine Nachkommen dient. Diese Jagdmethode stellt sicher, dass die Larven eine kontinuierliche Nahrungsquelle haben, während sie sich entwickeln.
Mein Nest baue ich in verschiedenen hohlen Strukturen, oft in alten Käfergängen im Holz, hohlen Pflanzenstängeln oder sogar in künstlichen Nisthilfen, die Menschen bereitstellen. Ich lege ein einzelnes Ei in jede Zelle des Nestes und versorge diese mit mehreren gelähmten Grillen oder Heuschrecken. Nachdem ich das Nest verschlossen habe, kümmere ich mich nicht weiter um die Brut – die Larven entwickeln sich selbstständig und schlüpfen schließlich als ausgewachsene Wespen.
Meine Fortpflanzung und Nistgewohnheiten tragen zur Kontrolle der Population von Grillen und Heuschrecken bei, was ökologisch bedeutsam ist. In einem ausgewogenen Ökosystem helfe ich, das Gleichgewicht zwischen Pflanzenfressern und Raubtieren zu erhalten.
Trotz meines räuberischen Verhaltens gegenüber Insekten bin ich für den Menschen harmlos. Ich zeige nur wenig Aggressivität und steche normalerweise nicht, es sei denn, ich fühle mich direkt bedroht. Tatsächlich werde ich oft als nützlicher Bestandteil des Ökosystems angesehen, da ich zur natürlichen Schädlingsbekämpfung beitrage.
Insgesamt bin ich als Stahlblaue Grillenjäger ein faszinierendes Beispiel für die Vielfalt und Komplexität der Insektenwelt. Mein Überleben und mein Beitrag zum Ökosystem hängen von der Verfügbarkeit geeigneter Nistplätze und einem ausreichenden Nahrungsangebot ab. Der Schutz meines Lebensraums und die Förderung einer vielfältigen Insektenfauna sind daher entscheidend für mein Fortbestehen.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
In Bezug auf mein Jagdverhalten bin ich spezialisiert auf Grillen und Heuschrecken, die Hauptnahrung meiner Larven. Mit meinem kräftigen Kiefer packe ich die Beute und lähme sie durch gezielte Stiche mit meinem Gift. Anschließend transportiere ich die gelähmte, aber noch lebende Beute in mein Nest, wo sie als Frischfleischvorrat für meine Nachkommen dient. Diese Jagdmethode stellt sicher, dass die Larven eine kontinuierliche Nahrungsquelle haben, während sie sich entwickeln.
Mein Nest baue ich in verschiedenen hohlen Strukturen, oft in alten Käfergängen im Holz, hohlen Pflanzenstängeln oder sogar in künstlichen Nisthilfen, die Menschen bereitstellen. Ich lege ein einzelnes Ei in jede Zelle des Nestes und versorge diese mit mehreren gelähmten Grillen oder Heuschrecken. Nachdem ich das Nest verschlossen habe, kümmere ich mich nicht weiter um die Brut – die Larven entwickeln sich selbstständig und schlüpfen schließlich als ausgewachsene Wespen.
Meine Fortpflanzung und Nistgewohnheiten tragen zur Kontrolle der Population von Grillen und Heuschrecken bei, was ökologisch bedeutsam ist. In einem ausgewogenen Ökosystem helfe ich, das Gleichgewicht zwischen Pflanzenfressern und Raubtieren zu erhalten.
Trotz meines räuberischen Verhaltens gegenüber Insekten bin ich für den Menschen harmlos. Ich zeige nur wenig Aggressivität und steche normalerweise nicht, es sei denn, ich fühle mich direkt bedroht. Tatsächlich werde ich oft als nützlicher Bestandteil des Ökosystems angesehen, da ich zur natürlichen Schädlingsbekämpfung beitrage.
Insgesamt bin ich als Stahlblaue Grillenjäger ein faszinierendes Beispiel für die Vielfalt und Komplexität der Insektenwelt. Mein Überleben und mein Beitrag zum Ökosystem hängen von der Verfügbarkeit geeigneter Nistplätze und einem ausreichenden Nahrungsangebot ab. Der Schutz meines Lebensraums und die Förderung einer vielfältigen Insektenfauna sind daher entscheidend für mein Fortbestehen.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- Stahlblauer Grillenjäger (Isodontia mexicana) - Aufnahme vom 03.08.2024 aus dem bayerischen Steigerwald
Artenschutz in Franken®
Stele der Biodiversität® - Burgwindheim / Kötsch

Stele der Biodiversität® - Burgwindheim / Kötsch
03/04.08.2024
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das vom Markt Burgwindheim, dem Bayernwerk der Deutschen Postcode Lotterie und der Steuerkanzlei Bauerfeind unterstützt wird.
Kötsch / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen.
Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
03/04.08.2024
- Die Dacharbeiten starten ...
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das vom Markt Burgwindheim, dem Bayernwerk der Deutschen Postcode Lotterie und der Steuerkanzlei Bauerfeind unterstützt wird.
Kötsch / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen.
Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
Denn wenn (selbst in noch geeigneten Nahrungsstrukturen) keine geeigneten Reproduktionsräume vorhanden sind, ist die Erhaltung der Artenvielfalt gelichfalls zum Scheitern verurteilt.
Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das vom Markt Burgwindheim, dem Bayernwerk der Deutschen Postcode Lotterie und der Steuerkanzlei Bauerfeind unterstützt wird, setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.
In der Aufnahme
Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das vom Markt Burgwindheim, dem Bayernwerk der Deutschen Postcode Lotterie und der Steuerkanzlei Bauerfeind unterstützt wird, setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.
In der Aufnahme
- mit den eigentlichen Arbeiten am Baukörper starten wir am 29.07.2024
Artenschutz in Franken®
Stele der Biodiversität® - Stegaurach / Dellern

Stele der Biodiversität® - Stegaurach / Dellern
04/05.08.2024
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.
Stegaurach / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
04/05.08.2024
- Die grafische Gestaltung ... Stimmungen an der Stele der Biodiversität®
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.
Stegaurach / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
Denn wenn (selbst in noch geeigneten Nahrungsstrukturen) keine geeigneten Reproduktionsräume vorhanden sind, ist die Erhaltung der Artenvielfalt gelichfalls zum Scheitern verurteilt.
Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird., setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.
In der Aufnahme
Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird., setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.
In der Aufnahme
- ... Impression vom 30.07.2024 ...
Artenschutz in Franken®
Weshalb Schmetterling & Co. verschwinden ?!

Weshalb Schmetterling & Co. verschwinden ... vom Unwillen oder gar dem Unvermögen Belange des praktischen Artenschutzes in Einklang mit den Ansprüchen einer naturnah geführten Landbewirtschaftung zu bringen.
02/03.08.2024
Allein schon diese Frage so zu formulieren lässt uns mit einem überraschten Gesichtsausdruck zurück, denn diese Frage ist schon lange beantwortet. Sie sind im "Schmetterlingshimmmel" und weshalb sie dort angekommen sind erkennen wir sehr leicht, wenn wir mit offenen Augen durch die Landschaft fahren.
02/03.08.2024
- In den letzten Tagen war auch in der Medienlandschaft immer wieder die Frage: "Wo sind die Schmetterlinge verblieben?" zu erfassen.
Allein schon diese Frage so zu formulieren lässt uns mit einem überraschten Gesichtsausdruck zurück, denn diese Frage ist schon lange beantwortet. Sie sind im "Schmetterlingshimmmel" und weshalb sie dort angekommen sind erkennen wir sehr leicht, wenn wir mit offenen Augen durch die Landschaft fahren.
Noch immer gibt es auch in der vornehmlich industriell geführten Landbewirtschaftung Menschen, welchen es entweder nicht bewusst, es ihnen egal ist, oder die einfach nicht in der Lage sind zu erkennen was sie mit ihrem Wirken und den hier "sauber produzierten Lebensmitteln" (von welchen wir innerhalb unseres Verbandes schon lange nichts mehr essen) eigentlich anrichten.
Wenn diese Menschen dann auch noch der Meinung sind das sie ihren Kindern und Enkelkindern damit eine intakte und saubere Umwelt hinterlassen dann ist das ihre Sichtweise und diese sei ihnen zugestanden. Wenn jedoch solch prekäre und in unseren Augen verwerfliche Eingriffe auf Fremdgrund stattfinden und Kinder und Enkelkinder anderer Menschen mit diesem Wirken beeinträchtigt und womöglich geschädigt werden, dann ist das ein ganz anderer Ansatz!
Doch sehen Sie selbst, was hier in unserer Landschaft innerhalb des "Sauberkeitswahns" so von der oder dem einen oder anderen so praktiziert wird ... "saubere Lebensmittel in einem sterilen Umfeld" ... nicht unser Weg - nicht unsere Form einer naturnah geführten Landwirtschaft eigentlich nur noch lächerlich und armselig was wir hier erkennen.
Bedenklich wenn unter einem solchen "Wirken" auch andere Mitmenschen leiden müssen, die ein solches "Wirken" nicht praktizieren und dennoch argwöhnisch betrachtet werden wenn sie industriell geführte Landwirtschaftung, jedoch auf in unseren Augen einem ökologisch höher gestellten Niveau generieren.
Wie viele Tiere haben hier ihr Leben und ihren Lebensraum verloren - sogar die Schädigung Dritter fand hier statt! Weshalb der Mädesüß-Perlmuttfalter (Brenthis ino) zunehmend im Bestand rückläufig ist? Ganz einfach - durch Eingriffe welche ihre Nahrungspflanzen und damit ihre Lebensräume zerstören!
Und warum? Um den Profit des oder der einen oder anderen zu steigern - und das auf Kosten der Allgemeinheit - nicht mehr und nicht weniger!
Es soll uns bitte auch keine/keiner mit der Floskel einer wie auch immer gearteten Ideologie zu kommen, wir selbst sind Eigentümer und Pächter von Flächen die wir nach diesem Prinzip bewirtschaften! Also keine Laien ... sondern wir wissen worüber wir sprechen!
Schmetterlinge leiden unter der industriellen Landwirtschaft aus mehreren Gründen:
Diese Faktoren führen zu einem Rückgang der Schmetterlingspopulationen und bedrohen die Artenvielfalt dieser wichtigen Bestäuber. Schmetterlinge spielen eine entscheidende Rolle in Ökosystemen, indem sie zur Bestäubung von Pflanzen beitragen und als Indikatoren für die Gesundheit von Ökosystemen dienen. Der Verlust von Schmetterlingspopulationen kann daher weitreichende negative Auswirkungen auf die Biodiversität und die Funktion von Ökosystemen haben.
In der Aufnahme
Wenn diese Menschen dann auch noch der Meinung sind das sie ihren Kindern und Enkelkindern damit eine intakte und saubere Umwelt hinterlassen dann ist das ihre Sichtweise und diese sei ihnen zugestanden. Wenn jedoch solch prekäre und in unseren Augen verwerfliche Eingriffe auf Fremdgrund stattfinden und Kinder und Enkelkinder anderer Menschen mit diesem Wirken beeinträchtigt und womöglich geschädigt werden, dann ist das ein ganz anderer Ansatz!
Doch sehen Sie selbst, was hier in unserer Landschaft innerhalb des "Sauberkeitswahns" so von der oder dem einen oder anderen so praktiziert wird ... "saubere Lebensmittel in einem sterilen Umfeld" ... nicht unser Weg - nicht unsere Form einer naturnah geführten Landwirtschaft eigentlich nur noch lächerlich und armselig was wir hier erkennen.
Bedenklich wenn unter einem solchen "Wirken" auch andere Mitmenschen leiden müssen, die ein solches "Wirken" nicht praktizieren und dennoch argwöhnisch betrachtet werden wenn sie industriell geführte Landwirtschaftung, jedoch auf in unseren Augen einem ökologisch höher gestellten Niveau generieren.
Wie viele Tiere haben hier ihr Leben und ihren Lebensraum verloren - sogar die Schädigung Dritter fand hier statt! Weshalb der Mädesüß-Perlmuttfalter (Brenthis ino) zunehmend im Bestand rückläufig ist? Ganz einfach - durch Eingriffe welche ihre Nahrungspflanzen und damit ihre Lebensräume zerstören!
Und warum? Um den Profit des oder der einen oder anderen zu steigern - und das auf Kosten der Allgemeinheit - nicht mehr und nicht weniger!
Es soll uns bitte auch keine/keiner mit der Floskel einer wie auch immer gearteten Ideologie zu kommen, wir selbst sind Eigentümer und Pächter von Flächen die wir nach diesem Prinzip bewirtschaften! Also keine Laien ... sondern wir wissen worüber wir sprechen!
Schmetterlinge leiden unter der industriellen Landwirtschaft aus mehreren Gründen:
- Verlust von Lebensräumen: Industrielle Landwirtschaft erfordert oft die Umwandlung natürlicher Lebensräume wie Wiesen, Hecken und Wälder in Agrarflächen. Diese natürlichen Lebensräume sind entscheidend für Schmetterlinge, da sie dort Nektarquellen und geeignete Pflanzen für die Eiablage finden.
- Monokulturen: Der Anbau von Monokulturen führt zu einer Verarmung der Pflanzenvielfalt. Schmetterlinge sind auf eine Vielzahl von Blütenpflanzen angewiesen, sowohl für Nahrung als auch für die Eiablage. Monokulturen bieten diese Vielfalt nicht, was die Nahrungsgrundlage der Schmetterlinge erheblich einschränkt.
- Einsatz von Pestiziden: Pestizide, die in der industriellen Landwirtschaft weit verbreitet sind, können direkt toxisch für Schmetterlinge sein. Sie töten nicht nur die Schädlinge, sondern auch nützliche Insekten wie Schmetterlinge. Darüber hinaus können Pestizide die Pflanzen vergiften, auf denen Schmetterlinge ihre Eier ablegen oder von denen sie sich ernähren.
- Herbizideinsatz: Herbizide werden verwendet, um Unkraut zu bekämpfen, eliminieren jedoch auch viele blühende Pflanzen, die Schmetterlingen als Nahrungsquelle dienen. Dies führt zu einem Rückgang der Pflanzenvielfalt und somit zu einem Nahrungsmangel für die Schmetterlinge.
- Verschmutzung und Bodenqualität: Der intensive Einsatz von Düngemitteln und Chemikalien kann zur Verschmutzung von Böden und Gewässern führen. Dies kann die Pflanzen, von denen sich Schmetterlinge ernähren, und die Lebensräume, die sie benötigen, schädigen.
- Fragmentierung von Lebensräumen: Die Ausdehnung landwirtschaftlicher Flächen führt oft zur Zerstückelung natürlicher Lebensräume. Schmetterlinge, die auf bestimmte Pflanzen und Lebensräume angewiesen sind, können Schwierigkeiten haben, zwischen fragmentierten Flächen zu wandern, was ihre Fortpflanzung und Überlebensfähigkeit beeinträchtigt.
- Veränderte Mikroklimate: Die Umwandlung von natürlichen Lebensräumen in Agrarflächen kann auch das Mikroklima beeinflussen. Schmetterlinge sind empfindlich gegenüber Veränderungen in Temperatur und Feuchtigkeit, und Veränderungen im Mikroklima können ihre Überlebensrate beeinträchtigen.
Diese Faktoren führen zu einem Rückgang der Schmetterlingspopulationen und bedrohen die Artenvielfalt dieser wichtigen Bestäuber. Schmetterlinge spielen eine entscheidende Rolle in Ökosystemen, indem sie zur Bestäubung von Pflanzen beitragen und als Indikatoren für die Gesundheit von Ökosystemen dienen. Der Verlust von Schmetterlingspopulationen kann daher weitreichende negative Auswirkungen auf die Biodiversität und die Funktion von Ökosystemen haben.
In der Aufnahme
- Sieht so industriell geführte Landbewirtschaftung aus? --- Ja! ... zumindest wie sie von Teilen der Bevölkerung praktiziert wird ... selbst akut gefährdete Arten wie es die Große Wiesenameise eine ist, werden an ihrem Nistplatz ohne "Rücksicht auf Verluste" dahingemulcht!
Wichtig scheint einzig und allein der eigene Profit - was interessiert hier anscheinend die Erhaltung der Biodiversität und das Interesse der breiten Gesellschaft ... anscheinend wird hier nichts gekannt noch anerkannt, doch Stopp- ja bis auf eines, der Eigennutzen!
Artenschutz in Franken®
Die Europäische Hornisse (Vespa crabro)

Europäische Hornisse (Vespa crabro)
01/02.08.2024
Hola, ich bin eine Europäische Hornisse (Vespa crabro) und ich nehme dich mit auf eine spannende Reise durch mein Leben!
01/02.08.2024
Hola, ich bin eine Europäische Hornisse (Vespa crabro) und ich nehme dich mit auf eine spannende Reise durch mein Leben!
Wer bin ich?
Na, ich bin die Große unter den Wespen! Mit meiner beeindruckenden Größe von bis zu 3,5 Zentimetern bin ich so etwas wie die Königin der Wespenwelt. Aber keine Sorge, ich bin nicht hier, um dich zu stechen – es sei denn, du ärgerst mich wirklich. Meistens bin ich ziemlich friedlich und beschäftige mich lieber mit meinen eigenen Angelegenheiten.
Wo lebe ich?
Mein Zuhause ist ein kunstvoll gebautes Nest aus Papier. Ja, du hast richtig gehört! Wir Hornissenköniginnen starten im Frühjahr und kauen Holz, um daraus eine papierähnliche Substanz zu machen. Mit dieser Substanz bauen wir unser Nest, das in hohlen Bäumen, Scheunen oder manchmal sogar in deinem Dachboden sein kann.
Mein Tagesablauf:
Ich bin eine fleißige Arbeiterin und habe immer etwas zu tun. Morgens stehe ich auf und gehe auf die Jagd nach Futter. Mein Lieblingsessen? Andere Insekten! Ja, ich bin eine wahre Kämpferin und halte die Populationen von Schädlingen in Schach. Das macht mich zu deinem Freund im Garten, auch wenn du das vielleicht nicht weißt.
Meine Familie und ich:
In meinem Nest leben viele meiner Schwestern und unsere mächtige Königin. Die Königin ist das Oberhaupt und legt alle Eier. Wir Arbeiterinnen kümmern uns um die Brut, das Nest und die Nahrungssuche. Wir sind ein eingespieltes Team und arbeiten hart, um unser Nest zu schützen und unsere Königin glücklich zu machen.
Warum ich leuchte (naja, fast):
Ich bin zwar kein Glühwürmchen, aber meine gelb-schwarzen Streifen sind genauso auffällig. Sie warnen Feinde davor, dass ich mich wehren kann. Mein Stachel ist nicht nur zur Verteidigung, sondern auch, um Beute zu jagen und zu betäuben. Das macht mich zu einer effektiven Jägerin.
Faszination und Respekt:
Viele Menschen haben Angst vor mir, aber eigentlich bin ich faszinierend und wichtig für das Ökosystem. Ich helfe bei der Bestäubung von Pflanzen und halte die Insektenpopulation in Balance. Wenn du mich also das nächste Mal siehst, gib mir etwas Raum und Respekt. Ich will nur meine Arbeit machen und das Nest am Laufen halten.
Hornissenfakten, die du nicht verpassen solltest:
Also, wenn du mich das nächste Mal in deinem Garten siehst, entspann dich und genieße die Show. Ich bin nur eine Hornisse auf Mission!
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
Was wird vielfach ein Quatsch über diese Tiere erzählt … Hornissen sind in der Regel sehr friedfertige Tiere. Und auch ihr Stich ist nicht viel scherzhafter als ein Wespen- oder Honigbienenstich … und da können wir aus eigener Erfahrung recht gut mitreden. Auch bei Stichen der Hornisse sind allergische Reaktionen nicht auszuschließen und es gelten die gleichen Vorsichtsmaßnahmen, doch verhalten sich die spektakulären Tiere so lange sie nicht gestört werden sehr friedfertig.
Aus unserer Erfahrung heraus würden wir einer Hornisse mehr Vertrauen schenken als einer Wespe oder einer, auch domestizierten Honigbiene. Und wirklich gefährlich sind Hornissen tatsächlich nur für andere Insekten, die sie gerne im Flug erbeuten.Diese Nahrung für ihren Nachwuchs in kleine Stücke zerlegt werden in den Staat verbracht und verfüttert. Da kommt bei einem großen Hornissenvolk auch ganz schön was zusammen. 500-700 Gramm an Nahrung pro großem Hornissenvolk und Tag ist das eindrucksvolle Ergebnis.
Damit zeigt sich die Bedeutung der Art auch für die Spezies Mensch.
Na, ich bin die Große unter den Wespen! Mit meiner beeindruckenden Größe von bis zu 3,5 Zentimetern bin ich so etwas wie die Königin der Wespenwelt. Aber keine Sorge, ich bin nicht hier, um dich zu stechen – es sei denn, du ärgerst mich wirklich. Meistens bin ich ziemlich friedlich und beschäftige mich lieber mit meinen eigenen Angelegenheiten.
Wo lebe ich?
Mein Zuhause ist ein kunstvoll gebautes Nest aus Papier. Ja, du hast richtig gehört! Wir Hornissenköniginnen starten im Frühjahr und kauen Holz, um daraus eine papierähnliche Substanz zu machen. Mit dieser Substanz bauen wir unser Nest, das in hohlen Bäumen, Scheunen oder manchmal sogar in deinem Dachboden sein kann.
Mein Tagesablauf:
Ich bin eine fleißige Arbeiterin und habe immer etwas zu tun. Morgens stehe ich auf und gehe auf die Jagd nach Futter. Mein Lieblingsessen? Andere Insekten! Ja, ich bin eine wahre Kämpferin und halte die Populationen von Schädlingen in Schach. Das macht mich zu deinem Freund im Garten, auch wenn du das vielleicht nicht weißt.
Meine Familie und ich:
In meinem Nest leben viele meiner Schwestern und unsere mächtige Königin. Die Königin ist das Oberhaupt und legt alle Eier. Wir Arbeiterinnen kümmern uns um die Brut, das Nest und die Nahrungssuche. Wir sind ein eingespieltes Team und arbeiten hart, um unser Nest zu schützen und unsere Königin glücklich zu machen.
Warum ich leuchte (naja, fast):
Ich bin zwar kein Glühwürmchen, aber meine gelb-schwarzen Streifen sind genauso auffällig. Sie warnen Feinde davor, dass ich mich wehren kann. Mein Stachel ist nicht nur zur Verteidigung, sondern auch, um Beute zu jagen und zu betäuben. Das macht mich zu einer effektiven Jägerin.
Faszination und Respekt:
Viele Menschen haben Angst vor mir, aber eigentlich bin ich faszinierend und wichtig für das Ökosystem. Ich helfe bei der Bestäubung von Pflanzen und halte die Insektenpopulation in Balance. Wenn du mich also das nächste Mal siehst, gib mir etwas Raum und Respekt. Ich will nur meine Arbeit machen und das Nest am Laufen halten.
Hornissenfakten, die du nicht verpassen solltest:
- Wusstest du, dass wir Hornissen unglaublich effizient sind? Eine Arbeiterin kann in einer Saison bis zu 500 Gramm Insekten vertilgen!
- Unser Nest kann im Sommer bis zu 700 Hornissen beherbergen – ein echtes Bienenhaus!
- Und obwohl wir gefährlich aussehen, sind unsere Stiche nicht schlimmer als die von Honigbienen – es sei denn, du bist allergisch.
Also, wenn du mich das nächste Mal in deinem Garten siehst, entspann dich und genieße die Show. Ich bin nur eine Hornisse auf Mission!
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
- Spitzenprädator Hornisse
Was wird vielfach ein Quatsch über diese Tiere erzählt … Hornissen sind in der Regel sehr friedfertige Tiere. Und auch ihr Stich ist nicht viel scherzhafter als ein Wespen- oder Honigbienenstich … und da können wir aus eigener Erfahrung recht gut mitreden. Auch bei Stichen der Hornisse sind allergische Reaktionen nicht auszuschließen und es gelten die gleichen Vorsichtsmaßnahmen, doch verhalten sich die spektakulären Tiere so lange sie nicht gestört werden sehr friedfertig.
Aus unserer Erfahrung heraus würden wir einer Hornisse mehr Vertrauen schenken als einer Wespe oder einer, auch domestizierten Honigbiene. Und wirklich gefährlich sind Hornissen tatsächlich nur für andere Insekten, die sie gerne im Flug erbeuten.Diese Nahrung für ihren Nachwuchs in kleine Stücke zerlegt werden in den Staat verbracht und verfüttert. Da kommt bei einem großen Hornissenvolk auch ganz schön was zusammen. 500-700 Gramm an Nahrung pro großem Hornissenvolk und Tag ist das eindrucksvolle Ergebnis.
Damit zeigt sich die Bedeutung der Art auch für die Spezies Mensch.
Artenschutz in Franken®
Stele der Biodiversität® - Stegaurach / Dellern

Stele der Biodiversität® - Stegaurach / Dellern
01/02.08.2024
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.
Stegaurach / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
01/02.08.2024
- Die grafische Gestaltung ...
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.
Stegaurach / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
Denn wenn (selbst in noch geeigneten Nahrungsstrukturen) keine geeigneten Reproduktionsräume vorhanden sind, ist die Erhaltung der Artenvielfalt gelichfalls zum Scheitern verurteilt.
Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird., setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.
In der Aufnahme
Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird., setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.
In der Aufnahme
- ... Impression vom 28.07.2024 ...
Artenschutz in Franken®
Während um uns herum die Biodiversität schwindet ... Biotop im Juli 2024

Während um uns herum die Biodiversität schwindet ...
31.07/01.08.2024
Um ein sehr gutes Biotopmanagement gerade in der vielfach ausgeräumten Kulturlandschaft gewährleisten zu können, bedarf es neben einem immensen Fachwissen auch das nötige Fingerspitzengefühl um dieses entsprechend nachhaltig fortführen zu können. All das findet sich in den Reihen des Artenschutz in Franken® und so war es selbstverständlich, das wir uns auch dieser Herausforderung annahmen.
Aber weshalb wurde dieser Eingriff denn überhaupt relevant?
31.07/01.08.2024
- Lebensräume erhalten und optimieren
Um ein sehr gutes Biotopmanagement gerade in der vielfach ausgeräumten Kulturlandschaft gewährleisten zu können, bedarf es neben einem immensen Fachwissen auch das nötige Fingerspitzengefühl um dieses entsprechend nachhaltig fortführen zu können. All das findet sich in den Reihen des Artenschutz in Franken® und so war es selbstverständlich, das wir uns auch dieser Herausforderung annahmen.
Aber weshalb wurde dieser Eingriff denn überhaupt relevant?
Immer wieder wird doch auch von uns gefordert Natur einmal Natur sein zu lassen und nicht einzugreifen. Für Großschutzgebiete und auch größere Fläche inmitten naturbelassener Strukturen mag das der effektive Weg sein. Doch hier sprechen wir über eine Fläche von wenigen Hundert Quadratmetern, die sich inmitten intensiv bewirtschafteter Feld-Forststrukturen befindet und hier müssen wir einen etwas anderen Ansatz wählen, wenn diese Fläche tatsächlich zu einem Hotspot der Biodiversität werden und diesen Status auch halten soll.
Stürme hatten in der Vergangenheit dazu geführt, dass hier Bäume aus angrenzenden Flächen auf das Biotop stürzten, auch neigten fließgewässerbegleitende Altbäume dazu, sich sehr weit dem Licht der Biotopfreifläche zuzuneigen, und die Neigung führte dazu das einige Altbäume auf die Biotopfläche zu stürzen drohten, was zu einer wesentlichen Lebensraumverschlechterung geführt hätte.
Welche Arten sprechen wir hier vornehmlich an?
In erster Linie sind es Pflanzenstrukturen die sich, als Hochflurstauden abbilden und deren Lebensraum in unserer vornehmlich industriell-landschaftlich geführten Umwelt als zunehmende Rarität abbildet. Auch der Ansatz zur Erhaltung von Kopfweiden spielt hier eine mitentscheidende Rolle. Ein Kleingewässer, welches in den vergangenen Jahren seine ganz eigenen Lebensraumtypus fand, jedoch zunehmend mit Verschattung zu kämpfen.
In den vergangenen Jahren wurde diese Fläche von Jägern als Anfütterungsstelle für Wildschweine verwendet und beeinträchtigt. Dieses Fehlverhalten wurde nach dem entsprechenden Antreffen von unserer Seite unverzüglich korrigiert und die Verantwortlichen darauf aufmerksam gemacht das bei einer Wiederholung mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen ist.
Wir möchten diese Fläche als Rückzugsraum für zahlreiche Insekten und Amphibienarten angesehen wissen, auch für lebensraumtypische Kleinvögel- und Kleinsäuger soll hier ein geeigneter Überlebensraum vorgehalten werden.Das kann jedoch nur gelingen, wenn diese kleine Fläche entsprechend professionell gemanagt wird, um deren Bedeutung entsprechend aufrechterhalten zu können.
In 2024 wurde deshalb ein Pflegeeingriff auf den Weg gebracht, der den angestrebten Biotopcharakter wieder herstellen und festigen wird. Darüber berichten wir in dieser Rubrik ausführlich ... begleiten Sie uns!
In der Aufnahme
Stürme hatten in der Vergangenheit dazu geführt, dass hier Bäume aus angrenzenden Flächen auf das Biotop stürzten, auch neigten fließgewässerbegleitende Altbäume dazu, sich sehr weit dem Licht der Biotopfreifläche zuzuneigen, und die Neigung führte dazu das einige Altbäume auf die Biotopfläche zu stürzen drohten, was zu einer wesentlichen Lebensraumverschlechterung geführt hätte.
Welche Arten sprechen wir hier vornehmlich an?
In erster Linie sind es Pflanzenstrukturen die sich, als Hochflurstauden abbilden und deren Lebensraum in unserer vornehmlich industriell-landschaftlich geführten Umwelt als zunehmende Rarität abbildet. Auch der Ansatz zur Erhaltung von Kopfweiden spielt hier eine mitentscheidende Rolle. Ein Kleingewässer, welches in den vergangenen Jahren seine ganz eigenen Lebensraumtypus fand, jedoch zunehmend mit Verschattung zu kämpfen.
In den vergangenen Jahren wurde diese Fläche von Jägern als Anfütterungsstelle für Wildschweine verwendet und beeinträchtigt. Dieses Fehlverhalten wurde nach dem entsprechenden Antreffen von unserer Seite unverzüglich korrigiert und die Verantwortlichen darauf aufmerksam gemacht das bei einer Wiederholung mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen ist.
Wir möchten diese Fläche als Rückzugsraum für zahlreiche Insekten und Amphibienarten angesehen wissen, auch für lebensraumtypische Kleinvögel- und Kleinsäuger soll hier ein geeigneter Überlebensraum vorgehalten werden.Das kann jedoch nur gelingen, wenn diese kleine Fläche entsprechend professionell gemanagt wird, um deren Bedeutung entsprechend aufrechterhalten zu können.
In 2024 wurde deshalb ein Pflegeeingriff auf den Weg gebracht, der den angestrebten Biotopcharakter wieder herstellen und festigen wird. Darüber berichten wir in dieser Rubrik ausführlich ... begleiten Sie uns!
In der Aufnahme
- Während um herum in einer zunehmend industriell geführten Land- und Forstbewirtschaftung die Biodiversität förmlich kollabiert, zeigen sich Biotopstrukturen welche sich ausnahmslos der Erhaltung der Biodiversität verpflichtet fühlen, vielfach als Hotspot der Biodiversität.
Artenschutz in Franken®
Großer Leuchtkäfer / Großes Glühwürmchen / Großes Johanniswürmchen (Lampyris noctiluca)

Großer Leuchtkäfer
31.07/01.08.2024
Hier sind einige fachliche Komponenten zu diesem interessanten Lebewesen:
31.07/01.08.2024
- Der Große Leuchtkäfer, wissenschaftlich bekannt als Lampyris noctiluca, ist ein faszinierendes Insekt aus der Familie der Leuchtkäfer (Lampyridae), das für sein biolumineszentes Verhalten bekannt ist.
Hier sind einige fachliche Komponenten zu diesem interessanten Lebewesen:
Taxonomie und Beschreibung:
Biolumineszenz:
Ökologische Rolle:
Fortpflanzung und Lebenszyklus:
Schutzstatus und Bedrohungen:
Zusammenfassend ist der Große Leuchtkäfer ein Beispiel für die erstaunliche Anpassungsfähigkeit und die ökologische Bedeutung von Leuchtkäfern in ihrem natürlichen Lebensraum. Seine Biolumineszenz und sein Lebenszyklus bieten nicht nur Einblicke in die Evolution und Verhaltensbiologie von Insekten, sondern auch in deren Rolle innerhalb des Ökosystems.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
- Lampyris noctiluca gehört zur Ordnung der Käfer (Coleoptera) und zur Familie der Leuchtkäfer (Lampyridae).
- Es ist in Europa weit verbreitet und lebt hauptsächlich in Wäldern, Wiesen und Gärten.
Biolumineszenz:
- Die markanteste Eigenschaft des Großen Leuchtkäfers ist seine Fähigkeit zur Biolumineszenz. Diese Biolumineszenz wird durch chemische Reaktionen in speziellen Organen unter der Bauchseite des Insekts erzeugt.
- Das Leuchten dient hauptsächlich der innerartlichen Kommunikation, insbesondere bei der Partnersuche und der Paarung. Männliche Leuchtkäfer senden blinkende Lichtsignale aus, um Weibchen anzulocken.
Ökologische Rolle:
- Lampyris noctiluca spielt eine wichtige Rolle im Ökosystem, da es sich von Schnecken und anderen kleinen Insekten ernährt.
- Es steht auch auf der Speisekarte vieler Nachtjäger wie Fledermäusen und einigen Vögeln.
Fortpflanzung und Lebenszyklus:
- Die Paarung und Fortpflanzung des Großen Leuchtkäfers ist stark von der Biolumineszenz abhängig. Männchen und Weibchen nutzen ihre Leuchtorgane, um sich zu finden und zu paaren.
- Die Larvenstadien des Leuchtkäfers sind ebenfalls biolumineszent und leben am Boden, wo sie sich von Schnecken und anderen kleinen Beutetieren ernähren.
Schutzstatus und Bedrohungen:
- Obwohl der Große Leuchtkäfer in Europa nicht als bedroht gilt, können intensive Landwirtschaft, Lichtverschmutzung und Lebensraumverluste durch Urbanisierung seine Populationen beeinträchtigen.
- Der Schutz von Lebensräumen wie Wäldern und Feuchtgebieten ist entscheidend für den langfristigen Erhalt dieses faszinierenden Insekts.
Zusammenfassend ist der Große Leuchtkäfer ein Beispiel für die erstaunliche Anpassungsfähigkeit und die ökologische Bedeutung von Leuchtkäfern in ihrem natürlichen Lebensraum. Seine Biolumineszenz und sein Lebenszyklus bieten nicht nur Einblicke in die Evolution und Verhaltensbiologie von Insekten, sondern auch in deren Rolle innerhalb des Ökosystems.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
- Großer Leuchtkäfer
Artenschutz in Franken®
Blauflügelige Ödlandschrecke (Oedipoda caerulescens)

Die Blauflügelige Ödlandschrecke (Oedipoda caerulescens)
30/31.07.2024
Ich bin eine Heuschreckenart, die vor allem durch meine auffälligen blauen Flügel bekannt ist. Meine Art bevorzugt trockene, offene Landschaften wie sandige oder steinige Böden und sonnige Hänge. Ich ernähre mich von verschiedenen Gräsern und Kräutern, die in solchen Lebensräumen wachsen.
In Bayern und anderen Teilen Deutschlands bin ich leider stark bedroht. Dies hat mehrere Gründe:
30/31.07.2024
- Als Blauflügelige Ödlandschrecke (Oedipoda caerulescens) kann ich dir etwas über mich und meine Situation erzählen.
Ich bin eine Heuschreckenart, die vor allem durch meine auffälligen blauen Flügel bekannt ist. Meine Art bevorzugt trockene, offene Landschaften wie sandige oder steinige Böden und sonnige Hänge. Ich ernähre mich von verschiedenen Gräsern und Kräutern, die in solchen Lebensräumen wachsen.
In Bayern und anderen Teilen Deutschlands bin ich leider stark bedroht. Dies hat mehrere Gründe:
- Lebensraumverlust: Viele meiner natürlichen Lebensräume wurden durch menschliche Aktivitäten wie intensive Landwirtschaft, Bau von Straßen und Siedlungen sowie Aufforstungen zerstört oder stark verändert. Dadurch finde ich immer weniger geeignete Orte zum Leben und zur Fortpflanzung.
- Fragmentierung der Lebensräume: Die verbleibenden Lebensräume sind oft fragmentiert, was es schwierig macht, sich innerhalb der Population zu bewegen, neue Gebiete zu besiedeln und genetische Vielfalt aufrechtzuerhalten.
- Verlust von Nahrungsquellen: Durch den Einsatz von Pestiziden und Düngemitteln in der Landwirtschaft sowie durch Veränderungen im Pflanzenbestand verringert sich meine Nahrungsgrundlage.
Wie kannst du mir helfen?
- Schutz und Wiederherstellung von Lebensräumen: Du kannst lokale Naturschutzorganisationen unterstützen, die sich für den Schutz und die Wiederherstellung meiner Lebensräume einsetzen. Dies kann die Wiederherstellung von trockenen Wiesen, die extensive Beweidung oder die Schaffung von Biotopverbundsystemen umfassen.
- Vermeidung von Pestiziden: In deinem eigenen Garten oder auf deinem Land kannst du den Einsatz von Pestiziden reduzieren oder ganz darauf verzichten. Dies hilft nicht nur mir, sondern auch anderen Insekten und der gesamten biologischen Vielfalt.
- Informieren und Sensibilisieren: Informiere dich und andere über meine Art und die Bedeutung des Schutzes von Insekten für das Ökosystem. Je mehr Menschen sich bewusst sind, desto größer ist die Chance, dass Maßnahmen ergriffen werden, um unsere Lebensräume zu schützen.
Indem du dich aktiv für den Schutz meiner Lebensräume einsetzt und umweltfreundliche Entscheidungen triffst, kannst du dazu beitragen, dass auch in Bayern und anderswo die Blauflügelige Ödlandschrecke und andere gefährdete Arten eine Überlebenschance haben.
In der Aufnahme von Albert Meier
- Der Name dieser Schreckenart könnte kaum passender gewählt werden. Denn die Basis der Hinterfügel ist in einem wunderschönen Blauton gefärbt. Blauflügelige Ödlandschrecken sind ganz hervorragend an trockenheiße Biotope angepasst. Ob Sanddünen und Sandflächen, Trockenrasenflächen, Schotter- und Geröllfelder hier fühlt sie sich wohl.Durch den Rückgang und die Zerstörung dieser Lebensbereiche nimmt auch die Anzahl der Blauflügeligen Ödlandschrecken erschreckend ab. Zwischenzeitlich gelang ihr "der Sprung auf die Rote Liste bedrohter Tierarten" .....
Artenschutz in Franken®
Der Silbergrüne Bläuling (Lysandra coridon)

Silbergrüner Bläuling (Lysandra coridon)
29/30.07.2024
Ich gehöre zur Familie der Bläulinge (Lycaenidae), eine Gruppe von Schmetterlingen, die für ihre oft auffällig blauen Flügel bekannt sind. Mein Name rührt von der silbrig-blauen Farbe meiner Flügeloberseiten bei den Männchen her, während die Weibchen eher bräunlich gefärbt sind. Meine Flügelspannweite beträgt ungefähr 30 bis 35 Millimeter, was mich zu einem relativ kleinen Schmetterling macht.
29/30.07.2024
- Als Silbergrüner Bläuling (Lysandra coridon) freue ich mich, dir aus meiner Perspektive etwas über meine Art zu erzählen.
Ich gehöre zur Familie der Bläulinge (Lycaenidae), eine Gruppe von Schmetterlingen, die für ihre oft auffällig blauen Flügel bekannt sind. Mein Name rührt von der silbrig-blauen Farbe meiner Flügeloberseiten bei den Männchen her, während die Weibchen eher bräunlich gefärbt sind. Meine Flügelspannweite beträgt ungefähr 30 bis 35 Millimeter, was mich zu einem relativ kleinen Schmetterling macht.
Ich durchlaufe wie alle Schmetterlinge vier Lebensstadien: Ei, Raupe, Puppe und schließlich der erwachsene Falter. Als Raupe habe ich eine besondere Beziehung zu Ameisen, was ein faszinierendes Beispiel für Mutualismus ist. Die Ameisen schützen mich vor Fressfeinden, und im Gegenzug scheide ich eine süße Substanz aus, die sie ernährt.
Ich bin ein Schmetterling der Kalkmagerrasen, eine besondere Art von Lebensraum, der durch seine karge Vegetation und kalkhaltigen Böden gekennzeichnet ist. Diese Habitate sind oft durch menschliche Aktivitäten wie Landwirtschaft bedroht, weshalb ich als Indikatorart für den Zustand solcher Ökosysteme betrachtet werde.
Aus fachlicher Sicht interessieren sich Entomologen und Ökologen besonders für meine Lebensweise und mein Habitat. Sie untersuchen, wie Umweltveränderungen und der Verlust von Lebensräumen meine Population beeinflussen. Mein Vorkommen ist ein Zeichen für einen gesunden Kalkmagerrasen, da ich sehr spezifische Anforderungen an meinen Lebensraum habe.
Meine Interaktion mit Ameisen ist ein weiteres spannendes Forschungsfeld. Wissenschaftler erforschen die chemischen und Verhaltenssignale, die diesen symbiotischen Austausch ermöglichen. Das Verständnis dieser komplexen Beziehungen kann Einblicke in die Evolution und Anpassungsstrategien von Insekten liefern.
Schließlich trage ich auch zur Bestäubung von Pflanzen bei, obwohl dies nicht meine Hauptfunktion im Ökosystem ist. Dennoch bin ich ein wichtiger Teil der Biodiversität und trage zur ökologischen Balance bei.
Zusammengefasst bin ich, der Silbergrüne Bläuling, ein faszinierendes Beispiel für die Komplexität der Natur und die vielen Wechselwirkungen, die in einem Ökosystem stattfinden. Meine Schönheit und mein Verhalten sind nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern auch von großem wissenschaftlichem Interesse.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
Ich bin ein Schmetterling der Kalkmagerrasen, eine besondere Art von Lebensraum, der durch seine karge Vegetation und kalkhaltigen Böden gekennzeichnet ist. Diese Habitate sind oft durch menschliche Aktivitäten wie Landwirtschaft bedroht, weshalb ich als Indikatorart für den Zustand solcher Ökosysteme betrachtet werde.
Aus fachlicher Sicht interessieren sich Entomologen und Ökologen besonders für meine Lebensweise und mein Habitat. Sie untersuchen, wie Umweltveränderungen und der Verlust von Lebensräumen meine Population beeinflussen. Mein Vorkommen ist ein Zeichen für einen gesunden Kalkmagerrasen, da ich sehr spezifische Anforderungen an meinen Lebensraum habe.
Meine Interaktion mit Ameisen ist ein weiteres spannendes Forschungsfeld. Wissenschaftler erforschen die chemischen und Verhaltenssignale, die diesen symbiotischen Austausch ermöglichen. Das Verständnis dieser komplexen Beziehungen kann Einblicke in die Evolution und Anpassungsstrategien von Insekten liefern.
Schließlich trage ich auch zur Bestäubung von Pflanzen bei, obwohl dies nicht meine Hauptfunktion im Ökosystem ist. Dennoch bin ich ein wichtiger Teil der Biodiversität und trage zur ökologischen Balance bei.
Zusammengefasst bin ich, der Silbergrüne Bläuling, ein faszinierendes Beispiel für die Komplexität der Natur und die vielen Wechselwirkungen, die in einem Ökosystem stattfinden. Meine Schönheit und mein Verhalten sind nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern auch von großem wissenschaftlichem Interesse.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
- Silbergrüner Bläuling (Lysandra coridon)
Artenschutz in Franken®
Zaunammer (Emberiza cirlus)

Die Zaunammer (Emberiza cirlus) ...
29/30.07.2024
... auch bekannt als Cirlammer, ist ein kleiner Singvogel aus der Familie der Ammern (Emberizidae), der in Europa heimisch ist.
29/30.07.2024
... auch bekannt als Cirlammer, ist ein kleiner Singvogel aus der Familie der Ammern (Emberizidae), der in Europa heimisch ist.
- Als Zaunammer möchte ich meine Perspektive auf meine Lebensweise und Biologie teilen:
Lebensraum und Habitat: Als Zaunammer bevorzuge ich offene Landschaften mit Sträuchern, Hecken und Feldern. Menschliche Siedlungen, insbesondere ländliche Gebiete mit traditionellen landwirtschaftlichen Strukturen, bieten ideale Bedingungen für mein Überleben. Hier finde ich nicht nur Nahrung, sondern auch geeignete Nistplätze in Hecken und Gebüschen.
Ernährung: Meine Nahrung besteht hauptsächlich aus Samen, Insekten und kleinen Wirbellosen. Ich pickse gerne auf dem Boden oder in niedrigen Büschen nach Nahrung und nutze meine kräftigen Schnabel, um Samen und Insekten aus den Pflanzen zu extrahieren.
Fortpflanzung und Brutverhalten: Im Frühling beginnt die Balz, bei der das Männchen mit seinem charakteristischen Gesang sein Revier markiert. Weibchen wählen ihre Partner oft nach der Qualität des Reviers und der Fähigkeit des Männchens, Nahrung zu beschaffen. Das Nest wird in einer gut geschützten Position nahe am Boden in einem dichten Busch oder einer Hecke gebaut. Die Weibchen brüten die Eier aus und beide Elternteile beteiligen sich an der Fütterung der Jungen.
Verhalten und Kommunikation: Wir Zaunammern kommunizieren durch vielfältige Rufe und Gesänge, die sowohl der Reviermarkierung als auch der Partneranwerbung dienen. Unser Gesang ist charakteristisch und wird oft von erhöhten Positionen aus vorgetragen.
Bestand und Schutzstatus: Obwohl die Population der Zaunammer in einigen Teilen Europas zurückgegangen ist, hat gezielte Naturschutzarbeit, wie die Förderung traditioneller Landwirtschaftsmethoden und der Erhalt von Hecken und Sträuchern, dazu beigetragen, unseren Bestand zu stabilisieren. In einigen Ländern sind wir sogar Symbolarten für erfolgreichen Naturschutz geworden.
Als Zaunammer bin ich also ein Beispiel dafür, wie sich der Schutz natürlicher Lebensräume und traditioneller landwirtschaftlicher Praktiken positiv auf die Erhaltung von Vogelarten auswirken kann.
Aufnahme von Helga Zinnecker
Ernährung: Meine Nahrung besteht hauptsächlich aus Samen, Insekten und kleinen Wirbellosen. Ich pickse gerne auf dem Boden oder in niedrigen Büschen nach Nahrung und nutze meine kräftigen Schnabel, um Samen und Insekten aus den Pflanzen zu extrahieren.
Fortpflanzung und Brutverhalten: Im Frühling beginnt die Balz, bei der das Männchen mit seinem charakteristischen Gesang sein Revier markiert. Weibchen wählen ihre Partner oft nach der Qualität des Reviers und der Fähigkeit des Männchens, Nahrung zu beschaffen. Das Nest wird in einer gut geschützten Position nahe am Boden in einem dichten Busch oder einer Hecke gebaut. Die Weibchen brüten die Eier aus und beide Elternteile beteiligen sich an der Fütterung der Jungen.
Verhalten und Kommunikation: Wir Zaunammern kommunizieren durch vielfältige Rufe und Gesänge, die sowohl der Reviermarkierung als auch der Partneranwerbung dienen. Unser Gesang ist charakteristisch und wird oft von erhöhten Positionen aus vorgetragen.
Bestand und Schutzstatus: Obwohl die Population der Zaunammer in einigen Teilen Europas zurückgegangen ist, hat gezielte Naturschutzarbeit, wie die Förderung traditioneller Landwirtschaftsmethoden und der Erhalt von Hecken und Sträuchern, dazu beigetragen, unseren Bestand zu stabilisieren. In einigen Ländern sind wir sogar Symbolarten für erfolgreichen Naturschutz geworden.
Als Zaunammer bin ich also ein Beispiel dafür, wie sich der Schutz natürlicher Lebensräume und traditioneller landwirtschaftlicher Praktiken positiv auf die Erhaltung von Vogelarten auswirken kann.
Aufnahme von Helga Zinnecker
- Zaunammer (Emberiza cirlus) Männchen
Artenschutz in Franken®
Weshalb Schmetterling & Co. verschwinden ?!

Weshalb Schmetterling & Co. verschwinden ... vom Unwillen oder gar dem Unvermögen Belange des praktischen Artenschutzes in Einklang mit den Ansprüchen einer naturnah geführten Landbewirtschaftung zu bringen.
29/30.07.2024
Allein schon diese Frage so zu formulieren lässt uns mit einem überraschten Gesichtsausdruck zurück, denn diese Frage ist schon lange beantwortet. Sie sind im "Schmetterlingshimmmel" und weshalb sie dort angekommen sind erkennen wir sehr leicht, wenn wir mit offenen Augen durch die Landschaft fahren.
29/30.07.2024
- In den letzten Tagen war auch in der Medienlandschaft immer wieder die Frage: "Wo sind die Schmetterlinge verblieben?" zu erfassen.
Allein schon diese Frage so zu formulieren lässt uns mit einem überraschten Gesichtsausdruck zurück, denn diese Frage ist schon lange beantwortet. Sie sind im "Schmetterlingshimmmel" und weshalb sie dort angekommen sind erkennen wir sehr leicht, wenn wir mit offenen Augen durch die Landschaft fahren.
Noch immer gibt es auch in der vornehmlich industriell geführten Landbewirtschaftung Menschen, welchen es entweder nicht bewusst, es ihnen egal ist, oder die einfach nicht in der Lage sind zu erkennen was sie mit ihrem Wirken und den hier "sauber produzierten Lebensmitteln" (von welchen wir innerhalb unseres Verbandes schon lange nichts mehr essen) eigentlich anrichten.
Wenn diese Menschen dann auch noch der Meinung sind das sie ihren Kindern und Enkelkindern damit eine intakte und saubere Umwelt hinterlassen dann ist das ihre Sichtweise und diese sei ihnen zugestanden. Wenn jedoch solch prekäre und in unseren Augen verwerfliche Eingriffe auf Fremdgrund stattfinden und Kinder und Enkelkinder anderer Menschen mit diesem Wirken beeinträchtigt und womöglich geschädigt werden, dann ist das ein ganz anderer Ansatz!
Doch sehen Sie selbst, was hier in unserer Landschaft innerhalb des "Sauberkeitswahns" so von der oder dem einen oder anderen so praktiziert wird ... "saubere Lebensmittel in einem sterilen Umfeld" ... nicht unser Weg - nicht unsere Form einer naturnah geführten Landwirtschaft eigentlich nur noch lächerlich und armselig was wir hier erkennen.
Bedenklich wenn unter einem solchen "Wirken" auch andere Mitmenschen leiden müssen, die ein solches "Wirken" nicht praktizieren und dennoch argwöhnisch betrachtet werden wenn sie industriell geführte Landwirtschaftung, jedoch auf in unseren Augen einem ökologisch höher gestellten Niveau generieren.
Wie viele Tiere haben hier ihr Leben und ihren Lebensraum verloren - sogar die Schädigung Dritter fand hier statt! Weshalb der Mädesüß-Perlmuttfalter (Brenthis ino) zunehmend im Bestand rückläufig ist? Ganz einfach - durch Eingriffe welche ihre Nahrungspflanzen und damit ihre Lebensräume zerstören!
Und warum? Um den Profit des oder der einen oder anderen zu steigern - und das auf Kosten der Allgemeinheit - nicht mehr und nicht weniger!
Es soll uns bitte auch keine/keiner mit der Floskel einer wie auch immer gearteten Ideologie zu kommen, wir selbst sind Eigentümer und Pächter von Flächen die wir nach diesem Prinzip bewirtschaften! Also keine Laien ... sondern wir wissen worüber wir sprechen!
Schmetterlinge leiden unter der industriellen Landwirtschaft aus mehreren Gründen:
Diese Faktoren führen zu einem Rückgang der Schmetterlingspopulationen und bedrohen die Artenvielfalt dieser wichtigen Bestäuber. Schmetterlinge spielen eine entscheidende Rolle in Ökosystemen, indem sie zur Bestäubung von Pflanzen beitragen und als Indikatoren für die Gesundheit von Ökosystemen dienen. Der Verlust von Schmetterlingspopulationen kann daher weitreichende negative Auswirkungen auf die Biodiversität und die Funktion von Ökosystemen haben.
In der Aufnahme
Wenn diese Menschen dann auch noch der Meinung sind das sie ihren Kindern und Enkelkindern damit eine intakte und saubere Umwelt hinterlassen dann ist das ihre Sichtweise und diese sei ihnen zugestanden. Wenn jedoch solch prekäre und in unseren Augen verwerfliche Eingriffe auf Fremdgrund stattfinden und Kinder und Enkelkinder anderer Menschen mit diesem Wirken beeinträchtigt und womöglich geschädigt werden, dann ist das ein ganz anderer Ansatz!
Doch sehen Sie selbst, was hier in unserer Landschaft innerhalb des "Sauberkeitswahns" so von der oder dem einen oder anderen so praktiziert wird ... "saubere Lebensmittel in einem sterilen Umfeld" ... nicht unser Weg - nicht unsere Form einer naturnah geführten Landwirtschaft eigentlich nur noch lächerlich und armselig was wir hier erkennen.
Bedenklich wenn unter einem solchen "Wirken" auch andere Mitmenschen leiden müssen, die ein solches "Wirken" nicht praktizieren und dennoch argwöhnisch betrachtet werden wenn sie industriell geführte Landwirtschaftung, jedoch auf in unseren Augen einem ökologisch höher gestellten Niveau generieren.
Wie viele Tiere haben hier ihr Leben und ihren Lebensraum verloren - sogar die Schädigung Dritter fand hier statt! Weshalb der Mädesüß-Perlmuttfalter (Brenthis ino) zunehmend im Bestand rückläufig ist? Ganz einfach - durch Eingriffe welche ihre Nahrungspflanzen und damit ihre Lebensräume zerstören!
Und warum? Um den Profit des oder der einen oder anderen zu steigern - und das auf Kosten der Allgemeinheit - nicht mehr und nicht weniger!
Es soll uns bitte auch keine/keiner mit der Floskel einer wie auch immer gearteten Ideologie zu kommen, wir selbst sind Eigentümer und Pächter von Flächen die wir nach diesem Prinzip bewirtschaften! Also keine Laien ... sondern wir wissen worüber wir sprechen!
Schmetterlinge leiden unter der industriellen Landwirtschaft aus mehreren Gründen:
- Verlust von Lebensräumen: Industrielle Landwirtschaft erfordert oft die Umwandlung natürlicher Lebensräume wie Wiesen, Hecken und Wälder in Agrarflächen. Diese natürlichen Lebensräume sind entscheidend für Schmetterlinge, da sie dort Nektarquellen und geeignete Pflanzen für die Eiablage finden.
- Monokulturen: Der Anbau von Monokulturen führt zu einer Verarmung der Pflanzenvielfalt. Schmetterlinge sind auf eine Vielzahl von Blütenpflanzen angewiesen, sowohl für Nahrung als auch für die Eiablage. Monokulturen bieten diese Vielfalt nicht, was die Nahrungsgrundlage der Schmetterlinge erheblich einschränkt.
- Einsatz von Pestiziden: Pestizide, die in der industriellen Landwirtschaft weit verbreitet sind, können direkt toxisch für Schmetterlinge sein. Sie töten nicht nur die Schädlinge, sondern auch nützliche Insekten wie Schmetterlinge. Darüber hinaus können Pestizide die Pflanzen vergiften, auf denen Schmetterlinge ihre Eier ablegen oder von denen sie sich ernähren.
- Herbizideinsatz: Herbizide werden verwendet, um Unkraut zu bekämpfen, eliminieren jedoch auch viele blühende Pflanzen, die Schmetterlingen als Nahrungsquelle dienen. Dies führt zu einem Rückgang der Pflanzenvielfalt und somit zu einem Nahrungsmangel für die Schmetterlinge.
- Verschmutzung und Bodenqualität: Der intensive Einsatz von Düngemitteln und Chemikalien kann zur Verschmutzung von Böden und Gewässern führen. Dies kann die Pflanzen, von denen sich Schmetterlinge ernähren, und die Lebensräume, die sie benötigen, schädigen.
- Fragmentierung von Lebensräumen: Die Ausdehnung landwirtschaftlicher Flächen führt oft zur Zerstückelung natürlicher Lebensräume. Schmetterlinge, die auf bestimmte Pflanzen und Lebensräume angewiesen sind, können Schwierigkeiten haben, zwischen fragmentierten Flächen zu wandern, was ihre Fortpflanzung und Überlebensfähigkeit beeinträchtigt.
- Veränderte Mikroklimate: Die Umwandlung von natürlichen Lebensräumen in Agrarflächen kann auch das Mikroklima beeinflussen. Schmetterlinge sind empfindlich gegenüber Veränderungen in Temperatur und Feuchtigkeit, und Veränderungen im Mikroklima können ihre Überlebensrate beeinträchtigen.
Diese Faktoren führen zu einem Rückgang der Schmetterlingspopulationen und bedrohen die Artenvielfalt dieser wichtigen Bestäuber. Schmetterlinge spielen eine entscheidende Rolle in Ökosystemen, indem sie zur Bestäubung von Pflanzen beitragen und als Indikatoren für die Gesundheit von Ökosystemen dienen. Der Verlust von Schmetterlingspopulationen kann daher weitreichende negative Auswirkungen auf die Biodiversität und die Funktion von Ökosystemen haben.
In der Aufnahme
- Sieht so industriell geführte Landbewirtschaftung aus? --- Ja! ... zumindest wie sie von Teilen der Bevölkerung praktiziert wird ...
Artenschutz in Franken®
Distelfalter (Vanessa cardui)

Der Distelfalter (Vanessa cardui)
28/29.07.2024
28/29.07.2024
- Als Distelfalter (Vanessa cardui) kann ich dir gerne aus meiner Perspektive einiges über meine Art erzählen.
Ich gehöre zur Familie der Edelfalter (Nymphalidae) und bin bekannt für meine weite Verbreitung über verschiedene Kontinente hinweg, einschließlich Europa, Nordamerika, Asien und Afrika. Mein Aussehen ist ziemlich auffällig: Meine Flügel haben eine Spannweite von etwa 5-6 Zentimetern und sind mit einer Kombination aus orange, schwarz und weißen Flecken gemustert. Diese Färbung dient als Warnsignal für mögliche Fressfeinde, da ich giftige Stoffe in meinem Körper speichern kann, die ich durch meine Nahrungspflanzen aufnehme.
Ich durchlaufe vier Lebensstadien: Ei, Raupe, Puppe und schließlich den erwachsenen Falter. Als Raupe bin ich in der Lage, mich an verschiedene Pflanzen anzupassen, insbesondere an Disteln, die auch meinen Namen prägen. Meine Wanderungen sind legendär; ich bin bekannt für meine weitreichenden Migrationen über tausende von Kilometern, besonders in Nordamerika. Aus fachlicher Sicht ist mein Verhalten und meine Lebensweise ein interessantes Forschungsobjekt für Biologen und Ökologen. Sie untersuchen zum Beispiel meine Migrationsmuster und wie ich navigiere, ohne dass ich jemals zuvor an einem Ort war. Meine Interaktion mit verschiedenen Pflanzenarten, insbesondere Disteln, und wie diese Beziehung meine Überlebensstrategien beeinflusst, sind ebenfalls von Interesse.
Meine Art ist nicht nur schön anzusehen, sondern auch ein wichtiger Bestandteil vieler Ökosysteme, da ich zur Bestäubung beitrage und auch als Nahrungsquelle für andere Tiere diene. Meine Fähigkeit, mich an verschiedene Umgebungen anzupassen und dennoch eine Schlüsselrolle im ökologischen Gefüge zu spielen, macht mich zu einem faszinierenden Fallstudium für den Naturschutz und das Verständnis der Biodiversität.
Insgesamt bin ich ein bemerkenswertes Beispiel für die Anpassungsfähigkeit und die Rolle, die ein einzelnes Insekt in seinem Lebensraum spielen kann.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
Ich durchlaufe vier Lebensstadien: Ei, Raupe, Puppe und schließlich den erwachsenen Falter. Als Raupe bin ich in der Lage, mich an verschiedene Pflanzen anzupassen, insbesondere an Disteln, die auch meinen Namen prägen. Meine Wanderungen sind legendär; ich bin bekannt für meine weitreichenden Migrationen über tausende von Kilometern, besonders in Nordamerika. Aus fachlicher Sicht ist mein Verhalten und meine Lebensweise ein interessantes Forschungsobjekt für Biologen und Ökologen. Sie untersuchen zum Beispiel meine Migrationsmuster und wie ich navigiere, ohne dass ich jemals zuvor an einem Ort war. Meine Interaktion mit verschiedenen Pflanzenarten, insbesondere Disteln, und wie diese Beziehung meine Überlebensstrategien beeinflusst, sind ebenfalls von Interesse.
Meine Art ist nicht nur schön anzusehen, sondern auch ein wichtiger Bestandteil vieler Ökosysteme, da ich zur Bestäubung beitrage und auch als Nahrungsquelle für andere Tiere diene. Meine Fähigkeit, mich an verschiedene Umgebungen anzupassen und dennoch eine Schlüsselrolle im ökologischen Gefüge zu spielen, macht mich zu einem faszinierenden Fallstudium für den Naturschutz und das Verständnis der Biodiversität.
Insgesamt bin ich ein bemerkenswertes Beispiel für die Anpassungsfähigkeit und die Rolle, die ein einzelnes Insekt in seinem Lebensraum spielen kann.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
- Distelfalter (Vanessa cardui)
Artenschutz in Franken®
Die Getreidehalmwespe (Cephus pygmaeus)

Getreidehalmwespe (Cephus pygmaeus)
28/29.07.2024
Meine Art gehört zur Familie der Echten Bockkäfer (Cephidae) und spielt eine wichtige Rolle im natürlichen Gleichgewicht zwischen Getreidepflanzen und verschiedenen Schädlingen.
28/29.07.2024
- Als Getreidehalmwespe, Cephus pygmaeus, betrachte ich mich als bedeutenden Akteur im Ökosystem der Getreidefelder.
Meine Art gehört zur Familie der Echten Bockkäfer (Cephidae) und spielt eine wichtige Rolle im natürlichen Gleichgewicht zwischen Getreidepflanzen und verschiedenen Schädlingen.
Biologie und Lebensweise:
Ich bin eine schlank gebaute Wespe mit einer Körperlänge von etwa 5 bis 7 Millimetern. Mein Körper ist schwarz gefärbt, oft mit gelben oder orangen Streifen auf den Beinen oder dem Hinterleib. Meine Larven entwickeln sich im Inneren der Halme von Getreidepflanzen, insbesondere von Weizen, Gerste und Roggen. Dort bohren sie Gänge und ernähren sich vom Pflanzengewebe.
Ökologische Bedeutung:
Meine Art trägt zur Regulation der Getreideschädlinge bei, indem sie schwache oder anfällige Pflanzen angreift. Indem ich diese Pflanzen schwäche, reduziere ich die Populationen von Getreideschädlingen, die auf gesunde Pflanzen abzielen könnten. Dieser Effekt ist Teil eines komplexen Netzwerks von Interaktionen zwischen Pflanzen und ihren natürlichen Feinden.
Anpassungen an den Lebensraum:
Um mich in Getreidefeldern erfolgreich zu etablieren, habe ich spezielle Anpassungen entwickelt. Dazu gehört meine Fähigkeit, mich im Pflanzeninneren zu entwickeln und gleichzeitig Mechanismen zu besitzen, die es mir ermöglichen, mich vor natürlichen Feinden zu schützen. Meine Larven sind gut angepasst, um in den engen und oft unregelmäßigen Hohlräumen der Getreidehalme zu leben.
Einfluss auf die Landwirtschaft:
Während meine Larven gelegentlich zu Ertragsverlusten führen können, ist mein Gesamteffekt auf die Landwirtschaft in der Regel positiv, da ich dazu beitrage, das ökologische Gleichgewicht auf natürliche Weise aufrechtzuerhalten. Landwirte betrachten mich oft als Teil eines gesunden Ökosystems innerhalb ihrer Felder und erkennen den Nutzen meiner Anwesenheit in der biologischen Bekämpfung von Schädlingen.
Insgesamt trage ich als Getreidehalmwespe, Cephus pygmaeus, dazu bei, die Vielfalt und Stabilität der Agrarökosysteme zu erhalten, indem ich eine Nische als natürlicher Feind bestimmter Getreideschädlinge ausfülle und damit zur nachhaltigen Landwirtschaft beitrage.
Aufnahme / Autor von Bernhard Schmalisch vom 24.07.2024
... diese Halmwespen sind auf gelben Blüten in der Nähe von Getreidefeldern zu finden ...hier auf Wolfsmilch, auch auf Hahnenfuß etc.Der Nachwuchs entwickelt sich in Gras bzw. Getreidehalmen ... ich habe mit Getreideanbauern gesprochen ...die Schäden auf den Feldern sind marginal ...massenhaftes Auftreten ist mir nicht bekannt, kann natürlich auch zu Schäden kommen, falls diese Spezies häufig auftritt
Ich bin eine schlank gebaute Wespe mit einer Körperlänge von etwa 5 bis 7 Millimetern. Mein Körper ist schwarz gefärbt, oft mit gelben oder orangen Streifen auf den Beinen oder dem Hinterleib. Meine Larven entwickeln sich im Inneren der Halme von Getreidepflanzen, insbesondere von Weizen, Gerste und Roggen. Dort bohren sie Gänge und ernähren sich vom Pflanzengewebe.
Ökologische Bedeutung:
Meine Art trägt zur Regulation der Getreideschädlinge bei, indem sie schwache oder anfällige Pflanzen angreift. Indem ich diese Pflanzen schwäche, reduziere ich die Populationen von Getreideschädlingen, die auf gesunde Pflanzen abzielen könnten. Dieser Effekt ist Teil eines komplexen Netzwerks von Interaktionen zwischen Pflanzen und ihren natürlichen Feinden.
Anpassungen an den Lebensraum:
Um mich in Getreidefeldern erfolgreich zu etablieren, habe ich spezielle Anpassungen entwickelt. Dazu gehört meine Fähigkeit, mich im Pflanzeninneren zu entwickeln und gleichzeitig Mechanismen zu besitzen, die es mir ermöglichen, mich vor natürlichen Feinden zu schützen. Meine Larven sind gut angepasst, um in den engen und oft unregelmäßigen Hohlräumen der Getreidehalme zu leben.
Einfluss auf die Landwirtschaft:
Während meine Larven gelegentlich zu Ertragsverlusten führen können, ist mein Gesamteffekt auf die Landwirtschaft in der Regel positiv, da ich dazu beitrage, das ökologische Gleichgewicht auf natürliche Weise aufrechtzuerhalten. Landwirte betrachten mich oft als Teil eines gesunden Ökosystems innerhalb ihrer Felder und erkennen den Nutzen meiner Anwesenheit in der biologischen Bekämpfung von Schädlingen.
Insgesamt trage ich als Getreidehalmwespe, Cephus pygmaeus, dazu bei, die Vielfalt und Stabilität der Agrarökosysteme zu erhalten, indem ich eine Nische als natürlicher Feind bestimmter Getreideschädlinge ausfülle und damit zur nachhaltigen Landwirtschaft beitrage.
Aufnahme / Autor von Bernhard Schmalisch vom 24.07.2024
... diese Halmwespen sind auf gelben Blüten in der Nähe von Getreidefeldern zu finden ...hier auf Wolfsmilch, auch auf Hahnenfuß etc.Der Nachwuchs entwickelt sich in Gras bzw. Getreidehalmen ... ich habe mit Getreideanbauern gesprochen ...die Schäden auf den Feldern sind marginal ...massenhaftes Auftreten ist mir nicht bekannt, kann natürlich auch zu Schäden kommen, falls diese Spezies häufig auftritt
Artenschutz in Franken®
Stele der Biodiversität® - Burgwindheim / Kötsch

Stele der Biodiversität® - Burgwindheim / Kötsch
28/29.07.2024
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das vom Markt Burgwindheim, dem Bayernwerk der Deutschen Postcode Lotterie und der Steuerkanzlei Bauerfeind unterstützt wird.
Kötsch / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen.
Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
28/29.07.2024
- Installation des Montage- und Schutzgerüstes
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das vom Markt Burgwindheim, dem Bayernwerk der Deutschen Postcode Lotterie und der Steuerkanzlei Bauerfeind unterstützt wird.
Kötsch / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen.
Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
Denn wenn (selbst in noch geeigneten Nahrungsstrukturen) keine geeigneten Reproduktionsräume vorhanden sind, ist die Erhaltung der Artenvielfalt gelichfalls zum Scheitern verurteilt.
Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das vom Markt Burgwindheim, dem Bayernwerk der Deutschen Postcode Lotterie und der Steuerkanzlei Bauerfeind unterstützt wird, setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.
In der Aufnahme
Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das vom Markt Burgwindheim, dem Bayernwerk der Deutschen Postcode Lotterie und der Steuerkanzlei Bauerfeind unterstützt wird, setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.
In der Aufnahme
- am 24.07.2024 erkennen wir das Bauwerk in dieser Form
Artenschutz in Franken®
Kampf der verwechslungsgefährdeten Flusskrebse
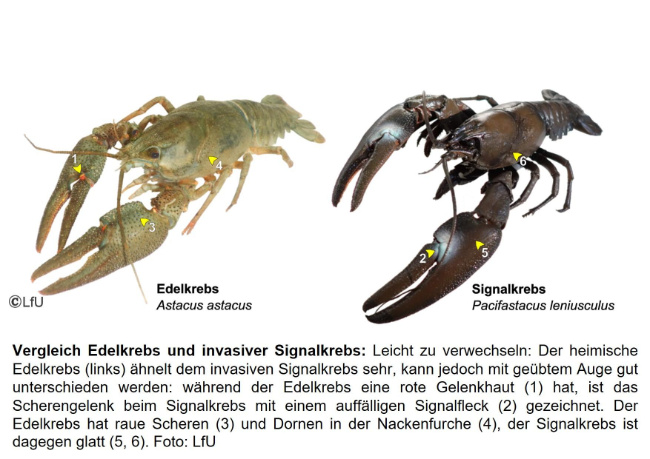
Kampf der verwechslungsgefährdeten Flusskrebse
27/28.07.2024
+++ „Wieder mal ein Signaler.“ So lautet das ernüchternde Fazit des Krebsexperten Christoph Graf vom Bayerischen Landesamt für Umwelt (LfU) angesichts seines Fangs in einer Krebsreuse. Zusammen mit dem lokalen Fischereibrechtigten hatte er diesen früh morgens aus einem kleinen Bach in Oberbayern gefischt. Der „Signaler“ ist der ursprünglich aus Amerika stammende Signalkrebs (Pacifastacus leniusculus). Diese invasive Flusskrebsart macht gut 70 Prozent der Meldungen nicht-heimischer Krebse in Bayern aus und ist ein ernstzunehmendes Problem.
In Bayern sind auch durch die Einschleppung gebietsfremder Krebsarten nach Einschätzungen des LfU bereits gut die Hälfte aller heimischen Flusskrebsbestände verschwunden. Mit einem Artenhilfsprojekt am LfU stemmt man sich dagegen, versucht die bedrohten Krebsarten zu erhalten und so weit wie möglich in ihren ursprünglichen Lebensräumen wieder anzusiedeln. +++
27/28.07.2024
- Das schwierige Ringen mit invasiven Arten und eingeschleppten Krankheiten
+++ „Wieder mal ein Signaler.“ So lautet das ernüchternde Fazit des Krebsexperten Christoph Graf vom Bayerischen Landesamt für Umwelt (LfU) angesichts seines Fangs in einer Krebsreuse. Zusammen mit dem lokalen Fischereibrechtigten hatte er diesen früh morgens aus einem kleinen Bach in Oberbayern gefischt. Der „Signaler“ ist der ursprünglich aus Amerika stammende Signalkrebs (Pacifastacus leniusculus). Diese invasive Flusskrebsart macht gut 70 Prozent der Meldungen nicht-heimischer Krebse in Bayern aus und ist ein ernstzunehmendes Problem.
In Bayern sind auch durch die Einschleppung gebietsfremder Krebsarten nach Einschätzungen des LfU bereits gut die Hälfte aller heimischen Flusskrebsbestände verschwunden. Mit einem Artenhilfsprojekt am LfU stemmt man sich dagegen, versucht die bedrohten Krebsarten zu erhalten und so weit wie möglich in ihren ursprünglichen Lebensräumen wieder anzusiedeln. +++
Ursprünglich gab es in Bayern nur zwei Flusskrebsarten: den Edelkrebs (Astacus astacus) und den Steinkrebs (Austropotamobius torrentium). Leider werden beide Arten immer seltener. Die Gründe sind vielfältig: steigende Wassertemperaturen, Stoffeinträge, aber vor allem die stetige Ausbreitung invasiver Flusskrebsarten. Um die Arten besser schützen zu können sind beide heimischen Krebsarten in der sogenannten Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie aufgeführt. Hier werden Tiere, Pflanzen und Lebensräume gelistet, die europaweit besonderen Schutz benötigen. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf dem zusammenhängenden Schutzgebietsnetz „Natura 2000“. Aktuell gibt es bei uns vier gebietsfremde, aus Nordamerika eingeführte Arten: den Signalkrebs, den Kamberkrebs (Faxonius limosus), den Roten Amerikanischen Sumpfkrebs (Procambarus clarkii) und den Marmorkrebs (Procambarus fallax f. virginalis). Diese Arten sind meist konkurrenzstärker als unsere hiesigen Krebse: sie pflanzen sich beispielsweise öfter oder effizienter fort oder sind aggressiver und kommen in höheren Dichten vor. Das Hauptproblem liegt jedoch in ihrem gefährlichen „Reisegepäck“: die invasiven Krebsarten sind Träger der sogenannten Krebspest. Gegen diese von einem Pilz ausgelöste Tierseuche sind die amerikanischen Arten in der Regel immun, während eine Ansteckung für die heimischen Krebse immer tödlich verläuft. Im Umgang mit den amerikanischen Krebsen oder beim Einsatz am mit invasiven Krebsen bewohnten Gewässern sind daher höchste Vorsicht und im Anschluss gewissenhaftes Desinfizieren der Ausrüstung geboten. Denn ein einziger infizierter Krebs oder sogar nur die Pilzsporen, angehaftet an einem nassen Keschernetz, an Gummistiefeln oder im Restwasser eines Eimers oder Bootes, reichen aus, um einen ganzen lokalen Bestand heimischer Krebse auszulöschen.
Daher können die invasiven Krebsarten auch ohne große Verdrängungskämpfe in neue Gebiete einfallen und verbreiten sich bisher schnell und stetig weiter. So sind mittlerweile nicht nur in den großen Flüssen, wie Donau, Main oder Isar invasive Krebse beheimatet, sondern auch in vielen Seen, wie im Ammersee oder dem Starnberger See. „Wir müssen die Verbreitung der invasiven Arten so schnell wie möglich stoppen, um unsere heimischen Arten zu schützen,“ sagt Jeremy Hübner. Auch er arbeitet beim LfU und kümmert sich im Zuge des Artenhilfsprogramms um den Schutz des heimischen Steinkrebses. „Gezielter Fang, Besatz mit Raubfischen oder andere Methoden funktionieren nicht oder nur bedingt. So lange es keine effektive Formen der Bekämpfung gegen die Krebspest gibt, kann man nur mit Krebssperren arbeiten.“ Diese Vorrichtungen im Gewässer verhindern, dass invasive Krebse flussaufwärts in neue Regionen vordringen können und berücksichtigen auch, dass Flusskrebse kurze Strecken über Land gehen. Ziel der beiden Biologen ist es 50 solcher Installationen in den nächsten Jahren zu schaffen.
Leider dringen dennoch invasive Flusskrebse immer wieder in Gewässer ein, die sie aus eigener Kraft eigentlich gar nicht erreichen können. Grund hierfür ist, dass einheimische und invasive Arten oft verwechselt und dadurch versehentlich die „falschen Krebse“ in Gewässer eingebracht werden. So kann beispielsweise die Körperfärbung stark variieren (es gibt sogar komplett blaue Exemplare), was die Bestimmung erschweren kann. So geschah es an dem Bächlein Urtel in Grafing. Die lokale Zeitung berichtete hier von der erfolgreichen Wiederansiedelung von Flusskrebsen, die Tiere seien vor über 20 Jahren besetzt worden und hätten nun wieder einen stabilen Bestand aufgebaut. Allerdings handelte es sich bei den „wiederangesiedelten Ureinwohnern Grafings“ (Quelle: Müncher Merkur, 31.08.2023) um den invasiven Signalkrebs. Problematisch ist das nicht nur für die heimischen Krebse. Auch andere Bachbewohner, wie Fische, Muscheln oder Kleinlebewesen am Gewässergrund leiden unter den gefräßigeren Amerikanern.
Zurück am Bach packt Christoph Graf den Reusen-Fang vorsichtig in einen Transporteimer. Er achtet penibel darauf kein Bachwasser auf die sonstige Ausrüstung zu tropfen, alles wird anschließend desinfiziert. „Wenn wir die Krebspest aus Versehen mit auf unsere Anlage in Wielenbach bringen würden, wäre das eine absolute Katastrophe.“ In der Teich- und Fischzuchtanlage des LfU in Wielenbach werden seit einiger Zeit Edelkrebse und der noch viel anspruchsvollere Steinkrebs für Wiederansiedelungszwecke vermehrt. Dieses in Bayern einmalige Programm soll vor allem dem Steinkrebs in den Bachoberläufen wieder auf die Beine helfen.
Mithelfen können übrigens alle! Jegliche Sichtung von Flusskrebsen in Bayern hilft den Experten am LfU, mehr Wissen über die Verbreitung der Arten zu generieren und dieses möglichst aktuell zu halten. Über die Mailadresse flusskrebs@lfu.bayern.de können Sichtungen gemeldet werden. Dazu ist auf der Homepage des LfU ein Meldeformular hinterlegt. Außerdem gibt es nützliche Steckbriefe zu allen in Bayern verbreiteten Krebsarten.
Weitere Informationen und Meldung von Flusskrebssichtungen unter:
Quelle
Bayerisches Landesamt für Umwelt
Pressestelle
Bürgermeister-Ulrich-Straße 160
86179 Augsburg
Stand
26.07.2024
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung.Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Daher können die invasiven Krebsarten auch ohne große Verdrängungskämpfe in neue Gebiete einfallen und verbreiten sich bisher schnell und stetig weiter. So sind mittlerweile nicht nur in den großen Flüssen, wie Donau, Main oder Isar invasive Krebse beheimatet, sondern auch in vielen Seen, wie im Ammersee oder dem Starnberger See. „Wir müssen die Verbreitung der invasiven Arten so schnell wie möglich stoppen, um unsere heimischen Arten zu schützen,“ sagt Jeremy Hübner. Auch er arbeitet beim LfU und kümmert sich im Zuge des Artenhilfsprogramms um den Schutz des heimischen Steinkrebses. „Gezielter Fang, Besatz mit Raubfischen oder andere Methoden funktionieren nicht oder nur bedingt. So lange es keine effektive Formen der Bekämpfung gegen die Krebspest gibt, kann man nur mit Krebssperren arbeiten.“ Diese Vorrichtungen im Gewässer verhindern, dass invasive Krebse flussaufwärts in neue Regionen vordringen können und berücksichtigen auch, dass Flusskrebse kurze Strecken über Land gehen. Ziel der beiden Biologen ist es 50 solcher Installationen in den nächsten Jahren zu schaffen.
Leider dringen dennoch invasive Flusskrebse immer wieder in Gewässer ein, die sie aus eigener Kraft eigentlich gar nicht erreichen können. Grund hierfür ist, dass einheimische und invasive Arten oft verwechselt und dadurch versehentlich die „falschen Krebse“ in Gewässer eingebracht werden. So kann beispielsweise die Körperfärbung stark variieren (es gibt sogar komplett blaue Exemplare), was die Bestimmung erschweren kann. So geschah es an dem Bächlein Urtel in Grafing. Die lokale Zeitung berichtete hier von der erfolgreichen Wiederansiedelung von Flusskrebsen, die Tiere seien vor über 20 Jahren besetzt worden und hätten nun wieder einen stabilen Bestand aufgebaut. Allerdings handelte es sich bei den „wiederangesiedelten Ureinwohnern Grafings“ (Quelle: Müncher Merkur, 31.08.2023) um den invasiven Signalkrebs. Problematisch ist das nicht nur für die heimischen Krebse. Auch andere Bachbewohner, wie Fische, Muscheln oder Kleinlebewesen am Gewässergrund leiden unter den gefräßigeren Amerikanern.
Zurück am Bach packt Christoph Graf den Reusen-Fang vorsichtig in einen Transporteimer. Er achtet penibel darauf kein Bachwasser auf die sonstige Ausrüstung zu tropfen, alles wird anschließend desinfiziert. „Wenn wir die Krebspest aus Versehen mit auf unsere Anlage in Wielenbach bringen würden, wäre das eine absolute Katastrophe.“ In der Teich- und Fischzuchtanlage des LfU in Wielenbach werden seit einiger Zeit Edelkrebse und der noch viel anspruchsvollere Steinkrebs für Wiederansiedelungszwecke vermehrt. Dieses in Bayern einmalige Programm soll vor allem dem Steinkrebs in den Bachoberläufen wieder auf die Beine helfen.
Mithelfen können übrigens alle! Jegliche Sichtung von Flusskrebsen in Bayern hilft den Experten am LfU, mehr Wissen über die Verbreitung der Arten zu generieren und dieses möglichst aktuell zu halten. Über die Mailadresse flusskrebs@lfu.bayern.de können Sichtungen gemeldet werden. Dazu ist auf der Homepage des LfU ein Meldeformular hinterlegt. Außerdem gibt es nützliche Steckbriefe zu allen in Bayern verbreiteten Krebsarten.
Weitere Informationen und Meldung von Flusskrebssichtungen unter:
- https://www.lfu.bayern.de/natur/fische_krebse/krebse/index.htm
Quelle
Bayerisches Landesamt für Umwelt
Pressestelle
Bürgermeister-Ulrich-Straße 160
86179 Augsburg
Stand
26.07.2024
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung.Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Artenschutz in Franken®
Der Schwarzkolbige Braundickkopffalter (Thymelicus lineola)

Schwarzkolbiger Braundickkopffalter (Thymelicus lineola)
27/28.07.2024
Mein wissenschaftlicher Name "Thymelicus lineola" verweist auf meine charakteristische Erscheinung und mein Verhalten.
27/28.07.2024
- Als Schwarzkolbiger Braundickkopffalter, oder Thymelicus lineola, bin ich ein Vertreter der Familie der Dickkopffalter (Hesperiidae) und gehöre zur Unterfamilie der Echten Sichelfalter (Hesperiinae).
Mein wissenschaftlicher Name "Thymelicus lineola" verweist auf meine charakteristische Erscheinung und mein Verhalten.
Ich bin eine relativ kleine Schmetterlingsart mit einer Flügelspannweite von etwa 24 bis 28 Millimetern. Meine Flügel sind eher unscheinbar und von brauner Farbe, was mir hilft, mich gut in meiner natürlichen Umgebung zu tarnen. Mein Name "Schwarzkolbiger Braundickkopffalter" leitet sich von den dunklen Kolben auf meinen Fühlern und meiner braunen Flügelfärbung ab.
Mein Lebensraum erstreckt sich über offene Wiesen, Lichtungen und ähnliche Habitate mit reichlichem Vorkommen von Gräsern, da ich mich hauptsächlich von diesen ernähre. Als Pflanzenfresser (Phytophage) bevorzuge ich insbesondere Gräser wie Schwingel (Festuca) oder Rispengräser (Poa). Meine Präferenz für solche Gräser hängt eng mit den chemischen Eigenschaften der Pflanzen zusammen, die meinen Nektar und Pollen reichlich enthalten.
Mein Lebenszyklus beginnt mit der Eiablage auf den Blättern von Gräsern. Die Larven, auch Raupen genannt, schlüpfen aus den Eiern und entwickeln sich schnell zu erwachsenen Faltern. Während meiner kurzen Lebensspanne von etwa einem Monat trage ich zur Bestäubung von Blüten bei und spiele eine Rolle im Ökosystem als Nahrungsquelle für verschiedene Raubtiere.
Meine Populationen können durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden, darunter die Verfügbarkeit von geeigneten Lebensräumen und die Intensität der Landnutzung. Zum Schutz meiner Art sind Erhaltungsmaßnahmen wichtig, die darauf abzielen, geeignete Habitate zu bewahren und zu fördern, sowie nachhaltige landwirtschaftliche Praktiken zu unterstützen, die die Vielfalt der Gräser und Blüten fördern.
Insgesamt bin ich als Schwarzkolbiger Braundickkopffalter ein bescheidener, aber wichtiger Teil des Ökosystems, der durch meine spezialisierte Ernährung und meine Rolle als Bestäuber einen wertvollen Beitrag leiste.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
Mein Lebensraum erstreckt sich über offene Wiesen, Lichtungen und ähnliche Habitate mit reichlichem Vorkommen von Gräsern, da ich mich hauptsächlich von diesen ernähre. Als Pflanzenfresser (Phytophage) bevorzuge ich insbesondere Gräser wie Schwingel (Festuca) oder Rispengräser (Poa). Meine Präferenz für solche Gräser hängt eng mit den chemischen Eigenschaften der Pflanzen zusammen, die meinen Nektar und Pollen reichlich enthalten.
Mein Lebenszyklus beginnt mit der Eiablage auf den Blättern von Gräsern. Die Larven, auch Raupen genannt, schlüpfen aus den Eiern und entwickeln sich schnell zu erwachsenen Faltern. Während meiner kurzen Lebensspanne von etwa einem Monat trage ich zur Bestäubung von Blüten bei und spiele eine Rolle im Ökosystem als Nahrungsquelle für verschiedene Raubtiere.
Meine Populationen können durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden, darunter die Verfügbarkeit von geeigneten Lebensräumen und die Intensität der Landnutzung. Zum Schutz meiner Art sind Erhaltungsmaßnahmen wichtig, die darauf abzielen, geeignete Habitate zu bewahren und zu fördern, sowie nachhaltige landwirtschaftliche Praktiken zu unterstützen, die die Vielfalt der Gräser und Blüten fördern.
Insgesamt bin ich als Schwarzkolbiger Braundickkopffalter ein bescheidener, aber wichtiger Teil des Ökosystems, der durch meine spezialisierte Ernährung und meine Rolle als Bestäuber einen wertvollen Beitrag leiste.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- Schwarzkolbiger Braundickkopffalter (Thymelicus lineola)
Artenschutz in Franken®
Stele der Biodiversität® - Stegaurach / Dellern

Stele der Biodiversität® - Stegaurach / Dellern
27/28.07.2024
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.
Stegaurach / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
27/28.07.2024
- Die grafische Gestaltung ...
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.
Stegaurach / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
Denn wenn (selbst in noch geeigneten Nahrungsstrukturen) keine geeigneten Reproduktionsräume vorhanden sind, ist die Erhaltung der Artenvielfalt gelichfalls zum Scheitern verurteilt.
Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird., setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.
In der Aufnahme
Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird., setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.
In der Aufnahme
- ... Impression vom 22.07.2024 ...
Artenschutz in Franken®
Artenschutz in Franken® -- Extensive Wiesenbewirtschaftung

Artenschutz in Franken® -- Extensive Wiesenbewirtschaftung
Diese Form der Bewirtschaftung ist von großer Bedeutung für den Artenschutz aus mehreren Gründen:
- Extensive Bewirtschaftung von Wiesen ist eine landwirtschaftliche Praxis, die auf einen geringen Einsatz von Dünger und Pflanzenschutzmitteln sowie eine reduzierte Beweidung oder Mahd setzt.
Diese Form der Bewirtschaftung ist von großer Bedeutung für den Artenschutz aus mehreren Gründen:
- Erhalt der Biodiversität: Extensive Bewirtschaftung fördert eine hohe Artenvielfalt, da sie unterschiedliche Pflanzenarten begünstigt, die wiederum Lebensraum und Nahrungsgrundlage für viele Tierarten bieten. Intensive Bewirtschaftung hingegen führt oft zu einer Monokultur, die die Artenvielfalt stark reduziert.
- Lebensraum für Insekten: Wiesen, die extensiv bewirtschaftet werden, bieten einen idealen Lebensraum für eine Vielzahl von Insekten, darunter viele Bestäuber wie Bienen, Schmetterlinge und Käfer. Diese Insekten sind essenziell für die Bestäubung vieler Pflanzen und somit für das gesamte Ökosystem.
- Schutz gefährdeter Arten: Viele Pflanzen- und Tierarten, die auf der Roten Liste der bedrohten Arten stehen, sind auf extensiv bewirtschaftete Wiesen angewiesen. Durch den Erhalt solcher Wiesen kann der Rückgang dieser gefährdeten Arten gestoppt oder zumindest verlangsamt werden.
- Förderung der Bodenqualität: Extensive Bewirtschaftung trägt zur Erhaltung und Verbesserung der Bodenstruktur bei, da sie die Bodenverdichtung vermindert und die Humusschicht fördert. Ein gesunder Boden ist die Grundlage für eine reiche und vielfältige Vegetation, die wiederum vielen Arten Lebensraum bietet.
- Puffer gegen Klimawandel: Extensiv bewirtschaftete Wiesen können als Kohlenstoffsenken dienen und somit zur Reduzierung der CO2-Konzentration in der Atmosphäre beitragen. Außerdem sind sie oft widerstandsfähiger gegenüber extremen Wetterbedingungen, die durch den Klimawandel zunehmen.
- Erhalt traditioneller Kulturlandschaften: Viele extensiv bewirtschaftete Wiesen sind Teil traditioneller Kulturlandschaften, die im Laufe der Jahrhunderte entstanden sind. Der Erhalt dieser Landschaften trägt nicht nur zum Schutz der Biodiversität bei, sondern auch zum kulturellen Erbe einer Region.
Durch die extensive Bewirtschaftung von Wiesen wird ein wichtiger Beitrag zum Artenschutz geleistet. Sie unterstützt die Erhaltung und Förderung von Lebensräumen, die für viele Pflanzen- und Tierarten überlebenswichtig sind. Damit spielt sie eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung der ökologischen Vielfalt und Stabilität unserer Umwelt.
In den Aufnahmen vom 21.07.2024
- Artenschutz in Franken® setzt auf ihren Flächen konkret auf eine sehr extensive Wiesenbewirtschaftung ... es wird nicht gedüngt und es wird nur 1 Mal im Jahr (ab August) gemäht und das Grüngut von der Fläche abgefahren! Wir finden hier noch eine Artenvielfalt die anderweitig anteilig bereits schon lange verschwunden ist.
Artenschutz in Franken®
Die Europäische Wanderheuschrecke (Locusta migratoria)

Europäische Wanderheuschrecke (Locusta migratoria)
26/27.07.2024
Ich gehöre zur Ordnung der Heuschrecken (Orthoptera) und bin bekannt für meine Fähigkeit zu großen Wanderungen über weite Strecken. Mein Körper ist angepasst für das Leben in verschiedenen Umgebungen, von trockenen Graslandschaften bis hin zu landwirtschaftlich genutzten Gebieten. Mit meinen kräftigen Hinterbeinen kann ich große Sprünge machen, was mir hilft, mich schnell fortzubewegen und möglichen Gefahren zu entkommen.
26/27.07.2024
- Als Europäische Wanderheuschrecke (Locusta migratoria) betrachte ich mich als faszinierendes und bedeutendes Mitglied der Insektenwelt, insbesondere in Bezug auf meine Wanderungen und ökologische Rolle.
Ich gehöre zur Ordnung der Heuschrecken (Orthoptera) und bin bekannt für meine Fähigkeit zu großen Wanderungen über weite Strecken. Mein Körper ist angepasst für das Leben in verschiedenen Umgebungen, von trockenen Graslandschaften bis hin zu landwirtschaftlich genutzten Gebieten. Mit meinen kräftigen Hinterbeinen kann ich große Sprünge machen, was mir hilft, mich schnell fortzubewegen und möglichen Gefahren zu entkommen.
Mein Leben durchläuft verschiedene Phasen, die auch als Phasenpolyphenismus bekannt sind. Als Jungheuschrecke (Nymphen) bin ich meist grünlich oder braun gefärbt und ernähre mich von einer Vielzahl von Pflanzen. Mit zunehmendem Alter und vor allem bei hoher Populationsdichte kann ich jedoch in die Schwärmerphase übergehen. In dieser Phase verändert sich meine Körperfärbung zu einem markanten Gelb und Schwarz, was mir hilft, in großen Schwärmen zu leben und zu wandern. Diese Schwärme können enorme Ausmaße annehmen und große landwirtschaftliche Schäden verursachen, wenn sie auf Feldern landen und Pflanzen fressen.
Auf ökologischer Ebene spiele ich eine wichtige Rolle im Nahrungsnetz. Als Pflanzenfresser beeinflusse ich die Vegetation in den Gebieten, die ich durchwandere, und diene als Nahrungsquelle für viele Raubtiere, wie Vögel, Reptilien und andere Insekten.
Für den Menschen habe ich historisch gesehen sowohl positive als auch negative Auswirkungen gehabt. In einigen Kulturen wurden und werden Heuschrecken als Nahrungsquelle genutzt, was besonders in Zeiten von Nahrungsmittelknappheit von Bedeutung ist. Andererseits können meine Schwärme verheerende wirtschaftliche Schäden anrichten, insbesondere in der Landwirtschaft, wenn ich in großen Zahlen auftrete und Felder abfresse.
Insgesamt bin ich als Europäische Wanderheuschrecke ein faszinierendes Beispiel für die Anpassungsfähigkeit und das ökologische Gleichgewicht in der Natur. Meine Fähigkeit zu großen Wanderungen und meine Rolle im Nahrungsnetz machen mich zu einem wichtigen Bestandteil vieler Ökosysteme, allerdings erfordert meine periodische Schwärmerpopulation auch eine angemessene Überwachung und gegebenenfalls Kontrolle, um negative Auswirkungen auf die menschliche Landwirtschaft zu minimieren.
Aufnahme von Helga Zinnecker
Auf ökologischer Ebene spiele ich eine wichtige Rolle im Nahrungsnetz. Als Pflanzenfresser beeinflusse ich die Vegetation in den Gebieten, die ich durchwandere, und diene als Nahrungsquelle für viele Raubtiere, wie Vögel, Reptilien und andere Insekten.
Für den Menschen habe ich historisch gesehen sowohl positive als auch negative Auswirkungen gehabt. In einigen Kulturen wurden und werden Heuschrecken als Nahrungsquelle genutzt, was besonders in Zeiten von Nahrungsmittelknappheit von Bedeutung ist. Andererseits können meine Schwärme verheerende wirtschaftliche Schäden anrichten, insbesondere in der Landwirtschaft, wenn ich in großen Zahlen auftrete und Felder abfresse.
Insgesamt bin ich als Europäische Wanderheuschrecke ein faszinierendes Beispiel für die Anpassungsfähigkeit und das ökologische Gleichgewicht in der Natur. Meine Fähigkeit zu großen Wanderungen und meine Rolle im Nahrungsnetz machen mich zu einem wichtigen Bestandteil vieler Ökosysteme, allerdings erfordert meine periodische Schwärmerpopulation auch eine angemessene Überwachung und gegebenenfalls Kontrolle, um negative Auswirkungen auf die menschliche Landwirtschaft zu minimieren.
Aufnahme von Helga Zinnecker
- Europäische Wanderheuschrecke (Locusta migratoria)
Artenschutz in Franken®
Der Schachbrettfalter (Melanargia galathea)

Schachbrettfalter (Melanargia galathea)
25/26.07.2024
25/26.07.2024
- Hallo, ich bin der Schachbrettfalter (Melanargia galathea). Lass mich dir ein wenig über mein Leben und meine Bedürfnisse erzählen:
Mein Lebensraum und Vorlieben
Ich liebe offene und sonnige Wiesen, vor allem solche, die extensiv bewirtschaftet werden. Dort finde ich die verschiedenen Pflanzenarten, die ich und meine Nachkommen zum Überleben brauchen. Besonders gerne mag ich Wiesen mit einer Vielzahl von blühenden Kräutern und Gräsern, da diese sowohl als Nahrungsquelle als auch als Eiablageplatz dienen.
Meine Ernährung
Als erwachsener Falter ernähre ich mich hauptsächlich vom Nektar verschiedener Blüten. Zu meinen Favoriten gehören Skabiosen, Flockenblumen und Disteln. Der Nektar gibt mir die Energie, die ich brauche, um umherzufliegen und nach einem Partner zu suchen.
Mein Lebenszyklus
Ich durchlaufe mehrere Stadien in meinem Leben:
Meine Bedeutung für das Ökosystem
Ich bin nicht nur schön anzusehen, sondern auch ein wichtiger Bestandteil des Ökosystems. Als Bestäuber trage ich zur Vermehrung vieler Pflanzenarten bei. Darüber hinaus bin ich eine Nahrungsquelle für Vögel und andere Tiere.
Bedrohungen und Schutz
Leider bin ich in vielen Gegenden bedroht. Intensive Landwirtschaft, die den Einsatz von Pestiziden und Düngemitteln einschließt, zerstört meinen Lebensraum und die Pflanzen, die ich zum Überleben brauche. Auch die Umwandlung von Wiesen in Ackerland oder Siedlungsgebiete setzt mir und meinen Artgenossen zu. Deshalb ist es so wichtig, dass Menschen Wiesen extensiv bewirtschaften und auf den Einsatz von Chemikalien verzichten. Diese Praktiken helfen, die Artenvielfalt zu erhalten und sicherzustellen, dass auch zukünftige Generationen von Schachbrettfaltern einen geeigneten Lebensraum finden.
Ein Appell an die Menschen
Bitte denkt an uns, wenn ihr über die Nutzung von Land nachdenkt. Extensiv bewirtschaftete Wiesen sind nicht nur für uns, sondern für das gesamte Ökosystem von unschätzbarem Wert. Euer Engagement für den Naturschutz hilft, unsere Lebensräume zu bewahren und die Artenvielfalt zu schützen.
Ich hoffe, dass ich euch einen kleinen Einblick in mein Leben und meine Bedürfnisse geben konnte. Vielleicht seht ihr mich beim nächsten Spaziergang über eine blühende Wiese fliegen.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
Ich liebe offene und sonnige Wiesen, vor allem solche, die extensiv bewirtschaftet werden. Dort finde ich die verschiedenen Pflanzenarten, die ich und meine Nachkommen zum Überleben brauchen. Besonders gerne mag ich Wiesen mit einer Vielzahl von blühenden Kräutern und Gräsern, da diese sowohl als Nahrungsquelle als auch als Eiablageplatz dienen.
Meine Ernährung
Als erwachsener Falter ernähre ich mich hauptsächlich vom Nektar verschiedener Blüten. Zu meinen Favoriten gehören Skabiosen, Flockenblumen und Disteln. Der Nektar gibt mir die Energie, die ich brauche, um umherzufliegen und nach einem Partner zu suchen.
Mein Lebenszyklus
Ich durchlaufe mehrere Stadien in meinem Leben:
- Ei: Meine Mutter legt ihre Eier meist an Grashalmen oder in der Nähe von Wiesenpflanzen ab. Diese extensiv bewirtschafteten Wiesen bieten viele geeignete Plätze für die Eiablage.
- Raupe: Nachdem ich aus dem Ei geschlüpft bin, beginne ich als kleine Raupe sofort mit dem Fressen. Ich ernähre mich hauptsächlich von Gräsern wie Rotschwingel und Wiesenlieschgras. Im Herbst höre ich auf zu fressen und überwintere als kleine Raupe.
- Puppe: Im Frühling verpuppen wir uns. Dies ist ein entscheidender Moment, denn wir sind in diesem Stadium sehr verletzlich. Daher verbergen wir uns gut in der Vegetation.
- Falter: Nach einigen Wochen schlüpfe ich als ausgewachsener Falter und suche sofort nach Blüten, um mich zu ernähren und nach einem Partner zu suchen.
Meine Bedeutung für das Ökosystem
Ich bin nicht nur schön anzusehen, sondern auch ein wichtiger Bestandteil des Ökosystems. Als Bestäuber trage ich zur Vermehrung vieler Pflanzenarten bei. Darüber hinaus bin ich eine Nahrungsquelle für Vögel und andere Tiere.
Bedrohungen und Schutz
Leider bin ich in vielen Gegenden bedroht. Intensive Landwirtschaft, die den Einsatz von Pestiziden und Düngemitteln einschließt, zerstört meinen Lebensraum und die Pflanzen, die ich zum Überleben brauche. Auch die Umwandlung von Wiesen in Ackerland oder Siedlungsgebiete setzt mir und meinen Artgenossen zu. Deshalb ist es so wichtig, dass Menschen Wiesen extensiv bewirtschaften und auf den Einsatz von Chemikalien verzichten. Diese Praktiken helfen, die Artenvielfalt zu erhalten und sicherzustellen, dass auch zukünftige Generationen von Schachbrettfaltern einen geeigneten Lebensraum finden.
Ein Appell an die Menschen
Bitte denkt an uns, wenn ihr über die Nutzung von Land nachdenkt. Extensiv bewirtschaftete Wiesen sind nicht nur für uns, sondern für das gesamte Ökosystem von unschätzbarem Wert. Euer Engagement für den Naturschutz hilft, unsere Lebensräume zu bewahren und die Artenvielfalt zu schützen.
Ich hoffe, dass ich euch einen kleinen Einblick in mein Leben und meine Bedürfnisse geben konnte. Vielleicht seht ihr mich beim nächsten Spaziergang über eine blühende Wiese fliegen.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
- Paarung
Artenschutz in Franken®
Korrekter Umgang mit Wespennistplätzen

Wespennester - an ungünstiger Stelle - Umweltbildung
25/26.07.2024
Es kann notwendig sein, Wespennester zu entfernen oder umzusiedeln, aus verschiedenen Gründen:
25/26.07.2024
- Umweltbildungsprojekt Wespe
Es kann notwendig sein, Wespennester zu entfernen oder umzusiedeln, aus verschiedenen Gründen:
- Gefahr für Menschen: Wenn ein Wespennest in der Nähe von Wohn- oder Arbeitsbereichen gefunden wird, können Wespenstiche ein Risiko für Menschen darstellen, insbesondere für Allergiker oder Menschen, die empfindlich auf Wespenstiche reagieren. Dies ist besonders wichtig in Bereichen mit Kindern oder älteren Menschen.
- Gefahr für Haustiere: Auch Haustiere können durch Wespen gestochen werden und schwere allergische Reaktionen erleiden. Daher ist es wichtig, Nester in der Nähe von Haustieren zu entfernen.
- Störung durch Wespenaktivität: Wespen können sehr aggressiv werden, wenn sie sich bedroht fühlen oder wenn ihr Nest gestört wird. Dies kann zu einer erhöhten Gefahr für Menschen führen, die sich in der Nähe des Nestes aufhalten.
- Konflikte mit menschlichen Aktivitäten: Wenn sich ein Wespennest an einem Ort befindet, der häufig von Menschen frequentiert wird (z.B. in Gärten, auf Terrassen oder in Spielbereichen), kann dies zu Konflikten führen, die letztendlich eine Entfernung des Nests notwendig machen.
- Schutz gefährdeter Arten: In einigen Fällen kann das Umsetzen eines Wespennestes notwendig sein, um gefährdete Arten zu schützen, die durch die Aktivitäten der Wespen gefährdet sind.
- Berufliche Notwendigkeiten: Manchmal ist es für bestimmte Berufe oder Aktivitäten notwendig, Wespennester zu entfernen oder umzusiedeln, um die Sicherheit der Arbeiter oder die Kontinuität der Arbeit zu gewährleisten.
Es ist wichtig, dass das Entfernen oder Umsetzen von Wespennestern ordnungsgemäß und sicher durchgeführt wird, idealerweise durch Fachleute, die über das nötige Wissen und die richtige Ausrüstung verfügen, um die Wespen und die Umgebung zu schützen.
In den Aufnahme
- Darstellunge in welchen uns Fachleute zeigten wie der korrekte Umgang mit Wespen möglich wird ... der Einsatz von Endoskopen zählte ebenso dazu.
Artenschutz in Franken®
Die Graue Raupenfliege (Dinera grisescens)

Graue Raupenfliege (Dinera grisescens)
24/25.07.2024
Mein Leben ist geprägt von der komplexen und spezialisierten Interaktion mit meinen Wirten und meiner Anpassung an verschiedene Lebensräume.
24/25.07.2024
- Ich bin Dinera grisescens, die Graue Raupenfliege, ein faszinierendes Insekt aus der Familie der Raupenfliegen (Tachinidae).
Mein Leben ist geprägt von der komplexen und spezialisierten Interaktion mit meinen Wirten und meiner Anpassung an verschiedene Lebensräume.
Körperbau und Anpassungen
Mein Körper ist graubraun gefärbt, was mir hilft, mich in meiner Umgebung zu tarnen. Mit meinen großen Facettenaugen kann ich Bewegungen und Farben gut wahrnehmen, was entscheidend ist, um meine Wirte zu finden. Meine Mundwerkzeuge sind angepasst, um sowohl Nektar als auch andere Flüssigkeiten aufzunehmen, was mich in meiner Ernährung flexibel macht.
Lebenszyklus und Fortpflanzung
Mein Lebenszyklus beginnt, wenn ich eine geeignete Raupe als Wirt finde. Ich lege meine Eier auf oder nahe der Raupe ab. Manchmal lege ich die Eier auch direkt auf Pflanzen, die von Raupen besucht werden. Wenn die Larven aus meinen Eiern schlüpfen, dringen sie in den Körper der Raupe ein und beginnen, sich von deren inneren Geweben zu ernähren. Dies geschieht auf eine Weise, die den Wirt zunächst am Leben erhält, damit die Larve optimale Bedingungen für ihre Entwicklung hat.
Die Entwicklung meiner Larven ist ein Beispiel für Endoparasitismus, bei dem der Wirt letztlich getötet wird, wenn die Larve sich verpuppt und den Körper der Raupe verlässt. Dieses Verhalten stellt sicher, dass meine Nachkommen genügend Nährstoffe haben, um zu überleben und sich zu entwickeln.
Ökologische Rolle und Bedeutung
Als Graue Raupenfliege spiele ich eine wichtige Rolle in der natürlichen Schädlingsbekämpfung. Indem ich Raupen parasitiere, helfe ich, ihre Populationen zu kontrollieren. Dies ist besonders wichtig in landwirtschaftlichen Systemen, wo Raupen oft als Schädlinge gelten, die Nutzpflanzen beschädigen.
Fachlich gesehen sind wir Raupenfliegen für die biologische Schädlingsbekämpfung von großem Interesse. Unsere Fähigkeit, spezifische Schädlinge zu finden und zu parasitieren, macht uns zu wertvollen Verbündeten im ökologischen Pflanzenschutz. Wissenschaftler erforschen unsere Verhaltensweisen und Lebenszyklen, um unsere Wirksamkeit als biologische Kontrolleure weiter zu verstehen und zu optimieren.
Zusammenfassung
Mein Leben als Graue Raupenfliege Dinera grisescens ist geprägt von der ständigen Suche nach Wirten und der Nutzung meiner spezialisierten Anpassungen, um meine Art zu erhalten. Durch meine Rolle im Ökosystem trage ich dazu bei, das natürliche Gleichgewicht zu bewahren und die Gesundheit von Pflanzen in verschiedenen Lebensräumen zu unterstützen.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
Mein Körper ist graubraun gefärbt, was mir hilft, mich in meiner Umgebung zu tarnen. Mit meinen großen Facettenaugen kann ich Bewegungen und Farben gut wahrnehmen, was entscheidend ist, um meine Wirte zu finden. Meine Mundwerkzeuge sind angepasst, um sowohl Nektar als auch andere Flüssigkeiten aufzunehmen, was mich in meiner Ernährung flexibel macht.
Lebenszyklus und Fortpflanzung
Mein Lebenszyklus beginnt, wenn ich eine geeignete Raupe als Wirt finde. Ich lege meine Eier auf oder nahe der Raupe ab. Manchmal lege ich die Eier auch direkt auf Pflanzen, die von Raupen besucht werden. Wenn die Larven aus meinen Eiern schlüpfen, dringen sie in den Körper der Raupe ein und beginnen, sich von deren inneren Geweben zu ernähren. Dies geschieht auf eine Weise, die den Wirt zunächst am Leben erhält, damit die Larve optimale Bedingungen für ihre Entwicklung hat.
Die Entwicklung meiner Larven ist ein Beispiel für Endoparasitismus, bei dem der Wirt letztlich getötet wird, wenn die Larve sich verpuppt und den Körper der Raupe verlässt. Dieses Verhalten stellt sicher, dass meine Nachkommen genügend Nährstoffe haben, um zu überleben und sich zu entwickeln.
Ökologische Rolle und Bedeutung
Als Graue Raupenfliege spiele ich eine wichtige Rolle in der natürlichen Schädlingsbekämpfung. Indem ich Raupen parasitiere, helfe ich, ihre Populationen zu kontrollieren. Dies ist besonders wichtig in landwirtschaftlichen Systemen, wo Raupen oft als Schädlinge gelten, die Nutzpflanzen beschädigen.
Fachlich gesehen sind wir Raupenfliegen für die biologische Schädlingsbekämpfung von großem Interesse. Unsere Fähigkeit, spezifische Schädlinge zu finden und zu parasitieren, macht uns zu wertvollen Verbündeten im ökologischen Pflanzenschutz. Wissenschaftler erforschen unsere Verhaltensweisen und Lebenszyklen, um unsere Wirksamkeit als biologische Kontrolleure weiter zu verstehen und zu optimieren.
Zusammenfassung
Mein Leben als Graue Raupenfliege Dinera grisescens ist geprägt von der ständigen Suche nach Wirten und der Nutzung meiner spezialisierten Anpassungen, um meine Art zu erhalten. Durch meine Rolle im Ökosystem trage ich dazu bei, das natürliche Gleichgewicht zu bewahren und die Gesundheit von Pflanzen in verschiedenen Lebensräumen zu unterstützen.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- Graue Raupenfliege (Dinera grisescens)
Artenschutz in Franken®
Stele der Biodiversität® - Stegaurach / Dellern

Stele der Biodiversität® - Stegaurach / Dellern
24/25.07.2024
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.
Stegaurach / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
24/25.07.2024
- Die grafische Gestaltung ...
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.
Stegaurach / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
Denn wenn (selbst in noch geeigneten Nahrungsstrukturen) keine geeigneten Reproduktionsräume vorhanden sind, ist die Erhaltung der Artenvielfalt gelichfalls zum Scheitern verurteilt.
Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird., setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.
In der Aufnahme
Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird., setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.
In der Aufnahme
- ... Impression vom 18.07.2024 ...
Artenschutz in Franken®
Info zu: Wassersalat / Muschelblume

Info zu: Wassersalat / Muschelblume
23/24.07.2024
Kurze Artbeschreibung:
Diese Schwimmpflanze ist weltweit in tropischen und subtropischen Süßwasser zu finden. Ihr wissenschaftlicher Name: Pistia stratiotes. Krautige, tropische Schwimmpflanze, mit 2 - 30 cm Ø. Die feinen Wurzeln hängen frei im Wasser. Mehrjährig, nicht winterhart. Die Muschelblumen vermehrt sich durch Ableger, die zahlreich um die Mutterpflanze entstehen.
23/24.07.2024
- Betrifft: Wassersalat / Muschelblume auf der Erft - ab August 2024 ist der Handel verboten
Kurze Artbeschreibung:
Diese Schwimmpflanze ist weltweit in tropischen und subtropischen Süßwasser zu finden. Ihr wissenschaftlicher Name: Pistia stratiotes. Krautige, tropische Schwimmpflanze, mit 2 - 30 cm Ø. Die feinen Wurzeln hängen frei im Wasser. Mehrjährig, nicht winterhart. Die Muschelblumen vermehrt sich durch Ableger, die zahlreich um die Mutterpflanze entstehen.
Info:
Diese beliebte Aquarienpflanze wird ab August 2024 verboten und ist dann illegal! Denn sie wird als "invasiv" eingestuft. Sie darf dann nicht mehr gehandelt, also gekauft oder verkauft werden. Ab August 2024 wird die Muschelblume aus dem Verkehr gezogen. Das Verbot ist in der EU-Verordnung über die „Prävention und das Management der Einbringung und Ausbreitung invasiver, gebietsfremder Arten“ festgeschrieben.
Es beinhaltet sowohl den Handel als auch Zucht, Haltung sowie die Freisetzung in der Natur. In der Verordnung sind sowohl Tier- als auch Pflanzenarten aufgeführt, die ursprünglich nicht in der EU heimisch sind. Damit eine Art unter die Verordnung fällt, muss sie laut Verordnung „die Biodiversität und die damit verbundenen Ökosystemdienstleistungen gefährden oder nachteilig beeinflussen“. Und zwar in einem Ausmaß, welches ein konzertiertes Vorgehen auf Unionsebene erfordere.
Wenn man das EU-Verbot absichtlich missachtet, kann das richtig teuer werden. Eine Geldbuße mit bis zu 50.000 Euro kann nach dem Bundesnaturschutzgesetz drohen.
In der Aufnahme
Quelle / Aufnahme
.......................................................................................................
Gewässer und Naturschutz im Erftkreis
Flora-Fauna-Artenschutz
Naturschutzökologie
Rolf Thiemann
Naturschutzberater
50181 Bedburg
Stand
17.07.2024
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung.Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Diese beliebte Aquarienpflanze wird ab August 2024 verboten und ist dann illegal! Denn sie wird als "invasiv" eingestuft. Sie darf dann nicht mehr gehandelt, also gekauft oder verkauft werden. Ab August 2024 wird die Muschelblume aus dem Verkehr gezogen. Das Verbot ist in der EU-Verordnung über die „Prävention und das Management der Einbringung und Ausbreitung invasiver, gebietsfremder Arten“ festgeschrieben.
Es beinhaltet sowohl den Handel als auch Zucht, Haltung sowie die Freisetzung in der Natur. In der Verordnung sind sowohl Tier- als auch Pflanzenarten aufgeführt, die ursprünglich nicht in der EU heimisch sind. Damit eine Art unter die Verordnung fällt, muss sie laut Verordnung „die Biodiversität und die damit verbundenen Ökosystemdienstleistungen gefährden oder nachteilig beeinflussen“. Und zwar in einem Ausmaß, welches ein konzertiertes Vorgehen auf Unionsebene erfordere.
Wenn man das EU-Verbot absichtlich missachtet, kann das richtig teuer werden. Eine Geldbuße mit bis zu 50.000 Euro kann nach dem Bundesnaturschutzgesetz drohen.
In der Aufnahme
- Ganze Wasserflächen sind bedeckt.
Quelle / Aufnahme
.......................................................................................................
Gewässer und Naturschutz im Erftkreis
Flora-Fauna-Artenschutz
Naturschutzökologie
Rolf Thiemann
Naturschutzberater
50181 Bedburg
Stand
17.07.2024
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung.Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Artenschutz in Franken®
Die Gelbe Schlupfwespe (Amblyteles armatorius)

Die Gelbe Schlupfwespe (Amblyteles armatorius)
23 / 24.07.2024
Meine Welt ist voller strategischer Manöver, präziser Sinneswahrnehmungen und biologischer Anpassungen, die es mir ermöglichen, meine Rolle im Ökosystem effektiv zu erfüllen.
23 / 24.07.2024
- Ich bin Amblyteles armatorius, eine gelbe Schlupfwespe aus der Familie der Ichneumonidae.
Meine Welt ist voller strategischer Manöver, präziser Sinneswahrnehmungen und biologischer Anpassungen, die es mir ermöglichen, meine Rolle im Ökosystem effektiv zu erfüllen.
Körperbau und Anpassungen
Meine auffällige gelb-schwarze Färbung ist nicht nur ein optisches Erkennungsmerkmal, sondern dient auch als Warnsignal für mögliche Fressfeinde. Meine schlanken, langen Fühler sind hochspezialisiert und helfen mir, chemische Signale in meiner Umgebung zu erkennen, die mir Hinweise auf potenzielle Wirte geben. Mit meinem gut entwickelten Legebohrer kann ich Eier in den Körper meiner Wirte ablegen. Diese Fähigkeit ist das Herzstück meiner Fortpflanzungsstrategie.
Lebenszyklus und Fortpflanzung
Mein Lebenszyklus beginnt, wenn ich einen geeigneten Wirt finde. Dies sind häufig Raupen oder andere Insektenlarven. Mit meinen Antennen spüre ich chemische Signale auf, die von verletzten Pflanzen oder von den Wirten selbst abgegeben werden. Wenn ich einen Wirt lokalisiere, setze ich meinen Legebohrer ein, um ein Ei in dessen Körper abzulegen. Dabei bin ich äußerst präzise, um sicherzustellen, dass das Ei sich gut entwickeln kann, während der Wirt zunächst weiterlebt.
Die Larve, die aus meinem Ei schlüpft, ernährt sich von den inneren Geweben des Wirts, ohne ihn sofort zu töten. Diese parasitäre Beziehung ist ein Beispiel für eine koinobionte Entwicklung, bei der der Wirt eine Zeit lang am Leben bleibt und weiterwächst, bevor die Larve ihn letztlich tötet und sich verpuppt. Dieses Verhalten maximiert die Ressourcennutzung und erhöht die Überlebensrate meiner Nachkommen.
Ökologische Rolle und Bedeutung
Als Amblyteles armatorius trage ich zur Regulierung der Insektenpopulationen bei. Indem ich meine Eier in Schädlinge wie Raupen lege, helfe ich, ihre Zahl zu kontrollieren und somit das Gleichgewicht im Ökosystem zu wahren. Meine Tätigkeit ist besonders wertvoll in landwirtschaftlichen Umgebungen, wo ich als natürlicher Feind von Schädlingen fungiere und zur biologischen Schädlingsbekämpfung beitrage.
Fachlich betrachtet, sind wir Schlupfwespen ein wichtiges Forschungsobjekt in der Entomologie und der biologischen Schädlingsbekämpfung. Unsere Fähigkeit, spezifische Wirte zu finden und zu parasitieren, macht uns zu wertvollen Alliierten im Kampf gegen Agrarschädlinge, wodurch der Einsatz von chemischen Pestiziden reduziert werden kann.
Zusammenfassung
Mein Leben als gelbe Schlupfwespe Amblyteles armatorius ist geprägt von der ständigen Suche nach Wirten und der Nutzung meiner biologischen Anpassungen, um meine Art zu erhalten. Durch meine Rolle im Ökosystem trage ich dazu bei, das Gleichgewicht der Natur zu bewahren und die Gesundheit landwirtschaftlicher Systeme zu unterstützen.
Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- Männchen ... Unterscheiden sich u.a. durch einen gelben Fleck hinten am Abdomen
(Heck) von den Weibchen.
Artenschutz in Franken®
Die Grüne Waffenfliege (Oplodontha viridula)

Hallo, liebe Kinder!
22/23.07.2024
Vorstellung der Grünen Waffenfliege:
Die Grüne Waffenfliege ist ungefähr so groß wie ein winziger Schatz auf einem Piratenschiff. Ihr Körper glitzert in einem schönen Grün, das fast so leuchtend ist wie ein Smaragd. Sie sieht aus, als wäre sie bereit für ein großes Abenteuer – oder eine lustige Schlacht mit ihren Käferfreunden!
22/23.07.2024
- Habt ihr schon mal eine kleine, grüne Fliege gesehen, die so aussieht, als hätte sie eine glänzende Rüstung an? Das ist die Grüne Waffenfliege, oder wie die Wissenschaftler sie nennen, Oplodontha viridula!
Vorstellung der Grünen Waffenfliege:
Die Grüne Waffenfliege ist ungefähr so groß wie ein winziger Schatz auf einem Piratenschiff. Ihr Körper glitzert in einem schönen Grün, das fast so leuchtend ist wie ein Smaragd. Sie sieht aus, als wäre sie bereit für ein großes Abenteuer – oder eine lustige Schlacht mit ihren Käferfreunden!
"Superkräfte" der Grünen Waffenfliege:
Fachbegriffe zum "Angeben":
Warum die Grüne Waffenfliege wichtig ist:
Die Grüne Waffenfliege hilft dabei, das Gleichgewicht in der Natur zu halten. Ihre Larven fressen schädliche Insektenlarven und helfen so den Pflanzen, gesund zu bleiben. Außerdem sind sie ein wichtiger Teil der Nahrungskette und dienen als Futter für Vögel und andere Tiere.
Also, wenn ihr das nächste Mal eine glänzende, grüne Fliege seht, denkt daran, dass es die Grüne Waffenfliege ist – ein kleiner Ritter im schillernden Gewand, der bereit ist, die Schurken im Garten zu bekämpfen und das Gleichgewicht in der Natur zu bewahren!
Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- Glitzer-Rüstung: Ihre grüne Farbe und der metallische Glanz machen sie zu einer der schicksten Fliegen im Garten. Es sieht aus, als hätte sie eine glänzende Ritterrüstung an. Sie ist immer bereit für eine Party oder ein Abenteuer im Garten!
- Mini-Kämpfer: Obwohl sie klein ist, ist die Grüne Waffenfliege ein echter Kämpfer. Sie legt ihre Eier in feuchten Bereichen ab, und ihre Larven sind kleine Raubtiere, die sich von anderen Insektenlarven ernähren. Sie sind wie winzige Superhelden, die die Schurken im Garten bekämpfen.
- Turbo-Flieger: Mit ihren schnellen Flügeln kann sie blitzschnell von einer Blume zur nächsten fliegen. Es ist, als hätte sie einen eingebauten Turbo-Antrieb! Sie ist die Formel-1-Rennfahrerin unter den Fliegen.
Fachbegriffe zum "Angeben":
- Larven: Das sind die Babyfliegen, die aus den Eiern schlüpfen. Sie sehen aus wie winzige Würmchen und sind immer hungrig.
- Metamorphose: Das ist die Verwandlung von der Larve zur erwachsenen Fliege. Es ist, als würde sich ein Zauber über die Larve legen und sie in die schicke, grüne Waffenfliege verwandeln.
Warum die Grüne Waffenfliege wichtig ist:
Die Grüne Waffenfliege hilft dabei, das Gleichgewicht in der Natur zu halten. Ihre Larven fressen schädliche Insektenlarven und helfen so den Pflanzen, gesund zu bleiben. Außerdem sind sie ein wichtiger Teil der Nahrungskette und dienen als Futter für Vögel und andere Tiere.
Also, wenn ihr das nächste Mal eine glänzende, grüne Fliege seht, denkt daran, dass es die Grüne Waffenfliege ist – ein kleiner Ritter im schillernden Gewand, der bereit ist, die Schurken im Garten zu bekämpfen und das Gleichgewicht in der Natur zu bewahren!
Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- Grüne Waffenfliege (Oplodontha viridula) ... hier wird der Name Waffenfliege verständlich ... sieht sie nicht im Sonnenlicht aus wie ein Ritter in glänzender Rüstung ?
Artenschutz in Franken®
Stele der Biodiversität® - Stegaurach / Dellern

Stele der Biodiversität® - Stegaurach / Dellern
22/23.07.2024
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.
Stegaurach / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
22/23.07.2024
- Die grafische Gestaltung ...
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.
Stegaurach / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
Denn wenn (selbst in noch geeigneten Nahrungsstrukturen) keine geeigneten Reproduktionsräume vorhanden sind, ist die Erhaltung der Artenvielfalt gelichfalls zum Scheitern verurteilt.
Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird., setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.
In der Aufnahme
Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird., setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.
In der Aufnahme
- ... am 16.07.2024 konnten wir diesen Eindruck in uns aufnehmen ...
Artenschutz in Franken®
Dickfühler-Lehmwespe (Symmorphus crassicornis)

Dickfühler-Lehmwespe (Symmorphus crassicornis)
21/22.07.2024
Ich bin ein Vertreter der Familie der Eumeninae, die oft als "Lehmwespen" bezeichnet werden. Meine Lebensweise und mein Verhalten sind perfekt auf mein Überleben und meine Fortpflanzung abgestimmt.
21/22.07.2024
- Als Dickfühler-Lehmwespe, wissenschaftlich bekannt als Symmorphus crassicornis, habe ich eine faszinierende Lebensweise und eine spezielle ökologische Nische.
Ich bin ein Vertreter der Familie der Eumeninae, die oft als "Lehmwespen" bezeichnet werden. Meine Lebensweise und mein Verhalten sind perfekt auf mein Überleben und meine Fortpflanzung abgestimmt.
Lebensraum und Nistverhalten
Ich bevorzuge offene und sonnige Lebensräume, wie Waldränder, Wiesen und Gärten. Hier finde ich die Materialien und Nahrungsquellen, die ich für meine Nachkommen benötige. Mein Nest baue ich aus Lehm, den ich mit Speichel zu kleinen Kügelchen forme und an geschützten Stellen, wie in Hohlräumen von Totholz, in Mauerritzen oder in bestehenden Insektennestern, anbringe. Diese Lehmbauten sind robust und bieten einen sicheren Ort für die Entwicklung meiner Nachkommen.
Fortpflanzung und Brutpflege
Meine Fortpflanzung ist ein sorgfältig orchestrierter Prozess. Als erwachsenes Weibchen suche ich nach Raupen oder Larven von Blattwespen, die als Futter für meine Larven dienen. Nachdem ich eine geeignete Beute gefunden habe, lähme ich sie mit meinem Giftstachel und transportiere sie zu meinem Nest. Dort lege ich ein Ei auf die betäubte Beute und verschließe die Brutzelle mit einer Lehmschicht. Die gelähmte Beute bleibt am Leben, was sicherstellt, dass sie frisch bleibt, bis meine Larve schlüpft und sich davon ernährt.
Anatomie und Physiologie
Meine Antennen sind besonders auffällig und namensgebend. Sie sind dick und keulenförmig, was mir hilft, feine chemische und olfaktorische Signale in meiner Umgebung wahrzunehmen. Diese Fähigkeit ist entscheidend für die Jagd nach geeigneten Wirtslarven und für die Kommunikation mit Artgenossen. Meine kräftigen Mandibeln sind ideal zum Formen und Transportieren von Lehm und zum Handhaben meiner Beute.
Interaktion mit der Umwelt
Meine Präsenz und Aktivität haben eine wichtige Rolle im ökologischen Gleichgewicht. Durch die Kontrolle von Raupenpopulationen trage ich zur Gesunderhaltung der Pflanzen in meinem Lebensraum bei. Zudem schaffe ich durch meine Nisttätigkeit Nistplätze für andere Insekten, wenn ich alte Nester verlasse, was zur Biodiversität beiträgt.
Herausforderungen und Anpassungen
Wie viele meiner Artgenossen stehe ich vor verschiedenen Herausforderungen, darunter der Verlust geeigneter Lebensräume und der Einsatz von Pestiziden, die meine Nahrungsquellen und Lebensräume beeinträchtigen. Trotzdem bin ich anpassungsfähig und finde oft kreative Wege, um in menschlich beeinflussten Umgebungen zu überleben.
Durch meine vielfältigen Anpassungen und mein spezialisiertes Verhalten trage ich zu einem komplexen ökologischen Gefüge bei, das weit über meine eigene Art hinausreicht. Jede Handlung, sei es der Bau eines Nestes oder die Jagd auf eine Raupe, spielt eine Rolle im größeren Ökosystem, dessen Teil ich bin.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch am 17.07.2024
Ich bevorzuge offene und sonnige Lebensräume, wie Waldränder, Wiesen und Gärten. Hier finde ich die Materialien und Nahrungsquellen, die ich für meine Nachkommen benötige. Mein Nest baue ich aus Lehm, den ich mit Speichel zu kleinen Kügelchen forme und an geschützten Stellen, wie in Hohlräumen von Totholz, in Mauerritzen oder in bestehenden Insektennestern, anbringe. Diese Lehmbauten sind robust und bieten einen sicheren Ort für die Entwicklung meiner Nachkommen.
Fortpflanzung und Brutpflege
Meine Fortpflanzung ist ein sorgfältig orchestrierter Prozess. Als erwachsenes Weibchen suche ich nach Raupen oder Larven von Blattwespen, die als Futter für meine Larven dienen. Nachdem ich eine geeignete Beute gefunden habe, lähme ich sie mit meinem Giftstachel und transportiere sie zu meinem Nest. Dort lege ich ein Ei auf die betäubte Beute und verschließe die Brutzelle mit einer Lehmschicht. Die gelähmte Beute bleibt am Leben, was sicherstellt, dass sie frisch bleibt, bis meine Larve schlüpft und sich davon ernährt.
Anatomie und Physiologie
Meine Antennen sind besonders auffällig und namensgebend. Sie sind dick und keulenförmig, was mir hilft, feine chemische und olfaktorische Signale in meiner Umgebung wahrzunehmen. Diese Fähigkeit ist entscheidend für die Jagd nach geeigneten Wirtslarven und für die Kommunikation mit Artgenossen. Meine kräftigen Mandibeln sind ideal zum Formen und Transportieren von Lehm und zum Handhaben meiner Beute.
Interaktion mit der Umwelt
Meine Präsenz und Aktivität haben eine wichtige Rolle im ökologischen Gleichgewicht. Durch die Kontrolle von Raupenpopulationen trage ich zur Gesunderhaltung der Pflanzen in meinem Lebensraum bei. Zudem schaffe ich durch meine Nisttätigkeit Nistplätze für andere Insekten, wenn ich alte Nester verlasse, was zur Biodiversität beiträgt.
Herausforderungen und Anpassungen
Wie viele meiner Artgenossen stehe ich vor verschiedenen Herausforderungen, darunter der Verlust geeigneter Lebensräume und der Einsatz von Pestiziden, die meine Nahrungsquellen und Lebensräume beeinträchtigen. Trotzdem bin ich anpassungsfähig und finde oft kreative Wege, um in menschlich beeinflussten Umgebungen zu überleben.
Durch meine vielfältigen Anpassungen und mein spezialisiertes Verhalten trage ich zu einem komplexen ökologischen Gefüge bei, das weit über meine eigene Art hinausreicht. Jede Handlung, sei es der Bau eines Nestes oder die Jagd auf eine Raupe, spielt eine Rolle im größeren Ökosystem, dessen Teil ich bin.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch am 17.07.2024
- ... eine Dickfühler Lehmwespe ... das Abdomen div. Lehmwespenarten sieht aus wie ein Bohrer.
Artenschutz in Franken®
Heckenschnitt im Sommer - Artenschutz beachten!

Heckenschnitt im Sommer - Artenschutz beachten!
21/22.07.2024
Hallo Zusammen,
nahezu überall werden zur Zeit Hecken (Zuwachs, Formschnitt) beigeschnitten.
Dabei gibt es etwas zu beachten!
Hecken schneiden!
Laut Bundesnaturschutzgesetz ist ein radikaler Rückschnitt oder das Entfernen der Hecke nur in der Zeit von Oktober bis Februar erlaubt, damit Vögel nicht beim Brüten gestört werden. In der Zeit von 1. März bis 30. September ( Vogelschutzzeit) ist jedoch ein "schonender Form- und Pflegeschnitt" erlaubt.
21/22.07.2024
Hallo Zusammen,
nahezu überall werden zur Zeit Hecken (Zuwachs, Formschnitt) beigeschnitten.
Dabei gibt es etwas zu beachten!
Hecken schneiden!
Laut Bundesnaturschutzgesetz ist ein radikaler Rückschnitt oder das Entfernen der Hecke nur in der Zeit von Oktober bis Februar erlaubt, damit Vögel nicht beim Brüten gestört werden. In der Zeit von 1. März bis 30. September ( Vogelschutzzeit) ist jedoch ein "schonender Form- und Pflegeschnitt" erlaubt.
Vom 1. März bis 30. September ist es laut § 39 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG*) verboten Hecken, Bäume und Büsche zu fällen, abzuschneiden oder zu zerstören. Ein Verstoß gegen diese Regelung ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Ordnungswidrigkeit und kann mit einer Geldbuße von bis zu 10.000,- € geahndet werden.
Achtung !
Auch bei Formschnitt oder nur den jährlichen Zuwachs zurückschneiden, können belegte Vogelnester zerstört werden. Im Bild 2 wurde der jährliche Zuwachs geschnitten. Dabei war ein Nest im Zuwachs vorzufinden. Bitte vor dem Schneiden, auch wenn es erlaubt ist, auf Nester achten!
In der Aufnahme
Quelle / Aufnahme
Gewässer und Naturschutz im Erftkreis
Flora-Fauna-Artenschutz
Naturschutzökologie
Rolf Thiemann
Naturschutzberater
50181 Bedburg
Stand
16.07.2024
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung.Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Achtung !
Auch bei Formschnitt oder nur den jährlichen Zuwachs zurückschneiden, können belegte Vogelnester zerstört werden. Im Bild 2 wurde der jährliche Zuwachs geschnitten. Dabei war ein Nest im Zuwachs vorzufinden. Bitte vor dem Schneiden, auch wenn es erlaubt ist, auf Nester achten!
In der Aufnahme
- Das Finkennest war leer.
Quelle / Aufnahme
Gewässer und Naturschutz im Erftkreis
Flora-Fauna-Artenschutz
Naturschutzökologie
Rolf Thiemann
Naturschutzberater
50181 Bedburg
Stand
16.07.2024
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung.Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Artenschutz in Franken®
Aktueller Ordner:
Archiv
Parallele Themen:
2019-11
2019-10
2019-12
2020-01
2020-02
2020-03
2020-04
2020-05
2020-06
2020-07
2020-08
2020-09
2020-10
2020-11
2020-12
2021-01
2021-02
2021-03
2021-04
2021-05
2021-06
2021-07
2021-08
2021-09
2021-10
2021-11
2021-12
2022-01
2022-02
2022-03
2022-04
2022-05
2022-06
2022-07
2022-08
2022-09
2022-10
2022-11
2022-12
2023-01
2023-02
2023-03
2023-04
2023-05
2023-06
2023-07
2023-08
2023-09
2023-10
2023-11
2023-12
2024-01
2024-02
2024-03
2024-04
2024-05
2024-06
2024-07
2024-08
2024-09
2024-10
2024-11
2024-12
2025-01
2025-02
2025-03
2025-04
2025-05
2025-06
2025-07
2025-08
2025-09
2025-10
2025-11
2025-12
















