Falten Erzwespe (Leucopsis dorsigera)

Falten Erzwespe (Leucopsis dorsigera)
20/21.07.2024
Als Erzwespe durchläuft sie einen komplexen Lebenszyklus, der stark mit anderen Arten interagiert, insbesondere mit Bienen und Wespen.
20/21.07.2024
- Die Erzwespe Leucospis dorsigera ist eine bemerkenswerte Art aus der Familie der Leucospidae, die sich durch ihre faszinierenden Lebensweise und ihre spezialisierten Anpassungen auszeichnet.
Als Erzwespe durchläuft sie einen komplexen Lebenszyklus, der stark mit anderen Arten interagiert, insbesondere mit Bienen und Wespen.
Leucospis dorsigera zeichnet sich durch ihre einzigartige Fähigkeit aus, Parasitoidenlarven in den Nestern von Bienen und Wespen zu überleben. Diese Erzwespe ist bekannt dafür, dass sie ihre Eier in die Brutzellen anderer Insektenarten legt, insbesondere in solche, die von Mauerbienen oder Sandwespen geschaffen wurden. Dieser parasitäre Lebensstil ist entscheidend für ihr Überleben und ihre Fortpflanzung.
Ein fachlicher Aspekt, der Leucospis dorsigera besonders interessant macht, ist ihre Anatomie und Physiologie, die sich an diese parasitäre Lebensweise angepasst hat. Zum Beispiel haben sie spezielle Werkzeuge, um die Brutzellen anderer Insekten zu durchdringen und ihre Eier genau dort abzulegen, wo sie sich am besten entwickeln können. Darüber hinaus sind ihre Eier oft mit chemischen Signalen versehen, die sicherstellen, dass sie nicht von den Wirtsinsekten erkannt und abgestoßen werden.
Ein weiterer faszinierender Punkt ist die Beziehung zwischen Leucospis dorsigera und ihren Wirtsinsekten. Durch die parasitäre Interaktion beeinflusst diese Erzwespe direkt die Populationen von Bienen und Wespen, die wiederum wichtige Rollen in ihren jeweiligen Ökosystemen spielen. Studien haben gezeigt, dass diese Wechselwirkungen weitreichende Auswirkungen auf die Struktur und Dynamik von Insektengemeinschaften haben können.
Insgesamt ist Leucospis dorsigera ein herausragendes Beispiel für die Evolution von Anpassungen in der Natur, die es einer Art ermöglichen, eine Nische zu besetzen, die auf die Ausnutzung anderer Organismen spezialisiert ist. Die Erforschung solcher Erzwespen hilft Wissenschaftlern nicht nur dabei, die Vielfalt und Komplexität der Natur zu verstehen, sondern auch, wie empfindlich ökologische Netzwerke auf subtile Veränderungen reagieren können.
Aufnahme von Bernhard Schmalisch - am 17.07.2024
... eine, von mir heute das erste mal gesehene Falten - Erzwespe, hier auf den Doldenblüten von Dill. Larven von diesen Tieren sind Parasitoiden von diversen Osmia Wildbienenarten ... der Legestachel dieses Weibchens ist über den Rücken nach vorne geklappt. Deswegen auch das kompakte Aussehen
Ein fachlicher Aspekt, der Leucospis dorsigera besonders interessant macht, ist ihre Anatomie und Physiologie, die sich an diese parasitäre Lebensweise angepasst hat. Zum Beispiel haben sie spezielle Werkzeuge, um die Brutzellen anderer Insekten zu durchdringen und ihre Eier genau dort abzulegen, wo sie sich am besten entwickeln können. Darüber hinaus sind ihre Eier oft mit chemischen Signalen versehen, die sicherstellen, dass sie nicht von den Wirtsinsekten erkannt und abgestoßen werden.
Ein weiterer faszinierender Punkt ist die Beziehung zwischen Leucospis dorsigera und ihren Wirtsinsekten. Durch die parasitäre Interaktion beeinflusst diese Erzwespe direkt die Populationen von Bienen und Wespen, die wiederum wichtige Rollen in ihren jeweiligen Ökosystemen spielen. Studien haben gezeigt, dass diese Wechselwirkungen weitreichende Auswirkungen auf die Struktur und Dynamik von Insektengemeinschaften haben können.
Insgesamt ist Leucospis dorsigera ein herausragendes Beispiel für die Evolution von Anpassungen in der Natur, die es einer Art ermöglichen, eine Nische zu besetzen, die auf die Ausnutzung anderer Organismen spezialisiert ist. Die Erforschung solcher Erzwespen hilft Wissenschaftlern nicht nur dabei, die Vielfalt und Komplexität der Natur zu verstehen, sondern auch, wie empfindlich ökologische Netzwerke auf subtile Veränderungen reagieren können.
Aufnahme von Bernhard Schmalisch - am 17.07.2024
... eine, von mir heute das erste mal gesehene Falten - Erzwespe, hier auf den Doldenblüten von Dill. Larven von diesen Tieren sind Parasitoiden von diversen Osmia Wildbienenarten ... der Legestachel dieses Weibchens ist über den Rücken nach vorne geklappt. Deswegen auch das kompakte Aussehen
Artenschutz in Franken®
Die Wilden Bienchen von Geiselwind

Die Wilden Bienchen von Geiselwind
20/21.07.2024
Ein Projekt des Artenschutz in Franken®, der Drei-Franken-Grundschule Geiselwind und Turmstationen Deutschland e.V. das unabhängig vom Markt Geiselwind, der Steuerkanzlei Bauerfeind und von der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.
Wildbienen - die unbekannten Bestäuber
Eigentlich haben die meisten von uns in ihrem Leben schon einmal Wildbienen gesehen. Doch bewusst als solche wahrgenommen werden diese Tiere kaum. Vielfach werden sie gar mit Wespen oder Fliegen verwechselt. Und hier zeigt sich auch bereits ein elementares Problem. Aufgrund einer weitverbreiteten Unkenntnis werden „die Wildbiene“ und deren Ansprüche an ihre Lebensräume nicht erkannt.
20/21.07.2024
- Montage der Wildbienenstation ist erfolgt
Ein Projekt des Artenschutz in Franken®, der Drei-Franken-Grundschule Geiselwind und Turmstationen Deutschland e.V. das unabhängig vom Markt Geiselwind, der Steuerkanzlei Bauerfeind und von der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.
Wildbienen - die unbekannten Bestäuber
Eigentlich haben die meisten von uns in ihrem Leben schon einmal Wildbienen gesehen. Doch bewusst als solche wahrgenommen werden diese Tiere kaum. Vielfach werden sie gar mit Wespen oder Fliegen verwechselt. Und hier zeigt sich auch bereits ein elementares Problem. Aufgrund einer weitverbreiteten Unkenntnis werden „die Wildbiene“ und deren Ansprüche an ihre Lebensräume nicht erkannt.
Wildbienen - für uns Menschen ungemein wichtig
Wir Menschen sind darauf angewiesen, dass unsere (Kultur) -Pflanzen bestäubt werden. Wildbienen spielen hierbei eine weitaus größere Rolle als bislang angenommen. Doch Wildbienen sichern nicht nur die Ernteerträge in der Landwirtschaft. Da sie häufig in enger Symbiose mit „ihrer Wildpflanze“ leben, sichern die kleinen Insekten auch das Überleben zahlloser Wildpflanzen.
Wildbienen – häufig im Bestand gefährdet
Doch viele unserer Wildbienenarten in Deutschland sind zwischenzeitlich akut in ihrem Bestand bedroht. Gerade auch durch eine zunehmend industrielle Landbewirtschaftung mit einem immensen Pestizideinsatz sowie der Zerstörung wichtiger Lebensräume haben wir Menschen zahlreiche Wildbienenarten bereits nahe an den Rand des Aussterbens gebracht. Je intensiver die Bewirtschaftungsformen und je umfangreicher Bewirtschaftungs-flächen werden, desto stärker hängt der Ertrag der Landwirtschaft auch von Wildbienen ab. Je mehr Lebensräume wir mit unserem Handeln in unserem Umfeld beeinträchtigen gefährden wir nicht nur eine faszinierende Insektengruppe. Nein mehr noch, wir setzen mit diesem Tun gar eine der (auch und gerade für den Menschen) wichtigsten Ökosysteme aufs Spiel.
In der Aufnahmen
Wir Menschen sind darauf angewiesen, dass unsere (Kultur) -Pflanzen bestäubt werden. Wildbienen spielen hierbei eine weitaus größere Rolle als bislang angenommen. Doch Wildbienen sichern nicht nur die Ernteerträge in der Landwirtschaft. Da sie häufig in enger Symbiose mit „ihrer Wildpflanze“ leben, sichern die kleinen Insekten auch das Überleben zahlloser Wildpflanzen.
Wildbienen – häufig im Bestand gefährdet
Doch viele unserer Wildbienenarten in Deutschland sind zwischenzeitlich akut in ihrem Bestand bedroht. Gerade auch durch eine zunehmend industrielle Landbewirtschaftung mit einem immensen Pestizideinsatz sowie der Zerstörung wichtiger Lebensräume haben wir Menschen zahlreiche Wildbienenarten bereits nahe an den Rand des Aussterbens gebracht. Je intensiver die Bewirtschaftungsformen und je umfangreicher Bewirtschaftungs-flächen werden, desto stärker hängt der Ertrag der Landwirtschaft auch von Wildbienen ab. Je mehr Lebensräume wir mit unserem Handeln in unserem Umfeld beeinträchtigen gefährden wir nicht nur eine faszinierende Insektengruppe. Nein mehr noch, wir setzen mit diesem Tun gar eine der (auch und gerade für den Menschen) wichtigsten Ökosysteme aufs Spiel.
In der Aufnahmen
- am 15.07.2024 wurde die Wildbienenstation installiert ... hier noch nicht Sicherungsstabiliatoren.
Artenschutz in Franken®
Cylindromyia brassicaria, Raupenfliege

Cylindromyia brassicaria, Raupenfliege
19/20.07.2024
Eine Art Kreiselkompass Im Gelenkbereich dieses Drehsinnesorgans sind Sinneszellen die in Kontakt mit dem kleinen Stiel, an dem diese Halteren am Körper befestigt sind, stehen.Wer sich Fliegen betrachtet, wird meist einen "hellen Punkt" unter den Flügeln sehen. Ohne dieses Instrument könnten sie nicht so akrobatisch fliegen.
19/20.07.2024
- "Halteren" ... die weißen Teile unter den Flügeln nennen sich Halteren. Das ist eine Rückbildung eines zweiten Flügelpaares und dient zur Stabilisierung des Fluges.
Eine Art Kreiselkompass Im Gelenkbereich dieses Drehsinnesorgans sind Sinneszellen die in Kontakt mit dem kleinen Stiel, an dem diese Halteren am Körper befestigt sind, stehen.Wer sich Fliegen betrachtet, wird meist einen "hellen Punkt" unter den Flügeln sehen. Ohne dieses Instrument könnten sie nicht so akrobatisch fliegen.
Die Fliege Cylindromyia bicolor ist eine Raupenfliege, die auf Wanzen spezialisiert ist. Sie legt auf erwachsene Wanzen ein Ei und die schlüpfende Larve bohrt sich in diese.Frisst den Wirt von innen auf und überwintert auch in diesem. Mit Wanzen ist eine große, bunte, teilweise wunderschöne Familie gemeint. (Nach meinem Geschmack halt) Die Bettwanzen sind klein und bringen die ganze Verwandtschaft in "Verruf".
Autor / Aufnahme von Bernhard Schmalisch 17.07.2024
Autor / Aufnahme von Bernhard Schmalisch 17.07.2024
Artenschutz in Franken®
Der Apollofalter (Parnassius apollo)

Der Apollofalter (Parnassius apollo)
19/20.07.2024
Mein schneeweißes Flügelkleid, verziert mit leuchtend roten und schwarzen Augenflecken, ist nicht nur eine Augenweide, sondern auch ein Mittel zur Tarnung und Abschreckung von Fressfeinden.
19/20.07.2024
- Ich bin der Apollofalter, Parnassius apollo, und ich schwebte einst majestätisch über die blumenreichen Wiesen und steinigen Hänge Europas.
Mein schneeweißes Flügelkleid, verziert mit leuchtend roten und schwarzen Augenflecken, ist nicht nur eine Augenweide, sondern auch ein Mittel zur Tarnung und Abschreckung von Fressfeinden.
Meine Reise beginnt als winziges Ei, das auf eine Pflanze der Gattung Sedum gelegt wird, oft auf Mauerpfeffer oder Fetthennen. Diese Pflanzen sind nicht zufällig ausgewählt – sie sind die bevorzugte Nahrung meiner zukünftigen Raupen. Nachdem ich schlüpfe, beginnt eine Phase intensiven Fressens, um die Energie für meine Verwandlung zu sammeln. Während ich als Raupe heranwachse, häute ich mich mehrfach, bevor ich mich schließlich verpuppere.
Die Verwandlung zur Puppe ist ein kritischer Moment in meinem Leben. In meinem Kokon ruhe ich, geschützt vor den Elementen, während sich in mir die Strukturen meines zukünftigen Daseins als Schmetterling formen. Nach Wochen des Wartens breche ich schließlich aus meiner Puppe hervor und entfalte meine prächtigen Flügel.
Als erwachsener Apollofalter habe ich eine kurze, aber bedeutungsvolle Lebensspanne. Meine Hauptaufgabe besteht darin, einen Partner zu finden und für Nachkommen zu sorgen. Dabei spielt mein prächtiges Aussehen eine wichtige Rolle. Die auffälligen Augenflecken auf meinen Flügeln sind nicht nur zur Zierde – sie schrecken potenzielle Fressfeinde ab, indem sie größere Tiere wie Augen oder Mäuler simulieren.
Mein Lebensraum sind vorwiegend alpine und subalpine Regionen, wo die Pflanzenwelt reich und vielfältig ist. Ich bevorzuge sonnige, trockene Hänge mit einer Fülle von Blütenpflanzen, die mir Nektar als Nahrung bieten. Diese speziellen Anforderungen machen mich jedoch anfällig für Veränderungen in meiner Umgebung. Der Verlust meines Lebensraumes durch menschliche Aktivitäten und der Klimawandel bedrohen mein Überleben.
Ein weiteres faszinierendes Merkmal meiner Art ist unsere Fähigkeit zur Thermoregulation. Meine dunklen Flügelbereiche absorbieren Wärme, was mir hilft, in den kühleren Höhenlagen aktiv zu bleiben. Dieses biologische Wunder erlaubt es mir, selbst in den frischen Morgenstunden oder bei bewölktem Wetter zu fliegen und nach Nahrung zu suchen.
Mein Dasein ist ein empfindlicher Indikator für die Gesundheit meiner Umwelt. Ein Rückgang meiner Population deutet oft auf tiefgreifende ökologische Probleme hin. Daher ist der Schutz meiner Lebensräume nicht nur für mich, sondern auch für das gesamte Ökosystem von großer Bedeutung. Die Erhaltung der Blumenwiesen und die Bekämpfung des Klimawandels sind entscheidend für mein Überleben.
Der Apollofalter, Parnassius apollo, ist somit nicht nur ein Symbol der alpinen Schönheit, sondern auch ein Mahnmal für den notwendigen Schutz unserer natürlichen Lebensräume und die komplexen ökologischen Zusammenhänge, die unser Leben und Überleben bestimmen.
Aufnahme von Klaus Sanwald
Die Verwandlung zur Puppe ist ein kritischer Moment in meinem Leben. In meinem Kokon ruhe ich, geschützt vor den Elementen, während sich in mir die Strukturen meines zukünftigen Daseins als Schmetterling formen. Nach Wochen des Wartens breche ich schließlich aus meiner Puppe hervor und entfalte meine prächtigen Flügel.
Als erwachsener Apollofalter habe ich eine kurze, aber bedeutungsvolle Lebensspanne. Meine Hauptaufgabe besteht darin, einen Partner zu finden und für Nachkommen zu sorgen. Dabei spielt mein prächtiges Aussehen eine wichtige Rolle. Die auffälligen Augenflecken auf meinen Flügeln sind nicht nur zur Zierde – sie schrecken potenzielle Fressfeinde ab, indem sie größere Tiere wie Augen oder Mäuler simulieren.
Mein Lebensraum sind vorwiegend alpine und subalpine Regionen, wo die Pflanzenwelt reich und vielfältig ist. Ich bevorzuge sonnige, trockene Hänge mit einer Fülle von Blütenpflanzen, die mir Nektar als Nahrung bieten. Diese speziellen Anforderungen machen mich jedoch anfällig für Veränderungen in meiner Umgebung. Der Verlust meines Lebensraumes durch menschliche Aktivitäten und der Klimawandel bedrohen mein Überleben.
Ein weiteres faszinierendes Merkmal meiner Art ist unsere Fähigkeit zur Thermoregulation. Meine dunklen Flügelbereiche absorbieren Wärme, was mir hilft, in den kühleren Höhenlagen aktiv zu bleiben. Dieses biologische Wunder erlaubt es mir, selbst in den frischen Morgenstunden oder bei bewölktem Wetter zu fliegen und nach Nahrung zu suchen.
Mein Dasein ist ein empfindlicher Indikator für die Gesundheit meiner Umwelt. Ein Rückgang meiner Population deutet oft auf tiefgreifende ökologische Probleme hin. Daher ist der Schutz meiner Lebensräume nicht nur für mich, sondern auch für das gesamte Ökosystem von großer Bedeutung. Die Erhaltung der Blumenwiesen und die Bekämpfung des Klimawandels sind entscheidend für mein Überleben.
Der Apollofalter, Parnassius apollo, ist somit nicht nur ein Symbol der alpinen Schönheit, sondern auch ein Mahnmal für den notwendigen Schutz unserer natürlichen Lebensräume und die komplexen ökologischen Zusammenhänge, die unser Leben und Überleben bestimmen.
Aufnahme von Klaus Sanwald
- Apollofalter (Parnassius apollo)
Artenschutz in Franken®
Stele der Biodiversität® - Rosendahl / GT - Darfeld

Stele der Biodiversität® - Rosendahl / GT - Darfeld
19/20.07.2024
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das von der Gemeinde Rosendahl, der MN Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co. KG und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.
Darfeld / Nordrhein-Westfalen. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
19/20.07.2024
- Virtueller Projektrundgang abgeschlossen
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das von der Gemeinde Rosendahl, der MN Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co. KG und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.
Darfeld / Nordrhein-Westfalen. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
Denn wenn (selbst in noch geeigneten Nahrungsstrukturen) keine geeigneten Reproduktionsräume vorhanden sind, ist die Erhaltung der Artenvielfalt gelichfalls zum Scheitern verurteilt.
Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V., das von der Gemeinde Rosendahl, der MN Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co. KG und der Deutschen Postcode Lotterieunterstützt wird, setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.
Am 14.07.2024 konnten wir einen weiteren Projektbaustein abschließen, den virtuellen Projektrundgang der es Ihnen ermöglicht auch ohne vor Ort zu sein, ganz nahe an das Projekt heranzurücken ...
Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V., das von der Gemeinde Rosendahl, der MN Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co. KG und der Deutschen Postcode Lotterieunterstützt wird, setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.
Am 14.07.2024 konnten wir einen weiteren Projektbaustein abschließen, den virtuellen Projektrundgang der es Ihnen ermöglicht auch ohne vor Ort zu sein, ganz nahe an das Projekt heranzurücken ...
Artenschutz in Franken®
Raupenfliege der Art Cylindromyia bicolor

Raupenfliege der Art Cylindromyia bicolor
18/19.07.2024
Lebensraum und Verbreitung
Ich, Cylindromyia bicolor, bin in verschiedenen Lebensräumen Europas anzutreffen, vor allem in offenen, blütenreichen Landschaften wie Wiesen, Waldrändern und Gärten. Hier finde ich nicht nur meine Nahrung, sondern auch geeignete Wirte für meine Larven.
18/19.07.2024
- Als Raupenfliege der Art Cylindromyia bicolor nehme ich dich mit auf eine Reise durch mein Leben, damit du besser verstehst, wer ich bin und welche Rolle ich in meinem Ökosystem spiele.
Lebensraum und Verbreitung
Ich, Cylindromyia bicolor, bin in verschiedenen Lebensräumen Europas anzutreffen, vor allem in offenen, blütenreichen Landschaften wie Wiesen, Waldrändern und Gärten. Hier finde ich nicht nur meine Nahrung, sondern auch geeignete Wirte für meine Larven.
Aussehen und Erkennung
Meine auffällige Erscheinung, mit einem schlanken Körper und charakteristischen schwarzen und orangen Streifen, hilft mir, mich in meinem Lebensraum zu behaupten. Diese Färbung dient auch als Warnsignal für potenzielle Feinde, da sie an giftige oder ungenießbare Arten erinnert.
Ernährung und Verhalten
Als erwachsene Fliege ernähre ich mich hauptsächlich von Nektar und Pollen. Ich fliege von Blume zu Blume, um mich zu ernähren, und trage dabei zur Bestäubung bei, was für das ökologische Gleichgewicht von großer Bedeutung ist.
Fortpflanzung und Lebenszyklus
Der wohl faszinierendste Teil meines Lebens ist meine Fortpflanzungsstrategie. Ich bin eine Parasitoidin, was bedeutet, dass meine Larven in oder auf einem Wirt heranwachsen, was in meinem Fall meist Raupen von Schmetterlingen oder Motten sind.
Eiablage
Wenn ich eine geeignete Raupe finde, lege ich meine Eier auf oder in ihre Nähe. Die Eier sind winzig und kaum sichtbar, aber sie enthalten das Potenzial für neues Leben. Sobald die Larven schlüpfen, bohren sie sich in den Körper der Raupe.
Entwicklung der Larven
Im Inneren der Raupe beginnen meine Larven, sich zu entwickeln. Sie ernähren sich von den Körperflüssigkeiten und Geweben ihres Wirtes, was zu dessen allmählichem Tod führt. Dieser Prozess ist grausam, aber notwendig für das Überleben meiner Art. Meine Larven durchlaufen mehrere Entwicklungsstadien innerhalb des Wirts, bis sie bereit sind, sich zu verpuppen.
Verpuppung und Metamorphose
Wenn meine Larven ausgewachsen sind, verlassen sie den toten oder sterbenden Wirt und verpuppen sich im Boden oder in der Streu. Hier durchlaufen sie die Metamorphose und verwandeln sich in erwachsene Fliegen. Dieser Prozess kann einige Wochen dauern, abhängig von den Umweltbedingungen.
Ökologische Rolle und Bedeutung
Meine Existenz mag grausam erscheinen, aber ich spiele eine wichtige Rolle im Ökosystem. Als natürliche Feindin von Schmetterlings- und Mottenraupen helfe ich, deren Populationen zu kontrollieren. Dies trägt zum Gleichgewicht in den Ökosystemen bei und verhindert übermäßigen Schaden an Pflanzen und Bäumen, den diese Raupen verursachen könnten.
Anpassungsstrategien
Im Laufe der Evolution habe ich spezielle Anpassungen entwickelt, um erfolgreich zu überleben. Meine Fähigkeit, geeignete Wirte zu finden und meine Eier präzise abzulegen, sind wesentliche Überlebensstrategien. Zudem habe ich eine hohe Toleranz gegenüber verschiedenen Umweltbedingungen, was meine Verbreitung in unterschiedlichen Lebensräumen ermöglicht.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass ich, Cylindromyia bicolor, eine faszinierende und komplexe Rolle in meinem Ökosystem spiele. Mein Leben mag brutal erscheinen, aber jede Phase meines Daseins trägt zum Gleichgewicht der Natur bei. Indem ich die Populationen meiner Wirte kontrolliere, unterstütze ich die Gesundheit und Stabilität meines Lebensraums.
Aufnahme von Bernhard Schmalisch
Meine auffällige Erscheinung, mit einem schlanken Körper und charakteristischen schwarzen und orangen Streifen, hilft mir, mich in meinem Lebensraum zu behaupten. Diese Färbung dient auch als Warnsignal für potenzielle Feinde, da sie an giftige oder ungenießbare Arten erinnert.
Ernährung und Verhalten
Als erwachsene Fliege ernähre ich mich hauptsächlich von Nektar und Pollen. Ich fliege von Blume zu Blume, um mich zu ernähren, und trage dabei zur Bestäubung bei, was für das ökologische Gleichgewicht von großer Bedeutung ist.
Fortpflanzung und Lebenszyklus
Der wohl faszinierendste Teil meines Lebens ist meine Fortpflanzungsstrategie. Ich bin eine Parasitoidin, was bedeutet, dass meine Larven in oder auf einem Wirt heranwachsen, was in meinem Fall meist Raupen von Schmetterlingen oder Motten sind.
Eiablage
Wenn ich eine geeignete Raupe finde, lege ich meine Eier auf oder in ihre Nähe. Die Eier sind winzig und kaum sichtbar, aber sie enthalten das Potenzial für neues Leben. Sobald die Larven schlüpfen, bohren sie sich in den Körper der Raupe.
Entwicklung der Larven
Im Inneren der Raupe beginnen meine Larven, sich zu entwickeln. Sie ernähren sich von den Körperflüssigkeiten und Geweben ihres Wirtes, was zu dessen allmählichem Tod führt. Dieser Prozess ist grausam, aber notwendig für das Überleben meiner Art. Meine Larven durchlaufen mehrere Entwicklungsstadien innerhalb des Wirts, bis sie bereit sind, sich zu verpuppen.
Verpuppung und Metamorphose
Wenn meine Larven ausgewachsen sind, verlassen sie den toten oder sterbenden Wirt und verpuppen sich im Boden oder in der Streu. Hier durchlaufen sie die Metamorphose und verwandeln sich in erwachsene Fliegen. Dieser Prozess kann einige Wochen dauern, abhängig von den Umweltbedingungen.
Ökologische Rolle und Bedeutung
Meine Existenz mag grausam erscheinen, aber ich spiele eine wichtige Rolle im Ökosystem. Als natürliche Feindin von Schmetterlings- und Mottenraupen helfe ich, deren Populationen zu kontrollieren. Dies trägt zum Gleichgewicht in den Ökosystemen bei und verhindert übermäßigen Schaden an Pflanzen und Bäumen, den diese Raupen verursachen könnten.
Anpassungsstrategien
Im Laufe der Evolution habe ich spezielle Anpassungen entwickelt, um erfolgreich zu überleben. Meine Fähigkeit, geeignete Wirte zu finden und meine Eier präzise abzulegen, sind wesentliche Überlebensstrategien. Zudem habe ich eine hohe Toleranz gegenüber verschiedenen Umweltbedingungen, was meine Verbreitung in unterschiedlichen Lebensräumen ermöglicht.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass ich, Cylindromyia bicolor, eine faszinierende und komplexe Rolle in meinem Ökosystem spiele. Mein Leben mag brutal erscheinen, aber jede Phase meines Daseins trägt zum Gleichgewicht der Natur bei. Indem ich die Populationen meiner Wirte kontrolliere, unterstütze ich die Gesundheit und Stabilität meines Lebensraums.
Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- Cylindromyia bicolor
Artenschutz in Franken®
Die Bartmeise (Panurus biarmicus)

Bartmeise (Panurus biarmicus)
18/19.07.2024
Meine goldbraunen Federn glänzen im Sonnenlicht, und mein auffälliges schwarz-weißes Bartmuster unter den Augen verleiht mir meinen unverwechselbaren Namen.
18/19.07.2024
- Ich bin eine Bartmeise, Panurus biarmicus, und ich bewege mich geschmeidig durch die Schilfrohre der Feuchtgebiete, die ich mein Zuhause nenne.
Meine goldbraunen Federn glänzen im Sonnenlicht, und mein auffälliges schwarz-weißes Bartmuster unter den Augen verleiht mir meinen unverwechselbaren Namen.
Mein Lebensraum besteht aus dichten Schilfgürteln entlang von Seen, Sümpfen und Flussmündungen. Hier finde ich nicht nur Schutz, sondern auch reichlich Nahrung. Als Allesfresser ernähre ich mich von einer abwechslungsreichen Kost: Im Sommer genieße ich eine Protein-reiche Diät aus Insekten und deren Larven, während im Winter Samen und kleine Pflanzen den Großteil meiner Nahrung ausmachen.
Mein Federkleid ist nicht nur schön, sondern auch funktional. Es hilft mir, mich in den Schilfrohren zu tarnen und vor Fressfeinden zu schützen. Meine kräftigen Beine und langen Zehen erlauben es mir, mich geschickt an den dünnen Schilfstängeln festzuklammern und durch das dichte Gestrüpp zu klettern.
Ein bemerkenswertes Merkmal meiner Spezies ist unser soziales Verhalten. Wir Bartmeisen leben in kleinen, engen Familienverbänden und bleiben auch außerhalb der Brutzeit in Gruppen zusammen. Dieses soziale Band stärkt unsere Gemeinschaft und verbessert unsere Überlebenschancen.
Im Frühling beginnt die Balzzeit, und ich wähle einen Partner, mit dem ich ein Nest aus Schilf und Gras baue. Mein Nest ist kunstvoll gestaltet und gut versteckt, um unsere Eier vor Fressfeinden zu schützen. Nach einer Brutzeit von etwa zwei Wochen schlüpfen die Küken, und beide Elternteile teilen sich die Aufgabe, die Jungen zu füttern und zu schützen.
Als Bartmeise bin ich ein Indikator für die Gesundheit meiner Umwelt. Mein Vorkommen deutet auf ein intaktes Feuchtgebiet hin, da ich saubere, ungestörte Lebensräume benötige, um zu gedeihen. Mein Dasein trägt zur Biodiversität bei und zeigt, wie wichtig der Schutz von Feuchtgebieten ist, nicht nur für mich, sondern für viele andere Arten, die hier leben.
Die Bartmeise, Panurus biarmicus, ist somit nicht nur ein charmanter Bewohner der Feuchtgebiete, sondern auch ein Symbol für die Bedeutung des Naturschutzes und die komplexen Wechselwirkungen innerhalb unserer Ökosysteme.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
Mein Federkleid ist nicht nur schön, sondern auch funktional. Es hilft mir, mich in den Schilfrohren zu tarnen und vor Fressfeinden zu schützen. Meine kräftigen Beine und langen Zehen erlauben es mir, mich geschickt an den dünnen Schilfstängeln festzuklammern und durch das dichte Gestrüpp zu klettern.
Ein bemerkenswertes Merkmal meiner Spezies ist unser soziales Verhalten. Wir Bartmeisen leben in kleinen, engen Familienverbänden und bleiben auch außerhalb der Brutzeit in Gruppen zusammen. Dieses soziale Band stärkt unsere Gemeinschaft und verbessert unsere Überlebenschancen.
Im Frühling beginnt die Balzzeit, und ich wähle einen Partner, mit dem ich ein Nest aus Schilf und Gras baue. Mein Nest ist kunstvoll gestaltet und gut versteckt, um unsere Eier vor Fressfeinden zu schützen. Nach einer Brutzeit von etwa zwei Wochen schlüpfen die Küken, und beide Elternteile teilen sich die Aufgabe, die Jungen zu füttern und zu schützen.
Als Bartmeise bin ich ein Indikator für die Gesundheit meiner Umwelt. Mein Vorkommen deutet auf ein intaktes Feuchtgebiet hin, da ich saubere, ungestörte Lebensräume benötige, um zu gedeihen. Mein Dasein trägt zur Biodiversität bei und zeigt, wie wichtig der Schutz von Feuchtgebieten ist, nicht nur für mich, sondern für viele andere Arten, die hier leben.
Die Bartmeise, Panurus biarmicus, ist somit nicht nur ein charmanter Bewohner der Feuchtgebiete, sondern auch ein Symbol für die Bedeutung des Naturschutzes und die komplexen Wechselwirkungen innerhalb unserer Ökosysteme.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
- Den Namen hat diese Meisenart von der Gesichtszeichnung , die beim Männchen an einen herabhängenden Schnurrbart erinnern soll. Bartmeisen bevorzugen Lebensräume in unmittelbarer Nähe zu Gewässer, Röhricht und Schilf.
Artenschutz in Franken®
Stele der Biodiversität® - Unterfriesen

Stele der Biodiversität® - Unterfriesen
18/19.07.2024
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutzes in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das unabhängig vom Bayernwerk, der Deutschen Postcode Lotterie und des Marktes Hirschaid unterstützt wird.
Unterfriesen / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen, kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
18/19.07.2024
- Grafische Gestaltung mit letztem Pinselstrich abgeschlossen
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutzes in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das unabhängig vom Bayernwerk, der Deutschen Postcode Lotterie und des Marktes Hirschaid unterstützt wird.
Unterfriesen / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen, kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
In der Aufnahme
- ein noch fehlender Bereich unterhalb der Wildbienenwand wurde vor wenigen Tagen mit der entsprechenden Grafik versehen ...
Artenschutz in Franken®
Die Späte Frühlingsschwebfliege / Gemeine Zart-Schwebfliege (Meliscaeva cinctella)

Späte Frühlingsschwebfliege / Gemeine Zart-Schwebfliege (Meliscaeva cinctella)
17/18.07.2024
Lass uns die Welt aus ihrer Perspektive betrachten und einige fachliche Komponenten einbeziehen:
17/18.07.2024
- Die Gemeine Zart-Schwebfliege (Meliscaeva cinctella), auch bekannt als Späte Frühlingsschwebfliege, ist eine Art aus der Familie der Schwebfliegen (Syrphidae), die in Mitteleuropa weit verbreitet ist.
Lass uns die Welt aus ihrer Perspektive betrachten und einige fachliche Komponenten einbeziehen:
Lebensraum und Verbreitung: Die Gemeine Zart-Schwebfliege ist typischerweise in offenen Landschaften anzutreffen, wie Wiesen, Gärten und lichten Wäldern. Sie bevorzugt blütenreiche Gebiete, da sie sich von Nektar und Pollen ernährt.
Ernährung und Nahrungsaufnahme: Als erwachsene Schwebfliege spielt die Nahrungsaufnahme eine zentrale Rolle. Sie besucht Blüten, um Nektar zu saugen, was nicht nur ihre eigene Energieversorgung sicherstellt, sondern auch zur Bestäubung von Pflanzen beiträgt. Ihre Nahrung besteht hauptsächlich aus Kohlenhydraten (Nektar) und gelegentlich aus Pollen, was sie zu einem wichtigen Bestandteil des ökologischen Netzwerks macht.
Fortpflanzung und Entwicklung: Die Fortpflanzung erfolgt in der Nähe von geeigneten Nahrungspflanzen. Die Weibchen legen ihre Eier in die Nähe von Blattläusen, die als Nahrung für die Larven dienen. Dieses Verhalten ist eine Form der Brutparasitoidie, bei der die Larven der Schwebfliege die Blattläuse als Wirt nutzen, um sich zu entwickeln.
Ökologische Rolle: Als Bestäuberin spielt die Gemeine Zart-Schwebfliege eine wichtige ökologische Rolle. Sie unterstützt die Erhaltung der Biodiversität und die Produktivität von Ökosystemen durch ihre Bestäubungsaktivitäten. Darüber hinaus können Schwebfliegenlarven zur Regulation von Blattlauspopulationen beitragen, was sie zu nützlichen Akteuren in der Schädlingsbekämpfung macht.
Anpassungen und Überlebensstrategien: Die Gemeine Zart-Schwebfliege ist gut an ihre Umgebung angepasst. Ihre Fähigkeit, schnell zwischen verschiedenen Nahrungsquellen zu wechseln, sowie ihre Fähigkeit, Blüten zu erkennen und effizient zu bestäuben, sind entscheidende Anpassungen. Sie sind auch oft durch ihre Tarnung geschützt, da ihr Aussehen oft mit Bienen oder Wespen verwechselt werden kann, was potenzielle Fressfeinde abschreckt.
Insgesamt zeigt die Gemeine Zart-Schwebfliege, wie ein relativ unscheinbares Insekt eine wichtige Rolle im Ökosystem spielt, indem es Nahrung webt, Pflanzen bestäubt und zur natürlichen Schädlingskontrolle beiträgt. Ihre Lebensweise und ökologische Bedeutung verdeutlichen die vielfältigen Interaktionen innerhalb der Natur und die Notwendigkeit, auch kleine Arten in Schutzmaßnahmen einzubeziehen.
Aufnahme am 17.07.2024 von Bernhard Schmalisch
Ernährung und Nahrungsaufnahme: Als erwachsene Schwebfliege spielt die Nahrungsaufnahme eine zentrale Rolle. Sie besucht Blüten, um Nektar zu saugen, was nicht nur ihre eigene Energieversorgung sicherstellt, sondern auch zur Bestäubung von Pflanzen beiträgt. Ihre Nahrung besteht hauptsächlich aus Kohlenhydraten (Nektar) und gelegentlich aus Pollen, was sie zu einem wichtigen Bestandteil des ökologischen Netzwerks macht.
Fortpflanzung und Entwicklung: Die Fortpflanzung erfolgt in der Nähe von geeigneten Nahrungspflanzen. Die Weibchen legen ihre Eier in die Nähe von Blattläusen, die als Nahrung für die Larven dienen. Dieses Verhalten ist eine Form der Brutparasitoidie, bei der die Larven der Schwebfliege die Blattläuse als Wirt nutzen, um sich zu entwickeln.
Ökologische Rolle: Als Bestäuberin spielt die Gemeine Zart-Schwebfliege eine wichtige ökologische Rolle. Sie unterstützt die Erhaltung der Biodiversität und die Produktivität von Ökosystemen durch ihre Bestäubungsaktivitäten. Darüber hinaus können Schwebfliegenlarven zur Regulation von Blattlauspopulationen beitragen, was sie zu nützlichen Akteuren in der Schädlingsbekämpfung macht.
Anpassungen und Überlebensstrategien: Die Gemeine Zart-Schwebfliege ist gut an ihre Umgebung angepasst. Ihre Fähigkeit, schnell zwischen verschiedenen Nahrungsquellen zu wechseln, sowie ihre Fähigkeit, Blüten zu erkennen und effizient zu bestäuben, sind entscheidende Anpassungen. Sie sind auch oft durch ihre Tarnung geschützt, da ihr Aussehen oft mit Bienen oder Wespen verwechselt werden kann, was potenzielle Fressfeinde abschreckt.
Insgesamt zeigt die Gemeine Zart-Schwebfliege, wie ein relativ unscheinbares Insekt eine wichtige Rolle im Ökosystem spielt, indem es Nahrung webt, Pflanzen bestäubt und zur natürlichen Schädlingskontrolle beiträgt. Ihre Lebensweise und ökologische Bedeutung verdeutlichen die vielfältigen Interaktionen innerhalb der Natur und die Notwendigkeit, auch kleine Arten in Schutzmaßnahmen einzubeziehen.
Aufnahme am 17.07.2024 von Bernhard Schmalisch
- Männchen - auf dem Doldenblüter Dill, der gerne von diversen Insekten besucht, oft förmlich umschwärmt wird. Hier sind die Farben des Sommers, nach meiner Meinung, gut abgebildet.
Artenschutz in Franken®
Die Schwarze Mörtelbiene (Megachile parietina)

Schwarze Mörtelbiene (Megachile parietina)
17/18.07.2024
Mein Name leitet sich von meiner Fähigkeit ab, komplexe Nester aus Lehmpartikeln zu konstruieren, die an eine Mörtelstruktur erinnern. Dieses Talent ist nicht nur ein Überlebenswerkzeug, sondern auch ein künstlerischer Ausdruck meiner Spezies.
17/18.07.2024
- Als Schwarze Mörtelbiene, Megachile parietina, betrachte ich die Welt durch die Linse meines einzigartigen Lebenszyklus und meiner bemerkenswerten biologischen Eigenschaften.
Mein Name leitet sich von meiner Fähigkeit ab, komplexe Nester aus Lehmpartikeln zu konstruieren, die an eine Mörtelstruktur erinnern. Dieses Talent ist nicht nur ein Überlebenswerkzeug, sondern auch ein künstlerischer Ausdruck meiner Spezies.
Mein Lebenszyklus beginnt als Ei, das von meiner Mutter sorgfältig in einem hohlen Pflanzenstängel oder einem anderen geeigneten Ort abgelegt wird. Als Larve ernähre ich mich von Pollen und Nektar, bevor ich mich verpuppe und in meiner Kokonhülle ruhe. Diese Metamorphose verwandelt mich in eine erwachsene Biene, die bald danach aus dem Nest schlüpft und sich der Bestäubung von Blüten widmet.
Eine meiner bemerkenswertesten Eigenschaften ist meine effiziente Sammeltechnik für Pollen und Nektar. Mit meinem charakteristischen Bauchhaarpinsel sammle ich Pollen auf und transportiere ihn in speziellen Bürsten an meinen Hinterbeinen, den Pollensammelhaaren, zu meinem Nest. Dort wird der Pollen als Nahrung für meine Nachkommen gespeichert, die in den Zellen des Lehmnestes heranwachsen.
Meine Vorliebe für trockene, sonnenexponierte Standorte wie Lehmwände, Sandsteinbrüche oder Steilhänge reflektiert meine Anpassungsfähigkeit an spezifische Lebensräume. Diese Standorte bieten nicht nur Schutz vor Raubtieren, sondern auch optimale Bedingungen für den Nestbau und die Aufzucht meiner Brut.
Als Bestäuberin spiele ich eine entscheidende Rolle im Ökosystem, indem ich zur Erhaltung der Pflanzenvielfalt und zur Sicherstellung der Erträge landwirtschaftlicher Kulturen beitrage. Meine Bescheidenheit in der Größe wird durch meine Bedeutung in der Natur kompensiert, wo jede meiner Aktionen dazu beiträgt, das Gleichgewicht und die Schönheit der Pflanzenwelt zu erhalten.
Die Schwarze Mörtelbiene, Megachile parietina, verkörpert somit nicht nur die Kunst des Nestbaus und der Bestäubung, sondern auch die Anpassungsfähigkeit und Bedeutung der kleinen Lebewesen für das größere Ökosystem.
Aufnahme von Helga Zinnecker
Eine meiner bemerkenswertesten Eigenschaften ist meine effiziente Sammeltechnik für Pollen und Nektar. Mit meinem charakteristischen Bauchhaarpinsel sammle ich Pollen auf und transportiere ihn in speziellen Bürsten an meinen Hinterbeinen, den Pollensammelhaaren, zu meinem Nest. Dort wird der Pollen als Nahrung für meine Nachkommen gespeichert, die in den Zellen des Lehmnestes heranwachsen.
Meine Vorliebe für trockene, sonnenexponierte Standorte wie Lehmwände, Sandsteinbrüche oder Steilhänge reflektiert meine Anpassungsfähigkeit an spezifische Lebensräume. Diese Standorte bieten nicht nur Schutz vor Raubtieren, sondern auch optimale Bedingungen für den Nestbau und die Aufzucht meiner Brut.
Als Bestäuberin spiele ich eine entscheidende Rolle im Ökosystem, indem ich zur Erhaltung der Pflanzenvielfalt und zur Sicherstellung der Erträge landwirtschaftlicher Kulturen beitrage. Meine Bescheidenheit in der Größe wird durch meine Bedeutung in der Natur kompensiert, wo jede meiner Aktionen dazu beiträgt, das Gleichgewicht und die Schönheit der Pflanzenwelt zu erhalten.
Die Schwarze Mörtelbiene, Megachile parietina, verkörpert somit nicht nur die Kunst des Nestbaus und der Bestäubung, sondern auch die Anpassungsfähigkeit und Bedeutung der kleinen Lebewesen für das größere Ökosystem.
Aufnahme von Helga Zinnecker
- Schwarze Mörtelbiene (Megachile parietina)
Artenschutz in Franken®
Stele der Biodiversität® - Stegaurach / Dellern

Stele der Biodiversität® - Stegaurach / Dellern
17/18.07.2024
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.
Stegaurach / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
17/18.07.2024
- Die ersten Pinselstriche sind gesetzt ...
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.
Stegaurach / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
Denn wenn (selbst in noch geeigneten Nahrungsstrukturen) keine geeigneten Reproduktionsräume vorhanden sind, ist die Erhaltung der Artenvielfalt gelichfalls zum Scheitern verurteilt.
Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird., setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.
In der Aufnahme
Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird., setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.
In der Aufnahme
- Am 12.07.2024 zeigen sich die ersten Pinseltriche am Objekt ...
Artenschutz in Franken®
Der Faulbaum-Bläuling (Celastrina argiolus)

Als Faulbaum-Bläuling (Celastrina argiolus), auch bekannt als Garten-Bläuling, erlebe ich die Welt auf eine faszinierende Weise, die voller Abenteuer und Überraschungen steckt.
16/17.06.2024
Meine Reise beginnt:
Ich schlüpfe aus einem winzigen Ei, das meine Mutter sorgfältig auf die Blätter oder Blüten meiner bevorzugten Wirtspflanzen abgelegt hat. Zu meinen Lieblingspflanzen zählen der Faulbaum (Rhamnus frangula), aber auch andere Sträucher und Bäume wie Stechpalme, Liguster und sogar Efeu.
16/17.06.2024
- Lass mich dir mein Leben und meine Eigenschaften aus meiner Sicht schildern:
Meine Reise beginnt:
Ich schlüpfe aus einem winzigen Ei, das meine Mutter sorgfältig auf die Blätter oder Blüten meiner bevorzugten Wirtspflanzen abgelegt hat. Zu meinen Lieblingspflanzen zählen der Faulbaum (Rhamnus frangula), aber auch andere Sträucher und Bäume wie Stechpalme, Liguster und sogar Efeu.
Als hungrige Raupe:
Als kleine Raupe beginne ich sofort, mich von den Blättern meiner Wirtspflanze zu ernähren. Mein Körper ist in der Anfangsphase grün, gut getarnt und mit feinen Härchen bedeckt, die mich vor Fressfeinden schützen. Ich wachse schnell und durchlaufe mehrere Häutungen, bevor ich mich zur Verpuppung vorbereite.
Die Metamorphose:
Der Prozess der Verwandlung ist magisch. In meiner Puppenform ruhe ich eine Weile, während sich mein Körper zu einem Schmetterling entwickelt. Wenn die Zeit reif ist, schlüpfe ich als erwachsener Falter und breite meine wunderschönen, bläulich schimmernden Flügel aus.
Mein prächtiges Aussehen:
Als erwachsener Falter bin ich leicht zu erkennen. Meine Flügeloberseiten sind bei den Männchen leuchtend blau mit einem feinen, dunklen Rand, während die Weibchen oft ein etwas blasseres Blau mit breiteren dunklen Rändern aufweisen. Die Flügelunterseiten sind bei beiden Geschlechtern blassblau mit zarten weißen Flecken, die mir helfen, mich bei geschlossenen Flügeln zu tarnen.
Mein Lebensraum:
Ich bin ein häufiger Besucher von Gärten, Waldrändern, Parks und Hecken. Ich liebe es, von Blüte zu Blüte zu flattern, um Nektar zu trinken. Zu meinen bevorzugten Nektarquellen gehören Blüten von Sträuchern wie Holunder, Brombeere und vielen anderen.
Meine Rolle im Ökosystem:
Ich trage zur Bestäubung bei, indem ich von Blüte zu Blüte fliege und Pollen transportiere. Gleichzeitig bin ich ein wichtiger Bestandteil des Nahrungsnetzes: Als Raupe werde ich von Vögeln und anderen Insekten gefressen, und als Falter biete ich Nahrung für Spinnen und Vögel.
Fachliche Komponenten:
Mein Abenteuer:
Jeder Tag ist ein neues Abenteuer, während ich durch die Luft tanze, auf der Suche nach Nahrung und einem geeigneten Ort für die nächste Generation von Faulbaum-Bläulingen. Ich erlebe die Welt in leuchtenden Farben und mit einem starken Überlebenswillen, immer bereit, meine Rolle im großen Kreislauf der Natur zu erfüllen.
So siehst du, mein Leben als Faulbaum-Bläuling ist alles andere als langweilig. Es ist geprägt von ständigen Veränderungen, beeindruckenden Anpassungsfähigkeiten und einer engen Verbindung zur Natur um mich herum.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
Als kleine Raupe beginne ich sofort, mich von den Blättern meiner Wirtspflanze zu ernähren. Mein Körper ist in der Anfangsphase grün, gut getarnt und mit feinen Härchen bedeckt, die mich vor Fressfeinden schützen. Ich wachse schnell und durchlaufe mehrere Häutungen, bevor ich mich zur Verpuppung vorbereite.
Die Metamorphose:
Der Prozess der Verwandlung ist magisch. In meiner Puppenform ruhe ich eine Weile, während sich mein Körper zu einem Schmetterling entwickelt. Wenn die Zeit reif ist, schlüpfe ich als erwachsener Falter und breite meine wunderschönen, bläulich schimmernden Flügel aus.
Mein prächtiges Aussehen:
Als erwachsener Falter bin ich leicht zu erkennen. Meine Flügeloberseiten sind bei den Männchen leuchtend blau mit einem feinen, dunklen Rand, während die Weibchen oft ein etwas blasseres Blau mit breiteren dunklen Rändern aufweisen. Die Flügelunterseiten sind bei beiden Geschlechtern blassblau mit zarten weißen Flecken, die mir helfen, mich bei geschlossenen Flügeln zu tarnen.
Mein Lebensraum:
Ich bin ein häufiger Besucher von Gärten, Waldrändern, Parks und Hecken. Ich liebe es, von Blüte zu Blüte zu flattern, um Nektar zu trinken. Zu meinen bevorzugten Nektarquellen gehören Blüten von Sträuchern wie Holunder, Brombeere und vielen anderen.
Meine Rolle im Ökosystem:
Ich trage zur Bestäubung bei, indem ich von Blüte zu Blüte fliege und Pollen transportiere. Gleichzeitig bin ich ein wichtiger Bestandteil des Nahrungsnetzes: Als Raupe werde ich von Vögeln und anderen Insekten gefressen, und als Falter biete ich Nahrung für Spinnen und Vögel.
Fachliche Komponenten:
- Taxonomie: Ich gehöre zur Familie der Bläulinge (Lycaenidae).
- Lebenszyklus: Ei, Raupe, Puppe und erwachsener Falter (vollständige Metamorphose).
- Morphologische Merkmale: Bläulich schimmernde Flügeloberseiten, blassblaue Flügelunterseiten mit weißen Flecken.
- Ökologische Bedeutung: Bestäuber und Teil des Nahrungsnetzes.
- Lebensraum: Gärten, Waldränder, Parks und Hecken, bevorzugt in der Nähe von Wirtspflanzen wie Faulbaum und Stechpalme.
Mein Abenteuer:
Jeder Tag ist ein neues Abenteuer, während ich durch die Luft tanze, auf der Suche nach Nahrung und einem geeigneten Ort für die nächste Generation von Faulbaum-Bläulingen. Ich erlebe die Welt in leuchtenden Farben und mit einem starken Überlebenswillen, immer bereit, meine Rolle im großen Kreislauf der Natur zu erfüllen.
So siehst du, mein Leben als Faulbaum-Bläuling ist alles andere als langweilig. Es ist geprägt von ständigen Veränderungen, beeindruckenden Anpassungsfähigkeiten und einer engen Verbindung zur Natur um mich herum.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- Faulbaum-Bläuling (Celastrina argiolus)
Artenschutz in Franken®
Die "Wilden Bienchen" von Sachsenkam

Die "Wilden Bienchen" von Sachsenkam
16/17.08.2024
Wildbienen - die unbekannten Bestäuber
Eigentlich haben die meisten von uns in ihrem Leben schon einmal Wildbienen gesehen. Doch bewusst als solche wahrgenommen werden diese Tiere kaum. Vielfach werden sie gar mit Wespen oder Fliegen verwechselt. Und hier zeigt sich auch bereits ein elementares Problem. Aufgrund einer weitverbreiteten Unkenntnis werden „die Wildbiene“ und deren Ansprüche an ihre Lebensräume nicht erkannt.
16/17.08.2024
- Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und der Gemeinde Sachsenkam das pädagogisch vom Haus für Kinder Sachsenkam begleitet und von der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.
Wildbienen - die unbekannten Bestäuber
Eigentlich haben die meisten von uns in ihrem Leben schon einmal Wildbienen gesehen. Doch bewusst als solche wahrgenommen werden diese Tiere kaum. Vielfach werden sie gar mit Wespen oder Fliegen verwechselt. Und hier zeigt sich auch bereits ein elementares Problem. Aufgrund einer weitverbreiteten Unkenntnis werden „die Wildbiene“ und deren Ansprüche an ihre Lebensräume nicht erkannt.
Wildbienen - für uns Menschen ungemein wichtig
Wir Menschen sind darauf angewiesen, dass unsere (Kultur) -Pflanzen bestäubt werden. Wildbienen spielen hierbei eine weitaus größere Rolle als bislang angenommen. Doch Wildbienen sichern nicht nur die Ernteerträge in der Landwirtschaft. Da sie häufig in enger Symbiose mit „ihrer Wildpflanze“ leben, sichern die kleinen Insekten auch das Überleben zahlloser Wildpflanzen.
Wildbienen – häufig im Bestand gefährdet
Doch viele unserer Wildbienenarten in Deutschland sind zwischenzeitlich akut in ihrem Bestand bedroht. Gerade auch durch eine zunehmend industrielle Landbewirtschaftung mit einem immensen Pestizideinsatz sowie der Zerstörung wichtiger Lebensräume haben wir Menschen zahlreiche Wildbienenarten bereits nahe an den Rand des Aussterbens gebracht. Je intensiver die Bewirtschaftungsformen und je umfangreicher Bewirtschaftungs-flächen werden, desto stärker hängt der Ertrag der Landwirtschaft auch von Wildbienen ab. Je mehr Lebensräume wir mit unserem Handeln in unserem Umfeld beeinträchtigen gefährden wir nicht nur eine faszinierende Insektengruppe. Nein mehr noch, wir setzen mit diesem Tun gar eine der (auch und gerade für den Menschen) wichtigsten Ökosysteme aufs Spiel.
In der Aufnahme von © Verwaltungsgemeinschaft Reichersbeuern
Wir Menschen sind darauf angewiesen, dass unsere (Kultur) -Pflanzen bestäubt werden. Wildbienen spielen hierbei eine weitaus größere Rolle als bislang angenommen. Doch Wildbienen sichern nicht nur die Ernteerträge in der Landwirtschaft. Da sie häufig in enger Symbiose mit „ihrer Wildpflanze“ leben, sichern die kleinen Insekten auch das Überleben zahlloser Wildpflanzen.
Wildbienen – häufig im Bestand gefährdet
Doch viele unserer Wildbienenarten in Deutschland sind zwischenzeitlich akut in ihrem Bestand bedroht. Gerade auch durch eine zunehmend industrielle Landbewirtschaftung mit einem immensen Pestizideinsatz sowie der Zerstörung wichtiger Lebensräume haben wir Menschen zahlreiche Wildbienenarten bereits nahe an den Rand des Aussterbens gebracht. Je intensiver die Bewirtschaftungsformen und je umfangreicher Bewirtschaftungs-flächen werden, desto stärker hängt der Ertrag der Landwirtschaft auch von Wildbienen ab. Je mehr Lebensräume wir mit unserem Handeln in unserem Umfeld beeinträchtigen gefährden wir nicht nur eine faszinierende Insektengruppe. Nein mehr noch, wir setzen mit diesem Tun gar eine der (auch und gerade für den Menschen) wichtigsten Ökosysteme aufs Spiel.
In der Aufnahme von © Verwaltungsgemeinschaft Reichersbeuern
- Die Wildbienenstation nach Entfernung der Sicherungssstabilisatoren
Artenschutz in Franken®
C-Falter ( Nymphalis c-album )

Der C-Falter ( Nymphalis c-album )
15/16.07.2024
Ich bin der C-Falter, bekannt für die markante weiße C-förmige Zeichnung auf der Unterseite meiner Hinterflügel, die mir auch meinen Namen gegeben hat. Ich gehöre zur Familie der Edelfalter (Nymphalidae) und bin in Europa, Nordafrika und Teilen Asiens weit verbreitet.
15/16.07.2024
- Als C-Falter (Polygonia c-album) nehme ich die Welt auf besondere Weise wahr und kann meine Geschichte so erzählen:
Ich bin der C-Falter, bekannt für die markante weiße C-förmige Zeichnung auf der Unterseite meiner Hinterflügel, die mir auch meinen Namen gegeben hat. Ich gehöre zur Familie der Edelfalter (Nymphalidae) und bin in Europa, Nordafrika und Teilen Asiens weit verbreitet.
Mein Leben beginnt als Ei, das ich als erwachsenes Weibchen auf die Futterpflanzen meiner zukünftigen Larven lege. Dazu gehören verschiedene Pflanzenarten wie Brennnesseln, Ulmen und Hopfen. Nach dem Schlüpfen fressen meine Larven gierig die Blätter dieser Pflanzen und durchlaufen mehrere Häutungen, bevor sie sich verpuppen.
Während meiner Raupenphase bin ich schwarz-weiß gefärbt und habe eine stachelige Erscheinung, die mich vor Fressfeinden schützt. Als Puppe verweile ich bewegungslos, während sich mein Körper zu einem prächtigen Schmetterling entwickelt.
Als erwachsener Falter habe ich einen auffälligen, gezackten Flügelrand, der mir hilft, mich optisch in mein Umfeld einzufügen und Raubtiere zu täuschen. Meine Flügeloberseiten sind orange mit schwarzen Flecken, was mir bei geöffneten Flügeln ein prächtiges Aussehen verleiht. Bei geschlossenen Flügeln hingegen tarne ich mich hervorragend, indem ich wie ein vertrocknetes Blatt wirke – eine perfekte Strategie gegen Fressfeinde.
In meiner Lebensweise bin ich vielseitig. Ich besuche eine Vielzahl von Blütenpflanzen, um Nektar zu trinken, und trage so zur Bestäubung bei. Besonders im Herbst, wenn die Tage kürzer werden, bereite ich mich auf den Winter vor. Ich gehöre zu den Schmetterlingen, die eine Winterruhe einlegen und in Ritzen, hohlen Bäumen oder Gebäuden überwintern. Wenn die Temperaturen im Frühling steigen, erwache ich aus meiner Ruhephase und mache mich wieder auf die Suche nach Nektar und einem geeigneten Platz zur Eiablage.
Fachlich betrachtet, umfasse ich mehrere bemerkenswerte Merkmale:
Ich bin also nicht nur ein schöner Anblick in der Natur, sondern auch ein wichtiger Teil des Ökosystems, der durch seine Anpassungsfähigkeit und faszinierenden Lebenszyklus beeindruckt.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
Während meiner Raupenphase bin ich schwarz-weiß gefärbt und habe eine stachelige Erscheinung, die mich vor Fressfeinden schützt. Als Puppe verweile ich bewegungslos, während sich mein Körper zu einem prächtigen Schmetterling entwickelt.
Als erwachsener Falter habe ich einen auffälligen, gezackten Flügelrand, der mir hilft, mich optisch in mein Umfeld einzufügen und Raubtiere zu täuschen. Meine Flügeloberseiten sind orange mit schwarzen Flecken, was mir bei geöffneten Flügeln ein prächtiges Aussehen verleiht. Bei geschlossenen Flügeln hingegen tarne ich mich hervorragend, indem ich wie ein vertrocknetes Blatt wirke – eine perfekte Strategie gegen Fressfeinde.
In meiner Lebensweise bin ich vielseitig. Ich besuche eine Vielzahl von Blütenpflanzen, um Nektar zu trinken, und trage so zur Bestäubung bei. Besonders im Herbst, wenn die Tage kürzer werden, bereite ich mich auf den Winter vor. Ich gehöre zu den Schmetterlingen, die eine Winterruhe einlegen und in Ritzen, hohlen Bäumen oder Gebäuden überwintern. Wenn die Temperaturen im Frühling steigen, erwache ich aus meiner Ruhephase und mache mich wieder auf die Suche nach Nektar und einem geeigneten Platz zur Eiablage.
Fachlich betrachtet, umfasse ich mehrere bemerkenswerte Merkmale:
- Taxonomie: Gattung Polygonia, Familie Nymphalidae.
- Morphologische Merkmale: Gezackter Flügelrand, orange-schwarze Flügeloberseite, C-förmige Zeichnung auf der Flügelunterseite.
- Lebenszyklus: Metamorphose von Ei, Raupe, Puppe bis zum adulten Falter.
- Ökologische Rolle: Bestäuber, Teil des Nahrungsnetzes (Räuber-Beute-Beziehungen).
- Überwinterungsstrategie: Winterruhe in geschützten Verstecken.
Ich bin also nicht nur ein schöner Anblick in der Natur, sondern auch ein wichtiger Teil des Ökosystems, der durch seine Anpassungsfähigkeit und faszinierenden Lebenszyklus beeindruckt.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- C-Falter ( Nymphalis c-album )
Artenschutz in Franken®
Die Späte Wespenschwebfliege (Chrysotoxum arcuatum)

Späte Wespenschwebfliege (Chrysotoxum arcuatum)
15/16.07.2024
Als Späte Wespenschwebfliege selbst könnte ich meine Art folgendermaßen beschreiben:
15/16.07.2024
- Die Späte Wespenschwebfliege (Chrysotoxum arcuatum) ist eine interessante Fliegenart aus der Familie der Schwebfliegen (Syrphidae).
Als Späte Wespenschwebfliege selbst könnte ich meine Art folgendermaßen beschreiben:
Ich gehöre zur Gattung Chrysotoxum und bin bekannt für mein auffälliges Aussehen, das dem einer Wespe ähnelt. Dies dient mir als Schutzmechanismus vor Fressfeinden, da viele Tiere Wespen aufgrund ihres Stichs meiden. Meine Flügelspannweite beträgt etwa 10 bis 12 mm, und mein Körper ist schlank und gestreift, was mich von echten Wespen unterscheidet, obwohl ich ähnlich aussehe.
Meine Larvenentwicklung erfolgt in verschiedenen Habitaten, insbesondere in feuchten Wäldern und in der Nähe von Gewässern, wo meine Larven sich von Blattlauspopulationen ernähren. Als erwachsene Fliege ernähre ich mich von Nektar und spiele eine wichtige Rolle als Bestäuber in meiner Umgebung. Dabei besuche ich eine Vielzahl von Blüten, wobei ich durch mein Erscheinungsbild oft Verwechslungen mit Wespen hervorrufe, was mich vor potenziellen Räubern schützt.
Meine Art ist in Europa verbreitet und kommt in verschiedenen Ökosystemen vor, von Wäldern bis zu offenen Landschaften. Ich bin eine von vielen Schwebfliegenarten, die durch ihre ökologische Rolle und Anpassungsfähigkeit bemerkenswert sind.
Fachliche Komponenten, die meine Art charakterisieren, umfassen meine taxonomische Klassifikation (Gattung Chrysotoxum, Familie Syrphidae), ökologische Interaktionen (Rolle als Bestäuber und Prädator von Blattläusen), morphologische Merkmale (Wespenimitation zur Verteidigung) sowie ökologische Verteilung und Habitatpräferenzen (feuchte Wälder, Gewässernähe).
Insgesamt bin ich als Späte Wespenschwebfliege eine faszinierende Spezies, die durch ihre Anpassungsfähigkeit und wichtige ökologische Rolle in verschiedenen Lebensräumen hervorsticht.
Aufnahme von Bernhard Schmalisch
Meine Larvenentwicklung erfolgt in verschiedenen Habitaten, insbesondere in feuchten Wäldern und in der Nähe von Gewässern, wo meine Larven sich von Blattlauspopulationen ernähren. Als erwachsene Fliege ernähre ich mich von Nektar und spiele eine wichtige Rolle als Bestäuber in meiner Umgebung. Dabei besuche ich eine Vielzahl von Blüten, wobei ich durch mein Erscheinungsbild oft Verwechslungen mit Wespen hervorrufe, was mich vor potenziellen Räubern schützt.
Meine Art ist in Europa verbreitet und kommt in verschiedenen Ökosystemen vor, von Wäldern bis zu offenen Landschaften. Ich bin eine von vielen Schwebfliegenarten, die durch ihre ökologische Rolle und Anpassungsfähigkeit bemerkenswert sind.
Fachliche Komponenten, die meine Art charakterisieren, umfassen meine taxonomische Klassifikation (Gattung Chrysotoxum, Familie Syrphidae), ökologische Interaktionen (Rolle als Bestäuber und Prädator von Blattläusen), morphologische Merkmale (Wespenimitation zur Verteidigung) sowie ökologische Verteilung und Habitatpräferenzen (feuchte Wälder, Gewässernähe).
Insgesamt bin ich als Späte Wespenschwebfliege eine faszinierende Spezies, die durch ihre Anpassungsfähigkeit und wichtige ökologische Rolle in verschiedenen Lebensräumen hervorsticht.
Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- Weibchen
Artenschutz in Franken®
Stele der Biodiversität® - Stegaurach / Dellern

Stele der Biodiversität® - Stegaurach / Dellern
15/16.07.2024
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.
Stegaurach / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
15/16.07.2024
- Start der grafischen Fassadengestaltung ...
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.
Stegaurach / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
Denn wenn (selbst in noch geeigneten Nahrungsstrukturen) keine geeigneten Reproduktionsräume vorhanden sind, ist die Erhaltung der Artenvielfalt gelichfalls zum Scheitern verurteilt.
Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird., setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.
In der Aufnahme
Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird., setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.
In der Aufnahme
- Gut vorbereitet - mit dieser Aufnahme wollen wir vor dem Start der grafischen Gestaltung, der für den 15.07.2024 geplant ist, einen Blick auf den hierfür vorbereiteten Zustand werfen. Die Aufnahme ist am 09.07.2024 entstanden.
...
Artenschutz in Franken®
Die Gemeine Sumpfschwebfliege (Helophilus pendulus)

Gemeine Sumpfschwebfliege (Helophilus pendulus)
14/15.07.2024
Mein Körper ist schlank und langgestreckt, und ich trage auffällige gelbe und schwarze Streifen auf meinem Abdomen, was mich von anderen Insekten unterscheidet.
14/15.07.2024
- Als Gemeine Sumpfschwebfliege (Helophilus pendulus) bin ich eine faszinierende Kreatur, die eng mit feuchten und sumpfigen Lebensräumen verbunden ist.
Mein Körper ist schlank und langgestreckt, und ich trage auffällige gelbe und schwarze Streifen auf meinem Abdomen, was mich von anderen Insekten unterscheidet.
Ich gehöre zur Familie der Schwebfliegen (Syrphidae), die für ihre bemerkenswerte Ähnlichkeit mit Wespen bekannt sind, was uns vor Fressfeinden schützt. Diese Mimikry ist jedoch nicht nur zur Tarnung gedacht, sondern dient auch der Abschreckung potenzieller Fressfeinde wie Vögel und andere Insekten.
Meine Larven entwickeln sich in stehenden oder langsam fließenden Gewässern, wie z.B. Teichen, Tümpeln oder feuchten Gräben. Dort ernähren sie sich von abgestorbenen Pflanzen und anderen organischen Materialien, wodurch sie eine wichtige Rolle im ökologischen Abbau und in der Nährstoffzirkulation spielen. Diese Gewässer bieten auch eine Fülle an Mikroorganismen, die für uns als Nahrung dienen.
Als erwachsene Fliege ernähre ich mich hauptsächlich von Nektar und Pollen, wobei ich eine wichtige Rolle als Bestäuber von Blütenpflanzen spiele. Dies ist nicht nur für die Pflanzen von Vorteil, sondern auch für die gesamte Ökosystemstabilität, da viele Pflanzenarten auf Bestäuber wie uns angewiesen sind, um sich fortzupflanzen.
In der Forschung bin ich auch von Interesse, da meine Lebensweise und mein Habitat als Indikator für die Qualität von Feuchtgebieten dienen können. Veränderungen in unseren Populationen könnten auf Umweltbelastungen hinweisen und somit wichtige Informationen für den Naturschutz liefern.
Zusammengefasst bin ich als Gemeine Sumpfschwebfliege nicht nur ein faszinierendes Beispiel für Anpassungsfähigkeit und Überlebensstrategien, sondern auch ein wichtiger Akteur in Ökosystemen, der durch seine verschiedenen Lebensstadien und Verhaltensweisen vielfältige ökologische Funktionen erfüllt.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
Meine Larven entwickeln sich in stehenden oder langsam fließenden Gewässern, wie z.B. Teichen, Tümpeln oder feuchten Gräben. Dort ernähren sie sich von abgestorbenen Pflanzen und anderen organischen Materialien, wodurch sie eine wichtige Rolle im ökologischen Abbau und in der Nährstoffzirkulation spielen. Diese Gewässer bieten auch eine Fülle an Mikroorganismen, die für uns als Nahrung dienen.
Als erwachsene Fliege ernähre ich mich hauptsächlich von Nektar und Pollen, wobei ich eine wichtige Rolle als Bestäuber von Blütenpflanzen spiele. Dies ist nicht nur für die Pflanzen von Vorteil, sondern auch für die gesamte Ökosystemstabilität, da viele Pflanzenarten auf Bestäuber wie uns angewiesen sind, um sich fortzupflanzen.
In der Forschung bin ich auch von Interesse, da meine Lebensweise und mein Habitat als Indikator für die Qualität von Feuchtgebieten dienen können. Veränderungen in unseren Populationen könnten auf Umweltbelastungen hinweisen und somit wichtige Informationen für den Naturschutz liefern.
Zusammengefasst bin ich als Gemeine Sumpfschwebfliege nicht nur ein faszinierendes Beispiel für Anpassungsfähigkeit und Überlebensstrategien, sondern auch ein wichtiger Akteur in Ökosystemen, der durch seine verschiedenen Lebensstadien und Verhaltensweisen vielfältige ökologische Funktionen erfüllt.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- Gemeine Sumpfschwebfliege (Helophilus pendulus)
Artenschutz in Franken®
Die Europäische Sumpfschildkröte (Emys orbicularis)

Europäische Sumpfschildkröte (Emys orbicularis)
14/15.07.2024
Ich gehöre zur Familie der Sumpfschildkröten und habe spezifische Eigenschaften, die mich an mein Lebensumfeld angepasst haben.
14/15.07.2024
- Als Europäische Sumpfschildkröte (Emys orbicularis) betrachte ich mich als eine faszinierende Kreatur, die eng mit Feuchtgebieten und langsam fließenden Gewässern verbunden ist.
Ich gehöre zur Familie der Sumpfschildkröten und habe spezifische Eigenschaften, die mich an mein Lebensumfeld angepasst haben.
Mein Körper ist relativ flach und oval, was es mir ermöglicht, mich gut im flachen Wasser und zwischen Wasserpflanzen zu bewegen. Meine Rückenschilde sind grünlich oder braun mit auffälligen gelben Flecken oder Linien gezeichnet, was mir hilft, mich in meiner Umgebung zu tarnen.
Ich bin ein Kaltblüter, was bedeutet, dass ich meine Körpertemperatur durch Sonnenbaden reguliere. Im Sommer sonne ich mich gerne auf trockenen, warmen Untergründen wie Steinen oder Baumstämmen, um meine Stoffwechselprozesse zu beschleunigen.
Meine Ernährung besteht hauptsächlich aus kleinen Fischen, Amphibien, Wirbellosen und Wasserpflanzen, die ich mit meinem kräftigen Kiefer und meinen starken Kiefermuskeln zerkleinere.
Lebensräume wie Feuchtgebiete, Teiche, Seen und langsam fließende Gewässer sind für mich von entscheidender Bedeutung, da sie nicht nur Nahrung bieten, sondern auch zum Brüten und Überwintern dienen. Besonders im Frühling, wenn ich zur Paarung an Land gehe, um mein Gelege abzulegen, benötige ich ruhige, ungestörte Uferzonen.
Leider sind meine Lebensräume zunehmend durch menschliche Aktivitäten bedroht. Die Zerstörung von Feuchtgebieten, Wasserverschmutzung und unkontrollierte Fischerei stellen ernsthafte Gefahren für meine Population dar. Der Schutz und die Erhaltung meiner Lebensräume sind daher entscheidend für mein Überleben und das meiner Artgenossen.
Insgesamt bin ich als Europäische Sumpfschildkröte eine Schlüsselart in Feuchtgebieten, die nicht nur ökologisch wichtige Funktionen erfüllt, sondern auch ein Symbol für die Vielfalt und Schönheit der aquatischen Lebensräume Europas ist.
In der Aufnahme von Helga Zinnecker
Ich bin ein Kaltblüter, was bedeutet, dass ich meine Körpertemperatur durch Sonnenbaden reguliere. Im Sommer sonne ich mich gerne auf trockenen, warmen Untergründen wie Steinen oder Baumstämmen, um meine Stoffwechselprozesse zu beschleunigen.
Meine Ernährung besteht hauptsächlich aus kleinen Fischen, Amphibien, Wirbellosen und Wasserpflanzen, die ich mit meinem kräftigen Kiefer und meinen starken Kiefermuskeln zerkleinere.
Lebensräume wie Feuchtgebiete, Teiche, Seen und langsam fließende Gewässer sind für mich von entscheidender Bedeutung, da sie nicht nur Nahrung bieten, sondern auch zum Brüten und Überwintern dienen. Besonders im Frühling, wenn ich zur Paarung an Land gehe, um mein Gelege abzulegen, benötige ich ruhige, ungestörte Uferzonen.
Leider sind meine Lebensräume zunehmend durch menschliche Aktivitäten bedroht. Die Zerstörung von Feuchtgebieten, Wasserverschmutzung und unkontrollierte Fischerei stellen ernsthafte Gefahren für meine Population dar. Der Schutz und die Erhaltung meiner Lebensräume sind daher entscheidend für mein Überleben und das meiner Artgenossen.
Insgesamt bin ich als Europäische Sumpfschildkröte eine Schlüsselart in Feuchtgebieten, die nicht nur ökologisch wichtige Funktionen erfüllt, sondern auch ein Symbol für die Vielfalt und Schönheit der aquatischen Lebensräume Europas ist.
In der Aufnahme von Helga Zinnecker
- Europäische Sumpfschildkröte (Emys orbicularis)
Artenschutz in Franken®
Stele der Biodiversität® - Stegaurach / Dellern
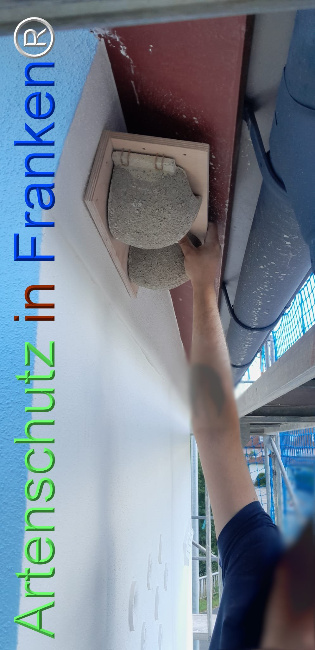
Stele der Biodiversität® - Stegaurach / Dellern
14/15.07.2024
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.
Stegaurach / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
14/15.07.2024
- Montage der Nisthilfen an der Außenfassade ...
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.
Stegaurach / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
Denn wenn (selbst in noch geeigneten Nahrungsstrukturen) keine geeigneten Reproduktionsräume vorhanden sind, ist die Erhaltung der Artenvielfalt gelichfalls zum Scheitern verurteilt.
Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird., setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.
In der Aufnahme
Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird., setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.
In der Aufnahme
- am 08.07.2024 wurde weitere Artenschutztools installiert ...
Artenschutz in Franken®
Walker auch Türkischer Maikäfer (Polyphylla fullo)

Der Walker, der auch Türkischer Maikäfer (Polyphylla fullo) genannt wird
13/14.07.2024
Ich bin ein Käfer der Familie Scarabaeidae und gehöre zur Gattung Polyphylla. Mein wissenschaftlicher Name, Polyphylla fullo, deutet auf meine Zugehörigkeit innerhalb dieser Gruppe hin.
13/14.07.2024
- Als Polyphylla fullo, auch bekannt als Walker, möchte ich meine faszinierende Existenz aus meiner eigenen Perspektive erklären, während ich gleichzeitig einige fachliche Aspekte einbinde.
Ich bin ein Käfer der Familie Scarabaeidae und gehöre zur Gattung Polyphylla. Mein wissenschaftlicher Name, Polyphylla fullo, deutet auf meine Zugehörigkeit innerhalb dieser Gruppe hin.
Als Mitglied dieser Familie spiele ich eine wichtige ökologische Rolle, besonders während meiner Larvenphase. Meine Larven leben in morschem Holz, wo sie sich von abgestorbenem organischen Material ernähren und so zur Zersetzung und Recycling von Nährstoffen beitragen.
Als erwachsener Käfer bin ich zwischen 15 und 30 Millimeter groß und besitze eine charakteristische, robuste Gestalt mit auffälligen, gezackten Antennen. Diese Antennen sind nicht nur ein markantes Merkmal, sondern dienen auch der Wahrnehmung meiner Umwelt und der Suche nach Partnern. Ich ernähre mich hauptsächlich von Blättern und bin besonders in warmen, sandigen Lebensräumen anzutreffen, wo ich mich durch Sand und Erde grabe, um mich vor Hitze zu schützen.
Meine Fortpflanzung ist ein interessanter Teil meines Lebenszyklus. Als Männchen bin ich aktiv auf der Suche nach Weibchen, um mich zu paaren. Dies geschieht häufig in den Abendstunden oder nachts, wenn die Temperaturen angenehmer sind. Einmal gepaart, legt das Weibchen Eier in den Boden, wo sie nach einiger Zeit schlüpfen und sich zu Larven entwickeln, um den Zyklus von neuem zu beginnen.
Fachlich betrachtet bin ich ein wichtiger Bestandteil des Ökosystems, da ich nicht nur zur Nährstoffrückführung beitrage, sondern auch als Nahrungsquelle für verschiedene Tiere diene, darunter Vögel und andere Insekten. Meine Anpassungsfähigkeit an verschiedene Lebensräume und meine Fähigkeit, Nahrung zu finden und mich fortzupflanzen, sind evolutionäre Merkmale, die mich erfolgreich gemacht haben.
Insgesamt bin ich als Polyphylla fullo stolz darauf, Teil der reichen Vielfalt der Natur zu sein und durch meine Lebensweise zur Aufrechterhaltung des ökologischen Gleichgewichts beizutragen.
In der Aufnahme:
Als erwachsener Käfer bin ich zwischen 15 und 30 Millimeter groß und besitze eine charakteristische, robuste Gestalt mit auffälligen, gezackten Antennen. Diese Antennen sind nicht nur ein markantes Merkmal, sondern dienen auch der Wahrnehmung meiner Umwelt und der Suche nach Partnern. Ich ernähre mich hauptsächlich von Blättern und bin besonders in warmen, sandigen Lebensräumen anzutreffen, wo ich mich durch Sand und Erde grabe, um mich vor Hitze zu schützen.
Meine Fortpflanzung ist ein interessanter Teil meines Lebenszyklus. Als Männchen bin ich aktiv auf der Suche nach Weibchen, um mich zu paaren. Dies geschieht häufig in den Abendstunden oder nachts, wenn die Temperaturen angenehmer sind. Einmal gepaart, legt das Weibchen Eier in den Boden, wo sie nach einiger Zeit schlüpfen und sich zu Larven entwickeln, um den Zyklus von neuem zu beginnen.
Fachlich betrachtet bin ich ein wichtiger Bestandteil des Ökosystems, da ich nicht nur zur Nährstoffrückführung beitrage, sondern auch als Nahrungsquelle für verschiedene Tiere diene, darunter Vögel und andere Insekten. Meine Anpassungsfähigkeit an verschiedene Lebensräume und meine Fähigkeit, Nahrung zu finden und mich fortzupflanzen, sind evolutionäre Merkmale, die mich erfolgreich gemacht haben.
Insgesamt bin ich als Polyphylla fullo stolz darauf, Teil der reichen Vielfalt der Natur zu sein und durch meine Lebensweise zur Aufrechterhaltung des ökologischen Gleichgewichts beizutragen.
In der Aufnahme:
- C. Werner sendet uns am 09.07.2024 die Aufnahmen eines vor dem Garagentor gefundenen, lebenden Walkers der auch Türkischer Maikäfer genannt wird.
Artenschutz in Franken®
Stele der Biodiversität® - Unterweiler

Stele der Biodiversität® - Unterweiler
13/14.07.2024
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® das vom Markt Burgwindheim, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.
Unterweiler / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
13/14.07.2024
- Das Monitoring - wir statten dem Projekt einen Julibesuch ab!
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® das vom Markt Burgwindheim, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.
Unterweiler / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
Denn wenn (selbst in noch geeigneten Nahrungsstrukturen) keine geeigneten Reproduktionsräume vorhanden sind, ist die Erhaltung der Artenvielfalt geleichfalls zum Scheitern verurteilt.
Ein Projekt des Artenschutz in Franken® das vom Markt Burgwindheim, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.
In der Aufnahme
Ein Projekt des Artenschutz in Franken® das vom Markt Burgwindheim, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.
In der Aufnahme
- Am 07.07.2024 besuchten wir das Projekt um dessen Entwicklungsprozess zu dokumentieren ... zahlreiche Eindrücke haben wir hiervon mitgebracht ...
Artenschutz in Franken®
Die Frühe Großstirnschwebfliege (Scaeva selenitica)

Frühe Großstirnschwebfliege (Scaeva selenitica)
12/13.07.2024
Die vielen wunderschönen Schwebfliegen, wenn sie in den bunten Sommerblumen naschen. Spritzen, auch wenn es so genannte "Biogifte" sind, wirken fatal. Sie vernichten nicht nur die Blattläuse, sondern verhindern, dass sich in Nutzgärten, aber auch auf kommunalen Flächen, ein Gleichgewicht entsteht.
12/13.07.2024
- Die wunderschönen Farben des Frühsommers.
Die vielen wunderschönen Schwebfliegen, wenn sie in den bunten Sommerblumen naschen. Spritzen, auch wenn es so genannte "Biogifte" sind, wirken fatal. Sie vernichten nicht nur die Blattläuse, sondern verhindern, dass sich in Nutzgärten, aber auch auf kommunalen Flächen, ein Gleichgewicht entsteht.
Befall von Blattläusen zeigt auch an, dass die Pflanzen eventuell an einem falschen Ort stehen.Befallene Bäume und Sträucher werden in kurzer Zeit von Marienkäfern besucht, die ihre Eier unter den Blättern ankleben, auch Blattläuse naschen.
Die schlüpfenden Larven sorgen dafür, dass die Blattläuse schnell weniger werden. Auch die Larven der meisten Schwebfliegen haben diese Blattläuse zum fressen gerne.
Der/ Die Garteninhaber*in kann das gut sehen, er/sie muss nur etwas warten können. Kann dabei die phantastische Artenvielfalt beobachten. Durch Kompostwirtschaft kann er/sie die Sträucher stärken, sie treiben durch und es gibt kaum Einbußen bei der Ernte.
Aufnahme und Autor
Die schlüpfenden Larven sorgen dafür, dass die Blattläuse schnell weniger werden. Auch die Larven der meisten Schwebfliegen haben diese Blattläuse zum fressen gerne.
Der/ Die Garteninhaber*in kann das gut sehen, er/sie muss nur etwas warten können. Kann dabei die phantastische Artenvielfalt beobachten. Durch Kompostwirtschaft kann er/sie die Sträucher stärken, sie treiben durch und es gibt kaum Einbußen bei der Ernte.
Aufnahme und Autor
- Bernhard Schmalisch
Artenschutz in Franken®
Blauschwarzer Eisvogel (Limenitis reducta)

Der Blauschwarze Eisvogel (Limenitis reducta)
12/13.07.2024
Erscheinungsbild
Als Blauschwarzer Eisvogel, oder wissenschaftlich Limenitis reducta bekannt, kann ich dir einen Einblick in mein faszinierendes Wesen geben. Mein Erscheinungsbild ist geprägt von einer eleganten schwarzen Grundfarbe mit markanten blauen Flecken auf den Flügeln, die mich zu einem auffälligen und doch harmonischen Schauspiel der Natur machen.
12/13.07.2024
Erscheinungsbild
- Der Blauschwarze Eisvogel zeichnet sich durch seine auffällige Färbung aus. Seine Flügel sind überwiegend schwarz mit kräftigen, metallisch-blauen Flecken, die je nach Lichteinfall schimmern können. Die Flügelspannweite beträgt etwa 45 bis 55 Millimeter, wobei die Weibchen meist etwas größer als die Männchen sind.
Als Blauschwarzer Eisvogel, oder wissenschaftlich Limenitis reducta bekannt, kann ich dir einen Einblick in mein faszinierendes Wesen geben. Mein Erscheinungsbild ist geprägt von einer eleganten schwarzen Grundfarbe mit markanten blauen Flecken auf den Flügeln, die mich zu einem auffälligen und doch harmonischen Schauspiel der Natur machen.
In meinem Lebenszyklus durchlaufe ich mehrere entscheidende Phasen. Mein Dasein beginnt als Ei, das auf den Blättern von Futterpflanzen abgelegt wird, die meinen Raupen später Nahrung bieten. Nach dem Schlüpfen entwickle ich mich zur Raupe, die auf diese Pflanzen spezialisiert ist. Während dieser Phase bin ich sehr anfällig für Prädation und muss mich vor verschiedenen Feinden schützen. Nach mehreren Häutungen und Wachstumsphasen verpuppe ich mich schließlich. Die Puppenruhe ist eine Zeit der Metamorphose, in der sich mein Körper radikal umgestaltet, um meine endgültige Gestalt anzunehmen. Dieser Prozess ist erstaunlich komplex und von spezialisierten biochemischen Vorgängen geprägt, die mein Äußeres und meine inneren Strukturen vollständig verändern.
Sobald ich als ausgewachsener Schmetterling schlüpfe, beginnt mein Leben in seiner schönsten Form. Meine Flügel sind nicht nur ein ästhetisches Wunderwerk, sondern auch funktionell perfekt angepasst an meine Bedürfnisse. Die blauen Flecken auf meinen Flügeln dienen nicht nur der Tarnung und Täuschung von Raubtieren, sondern haben auch eine thermoregulatorische Funktion, indem sie die Sonnenenergie absorbieren und so meine Körpertemperatur regulieren. Während meiner kurzen Lebensspanne als erwachsener Schmetterling spiele ich eine entscheidende Rolle in meinem Ökosystem. Als Bestäuber trage ich zur Erhaltung der Pflanzenvielfalt bei, indem ich Pollen von Blüte zu Blüte trage. Zugleich bin ich selbst Nahrungsquelle für verschiedene Raubtiere und spiele damit auch eine Rolle im Nahrungsgewebe meiner Umgebung.
Mein Lebensraum ist oft von besonderer Bedeutung, da ich spezifische Ansprüche an meine Umgebung habe. Ich bevorzuge sonnige Ökosysteme mit einer Vielzahl von Blütenpflanzen, die nicht nur Nahrung liefern, sondern auch Schutz bieten können.Insgesamt bin ich ein faszinierendes Beispiel für die Evolution und die Anpassungsfähigkeit der Natur. Meine Existenz ist ein Ergebnis von Millionen Jahren der natürlichen Selektion und Anpassung an meine Umwelt. Durch meine Schönheit und meine Rolle im Ökosystem bin ich ein Symbol für die fragile Schönheit und die Notwendigkeit des Naturschutzes in einer Welt, die sich ständig verändert.
Ich hoffe, dass ich dir einen interessanten Einblick in das Leben des Blauschwarzen Eisvogels geben konnte, ohne dabei zu trocken oder langweilig zu wirken.
In der Aufnahme von Helga Zinnecker
Sobald ich als ausgewachsener Schmetterling schlüpfe, beginnt mein Leben in seiner schönsten Form. Meine Flügel sind nicht nur ein ästhetisches Wunderwerk, sondern auch funktionell perfekt angepasst an meine Bedürfnisse. Die blauen Flecken auf meinen Flügeln dienen nicht nur der Tarnung und Täuschung von Raubtieren, sondern haben auch eine thermoregulatorische Funktion, indem sie die Sonnenenergie absorbieren und so meine Körpertemperatur regulieren. Während meiner kurzen Lebensspanne als erwachsener Schmetterling spiele ich eine entscheidende Rolle in meinem Ökosystem. Als Bestäuber trage ich zur Erhaltung der Pflanzenvielfalt bei, indem ich Pollen von Blüte zu Blüte trage. Zugleich bin ich selbst Nahrungsquelle für verschiedene Raubtiere und spiele damit auch eine Rolle im Nahrungsgewebe meiner Umgebung.
Mein Lebensraum ist oft von besonderer Bedeutung, da ich spezifische Ansprüche an meine Umgebung habe. Ich bevorzuge sonnige Ökosysteme mit einer Vielzahl von Blütenpflanzen, die nicht nur Nahrung liefern, sondern auch Schutz bieten können.Insgesamt bin ich ein faszinierendes Beispiel für die Evolution und die Anpassungsfähigkeit der Natur. Meine Existenz ist ein Ergebnis von Millionen Jahren der natürlichen Selektion und Anpassung an meine Umwelt. Durch meine Schönheit und meine Rolle im Ökosystem bin ich ein Symbol für die fragile Schönheit und die Notwendigkeit des Naturschutzes in einer Welt, die sich ständig verändert.
Ich hoffe, dass ich dir einen interessanten Einblick in das Leben des Blauschwarzen Eisvogels geben konnte, ohne dabei zu trocken oder langweilig zu wirken.
In der Aufnahme von Helga Zinnecker
- Blauschwarzer Eisvogel
Artenschutz in Franken®
"Artenschutz" - in der "Kulturlandschaft"

Feldweg und Randstreifen und Biodiversität - weg!
12/13.07.2024
Denn unser Land in dem wir leben zeigt landauf – landab, gerade auch auf dem zunehmend von der industriellen Landwirtschaft geführten Agrarsektor das gleiche monotone und in unseren Augen mehr als bedenkliche Bild einer Landwirtschaft wie wir sie vom Artenschutz in Franken® so nicht unterstützen, noch gutheißen können.
Doch was zeigen denn diese Aufnahmen so Bedenkliches?
12/13.07.2024
- Rolf Thiemann schildert hier in eindrucksvollen Aufnahmen die Situation aus einem Teil von Nordrhein-Westfalen, doch dieser Eindruck könnte nahezu in fast allen Teilen Deutschlands entstanden sein.
Denn unser Land in dem wir leben zeigt landauf – landab, gerade auch auf dem zunehmend von der industriellen Landwirtschaft geführten Agrarsektor das gleiche monotone und in unseren Augen mehr als bedenkliche Bild einer Landwirtschaft wie wir sie vom Artenschutz in Franken® so nicht unterstützen, noch gutheißen können.
Doch was zeigen denn diese Aufnahmen so Bedenkliches?
Vor einigen Tagen waren wir noch auf der Fläche, die wir hier in den Aufnahmen erkennen, um zu schauen, wie viel Ackerrand und Blühstreifen noch intakt sind. Es war erschreckend anzusehen, das vieles abgemäht oder untergepflügt war. Von der Biodiversität und Artenvielfalt ist bis auf wenige Tier- und Pflanzenarten, die hier jetzt ums nackte Überleben kämpfen, nichts mehr übrig geblieben.
Aufgrund dieser Ergebnisse, die wir, wie bereits angesprochen in nahezu allen Landesteilen vorfinden darf sehr wohl die Frage gestellt werden was denn Projekte welche dem Aspekt des Artenschutzes in der „Kulturlandschaft“ dienen sollen eigentlich bewirken? Vielfach werden intensive Untersuchungen auf den Weg gebracht und Gutachten erstellt, um dann ein solches Ergebnis hervorzubringen?
Sehr wohl kann da auch die Frage angebracht sein, was denn das ganze Engagement das hier geleistet wurde, um den Aspekt zur Erhaltung der Biodiversität gebracht hat? Nichts?!
Warum hat man nicht an die Erfolge angeknüpft und die Tier- und Pflanzenarten, die auf den Flächen der hier vorgestellten Aufnahmen einst vorkamen oder sich neu angesiedelt hatten, weiterhin nachhaltig geschützt? Ausgleichs- oder Ergänzungsflächen für Tier- und Pflanzenarten herzustellen macht nur Sinn, wenn diese einem objektivem Monitoring unterzogen werden. Ein ggf. nur medial schön gefärbter PR-Termin um diese Flächen dann sich selber oder dem Nacheigentümer überlassen, scheint zumindest hier der falsche Weg.
Nach unserer Auffassung bedarf es, zum nachhaltigen Schutz der Flora und Fauna, gerade in der Rekultivierungsphase und auch danach ein nachhaltiges Konzept zugunsten der Natur zu erarbeiten das auch intensiv kontrolliert werden muss.
In der Aufnahme
... wo vor wenigen Tagen noch ein Blühstreifen zu finden war ist dieser, der gar als Insektenfalle fungierte, nun abgetragen und mit ihm unzählige Lebensformen. Sieht so ein tragfähiges Naturschutzkonzept aus? Wir sagen Nein!
Autor und Aufnahmen
Rolf Thiemann
Naturschutzberater
Eisvogelweg 1
50181 Bedburg
Gewässer und Naturschutz im Erftkreis
Flora-Fauna-Artenschutz
Naturschutzökologie
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung.Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Aufgrund dieser Ergebnisse, die wir, wie bereits angesprochen in nahezu allen Landesteilen vorfinden darf sehr wohl die Frage gestellt werden was denn Projekte welche dem Aspekt des Artenschutzes in der „Kulturlandschaft“ dienen sollen eigentlich bewirken? Vielfach werden intensive Untersuchungen auf den Weg gebracht und Gutachten erstellt, um dann ein solches Ergebnis hervorzubringen?
Sehr wohl kann da auch die Frage angebracht sein, was denn das ganze Engagement das hier geleistet wurde, um den Aspekt zur Erhaltung der Biodiversität gebracht hat? Nichts?!
Warum hat man nicht an die Erfolge angeknüpft und die Tier- und Pflanzenarten, die auf den Flächen der hier vorgestellten Aufnahmen einst vorkamen oder sich neu angesiedelt hatten, weiterhin nachhaltig geschützt? Ausgleichs- oder Ergänzungsflächen für Tier- und Pflanzenarten herzustellen macht nur Sinn, wenn diese einem objektivem Monitoring unterzogen werden. Ein ggf. nur medial schön gefärbter PR-Termin um diese Flächen dann sich selber oder dem Nacheigentümer überlassen, scheint zumindest hier der falsche Weg.
Nach unserer Auffassung bedarf es, zum nachhaltigen Schutz der Flora und Fauna, gerade in der Rekultivierungsphase und auch danach ein nachhaltiges Konzept zugunsten der Natur zu erarbeiten das auch intensiv kontrolliert werden muss.
In der Aufnahme
... wo vor wenigen Tagen noch ein Blühstreifen zu finden war ist dieser, der gar als Insektenfalle fungierte, nun abgetragen und mit ihm unzählige Lebensformen. Sieht so ein tragfähiges Naturschutzkonzept aus? Wir sagen Nein!
Autor und Aufnahmen
Rolf Thiemann
Naturschutzberater
Eisvogelweg 1
50181 Bedburg
Gewässer und Naturschutz im Erftkreis
Flora-Fauna-Artenschutz
Naturschutzökologie
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung.Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Artenschutz in Franken®
Der Himmelblaue Bläuling (Polyommatus bellargus)

Der Himmelblaue Bläuling (Polyommatus bellargus)
11/12.07.2024
Meine Art gehört zur Familie der Bläulinge (Lycaenidae) innerhalb der Ordnung der Schmetterlinge (Lepidoptera). Mein Körper ist zart und von einer hellblauen Farbe geprägt, mit feinen schwarzen Punkten und einem charakteristischen Rand aus schwarzen Flecken auf den Flügeln.
11/12.07.2024
- Als Himmelblauer Bläuling (Polyommatus bellargus) betrachte ich meine Welt mit einem kaleidoskopischen Blick auf die Flora und Fauna der kalkreichen Trockenrasen und -weiden Europas.
Meine Art gehört zur Familie der Bläulinge (Lycaenidae) innerhalb der Ordnung der Schmetterlinge (Lepidoptera). Mein Körper ist zart und von einer hellblauen Farbe geprägt, mit feinen schwarzen Punkten und einem charakteristischen Rand aus schwarzen Flecken auf den Flügeln.
Ich bevorzuge Lebensräume, die reich an Kräutern und Wirtspflanzen sind, insbesondere solche, die für meine Larvenentwicklung ideal sind. Diese Wirtspflanzen gehören oft zur Gattung der Hufeisenklee (Hippocrepis), welche spezifische chemische Signale aussenden, die ich als adultes Tier wahrnehmen kann und die für die Eiablage attraktiv sind.
Meine Lebensweise ist eng mit den Jahreszeiten und dem Sonnenstand verbunden. Während der warmen Monate des Jahres, besonders im Frühling und Sommer, fliege ich aktiv in meinem Revier umher, um Nahrung zu suchen und potenzielle Partner anzulocken. Ich ernähre mich hauptsächlich von Nektar, den ich mit meiner langen Rüsselstruktur von Blüten sauge, wobei ich oft Blüten bevorzuge, die reich an Zucker und leicht zugänglich sind.
Die Fortpflanzung erfolgt in bestimmten Phasen des Jahres, wenn die Umweltbedingungen für die Eiablage und das Wachstum der Raupen optimal sind. Meine Eier lege ich meist einzeln an den Stängeln oder Blättern meiner Wirtspflanzen ab. Aus diesen Eiern schlüpfen winzige Raupen, die sich dann von den Blättern ihrer Wirtspflanzen ernähren und während ihres Wachstums mehrmals ihre Haut abwerfen, bevor sie sich schließlich verpuppen.
Mein Flugmuster ist typischerweise niedrig über dem Boden, wo ich mich unter anderem vor Prädatoren wie Vögeln und anderen Insekten verstecke. Meine Flügel reflektieren das Sonnenlicht auf eine Weise, die oft von Menschen bewundert wird, was mich zu einem Symbol für die Schönheit und Zartheit der Natur macht.
Als Individuum des Himmelblauen Bläulings bin ich ein Schlüsselakteur im Ökosystem, da ich nicht nur zur Bestäubung von Pflanzen beitrage, sondern auch eine Nahrungsquelle für verschiedene andere Organismen darstelle. Meine Populationen können durch Veränderungen in der Landnutzung und Umweltbedingungen stark beeinflusst werden, was mich zu einem Indikator für die Gesundheit und Vielfalt der Landschaft macht, in der ich lebe.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
Meine Lebensweise ist eng mit den Jahreszeiten und dem Sonnenstand verbunden. Während der warmen Monate des Jahres, besonders im Frühling und Sommer, fliege ich aktiv in meinem Revier umher, um Nahrung zu suchen und potenzielle Partner anzulocken. Ich ernähre mich hauptsächlich von Nektar, den ich mit meiner langen Rüsselstruktur von Blüten sauge, wobei ich oft Blüten bevorzuge, die reich an Zucker und leicht zugänglich sind.
Die Fortpflanzung erfolgt in bestimmten Phasen des Jahres, wenn die Umweltbedingungen für die Eiablage und das Wachstum der Raupen optimal sind. Meine Eier lege ich meist einzeln an den Stängeln oder Blättern meiner Wirtspflanzen ab. Aus diesen Eiern schlüpfen winzige Raupen, die sich dann von den Blättern ihrer Wirtspflanzen ernähren und während ihres Wachstums mehrmals ihre Haut abwerfen, bevor sie sich schließlich verpuppen.
Mein Flugmuster ist typischerweise niedrig über dem Boden, wo ich mich unter anderem vor Prädatoren wie Vögeln und anderen Insekten verstecke. Meine Flügel reflektieren das Sonnenlicht auf eine Weise, die oft von Menschen bewundert wird, was mich zu einem Symbol für die Schönheit und Zartheit der Natur macht.
Als Individuum des Himmelblauen Bläulings bin ich ein Schlüsselakteur im Ökosystem, da ich nicht nur zur Bestäubung von Pflanzen beitrage, sondern auch eine Nahrungsquelle für verschiedene andere Organismen darstelle. Meine Populationen können durch Veränderungen in der Landnutzung und Umweltbedingungen stark beeinflusst werden, was mich zu einem Indikator für die Gesundheit und Vielfalt der Landschaft macht, in der ich lebe.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
- Himmelblauer Bläuling (Polyommatus bellargus)
Artenschutz in Franken®
Die Kleine Mistbiene oder Gemeine Keulenschwebfliege (Syritta pipiens)

Kleine Mistbiene oder Gemeine Keulenschwebfliege (Syritta pipiens)
11/12.07.2024
Mein wissenschaftlicher Name, Syritta pipiens, deutet auf meine Zugehörigkeit zur Gattung Syritta hin, während "pipiens" auf mein häufiges Vorkommen und meine weit verbreitete Verbreitung hinweist.
11/12.07.2024
- Als Gemeine Keulenschwebfliege (Syritta pipiens) betrachte ich mich als ein faszinierendes Mitglied der Fliegenfamilie Syrphidae, bekannt für meine schlanke, wespengleiche Gestalt und mein bemerkenswertes Verhalten.
Mein wissenschaftlicher Name, Syritta pipiens, deutet auf meine Zugehörigkeit zur Gattung Syritta hin, während "pipiens" auf mein häufiges Vorkommen und meine weit verbreitete Verbreitung hinweist.
Ich gehöre zu den Fliegenarten, die oft mit Wespen verwechselt werden, was mich vor potenziellen Feinden schützt. Diese Mimikry ist eine meiner Anpassungen, um mich vor Prädatoren zu tarnen. Mein Körper ist schlank und gestreckt, mit einer charakteristischen gelb-schwarzen Zeichnung, die dazu beiträgt, diese Illusion aufrechtzuerhalten.
Meine Larven entwickeln sich in organischen Abfällen, wie z.B. faulenden Pflanzen oder Tierkadavern. Diese Umgebung bietet mir nicht nur Nahrung, sondern auch Sicherheit vor vielen meiner Feinde. Als erwachsene Fliege ernähre ich mich von Nektar und Pollen, was mich zu einem wichtigen Bestäuber macht, der zur Bestäubung von Pflanzen beiträgt.
Ein bemerkenswertes Merkmal meiner Lebensweise ist meine Fähigkeit zu schweben, was meiner Familie den Namen "Schwebfliegen" eingebracht hat. Dieses Flugverhalten ermöglicht es mir, Blüten zu besuchen und Pollen zu sammeln, während ich gleichzeitig potenziellen Gefahren ausweiche.
Meine Art ist in vielen Teilen der Welt verbreitet und in verschiedenen Lebensräumen anzutreffen, von Gärten und Parks bis hin zu landwirtschaftlichen Feldern und natürlichen Wäldern. Diese Vielseitigkeit zeigt sich auch in meiner ökologischen Rolle als Bestäuber und als Teil des Nahrungsnetzes vieler Ökosysteme.
In wissenschaftlichen Studien diene ich als Modellorganismus für die Untersuchung von Mimikry, Bestäubung und ökologischen Interaktionen. Forscher nutzen meine Mimikry als Fallbeispiel für evolutionäre Strategien zum Schutz vor Prädatoren und für die Evolution von Bestäuberanpassungen.
Zusammengefasst bin ich, die Gemeine Keulenschwebfliege (Syritta pipiens), nicht nur ein Meister der Tarnung und des Fliegens, sondern auch ein wesentlicher Akteur in der Erhaltung der Biodiversität und der ökologischen Gesundheit vieler Lebensräume weltweit.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
Meine Larven entwickeln sich in organischen Abfällen, wie z.B. faulenden Pflanzen oder Tierkadavern. Diese Umgebung bietet mir nicht nur Nahrung, sondern auch Sicherheit vor vielen meiner Feinde. Als erwachsene Fliege ernähre ich mich von Nektar und Pollen, was mich zu einem wichtigen Bestäuber macht, der zur Bestäubung von Pflanzen beiträgt.
Ein bemerkenswertes Merkmal meiner Lebensweise ist meine Fähigkeit zu schweben, was meiner Familie den Namen "Schwebfliegen" eingebracht hat. Dieses Flugverhalten ermöglicht es mir, Blüten zu besuchen und Pollen zu sammeln, während ich gleichzeitig potenziellen Gefahren ausweiche.
Meine Art ist in vielen Teilen der Welt verbreitet und in verschiedenen Lebensräumen anzutreffen, von Gärten und Parks bis hin zu landwirtschaftlichen Feldern und natürlichen Wäldern. Diese Vielseitigkeit zeigt sich auch in meiner ökologischen Rolle als Bestäuber und als Teil des Nahrungsnetzes vieler Ökosysteme.
In wissenschaftlichen Studien diene ich als Modellorganismus für die Untersuchung von Mimikry, Bestäubung und ökologischen Interaktionen. Forscher nutzen meine Mimikry als Fallbeispiel für evolutionäre Strategien zum Schutz vor Prädatoren und für die Evolution von Bestäuberanpassungen.
Zusammengefasst bin ich, die Gemeine Keulenschwebfliege (Syritta pipiens), nicht nur ein Meister der Tarnung und des Fliegens, sondern auch ein wesentlicher Akteur in der Erhaltung der Biodiversität und der ökologischen Gesundheit vieler Lebensräume weltweit.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- ... wird auch als kleine Mistbiene bezeichnet.Die Larven der diversen, auf dem Land als Mistbienen bezeichneten Schwebfliegen, können in sauerstoffarmen auch anaeroben Pfützen überleben. Auch in der Nähe von Misthaufen in belasteten Gewässern Die so genannten Rattenschwanzlarven atmen mit einer Art Syphon, der länger wie der Körper sein kann.Keulenschwebfliege weil sie Oberschenkel hat , wie die von einem Bodybuilder.
Artenschutz in Franken®
Mein Hund macht sowas nicht! - Beeinträchtigung von Rehkitzen

Mein Hund macht sowas nicht! - Beeinträchtigung von Rehkitzen
11/12.07.2024
Hier sind einige wichtige Aspekte, die erklären, warum Rehkitze durch solche Hunde bedroht sind:
Schutzlosigkeit der Rehkitze
Rehkitze sind in ihren ersten Lebenswochen sehr verletzlich. Sie sind noch nicht in der Lage, schnell zu laufen und sich vor Gefahren zu verstecken. Ihre einzige Verteidigung ist, sich still und regungslos ins Gras zu legen, um von Fressfeinden nicht entdeckt zu werden. Diese Strategie funktioniert gut gegen natürliche Feinde, aber nicht gegen Hunde, die durch ihren Geruchssinn leicht Rehkitze aufspüren können.
11/12.07.2024
- Rehkitze sind junge Rehe, die besonders im Frühjahr und Sommer geboren werden. In dieser Zeit sind sie besonders gefährdet, vor allem durch freilaufende und unerzogene Hunde.
Hier sind einige wichtige Aspekte, die erklären, warum Rehkitze durch solche Hunde bedroht sind:
Schutzlosigkeit der Rehkitze
Rehkitze sind in ihren ersten Lebenswochen sehr verletzlich. Sie sind noch nicht in der Lage, schnell zu laufen und sich vor Gefahren zu verstecken. Ihre einzige Verteidigung ist, sich still und regungslos ins Gras zu legen, um von Fressfeinden nicht entdeckt zu werden. Diese Strategie funktioniert gut gegen natürliche Feinde, aber nicht gegen Hunde, die durch ihren Geruchssinn leicht Rehkitze aufspüren können.
Instinkte der Hunde
Hunde haben einen natürlichen Jagdinstinkt. Auch wenn sie gut gefüttert und als Haustiere gehalten werden, kann dieser Instinkt durch den Geruch oder die Bewegung eines Rehkitzes ausgelöst werden. Freilaufende Hunde können dann versuchen, das Rehkitz zu jagen, zu beißen oder sogar zu töten, selbst wenn sie keine bösen Absichten haben.
Stress und Verletzungen
Selbst wenn ein Hund ein Rehkitz nicht tötet, kann er es schwer verletzen oder großen Stress verursachen. Der Stress durch eine Jagd kann für das junge Reh tödlich sein, da es seinen Kreislauf überlasten kann. Zudem können Verletzungen durch Hundebisse zu Infektionen führen, die das Rehkitz schwächen oder töten können.
Störung des Mutter-Kind-Bands
Die Muttertiere (Rehgeißen) lassen ihre Kitze oft für mehrere Stunden allein, während sie auf Nahrungssuche sind. Wenn ein Hund ein Rehkitz aufspürt und jagt, kann dies die Mutter davon abhalten, zu ihrem Kitz zurückzukehren, aus Angst vor dem Hund. Dies kann dazu führen, dass das Kitz verhungert oder dehydriert, weil es nicht mehr von seiner Mutter gesäugt wird.
Rechtliche Konsequenzen
In vielen Regionen gibt es Gesetze, die Hundehalter dazu verpflichten, ihre Hunde in der Nähe von Wildtieren anzuleinen. Freilaufende Hunde können nicht nur Rehkitze gefährden, sondern auch rechtliche Konsequenzen für die Hundehalter nach sich ziehen. Bußgelder oder andere Strafen sind möglich, wenn Hunde Wildtiere belästigen oder verletzen.
Was können Hundehalter tun?
Um Rehkitze zu schützen, können Hundehalter folgende Maßnahmen ergreifen:
Durch diese Maßnahmen können Hundehalter dazu beitragen, dass Rehkitze und andere Wildtiere sicher und ungestört in ihrem natürlichen Lebensraum leben können.
In der Aufnahme:
Betrifft: Mein Hund macht sowas nicht! Schon wieder wurde ein Rehkitz mit Hundebiss gefunden ... Nach der Freigabe / Zustimmung des Jagdpächters konnte das Kitzin eine Rekitz Auffangstation gebracht und versorgt werden. Sowas darf und muss nicht passieren!
Eine Bitte an alle Hundebesitzer, leint eure Hund an und lasst ihn nur unter Kontrolle von der Leine los!
Ps. Das Kitz hatte einen Zahnabdruck (Wunde) im Kopf und Unterkiefer.Wir schliesen daraus das es ein großer Hund war der den Kopf in der Schnautze hatte und zubiss.
Aufnahme und Autor Rolf Thiemann
Gewässer und Naturschutz im Erftkreis
Flora-Fauna-Artenschutz
Naturschutzökologie
50181 Bedburg
Stand 05.07.2024
Hunde haben einen natürlichen Jagdinstinkt. Auch wenn sie gut gefüttert und als Haustiere gehalten werden, kann dieser Instinkt durch den Geruch oder die Bewegung eines Rehkitzes ausgelöst werden. Freilaufende Hunde können dann versuchen, das Rehkitz zu jagen, zu beißen oder sogar zu töten, selbst wenn sie keine bösen Absichten haben.
Stress und Verletzungen
Selbst wenn ein Hund ein Rehkitz nicht tötet, kann er es schwer verletzen oder großen Stress verursachen. Der Stress durch eine Jagd kann für das junge Reh tödlich sein, da es seinen Kreislauf überlasten kann. Zudem können Verletzungen durch Hundebisse zu Infektionen führen, die das Rehkitz schwächen oder töten können.
Störung des Mutter-Kind-Bands
Die Muttertiere (Rehgeißen) lassen ihre Kitze oft für mehrere Stunden allein, während sie auf Nahrungssuche sind. Wenn ein Hund ein Rehkitz aufspürt und jagt, kann dies die Mutter davon abhalten, zu ihrem Kitz zurückzukehren, aus Angst vor dem Hund. Dies kann dazu führen, dass das Kitz verhungert oder dehydriert, weil es nicht mehr von seiner Mutter gesäugt wird.
Rechtliche Konsequenzen
In vielen Regionen gibt es Gesetze, die Hundehalter dazu verpflichten, ihre Hunde in der Nähe von Wildtieren anzuleinen. Freilaufende Hunde können nicht nur Rehkitze gefährden, sondern auch rechtliche Konsequenzen für die Hundehalter nach sich ziehen. Bußgelder oder andere Strafen sind möglich, wenn Hunde Wildtiere belästigen oder verletzen.
Was können Hundehalter tun?
Um Rehkitze zu schützen, können Hundehalter folgende Maßnahmen ergreifen:
- Anleinen: Hunde in Gebieten, in denen Wildtiere leben, immer an der Leine führen.
- Erziehung: Hunde gut trainieren, damit sie auf Befehle wie "Stopp" oder "Zurück" hören.
- Achtsamkeit: Auf Hinweisschilder und Warnungen in Naturgebieten achten, die auf das Vorkommen von Wildtieren hinweisen.
- Verantwortung: Hunde nicht unbeaufsichtigt in der Natur herumlaufen lassen.
Durch diese Maßnahmen können Hundehalter dazu beitragen, dass Rehkitze und andere Wildtiere sicher und ungestört in ihrem natürlichen Lebensraum leben können.
In der Aufnahme:
Betrifft: Mein Hund macht sowas nicht! Schon wieder wurde ein Rehkitz mit Hundebiss gefunden ... Nach der Freigabe / Zustimmung des Jagdpächters konnte das Kitzin eine Rekitz Auffangstation gebracht und versorgt werden. Sowas darf und muss nicht passieren!
Eine Bitte an alle Hundebesitzer, leint eure Hund an und lasst ihn nur unter Kontrolle von der Leine los!
Ps. Das Kitz hatte einen Zahnabdruck (Wunde) im Kopf und Unterkiefer.Wir schliesen daraus das es ein großer Hund war der den Kopf in der Schnautze hatte und zubiss.
Aufnahme und Autor Rolf Thiemann
Gewässer und Naturschutz im Erftkreis
Flora-Fauna-Artenschutz
Naturschutzökologie
50181 Bedburg
Stand 05.07.2024
Artenschutz in Franken®
Schmalbauchwespe (Gasteruption assectator)

Schmalbauchwespe (Gasteruption assectator)
10/11.07.2024
Gasteruption assectator - Männchen - ... aus der Sippe der Schmalbauchwespen ... schmale, schwarz und rot gezeichnete Wespen.Hinterschenkel und Hinterleib keulig verdickt.Weibchen haben eine kurze Legeröhre,daher sind die Geschlechter auch einfach unterscheidbar.
Das ganze Insekt hier ist etwa 1 cm.Sehr filigran u. (für mich) schwer zu fokussieren.Hier auf den Blüten von Dill
10/11.07.2024
Gasteruption assectator - Männchen - ... aus der Sippe der Schmalbauchwespen ... schmale, schwarz und rot gezeichnete Wespen.Hinterschenkel und Hinterleib keulig verdickt.Weibchen haben eine kurze Legeröhre,daher sind die Geschlechter auch einfach unterscheidbar.
Das ganze Insekt hier ist etwa 1 cm.Sehr filigran u. (für mich) schwer zu fokussieren.Hier auf den Blüten von Dill
... sie ist ein Brutparasit bei verschiedenen in Hohlräumen nistenden Solitärbienen. Lt. Fachliteratur diese Art primär bei Mauerbienen.
Trotzdem freue ich mich über diese Wespen, zeigt es doch, dass auch ihre Wirtstiere vorhanden sein müssen. Außerdem sind ca 40 % der erforschten Tiere Parasiten. Durch die Verdickungen an den Extremitäten wurden sie im ländlichen Bereich auch "Gichtwespen" genannt.
Aufnahme und Autor - Bernhard Schmalisch
Artenschutz in Franken®
Alarm im Ameisenhaufen! - Artenschutzprojekt Große Wiesenameise

Alarm im Ameisenhaufen!
10/11.07.2024
Hallo, ihr neugierigen Menschen! Wir sind die Großen Wiesenameisen (Formica pratensis), und unser Leben ist aufregend und gefährlich zugleich. Heute erzählen wir euch von den Gefahren, die unser geliebtes Nest bedrohen.
Das perfekte Zuhause
Unser Nest ist ein Meisterwerk. Wir bauen es aus Erde, Pflanzenresten und Nadeln, oft an sonnigen, offenen Plätzen wie Wiesen und Waldrändern. Hier leben wir in einer Gemeinschaft aus tausenden von Arbeiterinnen, Kriegerinnen und unserer hochgeschätzten Königin. Jeder hat seine Aufgabe, und das Leben könnte so schön sein – wäre da nicht die ständige Bedrohung.
10/11.07.2024
- Ein Tag im Leben der Großen Wiesenameisen
Hallo, ihr neugierigen Menschen! Wir sind die Großen Wiesenameisen (Formica pratensis), und unser Leben ist aufregend und gefährlich zugleich. Heute erzählen wir euch von den Gefahren, die unser geliebtes Nest bedrohen.
Das perfekte Zuhause
Unser Nest ist ein Meisterwerk. Wir bauen es aus Erde, Pflanzenresten und Nadeln, oft an sonnigen, offenen Plätzen wie Wiesen und Waldrändern. Hier leben wir in einer Gemeinschaft aus tausenden von Arbeiterinnen, Kriegerinnen und unserer hochgeschätzten Königin. Jeder hat seine Aufgabe, und das Leben könnte so schön sein – wäre da nicht die ständige Bedrohung.
Gefährliche Eindringlinge
1. Die Ameisenlöwen: Die gefürchteten Fallensteller
Habt ihr jemals von Ameisenlöwen gehört? Diese fiesen Kreaturen graben kleine Gruben im Sand, und wehe uns, wenn wir hineinstürzen! Einmal in der Falle, gibt es meist kein Entkommen. Der Ameisenlöwe zieht uns gnadenlos in die Tiefe.
2. Die räuberischen Ameisen: Unsere ewigen Feinde
Auch andere Ameisenarten machen uns das Leben schwer. Besonders die Roten Waldameisen haben es auf unsere Ressourcen abgesehen. Sie sind groß, stark und organisiert – fast wie wir, aber eben nicht ganz so freundlich.
Umweltkatastrophen
3. Der Regen: Unser größter natürlicher Feind
Stellt euch vor, ihr sitzt gemütlich zu Hause und plötzlich beginnt es zu regnen. Für euch mag das nur ein kleiner Regenschauer sein, für uns bedeutet es eine Flutkatastrophe. Wenn das Wasser in unser Nest eindringt, können ganze Tunnel und Kammern einstürzen. Die Rettung der Brut wird dann zu einem dramatischen Wettlauf gegen die Zeit.
4. Menschliche Eingriffe: Die unbewussten Zerstörer
Ihr Menschen seid oft die größten Störenfriede, ohne es überhaupt zu merken. Wenn ihr unsere Nester überseht und versehentlich zerstört, oder noch schlimmer, wenn ihr bewusst unsere Lebensräume verändert – durch Landwirtschaft, Bebauung oder Abholzung – dann steht unser ganzes Volk vor einer ungewissen Zukunft.
Die Verteidigung unseres Reiches
Wir sind nicht wehrlos! Unsere Kriegerinnen sind mutig und entschlossen, unser Nest bis zum letzten Tropfen Ameisensäure zu verteidigen. Unsere Strategie ist einfach: Angreifen und Eindringlinge vertreiben, bevor sie zu einer echten Bedrohung werden.
Die Zukunft unserer Kolonie
Trotz all dieser Gefahren geben wir nicht auf. Wir arbeiten unermüdlich, um unser Nest zu schützen und zu erhalten. Wir pflegen unsere Königin, erziehen unsere Brut und bauen immer weiter an unserem Heim.
Euer Beitrag
Ihr könnt uns helfen, indem ihr achtsam mit unserer Umwelt umgeht. Schützt unsere Lebensräume, achtet auf unsere Nester und verbreitet Wissen über die Wichtigkeit von Ameisen in der Natur. Jede kleine Handlung zählt und hilft uns, weiterhin unsere wichtige Rolle im Ökosystem zu erfüllen.
Also, wenn ihr das nächste Mal eine Ameisenstraße seht, denkt daran, dass wir Großen Wiesenameisen tapfer um unser Überleben kämpfen. Helft uns, und wir werden weiterhin die kleinen, fleißigen Helden der Wiesen und Wälder bleiben!
In der Aufnahme
1. Die Ameisenlöwen: Die gefürchteten Fallensteller
Habt ihr jemals von Ameisenlöwen gehört? Diese fiesen Kreaturen graben kleine Gruben im Sand, und wehe uns, wenn wir hineinstürzen! Einmal in der Falle, gibt es meist kein Entkommen. Der Ameisenlöwe zieht uns gnadenlos in die Tiefe.
2. Die räuberischen Ameisen: Unsere ewigen Feinde
Auch andere Ameisenarten machen uns das Leben schwer. Besonders die Roten Waldameisen haben es auf unsere Ressourcen abgesehen. Sie sind groß, stark und organisiert – fast wie wir, aber eben nicht ganz so freundlich.
Umweltkatastrophen
3. Der Regen: Unser größter natürlicher Feind
Stellt euch vor, ihr sitzt gemütlich zu Hause und plötzlich beginnt es zu regnen. Für euch mag das nur ein kleiner Regenschauer sein, für uns bedeutet es eine Flutkatastrophe. Wenn das Wasser in unser Nest eindringt, können ganze Tunnel und Kammern einstürzen. Die Rettung der Brut wird dann zu einem dramatischen Wettlauf gegen die Zeit.
4. Menschliche Eingriffe: Die unbewussten Zerstörer
Ihr Menschen seid oft die größten Störenfriede, ohne es überhaupt zu merken. Wenn ihr unsere Nester überseht und versehentlich zerstört, oder noch schlimmer, wenn ihr bewusst unsere Lebensräume verändert – durch Landwirtschaft, Bebauung oder Abholzung – dann steht unser ganzes Volk vor einer ungewissen Zukunft.
Die Verteidigung unseres Reiches
Wir sind nicht wehrlos! Unsere Kriegerinnen sind mutig und entschlossen, unser Nest bis zum letzten Tropfen Ameisensäure zu verteidigen. Unsere Strategie ist einfach: Angreifen und Eindringlinge vertreiben, bevor sie zu einer echten Bedrohung werden.
Die Zukunft unserer Kolonie
Trotz all dieser Gefahren geben wir nicht auf. Wir arbeiten unermüdlich, um unser Nest zu schützen und zu erhalten. Wir pflegen unsere Königin, erziehen unsere Brut und bauen immer weiter an unserem Heim.
Euer Beitrag
Ihr könnt uns helfen, indem ihr achtsam mit unserer Umwelt umgeht. Schützt unsere Lebensräume, achtet auf unsere Nester und verbreitet Wissen über die Wichtigkeit von Ameisen in der Natur. Jede kleine Handlung zählt und hilft uns, weiterhin unsere wichtige Rolle im Ökosystem zu erfüllen.
Also, wenn ihr das nächste Mal eine Ameisenstraße seht, denkt daran, dass wir Großen Wiesenameisen tapfer um unser Überleben kämpfen. Helft uns, und wir werden weiterhin die kleinen, fleißigen Helden der Wiesen und Wälder bleiben!
In der Aufnahme
- Ein Grund der Nistplatzzerstörung gerade in der Land- und Forstwirtschaft, jedoch auch im kommunal-privatem Umfeldt ist ein fehlendes Wissen über die Präsenz von Nistplätzen. Mit dem Freistellen des Nistplatzes verbessern wir die Lebensbedingungen der Ameisen ... Mittels Hinweistafel öffnen wir visuelle Horizonte und tragen wir konkret zur Erhaltung der Ameisennistplätze bei ...
Artenschutz in Franken®
Die Matte Schwarzkopfschwebfliege (Melanostoma scalare)

Die Matte Schwarzkopfschwebfliege (Melanostoma scalare)
10/11.07.2024
Mein wissenschaftlicher Name "Melanostoma scalare" bedeutet so viel wie "schwarzer Körper mit einer treppenartigen Zeichnung". Ich habe eine matte schwarze Färbung mit markanten gelben Streifen auf meinem Hinterleib, die mich von anderen Schwebfliegenarten unterscheidet.
10/11.07.2024
- Als Matte Schwarzkopfschwebfliege (Melanostoma scalare) bin ich eine faszinierende Insektenspezies, die zur Familie der Schwebfliegen gehört.
Mein wissenschaftlicher Name "Melanostoma scalare" bedeutet so viel wie "schwarzer Körper mit einer treppenartigen Zeichnung". Ich habe eine matte schwarze Färbung mit markanten gelben Streifen auf meinem Hinterleib, die mich von anderen Schwebfliegenarten unterscheidet.
Als Schwebfliege spiele ich eine wichtige Rolle in der Natur, da ich als Bestäuber von Blütenpflanzen fungiere. Während ich Nektar von den Blüten sammle, übertrage ich Pollen von einer Blume zur nächsten und trage somit zur Fortpflanzung der Pflanzen bei. Dieser Prozess ist entscheidend für das Ökosystem und die Artenvielfalt.
Meine Larven ernähren sich von verschiedenen organischen Materialien wie faulendem Pflanzenmaterial oder Exkrementen. Dadurch trage ich auch zur Zersetzung von organischem Material bei und unterstütze den Kreislauf der Nährstoffe in der Natur.
Insgesamt bin ich also ein wichtiges Glied in der Nahrungskette und im ökologischen Gleichgewicht. Meine auffällige Erscheinung und meine ökologische Bedeutung machen mich zu einem interessanten und nützlichen Insekt in der Naturwelt.
Aufname / Autor von Bernhard Schmalisch
Diese, sehr nützliche Insektengruppe, will nur die Salzkristalle auf der Haut lutschen.Sie stechen nicht und die Berührung durch diese harmlosen Insekten ist kaum spürbar. Alle Schwebfliegen die gelb/schwarze Warnfärbung tragen sind völlig harmlos.
Hier sitzt eine Schwarzkopf Schwebfliege auf meinem Zeigefinger.
Meine Larven ernähren sich von verschiedenen organischen Materialien wie faulendem Pflanzenmaterial oder Exkrementen. Dadurch trage ich auch zur Zersetzung von organischem Material bei und unterstütze den Kreislauf der Nährstoffe in der Natur.
Insgesamt bin ich also ein wichtiges Glied in der Nahrungskette und im ökologischen Gleichgewicht. Meine auffällige Erscheinung und meine ökologische Bedeutung machen mich zu einem interessanten und nützlichen Insekt in der Naturwelt.
Aufname / Autor von Bernhard Schmalisch
- ... nicht erschrecken u. nicht drauf hauen, wenn mal eine Schwebfliege auf dem Arm oder Körper landet. Wespen und Bienen haben Fühler, Fliegen nicht, bzw. nur Reste, die als Stummelfühler bezeichnet werden ... ein gutes Unterscheidungsmerkmal.
Diese, sehr nützliche Insektengruppe, will nur die Salzkristalle auf der Haut lutschen.Sie stechen nicht und die Berührung durch diese harmlosen Insekten ist kaum spürbar. Alle Schwebfliegen die gelb/schwarze Warnfärbung tragen sind völlig harmlos.
Hier sitzt eine Schwarzkopf Schwebfliege auf meinem Zeigefinger.
Artenschutz in Franken®
Gebänderte Pelzbiene (Anthophora aestivalis)

Die Gebänderte Pelzbiene (Anthophora aestivalis)
09/10.07.2024
Mein Zuhause und meine Vorlieben
Ich lebe am liebsten in sonnigen, offenen Gebieten, besonders in sandigen oder lehmigen Böden. Diese Orte sind perfekt für mich, um meine Nester zu bauen. Ich bin ziemlich geschickt im Graben und forme kleine Tunnel im Boden, wo ich meine Eier lege und meine Babys großziehe.
09/10.07.2024
- Hallo! Ich bin eine Gebänderte Pelzbiene, auch bekannt als Anthophora aestivalis. Lasst mich euch ein bisschen über mein Leben und meine Abenteuer erzählen!
Mein Zuhause und meine Vorlieben
Ich lebe am liebsten in sonnigen, offenen Gebieten, besonders in sandigen oder lehmigen Böden. Diese Orte sind perfekt für mich, um meine Nester zu bauen. Ich bin ziemlich geschickt im Graben und forme kleine Tunnel im Boden, wo ich meine Eier lege und meine Babys großziehe.
Mein flauschiger Körper
Mein Körper ist mit vielen kleinen Härchen bedeckt, die mir nicht nur mein flauschiges Aussehen verleihen, sondern auch sehr nützlich sind. Diese Härchen helfen mir, Pollen von den Blumen zu sammeln. Wenn ich von Blüte zu Blüte fliege, bleiben die Pollenkörner an meinen Haaren hängen. Das nennt man Bestäubung, und es hilft den Pflanzen, Früchte und Samen zu produzieren. Ich bin also ein wichtiger Teil der Natur und helfe dabei, dass alles blüht und wächst!
Meine Lieblingsblumen
Ich habe eine Vorliebe für bestimmte Blumen, besonders für die, die reich an Nektar und Pollen sind. Wenn ich eine Blume finde, lande ich darauf und benutze meine langen, spezialisierten Mundwerkzeuge, um den süßen Nektar zu trinken. Dabei sammle ich auch Pollen, den ich zurück in mein Nest bringe, um meine Babys zu füttern.
Mein Lebenszyklus
Mein Leben beginnt als Ei, das meine Mutter sorgfältig in einem unterirdischen Nest abgelegt hat. Nach ein paar Tagen schlüpfe ich als Larve und beginne, mich von dem Pollen und Nektar zu ernähren, den meine Mutter für mich gesammelt hat. Schließlich verpuppen sich die Larven und verwandeln sich in ausgewachsene Bienen, bereit, das Abenteuer des Lebens zu beginnen!
Meine Rolle in der Natur
Neben der Bestäubung habe ich auch andere wichtige Aufgaben. Zum Beispiel helfe ich dabei, den Boden zu belüften, wenn ich meine Nester grabe. Das verbessert die Bodenqualität und hilft den Pflanzen, besser zu wachsen. Und natürlich trage ich auch zur Artenvielfalt bei, indem ich mit vielen verschiedenen Pflanzen interagiere.
Ein lustiger Fakt über mich
Manchmal, wenn ich in Eile bin und von Blume zu Blume fliege, kann es passieren, dass ich ein bisschen tollpatschig bin und mit meinem flauschigen Körper in eine Blüte plumpse. Das sieht vielleicht lustig aus, aber keine Sorge, ich mache einfach weiter und genieße meinen süßen Nektar!
So, das war ein kleiner Einblick in mein Leben als Gebänderte Pelzbiene. Ich hoffe, ihr habt Spaß daran gehabt, mehr über mich zu erfahren!
Aufnahme von Bernhard Schmalisch
Mein Körper ist mit vielen kleinen Härchen bedeckt, die mir nicht nur mein flauschiges Aussehen verleihen, sondern auch sehr nützlich sind. Diese Härchen helfen mir, Pollen von den Blumen zu sammeln. Wenn ich von Blüte zu Blüte fliege, bleiben die Pollenkörner an meinen Haaren hängen. Das nennt man Bestäubung, und es hilft den Pflanzen, Früchte und Samen zu produzieren. Ich bin also ein wichtiger Teil der Natur und helfe dabei, dass alles blüht und wächst!
Meine Lieblingsblumen
Ich habe eine Vorliebe für bestimmte Blumen, besonders für die, die reich an Nektar und Pollen sind. Wenn ich eine Blume finde, lande ich darauf und benutze meine langen, spezialisierten Mundwerkzeuge, um den süßen Nektar zu trinken. Dabei sammle ich auch Pollen, den ich zurück in mein Nest bringe, um meine Babys zu füttern.
Mein Lebenszyklus
Mein Leben beginnt als Ei, das meine Mutter sorgfältig in einem unterirdischen Nest abgelegt hat. Nach ein paar Tagen schlüpfe ich als Larve und beginne, mich von dem Pollen und Nektar zu ernähren, den meine Mutter für mich gesammelt hat. Schließlich verpuppen sich die Larven und verwandeln sich in ausgewachsene Bienen, bereit, das Abenteuer des Lebens zu beginnen!
Meine Rolle in der Natur
Neben der Bestäubung habe ich auch andere wichtige Aufgaben. Zum Beispiel helfe ich dabei, den Boden zu belüften, wenn ich meine Nester grabe. Das verbessert die Bodenqualität und hilft den Pflanzen, besser zu wachsen. Und natürlich trage ich auch zur Artenvielfalt bei, indem ich mit vielen verschiedenen Pflanzen interagiere.
Ein lustiger Fakt über mich
Manchmal, wenn ich in Eile bin und von Blume zu Blume fliege, kann es passieren, dass ich ein bisschen tollpatschig bin und mit meinem flauschigen Körper in eine Blüte plumpse. Das sieht vielleicht lustig aus, aber keine Sorge, ich mache einfach weiter und genieße meinen süßen Nektar!
So, das war ein kleiner Einblick in mein Leben als Gebänderte Pelzbiene. Ich hoffe, ihr habt Spaß daran gehabt, mehr über mich zu erfahren!
Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- Die Gebänderte Pelzbiene (Anthophora aestivalis) - Weibchen
Artenschutz in Franken®
Ein Welterbe für den Mauersegler 2024 - "Uni" - Bamberg

Ein Welterbe für den Mauersegler 2024 - "Uni" - Bamberg
09/10.07.2024
• Ein innovatives Gemeinschaftsprojekt engagiert sich für die Erhaltung der letzten Mauersegler in der Stadt Bamberg.
Bamberg / Bayern. Wie auch in anderen Städten der Republik erkennen wir seit geraumer Zeit einen elementaren Rückgang der Vogelart Mauersegler. Neben Nahrungsmangel sind es vornehmlich fehlende Fortpflanzungsstätten die den Tieren zunehmend schwerer machen sich einer erfolgreichen Arterhaltung zu widmen.
Artenschutz in Franken®, Stadt Bamberg – Umweltamt und Universität Bamberg möchten mit fachlicher Unterstützung des Staatlichen Hochbauamts sowie den Fachbehörden des Denkmalschutzes dem Verlust der Biodiversität mit einem konkreten, regionalem Schutzprojekt entgegenwirken. Gefördert wird das Projekt durch das Bundesamt für Naturschutz (BfN) mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV).
09/10.07.2024
• Ein innovatives Gemeinschaftsprojekt engagiert sich für die Erhaltung der letzten Mauersegler in der Stadt Bamberg.
Bamberg / Bayern. Wie auch in anderen Städten der Republik erkennen wir seit geraumer Zeit einen elementaren Rückgang der Vogelart Mauersegler. Neben Nahrungsmangel sind es vornehmlich fehlende Fortpflanzungsstätten die den Tieren zunehmend schwerer machen sich einer erfolgreichen Arterhaltung zu widmen.
Artenschutz in Franken®, Stadt Bamberg – Umweltamt und Universität Bamberg möchten mit fachlicher Unterstützung des Staatlichen Hochbauamts sowie den Fachbehörden des Denkmalschutzes dem Verlust der Biodiversität mit einem konkreten, regionalem Schutzprojekt entgegenwirken. Gefördert wird das Projekt durch das Bundesamt für Naturschutz (BfN) mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV).
Mit der Installation einer speziellen Nisthilfenkette sollen neue Mauersegler Reproduktionsmöglichkeiten geschaffen werden. An einer geeigneten Bauwerkfassade sollen demnächst 9 neue Nistplätze angebracht werden.
Diese Niststätten bieten kulturfolgenden Kleinvogelarten wie z. B. dem Mauersegler nun geeignete, prädatorensichere Reproduktionsmöglichkeiten. Auch klimatische Faktoren waren Bestandteil des Projekts, denn mehr und mehr (auch traditionelle) Brutplätze verlieren aufgrund des Klimawandels ihre Funktionalität und damit verenden viele Jungtiere, bereits in überhitzen Brutnischen ohne jemals einen ersten Flügelschlag im freien Luftraum erleben zu dürfen. Die hier vorgesehenen Nisthilfen, die wir von diesem Hersteller bereits mehrfach mit Erfolg einsetzten, sind mit einer Ansitzschräge ausgestattet, welche natürliche Fressfeinde, die an den Reproduktionsstandorten in Erscheinung treten könnten, davon abhalten, sich hier niederzulassen.
Selbstredend das die Nisthilfen in einer nachhaltigen Konzeption ausgeführt wurden, um nach einer Annahme auch viele Jahrzehnte ihrer wertvollen Aufgabe nachkommen zu können. Ferner zeigen diese einen Einschlupf, der sich an der Unterseite der Nisthilfe befindet. Darüber hinaus verfügt die Nisthilfe über eine innenliegende Brutmulde.
In der Aufnahme
• Vor der Montage mussten sich die Nisthilfen einer farbig auf das anzusprechende Trägerbauwerk zugeschnittenen Bearbeitungskomponente unterziehen.
Diese Niststätten bieten kulturfolgenden Kleinvogelarten wie z. B. dem Mauersegler nun geeignete, prädatorensichere Reproduktionsmöglichkeiten. Auch klimatische Faktoren waren Bestandteil des Projekts, denn mehr und mehr (auch traditionelle) Brutplätze verlieren aufgrund des Klimawandels ihre Funktionalität und damit verenden viele Jungtiere, bereits in überhitzen Brutnischen ohne jemals einen ersten Flügelschlag im freien Luftraum erleben zu dürfen. Die hier vorgesehenen Nisthilfen, die wir von diesem Hersteller bereits mehrfach mit Erfolg einsetzten, sind mit einer Ansitzschräge ausgestattet, welche natürliche Fressfeinde, die an den Reproduktionsstandorten in Erscheinung treten könnten, davon abhalten, sich hier niederzulassen.
Selbstredend das die Nisthilfen in einer nachhaltigen Konzeption ausgeführt wurden, um nach einer Annahme auch viele Jahrzehnte ihrer wertvollen Aufgabe nachkommen zu können. Ferner zeigen diese einen Einschlupf, der sich an der Unterseite der Nisthilfe befindet. Darüber hinaus verfügt die Nisthilfe über eine innenliegende Brutmulde.
In der Aufnahme
• Vor der Montage mussten sich die Nisthilfen einer farbig auf das anzusprechende Trägerbauwerk zugeschnittenen Bearbeitungskomponente unterziehen.
Artenschutz in Franken®
"Pflege" von Flurweg-Grünstreifen

"Pflege" von Flurweg-Grünstreifen
08/09.07.2024
Flurwege und ihre ökologische Bedeutung
Flurwege, auch als Wegraine oder Wegränder bekannt, sind oft schmale Streifen von Vegetation entlang landwirtschaftlicher Felder, Wiesen und Straßen. Diese Bereiche spielen eine wichtige Rolle für die Biodiversität:
08/09.07.2024
- Das Thema der Entnahme von Gras an Flurwegen berührt verschiedene Aspekte der Biodiversität und Ökosystemgesundheit. Lass uns einen genaueren Blick darauf werfen, warum diese Praxis problematisch sein kann und welche Auswirkungen sie auf die biologische Vielfalt hat.
Flurwege und ihre ökologische Bedeutung
Flurwege, auch als Wegraine oder Wegränder bekannt, sind oft schmale Streifen von Vegetation entlang landwirtschaftlicher Felder, Wiesen und Straßen. Diese Bereiche spielen eine wichtige Rolle für die Biodiversität:
- Lebensraum für Pflanzen und Tiere: Flurwege bieten Lebensraum für zahlreiche Pflanzenarten, Insekten, Vögel und kleine Säugetiere. Sie sind oft Rückzugsgebiete für Pflanzen, die in intensiv genutzten Agrarlandschaften kaum noch vorkommen.
- Korridore für Wildtiere: Diese Bereiche dienen als Wanderkorridore, die es Wildtieren ermöglichen, sich sicher zwischen verschiedenen Lebensräumen zu bewegen. Sie sind besonders wichtig in fragmentierten Landschaften, wo größere zusammenhängende Naturflächen fehlen.
- Nahrung und Nistplätze: Viele Insekten, darunter Bestäuber wie Bienen und Schmetterlinge, nutzen die blühenden Pflanzen an Flurwegen als Nahrungsquelle. Vögel finden hier Samen und Insekten, und einige Arten nutzen die Vegetation als Nistplatz.
Problematik der Grasentnahme
Die Entnahme von Gras an Flurwegen kann mehrere negative Auswirkungen auf die Biodiversität haben:
In der Aufnahme
Die Entnahme von Gras an Flurwegen kann mehrere negative Auswirkungen auf die Biodiversität haben:
- Verlust von Lebensräumen: Wenn Gras gemäht und entfernt wird, verlieren viele Pflanzen- und Tierarten ihren Lebensraum. Seltene Pflanzenarten, die speziell an diese Habitate angepasst sind, können verschwinden, wenn ihre Nischen zerstört werden.......
In der Aufnahme
- was sich einmal in die "Köpfe" der breiten Bevölkerung "eingebrannt" ... nämlich der sinnlose Ansatz ein hygienisches Aussehen der Freiflur praktizieren zu wollen ... ist nur schwerlich wieder hier raus zu bekommen. Wenn gerade von dieser Seite auch noch betont wird wie wertvoll diesen die Zukunft der Kinder und Enkelkinder ist, dann sollte gerade diese Personen einmal darüber nachdenken was sie mit ihrem Wirken negatives für die uns nachfolgende Generation anrichten.
Artenschutz in Franken®
Mellanostoma mellina

Mellanostoma mellina
08/09.07.2024
An den unterschiedlichen Flecken am Abdomen von Mellanostoma scalare unterscheidbar.
08/09.07.2024
- Eine kleine Schwebfliegenart ... selten mit geöffneten Flügeln zu sehen, de fakto nur beim Fliegen.
An den unterschiedlichen Flecken am Abdomen von Mellanostoma scalare unterscheidbar.
Artenschutz in Franken®
Kamelhalsfliegen (Raphidioptera)

Willkommen in die wunderbare Welt der Kamelhalsfliegen!
07/08.07.2024
1. Die Anatomie: Unsere charmante Silhouette
Seht uns an, mit unseren eleganten, langen Hälsen, die uns den Spitznamen "Kamelhalsfliegen" eingebracht haben. Stellt euch vor, wir strecken unsere langen Hälse in die Luft wie neugierige Giraffen im Miniaturformat.
Wer kann schon widerstehen, uns nicht bewundern zu wollen?
07/08.07.2024
- Als stolze Vertreter der Ordnung Raphidioptera möchten wir euch einen Einblick in unser faszinierendes Leben geben – und das aus unserer ganz eigenen, lustigen Perspektive.
1. Die Anatomie: Unsere charmante Silhouette
Seht uns an, mit unseren eleganten, langen Hälsen, die uns den Spitznamen "Kamelhalsfliegen" eingebracht haben. Stellt euch vor, wir strecken unsere langen Hälse in die Luft wie neugierige Giraffen im Miniaturformat.
Wer kann schon widerstehen, uns nicht bewundern zu wollen?
2. Habitat: Unser kleines Königreich
Wir lieben es, uns in Wäldern und Gärten zu tummeln, besonders in der Nähe von Bäumen und Büschen. Hier verstecken wir uns geschickt und genießen das angenehme Klima. Unsere bevorzugten Hangouts sind feuchte, schattige Plätze – sozusagen unsere ganz persönlichen Wellnesstempel.
3. Ernährung: Der Gourmet-Lifestyle
Als Larven sind wir die gefräßigen Jäger der Mikro-Welt. Wir lieben es, uns von wehrlosen kleinen Insektenlarven und Eiern zu ernähren. Ein wahrer Festschmaus! Als erwachsene Kamelhalsfliegen schwenken wir dann lieber auf eine Diät aus Pollen und Nektar um. Man muss schließlich auf seine Figur achten, nicht wahr?
4. Fortpflanzung: Das Liebesleben
Unsere Liebesgeschichten sind wahrlich romantisch. Die Männchen fliegen elegant herum und präsentieren sich den Weibchen, in der Hoffnung, ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Nach einer erfolgreichen Balz legen die Weibchen ihre Eier in Rindenritzen oder unter Blätter. Ein Ort, der Schutz und Geborgenheit bietet – man muss schließlich auch an die Zukunft denken!
5. Evolutionäre Tricks: Unsere Superkräfte
Wir sind Meister der Tarnung und Anpassung. Unsere langen Hälse sind nicht nur schmückendes Beiwerk, sie helfen uns auch, unsere Beute zu überraschen. Mit einem schnellen Ruck – zack! – haben wir sie gefangen. Man könnte sagen, wir sind die Ninjas der Insektenwelt.
6. Ökologische Rolle: Die unsichtbaren Helden
Unsere Aufgabe in der Natur? Wir halten das Gleichgewicht! Indem wir uns von Schädlingen ernähren, helfen wir, deren Populationen in Schach zu halten. Wir sind die stillen Wächter der Natur, die im Verborgenen wirken. Ohne uns wäre die Welt ein viel chaotischerer Ort.
7. Interaktion mit Menschen: Die unbekannten Freunde
Für die meisten Menschen bleiben wir unbemerkt, aber das ist okay. Wir ziehen es vor, im Hintergrund zu bleiben und unsere wichtigen Aufgaben zu erfüllen. Wir stechen nicht und beißen nicht – wir sind wirklich die friedlichen Helden des Waldes.
Also, das nächste Mal, wenn ihr in einem Wald spazieren geht und einen winzigen, eleganten Insektenhals seht, denkt daran, dass ihr einen wahren Meister der Natur vor euch habt. Wir Kamelhalsfliegen mögen klein sein, aber unser Beitrag zur Natur ist riesig. Bleibt neugierig und haltet die Augen offen für die Wunder der Welt um euch herum!
In der Aufnahme von Helga Zinnecker
Wir lieben es, uns in Wäldern und Gärten zu tummeln, besonders in der Nähe von Bäumen und Büschen. Hier verstecken wir uns geschickt und genießen das angenehme Klima. Unsere bevorzugten Hangouts sind feuchte, schattige Plätze – sozusagen unsere ganz persönlichen Wellnesstempel.
3. Ernährung: Der Gourmet-Lifestyle
Als Larven sind wir die gefräßigen Jäger der Mikro-Welt. Wir lieben es, uns von wehrlosen kleinen Insektenlarven und Eiern zu ernähren. Ein wahrer Festschmaus! Als erwachsene Kamelhalsfliegen schwenken wir dann lieber auf eine Diät aus Pollen und Nektar um. Man muss schließlich auf seine Figur achten, nicht wahr?
4. Fortpflanzung: Das Liebesleben
Unsere Liebesgeschichten sind wahrlich romantisch. Die Männchen fliegen elegant herum und präsentieren sich den Weibchen, in der Hoffnung, ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Nach einer erfolgreichen Balz legen die Weibchen ihre Eier in Rindenritzen oder unter Blätter. Ein Ort, der Schutz und Geborgenheit bietet – man muss schließlich auch an die Zukunft denken!
5. Evolutionäre Tricks: Unsere Superkräfte
Wir sind Meister der Tarnung und Anpassung. Unsere langen Hälse sind nicht nur schmückendes Beiwerk, sie helfen uns auch, unsere Beute zu überraschen. Mit einem schnellen Ruck – zack! – haben wir sie gefangen. Man könnte sagen, wir sind die Ninjas der Insektenwelt.
6. Ökologische Rolle: Die unsichtbaren Helden
Unsere Aufgabe in der Natur? Wir halten das Gleichgewicht! Indem wir uns von Schädlingen ernähren, helfen wir, deren Populationen in Schach zu halten. Wir sind die stillen Wächter der Natur, die im Verborgenen wirken. Ohne uns wäre die Welt ein viel chaotischerer Ort.
7. Interaktion mit Menschen: Die unbekannten Freunde
Für die meisten Menschen bleiben wir unbemerkt, aber das ist okay. Wir ziehen es vor, im Hintergrund zu bleiben und unsere wichtigen Aufgaben zu erfüllen. Wir stechen nicht und beißen nicht – wir sind wirklich die friedlichen Helden des Waldes.
Also, das nächste Mal, wenn ihr in einem Wald spazieren geht und einen winzigen, eleganten Insektenhals seht, denkt daran, dass ihr einen wahren Meister der Natur vor euch habt. Wir Kamelhalsfliegen mögen klein sein, aber unser Beitrag zur Natur ist riesig. Bleibt neugierig und haltet die Augen offen für die Wunder der Welt um euch herum!
In der Aufnahme von Helga Zinnecker
- Kamelhalsfliege auf menschlichem Arm abgesetzt
Artenschutz in Franken®
Die Dickfühlerweichwanze (Heterotoma planicornis)

Die Dickfühlerweichwanze (Heterotoma planicornis)
07/07.07.2024
Hier sind einige Informationen über diese Art:
07/07.07.2024
- Die Dickfühlerweichwanze, wissenschaftlich bekannt als Heterotoma planicornis, gehört zur Familie der Weichwanzen (Miridae), einer großen Gruppe von Insekten, die weltweit verbreitet ist.
Hier sind einige Informationen über diese Art:
Taxonomie und Klassifikation:
Morphologie:
Lebensraum und Verbreitung:
Ernährung und Lebensweise:
Ökologische Bedeutung:
Fortpflanzung und Entwicklung:
Interaktion mit Menschen:
Die Dickfühlerweichwanze ist ein interessantes Beispiel für die Vielfalt der Wanzenwelt und spielt eine wichtige Rolle im ökologischen Gleichgewicht ihrer Lebensräume. Ihre Anpassungsfähigkeit an verschiedene Pflanzenarten und ihre Wechselwirkungen mit anderen Organismen machen sie zu einem faszinierenden Untersuchungsobjekt für Biologen und Ökologen.
Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- Die Dickfühlerweichwanze gehört zur Ordnung der Schnabelkerfe (Hemiptera) und zur Unterordnung der Wanzen (Heteroptera).
- Innerhalb der Familie Miridae ist sie in der Unterfamilie der Mirinae zu finden.
Morphologie:
- Erwachsene Dickfühlerweichwanzen haben eine längliche, schlanke Körperform mit einer durchschnittlichen Körperlänge von etwa 4-5 mm.
- Namensgebend sind ihre dicken Fühler, die aus mehreren Segmenten bestehen und nach vorne gerichtet sind.
- Die Farbgebung variiert, typischerweise sind sie jedoch grünlich bis braun gefärbt, manchmal mit hellen oder dunklen Mustern auf den Flügeln.
Lebensraum und Verbreitung:
- Diese Wanzenart ist in Europa, Nordafrika und Teilen Asiens verbreitet und findet sich häufig in Gärten, Wäldern und anderen vegetationsreichen Lebensräumen.
- Sie bevorzugen Pflanzen, die reich an Saft sind, wie zum Beispiel verschiedene krautige Pflanzen und Sträucher.
Ernährung und Lebensweise:
- Als Pflanzensauger ernährt sich die Dickfühlerweichwanze von Pflanzensaft, den sie durch ihren Stechrüssel aus den Geweben der Pflanzen saugt.
- Während der Paarungszeit sind die Wanzen besonders aktiv und kommunizieren möglicherweise über Pheromone, um Partner anzuziehen.
Ökologische Bedeutung:
- Obwohl sie für Pflanzen schädlich sein können, indem sie deren Saft entziehen, sind Dickfühlerweichwanzen oft auch Beute für verschiedene Raubinsekten und Vögel, was ihre Rolle in Nahrungsketten unterstreicht.
Fortpflanzung und Entwicklung:
- Die Weibchen legen ihre Eier in die Pflanzengewebe, wo die Larven schlüpfen und sich entwickeln.
- Die Entwicklung von Larve zu erwachsenem Tier durchläuft mehrere Stadien, die Häutungen beinhalten, bis die adulte Form erreicht ist.
Interaktion mit Menschen:
- In der Regel sind Dickfühlerweichwanzen für den Menschen unschädlich, können aber gelegentlich zur Plage werden, wenn sie in großen Mengen auftreten und Pflanzen schädigen.
Die Dickfühlerweichwanze ist ein interessantes Beispiel für die Vielfalt der Wanzenwelt und spielt eine wichtige Rolle im ökologischen Gleichgewicht ihrer Lebensräume. Ihre Anpassungsfähigkeit an verschiedene Pflanzenarten und ihre Wechselwirkungen mit anderen Organismen machen sie zu einem faszinierenden Untersuchungsobjekt für Biologen und Ökologen.
Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- Dickfühlerweichwanze (Heterotoma planicornis) ... Dickfühlerweichwanze ca. 5 mm lang, mit den grünen Beinen und den Fühlern unverwechselbar.
Räuberischer Helfer der Menschen, frisst Blattläuse etc. In Brombeeren aufgenommen.
Artenschutz in Franken®
Die Wilde Form der Westlichen Honigbiene (Apis mellifera)

Die Wilde Form der Westlichen Honigbiene (Apis mellifera)
07/08.07.2024
Die Aktivitäten dieser Tiere einmal außerhalb der bekannten Haltungsstrukturen erleben zu können ist sehr faszinierend. Diese Impressionen müssten wir in unserem Umfeld zukünftig sehr viel häufiger erkennen dürfen. Doch leider werden die Lebensräume von Wildtieren immer mehr beschnitten und der Aufschrei ist vielerorts dann groß, wenn sich ein Wildtier in die Nähe des Menschen verirrt.
Oder war es doch eigentlich anders herum?
07/08.07.2024
- Immer wieder treffen wir auch auf Honigbienen welche sich nicht in einem Bienenstock, sondern in Baumhöhlen oder anderen mehr oder minder geeigneten Bereichen niedergelassen haben.
Die Aktivitäten dieser Tiere einmal außerhalb der bekannten Haltungsstrukturen erleben zu können ist sehr faszinierend. Diese Impressionen müssten wir in unserem Umfeld zukünftig sehr viel häufiger erkennen dürfen. Doch leider werden die Lebensräume von Wildtieren immer mehr beschnitten und der Aufschrei ist vielerorts dann groß, wenn sich ein Wildtier in die Nähe des Menschen verirrt.
Oder war es doch eigentlich anders herum?
Wir als Menschen sind in die Lebensräume der Tiere eingedrungen und häufig ist das Einzige was "uns" einfällt die "Entnahme" dieser Tiere, also das Töten! Es ist schon traurig mit ansehen zu müssen welchen Umgang wir als Spezies mit den uns begleitenden Arten und Lebensräumen pflegen.
Viel wird meist geredet und wenig tatsächlich Wegweisendes im Sinne der Biodiversität kommt dabei heraus.
In der Aufnahme
• Ein vom Sturm gefällter Baum an einem Waldweg der von den Verantwortlichen "filetiert" wurde, die im Baumstamm vorhandene Baumhöhle beherbergt nun einen Staat Wilder Honigbienen. Ja doch wie lange eigentlich noch... so lange bis der oder die Eine gestochen und laut gejammert wird ... der Verlierer bleibt dann wie so häufig die Artenvielfalt.
Viel wird meist geredet und wenig tatsächlich Wegweisendes im Sinne der Biodiversität kommt dabei heraus.
In der Aufnahme
• Ein vom Sturm gefällter Baum an einem Waldweg der von den Verantwortlichen "filetiert" wurde, die im Baumstamm vorhandene Baumhöhle beherbergt nun einen Staat Wilder Honigbienen. Ja doch wie lange eigentlich noch... so lange bis der oder die Eine gestochen und laut gejammert wird ... der Verlierer bleibt dann wie so häufig die Artenvielfalt.
Artenschutz in Franken®
Stele der Biodiversität® - Rosendahl / GT - Höven

Stele der Biodiversität® - Rosendahl / GT - Höven
06/07.07.2024
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutzes in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das von der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.
Rosendahl / Nordrhein - Westfalen. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen, kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen.
Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
06/07.07.2024
- Freischaltung des virtuellen Rundgangs
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutzes in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das von der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.
Rosendahl / Nordrhein - Westfalen. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen, kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen.
Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
In der Aufnahme
... vor wenigen Tagen wurde der virtuelle Link zum Projektrundgang freigeschaltet ...
Artenschutz in Franken®
Die Garten-Wollbiene (Anthidium manicatum)

Garten-Wollbiene (Anthidium manicatum)
06/07.07.2024
Mein Leben ist geprägt von meinem Streben nach Innovation, Nachhaltigkeit und dem Wohl zukünftiger Generationen.
Lass mich dir meine Sichtweise näherbringen:
06/07.07.2024
- Als Garten-Wollbiene (Anthidium manicatum) sehe ich die Welt auf ganz besondere Weise.
Mein Leben ist geprägt von meinem Streben nach Innovation, Nachhaltigkeit und dem Wohl zukünftiger Generationen.
Lass mich dir meine Sichtweise näherbringen:
Ich bin bekannt für meine innovativen Methoden bei der Nestkonstruktion. Während viele meiner Artgenossen einfache Löcher im Boden oder in Holz bevorzugen, nutze ich weiche Pflanzenteile, um meine Nester auszukleiden. Diese innovativen Materialien bieten nicht nur Schutz und Wärme für meine Nachkommen, sondern auch eine komfortable Umgebung, die das Überleben meiner Brut sicherstellt.
Nachhaltigkeit ist für mich nicht nur ein Schlagwort, sondern eine Lebensweise. Ich sammle den Nektar und Pollen von einer Vielzahl von Pflanzen und trage so zur Bestäubung bei. Dies ist nicht nur für die Pflanzenwelt wichtig, sondern sichert auch die Nahrungsgrundlage für viele andere Lebewesen in unserem Ökosystem. Meine Sammelaktivitäten sind so ausgerichtet, dass ich die Ressourcen, die mir die Natur bietet, nicht übernutze. Ich achte darauf, dass die Pflanzen, die ich besuche, weiterhin gedeihen und sich vermehren können, um auch künftigen Generationen von Garten-Wollbienen eine Lebensgrundlage zu bieten.
Im Sinne nachfolgender Generationen baue ich meine Nester an sicheren Orten, fernab von möglichen Bedrohungen. Dies gewährleistet, dass meine Nachkommen in einer geschützten Umgebung aufwachsen können. Meine Wahl der Nistplätze berücksichtigt auch die Bedürfnisse anderer Insekten und Tiere, sodass wir in Harmonie miteinander leben können.
Ich glaube fest daran, dass jede Handlung, die ich heute durchführe, direkte Auswirkungen auf die Welt von morgen hat. Deshalb ist mein Verhalten stets darauf ausgerichtet, positive Spuren zu hinterlassen. Meine Bestäubungsarbeit trägt zur Biodiversität und zur Gesundheit unserer Umwelt bei, was letztlich auch den zukünftigen Generationen zugutekommt.
Zusammengefasst ist mein Leben als Garten-Wollbiene ein Balanceakt zwischen Innovation und Tradition, Nachhaltigkeit und Fortschritt sowie dem ständigen Bestreben, eine lebenswerte Welt für die kommenden Generationen zu schaffen.
In der Aufnahme / Autor Bernhard Schmalisch
... ein Männchen der großen Wollbiene verteidigt ein Blühareal von einer Staude Leonurus cardiaca Der Drohn wird bis 18 mm, ein großer imposanter Bienerich ... permanent wird die Staude umrundet ...zwischendurch auf einem Blatt in der Sonne Wärme getankt, die Staude steht im Halbschatten.Insekten sind wechselwarm und benötigen halt Wärme um agil zu bleiben ... zwischendurch tankt er auch Nektar, die Anstrengung in der Paarungszeit ist gewaltig ... andere Insekten werden vertrieben.
Egal wie groß die anderen Insekten sind, Pelzbienen, Hummeln, Honigbienen. Beim Vertreiben wird das andere Insekt angeflogen u. kurz vor dem Aufprall das Abdomen mit Dornen nach vorne gebogen.Anfliegende, kleinere Weibchen werden begattet.In den 90 Minuten der Beobachtung fanden 8 Paarungen statt.Danach pausiert das Männchen wieder kurz in der Sonne.
Nachhaltigkeit ist für mich nicht nur ein Schlagwort, sondern eine Lebensweise. Ich sammle den Nektar und Pollen von einer Vielzahl von Pflanzen und trage so zur Bestäubung bei. Dies ist nicht nur für die Pflanzenwelt wichtig, sondern sichert auch die Nahrungsgrundlage für viele andere Lebewesen in unserem Ökosystem. Meine Sammelaktivitäten sind so ausgerichtet, dass ich die Ressourcen, die mir die Natur bietet, nicht übernutze. Ich achte darauf, dass die Pflanzen, die ich besuche, weiterhin gedeihen und sich vermehren können, um auch künftigen Generationen von Garten-Wollbienen eine Lebensgrundlage zu bieten.
Im Sinne nachfolgender Generationen baue ich meine Nester an sicheren Orten, fernab von möglichen Bedrohungen. Dies gewährleistet, dass meine Nachkommen in einer geschützten Umgebung aufwachsen können. Meine Wahl der Nistplätze berücksichtigt auch die Bedürfnisse anderer Insekten und Tiere, sodass wir in Harmonie miteinander leben können.
Ich glaube fest daran, dass jede Handlung, die ich heute durchführe, direkte Auswirkungen auf die Welt von morgen hat. Deshalb ist mein Verhalten stets darauf ausgerichtet, positive Spuren zu hinterlassen. Meine Bestäubungsarbeit trägt zur Biodiversität und zur Gesundheit unserer Umwelt bei, was letztlich auch den zukünftigen Generationen zugutekommt.
Zusammengefasst ist mein Leben als Garten-Wollbiene ein Balanceakt zwischen Innovation und Tradition, Nachhaltigkeit und Fortschritt sowie dem ständigen Bestreben, eine lebenswerte Welt für die kommenden Generationen zu schaffen.
In der Aufnahme / Autor Bernhard Schmalisch
... ein Männchen der großen Wollbiene verteidigt ein Blühareal von einer Staude Leonurus cardiaca Der Drohn wird bis 18 mm, ein großer imposanter Bienerich ... permanent wird die Staude umrundet ...zwischendurch auf einem Blatt in der Sonne Wärme getankt, die Staude steht im Halbschatten.Insekten sind wechselwarm und benötigen halt Wärme um agil zu bleiben ... zwischendurch tankt er auch Nektar, die Anstrengung in der Paarungszeit ist gewaltig ... andere Insekten werden vertrieben.
Egal wie groß die anderen Insekten sind, Pelzbienen, Hummeln, Honigbienen. Beim Vertreiben wird das andere Insekt angeflogen u. kurz vor dem Aufprall das Abdomen mit Dornen nach vorne gebogen.Anfliegende, kleinere Weibchen werden begattet.In den 90 Minuten der Beobachtung fanden 8 Paarungen statt.Danach pausiert das Männchen wieder kurz in der Sonne.
Artenschutz in Franken®
Die Braune Wegschnecke (Arion fuscus)

Braune Wegschnecke (Arion fuscus)
06/07.07.2024
Mein Körper ist schlank und länglich, typischerweise zwischen 7 und 10 Zentimeter lang. Meine Färbung variiert von dunkelbraun bis hin zu fast schwarz, mit einer glänzenden, leicht schleimigen Oberfläche, die mir hilft, mich vor Austrocknung zu schützen und mich gleitend vorwärts zu bewegen.
06/07.07.2024
- Als Braune Wegschnecke (Arion fuscus) betrachte ich mich als Teil der großen Schneckenfamilie, die in feuchten und gemäßigten Regionen Europas und Nordamerikas verbreitet ist.
Mein Körper ist schlank und länglich, typischerweise zwischen 7 und 10 Zentimeter lang. Meine Färbung variiert von dunkelbraun bis hin zu fast schwarz, mit einer glänzenden, leicht schleimigen Oberfläche, die mir hilft, mich vor Austrocknung zu schützen und mich gleitend vorwärts zu bewegen.
Mein Lebensraum erstreckt sich von Gärten über Wälder bis hin zu landwirtschaftlichen Flächen, solange genügend Feuchtigkeit und Nahrung vorhanden sind. Ich ernähre mich hauptsächlich von verrottenden Pflanzen und Pilzen, die ich mit meiner radula, einer raspelartigen Zunge, abnagen kann. Dadurch spiele ich eine wichtige Rolle im Zersetzungsprozess organischen Materials und trage zur Nährstoffrückführung im Boden bei.
Als Weichtier gehöre ich zur Klasse der Schnecken (Gastropoda) und zur Familie der Wegschnecken (Arionidae). Mein Körper ist von einer dünnen, aber flexiblen Schale bedeckt, die als Rückzugsort dient und mir Schutz bietet, obwohl sie im Vergleich zu anderen Schneckenarten unterentwickelt ist.
Fortpflanzungstechnisch gesehen bin ich zwittrig, was bedeutet, dass ich sowohl männliche als auch weibliche Geschlechtsorgane habe. Die Paarung beginnt oft mit einer umwerbenden Tanzphase, bei der zwei Schnecken ihre Körper wellenförmig bewegen und miteinander interagieren, bevor sie Spermien austauschen.
Eine besondere Fähigkeit, die mich auszeichnet, ist meine Fähigkeit zur Schleimbildung. Dieser Schleim dient nicht nur dazu, meine Haut feucht zu halten und vor Austrocknung zu schützen, sondern auch als Verteidigungsmechanismus gegen Fressfeinde. Der Schleim enthält Chemikalien, die potenzielle Raubtiere abschrecken können, und kann zudem dazu verwendet werden, mich vorübergehend an Oberflächen zu haften oder sogar Hindernisse zu überwinden.
In Bezug auf ökologische Bedeutung bin ich ein Indikator für die Gesundheit von Ökosystemen, da ich auf Veränderungen in der Umwelt empfindlich reagiere, insbesondere auf Feuchtigkeitsverluste und Veränderungen in der Bodenzusammensetzung. Mein Auftreten kann auch für Gärtner und Landwirte relevant sein, da ich sowohl nützlich als auch potenziell schädlich sein kann, abhängig von den spezifischen Bedingungen und der Art der Landnutzung.
Insgesamt spiele ich als Braune Wegschnecke eine bedeutende Rolle im ökologischen Gefüge meiner Lebensräume, indem ich zur Zersetzung beitrage, als Nahrungsquelle für verschiedene Tiere diene und gleichzeitig auf Umweltveränderungen hinweise.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
Als Weichtier gehöre ich zur Klasse der Schnecken (Gastropoda) und zur Familie der Wegschnecken (Arionidae). Mein Körper ist von einer dünnen, aber flexiblen Schale bedeckt, die als Rückzugsort dient und mir Schutz bietet, obwohl sie im Vergleich zu anderen Schneckenarten unterentwickelt ist.
Fortpflanzungstechnisch gesehen bin ich zwittrig, was bedeutet, dass ich sowohl männliche als auch weibliche Geschlechtsorgane habe. Die Paarung beginnt oft mit einer umwerbenden Tanzphase, bei der zwei Schnecken ihre Körper wellenförmig bewegen und miteinander interagieren, bevor sie Spermien austauschen.
Eine besondere Fähigkeit, die mich auszeichnet, ist meine Fähigkeit zur Schleimbildung. Dieser Schleim dient nicht nur dazu, meine Haut feucht zu halten und vor Austrocknung zu schützen, sondern auch als Verteidigungsmechanismus gegen Fressfeinde. Der Schleim enthält Chemikalien, die potenzielle Raubtiere abschrecken können, und kann zudem dazu verwendet werden, mich vorübergehend an Oberflächen zu haften oder sogar Hindernisse zu überwinden.
In Bezug auf ökologische Bedeutung bin ich ein Indikator für die Gesundheit von Ökosystemen, da ich auf Veränderungen in der Umwelt empfindlich reagiere, insbesondere auf Feuchtigkeitsverluste und Veränderungen in der Bodenzusammensetzung. Mein Auftreten kann auch für Gärtner und Landwirte relevant sein, da ich sowohl nützlich als auch potenziell schädlich sein kann, abhängig von den spezifischen Bedingungen und der Art der Landnutzung.
Insgesamt spiele ich als Braune Wegschnecke eine bedeutende Rolle im ökologischen Gefüge meiner Lebensräume, indem ich zur Zersetzung beitrage, als Nahrungsquelle für verschiedene Tiere diene und gleichzeitig auf Umweltveränderungen hinweise.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- Braune Wegschnecke (Arion fuscus)
Artenschutz in Franken®
Hirschkäfer - Flugzeit und Meldezeit!

Der Hirschkäfer (Lucanus cervus)
05/06.07.2024
Durch diese Flugperiode werden immer wieder Tiere auffällig – Artenschutz in Franken® ist seit vielen Jahren gerne Ansprechpartner beim Fund eines solchen Tieres.
05/06.07.2024
- Im Juni/Juli jeden Jahres fliegen sie wieder … Hirschkäfer!
Durch diese Flugperiode werden immer wieder Tiere auffällig – Artenschutz in Franken® ist seit vielen Jahren gerne Ansprechpartner beim Fund eines solchen Tieres.
Hier nochmals ein "Merker" wie Hischkäfer aussehen ... obwohl diese eigentlich unverwechselbar (zumindest die Männchen) sind:
Aussehen und Merkmale:
• Größe: Männliche Hirschkäfer können bis zu 8 cm lang werden, während die Weibchen etwas kleiner sind, typischerweise bis zu 5 cm.
• Mandibeln: Die Männchen besitzen große, geweihartige Mandibeln, die sie bei Kämpfen um Weibchen einsetzen. Weibchen haben kleinere, kräftigere Mandibeln.
• Färbung: Die Deckflügel (Elytren) sind meist dunkelbraun bis schwarz, und der Körper kann einen metallischen Glanz haben.
• Flügel: Beide Geschlechter sind flugfähig. Die Männchen fliegen meist bei Dämmerung auf der Suche nach Weibchen.
Lebensraum und Verbreitung
• Lebensraum: Hirschkäfer bevorzugen alte, lichte Eichenwälder, sind aber auch in Laubmischwäldern, Parks und großen Gärten zu finden, besonders dort, wo alte Baumstämme und Totholz vorhanden sind.
• Verbreitung: Der Hirschkäfer ist in weiten Teilen Europas verbreitet, seine Bestände sind jedoch vielerorts rückläufig, weshalb er in vielen Regionen geschützt ist.
Lebenszyklus
• Eier: Die Weibchen legen ihre Eier in morsches Holz, bevorzugt - jedoch sicher nich nur - Eichen.
• Larven: Die Larven verbringen mehrere Jahre (bis zu sieben Jahre) im Holz, wo sie sich von totem Holz ernähren.
• Puppenstadium: Nach der Larvenzeit verpuppen sie sich im Boden.
• Adulte Käfer: Die ausgewachsenen Käfer erscheinen im Frühsommer und leben nur wenige Monate, in denen sie sich fortpflanzen.
Verhalten bei einem Fund eines Hirschkäfers
Schritte beim Fund:
1. Beobachten und nicht stören:
2. Vorsichtiges Eingreifen:
3. Lebensraum fördern:
Fundmeldung
Warum melden?
Das Melden von Hirschkäferfunden hilft Naturschutzorganisationen, die Verbreitung und den Zustand der Populationen besser zu verstehen und geeignete Schutzmaßnahmen zu ergreifen.
Wo melden?
• Naturschutzbehörden: Regionale oder lokale Naturschutzbehörden, die für den Artenschutz zuständig sind.
• Naturschutzorganisationen: Organisationen wie der NABU (Naturschutzbund Deutschland), der BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland) oder lokale Naturschutzgruppen.
• Citizen Science Projekte: Plattformen und Apps wie "Naturgucker", "iNaturalist" oder spezifische Projekte zur Erfassung von Hirschkäferdaten.
Oder Melden Sie ihn einfach beim Artenschutz in Franken®
Wie melden?
• Fotos: Mach ein Foto des Käfers und seines Fundorts.
• Details: Notiere Datum, Uhrzeit, genaue Fundstelle (GPS-Koordinaten, wenn möglich) und Beobachtungen (z.B. Verhalten des Käfers).
• Melde ihn einfach über unsere Internetpräsenz.
Zusammenfassung
Der Hirschkäfer ist eine beeindruckende, aber gefährdete Art. Bei einem Fund solltest du ihn in Ruhe beobachten, ihn bei Gefahr behutsam an einen sicheren Ort bringen und seinen Lebensraum fördern. Funde sollten bei Naturschutzbehörden, Naturschutzorganisationen oder über Citizen Science Projekte gemeldet werden, um zum Erhalt dieser faszinierenden Käferart beizutragen.
In der Aufnahme von Johannes Rother
Aussehen und Merkmale:
• Größe: Männliche Hirschkäfer können bis zu 8 cm lang werden, während die Weibchen etwas kleiner sind, typischerweise bis zu 5 cm.
• Mandibeln: Die Männchen besitzen große, geweihartige Mandibeln, die sie bei Kämpfen um Weibchen einsetzen. Weibchen haben kleinere, kräftigere Mandibeln.
• Färbung: Die Deckflügel (Elytren) sind meist dunkelbraun bis schwarz, und der Körper kann einen metallischen Glanz haben.
• Flügel: Beide Geschlechter sind flugfähig. Die Männchen fliegen meist bei Dämmerung auf der Suche nach Weibchen.
Lebensraum und Verbreitung
• Lebensraum: Hirschkäfer bevorzugen alte, lichte Eichenwälder, sind aber auch in Laubmischwäldern, Parks und großen Gärten zu finden, besonders dort, wo alte Baumstämme und Totholz vorhanden sind.
• Verbreitung: Der Hirschkäfer ist in weiten Teilen Europas verbreitet, seine Bestände sind jedoch vielerorts rückläufig, weshalb er in vielen Regionen geschützt ist.
Lebenszyklus
• Eier: Die Weibchen legen ihre Eier in morsches Holz, bevorzugt - jedoch sicher nich nur - Eichen.
• Larven: Die Larven verbringen mehrere Jahre (bis zu sieben Jahre) im Holz, wo sie sich von totem Holz ernähren.
• Puppenstadium: Nach der Larvenzeit verpuppen sie sich im Boden.
• Adulte Käfer: Die ausgewachsenen Käfer erscheinen im Frühsommer und leben nur wenige Monate, in denen sie sich fortpflanzen.
Verhalten bei einem Fund eines Hirschkäfers
Schritte beim Fund:
1. Beobachten und nicht stören:
- Dos: Halte Abstand und beobachte den Käfer in Ruhe. Erkunde, ob er sich in einer gefährlichen Position befindet (z.B. auf einer Straße).
- Don'ts: Den Käfer nicht unnötig berühren oder hochheben, da dies Stress verursacht.
2. Vorsichtiges Eingreifen:
- Dos: Falls der Käfer in Gefahr ist (z.B. auf einer stark befahrenen Straße), hebe ihn vorsichtig auf und setze ihn in der Nähe von Bäumen oder Gebüschen ab, idealerweise in einem schattigen Bereich.- Eigenschutz in jedem Fall beachten!
- Don'ts: Keine schnellen Bewegungen machen oder den Käfer fest drücken.
3. Lebensraum fördern:
- Dos: Unterstütze den Erhalt seines Lebensraums durch das Anlegen von Totholzhaufen im Garten oder das Belassen von alten Baumstümpfen. Informiere auch Freunde und Nachbarn über die Bedeutung von Hirschkäferhabitaten.
- Don'ts: Entferne keine alten Bäume oder Totholz, das als Lebensraum für die Larven dient. - Verkehrssicherung dringlich beachten!
Fundmeldung
Warum melden?
Das Melden von Hirschkäferfunden hilft Naturschutzorganisationen, die Verbreitung und den Zustand der Populationen besser zu verstehen und geeignete Schutzmaßnahmen zu ergreifen.
Wo melden?
• Naturschutzbehörden: Regionale oder lokale Naturschutzbehörden, die für den Artenschutz zuständig sind.
• Naturschutzorganisationen: Organisationen wie der NABU (Naturschutzbund Deutschland), der BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland) oder lokale Naturschutzgruppen.
• Citizen Science Projekte: Plattformen und Apps wie "Naturgucker", "iNaturalist" oder spezifische Projekte zur Erfassung von Hirschkäferdaten.
Oder Melden Sie ihn einfach beim Artenschutz in Franken®
Wie melden?
• Fotos: Mach ein Foto des Käfers und seines Fundorts.
• Details: Notiere Datum, Uhrzeit, genaue Fundstelle (GPS-Koordinaten, wenn möglich) und Beobachtungen (z.B. Verhalten des Käfers).
• Melde ihn einfach über unsere Internetpräsenz.
Zusammenfassung
Der Hirschkäfer ist eine beeindruckende, aber gefährdete Art. Bei einem Fund solltest du ihn in Ruhe beobachten, ihn bei Gefahr behutsam an einen sicheren Ort bringen und seinen Lebensraum fördern. Funde sollten bei Naturschutzbehörden, Naturschutzorganisationen oder über Citizen Science Projekte gemeldet werden, um zum Erhalt dieser faszinierenden Käferart beizutragen.
In der Aufnahme von Johannes Rother
- Hirschkäfer Männchen
Artenschutz in Franken®
Kleinvogel gefunden - und jetzt?

Kleinvogel gefunden - und jetzt?
05/06.07.2024
Derzeit erreichen uns wieder zahlreiche Anfragen die sich auf den korrekten Umgang des Tieres beim „Fund“ eines noch nicht flugfähigen Kleinvogels beziehen.
Wir vom Artenschutz in Franken® haben hier einige Informationen für Sie zusammengestellt: Wir erklären dir das Vorgehen und die in unseren Augen wichtigsten Dos und Don'ts bei einem Fund eines kleinen, noch nicht flugfähigen Vogels in Form eines einfachen, einprägsamen Mnemonics, den du leicht merken kannst: "VOGEL"
Jeder Buchstabe im Wort "VOGEL" steht dabei für einen wichtigen Schritt oder Hinweis:
05/06.07.2024
- Wie verhalte ich mich beim Fund eines noch nicht flugfähigen Kleinvogels richtig?
Derzeit erreichen uns wieder zahlreiche Anfragen die sich auf den korrekten Umgang des Tieres beim „Fund“ eines noch nicht flugfähigen Kleinvogels beziehen.
Wir vom Artenschutz in Franken® haben hier einige Informationen für Sie zusammengestellt: Wir erklären dir das Vorgehen und die in unseren Augen wichtigsten Dos und Don'ts bei einem Fund eines kleinen, noch nicht flugfähigen Vogels in Form eines einfachen, einprägsamen Mnemonics, den du leicht merken kannst: "VOGEL"
Jeder Buchstabe im Wort "VOGEL" steht dabei für einen wichtigen Schritt oder Hinweis:
V - Verhalten beobachten:
• Dos: Bevor du irgendetwas tust, beobachte den Vogel aus der Ferne. Manchmal (Meistens) sind die Eltern in der Nähe und kümmern sich um ihn.
• Don'ts: Den Vogel sofort anfassen oder wegtragen, ohne die Situation zu analysieren.
O - Ort sichern:
• Dos: Sicherstellen, dass der Vogel nicht durch Menschen, Hunde oder Katzen gefährdet ist.
• Don'ts: Den Vogel in gefährliche Bereiche lassen, wo er leicht verletzt werden kann.
G - Gesundheit prüfen:
• Dos: Prüfe vorsichtig, ob der Vogel verletzt ist. Wenn er offensichtlich verletzt ist, kontaktiere eine Wildtierauffangstation oder einen Tierarzt. Wende dich auch an die für die Örtlichkeit zuständige fachliche Einrichtung wie Naturschutzfachbehörde oder Umweltämter.
• Don'ts: Keine medizinische Erstversorgung versuchen, wenn du keine Erfahrung damit hast.
E - Eltern suchen:
• Dos: Versuche herauszufinden, ob die Eltern in der Nähe sind. Elternvögel kehren oft zurück, um ihre Jungen zu füttern.
• Don'ts: Den Vogel nicht sofort mitnehmen, da die Eltern ihn weiterhin versorgen könnten.
L - Letzte Entscheidung:
• Dos: Wenn der Vogel in Gefahr ist oder die Eltern nicht zurückkehren, kontaktiere eine Wildtierstation oder einen Experten für Rat und weitere Schritte.
• Don'ts: Den Vogel nicht ohne fachkundigen Rat mit nach Hause nehmen oder füttern, da falsche Pflege oft mehr schadet als hilft.
Zusammenfassung
• Verhalten beobachten: Erst schauen, nicht gleich handeln.
• Ort sichern: Gefahrenquelle ausschalten.
• Gesundheit prüfen: Verletzungen erkennen.
• Eltern suchen: Eltern in der Nähe?
• Letzte Entscheidung: Bei Gefahr oder verlassener Brut Wildtierstation kontaktieren.
Mit diesem Mnemonic kannst du dir so finden wir vom Artenschutz in Franken® recht leicht merken, wie du dich verhalten sollst, wenn du einen kleinen, noch nicht flugfähigen Vogel findest. Bitte beachte jedoch dabei immer den Eigenschutz, denn die Tier können Krankheiten übertragen die auch für den Menschen gefährlich werden können. Deshalb raten wir vornehmlich ... immer Finger weg - Fachleute kontaktieren!
Wir vom Artenschutz in Franken® sind keine Tierpflegestelle da wir uns in erster Linie mit der Lebensraumsicherung und Lebensraumschaffung befassen.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
• Dos: Bevor du irgendetwas tust, beobachte den Vogel aus der Ferne. Manchmal (Meistens) sind die Eltern in der Nähe und kümmern sich um ihn.
• Don'ts: Den Vogel sofort anfassen oder wegtragen, ohne die Situation zu analysieren.
O - Ort sichern:
• Dos: Sicherstellen, dass der Vogel nicht durch Menschen, Hunde oder Katzen gefährdet ist.
• Don'ts: Den Vogel in gefährliche Bereiche lassen, wo er leicht verletzt werden kann.
G - Gesundheit prüfen:
• Dos: Prüfe vorsichtig, ob der Vogel verletzt ist. Wenn er offensichtlich verletzt ist, kontaktiere eine Wildtierauffangstation oder einen Tierarzt. Wende dich auch an die für die Örtlichkeit zuständige fachliche Einrichtung wie Naturschutzfachbehörde oder Umweltämter.
• Don'ts: Keine medizinische Erstversorgung versuchen, wenn du keine Erfahrung damit hast.
E - Eltern suchen:
• Dos: Versuche herauszufinden, ob die Eltern in der Nähe sind. Elternvögel kehren oft zurück, um ihre Jungen zu füttern.
• Don'ts: Den Vogel nicht sofort mitnehmen, da die Eltern ihn weiterhin versorgen könnten.
L - Letzte Entscheidung:
• Dos: Wenn der Vogel in Gefahr ist oder die Eltern nicht zurückkehren, kontaktiere eine Wildtierstation oder einen Experten für Rat und weitere Schritte.
• Don'ts: Den Vogel nicht ohne fachkundigen Rat mit nach Hause nehmen oder füttern, da falsche Pflege oft mehr schadet als hilft.
Zusammenfassung
• Verhalten beobachten: Erst schauen, nicht gleich handeln.
• Ort sichern: Gefahrenquelle ausschalten.
• Gesundheit prüfen: Verletzungen erkennen.
• Eltern suchen: Eltern in der Nähe?
• Letzte Entscheidung: Bei Gefahr oder verlassener Brut Wildtierstation kontaktieren.
Mit diesem Mnemonic kannst du dir so finden wir vom Artenschutz in Franken® recht leicht merken, wie du dich verhalten sollst, wenn du einen kleinen, noch nicht flugfähigen Vogel findest. Bitte beachte jedoch dabei immer den Eigenschutz, denn die Tier können Krankheiten übertragen die auch für den Menschen gefährlich werden können. Deshalb raten wir vornehmlich ... immer Finger weg - Fachleute kontaktieren!
Wir vom Artenschutz in Franken® sind keine Tierpflegestelle da wir uns in erster Linie mit der Lebensraumsicherung und Lebensraumschaffung befassen.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
Artenschutz in Franken®
Stele der Biodiversität® - Stegaurach / Dellern

Stele der Biodiversität® - Stegaurach / Dellern
05/06.07.2024
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.
Stegaurach / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
05/06.07.2024
- Fast fertig um mit der grafischen Gestaltung zu beginnen ...
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.
Stegaurach / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
Denn wenn (selbst in noch geeigneten Nahrungsstrukturen) keine geeigneten Reproduktionsräume vorhanden sind, ist die Erhaltung der Artenvielfalt gelichfalls zum Scheitern verurteilt.
Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird., setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.
In der Aufnahme
Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird., setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.
In der Aufnahme
- ab dem 28.06.2024 ...erkennen wir die fast fertige Vorbereitung der Grundfläche der Fassaden- Außenhaut ...
Artenschutz in Franken®
Extremer Rückgang beim Braunbrustigel (Erinaceus europaeus)

Extremer Rückgang beim Braunbrustigel (Erinaceus europaeus)
04/05.07.2024
Bayern. Der Rückgang des Braunbrustigels (Erinaceus europaeus) kann auf eine Vielzahl von Faktoren zurückgeführt werden, die zusammenspielen und seine Population negativ beeinflussen.
Hier sind die in unseren Augen wichtigsten Gründe für den Bestandsrückgang des Braunbrustigels:
04/05.07.2024
- Aktuell erkennen wir vom Artenschutz in Franken® einen gravierenden Rückgang dieser Art, nicht nur hier bei uns in Bayern.
Bayern. Der Rückgang des Braunbrustigels (Erinaceus europaeus) kann auf eine Vielzahl von Faktoren zurückgeführt werden, die zusammenspielen und seine Population negativ beeinflussen.
Hier sind die in unseren Augen wichtigsten Gründe für den Bestandsrückgang des Braunbrustigels:
Lebensraumverlust und -fragmentierung
Nahrungsmangel
Klimawandel:
Krankheiten und Parasiten:
Prädation und Konkurrenz:
Um die Bedingungen für den Braunbrustigel zu fördern und seinen Bestand zu stabilisieren, sind vielfältige Maßnahmen erforderlich:
Schaffung und Erhaltung von Lebensräumen:
Reduktion des Pestizideinsatzes:
Schutz vor Straßenverkehr:
Förderung der Biodiversität:
Öffentlichkeitsarbeit und Bildung:
Durch diese Maßnahmen kann man dazu beitragen, den Lebensraum und die Lebensbedingungen des Braunbrustigels zu verbessern und somit seinen Bestand langfristig zu schützen und zu fördern.
In der Aufnahme von Johannes Rother
- Urbanisierung und Landwirtschaft: Die Ausbreitung von Städten und intensiv bewirtschafteten landwirtschaftlichen Flächen führt zur Zerstörung und Fragmentierung natürlicher Lebensräume. Hecken, Waldstücke und Grünflächen, die wichtige Rückzugsorte und Nahrungsquellen für Igel darstellen, verschwinden oder werden zerschnitten.
- Verkehrswege: Straßen und Autobahnen zerschneiden Lebensräume und erhöhen die Gefahr, dass Igel im Straßenverkehr überfahren werden.
Nahrungsmangel
- Pestizideinsatz: Der Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft und in Gärten reduziert die Verfügbarkeit von Insekten, Würmern und anderen wirbellosen Tieren, die wichtige Nahrungsquellen für Igel sind.
- Veränderte Landschaften: Monokulturen und aufgeräumte Gärten bieten weniger Vielfalt und weniger Nahrung als naturnahe, vielfältige Lebensräume.
Klimawandel:
- Extremwetter: Häufigere extreme Wetterereignisse wie Hitzewellen, Dürreperioden und starke Regenfälle können den Lebensraum und die Nahrungssuche der Igel beeinträchtigen.
- Winterschlafstörungen: Milder werdende Winter können den natürlichen Winterschlaf der Igel stören und ihren Energiehaushalt durcheinanderbringen.
Krankheiten und Parasiten:
- Parasiten: Igel sind anfällig für eine Reihe von Parasiten wie Flöhe, Zecken und Milben, die ihre Gesundheit schwächen können.
- Krankheiten: Auch Krankheiten wie das sogenannte "Igelsterben" (eine bakterielle Infektion) können zu hohen Sterblichkeitsraten führen.
Prädation und Konkurrenz:
- Natürliche Feinde: Füchse, Dachse und verwilderte Haustiere können eine Gefahr für Igel darstellen.
- Konkurrenz: Der Verlust von Lebensräumen und Nahrungsquellen kann auch die Konkurrenz mit anderen Tieren verschärfen.
Um die Bedingungen für den Braunbrustigel zu fördern und seinen Bestand zu stabilisieren, sind vielfältige Maßnahmen erforderlich:
Schaffung und Erhaltung von Lebensräumen:
- Naturnahe Gärten: Fördern Sie die Anlage von naturnahen Gärten mit Hecken, Laubhaufen, Totholz und vielfältiger Bepflanzung.
- Grünflächen und Hecken: Schützen und fördern Sie Grünflächen, Hecken und Waldstücke in urbanen und ländlichen Gebieten.
Reduktion des Pestizideinsatzes:
- Biologische Schädlingsbekämpfung: Nutzen Sie biologische Schädlingsbekämpfungsmethoden und reduzieren Sie den Einsatz von chemischen Pestiziden.
Schutz vor Straßenverkehr:
- Wildtierbrücken und -unterführungen: Installieren Sie Wildtierbrücken und -unterführungen, um Igeln das sichere Überqueren von Straßen zu ermöglichen.
- Sensibilisierung: Sensibilisieren Sie die Öffentlichkeit und Autofahrer für die Gefahren, die Straßenverkehr für Igel darstellt.
Förderung der Biodiversität:
- Vielseitige Bepflanzung: Fördern Sie die Anlage von Gärten und Feldern mit einer hohen Pflanzenvielfalt, die Insekten und andere Beutetiere für Igel anzieht.
Öffentlichkeitsarbeit und Bildung:
- Information und Aufklärung: Informieren und sensibilisieren Sie die Bevölkerung über die Bedeutung des Braunbrustigels und wie man seinen Lebensraum schützen kann.
- Bürgerbeteiligung: Fördern Sie Bürgerbeteiligungsprojekte wie Igelzählungen und den Bau von Igelhäusern.
Durch diese Maßnahmen kann man dazu beitragen, den Lebensraum und die Lebensbedingungen des Braunbrustigels zu verbessern und somit seinen Bestand langfristig zu schützen und zu fördern.
In der Aufnahme von Johannes Rother
- Braunbrustigel (Erinaceus europaeus)
Artenschutz in Franken®
Deutsche Wildtier Stiftung - Erster Igelnachwuchs liegt in den Nestern

Erster Igelnachwuchs liegt in den Nestern - bitte bei der Gartenarbeit jetzt besonders aufpassen!
04/05.07.2024
Von Juni bis September werden unsere Gärten und Parks zur Kinderstube für das Tier des Jahres 2024. Damit die jungen Igel sicher aufwachsen können, sollten wir Menschen jetzt bei der Gartenarbeit besonders auf sie achten: Die neue Igelfamilie braucht ein ungestörtes Versteck. Übrigens: Igelweibchen sind alleinerziehend - das Igelmännchen verschwindet gleich nach der Paarung.
04/05.07.2024
- Der erste Igelnachwuchs ist da! Rund sieben Zentimeter lang, mit etwa 100 weichen, unter der Haut versteckten Stacheln, blind, aber schon mit fünf winzigen Krallen an jeder Pfote - so liegen meist vier bis fünf Igel im geschützten Nest.
Von Juni bis September werden unsere Gärten und Parks zur Kinderstube für das Tier des Jahres 2024. Damit die jungen Igel sicher aufwachsen können, sollten wir Menschen jetzt bei der Gartenarbeit besonders auf sie achten: Die neue Igelfamilie braucht ein ungestörtes Versteck. Übrigens: Igelweibchen sind alleinerziehend - das Igelmännchen verschwindet gleich nach der Paarung.
Alle Gartenarbeiten unter Hecken, Sträuchern, in wilden Ecken oder dort, wo Laubhaufen und Totholz liegen, sollten jetzt besonders umsichtig erledigt oder sogar ganz gelassen werden. Denn hier liegen die Igel-Wurfnester gut versteckt. Sobald sich die Igelmutter allerdings durch Unruhe von außen gestört fühlt, kann es sein, dass sie das Nest verlässt. Dann verhungert der Nachwuchs, der in den ersten sechs Wochen gesäugt wird. "Wird ein Nest durch den Einsatz von Gartengeräten beschädigt oder zerstört, kann es zu tödlichen Verletzungen der Igel kommen", erklärt Lea-Carina Mendel, Natur- und Artenschützerin bei der Deutschen Wildtier Stiftung. Handwerkzeuge wie Heckenschere, Rechen und Besen sind in der Wurf- und Aufzuchtzeit darum besser geeignet als Maschinen. "Entdeckt man ein Nest, kann man mit ihnen viel schneller reagieren und die Tiere vor Schaden bewahren", so Mendel. Dass Mähroboter zum Igelschutz nicht in den Dämmerungs- und Nachtstunden eingesetzt werden, sollte mittlerweile selbstverständlich sein.
Mit etwa drei bis vier Wochen sind die Igel selbstständig. Sie verlassen ihr Nest und unternehmen kleinere Touren durch die Gärten. Ihre Milchzähne wachsen. Igel haben einen ausgeprägten Geruchssinn und riechen ihre Beute viele Meter weit. Die Igel lernen jetzt, was fressbar ist. So durchwühlen sie Kompost- und Laubhaufen nach Käfern, Raupen, Insektenlarven und Würmern und verspeisen auch weggeworfene Nahrungsreste neben Mülleimern. "Manchmal verliert ein Igeljunges bei all den kulinarischen Verlockungen den Überblick und findet den Weg zum Nest nicht mehr zurück. Mit leisen Pieplauten ruft es dann nach seiner Mutter", sagt Mendel. Die Igelmutter hört die Hilferufe, eilt schnaufend herbei und sammelt ihren verlorenen Gartenbummler wieder ein.
Es kann auch mal vorkommen, dass ein verirrter Jungigel tagsüber auf dem Rasen sitzt. "Das kann einen zwar stutzig machen, da Igel fast immer dämmerungs- und nachtaktiv sind - aber in der Regel ist auch dieser Tagesgast nicht gleich ein Waisenkind, sondern geht wieder seiner Wege oder wird vom Igelweibchen abgeholt", so die Artenschützerin. Mit etwa fünf bis sechs Wochen wiegen Igeljunge dann etwa 250 Gramm und sind unabhängig von der Mutter als Einzelgänger unterwegs.
Quelle
Deutsche Wildtier Stiftung
Stand
Hamburg, 25. Juni 2024
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung.Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
In der Aufnahme von Helga Zinnecker
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Mit etwa drei bis vier Wochen sind die Igel selbstständig. Sie verlassen ihr Nest und unternehmen kleinere Touren durch die Gärten. Ihre Milchzähne wachsen. Igel haben einen ausgeprägten Geruchssinn und riechen ihre Beute viele Meter weit. Die Igel lernen jetzt, was fressbar ist. So durchwühlen sie Kompost- und Laubhaufen nach Käfern, Raupen, Insektenlarven und Würmern und verspeisen auch weggeworfene Nahrungsreste neben Mülleimern. "Manchmal verliert ein Igeljunges bei all den kulinarischen Verlockungen den Überblick und findet den Weg zum Nest nicht mehr zurück. Mit leisen Pieplauten ruft es dann nach seiner Mutter", sagt Mendel. Die Igelmutter hört die Hilferufe, eilt schnaufend herbei und sammelt ihren verlorenen Gartenbummler wieder ein.
Es kann auch mal vorkommen, dass ein verirrter Jungigel tagsüber auf dem Rasen sitzt. "Das kann einen zwar stutzig machen, da Igel fast immer dämmerungs- und nachtaktiv sind - aber in der Regel ist auch dieser Tagesgast nicht gleich ein Waisenkind, sondern geht wieder seiner Wege oder wird vom Igelweibchen abgeholt", so die Artenschützerin. Mit etwa fünf bis sechs Wochen wiegen Igeljunge dann etwa 250 Gramm und sind unabhängig von der Mutter als Einzelgänger unterwegs.
- Mehr Infos für igelfreundliche Gärten finden Sie hier: Igel - Bahn frei für Stachelträger ( https://bit.ly/bahnfrei-fuer-den-igel).
Quelle
Deutsche Wildtier Stiftung
Stand
Hamburg, 25. Juni 2024
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung.Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
In der Aufnahme von Helga Zinnecker
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Artenschutz in Franken®
Stele der Biodiversität® - Stegaurach / Dellern

Stele der Biodiversität® - Stegaurach / Dellern
04/05.07.2024
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.
Stegaurach / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
04/05.07.2024
- Montage der Sekundärhabitate
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.
Stegaurach / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
Denn wenn (selbst in noch geeigneten Nahrungsstrukturen) keine geeigneten Reproduktionsräume vorhanden sind, ist die Erhaltung der Artenvielfalt gelichfalls zum Scheitern verurteilt.
Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird., setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.
In der Aufnahme
Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird., setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.
In der Aufnahme
- ab dem 24.06.2024 ...fand die Installation der Sekundärhabitate ...
Artenschutz in Franken®
Die Kellerassel ist ungefährdet, die Höhlenassel vom Aussterben

Neue Rote Liste: Die Kellerassel ist ungefährdet, die Höhlenassel vom Aussterben bedroht
03/04.07.2024
Für einige Asselarten ergeben sich jedoch Gefährdungen aus Lebensraumverlusten oder der Fragmentierung ihrer Lebensräume. So wurde die ehemals ungefährdete Gefleckte Körnerassel jetzt in die Vorwarnliste aufgenommen und die Art Armadillidium zenckeri in die Rote-Liste-Kategorie „Stark gefährdet“ hochgestuft.
03/04.07.2024
- Bonn. Der Zustand der Binnenasseln hat sich in den vergangenen Jahren nur im geringen Maße verändert. Das zeigt die neue Rote Liste, die das Bundesamt für Naturschutz (BfN) und das Rote-Liste-Zentrum (RLZ) jetzt veröffentlicht haben.
Für einige Asselarten ergeben sich jedoch Gefährdungen aus Lebensraumverlusten oder der Fragmentierung ihrer Lebensräume. So wurde die ehemals ungefährdete Gefleckte Körnerassel jetzt in die Vorwarnliste aufgenommen und die Art Armadillidium zenckeri in die Rote-Liste-Kategorie „Stark gefährdet“ hochgestuft.
Die neue Rote Liste behandelt nicht nur die in ihrem Bestand gefährdeten Arten, sondern alle 49 als etabliert geltenden Arten der Binnenasseln in Deutschland. Aktuell sind 5 Arten (10,2 %) als bestandsgefährdet eingestuft, davon ist eine Art – die Höhlenassel Proasellus cavaticus – vom Aussterben bedroht. Eine Asselart, Proasellus nolli, gilt deutschlandweit als ausgestorben oder verschollen. Von Natur aus extrem selten sind 6 Asselarten, 2 Arten stehen auf der Vorwarnliste und 29 Arten (59,2 %) gelten als ungefährdet, darunter auch die bekannte Kellerassel. Die meisten Arten werden hinsichtlich ihrer langfristigen und kurzfristigen Bestandstrends als mehr oder weniger stabil in ihren Beständen eingeschätzt.
BfN-Präsidentin Sabine Riewenherm: „Es ist erfreulich, dass bei den Asseln, im Vergleich zu anderen wirbellosen Tieren, ein geringerer Anteil der Arten bestandsgefährdet ist. Als Zersetzer organischen Materials im Boden haben sie eine wichtige Funktion im Ökosystem. Aber auch anpassungsfähige Tiere wie die Asseln leiden darunter, dass Lebensräume verschwinden, insbesondere die Spezialisten unter den Asseln. Artenschutz für Binnenasseln ist deshalb in erster Linie Lebensraumschutz. Dazu gehört die Erhaltung eines möglichst vielfältigen Mosaiks von Biotopen sowie deren Vernetzung.“
Dr. Jörg Haferkorn, Hauptautor der Roten Liste, ergänzt: „Gefährdungen für die Bestände zahlreicher Asselarten ergeben sich unter anderem durch Bodenversiegelung oder eine Intensivierung der Flächenbewirtschaftung. Wenn beispielsweise extensiv bewirtschaftete Streuobstwiesen aufgegeben oder durch Intensivobstplantagen ersetzt werden, wirkt sich dies negativ auf Asseln dieses Lebensraumtyps aus. Darüber hinaus werden Asseln durch die Fragmentierung ihrer Lebensräume gefährdet. Eine positive Bestandsentwicklung konnten wir für keine Art in den letzten 25 Jahren dokumentieren.“
Binnenasseln sind als einzige Krebstiere echte Landbewohner
In der Gruppe der Binnenasseln werden die auf dem Land sowie im Süßwasser lebenden Asselarten zusammengefasst. Sie besiedeln nahezu alle limnischen und terrestrischen Lebensräume Deutschlands. Bedingt durch die gute Anpassung vieler Asselarten an das Landleben können auch trockene, grundwasserferne und warme Standorte besiedelt werden. Kalte und trockene Witterungsperioden verbringen Landasseln in der oberen Bodenschicht, unter Steinen oder unter der Borke von Gehölzen. Süßwasserasseln leben in Stand- und Fließgewässern sowie in Höhlen und im Grundwasser.
Asseln gehören zu den Krebstieren und sind die einzigen Vertreter dieser Ordnung, die sich im Laufe der Evolution zu echten Landbewohnern entwickelt haben. Ursprüngliche Arten, z. B. die Sumpfassel, besitzen eine noch nahezu amphibische Lebensweise. Sofern sie an Land leben, benötigen viele Asselarten eine hohe Luftfeuchtigkeit zur Atmung. Die bekanntesten Arten sind die Kellerassel und die Mauerassel. Asseln zeigen keine Schadwirkung und übertragen keinerlei Krankheiten.
Hintergrund
Die Roten Listen der Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands
Die Rote Liste der Binnenasseln Deutschlands wurde von erfahrenen Experten der Bodenzoologie verfasst. Die bundesweiten Roten Listen werden vom Bundesamt für Naturschutz (BfN) herausgegeben und in dessen Auftrag vom Rote-Liste-Zentrum (RLZ) koordiniert. In den bundesweiten Roten Listen wird der Gefährdungsstatus von Tier-, Pflanzen- und Pilzarten für den Bezugsraum Deutschland dargestellt. Die Roten Listen sind zugleich Inventarlisten für einzelne Artengruppen und bieten Informationen nicht nur zu den gefährdeten, sondern zu allen in Deutschland vorkommenden Arten der untersuchten Organismengruppen. Die Autorinnen und Autoren bewerten die Gefährdungssituation insbesondere anhand der Bestandssituation und der Bestandsentwicklung. Die Grundlagen für die Gefährdungsanalysen werden von einer großen Zahl von ehrenamtlichen Artenkennerinnen und Artenkennern ermittelt. Die Roten Listen selbst werden von den Autorinnen und Autoren ebenfalls in weiten Teilen ehrenamtlich erstellt.
Für den Schutz der Artenvielfalt in Deutschland stellen Rote Listen eine entscheidende Grundlage dar. Sie dokumentieren den Zustand von Arten und mittelbar die Auswirkungen menschlichen Handelns auf die Natur. Damit sind sie Frühwarnsysteme für die Entwicklung der biologischen Vielfalt.
Das Rote-Liste-Zentrum
Das Rote-Liste-Zentrum koordiniert seit Dezember 2018 im Auftrag des Bundesamtes für Naturschutz die Erstellung der bundesweiten Roten Listen. Das Bundesumweltministerium fördert das Zentrum mit jährlich 3,1 Millionen Euro. Es ist am Projektträger im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Bonn angesiedelt und wird fachlich vom BfN betreut. Das Rote-Liste-Zentrum unterstützt die Autoren und Autorinnen sowie weitere beteiligte Fachleute der Roten Listen, indem es sie bei der Erstellung fachwissenschaftlich begleitet und Kosten für die Koordination, die Arbeitstreffen der Fachleute und andere vorbereitende Arbeiten übernimmt.
In der Aufnahme von © B. Kästle
Quelle
Bundesamt für Naturschutz
Referat Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Social Media
Konstantinstraße 110
53179 Bonn
Stand
02.07.2024
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung.Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
BfN-Präsidentin Sabine Riewenherm: „Es ist erfreulich, dass bei den Asseln, im Vergleich zu anderen wirbellosen Tieren, ein geringerer Anteil der Arten bestandsgefährdet ist. Als Zersetzer organischen Materials im Boden haben sie eine wichtige Funktion im Ökosystem. Aber auch anpassungsfähige Tiere wie die Asseln leiden darunter, dass Lebensräume verschwinden, insbesondere die Spezialisten unter den Asseln. Artenschutz für Binnenasseln ist deshalb in erster Linie Lebensraumschutz. Dazu gehört die Erhaltung eines möglichst vielfältigen Mosaiks von Biotopen sowie deren Vernetzung.“
Dr. Jörg Haferkorn, Hauptautor der Roten Liste, ergänzt: „Gefährdungen für die Bestände zahlreicher Asselarten ergeben sich unter anderem durch Bodenversiegelung oder eine Intensivierung der Flächenbewirtschaftung. Wenn beispielsweise extensiv bewirtschaftete Streuobstwiesen aufgegeben oder durch Intensivobstplantagen ersetzt werden, wirkt sich dies negativ auf Asseln dieses Lebensraumtyps aus. Darüber hinaus werden Asseln durch die Fragmentierung ihrer Lebensräume gefährdet. Eine positive Bestandsentwicklung konnten wir für keine Art in den letzten 25 Jahren dokumentieren.“
Binnenasseln sind als einzige Krebstiere echte Landbewohner
In der Gruppe der Binnenasseln werden die auf dem Land sowie im Süßwasser lebenden Asselarten zusammengefasst. Sie besiedeln nahezu alle limnischen und terrestrischen Lebensräume Deutschlands. Bedingt durch die gute Anpassung vieler Asselarten an das Landleben können auch trockene, grundwasserferne und warme Standorte besiedelt werden. Kalte und trockene Witterungsperioden verbringen Landasseln in der oberen Bodenschicht, unter Steinen oder unter der Borke von Gehölzen. Süßwasserasseln leben in Stand- und Fließgewässern sowie in Höhlen und im Grundwasser.
Asseln gehören zu den Krebstieren und sind die einzigen Vertreter dieser Ordnung, die sich im Laufe der Evolution zu echten Landbewohnern entwickelt haben. Ursprüngliche Arten, z. B. die Sumpfassel, besitzen eine noch nahezu amphibische Lebensweise. Sofern sie an Land leben, benötigen viele Asselarten eine hohe Luftfeuchtigkeit zur Atmung. Die bekanntesten Arten sind die Kellerassel und die Mauerassel. Asseln zeigen keine Schadwirkung und übertragen keinerlei Krankheiten.
Hintergrund
Die Roten Listen der Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands
Die Rote Liste der Binnenasseln Deutschlands wurde von erfahrenen Experten der Bodenzoologie verfasst. Die bundesweiten Roten Listen werden vom Bundesamt für Naturschutz (BfN) herausgegeben und in dessen Auftrag vom Rote-Liste-Zentrum (RLZ) koordiniert. In den bundesweiten Roten Listen wird der Gefährdungsstatus von Tier-, Pflanzen- und Pilzarten für den Bezugsraum Deutschland dargestellt. Die Roten Listen sind zugleich Inventarlisten für einzelne Artengruppen und bieten Informationen nicht nur zu den gefährdeten, sondern zu allen in Deutschland vorkommenden Arten der untersuchten Organismengruppen. Die Autorinnen und Autoren bewerten die Gefährdungssituation insbesondere anhand der Bestandssituation und der Bestandsentwicklung. Die Grundlagen für die Gefährdungsanalysen werden von einer großen Zahl von ehrenamtlichen Artenkennerinnen und Artenkennern ermittelt. Die Roten Listen selbst werden von den Autorinnen und Autoren ebenfalls in weiten Teilen ehrenamtlich erstellt.
Für den Schutz der Artenvielfalt in Deutschland stellen Rote Listen eine entscheidende Grundlage dar. Sie dokumentieren den Zustand von Arten und mittelbar die Auswirkungen menschlichen Handelns auf die Natur. Damit sind sie Frühwarnsysteme für die Entwicklung der biologischen Vielfalt.
Das Rote-Liste-Zentrum
Das Rote-Liste-Zentrum koordiniert seit Dezember 2018 im Auftrag des Bundesamtes für Naturschutz die Erstellung der bundesweiten Roten Listen. Das Bundesumweltministerium fördert das Zentrum mit jährlich 3,1 Millionen Euro. Es ist am Projektträger im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Bonn angesiedelt und wird fachlich vom BfN betreut. Das Rote-Liste-Zentrum unterstützt die Autoren und Autorinnen sowie weitere beteiligte Fachleute der Roten Listen, indem es sie bei der Erstellung fachwissenschaftlich begleitet und Kosten für die Koordination, die Arbeitstreffen der Fachleute und andere vorbereitende Arbeiten übernimmt.
In der Aufnahme von © B. Kästle
- Assel Porcellio Montanus
Quelle
Bundesamt für Naturschutz
Referat Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Social Media
Konstantinstraße 110
53179 Bonn
Stand
02.07.2024
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung.Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Artenschutz in Franken®
Artenschutz am Windradfuß?

Artenschutz am Windradfuß?
03/04.07.2024
Rolf Thiemann hat dieses Thema aufgegriffen und dazu folgenden Bericht verfasst und richtet einen etwas anderen Blickwinkel auf Aspekte dieser Art die zum Nachdenken anregen.
03/04.07.2024
- Vor einigen Tagen konnten wir einen doch recht „interessanten“ Bericht verfolgen der sich mit der Gestaltung von Umgriffen am Windradfuß befasste.
Rolf Thiemann hat dieses Thema aufgegriffen und dazu folgenden Bericht verfasst und richtet einen etwas anderen Blickwinkel auf Aspekte dieser Art die zum Nachdenken anregen.
Es wird erwähnt, dass die Flächen die einem Bericht angesprochen wurden intensiv von der Landwirtschaft genutzt werden: „Sehr viel Platz für die Natur gibt es nicht.“ Das stimmt, in den letzten Wochen sind etliche Blüh- und Randstreifen abgemäht worden.
Im Laufe der letzten Jahre sind zudem viele Ackerrandstreifen wieder umgebrochen worden, viele Landwirte ackern nun bis zu den Feldwegen.Zahlreiche gefährdete Tiere wie Grauammer und Feldlerche sowie unzählige Insektenarten verloren ihren Lebensraum und/oder wurden getötet.
In der Aufnahme:
Quelle
Gewässer und Naturschutz im Erftkreis
Flora-Fauna-Artenschutz
Naturschutzökologie
Rolf Thiemann
Naturschutzberater
50181 Bedburg
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung.Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Im Laufe der letzten Jahre sind zudem viele Ackerrandstreifen wieder umgebrochen worden, viele Landwirte ackern nun bis zu den Feldwegen.Zahlreiche gefährdete Tiere wie Grauammer und Feldlerche sowie unzählige Insektenarten verloren ihren Lebensraum und/oder wurden getötet.
In der Aufnahme:
- Bereich am Windradfuß der mit "Unkrautverichtern" abgespritz wurde.
Quelle
Gewässer und Naturschutz im Erftkreis
Flora-Fauna-Artenschutz
Naturschutzökologie
Rolf Thiemann
Naturschutzberater
50181 Bedburg
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung.Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Artenschutz in Franken®
Mauereidechse (Podarcis muralis)

Mauereidechse (Podarcis muralis)
02/03.07.2024
Unsere Art ist bekannt für unsere Anpassungsfähigkeit an urbane Umgebungen und die Fähigkeit, auf Mauern und Gebäuden zu leben. Diese Fähigkeit verdanken wir unter anderem unserer ausgezeichneten Klettertechnik und unserer Anpassung an verschiedene Klimabedingungen.
02/03.07.2024
- Als Mauereidechse, oder Podarcis muralis, betrachte ich meine Welt aus einer faszinierenden Perspektive.
Unsere Art ist bekannt für unsere Anpassungsfähigkeit an urbane Umgebungen und die Fähigkeit, auf Mauern und Gebäuden zu leben. Diese Fähigkeit verdanken wir unter anderem unserer ausgezeichneten Klettertechnik und unserer Anpassung an verschiedene Klimabedingungen.
Von Fachleuten werde ich oft als "Generalist" beschrieben, da ich in der Lage bin, eine Vielzahl von Lebensräumen zu besiedeln und mich an unterschiedliche Bedingungen anzupassen. Dies macht mich zu einem erfolgreichen Bewohner sowohl von städtischen als auch von ländlichen Gebieten.
Eine interessante Anekdote aus meinem Leben betrifft meine Fähigkeit zur Farbänderung. Wenn ich gestresst oder in Gefahr bin, kann sich meine Hautfarbe verändern, was mir hilft, mich vor potenziellen Feinden zu verstecken. Dies ist eine Form der Tarnung, die mir erlaubt, mich in meiner Umgebung zu verschmelzen und unentdeckt zu bleiben.
Eine weitere bemerkenswerte Eigenschaft ist meine Fähigkeit zur Regeneration von abgeworfenen Schwanzteilen. Wenn ein Raubtier mich am Schwanz packt, kann ich diesen aus eigener Kraft abwerfen, um zu entkommen. Später wächst der Schwanz nach, wobei er oft etwas kürzer und anders geformt ist als der ursprüngliche Schwanz.
Als Reptil gehöre ich zur Familie der Lacertidae und bin eng mit anderen Eidechsenarten verwandt. Wir Mauereidechsen sind territorial und markieren unsere Reviere aktiv, um unsere Präsenz zu signalisieren und Rivalen abzuschrecken. Während der Paarungszeit zeigt das Männchen sein auffälligstes Verhalten, um Weibchen anzuziehen und seine Dominanz zu demonstrieren.
Insgesamt bin ich als Mauereidechse ein faszinierendes Beispiel für die Anpassungsfähigkeit und Überlebensfähigkeit von Reptilien in urbanen Umgebungen. Meine Fähigkeit, mich an Veränderungen anzupassen, und meine einzigartigen Eigenschaften machen mich zu einem interessanten Studienobjekt für Biologen und Naturliebhaber gleichermaßen.
Mehr zur Mauereidechse (Podarcis muralis) hier auf unseren Seiten
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
Eine interessante Anekdote aus meinem Leben betrifft meine Fähigkeit zur Farbänderung. Wenn ich gestresst oder in Gefahr bin, kann sich meine Hautfarbe verändern, was mir hilft, mich vor potenziellen Feinden zu verstecken. Dies ist eine Form der Tarnung, die mir erlaubt, mich in meiner Umgebung zu verschmelzen und unentdeckt zu bleiben.
Eine weitere bemerkenswerte Eigenschaft ist meine Fähigkeit zur Regeneration von abgeworfenen Schwanzteilen. Wenn ein Raubtier mich am Schwanz packt, kann ich diesen aus eigener Kraft abwerfen, um zu entkommen. Später wächst der Schwanz nach, wobei er oft etwas kürzer und anders geformt ist als der ursprüngliche Schwanz.
Als Reptil gehöre ich zur Familie der Lacertidae und bin eng mit anderen Eidechsenarten verwandt. Wir Mauereidechsen sind territorial und markieren unsere Reviere aktiv, um unsere Präsenz zu signalisieren und Rivalen abzuschrecken. Während der Paarungszeit zeigt das Männchen sein auffälligstes Verhalten, um Weibchen anzuziehen und seine Dominanz zu demonstrieren.
Insgesamt bin ich als Mauereidechse ein faszinierendes Beispiel für die Anpassungsfähigkeit und Überlebensfähigkeit von Reptilien in urbanen Umgebungen. Meine Fähigkeit, mich an Veränderungen anzupassen, und meine einzigartigen Eigenschaften machen mich zu einem interessanten Studienobjekt für Biologen und Naturliebhaber gleichermaßen.
Mehr zur Mauereidechse (Podarcis muralis) hier auf unseren Seiten
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
- Mauereidechse (Podarcis muralis)
Artenschutz in Franken®
Rindenspringspinne (Marpissa muscosa)

Die Rindenspringspinne (Marpissa muscosa) ist eine interessante kleine Spinne, die zur Familie der Springspinnen gehört.
02/03.07.2024
Hier sind einige Infos über sie:
Aussehen
02/03.07.2024
Hier sind einige Infos über sie:
Aussehen
- Größe: Die Weibchen werden etwa 7-10 mm groß, die Männchen sind etwas kleiner.
- Farbe: Sie haben eine bräunliche bis graue Farbe mit dunkleren und helleren Streifen oder Flecken, die ihnen helfen, sich auf Baumrinde zu tarnen
- Augen: Sie haben acht Augen, wobei die vorderen Mittelaugen besonders groß sind, was ihnen ein hervorragendes Sehvermögen verleiht.
Lebensraum und Verbreitung
Verhalten
Fortpflanzung
Interessante Fakten
Tarnung: Ihre Färbung und Musterung helfen ihr, sich perfekt in ihrer Umgebung zu tarnen, was sie vor Feinden schützt und ihr ermöglicht, sich unbemerkt an ihre Beute heranzuschleichen.
Die Rindenspringspinne ist also eine faszinierende kleine Jägerin, die sowohl durch ihre Sprungkraft als auch durch ihre Tarnfähigkeiten beeindruckt.
In der Aufnahme / Autor Bernhard Schmalisch
- Verbreitung: Marpissa muscosa ist in Europa und Asien verbreitet.
- Lebensraum: Sie bevorzugt Lebensräume mit Baumrinde, daher ihr Name. Man findet sie oft auf alten Bäumen, in Wäldern und Parks, aber auch an Gebäuden mit rauer Oberfläche.
Verhalten
- Springen: Wie alle Springspinnen kann auch die Rindenspringspinne erstaunlich weit springen. Dies nutzt sie sowohl zur Jagd als auch zur Flucht vor Feinden.
- Jagd: Sie jagt aktiv, indem sie sich an ihre Beute heranschleicht und dann blitzschnell zuspringt. Ihre Beute besteht hauptsächlich aus kleinen Insekten und anderen Spinnen.
- Netze: Anders als viele andere Spinnen webt die Rindenspringspinne kein Netz, um Beute zu fangen. Sie verwendet ihre Spinnenseide hauptsächlich zum Bau von Schutzräumen und zur Absicherung beim Springen.
Fortpflanzung
- Balz: Männchen führen vor den Weibchen beeindruckende Tänze auf, um sie zu beeindrucken und Paarungsbereitschaft zu signalisieren.
- Eier: Die Weibchen legen ihre Eier in einem Kokon ab, den sie gut verstecken und bewachen.
Interessante Fakten
- Sehkraft: Ihre großen Mittelaugen verleihen ihr eine sehr gute Sehkraft, die sie für die Jagd und Orientierung nutzt.
Tarnung: Ihre Färbung und Musterung helfen ihr, sich perfekt in ihrer Umgebung zu tarnen, was sie vor Feinden schützt und ihr ermöglicht, sich unbemerkt an ihre Beute heranzuschleichen.
Die Rindenspringspinne ist also eine faszinierende kleine Jägerin, die sowohl durch ihre Sprungkraft als auch durch ihre Tarnfähigkeiten beeindruckt.
In der Aufnahme / Autor Bernhard Schmalisch
- Rindenspringspinne (Marpissa muscosa) ... "Die" blickt durch, mit ihren 8 Augen ... auch die Giftmandibeln mit Verdauungsenzymen sind prall gefüllt ...ihr fehlt wohl das Mittagessen...
Artenschutz in Franken®
Stele der Biodiversität® - Stegaurach / Dellern

Stele der Biodiversität® - Stegaurach / Dellern
02/03.07.2024
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.
Stegaurach / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
02/03.07.2024
- Installation der Fledermaus- Thermokammer
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.
Stegaurach / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
Denn wenn (selbst in noch geeigneten Nahrungsstrukturen) keine geeigneten Reproduktionsräume vorhanden sind, ist die Erhaltung der Artenvielfalt gelichfalls zum Scheitern verurteilt.
Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird., setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.
In der Aufnahme
Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird., setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.
In der Aufnahme
- am 18.06.2024 starten wir mit den Dacharbeiten ...
Artenschutz in Franken®
Der Hirschkäfer (Lucanus cervus)

Hirschkäfer (Lucanus cervus)
01/02.07.2024
01/02.07.2024
- Als Hirschkäfer (Lucanus cervus) kann ich dir erklären, warum du mich im Juni oder Juli häufiger als fertigen Käfer findest, und was du tun solltest, wenn du mich entdeckst.
Im Juni oder Juli bin ich als fertiger Käfer besonders aktiv, weil dies die Zeit ist, in der ich aus meiner Larvenhülle schlüpfe, die ich im Boden verbracht habe. Nach mehreren Jahren als Larve, die unterirdisch lebte und sich von morschem Holz ernährte, habe ich mich zu einem großen und kräftigen Käfer entwickelt. Diese Zeit ist für mich entscheidend, da ich nun flügge bin und auf der Suche nach einer Partnerin, um mich zu paaren.
Wenn du mich als Hirschkäfer entdeckst, ist es wichtig, dass du mich in meiner natürlichen Umgebung lässt. Ich brauche bestimmte Lebensräume wie alte Laubbäume und morsche Stämme, um mich fortzupflanzen und meine Eier abzulegen. Diese Bäume bieten nicht nur Nahrung für meine Larven, sondern auch Schutz vor Feinden und einen geeigneten Platz für meine Entwicklung.
Um meine Population zu unterstützen, könntest du Lebensräume erhalten oder schaffen, die für mich und andere Hirschkäfer geeignet sind. Das bedeutet, dass du alte Bäume und Totholz in Wäldern oder Parks schützen solltest. Wenn du mich in der Nähe von Straßen oder in Gefahr siehst, könntest du mich vorsichtig an einen sichereren Ort bringen, aber es ist wichtig, dass du mich nicht störst oder meine natürlichen Lebensräume zerstörst.
Denke daran, dass ich als Hirschkäfer eine wichtige Rolle im Ökosystem spiele, indem ich zur Zersetzung von Totholz beitrage und andere Tiere anlocke, die von mir und meinem Lebensraum abhängig sind. Indem du mich und meine Lebensräume schützt, trägst du zur Erhaltung der Artenvielfalt bei und sicherst meine Fortpflanzung für zukünftige Generationen.
In der Aufnahme von V.Greb
Wenn du mich als Hirschkäfer entdeckst, ist es wichtig, dass du mich in meiner natürlichen Umgebung lässt. Ich brauche bestimmte Lebensräume wie alte Laubbäume und morsche Stämme, um mich fortzupflanzen und meine Eier abzulegen. Diese Bäume bieten nicht nur Nahrung für meine Larven, sondern auch Schutz vor Feinden und einen geeigneten Platz für meine Entwicklung.
Um meine Population zu unterstützen, könntest du Lebensräume erhalten oder schaffen, die für mich und andere Hirschkäfer geeignet sind. Das bedeutet, dass du alte Bäume und Totholz in Wäldern oder Parks schützen solltest. Wenn du mich in der Nähe von Straßen oder in Gefahr siehst, könntest du mich vorsichtig an einen sichereren Ort bringen, aber es ist wichtig, dass du mich nicht störst oder meine natürlichen Lebensräume zerstörst.
Denke daran, dass ich als Hirschkäfer eine wichtige Rolle im Ökosystem spiele, indem ich zur Zersetzung von Totholz beitrage und andere Tiere anlocke, die von mir und meinem Lebensraum abhängig sind. Indem du mich und meine Lebensräume schützt, trägst du zur Erhaltung der Artenvielfalt bei und sicherst meine Fortpflanzung für zukünftige Generationen.
In der Aufnahme von V.Greb
- Hirschkäfer Männchen im Größenvergleich
Artenschutz in Franken®
Orangefarbener Feuerkäfer (Schizotus pectinicornis)

Orangefarbener Feuerkäfer (Schizotus pectinicornis)
01/02.07.2024
Diese Käferart ist in Europa weit verbreitet und bevorzugt feuchte Lebensräume wie Wälder, insbesondere in der Nähe von Flussufern und Teichen.
01/02.07.2024
- Der orangefarbene Feuerkäfer, wissenschaftlich als Schizotus pectinicornis bekannt, ist ein faszinierendes kleines Insekt, das zur Familie der Schwarzkäfer (Tenebrionidae) gehört.
Diese Käferart ist in Europa weit verbreitet und bevorzugt feuchte Lebensräume wie Wälder, insbesondere in der Nähe von Flussufern und Teichen.
Merkmale
Der orangefarbene Feuerkäfer ist leicht an seiner leuchtend orangefarbenen Färbung zu erkennen, die ihn von vielen anderen Käferarten unterscheidet. Erwachsene Käfer erreichen eine Länge von etwa 8 bis 12 Millimetern. Ein weiteres markantes Merkmal sind ihre gefiederten Antennen, die wie winzige Kämme aussehen, was ihnen den wissenschaftlichen Namen "pectinicornis" (von lateinisch "pecten" = Kamm) einbrachte.
Lebensweise und Ernährung
Diese Käfer sind meist im Frühjahr und Sommer aktiv. Die Larven und erwachsenen Käfer ernähren sich hauptsächlich von verrottendem Holz und anderen organischen Materialien. Dies macht sie zu wichtigen Akteuren im Ökosystem, da sie helfen, organische Stoffe zu zersetzen und den Nährstoffkreislauf aufrechtzuerhalten.
Fortpflanzung
Die Weibchen legen ihre Eier in feuchtes, verrottendes Holz oder unter Rinde ab. Nach einigen Wochen schlüpfen die Larven, die sich durch das verrottende Material fressen und über mehrere Monate hinweg zu erwachsenen Käfern heranwachsen. Dieser Lebenszyklus trägt zur natürlichen Recyclingprozesse in Wäldern bei.
Bedeutung für das Ökosystem
Der orangefarbene Feuerkäfer spielt eine wichtige Rolle im Waldökosystem. Durch ihre Aktivitäten tragen die Käfer zur Zersetzung von totem Holz und anderen organischen Stoffen bei, wodurch Nährstoffe wieder in den Boden gelangen und die Bodenfruchtbarkeit verbessert wird. Das ist ein Paradebeispiel für eine nachhaltige Lebensweise in der Natur.
Fazit
Der orangefarbene Feuerkäfer ist nicht nur ein hübscher kleiner Kerl, sondern auch ein echter Umweltheld. Durch seine Aktivitäten hilft er, unsere Wälder sauber und gesund zu halten, was für uns und unsere nachfolgenden Generationen von unschätzbarem Wert ist. Es zeigt sich, dass selbst die kleinsten Lebewesen einen großen Beitrag zu einem innovativen und nachhaltigen Leben leisten können. Also, das nächste Mal, wenn du einen dieser leuchtenden Käfer siehst, denke daran, wie viel Gutes sie für unser Ökosystem tun!
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
Der orangefarbene Feuerkäfer ist leicht an seiner leuchtend orangefarbenen Färbung zu erkennen, die ihn von vielen anderen Käferarten unterscheidet. Erwachsene Käfer erreichen eine Länge von etwa 8 bis 12 Millimetern. Ein weiteres markantes Merkmal sind ihre gefiederten Antennen, die wie winzige Kämme aussehen, was ihnen den wissenschaftlichen Namen "pectinicornis" (von lateinisch "pecten" = Kamm) einbrachte.
Lebensweise und Ernährung
Diese Käfer sind meist im Frühjahr und Sommer aktiv. Die Larven und erwachsenen Käfer ernähren sich hauptsächlich von verrottendem Holz und anderen organischen Materialien. Dies macht sie zu wichtigen Akteuren im Ökosystem, da sie helfen, organische Stoffe zu zersetzen und den Nährstoffkreislauf aufrechtzuerhalten.
Fortpflanzung
Die Weibchen legen ihre Eier in feuchtes, verrottendes Holz oder unter Rinde ab. Nach einigen Wochen schlüpfen die Larven, die sich durch das verrottende Material fressen und über mehrere Monate hinweg zu erwachsenen Käfern heranwachsen. Dieser Lebenszyklus trägt zur natürlichen Recyclingprozesse in Wäldern bei.
Bedeutung für das Ökosystem
Der orangefarbene Feuerkäfer spielt eine wichtige Rolle im Waldökosystem. Durch ihre Aktivitäten tragen die Käfer zur Zersetzung von totem Holz und anderen organischen Stoffen bei, wodurch Nährstoffe wieder in den Boden gelangen und die Bodenfruchtbarkeit verbessert wird. Das ist ein Paradebeispiel für eine nachhaltige Lebensweise in der Natur.
Fazit
Der orangefarbene Feuerkäfer ist nicht nur ein hübscher kleiner Kerl, sondern auch ein echter Umweltheld. Durch seine Aktivitäten hilft er, unsere Wälder sauber und gesund zu halten, was für uns und unsere nachfolgenden Generationen von unschätzbarem Wert ist. Es zeigt sich, dass selbst die kleinsten Lebewesen einen großen Beitrag zu einem innovativen und nachhaltigen Leben leisten können. Also, das nächste Mal, wenn du einen dieser leuchtenden Käfer siehst, denke daran, wie viel Gutes sie für unser Ökosystem tun!
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
- Orangefarbener Feuerkäfer (Schizotus pectinicornis)
Artenschutz in Franken®
Die Grüne Waffenfliege (Oplodontha viridula)

Die Grüne Waffenfliege (Oplodontha viridula)
01/02.07.2024
Hallo, liebe Kinder!
Das ist die Grüne Waffenfliege, oder wie die Wissenschaftler sie nennen, Oplodontha viridula!
01/02.07.2024
Hallo, liebe Kinder!
- Habt ihr schon mal eine kleine, grüne Fliege gesehen, die so aussieht, als hätte sie eine glänzende Rüstung an?
Das ist die Grüne Waffenfliege, oder wie die Wissenschaftler sie nennen, Oplodontha viridula!
Vorstellung der Grünen Waffenfliege:
Die Grüne Waffenfliege ist ungefähr so groß wie ein winziger Schatz auf einem Piratenschiff. Ihr Körper glitzert in einem schönen Grün, das fast so leuchtend ist wie ein Smaragd. Sie sieht aus, als wäre sie bereit für ein großes Abenteuer – oder eine lustige Schlacht mit ihren Käferfreunden!
Superkräfte der Grünen Waffenfliege:
Fachbegriffe zum "Angeben":
Warum die Grüne Waffenfliege wichtig ist:
Die Grüne Waffenfliege hilft dabei, das Gleichgewicht in der Natur zu halten. Ihre Larven fressen schädliche Insektenlarven und helfen so den Pflanzen, gesund zu bleiben. Außerdem sind sie ein wichtiger Teil der Nahrungskette und dienen als Futter für Vögel und andere Tiere.
Also, wenn ihr das nächste Mal eine glänzende, grüne Fliege seht, denkt daran, dass es die Grüne Waffenfliege ist – ein kleiner Ritter im schillernden Gewand, der bereit ist, die Schurken im Garten zu bekämpfen und das Gleichgewicht in der Natur zu bewahren!
Aufnahme von Bernhard Schmalisch am 23.06.2024
Die Grüne Waffenfliege ist ungefähr so groß wie ein winziger Schatz auf einem Piratenschiff. Ihr Körper glitzert in einem schönen Grün, das fast so leuchtend ist wie ein Smaragd. Sie sieht aus, als wäre sie bereit für ein großes Abenteuer – oder eine lustige Schlacht mit ihren Käferfreunden!
Superkräfte der Grünen Waffenfliege:
- Glitzer-Rüstung: Ihre grüne Farbe und der metallische Glanz machen sie zu einer der schicksten Fliegen im Garten. Es sieht aus, als hätte sie eine glänzende Ritterrüstung an. Sie ist immer bereit für eine Party oder ein Abenteuer im Garten!
- Mini-Kämpfer: Obwohl sie klein ist, ist die Grüne Waffenfliege ein echter Kämpfer. Sie legt ihre Eier in feuchten Bereichen ab, und ihre Larven sind kleine Raubtiere, die sich von anderen Insektenlarven ernähren. Sie sind wie winzige Superhelden, die die Schurken im Garten bekämpfen.
- Turbo-Flieger: Mit ihren schnellen Flügeln kann sie blitzschnell von einer Blume zur nächsten fliegen. Es ist, als hätte sie einen eingebauten Turbo-Antrieb! Sie ist die Formel-1-Rennfahrerin unter den Fliegen.
Fachbegriffe zum "Angeben":
- Larven: Das sind die Babyfliegen, die aus den Eiern schlüpfen. Sie sehen aus wie winzige Würmchen und sind immer hungrig.
- Metamorphose: Das ist die Verwandlung von der Larve zur erwachsenen Fliege. Es ist, als würde sich ein Zauber über die Larve legen und sie in die schicke, grüne Waffenfliege verwandeln.
Warum die Grüne Waffenfliege wichtig ist:
Die Grüne Waffenfliege hilft dabei, das Gleichgewicht in der Natur zu halten. Ihre Larven fressen schädliche Insektenlarven und helfen so den Pflanzen, gesund zu bleiben. Außerdem sind sie ein wichtiger Teil der Nahrungskette und dienen als Futter für Vögel und andere Tiere.
Also, wenn ihr das nächste Mal eine glänzende, grüne Fliege seht, denkt daran, dass es die Grüne Waffenfliege ist – ein kleiner Ritter im schillernden Gewand, der bereit ist, die Schurken im Garten zu bekämpfen und das Gleichgewicht in der Natur zu bewahren!
Aufnahme von Bernhard Schmalisch am 23.06.2024
- Grüne Waffenfliege (Oplodontha viridula)
Artenschutz in Franken®
Totenkopfschwebfliege / Gemeine Dolden-Schwebfliege (Myathropa florea)

Totenkopfschwebfliege / Gemeine Dolden-Schwebfliege (Myathropa florea)
30.06/01.07.2024
Keine Sorge, ich bin total nett und gar nicht unheimlich.
30.06/01.07.2024
- Hallo! Weißt du, wer ich bin? Ich bin die Totenkopfschwebfliege, aber du kannst mich einfach "Totti" nennen! Klingt gruselig, oder?
Keine Sorge, ich bin total nett und gar nicht unheimlich.
Ich sehe vielleicht ein bisschen aus wie eine Mini-Biene, aber ich bin eine Schwebfliege. Weißt du, was Schwebfliegen können? Wir können wie echte Helikopter in der Luft stehen! Zzzzzzz... einfach so! Cool, oder? Das ist, als ob du in der Luft stehen und dabei ein Eis essen könntest, ohne runterzufallen.
Auf meinem Rücken trage ich ein besonderes Muster, das aussieht wie ein Totenkopf. Das ist mein Superheldenkostüm! Damit denken Raubtiere, ich wäre gefährlich, und lassen mich in Ruhe. Aber psst, mein Geheimnis: Ich bin überhaupt nicht gefährlich. Ich habe nicht einmal einen Stachel!
Ich liebe es, von Blume zu Blume zu fliegen und Nektar zu schlürfen. Das ist wie eine Party, bei der es nur Süßigkeiten gibt. Und weißt du was? Während ich das mache, helfe ich den Blumen, Babys zu bekommen! Ja, wirklich! Wenn ich von Blume zu Blume fliege, nehme ich Pollen mit, und das hilft den Blumen, neue Samen zu machen. Das ist, als würde ich ihnen helfen, ihre eigene Blumenfamilie zu gründen.
Und das Beste? Wenn ich auf Blättern oder Blüten lande, kitzelt das so schön an meinen Füßchen! Hihihi!
Also, wenn du das nächste Mal eine Totenkopfschwebfliege siehst, denk an mich, Totti, den freundlichen Luftakrobaten, der Blumen hilft und gerne in der Sonne tanzt. Zzzzzzzz...!
Aufnahme von Klaus Sanwald
Totenkopfschwebfliege / Gemeine Dolden-Schwebfliege (Myathropa florea)
Auf meinem Rücken trage ich ein besonderes Muster, das aussieht wie ein Totenkopf. Das ist mein Superheldenkostüm! Damit denken Raubtiere, ich wäre gefährlich, und lassen mich in Ruhe. Aber psst, mein Geheimnis: Ich bin überhaupt nicht gefährlich. Ich habe nicht einmal einen Stachel!
Ich liebe es, von Blume zu Blume zu fliegen und Nektar zu schlürfen. Das ist wie eine Party, bei der es nur Süßigkeiten gibt. Und weißt du was? Während ich das mache, helfe ich den Blumen, Babys zu bekommen! Ja, wirklich! Wenn ich von Blume zu Blume fliege, nehme ich Pollen mit, und das hilft den Blumen, neue Samen zu machen. Das ist, als würde ich ihnen helfen, ihre eigene Blumenfamilie zu gründen.
Und das Beste? Wenn ich auf Blättern oder Blüten lande, kitzelt das so schön an meinen Füßchen! Hihihi!
Also, wenn du das nächste Mal eine Totenkopfschwebfliege siehst, denk an mich, Totti, den freundlichen Luftakrobaten, der Blumen hilft und gerne in der Sonne tanzt. Zzzzzzzz...!
Aufnahme von Klaus Sanwald
Totenkopfschwebfliege / Gemeine Dolden-Schwebfliege (Myathropa florea)
Artenschutz in Franken®
Gemeine Ohrwurm (Forficula auricularia)

Gemeine Ohrwurm (Forficula auricularia)
30.06/01.07.2024
Nein, keine Angst, er krabbelt nicht in eure Ohren, obwohl sein Name das vielleicht vermuten lässt. Das ist nur ein Missverständnis.
30.06/01.07.2024
- Hallo! Ich bin Timmy, und heute erzähle ich euch von einem meiner liebsten kleinen Krabbeltiere – dem Gemeinen Ohrwurm!
Nein, keine Angst, er krabbelt nicht in eure Ohren, obwohl sein Name das vielleicht vermuten lässt. Das ist nur ein Missverständnis.
Also, stellt euch vor, ihr seid draußen im Garten und hebt einen Blumentopf hoch. Überraschung! Da ist er, der Ohrwurm, mit seinen coolen Zangen am Hinterteil. Er sieht ein bisschen wie ein Mini-Dinosaurier aus, oder? Ich finde das total spannend!
Der Ohrwurm hat diesen besonderen Namen, weil die Leute früher geglaubt haben, dass er nachts in die Ohren krabbelt. Aber eigentlich interessiert er sich viel mehr für Blätter und kleine Insekten. Er ist also eher der Gärtner unter den Krabbeltieren. Er frisst all die fiesen Blattläuse, die unsere Pflanzen kaputt machen wollen. Ein echter Superheld im Mini-Format!
Und wisst ihr, was noch cooler ist? Die Ohrwurm-Mamas sind super liebevoll. Sie kümmern sich um ihre Babys, was für Insekten ziemlich ungewöhnlich ist. Sie bleiben bei ihren Eiern und kleinen Ohrwürmchen und passen gut auf sie auf. Ich stelle mir vor, wie die Ohrwurm-Mama ihren Kindern Geschichten erzählt, während sie in ihrer kleinen Höhle sitzt. Vielleicht erzählt sie ihnen von den großen Abenteuern draußen im Garten.
Der Ohrwurm hat auch eine echt praktische Lebensweise. Er versteckt sich tagsüber unter Steinen, Blättern oder in der Rinde von Bäumen und kommt nachts raus, um zu fressen. So bleibt er schön sicher vor hungrigen Vögeln. Clever, oder?
Und diese Zangen, die er hinten dran hat, sind nicht nur zur Show. Die benutzt er, um sich zu verteidigen und auch, um Beute zu fangen. Ein bisschen wie ein Superheld mit eingebauten Werkzeugen! Aber keine Sorge, er benutzt sie nicht gegen uns. Wir Menschen sind ihm ziemlich egal.
Also, wenn ihr das nächste Mal einen Ohrwurm im Garten seht, denkt daran, wie fleißig und nützlich er ist. Er hilft den Pflanzen und kümmert sich rührend um seine Familie. Vielleicht könnt ihr ihm sogar einen kleinen Unterschlupf bauen, wo er sich tagsüber verstecken kann. Dann habt ihr euren ganz persönlichen Garten-Superhelden immer in der Nähe. Cool, oder?
Aufnahme von Klaus Sanwald
Der Ohrwurm hat diesen besonderen Namen, weil die Leute früher geglaubt haben, dass er nachts in die Ohren krabbelt. Aber eigentlich interessiert er sich viel mehr für Blätter und kleine Insekten. Er ist also eher der Gärtner unter den Krabbeltieren. Er frisst all die fiesen Blattläuse, die unsere Pflanzen kaputt machen wollen. Ein echter Superheld im Mini-Format!
Und wisst ihr, was noch cooler ist? Die Ohrwurm-Mamas sind super liebevoll. Sie kümmern sich um ihre Babys, was für Insekten ziemlich ungewöhnlich ist. Sie bleiben bei ihren Eiern und kleinen Ohrwürmchen und passen gut auf sie auf. Ich stelle mir vor, wie die Ohrwurm-Mama ihren Kindern Geschichten erzählt, während sie in ihrer kleinen Höhle sitzt. Vielleicht erzählt sie ihnen von den großen Abenteuern draußen im Garten.
Der Ohrwurm hat auch eine echt praktische Lebensweise. Er versteckt sich tagsüber unter Steinen, Blättern oder in der Rinde von Bäumen und kommt nachts raus, um zu fressen. So bleibt er schön sicher vor hungrigen Vögeln. Clever, oder?
Und diese Zangen, die er hinten dran hat, sind nicht nur zur Show. Die benutzt er, um sich zu verteidigen und auch, um Beute zu fangen. Ein bisschen wie ein Superheld mit eingebauten Werkzeugen! Aber keine Sorge, er benutzt sie nicht gegen uns. Wir Menschen sind ihm ziemlich egal.
Also, wenn ihr das nächste Mal einen Ohrwurm im Garten seht, denkt daran, wie fleißig und nützlich er ist. Er hilft den Pflanzen und kümmert sich rührend um seine Familie. Vielleicht könnt ihr ihm sogar einen kleinen Unterschlupf bauen, wo er sich tagsüber verstecken kann. Dann habt ihr euren ganz persönlichen Garten-Superhelden immer in der Nähe. Cool, oder?
Aufnahme von Klaus Sanwald
- Gemeiner Ohrwurm (Forficula auricularia)
Artenschutz in Franken®
Junge Fledermaus gefunden ... und jetzt?

Junge Fledermaus gefunden ... und jetzt?
30.06/01.07.2024
Hier sind einige Schritte, die du unternehmen kannst:
30.06/01.07.2024
- Wenn du ein Fledermausjungtier am Boden findest, ist es wichtig, vorsichtig und bedacht vorzugehen.
Hier sind einige Schritte, die du unternehmen kannst:
- Ruhe bewahren: Annäherung sollte ruhig und langsam erfolgen, um das Tier nicht zusätzlich zu stressen.
- Bisssichere Handschuhe ( Kunststoffhandschuhe reichen hier vielfach nicht) tragen: Fledermäuse können Krankheiten wie Tollwut übertragen. Es ist wichtig, immer Handschuhe zu tragen, wenn du eine Fledermaus anfasst. Im Idealfall fasst Du diese jedoch erst gar nicht an!
- Beobachten: Prüfe, ob die Fledermaus verletzt ist oder ob es eine erwachsene Fledermaus in der Nähe gibt, die sich um das Junge kümmern könnte. Manchmal sind Jungtiere nur kurzzeitig aus dem Quartier gefallen und können von den Elterntieren zurückgeholt werden.
- Eingreifen nur wenn nötig: Wenn die Fledermaus verletzt ist oder sich in einer gefährlichen Situation befindet (z. B. auf einer stark befahrenen Straße), solltest du eingreifen.
- Transportbehälter vorbereiten: Bereite eine kleine Schachtel mit Lüftungslöchern vor. Lege ein weiches Tuch oder Küchenpapier hinein, damit die Fledermaus eine gemütliche Umgebung hat.
Vorsichtig aufnehmen: Hebe die Fledermaus vorsichtig (stabile Handschuhe tragen und nicht direkt mit dem Tier in Kontakt kommen) auf und lege sie in die vorbereitete Schachtel.
- Kontaktaufnahme mit Experten: Kontaktiere sofort eine lokale Wildtierstation, einen Fledermaus-Experten oder einen Tierarzt. Diese Fachleute können das Tier untersuchen und entscheiden, wie weiter vorzugehen ist. Sie haben die nötige Erfahrung und das Wissen, um sich richtig um das Jungtier zu kümmern.
- Kein Futter oder Wasser geben: Versuche nicht, die Fledermaus zu füttern oder ihr Wasser zu geben. Eine falsche Fütterung kann mehr Schaden anrichten als helfen.
- Quartier in der Nähe finden: Falls bekannt, wo das Quartier der Fledermäuse ist, und wenn das Jungtier unverletzt ist, kannst du versuchen, es in der Nähe des Quartiers an einen sicheren Ort zu setzen. Die Elterntiere könnten es dann zurückholen.
Die Hauptregel ist, dass das Wohl der Fledermaus an erster Stelle steht. Durch das richtige Verhalten und die Kontaktaufnahme mit Experten kannst du sicherstellen, dass das Jungtier die bestmögliche Chance hat, zu überleben und wieder in die Freiheit entlassen zu werden.
In der Aufnahme
- Aufgenommenes Jungtiere in Transportbox - vor der Weitergabe an den Fledermausexperten
Artenschutz in Franken®
Zweifleck-Waldrandschwebfliege (Pipiza noctiluca)

Zweifleck-Waldrandschwebfliege (Pipiza noctiluca)
29/30.06.2024
Mein Lebensraum und meine Lebensweise sind nachhaltig, da ich eng mit Wald- und Waldrandgebieten verbunden bin. Diese Gebiete bieten nicht nur Nahrung, sondern auch Schutz und Lebensgrundlage für viele andere Arten, einschließlich Menschen.
29/30.06.2024
- Als Zweifleck-Waldrandschwebfliege, Pipiza noctiluca, stehe ich für Innovation in der Natur.
Mein Lebensraum und meine Lebensweise sind nachhaltig, da ich eng mit Wald- und Waldrandgebieten verbunden bin. Diese Gebiete bieten nicht nur Nahrung, sondern auch Schutz und Lebensgrundlage für viele andere Arten, einschließlich Menschen.
Innovativ bin ich in meiner Rolle als Bestäuberin und als Indikator für die Gesundheit von Ökosystemen. Meine Fähigkeit, Pollen zu transportieren und dabei zur Bestäubung von Pflanzen beizutragen, unterstützt die Biodiversität und die Produktion von Nahrungsmitteln. Durch meine Präsenz trage ich zur Erhaltung der natürlichen Vielfalt bei und sichere damit auch die ökologischen Dienstleistungen, die der Menschheit zugutekommen.
Nachhaltigkeit bedeutet für mich, dass ich im Einklang mit meiner Umwelt lebe und dabei ihre Ressourcen nicht übernutze. Mein Lebenszyklus und meine Bedürfnisse sind Teil eines größeren ökologischen Gleichgewichts, das Generationen nach uns erhalten und nutzen können. Indem ich die ökologische Gesundheit fördere und natürliche Lebensräume unterstütze, trage ich dazu bei, dass auch kommende Generationen von der Schönheit und Funktionalität intakter Ökosysteme profitieren können.
Zusammengefasst repräsentiere ich als Zweifleck-Waldrandschwebfliege ein Modell der Nachhaltigkeit und Innovation, das darauf abzielt, unsere natürlichen Ressourcen zu bewahren und zu schützen, damit sie auch in Zukunft weiterhin genutzt werden können.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch am 26.06.2024
Nachhaltigkeit bedeutet für mich, dass ich im Einklang mit meiner Umwelt lebe und dabei ihre Ressourcen nicht übernutze. Mein Lebenszyklus und meine Bedürfnisse sind Teil eines größeren ökologischen Gleichgewichts, das Generationen nach uns erhalten und nutzen können. Indem ich die ökologische Gesundheit fördere und natürliche Lebensräume unterstütze, trage ich dazu bei, dass auch kommende Generationen von der Schönheit und Funktionalität intakter Ökosysteme profitieren können.
Zusammengefasst repräsentiere ich als Zweifleck-Waldrandschwebfliege ein Modell der Nachhaltigkeit und Innovation, das darauf abzielt, unsere natürlichen Ressourcen zu bewahren und zu schützen, damit sie auch in Zukunft weiterhin genutzt werden können.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch am 26.06.2024
- Zweifleck-Waldrandschwebfliege (Pipiza noctiluca)
Artenschutz in Franken®
Die Gelbe Raubfliege (Laphria flava)

Gelbe Raubfliege (Laphria flava)
29/30.06.2024
Mein Verhalten und meine Lebensweise spiegeln diese Prinzipien auf vielfältige Weise wider.
29/30.06.2024
- Als Gelbe Raubfliege (Laphria flava) betrachte ich die Welt aus einer Perspektive, die geprägt ist von Innovation, Nachhaltigkeit und Verantwortung gegenüber zukünftigen Generationen.
Mein Verhalten und meine Lebensweise spiegeln diese Prinzipien auf vielfältige Weise wider.
Innovativ ist mein Jagdverhalten. Ich nutze meine scharfen Augen und meine Fähigkeit, schnell zu fliegen, um andere Insekten effizient zu erbeuten. Mein Körper ist so gestaltet, dass ich meine Beute in der Luft fangen und sofort lähmen kann. Diese Methode ist nicht nur effektiv, sondern auch eine bemerkenswerte Anpassung, die mir ermöglicht, in verschiedenen Umgebungen erfolgreich zu jagen.
Nachhaltigkeit zeigt sich in meiner Rolle im Ökosystem. Als Raubfliege trage ich zur Kontrolle der Populationen anderer Insekten bei. Indem ich verschiedene Insektenarten als Nahrung nutze, helfe ich, das Gleichgewicht im Ökosystem zu erhalten. Dies verhindert Überpopulationen und unterstützt die Gesundheit und Vielfalt der Lebensgemeinschaften, in denen ich lebe.
Im Sinne nachfolgender Generationen ist mein Fortpflanzungsverhalten entscheidend. Ich lege meine Eier in morschem Holz oder in Böden, wo meine Larven leicht Nahrung finden können. Diese Strategie stellt sicher, dass meine Nachkommen in einer Umgebung schlüpfen, die reich an Ressourcen ist. Die Larven entwickeln sich langsam und tragen durch ihre Nahrungsaufnahme zur Zersetzung von organischem Material bei, was wiederum den Nährstoffkreislauf fördert.
Zusammengefasst zeigt die Gelbe Raubfliege, wie innovative Jagdtechniken, nachhaltige ökologische Rollen und vorausschauende Fortpflanzungsstrategien Hand in Hand gehen können. Mein Verhalten und meine Lebensweise sind darauf ausgerichtet, effizient zu überleben, das ökologische Gleichgewicht zu unterstützen und die Fortpflanzung meiner Art zu sichern. So trage ich dazu bei, dass auch zukünftige Generationen eine stabile und gesunde Umwelt vorfinden.
Aufnahme von Bernhard Schmalisch am 20.06.2024
Nachhaltigkeit zeigt sich in meiner Rolle im Ökosystem. Als Raubfliege trage ich zur Kontrolle der Populationen anderer Insekten bei. Indem ich verschiedene Insektenarten als Nahrung nutze, helfe ich, das Gleichgewicht im Ökosystem zu erhalten. Dies verhindert Überpopulationen und unterstützt die Gesundheit und Vielfalt der Lebensgemeinschaften, in denen ich lebe.
Im Sinne nachfolgender Generationen ist mein Fortpflanzungsverhalten entscheidend. Ich lege meine Eier in morschem Holz oder in Böden, wo meine Larven leicht Nahrung finden können. Diese Strategie stellt sicher, dass meine Nachkommen in einer Umgebung schlüpfen, die reich an Ressourcen ist. Die Larven entwickeln sich langsam und tragen durch ihre Nahrungsaufnahme zur Zersetzung von organischem Material bei, was wiederum den Nährstoffkreislauf fördert.
Zusammengefasst zeigt die Gelbe Raubfliege, wie innovative Jagdtechniken, nachhaltige ökologische Rollen und vorausschauende Fortpflanzungsstrategien Hand in Hand gehen können. Mein Verhalten und meine Lebensweise sind darauf ausgerichtet, effizient zu überleben, das ökologische Gleichgewicht zu unterstützen und die Fortpflanzung meiner Art zu sichern. So trage ich dazu bei, dass auch zukünftige Generationen eine stabile und gesunde Umwelt vorfinden.
Aufnahme von Bernhard Schmalisch am 20.06.2024
- Gelbe Raubfliege (Laphria flava)
Artenschutz in Franken®
Sie ist wieder da: die Bayerische Kurzohrmaus

Sie ist wieder da: die Bayerische Kurzohrmaus
29/30.06.2024
60 Jahre lang war sie verschollen, im vergangenen Jahr wurde sie nach aufwändiger Suche bei Mittenwald wiederentdeckt: „Microtus bavaricus“, die Bayerische Kurzohrmaus. Nun soll ihr Erhalt gesichert werden, denn sie ist eine der am gefährdetsten Säugetierarten Europas.
Nach aktuellem Stand des Wissens lebt sie nur im Bayerisch-Tiroler-Grenzraum. „Das ist eine echte Sensation. Ich freue mich sehr, dass die Kurzohrmaus in Bayern wiederentdeckt worden ist. Wir wollen, dass die Kurzohrmaus in Bayern wieder heimisch wird. Der Freistaat startet für die Bayerische Kurzohrmaus ein Artenhilfsprogramm. Mit dem Artenhilfsprogramm geben wir diesem kleinen Tier eine starke Rückendeckung“, so Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber.
29/30.06.2024
- Umfassende Maßnahmen zum Erhalt des seltensten Säugetiers Bayerns gestartet
60 Jahre lang war sie verschollen, im vergangenen Jahr wurde sie nach aufwändiger Suche bei Mittenwald wiederentdeckt: „Microtus bavaricus“, die Bayerische Kurzohrmaus. Nun soll ihr Erhalt gesichert werden, denn sie ist eine der am gefährdetsten Säugetierarten Europas.
Nach aktuellem Stand des Wissens lebt sie nur im Bayerisch-Tiroler-Grenzraum. „Das ist eine echte Sensation. Ich freue mich sehr, dass die Kurzohrmaus in Bayern wiederentdeckt worden ist. Wir wollen, dass die Kurzohrmaus in Bayern wieder heimisch wird. Der Freistaat startet für die Bayerische Kurzohrmaus ein Artenhilfsprogramm. Mit dem Artenhilfsprogramm geben wir diesem kleinen Tier eine starke Rückendeckung“, so Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber.
Bis 2025 sind 120.000 Euro vorgesehen, um die speziellen Lebensraumanforderungen der Art zu erfassen. Danach starten konkrete Pflegemaßnahmen zur Lebensraumaufwertung. Kooperationspartner im Artenhilfsprogramm des Bayerischen Landesamtes für Umwelt sind die Bayerischen Staatsforsten und der Alpenzoo in Innsbruck.
Im vergangenen Herbst war es so weit: die kleine und verschollen geglaubte Wühlmausart wurde zunächst auf einem Wildkamerafoto gesichtet. Anschließend gelang es, sie lebend zu fangen und genetisch zu identifizieren. Die Sensation war perfekt – die seltene Bayerische Kurzohrmaus wurde in der Nähe von Mittenwald am Fuße des Wettersteingebirges wiederentdeckt. Seit 2011 stellte das Bayerische Landesamt für Umwelt (LfU) intensive Nachforschungen in der gesamten Region an, die nun in der Nähe des Lautersees von Erfolg gekrönt wurden. „Damit ist die Art jedoch noch lange nicht gerettet, die schwierigsten Teil haben wir noch vor uns!“ sagt Dr. Christian Mikulla, Präsident des LfU.
Der Aufgabe, die Art dauerhaft zu erhalten, stellt sich nun ein interdisziplinäres Team. Im Dreiklang aus Umweltschutzbehörde, Landnutzer und Forschung sollen gezielte Schutzmaßnahmen entwickelt und umgesetzt werden. Zum „Startschuss“ des Artenhilfsprogramms (AHP) „Bayerische Kurzohrmaus“ trafen sich Vertreter des LfU, der Bayerischen Staatsforsten und des Innsbrucker Alpenzoos am Ort der Wiederentdeckung. Mit dabei waren auch Sachverständige, die für die „Fahndung“ nach der Maus beauftragt waren sowie das Ehepaar Ingrid und Claus König, die vor mehr als 60 Jahren die Art zum ersten Mal beschrieben haben.
Im Lebensraum der Kurzohrmaus werden nun weitere Untersuchungen mittels Wildkamera und Lebendfängen folgen, um das lokale Verbreitungsgebiet und die Lebensraumansprüche genauer zu verstehen. LfU Experte Dr. Simon Ripperger erklärt: „Anhand der bisherigen Nachweise erhärtet sich der Eindruck, dass die Maus lichte Schneeheide-Kiefernwälder bevorzugt.“. Lichte Wälder sind nicht nur wichtig für die Bayerische Kurzohrmaus, sie bieten Lebensraum für viele geschützte „Waldarten“, wie Waldameisen, Grün- und Grauspecht. Mit der richtigen Pflege lassen sich solche Strukturen wiederherstellen und langfristig erhalten. Martin Echter von den Bayerischen Staatsforsten führt dazu aus: „Die Lebensraumansprüche wertgebender Arten berücksichtigen wir bei der Waldbewirtschaftung. Durch die behutsame Auflichtung von Kiefern- und Fichtenbeständen schaffen wir hier ideale Bedingungen für die Bayerische Kurzohrmaus und andere Arten lichter Wälder.“. Nach der Lebensraumaufwertung wird das LfU prüfen, ob tatsächlich Kurzohrmäuse in die neu geschaffenen Habitate eingewandert sind. Diese Erfolgskontrolle ist wichtiger Teil der Maßnahmen. Bei der Wiederbesiedelung könnte auch nachgeholfen werden: Dr. André Stadler, Direktor des Alpenzoos Innsbruck leitet seit einigen Jahren eine erfolgreiche Nachzucht der bedrohten Nager. Die dort gezüchteten Tiere könnten im Rahmen von Auswilderungsprojekten die bayerischen Populationen stützen und so helfen, den Fortbestand zu sichern. „Die Reservepopulation der Kurzohrmäuse in den Zoos entwickelt sich weiterhin erfreulich gut, so dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist größer zu denken! Wenn die Situation es erfordert, steht der Alpenzoo als Partner bereit und kann helfen", so Stadler.
Weitere Informationen zur Bayerischen Kurzohrmaus:
In der Aufnahme von Quelle: David Stille, Stille NATUR
Quelle
Bayerisches Landesamt für Umwelt
Bürgermeister-Ulrich-Straße 160
86179 Augsburg
Stand
13.06.2024
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung.Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Im vergangenen Herbst war es so weit: die kleine und verschollen geglaubte Wühlmausart wurde zunächst auf einem Wildkamerafoto gesichtet. Anschließend gelang es, sie lebend zu fangen und genetisch zu identifizieren. Die Sensation war perfekt – die seltene Bayerische Kurzohrmaus wurde in der Nähe von Mittenwald am Fuße des Wettersteingebirges wiederentdeckt. Seit 2011 stellte das Bayerische Landesamt für Umwelt (LfU) intensive Nachforschungen in der gesamten Region an, die nun in der Nähe des Lautersees von Erfolg gekrönt wurden. „Damit ist die Art jedoch noch lange nicht gerettet, die schwierigsten Teil haben wir noch vor uns!“ sagt Dr. Christian Mikulla, Präsident des LfU.
Der Aufgabe, die Art dauerhaft zu erhalten, stellt sich nun ein interdisziplinäres Team. Im Dreiklang aus Umweltschutzbehörde, Landnutzer und Forschung sollen gezielte Schutzmaßnahmen entwickelt und umgesetzt werden. Zum „Startschuss“ des Artenhilfsprogramms (AHP) „Bayerische Kurzohrmaus“ trafen sich Vertreter des LfU, der Bayerischen Staatsforsten und des Innsbrucker Alpenzoos am Ort der Wiederentdeckung. Mit dabei waren auch Sachverständige, die für die „Fahndung“ nach der Maus beauftragt waren sowie das Ehepaar Ingrid und Claus König, die vor mehr als 60 Jahren die Art zum ersten Mal beschrieben haben.
Im Lebensraum der Kurzohrmaus werden nun weitere Untersuchungen mittels Wildkamera und Lebendfängen folgen, um das lokale Verbreitungsgebiet und die Lebensraumansprüche genauer zu verstehen. LfU Experte Dr. Simon Ripperger erklärt: „Anhand der bisherigen Nachweise erhärtet sich der Eindruck, dass die Maus lichte Schneeheide-Kiefernwälder bevorzugt.“. Lichte Wälder sind nicht nur wichtig für die Bayerische Kurzohrmaus, sie bieten Lebensraum für viele geschützte „Waldarten“, wie Waldameisen, Grün- und Grauspecht. Mit der richtigen Pflege lassen sich solche Strukturen wiederherstellen und langfristig erhalten. Martin Echter von den Bayerischen Staatsforsten führt dazu aus: „Die Lebensraumansprüche wertgebender Arten berücksichtigen wir bei der Waldbewirtschaftung. Durch die behutsame Auflichtung von Kiefern- und Fichtenbeständen schaffen wir hier ideale Bedingungen für die Bayerische Kurzohrmaus und andere Arten lichter Wälder.“. Nach der Lebensraumaufwertung wird das LfU prüfen, ob tatsächlich Kurzohrmäuse in die neu geschaffenen Habitate eingewandert sind. Diese Erfolgskontrolle ist wichtiger Teil der Maßnahmen. Bei der Wiederbesiedelung könnte auch nachgeholfen werden: Dr. André Stadler, Direktor des Alpenzoos Innsbruck leitet seit einigen Jahren eine erfolgreiche Nachzucht der bedrohten Nager. Die dort gezüchteten Tiere könnten im Rahmen von Auswilderungsprojekten die bayerischen Populationen stützen und so helfen, den Fortbestand zu sichern. „Die Reservepopulation der Kurzohrmäuse in den Zoos entwickelt sich weiterhin erfreulich gut, so dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist größer zu denken! Wenn die Situation es erfordert, steht der Alpenzoo als Partner bereit und kann helfen", so Stadler.
Weitere Informationen zur Bayerischen Kurzohrmaus:
- www.lfu.bayern.de/natur/kleinsaeuger/untersuchungen/kurzohrmaus/
In der Aufnahme von Quelle: David Stille, Stille NATUR
- In einer Lebendfalle gefangenes Exemplar der Bayerischen Kurzohrmaus (Microtus bavaricus)
Quelle
Bayerisches Landesamt für Umwelt
Bürgermeister-Ulrich-Straße 160
86179 Augsburg
Stand
13.06.2024
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung.Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Artenschutz in Franken®
Die Beerenblattzikade (Ribautiana tenerrima)

Hey, Kinder!
28/29.06.2024
Das könnte die Beerenblattzikade, oder wie die Wissenschaftler sie nennen, Empoasca vitis sein!
28/29.06.2024
- Habt ihr schon einmal eine winzige Kreatur gesehen, die wie ein Miniflieger von Blatt zu Blatt springt?
Das könnte die Beerenblattzikade, oder wie die Wissenschaftler sie nennen, Empoasca vitis sein!
Vorstellung der Beerenblattzikade:
Die Beerenblattzikade ist ein kleines Insekt, das etwa so groß wie ein Reiskorn ist. Sie hat einen weiß-grünen Körper, der sie fast unsichtbar zwischen den Blättern macht. Sie sieht aus wie ein kleiner, grüner Akrobat, der immer bereit ist für ein neues Abenteuer.
Fachbegriffe zum "Angeben":
- Nymphe: So nennt man die jungen Zikaden, bevor sie erwachsen werden. Sie sehen aus wie Mini-Versionen der Erwachsenen, aber ohne Flügel. Sie durchlaufen mehrere Häutungen, bei denen sie ihre alte Haut abstreifen, um zu wachsen.
- Stilett: Das ist das scharfe Mundwerkzeug der Zikade, mit dem sie Pflanzensaft aus den Blättern saugt. Es ist wie ein kleiner Trinkhalm, den sie in das Blatt steckt.
- Phloem: Das ist das saftige Gewebe in den Blättern, das die Zikade am liebsten mag. Es ist voll von Nährstoffen, die sie zum Wachsen braucht.
Superkräfte der Beerenblattzikade:
- Der Superspringer: Die Beerenblattzikade kann unglaublich weit springen. Wenn sie sich bedroht fühlt, springt sie mit ihren kräftigen Hinterbeinen blitzschnell davon. Sie ist der König des Weitsprungs in der Insektenwelt!
- Unsichtbarer Räuber: Dank ihrer grün-weißen Farbe kann sie sich perfekt zwischen den Blättern verstecken. Feinde wie Vögel und Spinnen haben es schwer, sie zu entdecken. Sie ist wie ein Tarnkünstler in der Natur.
- Der Saftschlürfer: Mit ihrem Stilett bohrt sie sich in die Blätter und schlürft den süßen Pflanzensaft. Aber Vorsicht: Wenn zu viele Zikaden an einer Pflanze saugen, kann die Pflanze krank werden. Die Blätter können gelb werden und abfallen.
Warum die Beerenblattzikade wichtig ist:
Auch wenn sie manchmal den Pflanzen schadet, gehört die Beerenblattzikade zum natürlichen Gleichgewicht im Garten. Sie ist Nahrung für viele andere Tiere, wie Vögel und Spinnen, und hilft so, das Ökosystem im Gleichgewicht zu halten.
Also, das nächste Mal, wenn ihr eine winzige, grüne Kreatur auf einem Blatt seht, wisst ihr, dass es die Beerenblattzikade sein könnte. Sie ist ein faszinierendes kleines Wesen mit vielen tollen Fähigkeiten und einem wichtigen Platz in der Natur!
P.S. Haltet eure Augen offen und vielleicht entdeckt ihr ja die nächste Nymphe, die sich gerade häutet und zum Erwachsenen wird!
Artenschutz in Franken®
Graue Fleischfliege (Sarcophaga carnaria)

Graue Fleischfliege
28/29.06.2024
Meine Lebensweise ist geprägt von Strategien, die sicherstellen, dass meine Art effizient und ressourcenschonend überlebt und gedeiht.
28/29.06.2024
- Als Graue Fleischfliege (Sarcophaga carnaria) sehe ich die Welt durch die Linse der Innovation, Nachhaltigkeit und Verantwortung gegenüber zukünftigen Generationen.
Meine Lebensweise ist geprägt von Strategien, die sicherstellen, dass meine Art effizient und ressourcenschonend überlebt und gedeiht.
Innovativ ist mein Verhalten insbesondere bei der Wahl meiner Fortpflanzungsstrategien. Ich lege meine Eier auf Aas oder in Wunden lebender Tiere. Diese Praxis stellt sicher, dass meine Larven sofort eine Nahrungsquelle haben, wenn sie schlüpfen. Diese Methode maximiert die Überlebensrate meiner Nachkommen und zeigt eine intelligente Nutzung vorhandener Ressourcen.
Nachhaltigkeit zeigt sich in meiner Rolle im Ökosystem. Indem ich Aas konsumiere, trage ich zur Zersetzung und Nährstoffrecycling bei. Meine Aktivitäten helfen, organisches Material abzubauen und die Umwelt sauber zu halten. Dies unterstützt die ökologische Balance und verhindert die Ausbreitung von Krankheiten, was für die Gesundheit des gesamten Ökosystems entscheidend ist.
Im Sinne nachfolgender Generationen ist mein Fortpflanzungsverhalten darauf ausgelegt, die kontinuierliche Präsenz meiner Art zu sichern. Ich lege eine große Anzahl von Eiern, um sicherzustellen, dass genügend Nachkommen das Erwachsenenalter erreichen. Durch diese hohe Reproduktionsrate trage ich zur genetischen Vielfalt bei, was die Resilienz meiner Population gegenüber Umweltveränderungen stärkt.
Zusammengefasst zeigt die Graue Fleischfliege, wie Innovation und Nachhaltigkeit in der Natur Hand in Hand gehen. Mein Verhalten und meine Lebensweise sind darauf ausgerichtet, effizient Ressourcen zu nutzen, das Ökosystem zu unterstützen und die Fortpflanzung meiner Art zu sichern. So trage ich aktiv dazu bei, dass auch zukünftige Generationen eine stabile und gesunde Umwelt vorfinden.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
Nachhaltigkeit zeigt sich in meiner Rolle im Ökosystem. Indem ich Aas konsumiere, trage ich zur Zersetzung und Nährstoffrecycling bei. Meine Aktivitäten helfen, organisches Material abzubauen und die Umwelt sauber zu halten. Dies unterstützt die ökologische Balance und verhindert die Ausbreitung von Krankheiten, was für die Gesundheit des gesamten Ökosystems entscheidend ist.
Im Sinne nachfolgender Generationen ist mein Fortpflanzungsverhalten darauf ausgelegt, die kontinuierliche Präsenz meiner Art zu sichern. Ich lege eine große Anzahl von Eiern, um sicherzustellen, dass genügend Nachkommen das Erwachsenenalter erreichen. Durch diese hohe Reproduktionsrate trage ich zur genetischen Vielfalt bei, was die Resilienz meiner Population gegenüber Umweltveränderungen stärkt.
Zusammengefasst zeigt die Graue Fleischfliege, wie Innovation und Nachhaltigkeit in der Natur Hand in Hand gehen. Mein Verhalten und meine Lebensweise sind darauf ausgerichtet, effizient Ressourcen zu nutzen, das Ökosystem zu unterstützen und die Fortpflanzung meiner Art zu sichern. So trage ich aktiv dazu bei, dass auch zukünftige Generationen eine stabile und gesunde Umwelt vorfinden.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- Graue Fleischfliege - Weibchen
Artenschutz in Franken®
Parasitäre Belastung bei Fledermäusen - hier Zwergfledermaus

Parasitäre Belastung bei Fledermäusen - hier Zwergfledermaus
28/29.06.2024
Sie hat eine Spannweite von etwa 18 bis 25 Zentimetern und wiegt nur 3,5 bis 8,5 Gramm. Ihr Fell ist dunkelbraun bis rotbraun, und sie hat ein kleines, rundes Gesicht mit kurzen, breiten Ohren. Zwergfledermäuse sind dämmerungs- und nachtaktiv und jagen vor allem kleine Insekten wie Mücken, die sie im Flug fangen.
Sie nutzen Echoortung, um sich in der Dunkelheit zu orientieren und Beute zu finden. Ihre Rufe sind für Menschen oft nicht hörbar.Diese Fledermäuse leben in verschiedenen Lebensräumen, darunter Wälder, Gärten und sogar städtische Gebiete. Tagsüber verstecken sie sich in Spalten von Gebäuden, Baumhöhlen oder unter Rinde. Im Winter halten sie Winterschlaf an frostfreien Orten wie Kellern oder Höhlen.
28/29.06.2024
- Die Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) ist eine der kleinsten Fledermausarten in Europa.
Sie hat eine Spannweite von etwa 18 bis 25 Zentimetern und wiegt nur 3,5 bis 8,5 Gramm. Ihr Fell ist dunkelbraun bis rotbraun, und sie hat ein kleines, rundes Gesicht mit kurzen, breiten Ohren. Zwergfledermäuse sind dämmerungs- und nachtaktiv und jagen vor allem kleine Insekten wie Mücken, die sie im Flug fangen.
Sie nutzen Echoortung, um sich in der Dunkelheit zu orientieren und Beute zu finden. Ihre Rufe sind für Menschen oft nicht hörbar.Diese Fledermäuse leben in verschiedenen Lebensräumen, darunter Wälder, Gärten und sogar städtische Gebiete. Tagsüber verstecken sie sich in Spalten von Gebäuden, Baumhöhlen oder unter Rinde. Im Winter halten sie Winterschlaf an frostfreien Orten wie Kellern oder Höhlen.
4kids ... Stell dir vor, Fledermäuse sind wie deine Haustiere, die draußen im Garten leben. Sie sind sehr hilfreich, weil sie viele Insekten essen, die uns manchmal stören können. Manchmal bekommen diese Fledermäuse kleine Tierchen auf ihrem Körper, die Parasiten genannt werden. Diese Parasiten können den Fledermäusen viel Ärger machen. Sie beißen und saugen das Blut der Fledermäuse, was ihnen wehtut und sie schwächt. Wenn eine Fledermaus zu viele Parasiten hat, kann das sehr gefährlich für sie sein.
Es ist so, als ob jemand dich die ganze Zeit kitzelt oder beißt – das würde dich auch krank und müde machen, oder? Genauso geht es den Fledermäusen.Wenn die Fledermäuse zu schwach werden, können sie nicht mehr genug essen oder sich gut ausruhen. Das macht sie dann sehr krank und sie können sogar sterben. Deshalb ist es wichtig, dass wir versuchen, ihnen zu helfen und sicherzustellen, dass sie nicht zu viele Parasiten haben.
4kids ... Stell dir vor,Fledermäuse haben kleine Tierchen auf ihrem Körper, die Parasiten genannt werden. Diese Parasiten sind wie winzige Blutsauger. Sie beißen die Fledermäuse und trinken ihr Blut, ähnlich wie Mücken Menschen stechen.
Wenn eine Fledermaus nur ein paar Parasiten hat, ist das normalerweise kein großes Problem. Aber wenn sie sehr viele Parasiten hat, kann das wirklich schlimm werden.
Hier sind einige Gründe, warum eine hohe parasitäre Belastung für Fledermäuse so gefährlich ist:
- Blutverlust: Viele Parasiten saugen viel Blut. Wenn die Fledermaus zu viel Blut verliert, wird sie schwach und krank, weil ihr Körper nicht genug Energie bekommt.
- Infektionen: Die Bisse der Parasiten können Wunden hinterlassen, die sich entzünden oder infizieren können. Das macht die Fledermaus noch kränker.
- Stress und Schwäche: Ständig von Parasiten gebissen zu werden, ist sehr unangenehm und stressig für die Fledermaus. Das schwächt ihr Immunsystem, also die Abwehrkräfte des Körpers, und sie wird anfälliger für andere Krankheiten.
- Energieverlust: Eine geschwächte Fledermaus hat weniger Energie, um nach Futter zu suchen und sich um sich selbst zu kümmern. Das kann dazu führen, dass sie nicht genug Nahrung findet und noch schwächer wird.
Zusammengefasst: Wenn eine Fledermaus zu viele Parasiten hat, verliert sie Blut, bekommt Infektionen, wird gestresst und schwach, und hat weniger Energie. All das zusammen kann so schlimm werden, dass die Fledermaus schließlich stirbt.
4kids ... Stell dir vor, du findest eine verletzte oder tote Fledermaus auf dem Boden. Es könnte spannend sein, sie genauer anzuschauen, aber es ist sehr wichtig, sie nicht anzufassen.
Fledermäuse können manchmal Krankheiten haben, die auf Menschen übergehen können. Das heißt, wenn du sie berührst, könntest du krank werden. Eine dieser Krankheiten ist Tollwut, und die ist sehr gefährlich.Außerdem können verletzte Fledermäuse Angst haben und beißen, um sich zu verteidigen, selbst wenn sie normalerweise nicht gefährlich sind.
Deshalb ist es besser, einem Erwachsenen Bescheid zu sagen, wenn du eine verletzte oder tote Fledermaus findest. Erwachsene wissen, wie sie die Fledermaus sicher behandeln oder wen sie anrufen können, um zu helfen. So bleibst du sicher und die Fledermaus bekommt die richtige Hilfe.
In der Aufnahme von S. Kundmüller
- Diese adulte Fledermaus (Männchen) wurde am 18.06.2024 am Boden liegend und noch lebend bei Temperaturen um 30 Grad vorgefunden. Die Erstversorgung mit Flüssigkeit konnte dem bereits sehr geschwächten Tier nicht mehr helfen. Es verstarb kurz darauf und so nahmen wie zumindest noch die Daten des Tieres ab.
Artenschutz in Franken®
Gewöhnliche Langbauchschwebfliege (Sphaerophoria scripta)

Gewöhnliche Langbauchschwebfliege (Sphaerophoria scripta)
27/28.06.2024
Ja, ich weiß, mein Name klingt ein bisschen lang und kompliziert, aber lasst euch nicht täuschen – ich bin eigentlich ziemlich unkompliziert!
27/28.06.2024
- Hallo! Ich bin die Gemeine oder Gewöhnliche Langbauchschwebfliege, aber ihr könnt mich ruhig "Schwebi" nennen.
Ja, ich weiß, mein Name klingt ein bisschen lang und kompliziert, aber lasst euch nicht täuschen – ich bin eigentlich ziemlich unkompliziert!
Ihr fragt euch sicher, was ich so den ganzen Tag mache. Nun, ich schwebe gerne herum, wie mein Name schon sagt. Das hat nicht nur Stil, sondern ist auch sehr praktisch. Wenn ihr jemals versucht habt, auf einer Blume zu landen, während der Wind weht, wisst ihr, wovon ich spreche. Aber ich schwebe einfach anmutig dorthin, wo ich hin will – das ist meine superkraft.
Und was mache ich, wenn ich nicht gerade schwebe? Ich bin ein großer Fan von Nektar. Leckerer, süßer Nektar. Das Beste daran? Während ich mich an den Blumen laben, bestäube ich sie auch noch. Ja, das ist eine Art "Win-Win-Situation". Die Blumen bekommen ihre Bestäubung, und ich bekomme meinen Nektar. Total innovativ, oder? Wer hätte gedacht, dass Essen so umweltfreundlich sein kann!
Aber das ist noch nicht alles! Als Larve helfe ich dabei, Blattläuse zu fressen. Ihr wisst schon, diese kleinen, nervigen Biester, die eure schönen Pflanzen zerstören. Ich bin quasi der Superheld der Gärten – klein, aber oho! Nachhaltigkeit ist mein zweiter Vorname. Durch mein ständiges Nektarschlürfen und Blattlausmampfen trage ich dazu bei, dass die Pflanzenwelt gesund bleibt. Und das alles, ohne Pestizide zu brauchen. Ganz im Sinne der nachfolgenden Generationen, versteht sich.
Also, das nächste Mal, wenn ihr eine kleine, gelb-schwarze Fliege seht, die wie eine Miniatur-Hubschrauber um die Blumen schwebt, denkt daran: Das bin ich, Schwebi, die Gemeine Langbauchschwebfliege. Immer im Einsatz für eine bessere, nachhaltigere Welt – und dabei noch ziemlich schick unterwegs!
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
Und was mache ich, wenn ich nicht gerade schwebe? Ich bin ein großer Fan von Nektar. Leckerer, süßer Nektar. Das Beste daran? Während ich mich an den Blumen laben, bestäube ich sie auch noch. Ja, das ist eine Art "Win-Win-Situation". Die Blumen bekommen ihre Bestäubung, und ich bekomme meinen Nektar. Total innovativ, oder? Wer hätte gedacht, dass Essen so umweltfreundlich sein kann!
Aber das ist noch nicht alles! Als Larve helfe ich dabei, Blattläuse zu fressen. Ihr wisst schon, diese kleinen, nervigen Biester, die eure schönen Pflanzen zerstören. Ich bin quasi der Superheld der Gärten – klein, aber oho! Nachhaltigkeit ist mein zweiter Vorname. Durch mein ständiges Nektarschlürfen und Blattlausmampfen trage ich dazu bei, dass die Pflanzenwelt gesund bleibt. Und das alles, ohne Pestizide zu brauchen. Ganz im Sinne der nachfolgenden Generationen, versteht sich.
Also, das nächste Mal, wenn ihr eine kleine, gelb-schwarze Fliege seht, die wie eine Miniatur-Hubschrauber um die Blumen schwebt, denkt daran: Das bin ich, Schwebi, die Gemeine Langbauchschwebfliege. Immer im Einsatz für eine bessere, nachhaltigere Welt – und dabei noch ziemlich schick unterwegs!
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- Gewöhnliche Langbauchschwebfliege (Sphaerophoria scripta)
Artenschutz in Franken®
Miscophus bicolor

Als Miscophus bicolor, eine Grabwespe, betrachte ich die Welt um mich herum aus einer Perspektive der Innovation, Nachhaltigkeit und der Verantwortung gegenüber zukünftigen Generationen.
27/28.06.2024
27/28.06.2024
- Meine Art hat im Laufe der Evolution ein bemerkenswertes Verhalten entwickelt, das sowohl effizient als auch ressourcenschonend ist.
Innovativ betrachtet, nutze ich meine Instinkte und Fähigkeiten, um nicht nur Nahrung zu beschaffen, sondern auch um sicherzustellen, dass die Ressourcen, die ich verwende, effektiv genutzt werden. Ich grabe meine Nester in den Boden, um meine Eier zu legen und meine Larven zu versorgen. Dieses Verhalten zeigt eine Anpassungsfähigkeit und Effizienz, die für meine Art überlebenswichtig ist.
Nachhaltigkeit ist ein zentraler Aspekt meines Verhaltens. Ich wähle meine Nistplätze sorgfältig aus und sorge dafür, dass ich keine übermäßige Belastung für die Umwelt darstelle. Indem ich natürliche Materialien wie Erde und Pflanzenreste nutze, minimiere ich meinen ökologischen Fußabdruck und trage dazu bei, dass meine Umgebung intakt bleibt.
Im Sinne kommender Generationen ist meine Lebensweise darauf ausgelegt, die Fortpflanzung meiner Art sicherzustellen und die genetische Vielfalt zu erhalten. Indem ich für meine Nachkommen sorge und sie in einer sicheren Umgebung großziehe, trage ich zur langfristigen Stabilität meiner Population bei. Dies ist ein wesentlicher Beitrag zur Gesundheit und Resilienz unseres Ökosystems.
Insgesamt betrachtet Miscophus bicolor die Welt durch die Linse der Anpassungsfähigkeit, Effizienz und Verantwortung. Unsere Art zeigt, wie Innovation und Nachhaltigkeit in der Natur Hand in Hand gehen können, um sicherzustellen, dass auch kommende Generationen die Schönheit und Funktionalität unserer Umwelt erleben können.
In der Aufnahme / Autor von Bernhard Schmalisch
Nachhaltigkeit ist ein zentraler Aspekt meines Verhaltens. Ich wähle meine Nistplätze sorgfältig aus und sorge dafür, dass ich keine übermäßige Belastung für die Umwelt darstelle. Indem ich natürliche Materialien wie Erde und Pflanzenreste nutze, minimiere ich meinen ökologischen Fußabdruck und trage dazu bei, dass meine Umgebung intakt bleibt.
Im Sinne kommender Generationen ist meine Lebensweise darauf ausgelegt, die Fortpflanzung meiner Art sicherzustellen und die genetische Vielfalt zu erhalten. Indem ich für meine Nachkommen sorge und sie in einer sicheren Umgebung großziehe, trage ich zur langfristigen Stabilität meiner Population bei. Dies ist ein wesentlicher Beitrag zur Gesundheit und Resilienz unseres Ökosystems.
Insgesamt betrachtet Miscophus bicolor die Welt durch die Linse der Anpassungsfähigkeit, Effizienz und Verantwortung. Unsere Art zeigt, wie Innovation und Nachhaltigkeit in der Natur Hand in Hand gehen können, um sicherzustellen, dass auch kommende Generationen die Schönheit und Funktionalität unserer Umwelt erleben können.
In der Aufnahme / Autor von Bernhard Schmalisch
- Diese kleine Grabwespe gräbt ihre einzelligen Nester etwa 2-5cm tief in Sand- und Lößböden ...Sie trägt etwa 7-12 kleine Spinnen verschiedener Gattungen in die Zelle als Larvenproviant ein. 4 bis 6 mm, Männchen, Weibchen in diesem Rahmen marginal größer.Bei uns ist sie selten, sie benötigt wärmere, offene Löß bis Sandböden u. fliegt von Juni bis September. Kaum Brachflächen, versiegelte Böden, ihr Lebensraum wird immer kleiner.
Artenschutz in Franken®
Die "Wilden Bienchen" von Benediktbeuern

Die "Wilden Bienchen" von Benediktbeuern
27/28.06.2024
Benediktbeuern / Bayern. Wildbienen - die unbekannten Bestäuber ... Eigentlich haben die meisten von uns in ihrem Leben schon einmal Wildbienen gesehen. Doch bewusst als solche wahrgenommen werden diese Tiere kaum. Vielfach werden sie gar mit Wespen oder Fliegen verwechselt. Und hier zeigt sich auch bereits ein elementares Problem. Aufgrund einer weitverbreiteten Unkenntnis werden „die Wildbiene“ und deren Ansprüche an ihre Lebensräume nicht erkannt.
27/28.06.2024
- Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und der Gemeinde Benediktbeuern das pädagogisch vom Gemeindekindergarten Benediktbeuern begleitet und von der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.
Benediktbeuern / Bayern. Wildbienen - die unbekannten Bestäuber ... Eigentlich haben die meisten von uns in ihrem Leben schon einmal Wildbienen gesehen. Doch bewusst als solche wahrgenommen werden diese Tiere kaum. Vielfach werden sie gar mit Wespen oder Fliegen verwechselt. Und hier zeigt sich auch bereits ein elementares Problem. Aufgrund einer weitverbreiteten Unkenntnis werden „die Wildbiene“ und deren Ansprüche an ihre Lebensräume nicht erkannt.
Wildbienen - für uns Menschen ungemein wichtig
Wir Menschen sind darauf angewiesen, dass unsere (Kultur) -Pflanzen bestäubt werden. Wildbienen spielen hierbei eine weitaus größere Rolle als bislang angenommen. Doch Wildbienen sichern nicht nur die Ernteerträge in der Landwirtschaft. Da sie häufig in enger Symbiose mit „ihrer Wildpflanze“ leben, sichern die kleinen Insekten auch das Überleben zahlloser Wildpflanzen.
In der Aufnahme vom 18.06.2024
Wir Menschen sind darauf angewiesen, dass unsere (Kultur) -Pflanzen bestäubt werden. Wildbienen spielen hierbei eine weitaus größere Rolle als bislang angenommen. Doch Wildbienen sichern nicht nur die Ernteerträge in der Landwirtschaft. Da sie häufig in enger Symbiose mit „ihrer Wildpflanze“ leben, sichern die kleinen Insekten auch das Überleben zahlloser Wildpflanzen.
In der Aufnahme vom 18.06.2024
- ... von den Sicherungsstreben befreit zeite sich die Wildbienenstation am 18.06.2024 ...
Artenschutz in Franken®
Große Schwebfliege / Gemeine Garten-Schwebfliege (Syrphus ribesii)

Hallo, ich bin die Große Schwebfliege oder Gemeine Garten-Schwebfliege, wissenschaftlich bekannt als Syrphus ribesii.
26/27.06.2024
26/27.06.2024
- Lass mich dir erzählen, wie ich mein Leben gestalte und dabei innovativ, nachhaltig und im Sinne unserer nachfolgenden Generationen lebe.
Innovativ: In meiner Welt habe ich einige erstaunliche Fähigkeiten entwickelt. Zum Beispiel sehe ich aus wie eine Wespe, obwohl ich eigentlich harmlos bin. Diese Mimikry ist eine innovative Strategie, die mich vor Fressfeinden schützt, weil viele Tiere denken, dass ich stechen kann und mich deshalb in Ruhe lassen.
Nachhaltig: Mein Lebensstil ist darauf ausgerichtet, im Einklang mit der Natur zu leben. Als erwachsene Schwebfliege ernähre ich mich von Nektar und Pollen, was mich zu einem wichtigen Bestäuber macht. Durch das Bestäuben trage ich zur Vermehrung der Pflanzen bei, was wiederum die Grundlage für viele andere Lebewesen in unserem Ökosystem ist. Meine Larven fressen Blattläuse, die oft Pflanzen schädigen. Indem ich die Blattlauspopulation kontrolliere, helfe ich, das Gleichgewicht im Garten zu erhalten.
Im Sinne uns nachfolgender Generationen: Ich lege großen Wert darauf, dass meine Nachkommen in einer gesunden Umgebung aufwachsen können. Deshalb achte ich darauf, meine Eier an Pflanzen abzulegen, die reichlich Nahrung für die Larven bieten. Indem ich dafür sorge, dass die Pflanzen gut bestäubt werden und frei von schädlichen Schädlingen bleiben, trage ich dazu bei, dass auch zukünftige Generationen von Schwebfliegen und anderen Gartenbewohnern in einem gesunden und blühenden Umfeld leben können.
So lebe ich also mein Leben als Große Schwebfliege: innovativ in meiner Erscheinung, nachhaltig in meiner Rolle als Bestäuber und Schädlingsbekämpfer und immer im Sinne der nachfolgenden Generationen.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
Nachhaltig: Mein Lebensstil ist darauf ausgerichtet, im Einklang mit der Natur zu leben. Als erwachsene Schwebfliege ernähre ich mich von Nektar und Pollen, was mich zu einem wichtigen Bestäuber macht. Durch das Bestäuben trage ich zur Vermehrung der Pflanzen bei, was wiederum die Grundlage für viele andere Lebewesen in unserem Ökosystem ist. Meine Larven fressen Blattläuse, die oft Pflanzen schädigen. Indem ich die Blattlauspopulation kontrolliere, helfe ich, das Gleichgewicht im Garten zu erhalten.
Im Sinne uns nachfolgender Generationen: Ich lege großen Wert darauf, dass meine Nachkommen in einer gesunden Umgebung aufwachsen können. Deshalb achte ich darauf, meine Eier an Pflanzen abzulegen, die reichlich Nahrung für die Larven bieten. Indem ich dafür sorge, dass die Pflanzen gut bestäubt werden und frei von schädlichen Schädlingen bleiben, trage ich dazu bei, dass auch zukünftige Generationen von Schwebfliegen und anderen Gartenbewohnern in einem gesunden und blühenden Umfeld leben können.
So lebe ich also mein Leben als Große Schwebfliege: innovativ in meiner Erscheinung, nachhaltig in meiner Rolle als Bestäuber und Schädlingsbekämpfer und immer im Sinne der nachfolgenden Generationen.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
- Gemeine Garten-Schwebfliege (Syrphus ribesii)
Artenschutz in Franken®
Die Wilden Bienen von Radolfzell

Die "Wilden Bienchen" von Radolfzell
26/27.06.2024
Radolfzell / Baden - Württemberg. Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken®, des Evangelischen Kindergarten Radolfzell und des Förderkreises des Kindergartens der ev. Kirchengemeinde Radolfzell, das von der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.
Wenn von Bienen die Rede ist, denken die meisten von uns sofort an die domestizierte Honigbiene. Dass es daneben in der Bundesrepublik Deutschland weitere ca. 560 Wildbienenarten gibt, ist den wenigsten bekannt.
26/27.06.2024
Radolfzell / Baden - Württemberg. Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken®, des Evangelischen Kindergarten Radolfzell und des Förderkreises des Kindergartens der ev. Kirchengemeinde Radolfzell, das von der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.
Wenn von Bienen die Rede ist, denken die meisten von uns sofort an die domestizierte Honigbiene. Dass es daneben in der Bundesrepublik Deutschland weitere ca. 560 Wildbienenarten gibt, ist den wenigsten bekannt.
Wildbienen - die unbekannten Bestäuber ... Eigentlich haben die meisten von uns in ihrem Leben schon einmal Wildbienen gesehen. Doch bewusst als solche wahrgenommen werden diese Tiere kaum.
Vielfach werden sie gar mit Wespen oder Fliegen verwechselt. Und hier zeigt sich auch bereits ein elementares Problem. Aufgrund einer weitverbreiteten Unkenntnis werden „die Wildbiene“ und deren Ansprüche an ihre Lebensräume nicht erkannt.
In der Aufnahme
Vielfach werden sie gar mit Wespen oder Fliegen verwechselt. Und hier zeigt sich auch bereits ein elementares Problem. Aufgrund einer weitverbreiteten Unkenntnis werden „die Wildbiene“ und deren Ansprüche an ihre Lebensräume nicht erkannt.
In der Aufnahme
- am 13.06.2024 wurde die Wildbienenwand installiert ... hier noch mit Sicherungsstabiliatoren
Artenschutz in Franken®
Die Rote Weichwanze (Deraeocoris ruber)

Hallo, Kinder!
25/26.06.2024
Stellt euch vor, ihr seid im Garten und seht einen winzigen roten Käfer mit einem schwarzen Cape. Das ist unsere Rote Weichwanze! Sie ist ungefähr so groß wie ein Fingernagel und hat einen glänzenden roten Körper, der aussieht, als hätte sie einen coolen Anzug an.
Und wisst ihr was?
25/26.06.2024
- Heute erzähle ich euch von einem kleinen, roten Superhelden der Insektenwelt: der Roten Weichwanze, auch bekannt als Deraeocoris ruber!
Stellt euch vor, ihr seid im Garten und seht einen winzigen roten Käfer mit einem schwarzen Cape. Das ist unsere Rote Weichwanze! Sie ist ungefähr so groß wie ein Fingernagel und hat einen glänzenden roten Körper, der aussieht, als hätte sie einen coolen Anzug an.
Und wisst ihr was?
- Sie hat super Kräfte!
Superkraft 1: Die Mega-Mücke-Jägerin!
Die Rote Weichwanze liebt es, kleine Mücken und Blattläuse zu fangen. Sie schleicht sich an sie heran, so leise wie eine Maus, und zack, schon hat sie sie erwischt! So hilft sie uns, den Garten sauber zu halten, damit die Pflanzen gesund bleiben.
Superkraft 2: Tarnkünstler!
Obwohl sie so leuchtend rot ist, kann sie sich super gut verstecken. Sie krabbelt geschickt über Blätter und Zweige, und manchmal sieht man sie gar nicht, weil sie so gut getarnt ist. Es ist, als würde sie ein unsichtbares Cape tragen!
Superkraft 3: Keine Angst vor dem Winter!
Im Winter versteckt sich die Rote Weichwanze unter Blättern oder in Ritzen und wartet geduldig, bis der Frühling kommt. Sie ist also ein echter Überlebenskünstler und immer bereit für das nächste Abenteuer, wenn die Sonne wieder scheint.
Warum wir sie lieben sollten:
Die Rote Weichwanze ist ein kleiner Held in unserem Garten. Sie hilft uns, die Pflanzen gesund zu halten, indem sie die bösen Insekten frisst. Also, das nächste Mal, wenn ihr eine kleine rote Wanze seht, könnt ihr ihr leise "Danke" sagen, denn sie ist ein wichtiger Freund für unsere Natur.
Na, wie findet ihr die Rote Weichwanze? Sie ist wirklich ein erstaunlicher kleiner Käfer, der uns zeigt, dass auch die kleinsten Wesen eine große Rolle spielen können!
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
Die Rote Weichwanze liebt es, kleine Mücken und Blattläuse zu fangen. Sie schleicht sich an sie heran, so leise wie eine Maus, und zack, schon hat sie sie erwischt! So hilft sie uns, den Garten sauber zu halten, damit die Pflanzen gesund bleiben.
Superkraft 2: Tarnkünstler!
Obwohl sie so leuchtend rot ist, kann sie sich super gut verstecken. Sie krabbelt geschickt über Blätter und Zweige, und manchmal sieht man sie gar nicht, weil sie so gut getarnt ist. Es ist, als würde sie ein unsichtbares Cape tragen!
Superkraft 3: Keine Angst vor dem Winter!
Im Winter versteckt sich die Rote Weichwanze unter Blättern oder in Ritzen und wartet geduldig, bis der Frühling kommt. Sie ist also ein echter Überlebenskünstler und immer bereit für das nächste Abenteuer, wenn die Sonne wieder scheint.
Warum wir sie lieben sollten:
Die Rote Weichwanze ist ein kleiner Held in unserem Garten. Sie hilft uns, die Pflanzen gesund zu halten, indem sie die bösen Insekten frisst. Also, das nächste Mal, wenn ihr eine kleine rote Wanze seht, könnt ihr ihr leise "Danke" sagen, denn sie ist ein wichtiger Freund für unsere Natur.
Na, wie findet ihr die Rote Weichwanze? Sie ist wirklich ein erstaunlicher kleiner Käfer, der uns zeigt, dass auch die kleinsten Wesen eine große Rolle spielen können!
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- ... was für Farben, bei diesen sehr variabel gefärbten Weichwanzen. Helfen mir wenn die Johannesbeeren Blattläuse haben. Eine Art, von vielen, die auch Blattläuse vertilgen.Spritzen und Vergiften der Blattläuse sorgt dafür, dass alle Helfer mit sterben. Wenn der nächste Anflug von lebend gebärenden Blattläusen statt findet, ist kaum noch ein Helfer da, der sie im Zaum hält.
Artenschutz in Franken®
Der Graubär (Diaphora mendica)

Hallo, ich bin der Graubär, wissenschaftlich bekannt als Diaphora mendica.
25/26.06.2024
25/26.06.2024
- Lass mich dir erzählen, wie ich mein Leben gestalte und dabei innovativ, nachhaltig und im Sinne unserer nachfolgenden Generationen lebe.
Innovativ: In meiner Welt habe ich einige kreative Lösungen entwickelt, um zu überleben. Zum Beispiel habe ich eine Tarnfarbe, die mir hilft, mich vor Feinden zu verstecken. Meine Flügel sind grau und pelzig, was mich wie einen kleinen Fleck auf der Rinde eines Baumes aussehen lässt. Diese Tarnung ist eine clevere Innovation, die mich vor Fressfeinden schützt.
Nachhaltig: Mein Lebensstil ist darauf ausgerichtet, im Einklang mit der Natur zu leben. Als Raupe ernähre ich mich von verschiedenen Pflanzen, aber ich achte darauf, nicht zu viel von einer einzigen Pflanze zu fressen. Dadurch helfe ich, das Gleichgewicht in meinem Lebensraum zu erhalten. Ich benutze nur so viel, wie ich zum Überleben brauche, und lasse genügend Ressourcen für andere Lebewesen.
Im Sinne uns nachfolgender Generationen: Ich lege großen Wert darauf, dass meine Nachkommen in einer gesunden Umgebung aufwachsen können. Deshalb wähle ich sorgfältig die besten Plätze aus, um meine Eier abzulegen – Orte, an denen die jungen Raupen reichlich Nahrung und Schutz finden werden. Indem ich die Pflanzen nicht übernutze und den Lebensraum respektiere, sorge ich dafür, dass auch zukünftige Generationen von Graubären in einer intakten Umwelt leben können.
So lebe ich also mein Leben als Graubär: innovativ in meiner Tarnung, nachhaltig in meiner Nutzung der Ressourcen und immer im Sinne der nachfolgenden Generationen.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
Nachhaltig: Mein Lebensstil ist darauf ausgerichtet, im Einklang mit der Natur zu leben. Als Raupe ernähre ich mich von verschiedenen Pflanzen, aber ich achte darauf, nicht zu viel von einer einzigen Pflanze zu fressen. Dadurch helfe ich, das Gleichgewicht in meinem Lebensraum zu erhalten. Ich benutze nur so viel, wie ich zum Überleben brauche, und lasse genügend Ressourcen für andere Lebewesen.
Im Sinne uns nachfolgender Generationen: Ich lege großen Wert darauf, dass meine Nachkommen in einer gesunden Umgebung aufwachsen können. Deshalb wähle ich sorgfältig die besten Plätze aus, um meine Eier abzulegen – Orte, an denen die jungen Raupen reichlich Nahrung und Schutz finden werden. Indem ich die Pflanzen nicht übernutze und den Lebensraum respektiere, sorge ich dafür, dass auch zukünftige Generationen von Graubären in einer intakten Umwelt leben können.
So lebe ich also mein Leben als Graubär: innovativ in meiner Tarnung, nachhaltig in meiner Nutzung der Ressourcen und immer im Sinne der nachfolgenden Generationen.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
- Graubär (Diaphora mendica)
Artenschutz in Franken®
Die "Wilden Bienchen" von Benediktbeuern

Die "Wilden Bienchen" von Benediktbeuern
25/26.06.2024
Benediktbeuern / Bayern. Wildbienen - die unbekannten Bestäuber ... Eigentlich haben die meisten von uns in ihrem Leben schon einmal Wildbienen gesehen. Doch bewusst als solche wahrgenommen werden diese Tiere kaum. Vielfach werden sie gar mit Wespen oder Fliegen verwechselt. Und hier zeigt sich auch bereits ein elementares Problem. Aufgrund einer weitverbreiteten Unkenntnis werden „die Wildbiene“ und deren Ansprüche an ihre Lebensräume nicht erkannt.
25/26.06.2024
- Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und der Gemeinde Benediktbeuern das pädagogisch vom Gemeindekindergarten Benediktbeuern begleitet und von der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.
Benediktbeuern / Bayern. Wildbienen - die unbekannten Bestäuber ... Eigentlich haben die meisten von uns in ihrem Leben schon einmal Wildbienen gesehen. Doch bewusst als solche wahrgenommen werden diese Tiere kaum. Vielfach werden sie gar mit Wespen oder Fliegen verwechselt. Und hier zeigt sich auch bereits ein elementares Problem. Aufgrund einer weitverbreiteten Unkenntnis werden „die Wildbiene“ und deren Ansprüche an ihre Lebensräume nicht erkannt.
Wildbienen - für uns Menschen ungemein wichtig
Wir Menschen sind darauf angewiesen, dass unsere (Kultur) -Pflanzen bestäubt werden. Wildbienen spielen hierbei eine weitaus größere Rolle als bislang angenommen. Doch Wildbienen sichern nicht nur die Ernteerträge in der Landwirtschaft. Da sie häufig in enger Symbiose mit „ihrer Wildpflanze“ leben, sichern die kleinen Insekten auch das Überleben zahlloser Wildpflanzen.
In der Aufnahme vom 12.06.2024
Wir Menschen sind darauf angewiesen, dass unsere (Kultur) -Pflanzen bestäubt werden. Wildbienen spielen hierbei eine weitaus größere Rolle als bislang angenommen. Doch Wildbienen sichern nicht nur die Ernteerträge in der Landwirtschaft. Da sie häufig in enger Symbiose mit „ihrer Wildpflanze“ leben, sichern die kleinen Insekten auch das Überleben zahlloser Wildpflanzen.
In der Aufnahme vom 12.06.2024
- Frisch montierte Wildbienenstation ... hier noch mit Sicherungsstabilisatoren
Artenschutz in Franken®
Scheckhorn-Distelbock (Agapanthia villosoviridescens)
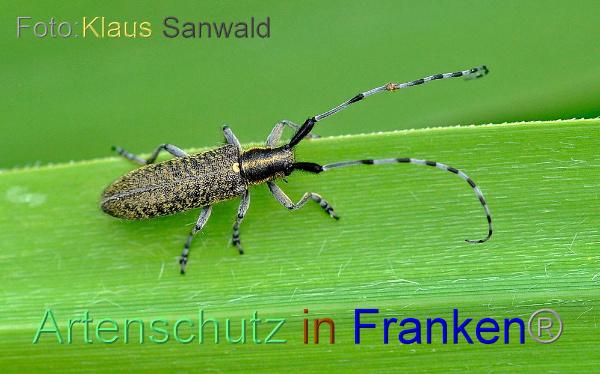
Scheckhorn-Distelbock (Agapanthia villosoviridescens)
24/25.06.2024
Sein Lebenszyklus ist eng mit der Distel verbunden, einer Pflanze, die oft als Unkraut betrachtet wird, aber für viele Insekten lebenswichtig ist. Innovativ nutzt der Scheckhorn-Distelbock die Distel nicht nur als Nahrungsquelle, sondern auch als Lebensraum für seine Larven, indem er sich nachhaltig in diese Umgebung integriert.
24/25.06.2024
- Der Scheckhorn-Distelbock, wiewohl er selbst ein bescheidener Käfer ist, spielt eine bedeutende Rolle im Ökosystem.
Sein Lebenszyklus ist eng mit der Distel verbunden, einer Pflanze, die oft als Unkraut betrachtet wird, aber für viele Insekten lebenswichtig ist. Innovativ nutzt der Scheckhorn-Distelbock die Distel nicht nur als Nahrungsquelle, sondern auch als Lebensraum für seine Larven, indem er sich nachhaltig in diese Umgebung integriert.
Nachhaltigkeit ist für den Scheckhorn-Distelbock von zentraler Bedeutung. Während er sich von Disteln ernährt, unterstützt er deren Bestäubung und trägt zur Biodiversität bei, indem er diese Pflanzen fördert. Seine ökologische Rolle als Bestäuber und Distelbestäuber hilft, die Vielfalt in natürlichen Lebensräumen zu erhalten, was wiederum im Sinne kommender Generationen ist. Durch die Bewahrung der Distel trägt der Scheckhorn-Distelbock dazu bei, dass zukünftige Generationen von der Schönheit und Vielfalt der Natur profitieren können.
In diesem Kontext ist der Scheckhorn-Distelbock ein Beispiel für die Symbiose zwischen einem Insekt und seiner Umwelt, das durch seine Anpassungsfähigkeit und seine Rolle im Ökosystem nachhaltige Praktiken unterstützt. Sein Beitrag zur Bewahrung der Distel und damit zur Förderung einer gesunden Umwelt ist ein ermutigendes Beispiel dafür, wie Natur und Menschheit harmonisch zusammenwirken können, um eine lebenswerte Zukunft zu sichern.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
In diesem Kontext ist der Scheckhorn-Distelbock ein Beispiel für die Symbiose zwischen einem Insekt und seiner Umwelt, das durch seine Anpassungsfähigkeit und seine Rolle im Ökosystem nachhaltige Praktiken unterstützt. Sein Beitrag zur Bewahrung der Distel und damit zur Förderung einer gesunden Umwelt ist ein ermutigendes Beispiel dafür, wie Natur und Menschheit harmonisch zusammenwirken können, um eine lebenswerte Zukunft zu sichern.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
- Scheckhorn-Distelbock
Artenschutz in Franken®
Wiesen-Erdzikade (Aphrodes makarovi)

Hallo, ich bin eine Wiesen-Erdzikade, wissenschaftlich bekannt als Aphrodes makarovi.
24/25.06.2024
24/25.06.2024
- Lass mich dir ein wenig über mein Leben erzählen, und wie ich innovativ, nachhaltig und im Sinne unserer nachfolgenden Generationen lebe.
Innovativ: In meinem kleinen Wiesenreich habe ich viele clevere Tricks entwickelt, um zu überleben. Zum Beispiel habe ich spezielle Beine, die es mir ermöglichen, schnell zu springen und mich vor Feinden zu verstecken. Meine Fähigkeit, Vibrationen zu erzeugen und zu spüren, hilft mir dabei, mit anderen Zikaden zu kommunizieren und meine Umgebung zu erkunden.
Nachhaltig: Ich lebe im Einklang mit der Natur. Meine Ernährung besteht hauptsächlich aus Pflanzensaft, den ich aus den Gräsern und Kräutern der Wiese sauge. Dabei achte ich darauf, nicht zu viel auf einmal zu nehmen, damit die Pflanzen sich erholen können. So stelle ich sicher, dass die Wiese gesund bleibt und genügend Nahrung für alle bietet, auch für andere Insekten.
Im Sinne uns nachfolgender Generationen: Ich lege großen Wert darauf, dass meine Nachkommen eine gute Zukunft haben. Deshalb wähle ich sorgfältig die besten Pflanzen aus, um meine Eier abzulegen, damit die jungen Zikaden ausreichend Nahrung und Schutz finden. Indem ich nur so viel nehme, wie ich brauche, und den Lebensraum respektiere, trage ich dazu bei, dass auch künftige Generationen von Wiesen-Erdzikaden in einer gesunden Umgebung aufwachsen können.
So lebe ich also innovativ und nachhaltig in meinem kleinen Wiesenreich, immer im Sinne unserer nachfolgenden Generationen.
In der Aufnahme / Autor von Bernhard Schmalisch ... Aufnahme vom 18.06.2024
Nachhaltig: Ich lebe im Einklang mit der Natur. Meine Ernährung besteht hauptsächlich aus Pflanzensaft, den ich aus den Gräsern und Kräutern der Wiese sauge. Dabei achte ich darauf, nicht zu viel auf einmal zu nehmen, damit die Pflanzen sich erholen können. So stelle ich sicher, dass die Wiese gesund bleibt und genügend Nahrung für alle bietet, auch für andere Insekten.
Im Sinne uns nachfolgender Generationen: Ich lege großen Wert darauf, dass meine Nachkommen eine gute Zukunft haben. Deshalb wähle ich sorgfältig die besten Pflanzen aus, um meine Eier abzulegen, damit die jungen Zikaden ausreichend Nahrung und Schutz finden. Indem ich nur so viel nehme, wie ich brauche, und den Lebensraum respektiere, trage ich dazu bei, dass auch künftige Generationen von Wiesen-Erdzikaden in einer gesunden Umgebung aufwachsen können.
So lebe ich also innovativ und nachhaltig in meinem kleinen Wiesenreich, immer im Sinne unserer nachfolgenden Generationen.
In der Aufnahme / Autor von Bernhard Schmalisch ... Aufnahme vom 18.06.2024
- eine Zwerzikade, die Jugendform einer Erdzikade ... Zikaden gibts viele, sehr viele Arten. Da sie meist sehr klein sind, entgehen sie der Aufmerksamkeit der meisten Menschen Die Larve, diese Jugendform, ist etwa 4 mm groß bzw. klein
Artenschutz in Franken®
Die "Wilden Bienchen" von Sachsenkam

Die "Wilden Bienchen" von Sachsenkam
24/25.06.2024
Sachsenkam / Bayern. Wildbienen - die unbekannten Bestäuber ... Eigentlich haben die meisten von uns in ihrem Leben schon einmal Wildbienen gesehen. Doch bewusst als solche wahrgenommen werden diese Tiere kaum.
Vielfach werden sie gar mit Wespen oder Fliegen verwechselt. Und hier zeigt sich auch bereits ein elementares Problem. Aufgrund einer weitverbreiteten Unkenntnis werden „die Wildbiene“ und deren Ansprüche an ihre Lebensräume nicht erkannt.
24/25.06.2024
- Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und der Gemeinde Sachsenkam das pädagogisch vom Haus für Kinder Sachsenkam begleitet und von der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.
Sachsenkam / Bayern. Wildbienen - die unbekannten Bestäuber ... Eigentlich haben die meisten von uns in ihrem Leben schon einmal Wildbienen gesehen. Doch bewusst als solche wahrgenommen werden diese Tiere kaum.
Vielfach werden sie gar mit Wespen oder Fliegen verwechselt. Und hier zeigt sich auch bereits ein elementares Problem. Aufgrund einer weitverbreiteten Unkenntnis werden „die Wildbiene“ und deren Ansprüche an ihre Lebensräume nicht erkannt.
Wildbienen - für uns Menschen ungemein wichtig
Wir Menschen sind darauf angewiesen, dass unsere (Kultur) -Pflanzen bestäubt werden. Wildbienen spielen hierbei eine weitaus größere Rolle als bislang angenommen. Doch Wildbienen sichern nicht nur die Ernteerträge in der Landwirtschaft. Da sie häufig in enger Symbiose mit „ihrer Wildpflanze“ leben, sichern die kleinen Insekten auch das Überleben zahlloser Wildpflanzen.
In der Aufnahme
Wir Menschen sind darauf angewiesen, dass unsere (Kultur) -Pflanzen bestäubt werden. Wildbienen spielen hierbei eine weitaus größere Rolle als bislang angenommen. Doch Wildbienen sichern nicht nur die Ernteerträge in der Landwirtschaft. Da sie häufig in enger Symbiose mit „ihrer Wildpflanze“ leben, sichern die kleinen Insekten auch das Überleben zahlloser Wildpflanzen.
In der Aufnahme
- Am 11.06.2024 fand die Montage der Wildbienenwand statt ... hier kurz nach der Fertigstellung ... noch mit Sicherungsstabilisatoren ...
Artenschutz in Franken®
Zweikeulen-Weichwanze (Closterotomus biclavatus)

Zweikeulen-Weichwanze (Closterotomus biclavatus)
23/24.06.2024
Ich möchte dir gerne aus meiner eigenen Perspektive erzählen, wie ich die Welt sehe und wie mein Leben und Verhalten innovativ, nachhaltig und im Sinne uns nachfolgender Generationen gestaltet ist.
23/24.06.2024
- Hallo, ich bin eine Zweikeulen-Weichwanze, wissenschaftlich bekannt als Closterotomus biclavatus.
Ich möchte dir gerne aus meiner eigenen Perspektive erzählen, wie ich die Welt sehe und wie mein Leben und Verhalten innovativ, nachhaltig und im Sinne uns nachfolgender Generationen gestaltet ist.
Innovativ
Meine Lebensweise ist durchaus innovativ. Als Vertreter der Weichwanzen habe ich spezielle Anpassungen entwickelt, die mir helfen, sowohl Fressfeinden zu entkommen als auch effizient Nahrung zu finden. Mein Körper ist weich und flexibel, was mir erlaubt, mich durch enge Spalten zu bewegen und mich gut zu verstecken. Zudem habe ich spezielle Mundwerkzeuge, mit denen ich sowohl Pflanzensäfte als auch kleine Insekten saugen kann. Diese Vielseitigkeit in meiner Ernährung gibt mir einen Vorteil und erlaubt es mir, in verschiedenen Lebensräumen zu überleben und zu gedeihen.
Nachhaltig
Ich lebe in Harmonie mit meiner Umgebung und trage dazu bei, das ökologische Gleichgewicht zu wahren. Durch meine Ernährungsweise trage ich zur Kontrolle von Pflanzenpopulationen bei und helfe, das Wachstum bestimmter Pflanzenarten zu regulieren. Gleichzeitig bin ich eine Nahrungsquelle für viele Vögel und andere Insektenfresser, was das Gleichgewicht in der Nahrungskette unterstützt. Meine Existenz ist also ein Beispiel für nachhaltige Interaktionen in der Natur.
Im Sinne uns nachfolgender Generationen
Mein Fortpflanzungsverhalten ist darauf ausgerichtet, dass auch zukünftige Generationen meiner Art überleben und gedeihen können. Ich lege meine Eier an geschützten Orten ab, damit sie vor Fressfeinden und Umwelteinflüssen sicher sind. Die jungen Nymphen, die schlüpfen, haben eine hohe Überlebensrate, weil ich strategisch geeignete Orte wähle, die Nahrung und Schutz bieten. So sorge ich dafür, dass meine Nachkommen in einer gesunden Umgebung aufwachsen und die Chance haben, sich ebenfalls fortzupflanzen.
Durch meine innovative Anpassungsfähigkeit, mein nachhaltiges Leben im Ökosystem und mein Augenmerk auf den Schutz und das Wohlergehen meiner Nachkommen trage ich dazu bei, dass auch zukünftige Generationen meiner Art eine Chance auf ein gesundes und erfolgreiches Leben haben.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
Meine Lebensweise ist durchaus innovativ. Als Vertreter der Weichwanzen habe ich spezielle Anpassungen entwickelt, die mir helfen, sowohl Fressfeinden zu entkommen als auch effizient Nahrung zu finden. Mein Körper ist weich und flexibel, was mir erlaubt, mich durch enge Spalten zu bewegen und mich gut zu verstecken. Zudem habe ich spezielle Mundwerkzeuge, mit denen ich sowohl Pflanzensäfte als auch kleine Insekten saugen kann. Diese Vielseitigkeit in meiner Ernährung gibt mir einen Vorteil und erlaubt es mir, in verschiedenen Lebensräumen zu überleben und zu gedeihen.
Nachhaltig
Ich lebe in Harmonie mit meiner Umgebung und trage dazu bei, das ökologische Gleichgewicht zu wahren. Durch meine Ernährungsweise trage ich zur Kontrolle von Pflanzenpopulationen bei und helfe, das Wachstum bestimmter Pflanzenarten zu regulieren. Gleichzeitig bin ich eine Nahrungsquelle für viele Vögel und andere Insektenfresser, was das Gleichgewicht in der Nahrungskette unterstützt. Meine Existenz ist also ein Beispiel für nachhaltige Interaktionen in der Natur.
Im Sinne uns nachfolgender Generationen
Mein Fortpflanzungsverhalten ist darauf ausgerichtet, dass auch zukünftige Generationen meiner Art überleben und gedeihen können. Ich lege meine Eier an geschützten Orten ab, damit sie vor Fressfeinden und Umwelteinflüssen sicher sind. Die jungen Nymphen, die schlüpfen, haben eine hohe Überlebensrate, weil ich strategisch geeignete Orte wähle, die Nahrung und Schutz bieten. So sorge ich dafür, dass meine Nachkommen in einer gesunden Umgebung aufwachsen und die Chance haben, sich ebenfalls fortzupflanzen.
Durch meine innovative Anpassungsfähigkeit, mein nachhaltiges Leben im Ökosystem und mein Augenmerk auf den Schutz und das Wohlergehen meiner Nachkommen trage ich dazu bei, dass auch zukünftige Generationen meiner Art eine Chance auf ein gesundes und erfolgreiches Leben haben.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- Zweikeulen-Weichwanze (Closterotomus biclavatus)
Artenschutz in Franken®
Rapsweißling (Pieris napi)

Der Rapsweißling (Pieris napi)
23/24.06.2024
Lass mich dir erzählen, wie ich mein Leben lebe und wie ich dabei innovativ, nachhaltig und im Sinne nachfolgender Generationen handle.
23/24.06.2024
- Hallo! Ich bin der Rapsweißling (Pieris napi), ein Schmetterling, der oft auf Wiesen und in Gärten zu finden ist.
Lass mich dir erzählen, wie ich mein Leben lebe und wie ich dabei innovativ, nachhaltig und im Sinne nachfolgender Generationen handle.
Ein innovatives Leben
Als Rapsweißling bin ich ständig auf der Suche nach neuen Wegen, mich anzupassen und zu überleben. Meine Flügel sind nicht nur schön anzusehen, sondern auch ein Meisterwerk der Natur. Sie sind mit speziellen Schuppen bedeckt, die nicht nur Farben erzeugen, sondern auch innovativ dabei helfen, das Sonnenlicht zu reflektieren und mich vor Überhitzung zu schützen. Dies erlaubt mir, auch an warmen Tagen aktiv zu bleiben und nach Nahrung zu suchen.
Nachhaltigkeit in meiner Lebensweise
Meine Lebensweise ist äußerst nachhaltig. Ich lege meine Eier auf Pflanzen der Familie der Kreuzblütler ab, insbesondere auf Raps. Diese Pflanzen dienen meinen Raupen als Nahrung und sorgen dafür, dass sie genügend Nährstoffe für ihre Entwicklung bekommen. Indem ich mich auf einheimische Pflanzen spezialisiert habe, fördere ich die Gesundheit und Vielfalt der lokalen Flora. Meine Raupen ernähren sich von den Blättern dieser Pflanzen, ohne sie vollständig zu zerstören, was sicherstellt, dass die Pflanzen weiter wachsen und gedeihen können.
Im Sinne nachfolgender Generationen
Meine Aktivitäten sind stets auf die Zukunft ausgerichtet. Wenn ich Eier lege, wähle ich sorgfältig Pflanzen aus, die meinen Nachkommen die besten Überlebenschancen bieten. Ich sorge dafür, dass meine Raupen genügend Nahrung haben und sich sicher verpuppen können. Dadurch stelle ich sicher, dass auch zukünftige Generationen von Rapsweißlingen erfolgreich schlüpfen und überleben können.
Durch meine Bestäubungsarbeit trage ich außerdem dazu bei, dass viele Pflanzen erfolgreich Samen produzieren. Dies sichert die Nahrungsgrundlage für viele andere Insekten und Tiere und trägt zur Stabilität und Vielfalt der Ökosysteme bei. So schaffe ich Lebensräume und Nahrungsquellen, die auch kommenden Generationen zugutekommen.
Zusammengefasst bin ich ein Beispiel dafür, wie Innovation, Nachhaltigkeit und das Denken an die Zukunft miteinander verknüpft sind. Meine Anpassungsfähigkeit und nachhaltigen Praktiken zeigen, dass es möglich ist, im Einklang mit der Natur zu leben und dabei eine bedeutende Rolle bei der Erhaltung und Förderung der biologischen Vielfalt zu spielen.
Ich hoffe, durch meine Perspektive hast du ein besseres Verständnis dafür bekommen, wie wichtig jeder kleine Teil unseres Ökosystems ist und wie wir durch die Beobachtung und Nachahmung der Natur nachhaltiger und zukunftsorientierter handeln können.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
Als Rapsweißling bin ich ständig auf der Suche nach neuen Wegen, mich anzupassen und zu überleben. Meine Flügel sind nicht nur schön anzusehen, sondern auch ein Meisterwerk der Natur. Sie sind mit speziellen Schuppen bedeckt, die nicht nur Farben erzeugen, sondern auch innovativ dabei helfen, das Sonnenlicht zu reflektieren und mich vor Überhitzung zu schützen. Dies erlaubt mir, auch an warmen Tagen aktiv zu bleiben und nach Nahrung zu suchen.
Nachhaltigkeit in meiner Lebensweise
Meine Lebensweise ist äußerst nachhaltig. Ich lege meine Eier auf Pflanzen der Familie der Kreuzblütler ab, insbesondere auf Raps. Diese Pflanzen dienen meinen Raupen als Nahrung und sorgen dafür, dass sie genügend Nährstoffe für ihre Entwicklung bekommen. Indem ich mich auf einheimische Pflanzen spezialisiert habe, fördere ich die Gesundheit und Vielfalt der lokalen Flora. Meine Raupen ernähren sich von den Blättern dieser Pflanzen, ohne sie vollständig zu zerstören, was sicherstellt, dass die Pflanzen weiter wachsen und gedeihen können.
Im Sinne nachfolgender Generationen
Meine Aktivitäten sind stets auf die Zukunft ausgerichtet. Wenn ich Eier lege, wähle ich sorgfältig Pflanzen aus, die meinen Nachkommen die besten Überlebenschancen bieten. Ich sorge dafür, dass meine Raupen genügend Nahrung haben und sich sicher verpuppen können. Dadurch stelle ich sicher, dass auch zukünftige Generationen von Rapsweißlingen erfolgreich schlüpfen und überleben können.
Durch meine Bestäubungsarbeit trage ich außerdem dazu bei, dass viele Pflanzen erfolgreich Samen produzieren. Dies sichert die Nahrungsgrundlage für viele andere Insekten und Tiere und trägt zur Stabilität und Vielfalt der Ökosysteme bei. So schaffe ich Lebensräume und Nahrungsquellen, die auch kommenden Generationen zugutekommen.
Zusammengefasst bin ich ein Beispiel dafür, wie Innovation, Nachhaltigkeit und das Denken an die Zukunft miteinander verknüpft sind. Meine Anpassungsfähigkeit und nachhaltigen Praktiken zeigen, dass es möglich ist, im Einklang mit der Natur zu leben und dabei eine bedeutende Rolle bei der Erhaltung und Förderung der biologischen Vielfalt zu spielen.
Ich hoffe, durch meine Perspektive hast du ein besseres Verständnis dafür bekommen, wie wichtig jeder kleine Teil unseres Ökosystems ist und wie wir durch die Beobachtung und Nachahmung der Natur nachhaltiger und zukunftsorientierter handeln können.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- Rapsweißling (Pieris napi)
Artenschutz in Franken®
Die „Wilden Bienen“ der Schatzinsel von Hemhof

Die „Wilden Bienen“ der Schatzinsel von Hemhof
23/24.06.2024
Bad Endorf / Bayern. Wildbienen - die unbekannten Bestäuber ... Eigentlich haben die meisten von uns in ihrem Leben schon einmal Wildbienen gesehen. Doch bewusst als solche wahrgenommen werden diese Tiere kaum.
Vielfach werden sie gar mit Wespen oder Fliegen verwechselt. Und hier zeigt sich auch bereits ein elementares Problem. Aufgrund einer weitverbreiteten Unkenntnis werden „die Wildbiene“ und deren Ansprüche an ihre Lebensräume nicht erkannt.
23/24.06.2024
- Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken®, der Kinderkrippe Die Schatzinsel und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V., dass von der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.
Bad Endorf / Bayern. Wildbienen - die unbekannten Bestäuber ... Eigentlich haben die meisten von uns in ihrem Leben schon einmal Wildbienen gesehen. Doch bewusst als solche wahrgenommen werden diese Tiere kaum.
Vielfach werden sie gar mit Wespen oder Fliegen verwechselt. Und hier zeigt sich auch bereits ein elementares Problem. Aufgrund einer weitverbreiteten Unkenntnis werden „die Wildbiene“ und deren Ansprüche an ihre Lebensräume nicht erkannt.
Wildbienen - für uns Menschen ungemein wichtig
Wir Menschen sind darauf angewiesen, dass unsere (Kultur) -Pflanzen bestäubt werden. Wildbienen spielen hierbei eine weitaus größere Rolle als bislang angenommen. Doch Wildbienen sichern nicht nur die Ernteerträge in der Landwirtschaft. Da sie häufig in enger Symbiose mit „ihrer Wildpflanze“ leben, sichern die kleinen Insekten auch das Überleben zahlloser Wildpflanzen.
Wildbienen – häufig im Bestand gefährdet
Doch viele unserer Wildbienenarten in Deutschland sind zwischenzeitlich akut in ihrem Bestand bedroht. Gerade auch durch eine zunehmend industrielle Landbewirtschaftung mit einem immensen Pestizideinsatz sowie der Zerstörung wichtiger Lebensräume haben wir Menschen zahlreiche Wildbienenarten bereits nahe an den Rand des Aussterbens gebracht. Je intensiver die Bewirtschaftungsformen und je umfangreicher Bewirtschaftungs-flächen werden, desto stärker hängt der Ertrag der Landwirtschaft auch von Wildbienen ab. Je mehr Lebensräume wir mit unserem Handeln in unserem Umfeld beeinträchtigen gefährden wir nicht nur eine faszinierende Insektengruppe. Nein mehr noch, wir setzen mit diesem Tun gar eine der (auch und gerade für den Menschen) wichtigsten Ökosysteme aufs Spiel.
In der Aufnahme
Wir Menschen sind darauf angewiesen, dass unsere (Kultur) -Pflanzen bestäubt werden. Wildbienen spielen hierbei eine weitaus größere Rolle als bislang angenommen. Doch Wildbienen sichern nicht nur die Ernteerträge in der Landwirtschaft. Da sie häufig in enger Symbiose mit „ihrer Wildpflanze“ leben, sichern die kleinen Insekten auch das Überleben zahlloser Wildpflanzen.
Wildbienen – häufig im Bestand gefährdet
Doch viele unserer Wildbienenarten in Deutschland sind zwischenzeitlich akut in ihrem Bestand bedroht. Gerade auch durch eine zunehmend industrielle Landbewirtschaftung mit einem immensen Pestizideinsatz sowie der Zerstörung wichtiger Lebensräume haben wir Menschen zahlreiche Wildbienenarten bereits nahe an den Rand des Aussterbens gebracht. Je intensiver die Bewirtschaftungsformen und je umfangreicher Bewirtschaftungs-flächen werden, desto stärker hängt der Ertrag der Landwirtschaft auch von Wildbienen ab. Je mehr Lebensräume wir mit unserem Handeln in unserem Umfeld beeinträchtigen gefährden wir nicht nur eine faszinierende Insektengruppe. Nein mehr noch, wir setzen mit diesem Tun gar eine der (auch und gerade für den Menschen) wichtigsten Ökosysteme aufs Spiel.
In der Aufnahme
- Am 11. Juni 2024 fand die Installation der Wildbienenstation statt ... hier noch mit den Sicherungsstabilisatoren ...
Artenschutz in Franken®
Neues Klimawandel-Projekt im Wattenmeer

Neues Klimawandel-Projekt im Wattenmeer
22/23.06.2024
Ahrensburg / Norderoog, 05.06.2024. Der Verein Jordsand startet ein neues Projekt im Wattenmeer: Die KLIMAHALLIG Norderoog. Im Rahmen dieses Bildungs- und Forschungsprojekts werden die Auswirkungen des Klimawandels im Wattenmeer vermittelt.
Die kleine Hallig Norderoog – westlich von Pellworm im Nationalpark Wattenmeer gelegen – kann ab sofort mithilfe von Livestream-Kameras virtuell besucht werden. Die breite Öffentlichkeit erhält somit Zugang zu diesem einzigartigen Naturkleinod. Bisher war die Hallig rein dem Natur- und Vogelschutz vorbehalten, sie darf von Menschen nicht betreten werden. Der Verein Jordsand betreibt hier Naturschutz- und Forschungsarbeit und kann nun live und vorort dabei begleitet werden: mit digitalen Angeboten wie Online-Veranstaltungen mit Liveschalten zur Hallig und Lehrvideos zu wissenschaftlichen Themen.
22/23.06.2024
Ahrensburg / Norderoog, 05.06.2024. Der Verein Jordsand startet ein neues Projekt im Wattenmeer: Die KLIMAHALLIG Norderoog. Im Rahmen dieses Bildungs- und Forschungsprojekts werden die Auswirkungen des Klimawandels im Wattenmeer vermittelt.
Die kleine Hallig Norderoog – westlich von Pellworm im Nationalpark Wattenmeer gelegen – kann ab sofort mithilfe von Livestream-Kameras virtuell besucht werden. Die breite Öffentlichkeit erhält somit Zugang zu diesem einzigartigen Naturkleinod. Bisher war die Hallig rein dem Natur- und Vogelschutz vorbehalten, sie darf von Menschen nicht betreten werden. Der Verein Jordsand betreibt hier Naturschutz- und Forschungsarbeit und kann nun live und vorort dabei begleitet werden: mit digitalen Angeboten wie Online-Veranstaltungen mit Liveschalten zur Hallig und Lehrvideos zu wissenschaftlichen Themen.
„Der Klimawandel wirkt sich direkt auf die Seevögel aus, das können wir auf Norderoog unmittelbar beobachten. Mit dem Projekt Klimahallig Norderoog bringen wir dieses wichtige Thema in die Öffentlichkeit und machen einen bedrohten Lebensraum virtuell erlebbar“ sagt Dr. Steffen Gruber, Geschäftsführer des Vereins Jordsand.
Die Hallig Norderoog ist seit 1909 im Privatbesitz des Vereins Jordsand. Sie liegt in der Kernzone des Nationalparks Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer und ist wichtiges Brut- und Rastgebiet für viele, darunter auch seltene Vogelarten. Bis zu 4.000 Brutpaare der in Deutschland vom Aussterben bedrohten Brandseeschwalbe ziehen hier jedes Jahr ihren Nachwuchs groß. Doch klimabedingte Veränderungen bedrohen zunehmend den Bruterfolg. So gab es in den letzten Jahren auf Norderoog immer öfter Landunter während der Brutzeit, sodass Teile oder die ganze Hallig überflutet waren. Die Häufung dieses als „Kükenfluten“ bekannten Phänomens gilt als Folge des Klimawandels und kann den Nachwuchs einzelner Kolonien oder gar ganze Generationen vernichten. Auch andere Wetterereignisse wie Starkwinde und Hitze- und Trockenperioden treten durch den Klimawandel vermehrt oder verlängert auf. Muschelsterben oder veränderte Fischbestände können die Folge sein und wirken sich direkt auf die Nahrungsverfügbarkeit der Seevögel aus. Von diesen Veränderungen wird im Projekt KLIMAHALLIG Norderoog berichtet.
„Ich hoffe natürlich, dass Norderoog dieses Jahr von einer Kükenflut verschont bleibt. Sollte es aber dazu kommen, werden wir davon live berichten, um möglichst viele Menschen auf die Folgen des Klimawandels für das Wattenmeer aufmerksam zu machen.“ Marlene Wynants, Projektleiterin KLIMAHALLIG Norderoog.
Im Rahmen des Projekts wurde Norderoog mit einer technischen Infrastruktur ausgestattet: Inmitten der wilden Natur des westlichsten Wattenmeeres stehen nun Livestream-Kameras, auf denen das Brutgeschehen und das bunte Treiben auf Norderoog im ganzen Jahresverlauf mitverfolgt werden kann. Zu entdecken sind balzende Lachmöwen, brütende Graugänse und schlafende Austernfischer, die sich immer zu Hochwasser auf der Hallig versammeln. Außerdem sind die Brutkolonie der Brandseeschwalben und Paare von brütenden Küstenseeschwalben zu sehen sowie Überraschungsgäste wie Seeadler oder Schwarzkopfmöwen.
„Jedes Jahr kämpfen die Tiere mit den Sturmfluten. Der Klimawandel ist voll da und bedroht das Leben auf der Hallig. Es ist wichtig für die Menschen, zu verstehen, wie wertvoll der Schatz der Natur ist. Und wie unverzichtbar es ist, diesen zu bewahren. Deswegen habe ich gerne die Schirmherrschaft für das Projekt Klimahallig des Vereins Jordsand übernommen.“ Tobias Goldschmidt, Umweltminister Schleswig-Holstein.
Das Projekt KLIMAHALLIG wird gefördert vom Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur Schleswig-Holstein. Umweltminister Tobias Goldschmidt hat die Schirmherrschaft übernommen, da ihm Bildungsarbeit zum Klimawandel vor der eigenen Haustür ein großes Anliegen ist.
Eigens für das Projekt hat der Verein Jordsand die Website www.klimahallig.de eingerichtet, auf der sich Interessierte rund um die Uhr informieren können. Des Weiteren gibt es Kooperationen mit Infozentren an der Nordseeküste, in denen das Geschehen auf der Hallig auf Monitoren verfolgt werden kann. Auch wird es Angebote für Schulen und Live-Events geben.
In der Aufnahme von Harro H. Mueller
Quelle
Verein Jordsand zum Schutz der Seevögel und der Natur e. V.
Bornkampsweg 35
22926 Ahrensburg
05. Juni 2024
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung.Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Die Hallig Norderoog ist seit 1909 im Privatbesitz des Vereins Jordsand. Sie liegt in der Kernzone des Nationalparks Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer und ist wichtiges Brut- und Rastgebiet für viele, darunter auch seltene Vogelarten. Bis zu 4.000 Brutpaare der in Deutschland vom Aussterben bedrohten Brandseeschwalbe ziehen hier jedes Jahr ihren Nachwuchs groß. Doch klimabedingte Veränderungen bedrohen zunehmend den Bruterfolg. So gab es in den letzten Jahren auf Norderoog immer öfter Landunter während der Brutzeit, sodass Teile oder die ganze Hallig überflutet waren. Die Häufung dieses als „Kükenfluten“ bekannten Phänomens gilt als Folge des Klimawandels und kann den Nachwuchs einzelner Kolonien oder gar ganze Generationen vernichten. Auch andere Wetterereignisse wie Starkwinde und Hitze- und Trockenperioden treten durch den Klimawandel vermehrt oder verlängert auf. Muschelsterben oder veränderte Fischbestände können die Folge sein und wirken sich direkt auf die Nahrungsverfügbarkeit der Seevögel aus. Von diesen Veränderungen wird im Projekt KLIMAHALLIG Norderoog berichtet.
„Ich hoffe natürlich, dass Norderoog dieses Jahr von einer Kükenflut verschont bleibt. Sollte es aber dazu kommen, werden wir davon live berichten, um möglichst viele Menschen auf die Folgen des Klimawandels für das Wattenmeer aufmerksam zu machen.“ Marlene Wynants, Projektleiterin KLIMAHALLIG Norderoog.
Im Rahmen des Projekts wurde Norderoog mit einer technischen Infrastruktur ausgestattet: Inmitten der wilden Natur des westlichsten Wattenmeeres stehen nun Livestream-Kameras, auf denen das Brutgeschehen und das bunte Treiben auf Norderoog im ganzen Jahresverlauf mitverfolgt werden kann. Zu entdecken sind balzende Lachmöwen, brütende Graugänse und schlafende Austernfischer, die sich immer zu Hochwasser auf der Hallig versammeln. Außerdem sind die Brutkolonie der Brandseeschwalben und Paare von brütenden Küstenseeschwalben zu sehen sowie Überraschungsgäste wie Seeadler oder Schwarzkopfmöwen.
„Jedes Jahr kämpfen die Tiere mit den Sturmfluten. Der Klimawandel ist voll da und bedroht das Leben auf der Hallig. Es ist wichtig für die Menschen, zu verstehen, wie wertvoll der Schatz der Natur ist. Und wie unverzichtbar es ist, diesen zu bewahren. Deswegen habe ich gerne die Schirmherrschaft für das Projekt Klimahallig des Vereins Jordsand übernommen.“ Tobias Goldschmidt, Umweltminister Schleswig-Holstein.
Das Projekt KLIMAHALLIG wird gefördert vom Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur Schleswig-Holstein. Umweltminister Tobias Goldschmidt hat die Schirmherrschaft übernommen, da ihm Bildungsarbeit zum Klimawandel vor der eigenen Haustür ein großes Anliegen ist.
Eigens für das Projekt hat der Verein Jordsand die Website www.klimahallig.de eingerichtet, auf der sich Interessierte rund um die Uhr informieren können. Des Weiteren gibt es Kooperationen mit Infozentren an der Nordseeküste, in denen das Geschehen auf der Hallig auf Monitoren verfolgt werden kann. Auch wird es Angebote für Schulen und Live-Events geben.
In der Aufnahme von Harro H. Mueller
- Brandseeschwalben
Quelle
Verein Jordsand zum Schutz der Seevögel und der Natur e. V.
Bornkampsweg 35
22926 Ahrensburg
05. Juni 2024
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung.Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Artenschutz in Franken®
Rainfarn-Maskenbiene (Hylaeus nigritus),

Hallo! Ich bin die Rainfarn-Maskenbiene (Hylaeus nigritus), und ich freue mich, dir einen Einblick in mein Leben und meine Mission zu geben.
22/23.06.2024
Ein innovatives Leben ... Ich gehöre zur Gattung Hylaeus, die dafür bekannt ist, sich an die verschiedensten Lebensräume anzupassen.
22/23.06.2024
- Aus meiner Perspektive zu sprechen, bedeutet, dir zu zeigen, wie innovativ, nachhaltig und im Sinne nachfolgender Generationen ich handle.
Ein innovatives Leben ... Ich gehöre zur Gattung Hylaeus, die dafür bekannt ist, sich an die verschiedensten Lebensräume anzupassen.
Statt Nektar und Pollen zu sammeln wie andere Bienen, habe ich eine innovative Methode entwickelt: Ich trage den Pollen in einem speziellen „Magen“ zurück in mein Nest. Diese Anpassung ermöglicht es mir, effizienter zu arbeiten und mich an verschiedene Blumenarten anzupassen. Es ist ein perfektes Beispiel für Innovation in der Natur – durch die Entwicklung neuer Techniken und Methoden, um in einer sich ständig verändernden Umgebung zu überleben.
Nachhaltigkeit in meiner Lebensweise
Nachhaltigkeit ist für mich nicht nur ein Schlagwort, sondern ein Lebensprinzip. Ich wähle meine Nistplätze sorgfältig aus, oft in verlassenen Hohlräumen von Pflanzenstängeln oder in totem Holz. Dadurch recycle ich natürliche Ressourcen und trage dazu bei, die Umwelt im Gleichgewicht zu halten. Ich nutze keine schädlichen Chemikalien oder künstlichen Materialien für den Bau meiner Nester. Meine Lebensweise ist ein Modell für nachhaltige Praxis, da ich das, was die Natur mir bietet, in harmonischer Weise nutze und zurückgebe.
Im Sinne nachfolgender Generationen
Meine Bemühungen sind immer auf die Zukunft ausgerichtet. Ich bestäube nicht nur Pflanzen, sondern trage auch zur genetischen Vielfalt und zur Gesundheit der Ökosysteme bei. Dies sichert die Nahrungsgrundlage für viele andere Arten und letztlich auch für die zukünftigen Generationen meiner Art und anderer Lebewesen. Durch meine Aktivitäten unterstütze ich die Fortpflanzung vieler Pflanzenarten, die für die Stabilität und das Wachstum unserer Lebensräume entscheidend sind.
Zusammengefasst bin ich ein lebendes Beispiel dafür, wie Innovation, Nachhaltigkeit und das Denken an zukünftige Generationen Hand in Hand gehen können. Meine Anpassungsfähigkeit und meine nachhaltigen Praktiken zeigen, dass es möglich ist, in Einklang mit der Natur zu leben und gleichzeitig eine bedeutende Rolle in der Erhaltung und Förderung der biologischen Vielfalt zu spielen.
Ich hoffe, du hast durch meine Sichtweise ein besseres Verständnis dafür bekommen, wie wichtig jede kleine Kreatur in unserem komplexen Ökosystem ist und wie wir durch Beobachtung und Nachahmung von uns Bienen auch als Menschen nachhaltiger und zukunftsorientierter handeln können.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch am 17.06.2024
Nachhaltigkeit in meiner Lebensweise
Nachhaltigkeit ist für mich nicht nur ein Schlagwort, sondern ein Lebensprinzip. Ich wähle meine Nistplätze sorgfältig aus, oft in verlassenen Hohlräumen von Pflanzenstängeln oder in totem Holz. Dadurch recycle ich natürliche Ressourcen und trage dazu bei, die Umwelt im Gleichgewicht zu halten. Ich nutze keine schädlichen Chemikalien oder künstlichen Materialien für den Bau meiner Nester. Meine Lebensweise ist ein Modell für nachhaltige Praxis, da ich das, was die Natur mir bietet, in harmonischer Weise nutze und zurückgebe.
Im Sinne nachfolgender Generationen
Meine Bemühungen sind immer auf die Zukunft ausgerichtet. Ich bestäube nicht nur Pflanzen, sondern trage auch zur genetischen Vielfalt und zur Gesundheit der Ökosysteme bei. Dies sichert die Nahrungsgrundlage für viele andere Arten und letztlich auch für die zukünftigen Generationen meiner Art und anderer Lebewesen. Durch meine Aktivitäten unterstütze ich die Fortpflanzung vieler Pflanzenarten, die für die Stabilität und das Wachstum unserer Lebensräume entscheidend sind.
Zusammengefasst bin ich ein lebendes Beispiel dafür, wie Innovation, Nachhaltigkeit und das Denken an zukünftige Generationen Hand in Hand gehen können. Meine Anpassungsfähigkeit und meine nachhaltigen Praktiken zeigen, dass es möglich ist, in Einklang mit der Natur zu leben und gleichzeitig eine bedeutende Rolle in der Erhaltung und Förderung der biologischen Vielfalt zu spielen.
Ich hoffe, du hast durch meine Sichtweise ein besseres Verständnis dafür bekommen, wie wichtig jede kleine Kreatur in unserem komplexen Ökosystem ist und wie wir durch Beobachtung und Nachahmung von uns Bienen auch als Menschen nachhaltiger und zukunftsorientierter handeln können.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch am 17.06.2024
- Rainfarn-Maskenbiene (Hylaeus nigritus)
Artenschutz in Franken®
Schöne Schmuckfliege (Otites formosa)

Hallo! Ich bin die Schöne Schmuckfliege, auch bekannt als Otites formosa.
22/23.06.2024
Ich bin eine ziemlich auffällige Fliege, nicht nur wegen meines hübschen Aussehens, sondern auch wegen meines interessanten Lebenszyklus und Verhaltens. Meine Körperlänge beträgt etwa 6-8 mm, und meine Flügel sind mit wunderschönen, bunten Mustern versehen, die mich von anderen Fliegen unterscheiden. Diese Muster helfen mir nicht nur, potenzielle Partner anzulocken, sondern auch, mich vor Feinden zu tarnen.
22/23.06.2024
- Ich erzähle dir gerne etwas über mich aus meiner Perspektive.
Ich bin eine ziemlich auffällige Fliege, nicht nur wegen meines hübschen Aussehens, sondern auch wegen meines interessanten Lebenszyklus und Verhaltens. Meine Körperlänge beträgt etwa 6-8 mm, und meine Flügel sind mit wunderschönen, bunten Mustern versehen, die mich von anderen Fliegen unterscheiden. Diese Muster helfen mir nicht nur, potenzielle Partner anzulocken, sondern auch, mich vor Feinden zu tarnen.
Ich bevorzuge warme, sonnige Lebensräume und bin oft in offenen Wäldern, auf Wiesen und an Waldrändern zu finden. Besonders gerne halte ich mich in der Nähe von verrottendem Pflanzenmaterial auf, da dies eine wichtige Nahrungsquelle für mich ist. Als erwachsene Fliege ernähre ich mich von Nektar, Pollen und verschiedenen organischen Substanzen, die ich auf Blättern und Blüten finde.
Ein wichtiger Teil meines Lebenszyklus ist die Fortpflanzung. Die Weibchen legen ihre Eier oft in verrottendem Pflanzenmaterial oder in feuchtem Boden ab. Sobald die Larven schlüpfen, ernähren sie sich von diesem Material und tragen so zur Zersetzung und Nährstoffrecycling bei. Dieser Prozess ist wichtig für das Ökosystem, da er hilft, organisches Material zu zersetzen und den Boden zu verbessern.
Ich bin nicht nur schön anzusehen, sondern spiele auch eine Rolle im ökologischen Gleichgewicht. Indem ich zur Zersetzung von organischem Material beitrage und als Nahrungsquelle für andere Tiere diene, helfe ich, das Gleichgewicht in meinem Lebensraum zu bewahren.
Wenn du mich entdeckst, freue ich mich, wenn du meine Lebensräume respektierst und schützt. Achte darauf, dass du keine verrottenden Pflanzenreste oder feuchten Boden zerstörst, in denen ich und meine Larven leben könnten. Indem du meine Umgebung schützt, trägst du dazu bei, dass ich weiterhin in einer gesunden und vielfältigen Umwelt leben kann.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch am 20.06.2024
Ein wichtiger Teil meines Lebenszyklus ist die Fortpflanzung. Die Weibchen legen ihre Eier oft in verrottendem Pflanzenmaterial oder in feuchtem Boden ab. Sobald die Larven schlüpfen, ernähren sie sich von diesem Material und tragen so zur Zersetzung und Nährstoffrecycling bei. Dieser Prozess ist wichtig für das Ökosystem, da er hilft, organisches Material zu zersetzen und den Boden zu verbessern.
Ich bin nicht nur schön anzusehen, sondern spiele auch eine Rolle im ökologischen Gleichgewicht. Indem ich zur Zersetzung von organischem Material beitrage und als Nahrungsquelle für andere Tiere diene, helfe ich, das Gleichgewicht in meinem Lebensraum zu bewahren.
Wenn du mich entdeckst, freue ich mich, wenn du meine Lebensräume respektierst und schützt. Achte darauf, dass du keine verrottenden Pflanzenreste oder feuchten Boden zerstörst, in denen ich und meine Larven leben könnten. Indem du meine Umgebung schützt, trägst du dazu bei, dass ich weiterhin in einer gesunden und vielfältigen Umwelt leben kann.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch am 20.06.2024
- Schöne Schmuckfliege (Otites formosa)
Artenschutz in Franken®
Ameisensackkäfer oder Ameisen-Blattkäfer (Clytra laeviuscula)

Ameisensackkäfer oder Ameisen-Blattkäfer (Clytra laeviuscula)
21/22.06.2024
Ich bin der Ameisensackkäfer oder Ameisen-Blattkäfer, Clytra laeviuscula. Mein Leben und meine Lebensweise sind ein Meisterwerk der Natur, das auf innovative und nachhaltige Weise funktioniert, im Sinne der nachfolgenden Generationen.
Innovation in meinem Leben
21/22.06.2024
Ich bin der Ameisensackkäfer oder Ameisen-Blattkäfer, Clytra laeviuscula. Mein Leben und meine Lebensweise sind ein Meisterwerk der Natur, das auf innovative und nachhaltige Weise funktioniert, im Sinne der nachfolgenden Generationen.
Innovation in meinem Leben
Meine Fortpflanzungsstrategie ist besonders innovativ. Ich lege meine Eier in einen schützenden Kokon, den ich geschickt an den Eingängen von Ameisennestern platziere. Die Ameisen, ohne sich dessen bewusst zu sein, tragen diesen Kokon in ihr Nest und kümmern sich um ihn, als wäre er ihr eigener. Dies sichert meinen Nachkommen Schutz und Nahrung in einer Umgebung, die ansonsten für uns unzugänglich wäre. Diese Taktik ist nicht nur genial, sondern auch ein hervorragendes Beispiel für die Nutzung vorhandener Ressourcen ohne zusätzliche Belastung der Umwelt.
Nachhaltigkeit meiner Lebensweise
Unsere Beziehung zu den Ameisenkolonien ist nachhaltig. Wir leben in Koexistenz mit den Ameisen und nutzen deren Schutz, ohne ihre Kolonien zu zerstören oder auszubeuten. Sobald meine Larven schlüpfen, ernähren sie sich von Abfällen und organischem Material im Nest der Ameisen, was zur Sauberkeit des Nestes beiträgt. Dies zeigt, dass unser Lebenszyklus in das bestehende Ökosystem integriert ist und es aufrecht erhält, anstatt es zu belasten.
Im Sinne nachfolgender Generationen
Unsere Lebensweise trägt dazu bei, dass die nächsten Generationen von Ameisensackkäfern eine gesunde und sichere Umgebung vorfinden. Durch die symbiotische Beziehung mit den Ameisen schaffen wir Bedingungen, die nicht nur unsere eigene Art schützen, sondern auch zur Stabilität der Ameisennester beitragen. Indem wir uns in diese ökologischen Nischen einfügen, helfen wir, die Balance des Ökosystems zu wahren, was langfristig auch anderen Arten zugutekommt. Dies ist im Sinne der Nachhaltigkeit und zum Wohl aller zukünftigen Generationen, sowohl unserer eigenen Art als auch der anderen Bewohner unseres Lebensraums.
Durch diese innovativen und nachhaltigen Methoden, die das Wohlergehen zukünftiger Generationen sichern, zeigen wir, dass selbst die kleinsten Lebewesen einen bedeutenden Beitrag zum Gleichgewicht und zur Erhaltung unserer Umwelt leisten können.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch am 16.06.2024
Nachhaltigkeit meiner Lebensweise
Unsere Beziehung zu den Ameisenkolonien ist nachhaltig. Wir leben in Koexistenz mit den Ameisen und nutzen deren Schutz, ohne ihre Kolonien zu zerstören oder auszubeuten. Sobald meine Larven schlüpfen, ernähren sie sich von Abfällen und organischem Material im Nest der Ameisen, was zur Sauberkeit des Nestes beiträgt. Dies zeigt, dass unser Lebenszyklus in das bestehende Ökosystem integriert ist und es aufrecht erhält, anstatt es zu belasten.
Im Sinne nachfolgender Generationen
Unsere Lebensweise trägt dazu bei, dass die nächsten Generationen von Ameisensackkäfern eine gesunde und sichere Umgebung vorfinden. Durch die symbiotische Beziehung mit den Ameisen schaffen wir Bedingungen, die nicht nur unsere eigene Art schützen, sondern auch zur Stabilität der Ameisennester beitragen. Indem wir uns in diese ökologischen Nischen einfügen, helfen wir, die Balance des Ökosystems zu wahren, was langfristig auch anderen Arten zugutekommt. Dies ist im Sinne der Nachhaltigkeit und zum Wohl aller zukünftigen Generationen, sowohl unserer eigenen Art als auch der anderen Bewohner unseres Lebensraums.
Durch diese innovativen und nachhaltigen Methoden, die das Wohlergehen zukünftiger Generationen sichern, zeigen wir, dass selbst die kleinsten Lebewesen einen bedeutenden Beitrag zum Gleichgewicht und zur Erhaltung unserer Umwelt leisten können.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch am 16.06.2024
- Ameisensackkäfer oder Ameisen-Blattkäfer (Clytra laeviuscula)
Artenschutz in Franken®
Ausgehüpft? - Der Springfrosch ...

Wanderer mit Sprungtalent: Unserem Springfrosch kann geholfen werden
Brauner Frosch auf Gras
21/22.06.2024
Freising. Obwohl nur 8 Zentimeter groß, wandert er weite Strecken und kann bis zu 2 Meter weit springen – unser heimischer Springfrosch. Um in geeigneten Gewässern für Nachwuchs sorgen zu können, durchquert er Laubwälder und Wiesen. Dabei muss er einige Hürden nehmen - speziell im bayerischen Alpenraum kann er Unterstützung gut gebrauchen.
Brauner Frosch auf Gras
21/22.06.2024
Freising. Obwohl nur 8 Zentimeter groß, wandert er weite Strecken und kann bis zu 2 Meter weit springen – unser heimischer Springfrosch. Um in geeigneten Gewässern für Nachwuchs sorgen zu können, durchquert er Laubwälder und Wiesen. Dabei muss er einige Hürden nehmen - speziell im bayerischen Alpenraum kann er Unterstützung gut gebrauchen.
Der heimische Springfrosch ähnelt im Aussehen dem wesentlich weiter verbreiteten Grasfrosch. Von diesem unterscheidet sich der Springfrosch insbesondere durch seine spitzere Schnauze und die deutlich längeren Beine. Anzutreffen ist der Springfrosch in wärmeren Laubmischwäldern und benachbarten Kleingewässern. Zur Überwinterung benötigt diese Amphibienart Laubwälder mit Versteckmöglichkeiten, z.B. Wurzelteller oder Totholz.
Ab Ende Januar wandert der Springfrosch dann zur Fortpflanzung in Richtung kleiner Gewässer. Diese können sogar bis zu einem Kilometer entfernt vom Überwinterungsplatz liegen. Die Laichgewässer sollten flache Uferbereiche aufweisen und möglichst fischfrei sein, damit Laich und Kaulquappen nicht als Fischfutter enden. Nachdem die Laichballen an Unterwasservegetation befestigt wurden, begeben sich die Frösche zu ihren Sommerlebensräumen in benachbarte Laubmischwälder. Nach Schlupf und Kaulquappenzeit gehen ab Juni auch die jungen Hüpferlinge an Land.
Der Springfrosch (Rana dalmatina) zählt zu den europaweit geschützten Arten der Fauna-Flora-Habitat-Richt-linie (FFH-RL). Im nationalen FFH-Bericht 2019 wurde der Erhaltungszustand der Art als „günstig“ bewertet, im Alpenraum aber als „unzureichend“ mit negativem Trend eingestuft. Um den günstigen Erhaltungszustand weiterhin zu wahren bzw. diesen zu erreichen, ist deshalb aktives Handeln gefragt. Dem Springfrosch kann mit einfachen Maßnahmen zur Verbesserung seiner Lebensräume unter die Arme gegriffen werden: im Vordergrund stehen die Pflege der Laichgewässer, um Verlandung und Fischbesatz entgegenzuwirken sowie das zeitlich, örtlich und technisch abgestimmte Mähen, um die Verletzungsgefahr für wandernde Frösche zu reduzieren.
„Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer können dem Springfrosch mit einfachen Maßnahmen im Rahmen einer integrativen - das heißt den Waldnaturschutz berücksichtigenden - Waldbewirtschaftung helfen. Das erfordert natürlich ein besseres Verständnis für diese Art und vor allem, dass man den Springfrosch erkennt“, erklärt Enno Uhl, Leiter der Abteilung Biodiversität und Naturschutz der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft.
Genau deshalb hat die Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF) nun ein neues Merkblatt zum Springfrosch herausgegeben. Neben Erkennungsmerkmalen und Erhaltungsmaßnahmen um Lebensräume zu sichern oder zu verbessern, gibt das Merkblatt auch Hinweise zu Fördermöglichkeiten und Ansprechpartnern.
Quelle
Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft
Hans-Carl-von-Carlowitz-Platz 1
85354 Freising
Stand
07.06.2024
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung.Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
In der Aufnahme von Werner Müller
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Ab Ende Januar wandert der Springfrosch dann zur Fortpflanzung in Richtung kleiner Gewässer. Diese können sogar bis zu einem Kilometer entfernt vom Überwinterungsplatz liegen. Die Laichgewässer sollten flache Uferbereiche aufweisen und möglichst fischfrei sein, damit Laich und Kaulquappen nicht als Fischfutter enden. Nachdem die Laichballen an Unterwasservegetation befestigt wurden, begeben sich die Frösche zu ihren Sommerlebensräumen in benachbarte Laubmischwälder. Nach Schlupf und Kaulquappenzeit gehen ab Juni auch die jungen Hüpferlinge an Land.
Der Springfrosch (Rana dalmatina) zählt zu den europaweit geschützten Arten der Fauna-Flora-Habitat-Richt-linie (FFH-RL). Im nationalen FFH-Bericht 2019 wurde der Erhaltungszustand der Art als „günstig“ bewertet, im Alpenraum aber als „unzureichend“ mit negativem Trend eingestuft. Um den günstigen Erhaltungszustand weiterhin zu wahren bzw. diesen zu erreichen, ist deshalb aktives Handeln gefragt. Dem Springfrosch kann mit einfachen Maßnahmen zur Verbesserung seiner Lebensräume unter die Arme gegriffen werden: im Vordergrund stehen die Pflege der Laichgewässer, um Verlandung und Fischbesatz entgegenzuwirken sowie das zeitlich, örtlich und technisch abgestimmte Mähen, um die Verletzungsgefahr für wandernde Frösche zu reduzieren.
„Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer können dem Springfrosch mit einfachen Maßnahmen im Rahmen einer integrativen - das heißt den Waldnaturschutz berücksichtigenden - Waldbewirtschaftung helfen. Das erfordert natürlich ein besseres Verständnis für diese Art und vor allem, dass man den Springfrosch erkennt“, erklärt Enno Uhl, Leiter der Abteilung Biodiversität und Naturschutz der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft.
Genau deshalb hat die Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF) nun ein neues Merkblatt zum Springfrosch herausgegeben. Neben Erkennungsmerkmalen und Erhaltungsmaßnahmen um Lebensräume zu sichern oder zu verbessern, gibt das Merkblatt auch Hinweise zu Fördermöglichkeiten und Ansprechpartnern.
Quelle
Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft
Hans-Carl-von-Carlowitz-Platz 1
85354 Freising
Stand
07.06.2024
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung.Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
In der Aufnahme von Werner Müller
- Springfrosch
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Artenschutz in Franken®
Kükenflut: Sommersturmflut reißt Seevogelnachwuchs an der Nordseeküste mit sich

Kükenflut: Sommersturmflut reißt Seevogelnachwuchs an der Nordseeküste mit sich
21/22.06.2024
Ahrensburg / Norderoog, 11.06.2024. Am Sonntag wurde die Nordseeküste von einer Sommersturmflut getroffen. Für Menschen war diese mit einer Höhe von bis zu 1 Meter über dem mittleren Hochwasser nicht gefährlich.
Dramatisch war die Situation hingegen für den Nachwuchs der Küstenvögel auf den kleinen Halligen und in den Vorländern, berichtet Verein Jordsand. Schon mehrere Tage alte Küken oder noch bebrütete Eier wurden durch ein für den Frühsommer extremes Hochwasser überflutet, weggespült und sind ertrunken oder unterkühlt.
21/22.06.2024
Ahrensburg / Norderoog, 11.06.2024. Am Sonntag wurde die Nordseeküste von einer Sommersturmflut getroffen. Für Menschen war diese mit einer Höhe von bis zu 1 Meter über dem mittleren Hochwasser nicht gefährlich.
Dramatisch war die Situation hingegen für den Nachwuchs der Küstenvögel auf den kleinen Halligen und in den Vorländern, berichtet Verein Jordsand. Schon mehrere Tage alte Küken oder noch bebrütete Eier wurden durch ein für den Frühsommer extremes Hochwasser überflutet, weggespült und sind ertrunken oder unterkühlt.
„Der Zeitpunkt hätte nicht schlechter sein können“ sagt Veit Hennig 1. Vorsitzender des Vereins Jordsand. „Die meisten Brutvögel hatten schon kleine Küken, oder sie waren kurz vor dem Schlupf. Ob so spät in der Brutzeit eine Ersatzbrut begonnen und erfolgreich sein wird ist äußerst fraglich.“
Es wurden von der Elbmündung bis nach Nordfriesland Vorländereien und Salzmarschen länger als eine Stunde überflutet. In Nordfriesland stand das Wasser auf der Hallig Südfall bis an die Warft heran. Die Halligen Süderoog, Nordstrandischmoor und Norderoog wurden zu sehr großen Teilen überspült. Auch auf Hallig Gröde waren wichtige Brutkolonien von dem Landunter betroffen.
Nele Waltering, Vogelwartin des Vereins Jordsand auf Hallig Norderoog, bangte um den Nachwuchs der einzigen schleswig-holsteinischen Brutkolonie der Brandseeschwalben. Diese waren am Ende nur in Teilen betroffen. Bei einem Wasserstand von 65 Zentimeter über dem mittleren Hochwasser waren jedoch die Lachmöwen, Flussseeschwalben und Austernfischer in Not, da die Hallig weit über die Hälfte überschwemmt war.
„Es tut sehr weh, mit ansehen zu müssen, wie diese Vögel auf einen Schlag alles verlieren. Ich habe ihre Balz und Brut in den vergangenen Wochen verfolgt und muss nun hilflos zusehen wie die Flut Eier und Küken mit sich reißt“, berichtet die Vogelwartin.
Die gerade schlüpfenden Küken der Küstenseeschwalben waren zum Glück nicht betroffen, da ihre Kolonie etwas höher nahe den Pfahlbauten auf Norderoog liegt. Sie und die Hauptkolonie der Brandseeschwalben können auf der Internetseite www.klimahallig.de live über drei Webcams beobachtet werden. Das vom Land Schleswig-Holstein geförderte Projekt „Klimahallig Norderoog“ des Vereins Jordsand verfolgt das Ziel die dramatischen Auswirkungen des Klimawandels auf das sensible Ökosystem Wattenmeer zu veranschaulichen und die Öffentlichkeit darüber zu informieren.
Auch in Dithmarschen waren bis in die Elbmündung hinein die großen Kolonien der Küstenvögel wie Säbelschnäbler oder Lachmöwe fast zwei Stunden unter Wasser. Im hamburgischen Wattenmeer waren vor allem die Vorländer der Insel Neuwerk betroffen.
Am Sonntag war Springtide – genau drei Tage nach Neumond läuft dann das Wasser höher auf und sinkt stärker ab. Zwischen einem Tiefdruckgebiet über Skandinavien und der Rückseite eines Hochdruckgebietes über Polen brausten Schauerböen von Westen mit einer Stärke von 6-8 Beaufort, in Spitzen sogar über 9 Bft heran, das sind über 75 Stundenkilometer.
Die Kombination von Meeresspiegelanstieg und Starkwind-Wetterlagen mitten in der Brutzeit gab es schon früher. Die Häufigkeit solcher „Kükenfluten“ nimmt aber gerade im Juni seit einigen Jahren signifikant zu. Die Wetterlagen haben sich durch den Klimawandel stark verändert, Starkwindereignisse aus Westen oder starke Hitzeperioden mit lang anhaltendem Ostwind machen den Tieren des Wattenmeeres von Muscheln bis zu den Vögeln sehr zu schaffen.
In der Aufnahme von Nele Waltering / Verein Jordsand
Quelle
Verein Jordsand zum Schutz der Seevögel und der Natur e. V.
Bornkampsweg 35
22926 Ahrensburg
11. Juni 2024
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung.Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Es wurden von der Elbmündung bis nach Nordfriesland Vorländereien und Salzmarschen länger als eine Stunde überflutet. In Nordfriesland stand das Wasser auf der Hallig Südfall bis an die Warft heran. Die Halligen Süderoog, Nordstrandischmoor und Norderoog wurden zu sehr großen Teilen überspült. Auch auf Hallig Gröde waren wichtige Brutkolonien von dem Landunter betroffen.
Nele Waltering, Vogelwartin des Vereins Jordsand auf Hallig Norderoog, bangte um den Nachwuchs der einzigen schleswig-holsteinischen Brutkolonie der Brandseeschwalben. Diese waren am Ende nur in Teilen betroffen. Bei einem Wasserstand von 65 Zentimeter über dem mittleren Hochwasser waren jedoch die Lachmöwen, Flussseeschwalben und Austernfischer in Not, da die Hallig weit über die Hälfte überschwemmt war.
„Es tut sehr weh, mit ansehen zu müssen, wie diese Vögel auf einen Schlag alles verlieren. Ich habe ihre Balz und Brut in den vergangenen Wochen verfolgt und muss nun hilflos zusehen wie die Flut Eier und Küken mit sich reißt“, berichtet die Vogelwartin.
Die gerade schlüpfenden Küken der Küstenseeschwalben waren zum Glück nicht betroffen, da ihre Kolonie etwas höher nahe den Pfahlbauten auf Norderoog liegt. Sie und die Hauptkolonie der Brandseeschwalben können auf der Internetseite www.klimahallig.de live über drei Webcams beobachtet werden. Das vom Land Schleswig-Holstein geförderte Projekt „Klimahallig Norderoog“ des Vereins Jordsand verfolgt das Ziel die dramatischen Auswirkungen des Klimawandels auf das sensible Ökosystem Wattenmeer zu veranschaulichen und die Öffentlichkeit darüber zu informieren.
Auch in Dithmarschen waren bis in die Elbmündung hinein die großen Kolonien der Küstenvögel wie Säbelschnäbler oder Lachmöwe fast zwei Stunden unter Wasser. Im hamburgischen Wattenmeer waren vor allem die Vorländer der Insel Neuwerk betroffen.
Am Sonntag war Springtide – genau drei Tage nach Neumond läuft dann das Wasser höher auf und sinkt stärker ab. Zwischen einem Tiefdruckgebiet über Skandinavien und der Rückseite eines Hochdruckgebietes über Polen brausten Schauerböen von Westen mit einer Stärke von 6-8 Beaufort, in Spitzen sogar über 9 Bft heran, das sind über 75 Stundenkilometer.
Die Kombination von Meeresspiegelanstieg und Starkwind-Wetterlagen mitten in der Brutzeit gab es schon früher. Die Häufigkeit solcher „Kükenfluten“ nimmt aber gerade im Juni seit einigen Jahren signifikant zu. Die Wetterlagen haben sich durch den Klimawandel stark verändert, Starkwindereignisse aus Westen oder starke Hitzeperioden mit lang anhaltendem Ostwind machen den Tieren des Wattenmeeres von Muscheln bis zu den Vögeln sehr zu schaffen.
In der Aufnahme von Nele Waltering / Verein Jordsand
- ... treibendes Lachmöwengelege
Quelle
Verein Jordsand zum Schutz der Seevögel und der Natur e. V.
Bornkampsweg 35
22926 Ahrensburg
11. Juni 2024
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung.Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Artenschutz in Franken®
Graue Gartenwanze (Rhaphigaster nebulosa)

Graue Gartenwanze (Rhaphigaster nebulosa)
20/21.06.2024
Ein innovativer Überlebenskünstler ... Als Graue Gartenwanze bin ich ein wahres Wunderwerk der Natur. Meine Art hat sich im Laufe der Zeit angepasst und entwickelt, um in verschiedenen Umgebungen zu überleben und zu gedeihen. Diese Innovationsfähigkeit ist ein Schlüssel zu unserem Erfolg.
20/21.06.2024
- Ich bin die Graue Gartenwanze, auch bekannt als Rhaphigaster nebulosa. Heute möchte ich dir aus meiner eigenen Sichtweise erzählen, wie ich mein Leben und meine Rolle in unserer gemeinsamen Umwelt sehe.
Ein innovativer Überlebenskünstler ... Als Graue Gartenwanze bin ich ein wahres Wunderwerk der Natur. Meine Art hat sich im Laufe der Zeit angepasst und entwickelt, um in verschiedenen Umgebungen zu überleben und zu gedeihen. Diese Innovationsfähigkeit ist ein Schlüssel zu unserem Erfolg.
Wir haben gelernt, in verschiedenen Lebensräumen zu leben, von Wäldern bis hin zu Gärten. Unser Panzer ist nicht nur ein Schutzschild gegen Raubtiere, sondern auch ein Werkzeug, das uns hilft, in unserer Umgebung getarnt zu bleiben. Unsere Fähigkeit, sich anzupassen und zu überleben, ist ein Paradebeispiel für innovative Evolution.
Nachhaltigkeit in jeder Bewegung
In meinem täglichen Leben achte ich darauf, Ressourcen effizient zu nutzen. Wir ernähren uns von Pflanzen und tragen so zur Regulierung der Pflanzenpopulationen bei, was ein Gleichgewicht in der Natur aufrechterhält. Unsere Fortpflanzung ist ebenfalls darauf ausgelegt, im Einklang mit unserer Umgebung zu bleiben. Wir legen unsere Eier an sicheren Orten ab, damit unsere Nachkommen eine gute Überlebenschance haben. Dies ist ein nachhaltiger Ansatz, der sicherstellt, dass wir unsere Umwelt nicht übermäßig belasten und im Einklang mit ihr leben.
Für die nächsten Generationen
Unser Verhalten und unsere Lebensweise sind darauf ausgerichtet, die Welt für die nachfolgenden Generationen, sowohl unserer eigenen Art als auch anderer Lebewesen, zu bewahren. Indem wir in Harmonie mit der Natur leben und unsere Populationen im Gleichgewicht halten, sorgen wir dafür, dass die Ressourcen, die wir nutzen, auch für zukünftige Generationen verfügbar bleiben. Wir tragen zur Artenvielfalt bei und spielen eine wichtige Rolle in unseren Ökosystemen. Unser Beitrag mag klein erscheinen, aber er ist essentiell für das größere Gleichgewicht der Natur.
Zusammengefasst
Ich, die Graue Gartenwanze, bin ein stolzer Vertreter einer innovativen und nachhaltigen Lebensweise. Unsere Anpassungsfähigkeit, unser effizientes Ressourcenmanagement und unser Engagement für eine lebenswerte Umwelt für die nächsten Generationen machen uns zu einem wichtigen Bestandteil der Natur. Wir sind ein Beispiel dafür, wie Lebewesen sich im Einklang mit ihrer Umgebung entwickeln und so zum Erhalt des natürlichen Gleichgewichts beitragen können.
Aufnahme von Bernhard Schmalisch
... mit "Graue Feldwanze" oder "Graue Gartenwanze" schlecht beschrieben ... Ich finde sie mit ihrer Zeichnung schön, diese Wanze.
Nachhaltigkeit in jeder Bewegung
In meinem täglichen Leben achte ich darauf, Ressourcen effizient zu nutzen. Wir ernähren uns von Pflanzen und tragen so zur Regulierung der Pflanzenpopulationen bei, was ein Gleichgewicht in der Natur aufrechterhält. Unsere Fortpflanzung ist ebenfalls darauf ausgelegt, im Einklang mit unserer Umgebung zu bleiben. Wir legen unsere Eier an sicheren Orten ab, damit unsere Nachkommen eine gute Überlebenschance haben. Dies ist ein nachhaltiger Ansatz, der sicherstellt, dass wir unsere Umwelt nicht übermäßig belasten und im Einklang mit ihr leben.
Für die nächsten Generationen
Unser Verhalten und unsere Lebensweise sind darauf ausgerichtet, die Welt für die nachfolgenden Generationen, sowohl unserer eigenen Art als auch anderer Lebewesen, zu bewahren. Indem wir in Harmonie mit der Natur leben und unsere Populationen im Gleichgewicht halten, sorgen wir dafür, dass die Ressourcen, die wir nutzen, auch für zukünftige Generationen verfügbar bleiben. Wir tragen zur Artenvielfalt bei und spielen eine wichtige Rolle in unseren Ökosystemen. Unser Beitrag mag klein erscheinen, aber er ist essentiell für das größere Gleichgewicht der Natur.
Zusammengefasst
Ich, die Graue Gartenwanze, bin ein stolzer Vertreter einer innovativen und nachhaltigen Lebensweise. Unsere Anpassungsfähigkeit, unser effizientes Ressourcenmanagement und unser Engagement für eine lebenswerte Umwelt für die nächsten Generationen machen uns zu einem wichtigen Bestandteil der Natur. Wir sind ein Beispiel dafür, wie Lebewesen sich im Einklang mit ihrer Umgebung entwickeln und so zum Erhalt des natürlichen Gleichgewichts beitragen können.
Aufnahme von Bernhard Schmalisch
... mit "Graue Feldwanze" oder "Graue Gartenwanze" schlecht beschrieben ... Ich finde sie mit ihrer Zeichnung schön, diese Wanze.
Artenschutz in Franken®
Veränderliche Krabbenspinne (Misumena vatia)

Veränderliche Krabbenspinne (Misumena vatia)
20/21.06.2024
Hier sind einige interessante Informationen über diese Spinnenart:
20/21.06.2024
- Die Veränderliche Krabbenspinne, wissenschaftlich bekannt als Misumena vatia, ist eine faszinierende Spinnenart, die für ihre Fähigkeit bekannt ist, ihre Körperfarbe zu ändern, um sich an ihre Umgebung anzupassen.
Hier sind einige interessante Informationen über diese Spinnenart:
Die Veränderliche Krabbenspinne ist relativ klein und hat einen kompakten Körperbau. Sie gehört zur Familie der Krabbenspinnen (Thomisidae). Ihre Farbe variiert von Weiß über Gelb bis hin zu Grün oder Braun. Diese Farbvariationen ermöglichen es der Spinne, sich auf Blumen oder Pflanzen zu verstecken und auf Beute zu lauern. Anders als viele andere Spinnen, die Netze weben, um ihre Beute zu fangen, ist die Veränderliche Krabbenspinne eine Lauerjägerin. Sie wartet geduldig auf Blüten oder anderen Strukturen und tarnt sich dabei oft geschickt, um Insekten anzulocken. Sobald ein potenzielles Beutetier in Reichweite ist, greift die Spinne blitzschnell zu.
Eine der bemerkenswertesten Eigenschaften der Veränderlichen Krabbenspinne ist ihre Fähigkeit, ihre Körperfarbe zu ändern. Diese Anpassung ermöglicht es ihr, sich perfekt an die Farbe der Blüten anzupassen, auf denen sie lauert. Auf diese Weise wird sie für ihre Beute nahezu unsichtbar. Die Veränderliche Krabbenspinne kommt in einer Vielzahl von Lebensräumen vor, einschließlich Gärten, Feldern, Wäldern und sogar städtischen Umgebungen. Sie ist häufig auf Blumen anzutreffen, wo sie auf ihre nächste Mahlzeit wartet.
Die Fortpflanzung der Veränderlichen Krabbenspinne erfolgt durch Paarung, bei der das Männchen Sperma auf ein spezielles Organ am Weibchen überträgt. Die Weibchen legen ihre Eier in einen Seidensack, den sie an einem geschützten Ort befestigen. Die Jungspinnen schlüpfen und durchlaufen mehrere Häutungen, bevor sie erwachsen werden.
Die Veränderliche Krabbenspinne ist eine beeindruckende Spinne, die sich durch ihre Anpassungsfähigkeit und ihr Jagdverhalten auszeichnet. Ihre Fähigkeit, ihre Farbe zu ändern, macht sie zu einem Meister der Tarnung und ermöglicht es ihr, erfolgreich Beute zu machen, während sie gleichzeitig potenzielle Feinde abwehrt.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
Veränderliche Krabbenspinnen mit erbeuteter Schwebfliege
Eine der bemerkenswertesten Eigenschaften der Veränderlichen Krabbenspinne ist ihre Fähigkeit, ihre Körperfarbe zu ändern. Diese Anpassung ermöglicht es ihr, sich perfekt an die Farbe der Blüten anzupassen, auf denen sie lauert. Auf diese Weise wird sie für ihre Beute nahezu unsichtbar. Die Veränderliche Krabbenspinne kommt in einer Vielzahl von Lebensräumen vor, einschließlich Gärten, Feldern, Wäldern und sogar städtischen Umgebungen. Sie ist häufig auf Blumen anzutreffen, wo sie auf ihre nächste Mahlzeit wartet.
Die Fortpflanzung der Veränderlichen Krabbenspinne erfolgt durch Paarung, bei der das Männchen Sperma auf ein spezielles Organ am Weibchen überträgt. Die Weibchen legen ihre Eier in einen Seidensack, den sie an einem geschützten Ort befestigen. Die Jungspinnen schlüpfen und durchlaufen mehrere Häutungen, bevor sie erwachsen werden.
Die Veränderliche Krabbenspinne ist eine beeindruckende Spinne, die sich durch ihre Anpassungsfähigkeit und ihr Jagdverhalten auszeichnet. Ihre Fähigkeit, ihre Farbe zu ändern, macht sie zu einem Meister der Tarnung und ermöglicht es ihr, erfolgreich Beute zu machen, während sie gleichzeitig potenzielle Feinde abwehrt.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
Veränderliche Krabbenspinnen mit erbeuteter Schwebfliege
Artenschutz in Franken®
Wanderfalke "trifft" auf regenerative Energie ... zum letzen Mal!
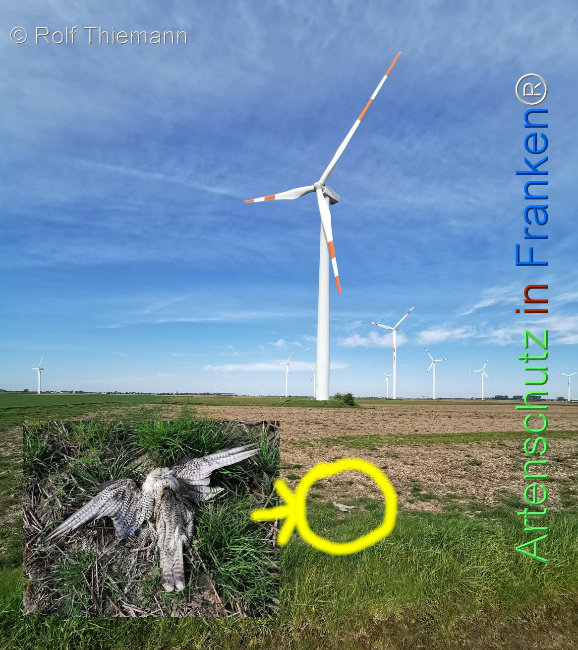
Herausforderungen der regenerativen Energie aus der Sichtweise des Wanderfalken, dessen Regenerationsfähigkeit mit dem "ersten Treffen" abgeschlossen war!
20/21.06.2024
Doch in den letzten Jahren habe ich bemerkt, dass sich meine Welt verändert hat. Hohe, seltsame Strukturen mit riesigen, sich drehenden Flügeln tauchen immer häufiger in meinen Lebensräumen auf. Diese Dinger nennen die Menschen Windkraftanlagen.
20/21.06.2024
- Ich bin ein Wanderfalke, ein schneller und wendiger Jäger der Lüfte. Meine Welt ist groß und weit, und ich durchfliege sie mit einer Geschwindigkeit und Präzision, die wenige andere Vögel erreichen können.
Doch in den letzten Jahren habe ich bemerkt, dass sich meine Welt verändert hat. Hohe, seltsame Strukturen mit riesigen, sich drehenden Flügeln tauchen immer häufiger in meinen Lebensräumen auf. Diese Dinger nennen die Menschen Windkraftanlagen.
Gefährdung durch Windkraftanlagen
Gefährliche Rotorblätter:
Verlust von Lebensraum:
Störung durch Bau und Betrieb:
Mögliche Schutzmaßnahmen
Ich hoffe, dass die Menschen verstehen, dass sie meinen Lebensraum und mein Überleben gefährden.
Hier sind einige Dinge, die sie tun könnten, um mir zu helfen:
Besserer Standort für Windkraftanlagen:
Sichtbare Markierungen:
Technische Hilfsmittel:
Schutzgebiete und Pufferzonen:
Zusammenarbeit und Verständnis
Ich bin nur ein Wanderfalke, aber ich hoffe, dass die Menschen verstehen, wie wichtig es ist, meine Lebensweise zu respektieren und zu schützen. Indem sie Maßnahmen ergreifen, um Windkraftanlagen sicherer für mich und meine Artgenossen zu machen, können sie helfen, unser Überleben zu sichern. Es ist möglich, sowohl erneuerbare Energie zu nutzen als auch die Artenvielfalt zu bewahren, wenn wir zusammenarbeiten und Rücksicht nehmen.
In der Aufnahme von Rolf Thiemann
Gefährliche Rotorblätter:
- Wenn ich im Sturzflug auf meine Beute zurase, konzentriere ich mich ganz auf sie. Die Rotorblätter der Windkraftanlagen drehen sich schnell und sind schwer zu sehen, besonders wenn ich im Jagdfieber bin. Eine Kollision mit einem dieser Blätter könnte tödlich für mich sein. Diese Gefahr ist immer präsent und macht mich nervös.
Verlust von Lebensraum:
- Windkraftanlagen verändern die Landschaft. Sie stehen oft in den weiten, offenen Gebieten, die ich zum Jagen brauche. Diese Gebiete werden weniger, und ich muss weiter fliegen, um geeignete Jagdgründe zu finden. Das kostet mich viel Energie und Zeit.
Störung durch Bau und Betrieb:
- Der Bau der Windkraftanlagen bringt Lärm und Unruhe. Dies stört meine Brutplätze und meine Ruhezeiten. Auch der Betrieb dieser Anlagen erzeugt Geräusche, die mein sensibles Gehör beeinträchtigen. All das macht es schwieriger für mich, in meiner Umgebung zu überleben und erfolgreich zu jagen.
Mögliche Schutzmaßnahmen
Ich hoffe, dass die Menschen verstehen, dass sie meinen Lebensraum und mein Überleben gefährden.
Hier sind einige Dinge, die sie tun könnten, um mir zu helfen:
Besserer Standort für Windkraftanlagen:
- Wenn die Menschen Windkraftanlagen an Orten bauen würden, die weit weg von meinen Brut- und Jagdgebieten liegen, wäre mein Leben sicherer. Ich könnte ohne ständige Angst vor Kollisionen fliegen und jagen.
Sichtbare Markierungen:
- Rotorblätter, die besser sichtbar sind, könnten mir helfen, sie rechtzeitig zu erkennen und zu vermeiden. Vielleicht könnten die Menschen sie mit Farben oder Mustern versehen, die ich gut sehen kann.
Technische Hilfsmittel:
- Moderne Technologien könnten dabei helfen, mich zu schützen. Radarsysteme könnten meine Anwesenheit erkennen und die Rotoren stoppen, wenn ich in der Nähe bin. So hätte ich eine Chance, sicher vorbeizufliegen.
Schutzgebiete und Pufferzonen:
- Wenn die Menschen Pufferzonen um meine Brutplätze und Jagdgebiete einrichten, könnten sie sicherstellen, dass ich genug Raum habe, um zu leben und zu jagen, ohne ständig auf diese gefährlichen Anlagen zu stoßen.
Zusammenarbeit und Verständnis
Ich bin nur ein Wanderfalke, aber ich hoffe, dass die Menschen verstehen, wie wichtig es ist, meine Lebensweise zu respektieren und zu schützen. Indem sie Maßnahmen ergreifen, um Windkraftanlagen sicherer für mich und meine Artgenossen zu machen, können sie helfen, unser Überleben zu sichern. Es ist möglich, sowohl erneuerbare Energie zu nutzen als auch die Artenvielfalt zu bewahren, wenn wir zusammenarbeiten und Rücksicht nehmen.
In der Aufnahme von Rolf Thiemann
- nicht einmal zwei Jahre durfte dieser durch eine Kollission mit den Rotorblatt einer Windkraftanlage getöteter Wanderfalke werden. Die Ringdaten am verendeten Tier waren hier eindeutig. Wie viele Tiere alljährlich an diese Anlage getötet werden kann nur geschätzt werden. Uns selbst liegen zahlreiche Nachweise von Tierschlagopfern hierzu vor. Lediglich an explitzit geeigneten Standorten kann die Installation von Windkraftanlagen von unserer Seite unterstützt werden.
Artenschutz in Franken®
Aktueller Ordner:
Archiv
Parallele Themen:
2019-11
2019-10
2019-12
2020-01
2020-02
2020-03
2020-04
2020-05
2020-06
2020-07
2020-08
2020-09
2020-10
2020-11
2020-12
2021-01
2021-02
2021-03
2021-04
2021-05
2021-06
2021-07
2021-08
2021-09
2021-10
2021-11
2021-12
2022-01
2022-02
2022-03
2022-04
2022-05
2022-06
2022-07
2022-08
2022-09
2022-10
2022-11
2022-12
2023-01
2023-02
2023-03
2023-04
2023-05
2023-06
2023-07
2023-08
2023-09
2023-10
2023-11
2023-12
2024-01
2024-02
2024-03
2024-04
2024-05
2024-06
2024-07
2024-08
2024-09
2024-10
2024-11
2024-12
2025-01
2025-02
2025-03
2025-04
2025-05
2025-06
2025-07
2025-08
2025-09
2025-10
2025-11
2025-12
















