Steinkauz im Kamin
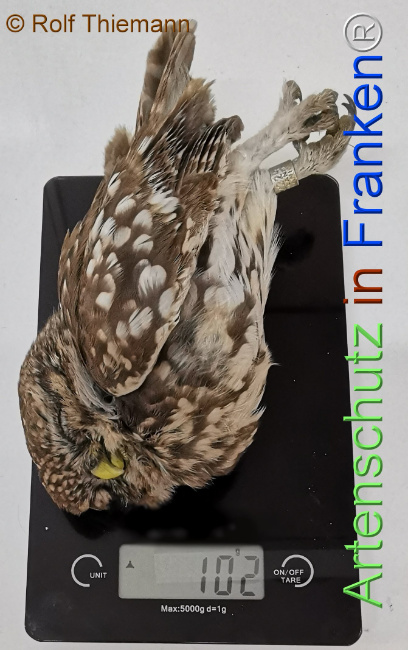
Steinkauz im Kamin
23/24.10.2024
Sie haben eine Vorliebe für alte, hohle Bäume oder auch Gebäudestrukturen wie Scheunen, Schuppen oder eben auch Kamine. Es gibt mehrere Gründe, warum Steinkäuze Kamine aufsuchen, aber auch warum sie dort häufig verenden können:
23/24.10.2024
- Steinkäuze sind kleine Eulen, die oft in ländlichen und halbländlichen Gebieten anzutreffen sind.
Sie haben eine Vorliebe für alte, hohle Bäume oder auch Gebäudestrukturen wie Scheunen, Schuppen oder eben auch Kamine. Es gibt mehrere Gründe, warum Steinkäuze Kamine aufsuchen, aber auch warum sie dort häufig verenden können:
- Nistplatzsuche: Steinkäuze suchen nach geeigneten Nistplätzen, die ihnen Sicherheit und Schutz bieten. Kamine können für sie attraktiv sein, da sie oft leer und dunkel sind, ähnlich wie natürliche Baumhöhlen, die sie normalerweise bevorzugen.
- Wärme und Schutz: Besonders im Winter bieten Kamine eine wärmere Umgebung als die Außentemperaturen. Für Steinkäuze kann dies eine willkommene Möglichkeit sein, um sich aufzuwärmen und vor den Elementen geschützt zu sein.
- Unbeabsichtigtes Hineinfliegen: Manchmal fliegen Steinkäuze unbeabsichtigt in Kamine hinein, besonders wenn sie in der Dämmerung oder Nacht unterwegs sind und die Öffnung des Kamins nicht gut erkennen können.
Warum Steinkäuze jedoch häufig in Kaminen verenden können:
- Schwieriger Ausstieg: Kamine haben oft eine glatte Innenwand, die es Vögeln schwer macht, wieder herauszukommen, sobald sie hineingeflogen sind. Für Steinkäuze, die relativ klein sind und nicht über eine starke Flugkraft verfügen, kann dies zu einem Problem werden.
- Mangelnde Fluchtmöglichkeiten: Wenn sie einmal im Kamin gefangen sind, haben Steinkäuze oft nicht genug Platz, um zu fliegen und sich zu bewegen. Dies kann zu Verletzungen führen oder dazu, dass sie an Erschöpfung sterben, bevor sie gerettet werden können.
- Rauch und Abgase: In benutzten oder schlecht gewarteten Kaminen können Rauch oder giftige Gase auftreten, die für die Vögel gefährlich oder tödlich sein können, insbesondere wenn sie längere Zeit dort feststecken.
Aufgrund dieser Risiken ist es wichtig, dass Kamine regelmäßig überprüft werden, insbesondere bevor sie wieder in Betrieb genommen werden. Es gibt auch verschiedene Maßnahmen, um Vögel wie Steinkäuze davon abzuhalten, in Kamine einzudringen, wie das Anbringen von Schutzgittern oder das Aufhängen von reflektierenden Objekten, die Vögel abschrecken können.
In den Aufnahmen von Rolf Thiemann
- Heute wurde ein Steinkauz in einem Hauskamin in 50189 Niederembt / Elsdorf gefunden.Der beringte Vogel wog 102 Gramm und war extrem abgemagert (Am Brustbein war links und rechts nichts mehr zu ertasten). Etwa 30 Minuten nachdem der Finder den Vogel brachte, ist er verendet.Die Ring-Nr. 4462224 Helgoland Germany wird zur Bestimmung in der Datenbank abgefragt. Mal schauen wie alt der Steinkauz war und woher er kam. Der Finder war über die Situation so schockiert, das er in naher Zukunft ein Gitter auf dem Kamin befestigt, damit so etwas nicht nochmal passiert.
Quelle
................................................................................
Gewässer und Naturschutz im Erftkreis
Flora-Fauna-Artenschutz
Naturschutzökologie
Rolf Thiemann
Naturschutzberater
Eisvogelweg 1
50181 Bedburg
Stand 14.10.2024
Artenschutz in Franken®
Der Kleiner Halsbock (Pseudovadonia livida)

Kleiner Halsbock (Pseudovadonia livida)
23/24.10.2024
Aber für dich einfach „Pseudovadonia livida“. Man könnte sagen, ich habe viele Namen, genau wie ich viele Lieblingsblüten habe. Ich bin klein, ich bin charmant, und ich bin immer auf der Suche nach dem nächsten Nektar-Spot. Lass mich dir ein bisschen aus meinem Leben erzählen, ich verspreche, es wird blumig!
23/24.10.2024
- Oh, hallo! Du hast mich erwischt – ich bin der Kleine Halsbock, manchmal auch als Bleicher Blütenbock oder Gelbflügeliger Halsbock bekannt.
Aber für dich einfach „Pseudovadonia livida“. Man könnte sagen, ich habe viele Namen, genau wie ich viele Lieblingsblüten habe. Ich bin klein, ich bin charmant, und ich bin immer auf der Suche nach dem nächsten Nektar-Spot. Lass mich dir ein bisschen aus meinem Leben erzählen, ich verspreche, es wird blumig!
Mein Look: Zwischen dezent und modisch
Als kleiner Käfer von etwa 6 bis 9 Millimetern Länge bin ich nicht der Größte, aber ich habe Stil. Mein Körper ist dunkelschwarz und, ich muss zugeben, ein bisschen schlicht. Aber warte – meine Flügeldecken? Die sind hellbraun bis gelblich, fast wie ein goldenes Cape, das im Sonnenlicht glänzt. Ein modischer Akzent, der mich von der Masse abhebt! Das macht mich zur perfekten Mischung aus dezent und auffällig, genau richtig, um in der Blütenwelt zu glänzen. Und apropos Glanz: Ich bin vielleicht kein Marienkäfer mit Punkten oder ein bunter Schmetterling, aber ich habe eine dezente Eleganz, die man zu schätzen wissen muss. Man nennt mich nicht ohne Grund „Bleicher Blütenbock“ – ich bin das Chamäleon der Blütenwiesen, immer angepasst, immer mittendrin.
Mein Lieblingshobby: Blütenbesuch
Im Sommer findest du mich eigentlich fast immer auf Blüten. Ich liebe Blüten! Besonders mag ich Doldenblütler und Korbblütler. Man könnte sagen, ich bin so etwas wie ein Blütensommelier – ich teste die besten Blüten der Saison und genieße jeden Tropfen Nektar. Mein Gaumen ist sehr fein, und ich bin wählerisch. Aber es ist nicht nur der Geschmack, der mich anzieht – Blüten sind auch der Ort, an dem sich alles abspielt. Sie sind unsere Cafés, unsere Lounges, unsere Tanzflächen. Wer die besten Blüten besucht, ist immer im Zentrum des Geschehens!
Ein Käfer auf einer Mission: Die Liebe des Lebens finden
Wie bei allen von uns geht es irgendwann auch bei mir um die Liebe. Ich suche nach der richtigen Partnerin, die mein Herz (und meine Blüten) erobert. Wenn ich sie finde, präsentieren wir uns gegenseitig auf den schönsten Blüten und tauschen Pheromone aus – das sind unsere kleinen duftenden Nachrichten. Es ist fast so, als würden wir uns mit Parfum benebeln, nur ein bisschen subtiler. Man könnte sagen, wir sind die Verliebten der Blütenwelt – und ja, manchmal geht es dabei auch ganz schön romantisch zu.
Mein Alltag: Zwischen Blüten und Abenteuer
Ein typischer Tag? Ganz einfach: Ich starte mit einem Frühstück in den Blüten. Danach surr’ ich ein bisschen herum, um neue Blütenfelder zu erkunden – immer auf der Suche nach dem besten Nektar und vielleicht einer netten Dame, die mein Herz schneller schlagen lässt. Aber natürlich gibt es auch Gefahren. Vögel und andere Räuber sehen in mir einen kleinen Snack – und da muss ich flink sein. Zum Glück bin ich ein geschickter Flieger und kann blitzschnell von Blüte zu Blüte wechseln. Aber manchmal, wenn die Sonne über der Wiese steht und alles in goldenem Licht erstrahlt, nehme ich mir einen Moment, um einfach innezuhalten. Ich denke dann darüber nach, wie vergänglich unser Leben ist. Wir sind kleine Käfer, und unsere Zeit in der Welt ist kurz. Das macht jeden Blütenbesuch umso kostbarer. Vielleicht ist das die große Lektion, die ich gelernt habe: Genieße die süßen Momente, solange sie da sind – und vielleicht auch ein bisschen Nektar mehr, als du brauchst.
Ein Käfer mit vielen Namen: Ein Rätsel für die Menschheit?
Dass man mich so viele verschiedene Namen gibt – Kleiner Halsbock, Bleicher Blütenbock, Gelbflügeliger Halsbock – zeigt, dass ich schwer zu fassen bin. Vielleicht bin ich zu vielseitig für einen einzigen Namen. Oder die Menschen wissen einfach nicht, was sie mit so einem charmanten, kleinen Kerl wie mir anfangen sollen! Ich sehe es so: Je mehr Namen, desto mehr Facetten meiner Persönlichkeit kommen zum Vorschein. Blütenbock klingt nach Romantiker, Gelbflügelig nach Entdecker, und Halsbock – naja, das klingt einfach cool.
Fazit: Ein kleiner Käfer mit großen Blütenträumen
Das Leben als Pseudovadonia livida ist kurz, aber voller Abenteuer. Ich bin ständig auf der Suche nach der nächsten tollen Blüte und der Liebe meines Lebens. Dabei genieße ich jeden Moment, sei es der Duft einer Blume oder das Kribbeln, wenn ich eine neue Blütenwiese entdecke. Denn, wie ich immer sage: Das Leben ist zu kurz für schlechte Blüten!
Also, wenn du das nächste Mal auf einer Sommerwiese spazieren gehst und ein kleiner, goldglänzender Käfer an dir vorbeifliegt – schau genau hin, es könnte gut sein, dass ich es bin. Und ich verspreche dir, ich bin genauso charmant, wie ich aussehe.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
Als kleiner Käfer von etwa 6 bis 9 Millimetern Länge bin ich nicht der Größte, aber ich habe Stil. Mein Körper ist dunkelschwarz und, ich muss zugeben, ein bisschen schlicht. Aber warte – meine Flügeldecken? Die sind hellbraun bis gelblich, fast wie ein goldenes Cape, das im Sonnenlicht glänzt. Ein modischer Akzent, der mich von der Masse abhebt! Das macht mich zur perfekten Mischung aus dezent und auffällig, genau richtig, um in der Blütenwelt zu glänzen. Und apropos Glanz: Ich bin vielleicht kein Marienkäfer mit Punkten oder ein bunter Schmetterling, aber ich habe eine dezente Eleganz, die man zu schätzen wissen muss. Man nennt mich nicht ohne Grund „Bleicher Blütenbock“ – ich bin das Chamäleon der Blütenwiesen, immer angepasst, immer mittendrin.
Mein Lieblingshobby: Blütenbesuch
Im Sommer findest du mich eigentlich fast immer auf Blüten. Ich liebe Blüten! Besonders mag ich Doldenblütler und Korbblütler. Man könnte sagen, ich bin so etwas wie ein Blütensommelier – ich teste die besten Blüten der Saison und genieße jeden Tropfen Nektar. Mein Gaumen ist sehr fein, und ich bin wählerisch. Aber es ist nicht nur der Geschmack, der mich anzieht – Blüten sind auch der Ort, an dem sich alles abspielt. Sie sind unsere Cafés, unsere Lounges, unsere Tanzflächen. Wer die besten Blüten besucht, ist immer im Zentrum des Geschehens!
Ein Käfer auf einer Mission: Die Liebe des Lebens finden
Wie bei allen von uns geht es irgendwann auch bei mir um die Liebe. Ich suche nach der richtigen Partnerin, die mein Herz (und meine Blüten) erobert. Wenn ich sie finde, präsentieren wir uns gegenseitig auf den schönsten Blüten und tauschen Pheromone aus – das sind unsere kleinen duftenden Nachrichten. Es ist fast so, als würden wir uns mit Parfum benebeln, nur ein bisschen subtiler. Man könnte sagen, wir sind die Verliebten der Blütenwelt – und ja, manchmal geht es dabei auch ganz schön romantisch zu.
Mein Alltag: Zwischen Blüten und Abenteuer
Ein typischer Tag? Ganz einfach: Ich starte mit einem Frühstück in den Blüten. Danach surr’ ich ein bisschen herum, um neue Blütenfelder zu erkunden – immer auf der Suche nach dem besten Nektar und vielleicht einer netten Dame, die mein Herz schneller schlagen lässt. Aber natürlich gibt es auch Gefahren. Vögel und andere Räuber sehen in mir einen kleinen Snack – und da muss ich flink sein. Zum Glück bin ich ein geschickter Flieger und kann blitzschnell von Blüte zu Blüte wechseln. Aber manchmal, wenn die Sonne über der Wiese steht und alles in goldenem Licht erstrahlt, nehme ich mir einen Moment, um einfach innezuhalten. Ich denke dann darüber nach, wie vergänglich unser Leben ist. Wir sind kleine Käfer, und unsere Zeit in der Welt ist kurz. Das macht jeden Blütenbesuch umso kostbarer. Vielleicht ist das die große Lektion, die ich gelernt habe: Genieße die süßen Momente, solange sie da sind – und vielleicht auch ein bisschen Nektar mehr, als du brauchst.
Ein Käfer mit vielen Namen: Ein Rätsel für die Menschheit?
Dass man mich so viele verschiedene Namen gibt – Kleiner Halsbock, Bleicher Blütenbock, Gelbflügeliger Halsbock – zeigt, dass ich schwer zu fassen bin. Vielleicht bin ich zu vielseitig für einen einzigen Namen. Oder die Menschen wissen einfach nicht, was sie mit so einem charmanten, kleinen Kerl wie mir anfangen sollen! Ich sehe es so: Je mehr Namen, desto mehr Facetten meiner Persönlichkeit kommen zum Vorschein. Blütenbock klingt nach Romantiker, Gelbflügelig nach Entdecker, und Halsbock – naja, das klingt einfach cool.
Fazit: Ein kleiner Käfer mit großen Blütenträumen
Das Leben als Pseudovadonia livida ist kurz, aber voller Abenteuer. Ich bin ständig auf der Suche nach der nächsten tollen Blüte und der Liebe meines Lebens. Dabei genieße ich jeden Moment, sei es der Duft einer Blume oder das Kribbeln, wenn ich eine neue Blütenwiese entdecke. Denn, wie ich immer sage: Das Leben ist zu kurz für schlechte Blüten!
Also, wenn du das nächste Mal auf einer Sommerwiese spazieren gehst und ein kleiner, goldglänzender Käfer an dir vorbeifliegt – schau genau hin, es könnte gut sein, dass ich es bin. Und ich verspreche dir, ich bin genauso charmant, wie ich aussehe.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- Der Kleine Halsbock ... erreicht als fertiger Käfer eine Körperlänge bis etwa 1 Zentimeter, wir erkennen ihn in unserer Region, dem Klimawandel geschuldet ab Ende April oder Anfang Mai. Während sich die Käfer für Doldenblütlern interessieren finden wir die Raupen vornehmlich in humuser Erde die von Pilzen gebildet wird, wo sie sich in einer mehrjährigen Phase entwickeln.
Artenschutz in Franken®
Die Schwarzfühler Borstenfliege (Nowickia ferox)

Schwarzfühler Borstenfliege (Nowickia ferox)
22/23.10.2024
Ja, ja, ich weiß – ich bin vielleicht nicht das glamouröseste Insekt im Garten, aber glaub mir, mein Leben hat Tiefgang. Und diese Borsten, die ich da habe, sind nicht nur für den Look! Lass mich dir erzählen, wie es ist, eine Fliege meines Kalibers zu sein.
22/23.10.2024
- Ah, grüß dich! Nowickia ferox, mein Name, oder wie ich in Fachkreisen genannt werde: die Schwarzfühler-Borstenfliege.
Ja, ja, ich weiß – ich bin vielleicht nicht das glamouröseste Insekt im Garten, aber glaub mir, mein Leben hat Tiefgang. Und diese Borsten, die ich da habe, sind nicht nur für den Look! Lass mich dir erzählen, wie es ist, eine Fliege meines Kalibers zu sein.
Mein Look: Borstig, aber elegant
Manche mögen mich als "wild" oder "rau" bezeichnen, aber ich sehe das als Kompliment. Meine dichte Behaarung und meine schwarzen Fühler – die mir übrigens meinen Namen geben – verleihen mir eine gewisse Robustheit. Ich bin quasi die tätowierte Rockerfliege unter den Dipteren. Insekten, die meinen Stil nicht zu schätzen wissen, finden mich vielleicht grimmig, aber ich nenne das: „Individueller Ausdruck“. Und ehrlich gesagt, wenn man so ein schweres Schicksal hat wie ich, dann muss man sich ein bisschen Härte zulegen.
Die Sache mit dem „ferox“ – es wird wild
Mein Artname, ferox, bedeutet „wild“ oder „heftig“. Und das ist kein Zufall, denn ich lebe ziemlich wild – im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin nämlich ein Parasit. Ja, du hast richtig gehört. Meine Damen legen ihre Eier auf Raupen von Schmetterlingen ab, die dann als lebende Futterboxen für unsere Larven dienen. Man könnte sagen, ich bin wie der Rächer der Fliegen: Unscheinbar, aber mit einer gewissen… nun ja, schlagkräftigen Methode. Aber bevor du mich vorschnell verurteilst: So funktioniert nun mal die Natur. Jeder hat seine Rolle, und meine ist es, das Gleichgewicht zu wahren. Während Schmetterlingsraupen friedlich durch die Welt kriechen, brauchen wir Borstenfliegen diesen kleinen Überlebensvorteil. Ein Gedanke, der mich manchmal selbst zum Grübeln bringt. Muss Leben immer auf Leben basieren? Ist das die Regel der Natur, die sich nicht ändern lässt? Ich trage meinen Teil zum Ökosystem bei, aber manchmal frage ich mich, ob ich nicht auch einfach... Blütenstaub sammeln könnte wie eine Biene. Aber naja, ich bin nun mal Nowickia ferox, keine Honigbiene.
Ein Tag im Leben einer Borstenfliege: Gar nicht so leicht!
Also, mein Tagesablauf? Nun ja, er ist eine Mischung aus Abenteuer, Jagd und ein bisschen nachdenklicher Melancholie. Morgens suche ich nach geeigneten Wirten – das ist der spannende Teil. Ich muss immer genau beobachten, wohin die Raupen sich verkriechen, und dann gilt es, den perfekten Moment abzuwarten. Nicht zu früh, nicht zu spät – alles muss sitzen. Es ist fast wie ein gefährliches Spiel. Stell dir das vor: Ich schwirre über den Pflanzen, verstecke mich in den Blättern und halte Ausschau nach potenziellen Zielen. Ein Adrenalinkick für eine kleine Fliege wie mich!
Und dann gibt es diese stillen Momente am Nachmittag. Die Sonne wärmt meine Borsten, und ich denke über mein Dasein nach. Bin ich wirklich ein Bösewicht? Oder bin ich nur ein kleines Rädchen im großen Räderwerk der Natur? Vielleicht bin ich ein Held, der sicherstellt, dass das Gleichgewicht gewahrt bleibt. Immerhin: Ohne mich gäbe es ein Übermaß an Schmetterlingsraupen – und dann hätten die Pflanzen keine Chance!
Partnerwahl und Liebe? Nicht so leicht, aber voller Hingabe!
Wenn ich mich mal verliebe, wird’s ernst. Bei uns Fliegen geht es um mehr als nur schnelles Glück – es geht ums Überleben der Art. Die Damen meiner Art legen großen Wert auf Stärke und Durchhaltevermögen. Nur die beste Raupe ist gut genug für die Eier. Ich muss sagen, das ist eine gewaltige Verantwortung. Manchmal wünsche ich mir ein entspannteres Leben, vielleicht als Fruchtfliege auf einer Banane. Aber hey, das ist nicht mein Weg. Ich bin Nowickia ferox, und ich trage das Erbe meiner Vorfahren in mir.
Fazit: Die Natur hat ihre eigenen Regeln
So, das ist mein Leben. Wild, borstig, ein bisschen grimmig und manchmal philosophisch. Ich bin stolz darauf, wer ich bin, auch wenn mein Lebensstil nicht jedermanns Geschmack ist. Denn wer kann schon sagen, dass er so nah am Herzschlag der Natur lebt wie ich? Manchmal, wenn ich über eine Wiese fliege und die Welt unter mir kleiner wird, denke ich, dass ich trotz aller Widrigkeiten genau am richtigen Ort bin. Ein kleines Rädchen, ja – aber ein wichtiges.
Und jetzt entschuldige mich – ich habe noch ein paar Raupen zu finden.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
Manche mögen mich als "wild" oder "rau" bezeichnen, aber ich sehe das als Kompliment. Meine dichte Behaarung und meine schwarzen Fühler – die mir übrigens meinen Namen geben – verleihen mir eine gewisse Robustheit. Ich bin quasi die tätowierte Rockerfliege unter den Dipteren. Insekten, die meinen Stil nicht zu schätzen wissen, finden mich vielleicht grimmig, aber ich nenne das: „Individueller Ausdruck“. Und ehrlich gesagt, wenn man so ein schweres Schicksal hat wie ich, dann muss man sich ein bisschen Härte zulegen.
Die Sache mit dem „ferox“ – es wird wild
Mein Artname, ferox, bedeutet „wild“ oder „heftig“. Und das ist kein Zufall, denn ich lebe ziemlich wild – im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin nämlich ein Parasit. Ja, du hast richtig gehört. Meine Damen legen ihre Eier auf Raupen von Schmetterlingen ab, die dann als lebende Futterboxen für unsere Larven dienen. Man könnte sagen, ich bin wie der Rächer der Fliegen: Unscheinbar, aber mit einer gewissen… nun ja, schlagkräftigen Methode. Aber bevor du mich vorschnell verurteilst: So funktioniert nun mal die Natur. Jeder hat seine Rolle, und meine ist es, das Gleichgewicht zu wahren. Während Schmetterlingsraupen friedlich durch die Welt kriechen, brauchen wir Borstenfliegen diesen kleinen Überlebensvorteil. Ein Gedanke, der mich manchmal selbst zum Grübeln bringt. Muss Leben immer auf Leben basieren? Ist das die Regel der Natur, die sich nicht ändern lässt? Ich trage meinen Teil zum Ökosystem bei, aber manchmal frage ich mich, ob ich nicht auch einfach... Blütenstaub sammeln könnte wie eine Biene. Aber naja, ich bin nun mal Nowickia ferox, keine Honigbiene.
Ein Tag im Leben einer Borstenfliege: Gar nicht so leicht!
Also, mein Tagesablauf? Nun ja, er ist eine Mischung aus Abenteuer, Jagd und ein bisschen nachdenklicher Melancholie. Morgens suche ich nach geeigneten Wirten – das ist der spannende Teil. Ich muss immer genau beobachten, wohin die Raupen sich verkriechen, und dann gilt es, den perfekten Moment abzuwarten. Nicht zu früh, nicht zu spät – alles muss sitzen. Es ist fast wie ein gefährliches Spiel. Stell dir das vor: Ich schwirre über den Pflanzen, verstecke mich in den Blättern und halte Ausschau nach potenziellen Zielen. Ein Adrenalinkick für eine kleine Fliege wie mich!
Und dann gibt es diese stillen Momente am Nachmittag. Die Sonne wärmt meine Borsten, und ich denke über mein Dasein nach. Bin ich wirklich ein Bösewicht? Oder bin ich nur ein kleines Rädchen im großen Räderwerk der Natur? Vielleicht bin ich ein Held, der sicherstellt, dass das Gleichgewicht gewahrt bleibt. Immerhin: Ohne mich gäbe es ein Übermaß an Schmetterlingsraupen – und dann hätten die Pflanzen keine Chance!
Partnerwahl und Liebe? Nicht so leicht, aber voller Hingabe!
Wenn ich mich mal verliebe, wird’s ernst. Bei uns Fliegen geht es um mehr als nur schnelles Glück – es geht ums Überleben der Art. Die Damen meiner Art legen großen Wert auf Stärke und Durchhaltevermögen. Nur die beste Raupe ist gut genug für die Eier. Ich muss sagen, das ist eine gewaltige Verantwortung. Manchmal wünsche ich mir ein entspannteres Leben, vielleicht als Fruchtfliege auf einer Banane. Aber hey, das ist nicht mein Weg. Ich bin Nowickia ferox, und ich trage das Erbe meiner Vorfahren in mir.
Fazit: Die Natur hat ihre eigenen Regeln
So, das ist mein Leben. Wild, borstig, ein bisschen grimmig und manchmal philosophisch. Ich bin stolz darauf, wer ich bin, auch wenn mein Lebensstil nicht jedermanns Geschmack ist. Denn wer kann schon sagen, dass er so nah am Herzschlag der Natur lebt wie ich? Manchmal, wenn ich über eine Wiese fliege und die Welt unter mir kleiner wird, denke ich, dass ich trotz aller Widrigkeiten genau am richtigen Ort bin. Ein kleines Rädchen, ja – aber ein wichtiges.
Und jetzt entschuldige mich – ich habe noch ein paar Raupen zu finden.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- die Raupenfliege Nowickia ferox ähnelt etwas der Igelfliege ... In der Landwirtschaft sind Raupenfliegen von großer Bedeutung bei der biologischen Schädlingsbekämpfung Zu unterscheiden an den schwarzen Stummelfühlern die sie aufweist
Artenschutz in Franken®
Der Gemeine Riesenschirmling (Macrolepiota procera)

Gemeiner Riesenschirmling (Macrolepiota procera)
22/23.10.2024
Zunächst aber möchte ich betonen, dass niemand Pilze sammeln oder essen sollte, ohne zuvor eine exakte Bestimmung durch einen Pilzfachmann (Mykologen) durchführen zu lassen. Einige Pilze, die mir ähnlich sehen, sind giftig und können schwerwiegende Vergiftungen verursachen.
22/23.10.2024
- Ich, der Gemeine Riesenschirmling, auch bekannt als Parasol oder Riesenschirmpilz, trage den wissenschaftlichen Namen Macrolepiota procera und möchte dir aus meiner Sicht etwas über mich erzählen.
Zunächst aber möchte ich betonen, dass niemand Pilze sammeln oder essen sollte, ohne zuvor eine exakte Bestimmung durch einen Pilzfachmann (Mykologen) durchführen zu lassen. Einige Pilze, die mir ähnlich sehen, sind giftig und können schwerwiegende Vergiftungen verursachen.
Mein Aussehen und Lebensraum
Ich bin ein stattlicher Pilz und kann mit meinem langen, schlanken Stiel und meinem großen, schirmartigen Hut, der bis zu 30 cm im Durchmesser erreicht, durchaus beeindruckend wirken. Mein Hut ist zunächst kugelig geschlossen und öffnet sich später zu einer weit aufgespannten, flachen Form. Auf meinem hellbraunen Hut erkennt man schuppenartige Flecken, die mir ein unverwechselbares Aussehen verleihen. Mein Stiel ist mit einer charakteristischen, verschiebbaren Ringzone ausgestattet und zeigt eine Schuppenstruktur, die mich wie eine „Schlange“ erscheinen lässt.
Man findet mich hauptsächlich in lichten Wäldern, an Waldrändern, aber auch auf Wiesen und Weiden. Ich bevorzuge nährstoffreiche Böden und bin im Spätsommer bis Herbst oft zu finden, wenn die Bedingungen feucht und warm genug sind. Besonders gerne wachse ich in kleinen Gruppen, aber auch allein stehe ich manchmal majestätisch da.
Mein ökologischer Beitrag
Als Pilz spiele ich eine bedeutende Rolle im Ökosystem. Ich bin ein Saprobiont, das heißt, ich baue abgestorbenes organisches Material ab und trage somit zur Zersetzung von Pflanzenresten bei. Dadurch helfe ich, Nährstoffe im Boden zu recyceln und die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten. Ohne Pilze wie mich wäre der Nährstoffkreislauf in Wäldern und auf Wiesen gestört, und die Pflanzengesellschaften könnten nicht so üppig gedeihen.
Verwechslungsmöglichkeiten und Gefahr
Obwohl ich ein bekannter und beliebter Speisepilz bin, sehe ich anderen, teilweise sehr giftigen Pilzen ähnlich, beispielsweise dem giftigen Safranschirmling (Chlorophyllum brunneum) oder dem Grünen Knollenblätterpilz (Amanita phalloides), der zu den gefährlichsten Pilzen gehört. Diese Verwechslungsgefahr kann lebensbedrohliche Folgen haben. Daher betone ich nochmals: Eine exakte Bestimmung durch einen erfahrenen Mykologen ist unerlässlich! Es gibt keine einfache Faustregel, die sicher vor Verwechslungen schützt, da viele Pilze ähnliche Merkmale aufweisen.
Mein Verbreitungsgebiet und Wuchszeit
Ich bin in weiten Teilen Europas heimisch und auch in Asien sowie Nordamerika anzutreffen. Ich wachse typischerweise von Spätsommer bis in den Herbst hinein. Meine Vorliebe für offene Waldlichtungen und Wegränder macht es leicht, mich zu finden, aber das Sammeln sollte, wie erwähnt, nur mit einer fundierten Bestimmung erfolgen.
Hinweis an alle Pilzsammler und -interessierten
Der Wald und die Wiese ist mein Zuhause, und ich spiele eine wichtige Rolle im Ökosystem. Aber ich weiß auch, dass manche Menschen mich als Delikatesse schätzen. Daher ist es wichtig, Verantwortung zu übernehmen: Pilze sollten nie ohne Fachkenntnis gesammelt und verzehrt werden, und zur Sicherheit sollte immer ein Pilzexperte oder Expertin hinzugezogen werden. Ich möchte nicht, dass jemand durch Unachtsamkeit Schaden nimmt oder eine Verwechslung zur Gefahr wird.
Genieße den Wald und die Wiese, schätze die Vielfalt der Pilze und ihrer ökologischen Rolle – aber sei vorsichtig und verantwortungsvoll! Im Idealfall lässt Du sie stehen und siehst sie dir lediglich an!
Aufnahme von Jasmin Wegener
- Der Gemeine Riesenschirmling (Macrolepiota procera)
Artenschutz in Franken®
Die Punktierte Zartschrecke (Leptophyes punctatissima)

Punktierte Zartschrecke
21/22.10.2024
Ich bin zwar nur ein kleiner Vertreter der Heuschrecken, aber das heißt nicht, dass mein Leben langweilig ist – ganz im Gegenteil! Lass mich dir erzählen, wie es so ist, in meiner Haut zu stecken (übrigens: schön grün mit vielen charmanten kleinen Punkten, falls du dich fragst).
21/22.10.2024
- Oh, hallo! Schön, dass du dich für mich, die Punktierte Zartschrecke, interessierst – oder, wie meine Freunde mich nennen: Lepto oder Pünktchen.
Ich bin zwar nur ein kleiner Vertreter der Heuschrecken, aber das heißt nicht, dass mein Leben langweilig ist – ganz im Gegenteil! Lass mich dir erzählen, wie es so ist, in meiner Haut zu stecken (übrigens: schön grün mit vielen charmanten kleinen Punkten, falls du dich fragst).
Der Körperbau: Zart, aber oho!
Ich bin nur etwa 1,5 bis 2 Zentimeter groß. Klein, oder? Aber das hat seine Vorteile – ich passe fast überall hin, vor allem in dichte Vegetation. Mit meinen langen Fühlern (ja, die sind tatsächlich länger als mein ganzer Körper!) erkunde ich meine Umgebung. Die sind praktisch wie meine eigenen Superantennen, mit denen ich fast alles erfühlen kann. Und diese hübschen Punkte auf meinem Körper? Das sind nicht nur Schönheitsmerkmale – sie helfen mir, mich perfekt im Blattwerk zu tarnen. Modischer Tarnanzug, könnte man sagen!
Was steht auf dem Speiseplan?
Was ich gerne esse? Nun, ich bin ein Gourmet, der es gern grün mag. Blätter, Blüten und junge Triebe sind mein absolutes Lieblingsessen. Natürlich achte ich dabei immer auf Qualität und Frische – ich will ja schließlich nicht die Fruchtfliege im Salat haben! Es gibt so viele leckere Pflanzen, die ich naschen kann, und als Meister der Blattakrobatik klettere ich überall hin, um an die besten Stellen zu kommen.
Die Sache mit dem Singen... oder eher dem Knistern
Du fragst dich sicher, ob ich auch so schön zirpen kann wie andere meiner Kollegen. Leider muss ich dich enttäuschen – ich bin keine große Sängerin. Ich mache eher ein zartes Knistern, wenn ich mich paaren will. Es klingt ein bisschen so, als würde man zwei Blätter sanft aneinander reiben – nicht so laut wie bei den Grillen, aber hey, wer’s subtil mag, wird meinen Sound lieben. Romantik geht auch leise!
Liebe auf Grashalme
Apropos Romantik: Bei uns Punktierten Zartschrecken geht es da sehr aufmerksam zu. Wenn ich auf der Suche nach einem Partner bin, achte ich genau darauf, wer da so durchs Gras hopst. Wir Damen haben nämlich ganz schön hohe Ansprüche! Und die Herren beeindrucken uns mit ihren ballettartigen Bewegungen. Der Tanz ist entscheidend – wer mich charmant umgarnt, bekommt die Chance, mir ein Geschenk zu überreichen: eine sogenannte Spermatophylax, die mir nicht nur seine Zuneigung, sondern auch ein paar Nährstoffe schenkt. Praktisch, oder? Liebe geht bei uns eben auch durch den Magen.
Ein perfekter Tag im Leben einer Punktierten Zartschrecke
Ich verbringe meine Tage am liebsten in der Sonne, sitze auf einem Grashalm und lasse mir den Wind um die Fühler wehen. Ab und zu husche ich durch die Wiesen, um einen leckeren Snack zu finden oder neue Abenteuer zu erleben – es gibt immer etwas zu entdecken. Ein bisschen Klettern, ein bisschen Knabbern, ein bisschen Plaudern mit den Nachbarn (denn auch die haben viele Geschichten zu erzählen) – das ist mein Traumtag.
Die Herausforderung: Winterzeit
Der Winter ist für mich und meine Artgenossen die wohl größte Herausforderung. Aber keine Sorge, wir haben einen Trick auf Lager. Unsere Eier überdauern den Winter, gut versteckt in der Erde oder im Pflanzenmaterial. Das bedeutet, wir haben uns praktisch eine kleine „Pause“ gegönnt, bis es im Frühling wieder losgeht. Man könnte sagen, ich habe mein eigenes kleines Schlafquartier gebucht, nur dass ich selbst nicht mehr da bin – aber meine kleinen Nachkommen sind es!
Fazit: Klein, aber mit Charme!
Ich bin vielleicht nicht die lauteste, größte oder auffälligste Heuschrecke, aber ich habe Charme und lebe ein Leben voller kleiner Freuden. Ob ich mich durchs Gras schlage, auf Blättern surfe oder bei Sonnenuntergang das sanfte Knistern meiner Artgenossen lausche – das Leben als Punktierte Zartschrecke ist alles andere als langweilig.
Also, wenn du das nächste Mal eine winzige, grüne Schrecke mit Punkten siehst, denk daran: Es könnte Pünktchen sein, die sich durch die Wiese hüpft und ihren kleinen, großen Abenteuern nachgeht!
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
Ich bin nur etwa 1,5 bis 2 Zentimeter groß. Klein, oder? Aber das hat seine Vorteile – ich passe fast überall hin, vor allem in dichte Vegetation. Mit meinen langen Fühlern (ja, die sind tatsächlich länger als mein ganzer Körper!) erkunde ich meine Umgebung. Die sind praktisch wie meine eigenen Superantennen, mit denen ich fast alles erfühlen kann. Und diese hübschen Punkte auf meinem Körper? Das sind nicht nur Schönheitsmerkmale – sie helfen mir, mich perfekt im Blattwerk zu tarnen. Modischer Tarnanzug, könnte man sagen!
Was steht auf dem Speiseplan?
Was ich gerne esse? Nun, ich bin ein Gourmet, der es gern grün mag. Blätter, Blüten und junge Triebe sind mein absolutes Lieblingsessen. Natürlich achte ich dabei immer auf Qualität und Frische – ich will ja schließlich nicht die Fruchtfliege im Salat haben! Es gibt so viele leckere Pflanzen, die ich naschen kann, und als Meister der Blattakrobatik klettere ich überall hin, um an die besten Stellen zu kommen.
Die Sache mit dem Singen... oder eher dem Knistern
Du fragst dich sicher, ob ich auch so schön zirpen kann wie andere meiner Kollegen. Leider muss ich dich enttäuschen – ich bin keine große Sängerin. Ich mache eher ein zartes Knistern, wenn ich mich paaren will. Es klingt ein bisschen so, als würde man zwei Blätter sanft aneinander reiben – nicht so laut wie bei den Grillen, aber hey, wer’s subtil mag, wird meinen Sound lieben. Romantik geht auch leise!
Liebe auf Grashalme
Apropos Romantik: Bei uns Punktierten Zartschrecken geht es da sehr aufmerksam zu. Wenn ich auf der Suche nach einem Partner bin, achte ich genau darauf, wer da so durchs Gras hopst. Wir Damen haben nämlich ganz schön hohe Ansprüche! Und die Herren beeindrucken uns mit ihren ballettartigen Bewegungen. Der Tanz ist entscheidend – wer mich charmant umgarnt, bekommt die Chance, mir ein Geschenk zu überreichen: eine sogenannte Spermatophylax, die mir nicht nur seine Zuneigung, sondern auch ein paar Nährstoffe schenkt. Praktisch, oder? Liebe geht bei uns eben auch durch den Magen.
Ein perfekter Tag im Leben einer Punktierten Zartschrecke
Ich verbringe meine Tage am liebsten in der Sonne, sitze auf einem Grashalm und lasse mir den Wind um die Fühler wehen. Ab und zu husche ich durch die Wiesen, um einen leckeren Snack zu finden oder neue Abenteuer zu erleben – es gibt immer etwas zu entdecken. Ein bisschen Klettern, ein bisschen Knabbern, ein bisschen Plaudern mit den Nachbarn (denn auch die haben viele Geschichten zu erzählen) – das ist mein Traumtag.
Die Herausforderung: Winterzeit
Der Winter ist für mich und meine Artgenossen die wohl größte Herausforderung. Aber keine Sorge, wir haben einen Trick auf Lager. Unsere Eier überdauern den Winter, gut versteckt in der Erde oder im Pflanzenmaterial. Das bedeutet, wir haben uns praktisch eine kleine „Pause“ gegönnt, bis es im Frühling wieder losgeht. Man könnte sagen, ich habe mein eigenes kleines Schlafquartier gebucht, nur dass ich selbst nicht mehr da bin – aber meine kleinen Nachkommen sind es!
Fazit: Klein, aber mit Charme!
Ich bin vielleicht nicht die lauteste, größte oder auffälligste Heuschrecke, aber ich habe Charme und lebe ein Leben voller kleiner Freuden. Ob ich mich durchs Gras schlage, auf Blättern surfe oder bei Sonnenuntergang das sanfte Knistern meiner Artgenossen lausche – das Leben als Punktierte Zartschrecke ist alles andere als langweilig.
Also, wenn du das nächste Mal eine winzige, grüne Schrecke mit Punkten siehst, denk daran: Es könnte Pünktchen sein, die sich durch die Wiese hüpft und ihren kleinen, großen Abenteuern nachgeht!
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- ... sie sind auf Blättern durch ihre Zeichnung gut getarnt, die Zartschrecken
Artenschutz in Franken®
Eingeschleppter Pilz bedroht Latschenkiefer
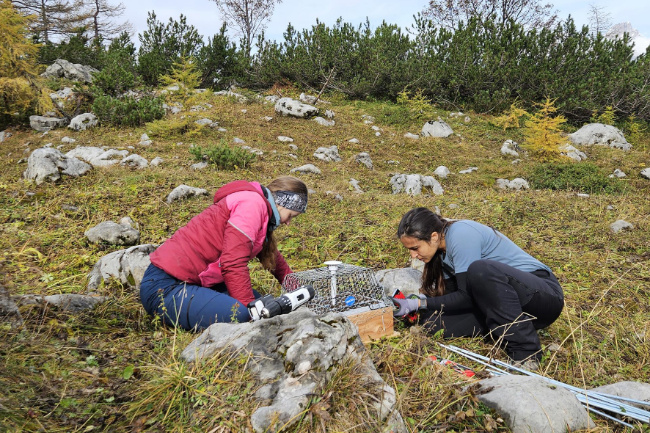
Eingeschleppter Pilz bedroht Latschenkiefer
21/22.10.2024
Braune Nadelspitzen, schwindende Vitalität und ein Absterben der Bäume bei mehrjährigem Befall: 2022 wiesen Forschende die so genannte „Braunfleckenkrankheit“ erstmals an Latschenkiefern im Berchtesgadener Talkessel und im Nationalpark nach.
Heuer startete die Nationalparkverwaltung ein Projekt zur Erforschung der Krankheit, die durch einen aus Nord- und Mittelamerika eingeschleppten Pilz ausgelöst wird. Mit ersten Ergebnissen ist in rund zwei Jahren zu rechnen.
21/22.10.2024
- Neues Forschungsprojekt im Nationalpark
Braune Nadelspitzen, schwindende Vitalität und ein Absterben der Bäume bei mehrjährigem Befall: 2022 wiesen Forschende die so genannte „Braunfleckenkrankheit“ erstmals an Latschenkiefern im Berchtesgadener Talkessel und im Nationalpark nach.
Heuer startete die Nationalparkverwaltung ein Projekt zur Erforschung der Krankheit, die durch einen aus Nord- und Mittelamerika eingeschleppten Pilz ausgelöst wird. Mit ersten Ergebnissen ist in rund zwei Jahren zu rechnen.
Die Latsche ist eine Charakterart im Nationalpark Berchtesgaden und von großer Bedeutung für die Gebirgsökosysteme im Schutzgebiet. „Sie stabilisiert den Boden, fördert die Humusbildung und sorgt für ein ausgeglichenes Mikroklima. Die Latsche ermöglicht es anderen Pflanzen, sich in rauer Umgebung zu etablieren und bietet Lebensraum für Mikroorganismen, Pilze, Pflanzen und Tiere“, erklärt Projektleiterin Barbara de Araujo die Bedeutung der robusten Baumart, die im Schutzwald außerdem Bodenerosion und Nährstoffverlust durch Lawinen oder Steinschlag entgegenwirkt.
Im Nationalpark sind rund 1.700 Hektar mit Latschen bewachsen, das sind 15 Prozent der mit Holzgewächsen bestockten Gesamtfläche. Dabei kommen sie vorrangig in Höhenstufen zwischen 1.200 und 1.900 m vor. Aktuell untersuchen Forschende im Wimbachtal die Auswirkungen der Latschengesundheit auf Mikroklima, Boden und Waldverjüngung.
Dazu wurden bis hinauf zum Trischüblpass 72 Holzkästen mit den Samen von vier verschiedenen Baumarten ausgebracht. Barbara de Araujo erforscht damit das Keim- und Anwuchsverhalten von Fichte, Zirbe, Bergahorn und Vogelbeere, die Teil der natürlichen Waldgesellschaft sind und häufig zusammen mit Latschen vorkommen. Ein Gitterkorb schützt die Saat vor tierischen Samensammlern und Pflanzenfressern. De Araujo und ihr Team haben die Kästen unter gesunden Latschen, kranken Latschen und im Offenland ausgebracht.
Mit dem Experiment möchten die Wissenschaftler herausfinden, wie die künftige Bergwalddynamik unter dem Einfluss des Pilzes aussehen könnte. Mit Ergebnissen rechnet de Araujo nach zwei Vegetationsperioden. Danach werden alle Installationen wieder aus der Fläche entfernt.
Das Projekt ist ein wichtiger Beitrag des Nationalparks zur Erforschung eines zunehmenden Problems der globalisierten Welt: Das Verschleppen von Arten in Ökosysteme, die an die Neuankömmlinge nicht angepasst sind. Weltweit trugen diese sogenannten „invasiven Arten“ bei 60 Prozent der ausgestorbenen Arten zu deren Verschwinden bei. Hinzu kommt, dass der Klimawandel dem neuen Pilz die Ausbreitung in höhere Gebirgslagen ermöglicht.
In der Aufnahme des Nationalparks Berchtesgaden
Quellenangabe
Nationalparkverwaltung Berchtesgaden
Doktorberg 6
83471 Berchtesgaden
Status
10.10.2024
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung.Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Im Nationalpark sind rund 1.700 Hektar mit Latschen bewachsen, das sind 15 Prozent der mit Holzgewächsen bestockten Gesamtfläche. Dabei kommen sie vorrangig in Höhenstufen zwischen 1.200 und 1.900 m vor. Aktuell untersuchen Forschende im Wimbachtal die Auswirkungen der Latschengesundheit auf Mikroklima, Boden und Waldverjüngung.
Dazu wurden bis hinauf zum Trischüblpass 72 Holzkästen mit den Samen von vier verschiedenen Baumarten ausgebracht. Barbara de Araujo erforscht damit das Keim- und Anwuchsverhalten von Fichte, Zirbe, Bergahorn und Vogelbeere, die Teil der natürlichen Waldgesellschaft sind und häufig zusammen mit Latschen vorkommen. Ein Gitterkorb schützt die Saat vor tierischen Samensammlern und Pflanzenfressern. De Araujo und ihr Team haben die Kästen unter gesunden Latschen, kranken Latschen und im Offenland ausgebracht.
Mit dem Experiment möchten die Wissenschaftler herausfinden, wie die künftige Bergwalddynamik unter dem Einfluss des Pilzes aussehen könnte. Mit Ergebnissen rechnet de Araujo nach zwei Vegetationsperioden. Danach werden alle Installationen wieder aus der Fläche entfernt.
Das Projekt ist ein wichtiger Beitrag des Nationalparks zur Erforschung eines zunehmenden Problems der globalisierten Welt: Das Verschleppen von Arten in Ökosysteme, die an die Neuankömmlinge nicht angepasst sind. Weltweit trugen diese sogenannten „invasiven Arten“ bei 60 Prozent der ausgestorbenen Arten zu deren Verschwinden bei. Hinzu kommt, dass der Klimawandel dem neuen Pilz die Ausbreitung in höhere Gebirgslagen ermöglicht.
In der Aufnahme des Nationalparks Berchtesgaden
- Nationalpark-Mitarbeiterin Barbara de Araujo (r.) erforscht im Rahmen ihrer Doktorarbeit die Auswirkungen der Braunfleckenkrankheit bei Latschenkiefern. Im Wimbachtal hat die Wissenschaftlerin ein Experiment gestartet, mit Ergebnissen ist in rund zwei Jahren zu rechnen.
Quellenangabe
Nationalparkverwaltung Berchtesgaden
Doktorberg 6
83471 Berchtesgaden
Status
10.10.2024
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung.Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Artenschutz in Franken®
Amphibiensterben -Getötet - mit nur einem Jahr an Lebenszeit

Amphibiensterben -Getötet - mit nur einem Jahr an Lebenszeit
20/21.10.2024
Diese Gefahr ist eng mit der Fragmentierung und Zerschneidung ihrer natürlichen Lebensräume durch Straßen und Verkehrswege verbunden. Im Folgenden wird dargelegt, warum dies ein ernstes Problem für Amphibienpopulationen darstellt und welche ökologischen und biologischen Mechanismen dahinterstecken.
20/21.10.2024
- Heimische Amphibien sind während ihrer Wanderungen zu Laichgewässern sowie zu ihren Sommer- und Winterlebensräumen einer erheblichen Gefahr ausgesetzt, wenn sie Straßen überqueren müssen.
Diese Gefahr ist eng mit der Fragmentierung und Zerschneidung ihrer natürlichen Lebensräume durch Straßen und Verkehrswege verbunden. Im Folgenden wird dargelegt, warum dies ein ernstes Problem für Amphibienpopulationen darstellt und welche ökologischen und biologischen Mechanismen dahinterstecken.
Amphibische Wanderungen: Ein kritisches Verhalten
Amphibien wie der Grasfrosch (Rana temporaria), die Erdkröte (Bufo bufo) und der Teichmolch (Lissotriton vulgaris) sind auf jährliche Wanderungen angewiesen, die sich aus ihrem komplexen Lebenszyklus und ihrer stark standortgebundenen Lebensweise ergeben. Diese Wanderungen sind essenziell, um ihre Laichgewässer zu erreichen, in denen sie ihre Eier ablegen und die Entwicklung der Larven stattfindet. Häufig handelt es sich bei diesen Gewässern um kleine Teiche oder temporäre Tümpel, die oft viele Kilometer von ihren Sommer- oder Winterquartieren entfernt sind.
Gefahren durch Straßenüberquerungen
Während der Wanderungen sind Amphibien gezwungen, Straßen zu überqueren, da diese Landschaftsbarrieren oft mitten durch ihre traditionellen Wanderkorridore verlaufen. Amphibien sind besonders gefährdet, da sie sich aufgrund ihrer Fortbewegungsweise langsam und meist während der Dämmerung oder nachts bewegen, wenn es kühler und feuchter ist. Diese Zeiten fallen jedoch häufig mit Zeiten zusammen, in denen Autofahrer durch schlechte Sichtverhältnisse beeinträchtigt sind und Amphibien kaum wahrnehmen können.
Die hohe Mortalitätsrate, die durch Überfahren verursacht wird, kann erhebliche Auswirkungen auf lokale Populationen haben. Bereits bei einer Überfahrquote von 10–30 % kann der Fortbestand einer Population gefährdet sein, da Amphibien oft ein hohes Alter erreichen müssen, um ihre Reproduktionsrate auszugleichen. Wenn viele Individuen während der Wanderung sterben, sinkt die Anzahl der potenziellen Fortpflanzungspartner drastisch, was langfristig zu einem Populationsrückgang oder sogar zum Aussterben lokaler Populationen führen kann.
Ökologische Konsequenzen der Straßenmortalität
Die Überfahrgefahr wirkt sich nicht nur auf Individuen aus, sondern hat tiefgreifende Folgen für ganze Amphibienpopulationen und die betroffenen Ökosysteme. Amphibien sind bedeutende Bioindikatoren und spielen eine zentrale Rolle in ihren Lebensräumen, sowohl als Räuber von Insekten als auch als Beutetiere für andere Tiere wie Vögel und Säugetiere. Ein Rückgang der Amphibienpopulationen führt zu einem Ungleichgewicht in den trophischen Netzwerken und kann negative Kaskadeneffekte auf andere Arten haben, die von Amphibien abhängig sind.
Fragmentierung und genetische Isolation
Straßen stellen nicht nur eine direkte Gefahr dar, sondern wirken auch als Barriere, die die Populationen fragmentiert und genetisch isoliert. Die regelmäßige Überquerung von Straßen ist oft nötig, um den genetischen Austausch zwischen Populationen aufrechtzuerhalten und Inzucht zu vermeiden. Wenn Amphibien aufgrund der Straßenmortalität oder anderer Hindernisse (z. B. Leitplanken) an der Überquerung gehindert werden, kann dies zur genetischen Verarmung und zur verringerten Widerstandsfähigkeit der Populationen gegenüber Krankheiten und Umweltveränderungen führen.
Schutzmaßnahmen und technische Lösungen
Um den negativen Einfluss von Straßen auf Amphibien zu minimieren, sind spezielle Schutzmaßnahmen notwendig. Amphibienleitsysteme wie Leitzäune und Tunnelsysteme, die unter Straßen hindurchführen, haben sich als effektiv erwiesen. Diese Systeme leiten die Amphibien sicher unter die Straße und verhindern so die Überquerung an gefährlichen Stellen. Zudem helfen temporäre Maßnahmen wie das Errichten von mobilen Amphibienzäunen während der Hauptwanderzeiten und das manuelle Umsetzen durch Naturschutzorganisationen, die Mortalität zu reduzieren.
Fazit
Amphibien sind durch Straßen während ihrer Wanderungen erheblich gefährdet, was direkte und indirekte Folgen für ihre Populationen und die Ökosysteme, in denen sie leben, hat. Die Zerschneidung und Fragmentierung ihrer Lebensräume durch Straßen führt zu hoher Mortalität und genetischer Isolation, was langfristig das Überleben vieler Arten gefährdet. Schutzmaßnahmen und die Berücksichtigung von Amphibienkorridoren bei der Planung von Infrastrukturen sind daher entscheidend, um die Biodiversität und die ökologischen Funktionen dieser wichtigen Artengruppe zu erhalten.
In der Aufnahme
Amphibien wie der Grasfrosch (Rana temporaria), die Erdkröte (Bufo bufo) und der Teichmolch (Lissotriton vulgaris) sind auf jährliche Wanderungen angewiesen, die sich aus ihrem komplexen Lebenszyklus und ihrer stark standortgebundenen Lebensweise ergeben. Diese Wanderungen sind essenziell, um ihre Laichgewässer zu erreichen, in denen sie ihre Eier ablegen und die Entwicklung der Larven stattfindet. Häufig handelt es sich bei diesen Gewässern um kleine Teiche oder temporäre Tümpel, die oft viele Kilometer von ihren Sommer- oder Winterquartieren entfernt sind.
Gefahren durch Straßenüberquerungen
Während der Wanderungen sind Amphibien gezwungen, Straßen zu überqueren, da diese Landschaftsbarrieren oft mitten durch ihre traditionellen Wanderkorridore verlaufen. Amphibien sind besonders gefährdet, da sie sich aufgrund ihrer Fortbewegungsweise langsam und meist während der Dämmerung oder nachts bewegen, wenn es kühler und feuchter ist. Diese Zeiten fallen jedoch häufig mit Zeiten zusammen, in denen Autofahrer durch schlechte Sichtverhältnisse beeinträchtigt sind und Amphibien kaum wahrnehmen können.
Die hohe Mortalitätsrate, die durch Überfahren verursacht wird, kann erhebliche Auswirkungen auf lokale Populationen haben. Bereits bei einer Überfahrquote von 10–30 % kann der Fortbestand einer Population gefährdet sein, da Amphibien oft ein hohes Alter erreichen müssen, um ihre Reproduktionsrate auszugleichen. Wenn viele Individuen während der Wanderung sterben, sinkt die Anzahl der potenziellen Fortpflanzungspartner drastisch, was langfristig zu einem Populationsrückgang oder sogar zum Aussterben lokaler Populationen führen kann.
Ökologische Konsequenzen der Straßenmortalität
Die Überfahrgefahr wirkt sich nicht nur auf Individuen aus, sondern hat tiefgreifende Folgen für ganze Amphibienpopulationen und die betroffenen Ökosysteme. Amphibien sind bedeutende Bioindikatoren und spielen eine zentrale Rolle in ihren Lebensräumen, sowohl als Räuber von Insekten als auch als Beutetiere für andere Tiere wie Vögel und Säugetiere. Ein Rückgang der Amphibienpopulationen führt zu einem Ungleichgewicht in den trophischen Netzwerken und kann negative Kaskadeneffekte auf andere Arten haben, die von Amphibien abhängig sind.
Fragmentierung und genetische Isolation
Straßen stellen nicht nur eine direkte Gefahr dar, sondern wirken auch als Barriere, die die Populationen fragmentiert und genetisch isoliert. Die regelmäßige Überquerung von Straßen ist oft nötig, um den genetischen Austausch zwischen Populationen aufrechtzuerhalten und Inzucht zu vermeiden. Wenn Amphibien aufgrund der Straßenmortalität oder anderer Hindernisse (z. B. Leitplanken) an der Überquerung gehindert werden, kann dies zur genetischen Verarmung und zur verringerten Widerstandsfähigkeit der Populationen gegenüber Krankheiten und Umweltveränderungen führen.
Schutzmaßnahmen und technische Lösungen
Um den negativen Einfluss von Straßen auf Amphibien zu minimieren, sind spezielle Schutzmaßnahmen notwendig. Amphibienleitsysteme wie Leitzäune und Tunnelsysteme, die unter Straßen hindurchführen, haben sich als effektiv erwiesen. Diese Systeme leiten die Amphibien sicher unter die Straße und verhindern so die Überquerung an gefährlichen Stellen. Zudem helfen temporäre Maßnahmen wie das Errichten von mobilen Amphibienzäunen während der Hauptwanderzeiten und das manuelle Umsetzen durch Naturschutzorganisationen, die Mortalität zu reduzieren.
Fazit
Amphibien sind durch Straßen während ihrer Wanderungen erheblich gefährdet, was direkte und indirekte Folgen für ihre Populationen und die Ökosysteme, in denen sie leben, hat. Die Zerschneidung und Fragmentierung ihrer Lebensräume durch Straßen führt zu hoher Mortalität und genetischer Isolation, was langfristig das Überleben vieler Arten gefährdet. Schutzmaßnahmen und die Berücksichtigung von Amphibienkorridoren bei der Planung von Infrastrukturen sind daher entscheidend, um die Biodiversität und die ökologischen Funktionen dieser wichtigen Artengruppe zu erhalten.
In der Aufnahme
- dieser kleine Springfrosch (zur Beachtung: Springfrösche werden immer wieder mit Grasfröschen verwechselt) wurde beim Versuch eine Staatsstraße zu überqueren getötet!
Artenschutz in Franken®
Finale Rückzugsräume - Artenschutz nur auf dem Papier?

Finale Rückzugsräume - Artenschutz nur auf dem Papier?
19/20.10.2024
Im Folgenden wird erläutert, warum Brachen so wertvoll sind und welche Folgen ihre Zerstörung für die Artenvielfalt und letztlich auch für das menschliche Leben hat.
19/20.10.2024
- Brachen spielen eine zentrale Rolle in der Erhaltung der Biodiversität, besonders in einer ausgeräumten landwirtschaftlichen Landschaft, in der natürliche Lebensräume selten geworden sind.
Im Folgenden wird erläutert, warum Brachen so wertvoll sind und welche Folgen ihre Zerstörung für die Artenvielfalt und letztlich auch für das menschliche Leben hat.
Strukturvielfalt und Habitatfunktion
Brachen sind ungenutzte, häufig brachliegende Flächen, die sich durch eine hohe Strukturvielfalt auszeichnen. Sie bieten verschiedenen Pflanzengesellschaften und Tierarten eine wertvolle Zuflucht, da sie im Vergleich zu intensiv genutzten Agrarflächen vielfältigere Mikrohabitate und Nischen aufweisen. Auf einer Brachfläche finden sich oft Gräser, Wildblumen, Büsche und manchmal auch junge Bäume. Diese Vegetationsstrukturen bieten Insekten, Vögeln, Reptilien und kleinen Säugetieren Lebensraum, Nahrung und Versteckmöglichkeiten. Besonders bodenbrütende Vögel, wie die Feldlerche (Alauda arvensis), sind auf solche ungestörten Flächen angewiesen.
Rückzugsort für seltene und spezialisierte Arten
In einer ausgeräumten landwirtschaftlichen Landschaft, die durch Monokulturen und den Einsatz von Pestiziden und Düngemitteln geprägt ist, sind Brachen oft die letzten Rückzugsorte für seltene und spezialisierte Arten. Solche Arten sind auf spezifische Bedingungen angewiesen, die in intensiv bewirtschafteten Flächen nicht mehr gegeben sind. Dazu zählen unter anderem Wildkräuter, die auf Brachen blühen und so bestäubenden Insekten wie Bienen, Schmetterlingen und Käfern Nahrung bieten. Ohne solche Rückzugsräume sind diese spezialisierten Arten akut gefährdet und könnten lokal aussterben.
Ökologische Funktionen und Synergieeffekte
Brachen übernehmen zudem wichtige ökologische Funktionen, indem sie als Korridore für die Vernetzung von Populationen dienen. Diese Korridore ermöglichen es Tierarten, zwischen verschiedenen Lebensräumen zu wandern und sich genetisch auszutauschen, was die genetische Vielfalt innerhalb einer Population erhöht und die Art somit widerstandsfähiger gegenüber Umweltveränderungen macht. Diese Biotopverbundsysteme sind entscheidend, um die Resilienz von Ökosystemen zu stärken.
Negative Auswirkungen der Zerstörung von Brachen
Wenn Brachen zerstört werden, sei es durch Umwandlung in landwirtschaftliche Nutzflächen oder durch Bebauung, hat das erhebliche negative Auswirkungen auf die Artenvielfalt. Der Verlust dieser vielfältigen Habitate führt zum Rückgang vieler spezialisierter und gefährdeter Arten, was zu einer Homogenisierung der Landschaft und damit zu einem generellen Verlust der Biodiversität führt. Solche Verluste sind oft irreversibel und können Kaskadeneffekte nach sich ziehen, die das gesamte Ökosystem destabilisieren.
Bedeutung für das menschliche Leben
Der Rückgang der Artenvielfalt hat auch direkte und indirekte Auswirkungen auf das menschliche Leben. Viele Ökosystemdienstleistungen, von denen der Mensch abhängig ist, wie Bestäubung, Bodenfruchtbarkeit und Schädlingskontrolle, sind an eine hohe Artenvielfalt gekoppelt. Ein Rückgang der Insektenpopulationen aufgrund des Verlusts von Brachen könnte beispielsweise die Bestäubung landwirtschaftlicher Nutzpflanzen beeinträchtigen, was wiederum die Ernährungssicherheit gefährdet. Zudem spielt Biodiversität eine wichtige Rolle bei der Regulation des Klimas, der Wasserqualität und der Bodenbildung.
Fazit
Brachen sind in einer intensiv genutzten landwirtschaftlichen Umgebung unverzichtbar, um die biologische Vielfalt zu schützen und zu fördern. Sie bieten nicht nur spezialisierte Lebensräume und ökologische Korridore, sondern tragen auch wesentlich zur Stabilität und Resilienz von Ökosystemen bei. Ihre Zerstörung hat weitreichende negative Konsequenzen, die letztlich auch das menschliche Leben bedrohen, da sie fundamentale ökologische Prozesse und Dienstleistungen beeinträchtigt. Es ist daher essenziell, Brachen zu schützen und zu fördern, um die Biodiversität und damit auch unsere eigene Lebensgrundlage langfristig zu sichern.
In der Aufnahme
Brachen sind ungenutzte, häufig brachliegende Flächen, die sich durch eine hohe Strukturvielfalt auszeichnen. Sie bieten verschiedenen Pflanzengesellschaften und Tierarten eine wertvolle Zuflucht, da sie im Vergleich zu intensiv genutzten Agrarflächen vielfältigere Mikrohabitate und Nischen aufweisen. Auf einer Brachfläche finden sich oft Gräser, Wildblumen, Büsche und manchmal auch junge Bäume. Diese Vegetationsstrukturen bieten Insekten, Vögeln, Reptilien und kleinen Säugetieren Lebensraum, Nahrung und Versteckmöglichkeiten. Besonders bodenbrütende Vögel, wie die Feldlerche (Alauda arvensis), sind auf solche ungestörten Flächen angewiesen.
Rückzugsort für seltene und spezialisierte Arten
In einer ausgeräumten landwirtschaftlichen Landschaft, die durch Monokulturen und den Einsatz von Pestiziden und Düngemitteln geprägt ist, sind Brachen oft die letzten Rückzugsorte für seltene und spezialisierte Arten. Solche Arten sind auf spezifische Bedingungen angewiesen, die in intensiv bewirtschafteten Flächen nicht mehr gegeben sind. Dazu zählen unter anderem Wildkräuter, die auf Brachen blühen und so bestäubenden Insekten wie Bienen, Schmetterlingen und Käfern Nahrung bieten. Ohne solche Rückzugsräume sind diese spezialisierten Arten akut gefährdet und könnten lokal aussterben.
Ökologische Funktionen und Synergieeffekte
Brachen übernehmen zudem wichtige ökologische Funktionen, indem sie als Korridore für die Vernetzung von Populationen dienen. Diese Korridore ermöglichen es Tierarten, zwischen verschiedenen Lebensräumen zu wandern und sich genetisch auszutauschen, was die genetische Vielfalt innerhalb einer Population erhöht und die Art somit widerstandsfähiger gegenüber Umweltveränderungen macht. Diese Biotopverbundsysteme sind entscheidend, um die Resilienz von Ökosystemen zu stärken.
Negative Auswirkungen der Zerstörung von Brachen
Wenn Brachen zerstört werden, sei es durch Umwandlung in landwirtschaftliche Nutzflächen oder durch Bebauung, hat das erhebliche negative Auswirkungen auf die Artenvielfalt. Der Verlust dieser vielfältigen Habitate führt zum Rückgang vieler spezialisierter und gefährdeter Arten, was zu einer Homogenisierung der Landschaft und damit zu einem generellen Verlust der Biodiversität führt. Solche Verluste sind oft irreversibel und können Kaskadeneffekte nach sich ziehen, die das gesamte Ökosystem destabilisieren.
Bedeutung für das menschliche Leben
Der Rückgang der Artenvielfalt hat auch direkte und indirekte Auswirkungen auf das menschliche Leben. Viele Ökosystemdienstleistungen, von denen der Mensch abhängig ist, wie Bestäubung, Bodenfruchtbarkeit und Schädlingskontrolle, sind an eine hohe Artenvielfalt gekoppelt. Ein Rückgang der Insektenpopulationen aufgrund des Verlusts von Brachen könnte beispielsweise die Bestäubung landwirtschaftlicher Nutzpflanzen beeinträchtigen, was wiederum die Ernährungssicherheit gefährdet. Zudem spielt Biodiversität eine wichtige Rolle bei der Regulation des Klimas, der Wasserqualität und der Bodenbildung.
Fazit
Brachen sind in einer intensiv genutzten landwirtschaftlichen Umgebung unverzichtbar, um die biologische Vielfalt zu schützen und zu fördern. Sie bieten nicht nur spezialisierte Lebensräume und ökologische Korridore, sondern tragen auch wesentlich zur Stabilität und Resilienz von Ökosystemen bei. Ihre Zerstörung hat weitreichende negative Konsequenzen, die letztlich auch das menschliche Leben bedrohen, da sie fundamentale ökologische Prozesse und Dienstleistungen beeinträchtigt. Es ist daher essenziell, Brachen zu schützen und zu fördern, um die Biodiversität und damit auch unsere eigene Lebensgrundlage langfristig zu sichern.
In der Aufnahme
- Eingeschränkt in ihrer Funktionalität zeigt sich eine beispielgebende Fläche, welche grundsätzlich ein hochwertiges ökologisches Ponetial in sich trägt, jedoch durch verschiedene menschliche Einflüsse viel von ihrer Wertigkeit verliert ... hier hat die Artenvielfalt wohl wenig Chancen ... mehr als bedenklich wenn es sich hierbei noch um kommunale Flächen handelt!
Artenschutz in Franken®
Start der Weltnaturkonferenz in Cali
Start der Weltnaturkonferenz in Cali
18/19.10.2024
Am Montag beginnt die 16. Weltnaturkonferenz (CBD COP16) in Cali, Kolumbien. Nachdem vor zwei Jahren das Weltnaturabkommen in Montréal unter großem Applaus beschlossen wurde, wird sich in Cali zeigen, wie es um die Umsetzung der Ziele steht. Bisher haben nur wenige Staaten nationale Umsetzungsstrategien und Aktionspläne (NBSAPs) vorgelegt. Der WWF fordert mehr politischen Willen vor allem von Industriestaaten, um den Verlust der Arten und Ökosysteme bis 2030 zu stoppen und umzukehren.
18/19.10.2024
- Der WWF fordert mehr politischen Willen, um den Verlust der Arten und Ökosysteme bis 2030 zu stoppen und umzukehren
Am Montag beginnt die 16. Weltnaturkonferenz (CBD COP16) in Cali, Kolumbien. Nachdem vor zwei Jahren das Weltnaturabkommen in Montréal unter großem Applaus beschlossen wurde, wird sich in Cali zeigen, wie es um die Umsetzung der Ziele steht. Bisher haben nur wenige Staaten nationale Umsetzungsstrategien und Aktionspläne (NBSAPs) vorgelegt. Der WWF fordert mehr politischen Willen vor allem von Industriestaaten, um den Verlust der Arten und Ökosysteme bis 2030 zu stoppen und umzukehren.
„Der fortschreitende Verlust der biologischen Vielfalt hat seit der Verabschiedung des Weltnaturabkommens nicht abgenommen. Fünf Jahre bleiben, um die ambitionierten globalen Ziele umzusetzen und den Biodiversitätsverlust umzukehren. Es ist keine Zeit mehr für leere Worte auf großer Bühne. Wenn wir auch in Zukunft gut und sicher auf diesem Planeten leben wollen, müssen wir seine Grenzen respektieren“, erklärt Kathrin Samson, Vorständin Naturschutz beim WWF Deutschland.
Damit die Konferenz ein Erfolg wird, muss sie aus Sicht des WWF
Insbesondere die deutsche Bundesregierung trägt eine besondere Verantwortung, die sich aus dem immensen ökologischen Fußabdruck Deutschlands auf die globale Biodiversität ergibt. Die Nationale Biodiversitätsstrategie, die als das deutsche NBSAP gilt, liegt bislang nicht vor. Zudem fehlt weiterhin Transparenz bei der Berechnung der internationalen Biodiversitätsfinanzierung aus dem deutschen Bundeshaushalt, um den stetigen Aufwuchs zu den von Bundeskanzler Scholz verkündeten Zielwert der 1,5 Mrd. Euro pro Jahr glaubwürdig zu gestalten.
„Noch haben wir es in der Hand, unsere Ökosysteme und Lebensgrundlagen zu retten. Das Weltnaturabkommen skizziert klar, was zu tun ist. Die Staatengemeinschaft muss diesen Weg jetzt mit politischem Willen und starken Zusagen einschlagen, damit Wohlstand, Gesundheit und Sicherheit unserer Gesellschaft eine Zukunft haben“, so Kathrin Samson.
In den letzten 50 Jahren hat der Mensch die untersuchten Wirbeltierbestände um durchschnittlich 73 Prozent dezimiert. Das geht aus dem aktuellen Living Planet Report des WWF hervor Die Zerstörung der Lebensräume vieler Tiere und Pflanzen, Übernutzung, Umweltverschmutzung sowie die Klimakrise sind die Hauptgründe für die Artenkrise. Nicht nachhaltiger Konsum, Energiehunger und Produktion treiben sie stetig voran.
Quelle
WWF
Stand:
18.10.2024
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung.Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Damit die Konferenz ein Erfolg wird, muss sie aus Sicht des WWF
- alle Vertragsstaaten dazu bewegen, ihre nationalen Strategien und Aktionspläne für die Umsetzung umgehend fertigzustellen, zu veröffentlichen und umzusetzen
- das Vertrauen und die Verlässlichkeit bei der finanziellen Unterstützung für die Umsetzung stärken und einen konkreten strategischen Rahmen für eine Finanzwirtschaft im Einklang mit der Natur beschließen. Dazu gehören neben der direkten Finanzierung auch Offenlegungspflichten für ökologische Auswirkungen im Finanzsektor und der Umbau umweltschädlicher Subventionen
- die Treiber des Biodiversitätsverlustes über alle Ressorts und wirtschaftlichen Sektoren im Einklang mit Menschenrechten und unter Einbeziehung aller gesellschaftlichen Stakeholder, insbesondere indigener Bevölkerungen und lokaler Gemeinschaften, adressieren
- dafür sorgen, dass Maßnahmen für Biodiversitätserhalt und Klimaschutz enger verzahnt werden und die Umsetzung des Weltnaturabkommens und des Pariser Vertrags gemeinsam gestaltet wird.
Insbesondere die deutsche Bundesregierung trägt eine besondere Verantwortung, die sich aus dem immensen ökologischen Fußabdruck Deutschlands auf die globale Biodiversität ergibt. Die Nationale Biodiversitätsstrategie, die als das deutsche NBSAP gilt, liegt bislang nicht vor. Zudem fehlt weiterhin Transparenz bei der Berechnung der internationalen Biodiversitätsfinanzierung aus dem deutschen Bundeshaushalt, um den stetigen Aufwuchs zu den von Bundeskanzler Scholz verkündeten Zielwert der 1,5 Mrd. Euro pro Jahr glaubwürdig zu gestalten.
„Noch haben wir es in der Hand, unsere Ökosysteme und Lebensgrundlagen zu retten. Das Weltnaturabkommen skizziert klar, was zu tun ist. Die Staatengemeinschaft muss diesen Weg jetzt mit politischem Willen und starken Zusagen einschlagen, damit Wohlstand, Gesundheit und Sicherheit unserer Gesellschaft eine Zukunft haben“, so Kathrin Samson.
In den letzten 50 Jahren hat der Mensch die untersuchten Wirbeltierbestände um durchschnittlich 73 Prozent dezimiert. Das geht aus dem aktuellen Living Planet Report des WWF hervor Die Zerstörung der Lebensräume vieler Tiere und Pflanzen, Übernutzung, Umweltverschmutzung sowie die Klimakrise sind die Hauptgründe für die Artenkrise. Nicht nachhaltiger Konsum, Energiehunger und Produktion treiben sie stetig voran.
Quelle
WWF
Stand:
18.10.2024
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung.Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Artenschutz in Franken®
Ostsee-Fangmengen: Mit Weitblick fischen
Ostsee-Fangmengen: Mit Weitblick fischen
18/19.10.2024
Hamburg/Luxemburg: Ab Montag verhandeln die Fischereiminister:innen der EU darüber, wieviel Fisch 2025 in der Ostsee gefangen werden darf. Der WWF fordert, die Festlegung der Fangmengen an dem desolaten Zustand der Fischbestände und des Ökosystems Ostsee insgesamt auszurichten und vorsorglich unter den wissenschaftlichen Fang-Empfehlungen zu bleiben.
18/19.10.2024
- WWF vor Verhandlungen über Ostsee-Fangmengen: „Grenzen des Ökosystems beachten und Beifang von Dorsch und westlichem Hering auf das Minimum reduzieren"
Hamburg/Luxemburg: Ab Montag verhandeln die Fischereiminister:innen der EU darüber, wieviel Fisch 2025 in der Ostsee gefangen werden darf. Der WWF fordert, die Festlegung der Fangmengen an dem desolaten Zustand der Fischbestände und des Ökosystems Ostsee insgesamt auszurichten und vorsorglich unter den wissenschaftlichen Fang-Empfehlungen zu bleiben.
„Das Ökosystem Ostsee ist längst am Limit. Das Zusammenspiel von jahrzehntelanger Überfischung, Nährstoffüberschuss und Klimakrise hat fatale Auswirkungen: Die Bestände der heimischen Brotfische Dorsch und Hering sind bereits kollabiert. Eine Kehrtwende ist nicht in Sicht, deshalb ist Vorsorge gefragt, die auch die Wechselwirkungen zwischen den Arten berücksichtigt“, betont Philipp Kanstinger, Fischereiexperte beim WWF Deutschland. „In der Schollenfischerei wird immer auch Dorsch mitgefangen, weil beide Arten am Meeresboden leben. Es gibt nur noch so wenig Dorsche, dass allein ihr Beifang eine Erholung des Bestands gefährdet. Daher muss die Beifangquote gekürzt werden.“ Zusätzlich müsse die Fischerei besser kontrolliert werden. Um zu verhindern, dass Dorschbeifang verbotenerweise über Bord geworfen wird, braucht es auf See eine verpflichtende Überwachung des Fangs mithilfe von Kameras.
Auch die häufigen Fehlmeldungen aus der industriellen Fischerei auf Sprotte und Hering müssen durch bessere Kontrolle auf See und vorsichtig gesetzte Fangmengen eingedämmt werden. Der Heringsbestand in der zentralen Ostsee zeigt erste, leichte Erholungstendenzen. Statt jetzt wie von der EU-Kommission geplant die Fangmenge zu verdoppeln und damit Erholung zu riskieren, sollte die erhöhte Fangmenge vorsorglich unter der wissenschaftlichen Empfehlung bleiben, fordert der WWF. „Nutznießer der erhöhten Fangmenge sind vor allem industrielle Fischtrawler, deren Fang ins Tierfutter geht. Für diese Verschwendung dürfen wir die Gesundheit des Ökosystems nicht leichtfertig aufs Spiel setzen. Hering und Sprotte sind wertvolle Speisefische und spielen im Nahrungsnetz der Ostsee eine Schlüsselrolle“, so WWF-Experte Kanstinger.
Die Klimakrise erschwert es Fischbeständen im kritischen Zustand, wieder auf gesunde Größe anzuwachsen. Auch wissenschaftliche Prognosen waren da häufig zu optimistisch. Die Fischereiminister:innen müssen aus den Fehlern der Vergangenheit lernen und die langfristige Gesundung statt kurzfristiger Erträge priorisieren. WWF-Experte Philipp Kanstinger sagt: „Man kann sich nicht ewig über die ökologischen Zusammenhänge und natürlichen Grenzen hinwegsetzen. Vorsorge statt Nachsehen – das muss jetzt die Leitschnur sein“.
Quelle
WWF
Stand:
18.10.2024
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung.Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Auch die häufigen Fehlmeldungen aus der industriellen Fischerei auf Sprotte und Hering müssen durch bessere Kontrolle auf See und vorsichtig gesetzte Fangmengen eingedämmt werden. Der Heringsbestand in der zentralen Ostsee zeigt erste, leichte Erholungstendenzen. Statt jetzt wie von der EU-Kommission geplant die Fangmenge zu verdoppeln und damit Erholung zu riskieren, sollte die erhöhte Fangmenge vorsorglich unter der wissenschaftlichen Empfehlung bleiben, fordert der WWF. „Nutznießer der erhöhten Fangmenge sind vor allem industrielle Fischtrawler, deren Fang ins Tierfutter geht. Für diese Verschwendung dürfen wir die Gesundheit des Ökosystems nicht leichtfertig aufs Spiel setzen. Hering und Sprotte sind wertvolle Speisefische und spielen im Nahrungsnetz der Ostsee eine Schlüsselrolle“, so WWF-Experte Kanstinger.
Die Klimakrise erschwert es Fischbeständen im kritischen Zustand, wieder auf gesunde Größe anzuwachsen. Auch wissenschaftliche Prognosen waren da häufig zu optimistisch. Die Fischereiminister:innen müssen aus den Fehlern der Vergangenheit lernen und die langfristige Gesundung statt kurzfristiger Erträge priorisieren. WWF-Experte Philipp Kanstinger sagt: „Man kann sich nicht ewig über die ökologischen Zusammenhänge und natürlichen Grenzen hinwegsetzen. Vorsorge statt Nachsehen – das muss jetzt die Leitschnur sein“.
Quelle
WWF
Stand:
18.10.2024
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung.Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Artenschutz in Franken®
Vom Trafohaus zur Stele der Biodiversität®

Vom Trafohaus zur Stele der Biodiversität®
18/19.10.2024
Burgwindheim / Bayern. Stelen bundesdeutscher Biodiversität, so der zugegeben etwas sperrige Titel für ein in dieser Form einmaliges Entwicklungskonzept des Artenschutzes in Franken®. Im Fokus stehen dabei Bauwerke, die viele Jahre für den Menschen unverzichtbar waren, jedoch meist ein Schattendasein führten, obwohl diese voller Energie steckten. Trafotürme oder auch Trafohäuser wurden sie landläufig genannt.
18/19.10.2024
- Ein bislang in dieser Form in Deutschland wohl einzigartiges Konzept stellt sich in einer kurzen Feierstunde projektausgerichtet erneut der breiten Öffentlichkeit vor.
Burgwindheim / Bayern. Stelen bundesdeutscher Biodiversität, so der zugegeben etwas sperrige Titel für ein in dieser Form einmaliges Entwicklungskonzept des Artenschutzes in Franken®. Im Fokus stehen dabei Bauwerke, die viele Jahre für den Menschen unverzichtbar waren, jedoch meist ein Schattendasein führten, obwohl diese voller Energie steckten. Trafotürme oder auch Trafohäuser wurden sie landläufig genannt.
Oasen des (Über) – Lebens
Doch gerade in den vergangenen Jahren verloren diese Kulturgüter mehr und mehr an Bedeutung. Technische Änderungen führten dazu, dass zahlreiche der Gebäude abgerissen wurden und es auch heute noch immer werden. Mit jedem Abbruch verlieren wir auch ein unwiederbringliches Zeitzeugnis, unserer urbanen Lebensweise. Hier und da standen die Häuschen in Strukturen, die mit ihnen in einen langen, gemeinsamen Dornröschenschlaf verfielen. Im eigentlichen Sinn bilden diese Kleinbaukörper, bei einer entsprechend durchdachten und durchgeplanten Nutzungsänderung, wiederkehrend hochwertige Ökosysteme inmitten zunehmend strukturarmer Bereiche ab.
Gemeinsam für mehr sichtbaren Artenschutz und Umweltbildung.
Artenschutz in Franken®, Bayernwerk AG, Markt Burgwindheim, Turmstationen Deutschland e.V., Steuerkanzlei Bauerfeind und Deutsche Postcode Lotterie erweckten vor wenigen Tagen ein altes, vormaliges Trafohaus in der Gemeinde Burgwindheim GT-Kötsch aus seinem (ökologischen) Ruhezustand. In den vergangenen zwei Monaten wurde, nach einer über einjährigen Vorbereitungsphase, der Baukörper großzügig umgestaltet und so zu einer „Stele der Biodiversität®“ umfunktioniert. Ausgestattet mit speziellen, teilweise eigenentwickelten Sekundärhabitaten, die in und auf die Fassade, sowie in den Dachstuhl des Gebäudes integriert wurden, bietet das Gebäude nun nachhaltig hochwertige Lebens- und Fortpflanzungsräume, auch für im Bestand gefährdete Tierarten. Vornehmlich für Spezies welche den Menschen gar seit vielen Jahrhunderten als sogenannte Kulturfolger eng begleiten. Diese Koexistenz kündigt der Mensch seit geraumer Zeit auf. Mit diesem erschreckenden Vorgang verlieren diese gleichfalls unsere Gesellschaftsform prägenden Kulturfolger ihre Lebensgrundlage, da überlebensrelevante Fortpflanzungs- und Nahrungsbereiche verschwinden. Wir als „Gattung“ Mensch verlieren damit ebenfalls den direkten Kontakt zur Umwelt sowie zu unseren Mitgeschöpfen, die ein wichtiger Teil unseres Lebensbereiches sind. Im Detail konnten hier, am vormals artenfern strukturierten „Türmchen“, vielfältige (Überlebens) - Strukturen geschaffen werden um beispielsweise Fledermäusen, Turmfalken, Mehlschwalben oder auch Mauerseglern geeignete, bewusst reproduktionszugeordnete Strukturen anzubieten. Wie begehrt diese Einrichtungen sind, zeigt die teilweise Besiedlung dergleichen bereits während der Umgestaltungsphase.
Umweltbildung vermitteln.
Der ehemalige Trafoturm informiert ferner durch eine multimediale Projektinformation, die am Bauwerk angebracht ist, weiterführend über wichtige Projektinhalte. Über ein „Get-it“ System, sowie der entsprechenden Internetanbindung soll es auch gelingen, die „Smartphone- und Tablet-Generation“ für den Erhalt der ökologischen und kulturellen Vielfalt zu begeistern. An Standorten wie diesem hier in Stegaurach kann es der Aktuellen, jedoch auch der uns nachfolgenden Generation noch möglich sein, Wildtiere in ihren natürlichen, kulturfolgenden Verhaltensmustern zu erleben.
Eye Catcher – grafische Baukörpergestaltung
Als wahrer Eye Catcher stellt sich die Stele der Biodiversität® durch die künstlerische Baukörpergestaltung dar. Die Fassade des Bauwerks wurde aufwendig grafisch gestaltet und taucht in eine ganz eigene Welt ein, gerade um die Fantasie der Kinder anzuregen. Für Erwachsene bieten sich gleichfalls nicht alltägliche Perspektiven. Mit der hier gewählten Gestaltungsform möchten wir den Baukörper jedoch auch als Mahnmal verstanden wissen. Denn mit unserem Wirken tragen wir als Gesellschaft unmittelbar zum Niedergang der Biodiversität bei. Was wir alles Verlieren erkennen wir teilweise auf der Baukörperfassade und so kann dieser Ansatz auch einen wichtigen Beitrag leisten uns zunehmend um die Erhaltung der Artenvielfalt, im ureigenen Interesse zu bemühen.
Ein Netz der Biodiversität legt sich über das Land.
Das Projekt Stelen der Biodiversität®, dass durch die vollkommen ehrenamtlich agierende Organisation Artenschutz in Franken® federführend betreut wird, hat es sich zum Ziel gesetzt, ein Netz dieses Projektansatzes über das Land zu legen. Und so reiht sich das Projekt in eine Aufeinanderfolge von erfolgreichen Projektbausteinen ein, die sich bereits an anderer Stelle in Bayern, sowie in zahlreichen anderen Bundesländer Deutschlands wiederfinden.
Als offizielles Projekt der UN Dekade Biologische Vielfalt mehrfach ausgezeichnet, wird der hohen inhaltlichen Qualität des Konzepts Rechnung getragen.
In der Aufnahme
- Am 10. Oktober fanden sich der 1. Bürgermeister des Marktes Burgwindheim, Johannes Polenz (Bildmitte) - Michael Heimbach von der Bayernwerk Netz GmbH (links) und der 1. Vorsitzende des Artenschutz in Franken, Thomas Köhler vor Ort zusammen um die offizielle Projektübergabe an die Öffentlichkeit zu kommunizieren.
Artenschutz in Franken®
Der Braune Grashüpfer (Chorthippus brunneus)

Aus dem Leben des Braunen Grashüpfer`s
17/18.10.2024
Ich bin vielleicht braun und unscheinbar, aber hey, das heißt nicht, dass ich langweilig bin. Ich bin ein echter Überlebenskünstler und lebe mein bestes Grashüpfer-Leben. Lass mich dir ein bisschen was über mich erzählen!"
17/18.10.2024
- "Hey, du! Ja, genau, ich bin's—der Braune Grashüpfer. Oder wie meine wissenschaftlichen Freunde sagen: Chorthippus brunneus.
Ich bin vielleicht braun und unscheinbar, aber hey, das heißt nicht, dass ich langweilig bin. Ich bin ein echter Überlebenskünstler und lebe mein bestes Grashüpfer-Leben. Lass mich dir ein bisschen was über mich erzählen!"
Mein Lebensraum – die Sonnenterassen des Grashüpfers
"Also, zuerst mal mein Wohnort: Ich bin ein echter Sonnenanbeter. Du findest mich auf trockenen, grasbewachsenen Flächen, wie Wiesen, Sanddünen oder Wegrändern. Aber bitte, nichts allzu Feuchtes, das ist so gar nicht mein Ding. Da könnte ich mir ja die Antennen verknicken! Ich mag es warm und trocken, und da kann ich mich super tarnen—mein braunes Kleid passt perfekt zur Umgebung. Stealth-Modus aktiviert, sag ich da nur!"
Gesangseinlage – Grashüpfer Karaoke
"Jetzt kommen wir zu meinem Talent. Vielleicht hast du ja schon mal meinen Gesang gehört. Ich kann ziemlich gut zirpen, und das ist auch eine wichtige Sache für mich. Wir Männchen machen das, um die Weibchen zu beeindrucken. Wir haben so eine Art ‘Streichorchester’ eingebaut—die Schenkel an den Hinterbeinen reiben wir an unseren Flügeln, und voilà, schon erklingt meine Symphonie. Ist aber nicht ganz einfach, ich muss mich schon richtig ins Zeug legen. Wie bei einer Talentshow: Nur die Besten kommen weiter!" "Manchmal höre ich, wie die Leute meinen Sound mit dem Knistern von Rascheln vergleichen. Ja, ich bin halt nicht der lauteste Grashüpfer, aber dafür habe ich einen unverwechselbaren Stil—so ein bisschen ‘rustikales Zirpen’. Manche nennen es sogar den „Knirsch-Country“! Klingt doch cool, oder?"
Nahrung – ich bin ein Gourmet, okay?
"Ich bin übrigens ein Vegetarier. Du findest mich meistens beim genüsslichen Knabbern an Gräsern oder anderen Kräutern. Manchmal ziehe ich auch kleine Halme vor, die besonders knusprig sind—muss ja Abwechslung sein. Ich meine, was bringt es, die ganze Zeit nur das gleiche Gras zu futtern? Aber ich halte meine Diät simpel, denn ich muss leicht und agil bleiben. Wer weiß, wann das nächste Weibchen vorbeihüpft!"
Tarnung und Flucht – Die Kunst des unauffälligen Hüpfen
"Meine größte Stärke? Ich kann springen wie ein Profi! Mit meinen Hinterbeinen habe ich Sprungfedern, die sogar einen Superhelden neidisch machen würden. Aber das ist kein Wettkampf, okay? Das ist Überleben. Wenn jemand kommt, der nicht so freundlich ist wie du—zum Beispiel ein Vogel, der mich als Snack sieht—springe ich blitzschnell weg und verschwinde im Gras. Ninja-Style!" "Wenn es mal so richtig brenzlig wird, kann ich auch noch meine Flügel auspacken und ein paar kurze Strecken fliegen. Ja, du hast richtig gehört: Ich bin nicht nur ein Jumper, sondern auch ein Mini-Pilot. Meine Flügel sind zwar nicht die größten, aber für einen schnellen Abgang reicht es."
Der Grashüpfer-Lifestyle – Alltag zwischen Sonnenbädern und Dating
"Mein Alltag ist also ziemlich entspannt: Sonnenbaden, Fressen, Singen und gelegentlich ein paar akrobatische Sprünge, um zu beweisen, dass ich noch in Form bin. Und natürlich immer auf der Suche nach einem charmanten Weibchen. Denn schließlich will ich ja auch für Nachwuchs sorgen—die nächste Generation muss schließlich genauso gute Jumper und Sänger werden wie ich!"
Zum Schluss noch ein Fun Fact
"Übrigens, wusstest du, dass ich nicht nur braun sein kann? Manchmal haben wir Braunen Grashüpfer sogar ein paar grünliche Stellen. Aber das hängt vom Lebensraum ab, wir sind da anpassungsfähig. Außerdem: Je mehr ich mich in der Sonne aufhalte, desto intensiver wird mein Braun. Perfekte Tarnung und ein gratis Sonnenstudio—was will man mehr?"
"Also, das war ein Einblick in mein Leben als Brauner Grashüpfer. Jetzt weißt du Bescheid! Wenn du das nächste Mal mein Zirpen hörst, dann denk an mich und meinen coolen Lifestyle. Wer weiß, vielleicht sitze ich dann ganz in deiner Nähe auf einem Halm und genieße die Sonne."
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- Brauner Grashüpfer (Chorthippus brunneus) - Männchen
Artenschutz in Franken®
Biberäsung ...

Biberäsung ...
17/18.10.2024
Als Europäischer Biber (Castor fiber) ist mein Hauptnahrungsmittel Gras, ähnlich wie für Kühe auf der Wiese. Gras ist reich an Nährstoffen und leicht verfügbar, besonders entlang der Ufer von Flüssen, wo ich lebe.
17/18.10.2024
Als Europäischer Biber (Castor fiber) ist mein Hauptnahrungsmittel Gras, ähnlich wie für Kühe auf der Wiese. Gras ist reich an Nährstoffen und leicht verfügbar, besonders entlang der Ufer von Flüssen, wo ich lebe.
Wenn ich Gras fresse, erfüllt es meinen Bedarf an Ballaststoffen und anderen Nährstoffen, die für meine Verdauung wichtig sind. Diese Nahrungsaufnahme ermöglicht es mir, meine Energie zu erhalten, während ich meinen Lebensraum nutze und gleichzeitig das Ökosystem durch meinen Einfluss als Landschaftsgestalter unterstütze.
In der Aufnahme
... erkennen wir den Pfad des Bibers und die zum Teil abgegraste Wiese unmittelbar an Gewässer ...
In der Aufnahme
... erkennen wir den Pfad des Bibers und die zum Teil abgegraste Wiese unmittelbar an Gewässer ...
Artenschutz in Franken®
Aussichten? - negativ!

Der Europäische Braunbrustigel (Erinaceus europaeus)
16/17.10.2024
Ich bin vielleicht klein und kugelig, aber ich habe meinen Stacheln so einiges zu bieten – die sind meine Geheimwaffe und mein Schutzschild. Doch bevor du denkst, ich bin nur ein kleines Stacheltier, lass mich dir erzählen, was es wirklich bedeutet, ein Braunbrustigel zu sein. Und warum das Überleben für mich und meine Familie gerade so hart ist.
16/17.10.2024
- Hallo! Ich bin der Europäische Braunbrustigel (Erinaceus europaeus) – aber meine Freunde nennen mich einfach „Igel“.
Ich bin vielleicht klein und kugelig, aber ich habe meinen Stacheln so einiges zu bieten – die sind meine Geheimwaffe und mein Schutzschild. Doch bevor du denkst, ich bin nur ein kleines Stacheltier, lass mich dir erzählen, was es wirklich bedeutet, ein Braunbrustigel zu sein. Und warum das Überleben für mich und meine Familie gerade so hart ist.
Mein Lebensraum – Eine Welt aus Wiesen und Hecken
Als Igel liebe ich die Natur – vor allem Gärten, Wiesen, Wälder und Hecken. Überall, wo es ein bisschen unaufgeräumt ist, fühle ich mich wohl. Dort finde ich Unterschlupf und vor allem mein Lieblingsessen: Insekten, Schnecken, Regenwürmer und Spinnen. Aber auch Beeren und Früchte lasse ich mir schmecken.
Früher konnte ich mich einfach in den hohen Wiesen und an Heckenrändern verstecken, doch heute gibt es immer weniger dieser wilden, naturbelassenen Orte. Die Landwirtschaft wird intensiver, Wiesen werden gemäht und viele alte Hecken verschwinden. Die Menschen lieben es ordentlich – und das ist mein Problem. Denn ich brauche das Chaos, die Verstecke und die Insekten, die dort leben.
Eine Straße mit Tücken und der Fluch der Zäune
Was mich wirklich bedrückt, ist der Wandel in meinem Lebensraum. Die Straßen – überall Straßen! Für mich sind das gefährliche Schnellstraßen des Todes. Wenn ich nachts unterwegs bin, sehe ich oft diese blendenden Lichter und höre das Donnern der Motoren. Aber ich bin nicht schnell, ich bin vorsichtig und oft rolle ich mich einfach ein, wenn ich Angst habe – das hilft aber leider nicht gegen Autos. Deshalb passiert es oft, dass viele meiner Freunde und Verwandten das Nächtliche Straßenabenteuer nicht überleben.
Außerdem haben immer mehr Menschen dichte Zäune und Mauern um ihre Gärten – und das schränkt meine Streifzüge ein. Ihr müsst wissen, ich laufe jede Nacht mehrere Kilometer, um Futter zu finden und mein Revier zu erkunden. Wenn ich nicht mehr durch die Gärten komme, bleibt mir nur die Straße – und das endet oft nicht gut.
Der Nachwuchs – Ein stacheliges Risiko
Jetzt kommt der Teil, der mir wirklich Sorgen macht: meine Kinder. Wenn die warmen Monate kommen, ist Fortpflanzungszeit, und dann bekomme ich zwischen vier und sechs kleine Igelbabys. Die Kleinen sind anfangs blind und ohne Stacheln, also total schutzlos. Deshalb verstecke ich sie in einem gut gebauten Nest aus Laub und Gras. Aber auch hier lauern Gefahren.
Zum einen passiert es oft, dass Menschen Hecken schneiden oder Laubhaufen wegräumen, ohne zu wissen, dass dort meine Jungen liegen. Das ist für uns eine Katastrophe, denn unsere Nester sind unser Rückzugsort und ohne Schutz sind die Kleinen verloren. Zum anderen fehlen durch Pestizide und Insektensterben immer mehr Nahrungsquellen. Ein hungriger Igel-Nachwuchs hat es schwer, groß zu werden, wenn die Erde leer ist.
Warum die Welt für uns gerade so gefährlich ist
Es klingt vielleicht traurig, aber ich bin mittlerweile stark gefährdet. Das liegt nicht nur daran, dass es weniger Insekten gibt oder dass wir oft unter die Räder kommen. Auch der Klimawandel macht uns zu schaffen. Früher war es so: Im Herbst baute ich mein Nest und verschlief die kalten Monate. Aber jetzt werden die Winter immer milder, was bedeutet, dass ich oft aus meinem Winterschlaf aufwache, weil es zu warm ist. Das kostet mich Energie, und wenn ich dann kein Futter finde, kann das gefährlich werden.
Meine Babys haben es sogar noch schwerer: Sie brauchen einen ruhigen und sicheren Start ins Leben, und viele überleben das erste Jahr nicht, weil wir durch den Verlust von Lebensräumen, Futterknappheit und Gefahren wie Straßen und Gartengeräte ständig bedroht sind.
Ein nachdenklicher Blick in die Zukunft – Die Sicht eines Igels
Manchmal, wenn ich durch den Garten streife und mir ein paar Würmer suche, denke ich darüber nach, wie es früher war. Da gab es wilde Ecken und verwilderte Gärten, in denen ich mich frei bewegen konnte. Heute sehe ich immer öfter diese sauberen, grünen Rasenflächen und höre, wie Menschen Maschinen benutzen, um das Laub zu entfernen. Alles muss ordentlich sein – aber dabei gehen mir und meiner Familie unsere Verstecke verloren.
Wir Igel sind Meister im Überleben, und seit Tausenden von Jahren sind wir Teil eurer Gärten und Wälder. Aber jetzt brauchen wir eure Hilfe: Lasst die Natur ein bisschen unordentlich sein, lasst ein paar wilde Ecken stehen und überlegt, ob ihr einen „Igel-Tunnel“ unter eurem Zaun durchlasst, damit wir hindurchschlüpfen können.
Ich bin klein, stachelig und vielleicht etwas langsam – aber ich bin auch ein wichtiger Teil der Natur. Vielleicht kannst du mir helfen, damit meine Kinder auch noch in Zukunft durch die Wiesen streifen und sich am Nachthimmel orientieren können.
In der Aufnahme von Helga Zinnecker
- Junger Igel im Oktober 2024
Artenschutz in Franken®
„Plastikcity“ … interessante Impressionen – auch in Deutschland möglich?!

„Plastikcity“ … interessante Impressionen – auch in Deutschland möglich?!
16/17.10.2024
Deutschland. Wir kamen vor wenigen Tagen bei einer unserer Deutschlandfahrten an einem Baugebiet vorbei, doch meinten wir zu Beginn das dieses Gelände eigentlich nicht in Deutschland läge. Denn was wir dort vorfanden war tatsächlich „bemerkenswert“.
16/17.10.2024
Deutschland. Wir kamen vor wenigen Tagen bei einer unserer Deutschlandfahrten an einem Baugebiet vorbei, doch meinten wir zu Beginn das dieses Gelände eigentlich nicht in Deutschland läge. Denn was wir dort vorfanden war tatsächlich „bemerkenswert“.
Bei leichtem Wind sahen wir auf der Fläche nahezu überall Papier und Plastik herumfliegen. LKWs fahren seit Wochen einen Unterboden als tragfähigen Untergrund in das Gelände. Wenn man sich das recycelte Material genauer ansieht, findet man auch Alu, Eisen, Kronkorken, Glas, Fliesen, Stoff und Unmengen an Plastik in allen Formen und Größen.Das Mikroplastik ist mit großer Wahrscheinlichkeit Tonnenweise hier zu finden.
Die Beobachtung wurde selbstverständlich auch den zuständigen Behörden gemeldet, denn das ist schon sehr interessant und in dieser Form hatten wir solche Eindrücke persönlich noch nicht entdecken vorfinden können.
In der Regel bemühen sich natur- und klimainteressierten Bürger, der Versucht Müll zu vermeiden und unsere Umwelt nachhaltig zu schützen. Hier scheint es etwas anders zu sein?! Seit 2023 ist es in der EU verboten -Mikroplastikpartikel absichtlich zuzufügen oder zu verarbeiten und einzubringen z.B. auf dem Sportplatz Kunstrasen-Untergrund.
Autor und Aufnahmen
Gewässer und Naturschutz im Erftkreis
Flora-Fauna-Artenschutz
Naturschutzökologie
Rolf Thiemann
Naturschutzberater
Eisvogelweg 1
50181 Bedburg
Stand
08.10.2024
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung.Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Die Beobachtung wurde selbstverständlich auch den zuständigen Behörden gemeldet, denn das ist schon sehr interessant und in dieser Form hatten wir solche Eindrücke persönlich noch nicht entdecken vorfinden können.
In der Regel bemühen sich natur- und klimainteressierten Bürger, der Versucht Müll zu vermeiden und unsere Umwelt nachhaltig zu schützen. Hier scheint es etwas anders zu sein?! Seit 2023 ist es in der EU verboten -Mikroplastikpartikel absichtlich zuzufügen oder zu verarbeiten und einzubringen z.B. auf dem Sportplatz Kunstrasen-Untergrund.
Autor und Aufnahmen
Gewässer und Naturschutz im Erftkreis
Flora-Fauna-Artenschutz
Naturschutzökologie
Rolf Thiemann
Naturschutzberater
Eisvogelweg 1
50181 Bedburg
Stand
08.10.2024
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung.Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Artenschutz in Franken®
Der Schachbrett-Marienkäfer (Propylea quatuordecimpunctata)

Der Schachbrett-Marienkäfer (Propylea quatuordecimpunctata) ...
14/15.10.2024
... ist eine faszinierende Art aus der Familie der Marienkäfer (Coccinellidae), die aufgrund ihres Aussehens und Verhaltens bemerkenswert ist.
14/15.10.2024
... ist eine faszinierende Art aus der Familie der Marienkäfer (Coccinellidae), die aufgrund ihres Aussehens und Verhaltens bemerkenswert ist.
- Als Schachbrett-Marienkäfer würde ich mein Leben vor allem durch meine morphologischen Merkmale und mein Verhalten beschreiben:
- Körperbau und Farbe: Ich bin relativ klein und oval geformt, mit einem charakteristischen (schwarzen) Körper und vierzehn (roten) Punkten auf meinen Flügeldecken. Diese Farbmuster dienen als Warnung für potenzielle Fressfeinde, dass ich giftig bin oder einen unangenehmen Geschmack habe, was mich vor Räubern schützt.
- Lebensraum und Verbreitung: Als Schachbrett-Marienkäfer lebe ich in verschiedenen Habitaten, einschließlich Wäldern, Gärten, Parks und landwirtschaftlich genutzten Gebieten. Ich bevorzuge Pflanzen, die Blattläuse beherbergen, da diese meine Hauptnahrungsquelle sind. Meine Verbreitung erstreckt sich über große Teile Europas und Asiens.
- Ernährung: Meine Hauptnahrungsquelle sind Blattläuse und andere kleine Insekten, die ich mit meinen kräftigen Mundwerkzeugen effizient fressen kann. Dadurch bin ich für Landwirte und Gärtner nützlich, da ich als natürlicher Schädlingsbekämpfer fungiere und dazu beitrage, die Populationen von Schädlingen in Schach zu halten.
- Fortpflanzung und Entwicklung: Ich durchlaufe eine vollständige Metamorphose, beginnend als Ei, dann als Larve und schließlich als erwachsener Marienkäfer. Die Eiablage erfolgt in der Nähe von Nahrungsquellen, um sicherzustellen, dass die Larven genügend Nahrung haben, sobald sie schlüpfen. Meine Larvenstadien sind besonders hungrig und fressen große Mengen an Blattläusen, bevor sie sich verpuppen.
- Ökologische Bedeutung: Als "Raubinsekt" trage ich zur biologischen Schädlingsbekämpfung bei, was mich zu einem wertvollen Akteur im ökologischen Gleichgewicht macht. Mein Vorhandensein hilft dabei, die Anwendung von Insektiziden zu reduzieren und unterstützt die Gesundheit von Pflanzenpopulationen.
Zusammengefasst ist der Schachbrett-Marienkäfer ein wichtiges Beispiel für eine Spezies, die sowohl ökologisch als auch landwirtschaftlich bedeutend ist. Seine Anpassungen an bestimmte Nahrungsquellen und seine Warnfarben machen ihn zu einem erfolgreichen Überlebenskünstler in verschiedenen Lebensräumen.
Aufnahme / Autor Bernhard Schmalisch
- Hier ist ein frisch geknickter Pflanzentrieb zu erkennen. Die Ameisen und auch der Marienkäfer partizipieren an dem kohlehydratreichen Saft der austritt.Denke die Ameisen wollen den Käfer auch vertreiben,Marienkäfer sind schließlich die Fressfeinde der Blattläuse, die von ihnen "gemolken" werden. Durch seinen Chitinpanzer und auch seine chemischen Abwehrstoffe kann er sich schützen.Bei Bedrohung scheiden die Käfer an den Beingelenken Blutströpfchen mit giftigen Wirkstoffen ab.Viele die einen Käfer in der Hand hatten kennen den Geruch dieser gelb/ocker klebrigen Flüssigkeit, die dann auch auf der Hand zu sehen ist.
Artenschutz in Franken®
Grünfläche soll Feldweg werden!

Grünfläche soll Feldweg werden!
14/15.10.2024
Nordrhein - Westfalen. Das "Spektakel um die Baumallee in Bedburg" entlang der St. Rochusstraße geht weiter.
Vorige Woche erfuhr ich von einem Landwirt, dass von dem cirka 10 Meter breiten Grünstreifen auf dem die Bäume gepflanzt werden sollen, 5 Meter dem Landwirt von der Stadt als Wirtschaftsweg versprochen wurden.
14/15.10.2024
Nordrhein - Westfalen. Das "Spektakel um die Baumallee in Bedburg" entlang der St. Rochusstraße geht weiter.
Vorige Woche erfuhr ich von einem Landwirt, dass von dem cirka 10 Meter breiten Grünstreifen auf dem die Bäume gepflanzt werden sollen, 5 Meter dem Landwirt von der Stadt als Wirtschaftsweg versprochen wurden.
Des weiteren kommt noch eine Abstandsfläche (4 Meter) zur Kreisstraße hinzu. Somit ist der Rest der Fläche zu klein um vernünftige Alleebäume zu pflanzen. Warum soll von unserem Grünstreifen eine Fläche für einen Wirtschaftsweg abgegeben werden?
Der Landwirt sollte seinen Acker für seinen Weg hergeben! Außerdem war da nie ein Feldweg - Der Landwirt fuhr immer über die asphaltierten Zufahrten auf seinen Acker.Auch das geplante Weit auseinandersetzen (20 Meter) der Bäume sollte überdacht werden, damit eine vernünftige Baumallee zu erkennen ist.
Autor und Aufnahmen
Gewässer und Naturschutz im Erftkreis
Flora-Fauna-Artenschutz
Naturschutzökologie
Rolf Thiemann
Naturschutzberater
Eisvogelweg 1
50181 Bedburg
Stand
07.10.2024
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung.Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Der Landwirt sollte seinen Acker für seinen Weg hergeben! Außerdem war da nie ein Feldweg - Der Landwirt fuhr immer über die asphaltierten Zufahrten auf seinen Acker.Auch das geplante Weit auseinandersetzen (20 Meter) der Bäume sollte überdacht werden, damit eine vernünftige Baumallee zu erkennen ist.
Autor und Aufnahmen
Gewässer und Naturschutz im Erftkreis
Flora-Fauna-Artenschutz
Naturschutzökologie
Rolf Thiemann
Naturschutzberater
Eisvogelweg 1
50181 Bedburg
Stand
07.10.2024
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung.Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Artenschutz in Franken®
Der Eurasische Kranich (Grus grus)

Eurasischer Kranich (Grus grus)
13/14.10.2024
Meine Art lebt seit unzähligen Generationen in diesen Weiten und wir sind als Zugvögel wahre Meister der Navigation. Wir leben in der Alten Welt – von Nord- und Mitteleuropa bis hin zu Asien. Lass mich dich in mein Leben mitnehmen, damit du verstehst, was es bedeutet, ein Kranich zu sein.
13/14.10.2024
- Ich bin der Kranich (Grus grus). Meine Flügel tragen mich weit über das Land, und meine Laute, die trompetenähnlich den Himmel durchdringen, sind das Zeichen für den Wechsel der Jahreszeiten.
Meine Art lebt seit unzähligen Generationen in diesen Weiten und wir sind als Zugvögel wahre Meister der Navigation. Wir leben in der Alten Welt – von Nord- und Mitteleuropa bis hin zu Asien. Lass mich dich in mein Leben mitnehmen, damit du verstehst, was es bedeutet, ein Kranich zu sein.
Mein Lebensraum und meine Nahrung
Ich bin ein Bewohner von Feuchtgebieten, Mooren, Sümpfen und Flachwassergebieten. Diese Gebiete bieten mir Schutz und eine reiche Nahrungsquelle. Meine Nahrung ist vielfältig, denn ich bin ein Allesfresser. In den Sommermonaten ernähre ich mich von Insekten, kleinen Wirbeltieren und Pflanzen. Doch auch Samen, Knollen und Beeren stehen auf meinem Speiseplan. Mit meinem spitzen Schnabel durchwühle ich das flache Wasser und die weichen Böden nach Nahrung. Diesen Lebensraum brauche ich nicht nur zum Fressen, sondern auch zum Brüten. Die Nester, die wir bauen, sind flache Plattformen aus Schilf und anderen Pflanzen.
Die Brutzeit – der Beginn des neuen Lebens
Wenn der Frühling naht, treibt uns der Drang zur Fortpflanzung in unsere Brutgebiete zurück. Dort suche ich zusammen mit meinem Partner, mit dem ich oft mein Leben lang zusammen bleibe, einen sicheren Platz im flachen Wasser oder in Sumpfgebieten. Nach einer beeindruckenden Balz, die voller Tänze, Sprünge und Rufe ist, legt mein Weibchen normalerweise zwei Eier. Wir wechseln uns ab, das Gelege zu bebrüten, und nach etwa 30 Tagen schlüpfen unsere Küken.
Unsere Jungen wachsen schnell, doch sie sind in ihren ersten Lebenswochen sehr verletzlich. Wir schützen sie vor Fressfeinden und führen sie sicher durch das Revier, bis sie selbst stark genug sind, um kurze Flüge zu unternehmen. Im Spätsommer sind sie bereit, mit uns den großen Zug anzutreten.
Der Zug des Kranichs – eine Reise der Generationen
Für uns Kraniche ist der Zug das Herzstück unseres Lebenszyklus. Der Herbst kündigt den Beginn unserer langen Reise an. Die Tage werden kürzer, und die Temperaturen sinken – es ist Zeit, nach Süden zu ziehen. Schon lange vor dem Abflug sammeln wir uns in großen Gruppen auf den Rastplätzen. Diese Orte sind entscheidend für uns, denn sie bieten Nahrung und Sicherheit, bevor wir uns auf den beschwerlichen Flug machen. In Mitteleuropa ist einer dieser wichtigen Rastplätze das Biosphärenreservat Schaalsee in Deutschland. Tausende von uns sammeln sich dort, um Kräfte für den Zug zu tanken.
Wenn die Zeit reif ist, formen wir eine V-Formation am Himmel. Diese Formation hilft uns, Energie zu sparen, denn der Auftrieb, den der Vogel an der Spitze erzeugt, erleichtert es den nachfolgenden Kranichen, im Wind zu gleiten. Wir wechseln uns an der Spitze ab, um die Belastung zu teilen. Unsere Flugroute führt uns über Kontinente und Meere hinweg. Jedes Jahr fliegen wir tausende Kilometer von unseren Brutgebieten in Nordeuropa bis zu unseren Winterquartieren in Spanien, Nordafrika oder sogar bis nach Indien.
Orientierung und Energie sparen – die Wissenschaft hinter dem Zug
Unsere Zugrouten folgen uralten Pfaden. Wir orientieren uns an der Sonne, den Sternen und dem Erdmagnetfeld. Auch die Landschaften und Flussverläufe sind uns vertraut, und oft fliegen wir entlang von Gebirgsketten oder Küsten, um uns zu orientieren. Wissenschaftler haben festgestellt, dass wir Kraniche diese Fähigkeiten schon in jungen Jahren lernen. Die älteren und erfahrenen Vögel führen die Jungvögel und weisen ihnen den Weg. Dieses Wissen wird über Generationen weitergegeben.
Doch es geht nicht nur um die Orientierung – der Flug kostet uns viel Energie. Wir sind auf thermische Aufwinde angewiesen, die uns in die Höhe tragen, sodass wir lange Strecken gleiten können, ohne mit den Flügeln zu schlagen. Diese Aufwinde sind besonders über Land verfügbar, daher vermeiden wir große Wasserflächen so gut es geht. An den Rastplätzen füllen wir unsere Energiereserven mit Mais, Getreide und anderen Pflanzen, die uns Menschen hinterlassen.
Die Bedrohungen auf unserer Reise
Doch unser Zug ist nicht ohne Gefahren. Menschen verändern unsere Landschaften, entwässern Moore und Sümpfe und zerstören damit wichtige Rastplätze und Brutgebiete. Wir sind auf den Schutz dieser Gebiete angewiesen, um zu überleben. Auch die zunehmende Bebauung und der Ausbau von Windkraftanlagen auf unseren Routen können für uns gefährlich werden, da wir auf offenen Raum und ungestörte Flugkorridore angewiesen sind.
Aber es gibt Hoffnung. Viele Menschen setzen sich für uns ein und schützen unsere Rast- und Brutplätze. Große Reservate wie der Nationalpark Hortobágy in Ungarn oder das spanische Laguna de Gallocanta sind sichere Häfen für uns. Hier können wir ungestört rasten und uns auf den nächsten Flugabschnitt vorbereiten.
Der Frühling – die Rückkehr und der Neuanfang
Im Frühling kehren wir zurück in unsere Brutgebiete. Der Zug nach Norden ist ebenso beschwerlich, aber der Gedanke an die Fortpflanzung und den Neubeginn treibt uns an. Wieder sammeln wir uns auf den Rastplätzen, wieder formieren wir uns in Gruppen und überqueren weite Strecken. Die Jungvögel, die mit uns reisen, lernen jedes Mal mehr über die Routen und Bedingungen.
Für mich und meine Art ist dieser Zyklus von Zug, Fortpflanzung und Rückkehr das Fundament unseres Lebens. Wir sind Teil eines Kreislaufs, der schon seit Jahrtausenden besteht und den wir an die nächste Generation weitergeben.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
Ich bin ein Bewohner von Feuchtgebieten, Mooren, Sümpfen und Flachwassergebieten. Diese Gebiete bieten mir Schutz und eine reiche Nahrungsquelle. Meine Nahrung ist vielfältig, denn ich bin ein Allesfresser. In den Sommermonaten ernähre ich mich von Insekten, kleinen Wirbeltieren und Pflanzen. Doch auch Samen, Knollen und Beeren stehen auf meinem Speiseplan. Mit meinem spitzen Schnabel durchwühle ich das flache Wasser und die weichen Böden nach Nahrung. Diesen Lebensraum brauche ich nicht nur zum Fressen, sondern auch zum Brüten. Die Nester, die wir bauen, sind flache Plattformen aus Schilf und anderen Pflanzen.
Die Brutzeit – der Beginn des neuen Lebens
Wenn der Frühling naht, treibt uns der Drang zur Fortpflanzung in unsere Brutgebiete zurück. Dort suche ich zusammen mit meinem Partner, mit dem ich oft mein Leben lang zusammen bleibe, einen sicheren Platz im flachen Wasser oder in Sumpfgebieten. Nach einer beeindruckenden Balz, die voller Tänze, Sprünge und Rufe ist, legt mein Weibchen normalerweise zwei Eier. Wir wechseln uns ab, das Gelege zu bebrüten, und nach etwa 30 Tagen schlüpfen unsere Küken.
Unsere Jungen wachsen schnell, doch sie sind in ihren ersten Lebenswochen sehr verletzlich. Wir schützen sie vor Fressfeinden und führen sie sicher durch das Revier, bis sie selbst stark genug sind, um kurze Flüge zu unternehmen. Im Spätsommer sind sie bereit, mit uns den großen Zug anzutreten.
Der Zug des Kranichs – eine Reise der Generationen
Für uns Kraniche ist der Zug das Herzstück unseres Lebenszyklus. Der Herbst kündigt den Beginn unserer langen Reise an. Die Tage werden kürzer, und die Temperaturen sinken – es ist Zeit, nach Süden zu ziehen. Schon lange vor dem Abflug sammeln wir uns in großen Gruppen auf den Rastplätzen. Diese Orte sind entscheidend für uns, denn sie bieten Nahrung und Sicherheit, bevor wir uns auf den beschwerlichen Flug machen. In Mitteleuropa ist einer dieser wichtigen Rastplätze das Biosphärenreservat Schaalsee in Deutschland. Tausende von uns sammeln sich dort, um Kräfte für den Zug zu tanken.
Wenn die Zeit reif ist, formen wir eine V-Formation am Himmel. Diese Formation hilft uns, Energie zu sparen, denn der Auftrieb, den der Vogel an der Spitze erzeugt, erleichtert es den nachfolgenden Kranichen, im Wind zu gleiten. Wir wechseln uns an der Spitze ab, um die Belastung zu teilen. Unsere Flugroute führt uns über Kontinente und Meere hinweg. Jedes Jahr fliegen wir tausende Kilometer von unseren Brutgebieten in Nordeuropa bis zu unseren Winterquartieren in Spanien, Nordafrika oder sogar bis nach Indien.
Orientierung und Energie sparen – die Wissenschaft hinter dem Zug
Unsere Zugrouten folgen uralten Pfaden. Wir orientieren uns an der Sonne, den Sternen und dem Erdmagnetfeld. Auch die Landschaften und Flussverläufe sind uns vertraut, und oft fliegen wir entlang von Gebirgsketten oder Küsten, um uns zu orientieren. Wissenschaftler haben festgestellt, dass wir Kraniche diese Fähigkeiten schon in jungen Jahren lernen. Die älteren und erfahrenen Vögel führen die Jungvögel und weisen ihnen den Weg. Dieses Wissen wird über Generationen weitergegeben.
Doch es geht nicht nur um die Orientierung – der Flug kostet uns viel Energie. Wir sind auf thermische Aufwinde angewiesen, die uns in die Höhe tragen, sodass wir lange Strecken gleiten können, ohne mit den Flügeln zu schlagen. Diese Aufwinde sind besonders über Land verfügbar, daher vermeiden wir große Wasserflächen so gut es geht. An den Rastplätzen füllen wir unsere Energiereserven mit Mais, Getreide und anderen Pflanzen, die uns Menschen hinterlassen.
Die Bedrohungen auf unserer Reise
Doch unser Zug ist nicht ohne Gefahren. Menschen verändern unsere Landschaften, entwässern Moore und Sümpfe und zerstören damit wichtige Rastplätze und Brutgebiete. Wir sind auf den Schutz dieser Gebiete angewiesen, um zu überleben. Auch die zunehmende Bebauung und der Ausbau von Windkraftanlagen auf unseren Routen können für uns gefährlich werden, da wir auf offenen Raum und ungestörte Flugkorridore angewiesen sind.
Aber es gibt Hoffnung. Viele Menschen setzen sich für uns ein und schützen unsere Rast- und Brutplätze. Große Reservate wie der Nationalpark Hortobágy in Ungarn oder das spanische Laguna de Gallocanta sind sichere Häfen für uns. Hier können wir ungestört rasten und uns auf den nächsten Flugabschnitt vorbereiten.
Der Frühling – die Rückkehr und der Neuanfang
Im Frühling kehren wir zurück in unsere Brutgebiete. Der Zug nach Norden ist ebenso beschwerlich, aber der Gedanke an die Fortpflanzung und den Neubeginn treibt uns an. Wieder sammeln wir uns auf den Rastplätzen, wieder formieren wir uns in Gruppen und überqueren weite Strecken. Die Jungvögel, die mit uns reisen, lernen jedes Mal mehr über die Routen und Bedingungen.
Für mich und meine Art ist dieser Zyklus von Zug, Fortpflanzung und Rückkehr das Fundament unseres Lebens. Wir sind Teil eines Kreislaufs, der schon seit Jahrtausenden besteht und den wir an die nächste Generation weitergeben.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
- Herbstzug der Kranich
Artenschutz in Franken®
Überlebensraum Freiflächen- PV - Monitoring

Überlebensraum Freiflächen- PV - Monitoring
13/14.10.2024
Bayern. Seit geraumer Zeit haben wir unterschiedliche Freiflächenanlagen im Fokus und Monitoring, im Jahre 2024 haben wir nun damit begonnen einige dieser Flächen mit Nisthilfen auszustatten, um eine Lebensraumergänzung zu erreichen. Keinesfalls muss eine Freiflächenphotovoltaikanlage ökologisch wertvoll sein.
Es gibt Anlagen, die als Lebensraum für heimische Spezies kaum etwas hergeben, andere wiederum haben das Potenzial als hochwertiger Lebensraum zu fungieren.
13/14.10.2024
Bayern. Seit geraumer Zeit haben wir unterschiedliche Freiflächenanlagen im Fokus und Monitoring, im Jahre 2024 haben wir nun damit begonnen einige dieser Flächen mit Nisthilfen auszustatten, um eine Lebensraumergänzung zu erreichen. Keinesfalls muss eine Freiflächenphotovoltaikanlage ökologisch wertvoll sein.
Es gibt Anlagen, die als Lebensraum für heimische Spezies kaum etwas hergeben, andere wiederum haben das Potenzial als hochwertiger Lebensraum zu fungieren.
Solche haben wir nun auserkoren, um deren bereits interessante Lebensraumstruktur weiter zu verbessern. Nisthilfen stellen eine solche Lebensraumverbesserung dar. Auf geschützter Fläche können nun Kleinvögel- und Wildbienen neben Nahrung auch Fortpflanzungsmöglichkeiten finden.
In einer mehr und mehr ausgeräumten Freiflur bieten gut gemachte und gut durchdachte Fotovoltaikanlagen einen wertvollen Überlebensraum für zunehmend im Bestand gefährdete Tier- und Pflanzenarten. Artenschutz in Franken® bringt sich gerne ein, diese Bereiche professionell zu optimieren.
In der Aufnahme
In einer mehr und mehr ausgeräumten Freiflur bieten gut gemachte und gut durchdachte Fotovoltaikanlagen einen wertvollen Überlebensraum für zunehmend im Bestand gefährdete Tier- und Pflanzenarten. Artenschutz in Franken® bringt sich gerne ein, diese Bereiche professionell zu optimieren.
In der Aufnahme
- Sehr gut entwickelt sich der Bereich der die Freiflächen umgibt ... ein Überlebensraum entwickelt sich ...
Artenschutz in Franken®
Der Erlenzeisig (Spinus spinus)

Erlenzeisig (Spinus spinus)
12/13.10.2024
Ich bin der Erlenzeisig, wissenschaftlich bekannt als Spinus spinus, eine kleine Singvogelart aus der Familie der Finken (Fringillidae). Meine Art ist in Europa und Teilen Asiens heimisch und bekannt für unsere auffällige gelb-grüne Färbung während der Brutzeit.
12/13.10.2024
- Als Erlenzeisig möchte ich gerne mein Leben und meine Lebensweise aus meiner eigenen Perspektive erklären, und dabei verschiedene fachliche Komponenten einbeziehen.
Ich bin der Erlenzeisig, wissenschaftlich bekannt als Spinus spinus, eine kleine Singvogelart aus der Familie der Finken (Fringillidae). Meine Art ist in Europa und Teilen Asiens heimisch und bekannt für unsere auffällige gelb-grüne Färbung während der Brutzeit.
Lebensraum und Verbreitung: Als Erlenzeisig bevorzuge ich Laub- und Mischwälder sowie Parklandschaften mit reichlichem Baumbestand. Besonders gerne halte ich mich in der Nähe von Erle und Birke auf, da ich dort nicht nur Nahrung finde, sondern auch geeignete Brutplätze.
Ernährung: Meine Ernährung besteht hauptsächlich aus Samen, vor allem von Erle, Birke und anderen Bäumen. Im Winter können auch Knospen und kleine Beeren eine wichtige Nahrungsquelle darstellen. Durch meine kräftigen Schnabelstrukturen bin ich gut angepasst, um auch harte Samen zu knacken.
Fortpflanzung und Brutverhalten: Im Frühling beginnt unsere Brutzeit. Die Weibchen wählen Nistplätze in dichten Baumkronen, oft in der Nähe von Wasserquellen oder an Waldrändern. Unser Nest ist kompakt und aus feinen Gräsern, Moos und kleinen Zweigen gebaut. Dort legt das Weibchen mehrere Eier, die sie alleine überwacht und bebrütet, während das Männchen in dieser Zeit Nahrung sucht.
Sozialverhalten und Gesang: Erlenzeisige sind gesellige Vögel und leben oft in kleinen Trupps außerhalb der Brutzeit. Unser Gesang ist melodisch und besteht aus klaren, flötenden Tönen, die sowohl der Kommunikation untereinander als auch der Revierabgrenzung dienen.
Migration und Überwinterung: Ein Teil unserer Populationen sind Zugvögel und verlassen in den Wintermonaten die nördlichen Brutgebiete, um südlichere Regionen aufzusuchen, wo das Nahrungsangebot während der kalten Jahreszeit besser ist. Dort bilden wir oft größere Schwärme mit anderen Finkenarten.
Schutzstatus und Bedrohungen: Obwohl wir nicht akut gefährdet sind, stehen wir doch unter Beobachtung, da der Verlust geeigneter Lebensräume und intensivierte Landwirtschaft unsere Populationen beeinträchtigen können. Naturschutzmaßnahmen, wie die Erhaltung von naturnahen Wäldern und die Förderung von Biotopverbundsystemen, sind daher entscheidend für unseren langfristigen Schutz.
Insgesamt sind wir Erlenzeisige anpassungsfähige Vögel, die eng mit den Wäldern und ihrer natürlichen Umgebung verbunden sind. Unsere Fähigkeit, uns an unterschiedliche Lebensräume anzupassen und unsere melodischen Gesänge machen uns zu einer faszinierenden Spezies innerhalb der Vogelwelt.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
Ernährung: Meine Ernährung besteht hauptsächlich aus Samen, vor allem von Erle, Birke und anderen Bäumen. Im Winter können auch Knospen und kleine Beeren eine wichtige Nahrungsquelle darstellen. Durch meine kräftigen Schnabelstrukturen bin ich gut angepasst, um auch harte Samen zu knacken.
Fortpflanzung und Brutverhalten: Im Frühling beginnt unsere Brutzeit. Die Weibchen wählen Nistplätze in dichten Baumkronen, oft in der Nähe von Wasserquellen oder an Waldrändern. Unser Nest ist kompakt und aus feinen Gräsern, Moos und kleinen Zweigen gebaut. Dort legt das Weibchen mehrere Eier, die sie alleine überwacht und bebrütet, während das Männchen in dieser Zeit Nahrung sucht.
Sozialverhalten und Gesang: Erlenzeisige sind gesellige Vögel und leben oft in kleinen Trupps außerhalb der Brutzeit. Unser Gesang ist melodisch und besteht aus klaren, flötenden Tönen, die sowohl der Kommunikation untereinander als auch der Revierabgrenzung dienen.
Migration und Überwinterung: Ein Teil unserer Populationen sind Zugvögel und verlassen in den Wintermonaten die nördlichen Brutgebiete, um südlichere Regionen aufzusuchen, wo das Nahrungsangebot während der kalten Jahreszeit besser ist. Dort bilden wir oft größere Schwärme mit anderen Finkenarten.
Schutzstatus und Bedrohungen: Obwohl wir nicht akut gefährdet sind, stehen wir doch unter Beobachtung, da der Verlust geeigneter Lebensräume und intensivierte Landwirtschaft unsere Populationen beeinträchtigen können. Naturschutzmaßnahmen, wie die Erhaltung von naturnahen Wäldern und die Förderung von Biotopverbundsystemen, sind daher entscheidend für unseren langfristigen Schutz.
Insgesamt sind wir Erlenzeisige anpassungsfähige Vögel, die eng mit den Wäldern und ihrer natürlichen Umgebung verbunden sind. Unsere Fähigkeit, uns an unterschiedliche Lebensräume anzupassen und unsere melodischen Gesänge machen uns zu einer faszinierenden Spezies innerhalb der Vogelwelt.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
- Erlenzeisig im Oktoberregen
Artenschutz in Franken®
PV - Freifläche - Überlebensräume für Zauneidechse & Co.

Überlebensräume für Zauneidechse & Co.
12/13.10.2024
Bayern. Mit der Neuanlage entsprechender Lebensraumkulissen bemühen wir uns einer möglichst breiten Artenvielfalt die benötigten Strukturen vorzuhalten, um in einer zunehmend vom Menschen geprägten und übernutzen Umwelt überdauern zu können.
Viele Tier- und Pflanzenarten leben bereits viele Millionen Jahre auf diesem Planeten. Der Spezies Mensch ist es nun tatsächlich gelungen diesen Lebensformen den Todesstoß zu versetzen indem sie entweder die Arten direkt oder deren Lebensräume eliminiert.
12/13.10.2024
- Projekt im Monitoring - Sichtbar machen was wichtig wird!
Bayern. Mit der Neuanlage entsprechender Lebensraumkulissen bemühen wir uns einer möglichst breiten Artenvielfalt die benötigten Strukturen vorzuhalten, um in einer zunehmend vom Menschen geprägten und übernutzen Umwelt überdauern zu können.
Viele Tier- und Pflanzenarten leben bereits viele Millionen Jahre auf diesem Planeten. Der Spezies Mensch ist es nun tatsächlich gelungen diesen Lebensformen den Todesstoß zu versetzen indem sie entweder die Arten direkt oder deren Lebensräume eliminiert.
Der uns nachfolgenden Generation hinterlassen wir, wenn wir noch wenige Jahre so weitermachen wie bisher einen ausgeräumten und lebensfeindlichen Planeten. Der Ansatz zum Klimaschutz darf nicht zulasten der Biodiversität gehen, denn nur wenn beides stimmt, Klima und Artenvielfalt, können wir davon sprechend das es uns gelungen ist, den Planeten Erde für unsere Kinder und Enkelkinder zu erhalten.
In Zusammenarbeit mit dem Betreiber einer Freiflächenfotovoltaikanlage konnten wir am 12. April 2024 mit der Anlage speziell für die Leitart Zauneidechse ausgerichteter Habitatstrukturen beginnen. In dieser Rubrik möchten wir Ihnen einige Eindrücke von der Gestaltung der Lebensraumanlage vermitteln. An einem sonnigen Tag wurden die ersten Arbeitsschritte generiert.
In der Aufnahme
In Zusammenarbeit mit dem Betreiber einer Freiflächenfotovoltaikanlage konnten wir am 12. April 2024 mit der Anlage speziell für die Leitart Zauneidechse ausgerichteter Habitatstrukturen beginnen. In dieser Rubrik möchten wir Ihnen einige Eindrücke von der Gestaltung der Lebensraumanlage vermitteln. An einem sonnigen Tag wurden die ersten Arbeitsschritte generiert.
In der Aufnahme
- Mit weiteren Informationseinheiten machen wir sichtbar was uns hier wichtig ist!
Artenschutz in Franken®
Vogel des Jahres 2025

Vogel des Jahres 2025
11/12.10.2024
Eigentlich nenne ich mich selbst gar nicht so – ich bin einfach ich, mit meinem leuchtend orange-roten Schwanz und meinem schlichten, dunklen Federkleid. Und dieses Jahr bin ich stolz darauf, dass ich zum Vogel des Jahres 2025 gewählt wurde! Lass mich dir erzählen, warum das passiert ist.
11/12.10.2024
- Hallo, Mensch! Ich bin ein Hausrotschwanz, oder wie ihr mich in wissenschaftlich nennt, Phoenicurus ochruros.
Eigentlich nenne ich mich selbst gar nicht so – ich bin einfach ich, mit meinem leuchtend orange-roten Schwanz und meinem schlichten, dunklen Federkleid. Und dieses Jahr bin ich stolz darauf, dass ich zum Vogel des Jahres 2025 gewählt wurde! Lass mich dir erzählen, warum das passiert ist.
Wer bin ich?
Du hast mich bestimmt schon gesehen. Ich bin oft in deiner Nähe, besonders in Städten, Dörfern und Siedlungen. Ursprünglich kam ich aus felsigen, gebirgigen Landschaften, aber mittlerweile sind eure Gebäude meine neuen Felsen. Ich liebe es, auf Dachkanten, Schornsteinen und Zäunen zu sitzen und von dort aus mein Lied zu singen – das hat so einen kratzenden Klang, fast als würde ich einen Stein reiben oder Metall schlagen. Vielleicht hast du es ja schon mal gehört?
Warum bin ich Vogel des Jahres 2025?
Ich bin stolz, dass die Menschen mich ausgewählt haben, denn das bedeutet, dass sie mich und meine Bedürfnisse ernst nehmen. In euren Städten gibt es immer weniger Orte, an denen ich nisten kann. Die alten Gebäude, an denen ich mich immer wohlgefühlt habe, verschwinden und machen modernen, glatten Fassaden Platz, an denen es kaum noch Nischen für meine Nester gibt.
Zudem wird es immer schwieriger, Nahrung zu finden. Insekten, die meine Hauptnahrung sind, sind seltener geworden – das hängt mit eurer intensiven Landwirtschaft und dem Einsatz von Pestiziden zusammen. Früher konnte ich im Umkreis von Städten und Dörfern genügend Futter finden, aber jetzt wird das schwieriger.
Ich wurde also zum Vogel des Jahres 2025 gewählt, um darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig es ist, dass ihr Menschen eure Städte und Dörfer so gestaltet, dass auch ich, der Hausrotschwanz, hier leben kann. Das heißt, mehr grüne Flächen, Dachgärten und weniger Pestizide – und vielleicht, wenn ihr Lust habt, auch ein paar Nistkästen anbringen. Solche kleinen Maßnahmen können mir und vielen anderen Tieren helfen.
Ein Zeichen der Hoffnung
Dass ich jetzt diesen Titel trage, ist nicht nur ein Alarmruf – es ist auch ein Zeichen der Hoffnung. Denn ihr Menschen seid in der Lage, mir zu helfen. Viele von euch wissen, wie wichtig es ist, dass auch wir Vögel in euren Städten einen Platz haben. Die Wahl zum Vogel des Jahres gibt mir eine Stimme, und gemeinsam können wir sicherstellen, dass ich weiterhin mit meinem leuchtend roten Schwanz von Dach zu Dach hüpfen und mein Lied in euren Städten singen kann.
Danke, dass ihr mir zuhört und mich zum Vogel des Jahres 2025 gemacht habt. Jetzt liegt es an uns allen, meine Heimat lebenswert zu gestalten – für uns beide, Hausrotschwanz und Mensch.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- „Vogel des Jahres 2007“ - Turmfalke, mit dem Vogel des Jahres „Vogel des Jahres 2025" ... beides Weibchen.
Artenschutz in Franken®
Lehmpfützen weg - Rauschschwalben weg?

Lehmpfützen weg - Rauschschwalben weg?
11/12.10.2024
Nordrhein - Westfalen. 2010 / 2015 waren in den Gebäuden der alten NATO-Raketenstation am Rübenbusch in Bedburg 52 Rauchschwalbennester in und an den verlassenen Gebäuden zu finden. In der näheren Umgebung fanden sich auf zwei Feldwegen Wasserpfützen mit Lehm.
Die Rauchschwalben holten sich von da ihr Baumaterial, um ihre Reproduktionsstätten zu gestalten. Mit der Wolle von den auf der eingezäunten Fläche weidenden Schafen kleideten die Schwalben ihre Nester aus.
11/12.10.2024
Nordrhein - Westfalen. 2010 / 2015 waren in den Gebäuden der alten NATO-Raketenstation am Rübenbusch in Bedburg 52 Rauchschwalbennester in und an den verlassenen Gebäuden zu finden. In der näheren Umgebung fanden sich auf zwei Feldwegen Wasserpfützen mit Lehm.
Die Rauchschwalben holten sich von da ihr Baumaterial, um ihre Reproduktionsstätten zu gestalten. Mit der Wolle von den auf der eingezäunten Fläche weidenden Schafen kleideten die Schwalben ihre Nester aus.
Jetzt wo die Gebäude bis auf drei Bunker abgerissen wurden, sind 3 Nester übrig geblieben. Die Schafe sind weg und die Feldwege wurden befestigt / beschottert.
Bis heute wurden keine Ausgleichsmaßnahmen zum Erhalt / Schutz der Schwalben angeboten. Sollten Schwalben im nächsten Jahr zurückkommen, finden sie zwar Nahrung, aber kein Nistmaterial. Des Weiteren sind Bachstelze und Feldsperling als Folgenutzer in den Nestern zu finden.
Alleine das Abhandenkommen von naturnahen Feldwegen mit Fahrspuren und Mittelgrün ist ein großer Verlust für unsere Artenvielfalt und Biodiversität. Die Feldwege haben in dem Gesamtgefüge einen sehr wichtigen Platz und sind schutzwürdig. Feldwege sollten im Landschaftsplan festgeschrieben werden, als Teil des Gesamtkomplexes geschützt und erhalten bleiben.
Quelle / Aufnahmen
Gewässer und Naturschutz im Erftkreis
Flora-Fauna-Artenschutz
Naturschutzökologie
Rolf Thiemann
Naturschutzberater
Eisvogelweg 1
50181 Bedburg
Stand
05.10.2024
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung.Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Bis heute wurden keine Ausgleichsmaßnahmen zum Erhalt / Schutz der Schwalben angeboten. Sollten Schwalben im nächsten Jahr zurückkommen, finden sie zwar Nahrung, aber kein Nistmaterial. Des Weiteren sind Bachstelze und Feldsperling als Folgenutzer in den Nestern zu finden.
Alleine das Abhandenkommen von naturnahen Feldwegen mit Fahrspuren und Mittelgrün ist ein großer Verlust für unsere Artenvielfalt und Biodiversität. Die Feldwege haben in dem Gesamtgefüge einen sehr wichtigen Platz und sind schutzwürdig. Feldwege sollten im Landschaftsplan festgeschrieben werden, als Teil des Gesamtkomplexes geschützt und erhalten bleiben.
Quelle / Aufnahmen
Gewässer und Naturschutz im Erftkreis
Flora-Fauna-Artenschutz
Naturschutzökologie
Rolf Thiemann
Naturschutzberater
Eisvogelweg 1
50181 Bedburg
Stand
05.10.2024
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung.Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Artenschutz in Franken®
WWF Living Planet Report zeigt dramatischen Rückgang der Wildtierbestände ..

WWF Living Planet Report zeigt dramatischen Rückgang der Wildtierbestände weltweit
10/11.10.2024
Die Populationsgrößen von Säugetieren, Amphibien, Reptilien und Vögeln und Fischen nehmen weltweit drastisch ab. In den letzten 50 Jahren hat der Mensch die untersuchten Wirbeltierbestände um durchschnittlich 73 Prozent dezimiert.
Das geht aus dem heute erschienenen Living Planet Report 2024 des WWF hervor. Den stärksten Rückgang verzeichnen die Süßwasserökosysteme mit 85 Prozent, gefolgt von Land- (69%) und Meeresökosystemen (56%) Prozent. Geografisch sind Lateinamerika und die Karibik (95%), Afrika (76%) und die Asien-Pazifik-Region (60%) am stärksten betroffen. Dabei laufen ökologische Kipppunkte Gefahr, überschritten zu werden.
10/11.10.2024
- Untersuchte Wirbeltierbestände schrumpfen weltweit im Durchschnitt um 73 Prozent/ Ambitionierter Naturschutz und Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft nötig
Die Populationsgrößen von Säugetieren, Amphibien, Reptilien und Vögeln und Fischen nehmen weltweit drastisch ab. In den letzten 50 Jahren hat der Mensch die untersuchten Wirbeltierbestände um durchschnittlich 73 Prozent dezimiert.
Das geht aus dem heute erschienenen Living Planet Report 2024 des WWF hervor. Den stärksten Rückgang verzeichnen die Süßwasserökosysteme mit 85 Prozent, gefolgt von Land- (69%) und Meeresökosystemen (56%) Prozent. Geografisch sind Lateinamerika und die Karibik (95%), Afrika (76%) und die Asien-Pazifik-Region (60%) am stärksten betroffen. Dabei laufen ökologische Kipppunkte Gefahr, überschritten zu werden.
„Der Living Planet Index zeigt: Wir zerstören, was uns am Leben hält. Unsere Gesundheit, unsere Lebensmittelversorgung, unser Zugang zu sauberem Wasser, die Stabilität der Wirtschaft und erträgliche Temperaturen sind abhängig von intakten Ökosystemen und gesunden Wildtierbeständen. Was wir für ein gutes und sicheres Leben benötigen, steht durch unsere Lebensweise auf dem Spiel“, so Kathrin Samson, Vorständin Naturschutz beim WWF Deutschland.
Der WWF betont, dass alle Ursachen für das Artensterben menschengemacht sind. Die Zerstörung der Lebensräume vieler Tiere und Pflanzen, Umweltverschmutzung und die Klimakrise könnten für viele Arten das Aus bedeuten. Zusammen mit der Zoologischen Gesellschaft London werteten die WWF Autor:innen für den Living Planet Report fast 35.000 globale Populationen von annähernd 5.500 Wirbeltierarten auf der ganzen Welt aus.
Dramatisch sieht es beispielsweise für den Atlantischen Kabeljau/Dorsch im Nordatlantik und der westlichen Ostsee aus. Sein Bestand brach zwischen 2000 und 2023 um 77 Prozent ein. Auch die Population der Amazonas-Rosa-Flussdelfine und die der kleineren Tucuxi-Delfine im brasilianischen Mamirauá-Schutzgebiet gehen rasant zurück, von 1996 bis 2016 um 65 Prozent bzw. 75 Prozent. Dazu starben im Jahr 2023 während extremer Hitze und Dürre mehr als 330 Flussdelfine in nur zwei Seen.
Dass Artenschutzmaßnahmen wirken, zeigt sich hingegen beim Wisent. Die Art war in freier Wildbahn ausgestorben und ist bis heute wieder auf ca. 6.800 Tiere angewachsen. Die meisten Wisente Europas (91–100 Prozent) leben in geschützten Gebieten. Auch die Berggorillas im Virunga-Bergmassiv erholen sich, der Bestand ist auf rund 700 Tiere angewachsen.
Der Living Planet Index dient auch als Frühwarnsystem für drohende ökologische Kipppunkte. Die Doppelkrise aus Biodiversitätsverlust und Klimakrise bringt nicht nur einzelne Arten an ihre Grenzen, sondern gefährdet die Stabilität ganzer Ökosysteme. Die Zerstörung des Amazonas-Regenwaldes und die globale Massenbleiche von Korallenriffen sind nur zwei Beispiele dafür. „Mit jeder Ausgabe des Living Planet Report müssen wir weiteren Schwund der Natur verkünden. Die Menschheit läuft Gefahr, die eigene Handlungsmacht zu verlieren. Mit der Natur lässt sich nicht verhandeln - die Kipppunkte, auf die wir zusteuern, markieren die Grenze des Unumkehrbaren“, warnt Kathrin Samson.
Die nächsten fünf Jahre sind entscheidend für die Zukunft des Lebens auf unserer Erde. Der diesjährige Living Planet Report ist dabei nicht nur eine Warnung, sondern auch ein Wegweiser für eine nachhaltige Zukunft. Naturschutz muss dabei zwingend Hand in Hand gehen mit der Transformation der Nahrungsmittelerzeugung, des globalen Energiesystems und des Finanzsystems. „Noch können wir das Ruder herumreißen und den Verlust der biologischen Vielfalt aufhalten. Dafür muss aber die Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft schneller gehen“, fordert Kathrin Samson.
Auch die drei internationalen Konferenzen zum Ende des Jahres können Fortschritte bringen. Dafür braucht es auf der Weltnaturkonferenz in Kolumbien als auch auf der Klima-COP in Aserbaidschan und bei den Verhandlungen des UN-Plastikabkommens in Südkorea den politischen Willen, Artensterben und Klimakrise aufzuhalten. Auch Deutschland trägt dabei eine große Verantwortung.
Hintergrund zum Living Planet Report
Der Living Planet Report zeigt den ökologischen Gesundheitszustand der Erde und Wege aus der Biodiversitätskrise. Die Studie wird seit 1998 vom WWF (World Wide Fund for Nature) veröffentlicht. Seit 2000 erscheint sie alle zwei Jahre. Die aktuelle 15. Ausgabe hat der WWF gemeinsam mit der Zoological Society of London erstellt. Anhand der Auswertung von fast 35.000 Wirbeltier-Populationen aus 5.495 Arten zeigt der 15. Living Planet Index einen durchschnittlichen Rückgang der Bestände um 73 Prozent im Zeitraum von 1970 bis 2020. Die prozentuale Veränderung spiegelt die durchschnittliche proportionale Veränderung der Größe der Bestände über einen längeren Zeitraum wider – nicht die Anzahl der verlorenen Einzeltiere oder gar die Anzahl ausgestorbener Arten.
Quelle:
WWF
Stand:
10.10.2024
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung.Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
In der Aufnahme von Willibald Lang
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Der WWF betont, dass alle Ursachen für das Artensterben menschengemacht sind. Die Zerstörung der Lebensräume vieler Tiere und Pflanzen, Umweltverschmutzung und die Klimakrise könnten für viele Arten das Aus bedeuten. Zusammen mit der Zoologischen Gesellschaft London werteten die WWF Autor:innen für den Living Planet Report fast 35.000 globale Populationen von annähernd 5.500 Wirbeltierarten auf der ganzen Welt aus.
Dramatisch sieht es beispielsweise für den Atlantischen Kabeljau/Dorsch im Nordatlantik und der westlichen Ostsee aus. Sein Bestand brach zwischen 2000 und 2023 um 77 Prozent ein. Auch die Population der Amazonas-Rosa-Flussdelfine und die der kleineren Tucuxi-Delfine im brasilianischen Mamirauá-Schutzgebiet gehen rasant zurück, von 1996 bis 2016 um 65 Prozent bzw. 75 Prozent. Dazu starben im Jahr 2023 während extremer Hitze und Dürre mehr als 330 Flussdelfine in nur zwei Seen.
Dass Artenschutzmaßnahmen wirken, zeigt sich hingegen beim Wisent. Die Art war in freier Wildbahn ausgestorben und ist bis heute wieder auf ca. 6.800 Tiere angewachsen. Die meisten Wisente Europas (91–100 Prozent) leben in geschützten Gebieten. Auch die Berggorillas im Virunga-Bergmassiv erholen sich, der Bestand ist auf rund 700 Tiere angewachsen.
Der Living Planet Index dient auch als Frühwarnsystem für drohende ökologische Kipppunkte. Die Doppelkrise aus Biodiversitätsverlust und Klimakrise bringt nicht nur einzelne Arten an ihre Grenzen, sondern gefährdet die Stabilität ganzer Ökosysteme. Die Zerstörung des Amazonas-Regenwaldes und die globale Massenbleiche von Korallenriffen sind nur zwei Beispiele dafür. „Mit jeder Ausgabe des Living Planet Report müssen wir weiteren Schwund der Natur verkünden. Die Menschheit läuft Gefahr, die eigene Handlungsmacht zu verlieren. Mit der Natur lässt sich nicht verhandeln - die Kipppunkte, auf die wir zusteuern, markieren die Grenze des Unumkehrbaren“, warnt Kathrin Samson.
Die nächsten fünf Jahre sind entscheidend für die Zukunft des Lebens auf unserer Erde. Der diesjährige Living Planet Report ist dabei nicht nur eine Warnung, sondern auch ein Wegweiser für eine nachhaltige Zukunft. Naturschutz muss dabei zwingend Hand in Hand gehen mit der Transformation der Nahrungsmittelerzeugung, des globalen Energiesystems und des Finanzsystems. „Noch können wir das Ruder herumreißen und den Verlust der biologischen Vielfalt aufhalten. Dafür muss aber die Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft schneller gehen“, fordert Kathrin Samson.
Auch die drei internationalen Konferenzen zum Ende des Jahres können Fortschritte bringen. Dafür braucht es auf der Weltnaturkonferenz in Kolumbien als auch auf der Klima-COP in Aserbaidschan und bei den Verhandlungen des UN-Plastikabkommens in Südkorea den politischen Willen, Artensterben und Klimakrise aufzuhalten. Auch Deutschland trägt dabei eine große Verantwortung.
Hintergrund zum Living Planet Report
Der Living Planet Report zeigt den ökologischen Gesundheitszustand der Erde und Wege aus der Biodiversitätskrise. Die Studie wird seit 1998 vom WWF (World Wide Fund for Nature) veröffentlicht. Seit 2000 erscheint sie alle zwei Jahre. Die aktuelle 15. Ausgabe hat der WWF gemeinsam mit der Zoological Society of London erstellt. Anhand der Auswertung von fast 35.000 Wirbeltier-Populationen aus 5.495 Arten zeigt der 15. Living Planet Index einen durchschnittlichen Rückgang der Bestände um 73 Prozent im Zeitraum von 1970 bis 2020. Die prozentuale Veränderung spiegelt die durchschnittliche proportionale Veränderung der Größe der Bestände über einen längeren Zeitraum wider – nicht die Anzahl der verlorenen Einzeltiere oder gar die Anzahl ausgestorbener Arten.
Quelle:
WWF
Stand:
10.10.2024
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung.Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
In der Aufnahme von Willibald Lang
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Artenschutz in Franken®
Der Grünspecht (Picus viridis)

Grünspecht (Picus viridis)
10/11.10.2024
Meine auffällige grün-gelbe Färbung, die rote Kopfplatte und mein typischer Ruf machen mich unverkennbar, aber es ist vor allem mein Verhalten und meine Lebensweise, die mich zu einem bedeutenden Akteur im Ökosystem machen.
10/11.10.2024
- Als Grünspecht (Picus viridis) möchte ich dir meine Welt aus meiner Perspektive schildern und verdeutlichen, warum ich eine wichtige Rolle im Ökohaushalt spiele.
Meine auffällige grün-gelbe Färbung, die rote Kopfplatte und mein typischer Ruf machen mich unverkennbar, aber es ist vor allem mein Verhalten und meine Lebensweise, die mich zu einem bedeutenden Akteur im Ökosystem machen.
Meine Lebensweise und ökologische Nische
Ich bin ein spezialisierter Vogel, der sich vor allem auf Ameisen spezialisiert hat. Mein langer, klebriger und beweglicher Zungenapparat ist ein Wunder der Evolution, das es mir ermöglicht, Ameisen aus ihren Nestern zu ziehen. Während andere Spechte gerne Bäume bearbeiten, suche ich hauptsächlich am Boden nach Nahrung. Mein bevorzugtes Habitat sind lichter Wald, Streuobstwiesen, Waldränder und manchmal auch offene Landschaften, solange es alte Bäume gibt, die ich als Brutplätze nutzen kann.
Meine Bedeutung im Ökosystem
- Regulation von Ameisenpopulationen: Als einer der wenigen Vögel, die sich in erster Linie von Ameisen ernähren, spiele ich eine Schlüsselrolle bei der Regulierung ihrer Population. Ameisen sind wichtige Insekten, aber wenn sie überhandnehmen, können sie das Nahrungsnetz stören. Ich halte die Population in einem gesunden Gleichgewicht. Indem ich die Bestände von Wiesenameisen (meiner bevorzugten Nahrung) kontrolliere, verhindere ich eine Überpopulation und damit eine zu starke Beeinflussung anderer Insekten- oder Pflanzenarten durch diese Ameisen.
- Förderung der Bodengesundheit: Wenn ich am Boden nach Ameisennestern grabe, trage ich zur Durchmischung und Belüftung des Bodens bei. Dadurch wird die Bodenstruktur verbessert, was das Wachstum von Pflanzen fördert. Dies mag ein indirekter Effekt sein, aber er hat dennoch eine positive Wirkung auf das Ökosystem.
- Schaffung von Brut- und Lebensräumen für andere Arten: Wie andere Spechte bin auch ich ein sogenannter "Primärhöhlenbrüter", was bedeutet, dass ich meine Nisthöhlen selbst in morschen oder abgestorbenen Bäumen schlage. Diese Höhlen werden nach meiner Brutzeit oft von anderen Arten genutzt, wie z.B. Meisen, Kleibern oder Fledermäusen. Ich trage also zur Schaffung von wertvollen Lebensräumen bei, die für viele Arten entscheidend sind.
- Förderung der Waldgesundheit: Indem ich vor allem alte und absterbende Bäume als Brutplätze nutze, trage ich zur natürlichen Auslese im Wald bei. Diese toten Bäume sind ein wichtiger Bestandteil des Waldes, da sie Lebensraum für viele Organismen bieten, darunter Pilze, Insekten und Mikroorganismen, die den Abbau und die Rückführung von Nährstoffen in den Boden ermöglichen. Meine Höhlen unterstützen diesen Prozess, indem sie den Abbau beschleunigen und Platz für nachfolgende Pionierpflanzen schaffen.
- Indikatorart für intakte Ökosysteme: Meine Anwesenheit in einem Gebiet kann als Indikator für die Gesundheit des Ökosystems dienen. Ich bin auf alte Bäume, lichte Wälder und eine gesunde Ameisenpopulation angewiesen. Wenn ich in einem Gebiet gedeihe, bedeutet dies, dass diese Faktoren vorhanden und funktional sind. Mein Rückgang wäre hingegen ein Warnsignal für den Verlust wichtiger Lebensräume und das Verschwinden von Arten, die auf diese Lebensräume angewiesen sind.
Fachlich hochstehende Komponenten:
- Anpassung und Spezialisierung: Meine Zunge ist ein herausragendes Beispiel für evolutionäre Anpassung. Mit einer Länge von bis zu 10 cm und einer klebrigen Oberfläche kann ich Ameisen selbst aus tiefen Nestern herausziehen. Diese Spezialisierung zeigt, wie komplexe Ökosysteme durch spezialisierte Räuber stabilisiert werden. Ohne diese Anpassung wäre ich nicht in der Lage, die ökologischen Nischen zu füllen, die ich besetze.
- Bedeutung für das Mikroklima: Die von mir geschaffenen Höhlen fördern die Belüftung von Baumstämmen und unterstützen das lokale Mikroklima. In diesen Höhlen können sich Insekten und andere Tiere ansiedeln, die zur biologischen Vielfalt des Waldes beitragen und mikrobielle Zersetzungsprozesse fördern, die für den Nährstoffkreislauf von großer Bedeutung sind.
- Langfristige Bedeutung für die Artenvielfalt: Indem ich nicht nur einen direkten Einfluss auf die Ameisenpopulation habe, sondern auch indirekt das Lebensraumangebot für andere Arten erweitere, trage ich langfristig zur Stabilität und Widerstandsfähigkeit des Ökosystems bei. Die von mir geschaffenen Strukturen (Höhlen, Bodenbearbeitung) sind nachhaltige Beiträge zur Artenvielfalt, die über meine Lebenszeit hinaus Wirkung zeigen.
Fazit:
Ich, der Grünspecht (Picus viridis), spiele eine wesentliche Rolle im ökologischen Gefüge. Durch meine Spezialisierung auf Ameisen kontrolliere ich ihre Bestände und beeinflusse so die Dynamik des Bodens und anderer Insektenpopulationen. Meine Fähigkeit, Höhlen in Bäume zu schlagen, schafft wertvolle Nistplätze für viele Arten und fördert die biologische Vielfalt in Wäldern und offenen Landschaften. Indem ich alte Bäume nutze, trage ich zur natürlichen Waldentwicklung und zur Schaffung von Mikrohabitaten bei.
Meine Präsenz ist ein Zeichen für ein intaktes Ökosystem, und mein Verschwinden wäre ein Hinweis auf den Verlust von Lebensräumen, der sich negativ auf viele andere Arten auswirken würde.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
- Junger Grünspecht
Artenschutz in Franken®
Unser Wald: Vom Klimaschützer zum Klimakiller

Unser Wald: Vom Klimaschützer zum Klimakiller
09/10.10.2024
Heute stellt Bundesminister Özdemir die Ergebnisse der vierten Bundeswaldinventur vor. Sie liefert erschreckende Erkenntnisse: In den letzten fünf Jahren hat der Wald in Deutschland weniger Kohlendioxid eingelagert, als er abgegeben hat.
Dr. Susanne Winter, Programmleitung Wald beim WWF Deutschland ist besorgt: „Die Hoffnung ist nicht mehr grün. Die Bundesregierung hat den Wald als Klimaschützer fest eingeplant. Doch wir überfrachten ihn mit Aufgaben und plündern ihn aus. Mit der Bundeswaldinventur haben wir es amtlich: Der Wald fällt als Klimaschützer aus.“
09/10.10.2024
- Bundeswaldinventur: Deutschlands größtes Ökosystem ist zur Treibhausgasquelle geworden
Heute stellt Bundesminister Özdemir die Ergebnisse der vierten Bundeswaldinventur vor. Sie liefert erschreckende Erkenntnisse: In den letzten fünf Jahren hat der Wald in Deutschland weniger Kohlendioxid eingelagert, als er abgegeben hat.
Dr. Susanne Winter, Programmleitung Wald beim WWF Deutschland ist besorgt: „Die Hoffnung ist nicht mehr grün. Die Bundesregierung hat den Wald als Klimaschützer fest eingeplant. Doch wir überfrachten ihn mit Aufgaben und plündern ihn aus. Mit der Bundeswaldinventur haben wir es amtlich: Der Wald fällt als Klimaschützer aus.“
Die Inventurdaten zeigen: Der deutsche Wald hat nicht den erwarteten Beitrag als Kohlenstoffsenke geleistet. Denn der Holzzuwachs stagniert seit der letzten Inventur im Jahr 2012. Der mittlere Zuwachs lag mit 9,41 m³ pro Hektar und Jahr im Durchschnitt unter dem Abgang durch Holznutzung oder Absterben von rund 10,2 m³ pro Hektar und Jahr. Damit entfernt sich die deutsche Forstwirtschaft von ihrem Nachhaltigkeitsversprechen.
Auffällig ist, dass in Großprivatwäldern deutlich weniger Nadelholz als Laubholz genutzt wird als in öffentlichen Wäldern. Hier scheint der notwendige Waldumbau– ein erklärtes Ziel der Ampelkoalition – nicht ausreichend zu erfolgen. Jetzt rächt sich, dass der Umbau von Nadelholzmonokulturen in klimastabile Laubwälder nicht frühzeitig und konsequent angegangen wurde. Das Totholzvolumen liegt jetzt bei rund 29 m³ pro Hektar und hat damit erfreulich zugenommen. Dies ist aber vor allem auf abgestorbene Nadelholzforste zurückzuführen, die weniger zum Biodiversitätserhalt beitragen. Der Wert für den Großprivatwald ist mit 23 m³ pro Hektar im Vergleich zum Staatswald mit 36 m³ pro Hektar auffallend niedrig.
Ende September hatte das Oberverwaltungsgericht (OVG) Berlin-Brandenburg bestätigt, dass die Ziele des Klimaschutzgesetzes im Landnutzungssektor (LULUCF) mit den bisher geplanten Maßnahmen zu praktisch 100 Prozent verfehlt würden. Soll der Wald jedoch Partner im Klimaschutz bleiben und die 2030er Klimaschutzziele erreicht werden, geht das nur durch deutlich weniger Holznutzung und Aufbau des Holzvorrats. „Dazu muss der jährliche Holzeinschlag in den nächsten Jahren um rund ein Drittel verringert werden“, fordert Susanne Winter. „Alte Laubwälder dürfen gar nicht mehr oder nur sehr wenig und schonend genutzt werden, großflächige Rodungen sind auszuschließen. Zudem müssen wir die Moore schnell und umfassend wiedervernässen, die Förderung von Holzverbrennung in Kraftwerken abschaffen und eine funktionierende Kreislaufwirtschaft für Holz durchsetzen.“ Altholz sollte nicht verbrannt, sondern gleichwertig weitergenutzt werden. Außerdem sollte die Bundesregierung mit der Bundeswaldgesetzreform dringend die Möglichkeit nutzen, den Waldzustand und nicht nur die Waldfläche zu schützen.
„Angesichts dieser verheerenden Bilanz aus der Bundeswaldinventur zeigt sich mehr denn je, dass wir ein starkes Bundeswaldgesetz brauchen. Es liefert bundesweit gültige Vorgaben, die wir für den Klima- und Biodiversitätsschutz dringend benötigen. Jetzt liegt es an Bundesminister Özdemir, ob wir den Wald in Deutschland fit für den Klima- und Biodiversitätsschutz und unsere Zukunft machen können. Insbesondere muss es eine Obergrenze für genehmigungsfähige Kahlschläge geben und der Wald darf nicht durch eng beieinander liegende Rückegassen für die Holzfällung und -transport zerhäckselt werden. Hier muss dringend nachgebessert werden. Der über die EU-Biodiversitätsstrategie vereinbarte Schutz der Wälder mit 10 Prozent Stilllegung und 30 Prozent wirksamen Schutzgebieten muss endlich umgesetzt werden, um dem Wald sein Überleben zu erleichtern, “ so Winter.
Hintergrund:
Alle zehn Jahre wird der Wald in Deutschland inventarisiert. Das Thünen-Institut für Waldökosysteme ist vom BMEL mit der Bundesinventurleitung beauftragt und fasst die Ergebnisse zusammen. Für die Durchführung wurde ein Stichprobennetz in mindestens einem vier mal vier Kilometer Raster über das Land verteilt, um die grundlegende Vergleichbarkeit zu gewährleisten. An den Stichprobenpunkten erfassen speziell geschulte Forstleute über 150 Merkmale: Baumarten und Baumhöhe, Durchmesser der ausgewählten Probebäume sowie Art und Menge des Totholzes. Die Ergebnisse sind eine zentrale Informationsquelle für die Wald-, Klima- und Naturschutzpolitik von Bund und Ländern.
Quelle
WWF
Stand:
08.10.2024
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung.Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
In der Aufnahme von Artenschutz in Franken®
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Auffällig ist, dass in Großprivatwäldern deutlich weniger Nadelholz als Laubholz genutzt wird als in öffentlichen Wäldern. Hier scheint der notwendige Waldumbau– ein erklärtes Ziel der Ampelkoalition – nicht ausreichend zu erfolgen. Jetzt rächt sich, dass der Umbau von Nadelholzmonokulturen in klimastabile Laubwälder nicht frühzeitig und konsequent angegangen wurde. Das Totholzvolumen liegt jetzt bei rund 29 m³ pro Hektar und hat damit erfreulich zugenommen. Dies ist aber vor allem auf abgestorbene Nadelholzforste zurückzuführen, die weniger zum Biodiversitätserhalt beitragen. Der Wert für den Großprivatwald ist mit 23 m³ pro Hektar im Vergleich zum Staatswald mit 36 m³ pro Hektar auffallend niedrig.
Ende September hatte das Oberverwaltungsgericht (OVG) Berlin-Brandenburg bestätigt, dass die Ziele des Klimaschutzgesetzes im Landnutzungssektor (LULUCF) mit den bisher geplanten Maßnahmen zu praktisch 100 Prozent verfehlt würden. Soll der Wald jedoch Partner im Klimaschutz bleiben und die 2030er Klimaschutzziele erreicht werden, geht das nur durch deutlich weniger Holznutzung und Aufbau des Holzvorrats. „Dazu muss der jährliche Holzeinschlag in den nächsten Jahren um rund ein Drittel verringert werden“, fordert Susanne Winter. „Alte Laubwälder dürfen gar nicht mehr oder nur sehr wenig und schonend genutzt werden, großflächige Rodungen sind auszuschließen. Zudem müssen wir die Moore schnell und umfassend wiedervernässen, die Förderung von Holzverbrennung in Kraftwerken abschaffen und eine funktionierende Kreislaufwirtschaft für Holz durchsetzen.“ Altholz sollte nicht verbrannt, sondern gleichwertig weitergenutzt werden. Außerdem sollte die Bundesregierung mit der Bundeswaldgesetzreform dringend die Möglichkeit nutzen, den Waldzustand und nicht nur die Waldfläche zu schützen.
„Angesichts dieser verheerenden Bilanz aus der Bundeswaldinventur zeigt sich mehr denn je, dass wir ein starkes Bundeswaldgesetz brauchen. Es liefert bundesweit gültige Vorgaben, die wir für den Klima- und Biodiversitätsschutz dringend benötigen. Jetzt liegt es an Bundesminister Özdemir, ob wir den Wald in Deutschland fit für den Klima- und Biodiversitätsschutz und unsere Zukunft machen können. Insbesondere muss es eine Obergrenze für genehmigungsfähige Kahlschläge geben und der Wald darf nicht durch eng beieinander liegende Rückegassen für die Holzfällung und -transport zerhäckselt werden. Hier muss dringend nachgebessert werden. Der über die EU-Biodiversitätsstrategie vereinbarte Schutz der Wälder mit 10 Prozent Stilllegung und 30 Prozent wirksamen Schutzgebieten muss endlich umgesetzt werden, um dem Wald sein Überleben zu erleichtern, “ so Winter.
Hintergrund:
Alle zehn Jahre wird der Wald in Deutschland inventarisiert. Das Thünen-Institut für Waldökosysteme ist vom BMEL mit der Bundesinventurleitung beauftragt und fasst die Ergebnisse zusammen. Für die Durchführung wurde ein Stichprobennetz in mindestens einem vier mal vier Kilometer Raster über das Land verteilt, um die grundlegende Vergleichbarkeit zu gewährleisten. An den Stichprobenpunkten erfassen speziell geschulte Forstleute über 150 Merkmale: Baumarten und Baumhöhe, Durchmesser der ausgewählten Probebäume sowie Art und Menge des Totholzes. Die Ergebnisse sind eine zentrale Informationsquelle für die Wald-, Klima- und Naturschutzpolitik von Bund und Ländern.
Quelle
WWF
Stand:
08.10.2024
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung.Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
In der Aufnahme von Artenschutz in Franken®
- Blick in den mehr und mehr an Charakter verlierenden bayerischen Steigerforst, der nach unserer Auffassung den Namen Steigerwald an zahllosen Standorten seit geraumer Zeit verloren hat. Es wäre endlich an der Zeit, so sind wir der Überzeugung ein Großschutzgebiet zu installieren, um dieser zunehmend ausgedünnten, kränkelten Struktur wieder das Leben einzuhauchen, welches es verdient hat. Denn ein lebendiger Wald ist weit mehr als Wirtschaftsforste mit einem begleitenden "Schutzkonzeptchen". Hiervon sind wir felsenfest überzeugt!
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Artenschutz in Franken®
Der Rotfuchs (Vulpes vulpes)

Rotfuchs (Vulpes vulpes)
09/10.10.2024
Meine ökologische Rolle
Ich bin ein geschickter Jäger und Aasfresser, was bedeutet, dass ich ein breites Spektrum an Nahrung zu mir nehme. Diese Anpassungsfähigkeit macht mich zu einem wichtigen Teil der Nahrungskette. Durch meine Fähigkeit, sowohl kleine Säugetiere als auch Insekten, Vögel und Früchte zu fressen, trage ich zur Regulierung von Populationen vieler Tierarten bei.
09/10.10.2024
- Als Rotfuchs (Vulpes vulpes) möchte ich dir meine wichtige Rolle im Ökosystem näherbringen und erklären, weshalb ich für die Biodiversität so bedeutend bin.
Meine ökologische Rolle
Ich bin ein geschickter Jäger und Aasfresser, was bedeutet, dass ich ein breites Spektrum an Nahrung zu mir nehme. Diese Anpassungsfähigkeit macht mich zu einem wichtigen Teil der Nahrungskette. Durch meine Fähigkeit, sowohl kleine Säugetiere als auch Insekten, Vögel und Früchte zu fressen, trage ich zur Regulierung von Populationen vieler Tierarten bei.
- Regulation von Kleinsäugern: Einer meiner Hauptnahrungsquellen sind kleine Säugetiere wie Mäuse und Ratten. Wenn sich ihre Populationen unkontrolliert vermehren, könnten sie erhebliche Schäden in landwirtschaftlichen Flächen und Wäldern anrichten. Indem ich die Bestände dieser Tiere in Schach halte, trage ich zur Stabilität des Ökosystems bei und verhindere Schädlingsausbrüche.
- Aasfresser und "Gesundheitspolizei": Als Aasfresser helfe ich, tote Tiere aus der Umgebung zu entfernen. Auf diese Weise trage ich zur Sauberkeit der Umwelt bei und helfe, die Ausbreitung von Krankheiten zu verringern. Aas wäre sonst eine Brutstätte für Krankheitserreger und könnte die Gesundheit anderer Tiere gefährden.
- Samenverbreitung und Förderung der Pflanzenvielfalt: Neben Fleisch fresse ich auch gerne Früchte und Beeren. Wenn ich durch die Landschaft streife, trage ich die Samen dieser Pflanzen über weite Strecken in meinen Ausscheidungen mit. Das fördert die Ausbreitung von Pflanzen und trägt zur Vegetationsvielfalt in verschiedenen Gebieten bei.
- Rolle in der Nahrungskette: Obwohl ich ein erfolgreicher Jäger bin, stehe ich selbst nicht an der Spitze der Nahrungskette. Raubtiere wie Wölfe, Luchse und Greifvögel jagen mich gelegentlich. Ich bin somit auch eine Nahrungsquelle für größere Räuber und leiste meinen Beitrag zur Erhaltung des Gleichgewichts in der Nahrungspyramide.
Bedeutung für die Biodiversität
- Stabilisierung von Ökosystemen: Ich beeinflusse indirekt die Pflanzenwelt, indem ich die Population von Herbivoren (pflanzenfressenden Tieren) kontrolliere. Wenn ich beispielsweise die Mäusepopulation dezimiere, können Pflanzen besser wachsen und sich entwickeln, ohne durch übermäßigen Fraß geschädigt zu werden. Das wiederum fördert die Artenvielfalt in den Pflanzenbeständen und schafft Lebensräume für andere Organismen.
- Prädator der invasiven Arten: In vielen Regionen trage ich auch dazu bei, invasive Arten zu kontrollieren. Einige eingeschleppte Nagetiere oder kleine Raubtiere könnten das natürliche Gleichgewicht stören, aber durch mein Jagdverhalten verhindere ich, dass solche Arten dominieren und einheimische Arten verdrängen.
- Indikator für Ökosystemgesundheit: Meine Präsenz kann auch als Indikator für die Gesundheit des Ökosystems dienen. Wenn ich in einem Gebiet gut gedeihe, deutet das darauf hin, dass das Nahrungsangebot ausreichend ist und das Ökosystem relativ im Gleichgewicht steht.
- Wichtiger Bestandteil ländlicher und städtischer Ökosysteme: Meine Anpassungsfähigkeit macht mich nicht nur zu einem Bewohner wilder Landschaften, sondern auch von urbanen Gebieten. In Städten kontrolliere ich die Ratten- und Mäusepopulationen, was vor allem in dicht besiedelten Gebieten nützlich ist. Meine Rolle als „Schädlingsbekämpfer“ in städtischen Ökosystemen trägt ebenfalls zur Erhaltung der Biodiversität bei.
Zusammengefasst:
Ich, der Rotfuchs (Vulpes vulpes), bin ein unverzichtbarer Teil der Natur. Durch mein Verhalten als Jäger, Aasfresser und Samenverbreiter beeinflusse ich viele verschiedene Ebenen des Ökosystems positiv. Ich helfe, die Population von Kleinsäugern zu regulieren, was eine übermäßige Schädigung der Vegetation verhindert. Zudem sorge ich für Sauberkeit in der Natur, indem ich Aas beseitige, und fördere die Vielfalt von Pflanzenarten durch die Verbreitung ihrer Samen.
Meine Rolle ist nicht nur auf wildes Land beschränkt, sondern auch in städtischen Gebieten von großer Bedeutung. Durch meine Fähigkeit, mich an verschiedene Lebensräume anzupassen, trage ich zur Stabilität und Vielfalt der Natur bei – und damit zur Erhaltung einer gesunden, artenreichen Umwelt.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
- Junger Rotfuchs
Artenschutz in Franken®
Ökokonto - Artenschutz nur auf dem Papier?

Ökokonto - Artenschutz nur auf dem Papier?
08/09.10.2024
Wenn Bauvorhaben, Infrastrukturprojekte oder landwirtschaftliche Maßnahmen die Umwelt beeinträchtigen, verlangt das deutsche Naturschutzrecht, dass diese Eingriffe ausgeglichen werden müssen. Hier kommen die Ausgleichsflächen ins Spiel. Sie dienen der ökologischen Wiederherstellung, Verbesserung oder Schaffung von neuen Lebensräumen, um den durch menschliche Aktivitäten verursachten Verlust an natürlichen Ressourcen zu kompensieren.
Das Ökokonto-System ermöglicht es, vorgezogene Kompensationsmaßnahmen durchzuführen und diese auf einem "Konto" zu gutschreiben, bevor der eigentliche Eingriff stattfindet. Es erlaubt eine flexiblere und langfristig planbare Handhabung der Kompensationsverpflichtungen.
08/09.10.2024
- Ausgleichsflächen im Rahmen des Ökokontos in Bayern sind Flächen, die zur Kompensation von Eingriffen in die Natur und Landschaft geschaffen werden.
Wenn Bauvorhaben, Infrastrukturprojekte oder landwirtschaftliche Maßnahmen die Umwelt beeinträchtigen, verlangt das deutsche Naturschutzrecht, dass diese Eingriffe ausgeglichen werden müssen. Hier kommen die Ausgleichsflächen ins Spiel. Sie dienen der ökologischen Wiederherstellung, Verbesserung oder Schaffung von neuen Lebensräumen, um den durch menschliche Aktivitäten verursachten Verlust an natürlichen Ressourcen zu kompensieren.
Das Ökokonto-System ermöglicht es, vorgezogene Kompensationsmaßnahmen durchzuführen und diese auf einem "Konto" zu gutschreiben, bevor der eigentliche Eingriff stattfindet. Es erlaubt eine flexiblere und langfristig planbare Handhabung der Kompensationsverpflichtungen.
Fachlich wertvolle Aspekte des Ökokontos und Ausgleichsflächen in Bayern:
Fazit:
Das Ökokonto und die damit verbundenen Ausgleichsflächen in Bayern sind ein wichtiges Instrument im Naturschutz, um Eingriffe in die Landschaft auszugleichen. Sie fördern die Biodiversität, schaffen langfristig stabile Lebensräume und unterstützen den Klimaschutz. Gleichzeitig bieten sie eine flexible und planbare Lösung für Bauherren und Kommunen, die ihre Kompensationsverpflichtungen erfüllen müssen, während sie zur ökologischen Verbesserung der Landschaft beitragen.
In der Aufnahme 10/2024
- Vorsorge für Naturschutzmaßnahmen: Ein zentrales Ziel des Ökokontos ist es, Naturschutzmaßnahmen frühzeitig zu planen und durchzuführen, bevor schädliche Eingriffe in die Natur geschehen. Durch die frühzeitige Schaffung von Ausgleichsflächen kann eine langfristige ökologische Stabilität sichergestellt werden.
- Verbesserung von Biodiversität: Ausgleichsflächen werden oft als Biotope, Feuchtgebiete, Hecken oder artenreiche Wiesen angelegt, die speziell darauf ausgelegt sind, die biologische Vielfalt zu fördern. Diese Flächen bieten wichtigen Lebensraum für bedrohte Tier- und Pflanzenarten und unterstützen den Naturschutz in stark fragmentierten Landschaften.
- Langfristige Bindung der Flächen: In Bayern ist gesetzlich festgelegt, dass Ausgleichsflächen dauerhaft gesichert werden müssen, sodass der ökologische Nutzen nicht nur kurzfristig besteht, sondern langfristig erhalten bleibt. Dies geschieht oft durch vertragliche Bindungen oder durch die Überführung der Flächen in Naturschutzprogramme.
- Ersatz für Eingriffe in Schutzgebiete: Ausgleichsflächen können eine wichtige Rolle spielen, wenn in Schutzgebieten Bauvorhaben oder landwirtschaftliche Umstellungen stattfinden. Um den Verlust an ökologischer Funktionalität in diesen sensiblen Bereichen auszugleichen, werden hochwertige Flächen als Ersatz geschaffen.
- Ökologischer Mehrwert durch Strukturvielfalt: Die Maßnahmen zur Gestaltung der Ausgleichsflächen zielen häufig darauf ab, eine hohe Strukturvielfalt zu schaffen, beispielsweise durch die Schaffung von Kleingewässern, Hecken oder Trockenrasen. Diese Vielfalt an Lebensräumen erhöht die ökologische Resilienz der Landschaft und hilft, verschiedene Arten anzulocken und zu erhalten.
- Funktion im Klimaschutz: Neben dem Artenschutz spielen Ausgleichsflächen auch eine Rolle im Klimaschutz. Sie können CO₂ binden, indem sie Humus aufbauen oder Aufforstungen anregen. Besonders Feuchtgebiete oder artenreiche Wiesen können zur Kohlenstoffspeicherung beitragen.
- Kombination mit Landwirtschaft: In Bayern werden oft Flächen von Landwirten für das Ökokonto genutzt. Diese können in einer angepassten Form bewirtschaftet werden, beispielsweise durch extensive Weidewirtschaft oder ökologischen Landbau, was eine nachhaltige Nutzung mit den Zielen des Naturschutzes verbindet.
- Kooperation zwischen verschiedenen Akteuren: Das Ökokonto-System bringt verschiedene Akteure zusammen, darunter Kommunen, Bauherren, Landwirte und Naturschutzorganisationen. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es, die Ausgleichsmaßnahmen möglichst effizient und im Sinne eines ganzheitlichen Naturschutzes zu gestalten.
Fazit:
Das Ökokonto und die damit verbundenen Ausgleichsflächen in Bayern sind ein wichtiges Instrument im Naturschutz, um Eingriffe in die Landschaft auszugleichen. Sie fördern die Biodiversität, schaffen langfristig stabile Lebensräume und unterstützen den Klimaschutz. Gleichzeitig bieten sie eine flexible und planbare Lösung für Bauherren und Kommunen, die ihre Kompensationsverpflichtungen erfüllen müssen, während sie zur ökologischen Verbesserung der Landschaft beitragen.
In der Aufnahme 10/2024
- eine als Fläche des Ökokontos ausgezeichnete Fläche ... hier hat die Artenvielfalt wohl wenig Chancen ...
Artenschutz in Franken®
Der Rothirsch (Cervus elaphus)

Rothirsch (Cervus elaphus)
07/08.10.2024
Der Rothirsch (Cervus elaphus) ist ein majestätisches Wildtier, das natürlicherweise in Wäldern und offenen Landschaften Europas vorkommt. In Deutschland sind wir vor allem in bewaldeten Regionen anzutreffen, wo wir von einer Vielzahl an Faktoren beeinflusst werden, die unsere Population bedrohen.
07/08.10.2024
- Als Rothirsch möchte ich dir gerne aus meiner Sicht berichten und fachlich fundiert auf die akute Gefährdung unserer Art in Deutschland eingehen.
Der Rothirsch (Cervus elaphus) ist ein majestätisches Wildtier, das natürlicherweise in Wäldern und offenen Landschaften Europas vorkommt. In Deutschland sind wir vor allem in bewaldeten Regionen anzutreffen, wo wir von einer Vielzahl an Faktoren beeinflusst werden, die unsere Population bedrohen.
Akute Gefährdung in Deutschland:
Maßnahmen zur Verbesserung der Situation:
Die Zukunft des Rothirsches in Deutschland hängt stark davon ab, wie wir diese Herausforderungen angehen. Durch eine ganzheitliche und kooperative Herangehensweise können wir dazu beitragen, unsere Populationen zu schützen und langfristig zu sichern.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
- Lebensraumverlust und Fragmentierung: Durch den zunehmenden Ausbau von Siedlungen, Verkehrswegen und landwirtschaftlichen Flächen schrumpfen unsere natürlichen Lebensräume. Dies führt zu einer Fragmentierung unserer Populationen, was die genetische Vielfalt verringert und die Wanderungsmöglichkeiten einschränkt.
- Jagd und Wilderei: Obwohl die Jagd auf Rothirsche in Deutschland reguliert ist, gibt es immer wieder Fälle von Wilderei, die unsere Populationen zusätzlich belasten können, besonders wenn illegale Abschüsse stattfinden.
- Klimawandel: Der Klimawandel wirkt sich ebenfalls auf uns aus, indem er unsere Lebensräume verändert und zu unvorhersehbaren Wetterereignissen führt, die unsere Nahrungssuche und das Fortpflanzungsverhalten beeinträchtigen können.
- Konkurrenz um Ressourcen: Die Zunahme anderer Arten wie Rehe und Wildschweine kann zu einer verstärkten Konkurrenz um Nahrung und Lebensraum führen, was unsere Überlebenschancen verringert.
- Störungen und Infrastruktur: Menschliche Störungen, wie z.B. durch Freizeitaktivitäten oder den Bau von Infrastrukturen wie Windparks oder Straßen, können unsere Ruhephasen stören und zu Stress führen.
Maßnahmen zur Verbesserung der Situation:
- Schutz und Erhalt von Lebensräumen: Es ist entscheidend, unsere natürlichen Lebensräume zu schützen und zu erweitern, um die Fragmentierung zu reduzieren und Wanderungskorridore zu sichern.
- Strengere Regulierung der Jagd: Eine sorgfältige Regulierung der Jagd, um Überpopulationen zu vermeiden und illegale Jagdaktivitäten zu bekämpfen, ist essentiell.
- Anpassung an den Klimawandel: Strategien zur Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels, wie z.B. die Schaffung von klimaresilienten Lebensräumen, sind notwendig.
- Monitoring und Forschung: Kontinuierliches Monitoring unserer Populationen und Forschung zur genetischen Vielfalt und Verhaltensökologie sind wichtig, um fundierte Managemententscheidungen zu treffen.
- Bewusstseinsbildung und Zusammenarbeit: Die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Bedeutung des Rothirsches und die Zusammenarbeit mit lokalen Gemeinschaften, Landwirten und Naturschutzorganisationen sind entscheidend für langfristige Schutzmaßnahmen.
Die Zukunft des Rothirsches in Deutschland hängt stark davon ab, wie wir diese Herausforderungen angehen. Durch eine ganzheitliche und kooperative Herangehensweise können wir dazu beitragen, unsere Populationen zu schützen und langfristig zu sichern.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
- Rothirschmännchen in der Ruffolge
Artenschutz in Franken®
Stele der Biodiversität® - Burgwindheim / Kötsch

Stele der Biodiversität® - Burgwindheim / Kötsch
06/07.10.2024
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das vom Markt Burgwindheim, dem Bayernwerk der Deutschen Postcode Lotterie und der Steuerkanzlei Bauerfeind unterstützt wird.
Kötsch / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen.
Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
06/07.10.2024
- Grafik - abgeschlossen!
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das vom Markt Burgwindheim, dem Bayernwerk der Deutschen Postcode Lotterie und der Steuerkanzlei Bauerfeind unterstützt wird.
Kötsch / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen.
Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
Denn wenn (selbst in noch geeigneten Nahrungsstrukturen) keine geeigneten Reproduktionsräume vorhanden sind, ist die Erhaltung der Artenvielfalt gelichfalls zum Scheitern verurteilt.
Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das vom Markt Burgwindheim, dem Bayernwerk der Deutschen Postcode Lotterie und der Steuerkanzlei Bauerfeind unterstützt wird, setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.
In der Aufnahme
Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das vom Markt Burgwindheim, dem Bayernwerk der Deutschen Postcode Lotterie und der Steuerkanzlei Bauerfeind unterstützt wird, setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.
In der Aufnahme
- Ausgerüstet ... am 01.10.2024
Artenschutz in Franken®
Die Baumsichelwanze (Himacerus apterus)

Baumsichelwanze (Himacerus apterus)
05/06.10.2024
Lass mich dir etwas über mein Leben und meine Fähigkeiten erzählen.
05/06.10.2024
- Hallo, ich bin die Baumsichelwanze, auch bekannt als Himacerus apterus, und ich möchte dir gerne meine Welt aus meiner Perspektive erklären.
Lass mich dir etwas über mein Leben und meine Fähigkeiten erzählen.
Wer bin ich?
Ich gehöre zur Familie der Sichelwanzen (Nabidae) und werde oft wegen meiner sichelförmigen Vorderbeine erkannt. Diese speziellen Beine sind mein wichtigstes Werkzeug, das ich nutze, um meine Beute zu fangen – kleine Insekten, Spinnen und manchmal auch Blattläuse. Wie meine Verwandten habe ich einen stechend-saugenden Rüssel, mit dem ich meine Beute durchbohre und ihre Körpersäfte aufsauge.
Mein Lebensraum
Ich lebe meistens auf Bäumen, Sträuchern oder niedriger Vegetation. Besonders wohl fühle ich mich in Wäldern und an Waldrändern, wo es viele Möglichkeiten gibt, Beute zu machen und mich vor Fressfeinden zu verstecken. Du findest mich oft in Laubwäldern, aber ich bin nicht wählerisch, solange es genügend Insekten gibt, die ich fangen kann.
Meine Verteidigung
Obwohl ich nicht groß bin – nur etwa 7 bis 9 Millimeter lang – habe ich ein paar Tricks, um mich zu schützen. Wenn ich in Gefahr bin, kann ich mich sehr schnell bewegen oder sogar tot stellen, damit Fressfeinde das Interesse an mir verlieren. Meine bräunliche Färbung sorgt dafür, dass ich gut getarnt bin und auf Baumrinde oder Laub nur schwer zu erkennen bin.
Mein Körperbau
Wie der lateinische Name Himacerus apterus andeutet, habe ich keine voll entwickelten Flügel (das bedeutet "apterus" = "flügellos"). Trotzdem kann ich mich dank meiner kräftigen Beine und meiner schnellen Reflexe blitzschnell bewegen. Meine Fühler sind lang und helfen mir dabei, meine Umgebung zu erkunden und Beute zu erschnuppern. Meine Augen sind ebenfalls ziemlich gut entwickelt, sodass ich Bewegungen in meiner Nähe schnell wahrnehmen kann.
Meine Nahrung
Als Raubwanze bin ich ein Jäger. Meine Ernährung besteht hauptsächlich aus kleinen Insekten. Mein Jagdverhalten ist einfach: Ich nutze meine gut entwickelten Sichelbeine, um Beute zu packen und dann mit meinem Stechrüssel in ihren Körper einzudringen. Der Rüssel spritzt Verdauungssäfte in die Beute, um ihre inneren Organe zu verflüssigen, die ich dann aufsauge. So muss ich nichts kauen, sondern sauge die Nährstoffe einfach direkt auf.
Fortpflanzung und Entwicklung
Nach der Paarung lege ich meine Eier in Ritzen von Rinden oder in andere schützende Orte. Die Jungtiere, die Nymphen genannt werden, sehen mir schon sehr ähnlich, nur dass sie kleiner und noch nicht vollständig entwickelt sind. Sie häuten sich mehrmals, bevor sie ausgewachsen sind und selbst auf Jagd gehen können. Eine vollständige Metamorphose durchlaufe ich also nicht, ich entwickle mich durch verschiedene Stadien der unvollständigen Metamorphose (Hemimetabolie), was bedeutet, dass ich als Nymphe schon wie ein Miniaturerwachsener aussehe.
Beziehungen zu anderen
Ich bin zwar ein gefürchteter Jäger unter den kleinen Insekten, habe aber auch meine eigenen Feinde. Vögel, Spinnen oder andere größere Raubwanzen können mich angreifen. Auch der Mensch trägt indirekt zu meinem Überleben bei, denn durch den Rückgang der natürlichen Wälder und die landwirtschaftliche Nutzung sinkt die Zahl meiner natürlichen Feinde, was mir mehr Freiheit gibt, mich auszubreiten.
Fazit
Als Baumsichelwanze führe ich ein einfaches, aber strategisches Leben. Ich bin ein kleiner, effektiver Jäger mit spezifischen Anpassungen, die mir erlauben, in meiner Umgebung erfolgreich zu überleben. Jeder Tag ist eine neue Herausforderung, ob beim Beutejagen oder beim Verstecken vor meinen Feinden – aber genau das macht mein Dasein so spannend!
Aufnahme von Bernhard Schmalisch
Ich gehöre zur Familie der Sichelwanzen (Nabidae) und werde oft wegen meiner sichelförmigen Vorderbeine erkannt. Diese speziellen Beine sind mein wichtigstes Werkzeug, das ich nutze, um meine Beute zu fangen – kleine Insekten, Spinnen und manchmal auch Blattläuse. Wie meine Verwandten habe ich einen stechend-saugenden Rüssel, mit dem ich meine Beute durchbohre und ihre Körpersäfte aufsauge.
Mein Lebensraum
Ich lebe meistens auf Bäumen, Sträuchern oder niedriger Vegetation. Besonders wohl fühle ich mich in Wäldern und an Waldrändern, wo es viele Möglichkeiten gibt, Beute zu machen und mich vor Fressfeinden zu verstecken. Du findest mich oft in Laubwäldern, aber ich bin nicht wählerisch, solange es genügend Insekten gibt, die ich fangen kann.
Meine Verteidigung
Obwohl ich nicht groß bin – nur etwa 7 bis 9 Millimeter lang – habe ich ein paar Tricks, um mich zu schützen. Wenn ich in Gefahr bin, kann ich mich sehr schnell bewegen oder sogar tot stellen, damit Fressfeinde das Interesse an mir verlieren. Meine bräunliche Färbung sorgt dafür, dass ich gut getarnt bin und auf Baumrinde oder Laub nur schwer zu erkennen bin.
Mein Körperbau
Wie der lateinische Name Himacerus apterus andeutet, habe ich keine voll entwickelten Flügel (das bedeutet "apterus" = "flügellos"). Trotzdem kann ich mich dank meiner kräftigen Beine und meiner schnellen Reflexe blitzschnell bewegen. Meine Fühler sind lang und helfen mir dabei, meine Umgebung zu erkunden und Beute zu erschnuppern. Meine Augen sind ebenfalls ziemlich gut entwickelt, sodass ich Bewegungen in meiner Nähe schnell wahrnehmen kann.
Meine Nahrung
Als Raubwanze bin ich ein Jäger. Meine Ernährung besteht hauptsächlich aus kleinen Insekten. Mein Jagdverhalten ist einfach: Ich nutze meine gut entwickelten Sichelbeine, um Beute zu packen und dann mit meinem Stechrüssel in ihren Körper einzudringen. Der Rüssel spritzt Verdauungssäfte in die Beute, um ihre inneren Organe zu verflüssigen, die ich dann aufsauge. So muss ich nichts kauen, sondern sauge die Nährstoffe einfach direkt auf.
Fortpflanzung und Entwicklung
Nach der Paarung lege ich meine Eier in Ritzen von Rinden oder in andere schützende Orte. Die Jungtiere, die Nymphen genannt werden, sehen mir schon sehr ähnlich, nur dass sie kleiner und noch nicht vollständig entwickelt sind. Sie häuten sich mehrmals, bevor sie ausgewachsen sind und selbst auf Jagd gehen können. Eine vollständige Metamorphose durchlaufe ich also nicht, ich entwickle mich durch verschiedene Stadien der unvollständigen Metamorphose (Hemimetabolie), was bedeutet, dass ich als Nymphe schon wie ein Miniaturerwachsener aussehe.
Beziehungen zu anderen
Ich bin zwar ein gefürchteter Jäger unter den kleinen Insekten, habe aber auch meine eigenen Feinde. Vögel, Spinnen oder andere größere Raubwanzen können mich angreifen. Auch der Mensch trägt indirekt zu meinem Überleben bei, denn durch den Rückgang der natürlichen Wälder und die landwirtschaftliche Nutzung sinkt die Zahl meiner natürlichen Feinde, was mir mehr Freiheit gibt, mich auszubreiten.
Fazit
Als Baumsichelwanze führe ich ein einfaches, aber strategisches Leben. Ich bin ein kleiner, effektiver Jäger mit spezifischen Anpassungen, die mir erlauben, in meiner Umgebung erfolgreich zu überleben. Jeder Tag ist eine neue Herausforderung, ob beim Beutejagen oder beim Verstecken vor meinen Feinden – aber genau das macht mein Dasein so spannend!
Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- hier eine Baumsichelwanze, die eben ein Kleininsekt gefangen hat und
dieses mit dem Rostrum aussaugt.
Artenschutz in Franken®
Mehr Klimaschutz durch renaturierte Küstenmoore

Mehr Klimaschutz durch renaturierte Küstenmoore
04/05.10.2024
Berlin/Bonn. Bundesumweltministerin Steffi Lemke hat heute Küstenmoorflächen in Bresewitz am Rande der Vorpommerschen Boddenlandschaft besucht und den Förderscheck zum Start eines Moorklimaschutzprojektes überreicht.
04/05.10.2024
Berlin/Bonn. Bundesumweltministerin Steffi Lemke hat heute Küstenmoorflächen in Bresewitz am Rande der Vorpommerschen Boddenlandschaft besucht und den Förderscheck zum Start eines Moorklimaschutzprojektes überreicht.
Intakte Moore sind in der Lage, große Mengen an klimaschädlichem CO2 zu binden. Allerdings wurden in der Vergangenheit die Moorflächen in Deutschland fast vollständig entwässert. Da entwässerte Moorböden eine bedeutende Quelle von Treibhausgasemissionen darstellen, fördert das Bundesumweltministerium im Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz (ANK) verstärkt die Renaturierung und den Schutz von Mooren. Das im Bundesamt für Naturschutz (BfN) betreute Vorhaben „Moorklimaschutz an der Ostseeküste“ erhält für die Renaturierung von Küstenmooren an der Ostsee bis 2034 eine Förderung von rund 27 Millionen Euro. Ziel des Verbundprojektes der Ostseestiftung, der Universität Greifswald und des Leibniz-Institutes für Ostseeforschung Warnemünde ist es, rund 850 Hektar Küstenmoore zu renaturieren.
Bundesumweltministerin Steffi Lemke: „Intakte Moore sind echte Alleskönner. Sie sind natürliche Kohlenstoffspeicher und damit gut für das Klima, sie regulieren den Wasserhaushalt, und helfen damit bei Starkregen und Überflutungen genauso wie bei Hitze und Dürre. Mit dem Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz stärken wir unsere Ökosysteme und helfen gleichzeitig, das sich dramatisch verändernde Klima zu schützen. Moore stehen dabei besonders im Fokus. Mit zwei neuen Förderprogrammen im ANK fördern wir seit September ihre Wiedervernässung und Renaturierung. Das neue Modellvorhaben zum Moorklimaschutz an der Ostseeküste wird dabei vor allem für Küstenmoore Vorbild für hoffentlich zahlreiche weitere Projekte sein.“
BfN-Präsidentin Sabine Riewenherm: „Wälder und Auen, Böden und Moore, Meere und Gewässer, Grünflächen in der Stadt und auf dem Land können Kohlendioxid aus der Atmosphäre binden und langfristig speichern. Der Schutz dieser Flächen ist noch mehr als Klimaschutz: Intakte Ökosysteme sind auch Orte großer biologischer Vielfalt. Sie bieten Lebensraum für viele, teilweise seltene und hochspezialisierte Tiere und Pflanzen.“
Hintergrund
Die ursprünglich etwa 40.000 Hektar Küstenmoore an der Küste Mecklenburg-Vorpommerns sind heute überwiegend eingedeicht, entwässert und werden intensiv genutzt. Das hat zur Folge, dass diese ehemaligen Moorflächen große Mengen klimaschädlicher Gase freisetzen, statt sie zu binden.
Das Ziel der Verbundpartner ist es, zukünftig die klimaschädlichen Emissionen dieser Flächen um 15.000 bis 25.000 Tonnen CO2-Äquivalente pro Jahr zu vermindern. Neben der erwarteten Klimaschutzwirkung werden auf den restaurierten Moorflächen Daten zu wichtigen Ökosystemleistungen wie Moorwachstum, Hochwasserschutz, Nährstoffrückhalt, Grundwasserneubildung und Biodiversitätszuwachs erfasst. Diese neuen Erkenntnisse erlauben erstmals eine gezieltere Herangehensweise an die Restauration von Küstenmooren mit berechenbaren Auswirkungen für den Klima- und Naturschutz.
Die Maßnahmen konzentrieren sich auf zwölf Küstenmoor-Abschnitte entlang der Küste Mecklenburg-Vorpommerns zwischen Rostock und der polnischen Ostseeküste. In den ersten Jahren werden die Restaurationsplanungen für alle Vorhabengebiete abgeschlossen. Wichtig dafür sind möglichst einvernehmliche Lösungen zwischen allen Beteiligten, die die Interessen der Gemeinden, Eigentümer*innen und Landwirt*innen ausgewogen berücksichtigen. Im Fokus stehen zudem Deichbaumaßnahmen zur Rückverlegung von Deichen, die auch dem Hochwasserschutz zugutekommen.
Das Projekt erhält zusätzliche Förderung durch das Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern.
Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz
Mit dem Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz (ANK) will die Bundesregierung entscheidend dazu beitragen, den allgemeinen Zustand der Ökosysteme in Deutschland deutlich zu verbessern und so ihre Resilienz und ihre Klimaschutzleistung zu stärken. Neben Treibhausgasminderung und Negativemissionen wird auch ein Beitrag zur Klimaanpassung erreicht. Die Natur an Land und im Meer soll besser geschützt und widerstandsfähiger werden, um dauerhaft zu den nationalen Klimaschutzzielen beizutragen. Die Land- und Forstwirtschaft soll nachhaltig werden und mehr Raum lassen für eine vielfältige Tier- und Pflanzenwelt auf den bewirtschafteten Flächen. Das Vorhaben „Moorklimaschutz an der Ostseeküste“ ist eines der Projekte, die das Bundesumweltministerium und das Bundesamt für Naturschutz im Rahmen des ANK fördern.
Quelle
Bundesamt für Naturschutz
Referat Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Social Media
Konstantinstraße 110
53179 Bonn
Stand
04.10.2024
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung.Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
In der Aufnahme von Helga Zinnecker
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Bundesumweltministerin Steffi Lemke: „Intakte Moore sind echte Alleskönner. Sie sind natürliche Kohlenstoffspeicher und damit gut für das Klima, sie regulieren den Wasserhaushalt, und helfen damit bei Starkregen und Überflutungen genauso wie bei Hitze und Dürre. Mit dem Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz stärken wir unsere Ökosysteme und helfen gleichzeitig, das sich dramatisch verändernde Klima zu schützen. Moore stehen dabei besonders im Fokus. Mit zwei neuen Förderprogrammen im ANK fördern wir seit September ihre Wiedervernässung und Renaturierung. Das neue Modellvorhaben zum Moorklimaschutz an der Ostseeküste wird dabei vor allem für Küstenmoore Vorbild für hoffentlich zahlreiche weitere Projekte sein.“
BfN-Präsidentin Sabine Riewenherm: „Wälder und Auen, Böden und Moore, Meere und Gewässer, Grünflächen in der Stadt und auf dem Land können Kohlendioxid aus der Atmosphäre binden und langfristig speichern. Der Schutz dieser Flächen ist noch mehr als Klimaschutz: Intakte Ökosysteme sind auch Orte großer biologischer Vielfalt. Sie bieten Lebensraum für viele, teilweise seltene und hochspezialisierte Tiere und Pflanzen.“
Hintergrund
Die ursprünglich etwa 40.000 Hektar Küstenmoore an der Küste Mecklenburg-Vorpommerns sind heute überwiegend eingedeicht, entwässert und werden intensiv genutzt. Das hat zur Folge, dass diese ehemaligen Moorflächen große Mengen klimaschädlicher Gase freisetzen, statt sie zu binden.
Das Ziel der Verbundpartner ist es, zukünftig die klimaschädlichen Emissionen dieser Flächen um 15.000 bis 25.000 Tonnen CO2-Äquivalente pro Jahr zu vermindern. Neben der erwarteten Klimaschutzwirkung werden auf den restaurierten Moorflächen Daten zu wichtigen Ökosystemleistungen wie Moorwachstum, Hochwasserschutz, Nährstoffrückhalt, Grundwasserneubildung und Biodiversitätszuwachs erfasst. Diese neuen Erkenntnisse erlauben erstmals eine gezieltere Herangehensweise an die Restauration von Küstenmooren mit berechenbaren Auswirkungen für den Klima- und Naturschutz.
Die Maßnahmen konzentrieren sich auf zwölf Küstenmoor-Abschnitte entlang der Küste Mecklenburg-Vorpommerns zwischen Rostock und der polnischen Ostseeküste. In den ersten Jahren werden die Restaurationsplanungen für alle Vorhabengebiete abgeschlossen. Wichtig dafür sind möglichst einvernehmliche Lösungen zwischen allen Beteiligten, die die Interessen der Gemeinden, Eigentümer*innen und Landwirt*innen ausgewogen berücksichtigen. Im Fokus stehen zudem Deichbaumaßnahmen zur Rückverlegung von Deichen, die auch dem Hochwasserschutz zugutekommen.
Das Projekt erhält zusätzliche Förderung durch das Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern.
Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz
Mit dem Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz (ANK) will die Bundesregierung entscheidend dazu beitragen, den allgemeinen Zustand der Ökosysteme in Deutschland deutlich zu verbessern und so ihre Resilienz und ihre Klimaschutzleistung zu stärken. Neben Treibhausgasminderung und Negativemissionen wird auch ein Beitrag zur Klimaanpassung erreicht. Die Natur an Land und im Meer soll besser geschützt und widerstandsfähiger werden, um dauerhaft zu den nationalen Klimaschutzzielen beizutragen. Die Land- und Forstwirtschaft soll nachhaltig werden und mehr Raum lassen für eine vielfältige Tier- und Pflanzenwelt auf den bewirtschafteten Flächen. Das Vorhaben „Moorklimaschutz an der Ostseeküste“ ist eines der Projekte, die das Bundesumweltministerium und das Bundesamt für Naturschutz im Rahmen des ANK fördern.
Quelle
Bundesamt für Naturschutz
Referat Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Social Media
Konstantinstraße 110
53179 Bonn
Stand
04.10.2024
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung.Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
In der Aufnahme von Helga Zinnecker
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Artenschutz in Franken®
Heller Girn (Ceraleptus lividus)

Der Helle Girn (Ceraleptus lividus)
04/05.10.2024
Mit meinem speziellen Aussehen und meiner ökologischen Rolle trage ich zu einem subtilen, aber wichtigen Gleichgewicht in den Lebensräumen bei, die ich durchstreife.
04/05.10.2024
- Ich, der Helle Girn (Ceraleptus lividus), bin ein kleines, aber durchaus bemerkenswertes Mitglied der Familie der Randwanzen (Coreidae), das in weiten Teilen Europas vorkommt.
Mit meinem speziellen Aussehen und meiner ökologischen Rolle trage ich zu einem subtilen, aber wichtigen Gleichgewicht in den Lebensräumen bei, die ich durchstreife.
Aussehen und Erkennungsmerkmale
Mit einer Körperlänge von 10 bis 11 Millimetern bin ich eher unauffällig. Mein Körper ist schlank und langgezogen, und meine Färbung reicht von hellbräunlich bis gelblich, oft mit dunkleren Zeichnungen. Diese Tarnfarbe hilft mir dabei, mich unbemerkt in meinem Lebensraum zu bewegen. Meine langen Fühler, die meist viergliedrig sind, geben mir wichtige Informationen über meine Umgebung. Eines meiner auffälligeren Merkmale sind meine schmalen, membranartigen Flügel, die es mir ermöglichen, mich bei Bedarf auf die Suche nach neuen Nahrungsquellen oder Paarungspartnern zu begeben.
Lebensweise und Verhalten
Ich bin ein Bewohner trockener, offener Lebensräume wie trockenen Wiesen, Waldrändern und steinigen Flächen, wobei ich die Sonne bevorzuge. Die meiste Zeit verbringe ich am Boden, wo ich nach Nahrung suche. Anders als viele meiner Verwandten ernähre ich mich vorwiegend von Samen. Dabei nutze ich meinen spezialisierten Rüssel, um die Schale der Samen zu durchbohren und deren nährstoffreiche Inhalte herauszusaugen. Dies ist eine effiziente Methode, um auch in trockenen, kargen Gebieten zu überleben, in denen frische Beute schwer zu finden wäre.
Obwohl ich auf Samen spezialisiert bin, bin ich nicht wählerisch und nehme auch absterbende Pflanzenteile oder gelegentlich tote Insekten zu mir. Diese Flexibilität in meiner Ernährung hat mich zu einem wahren Überlebenskünstler gemacht, der sich an verschiedene Lebensräume anpassen kann.
Fortpflanzung und Entwicklung
Wenn es Zeit für die Fortpflanzung ist, lege ich meine Eier an geschützten Stellen auf Pflanzen oder in der Nähe des Bodens ab. Die Entwicklung meiner Nachkommen erfolgt in mehreren Nymphenstadien. Die Jungtiere, die nach dem Schlüpfen entstehen, sehen mir bereits ähnlich, allerdings sind sie noch flügellos. Durch mehrere Häutungen erreichen sie schließlich das Erwachsenenstadium. Diese Metamorphose ist temperaturabhängig und hängt stark von den äußeren Bedingungen ab.
Ökologische Bedeutung
Meine Rolle im Ökosystem mag zunächst unbedeutend erscheinen, aber ich spiele eine wichtige Rolle im Kreislauf der Nährstoffe. Durch das Fressen von Samen und totem Pflanzenmaterial sorge ich dafür, dass diese Nährstoffe wieder in den Boden zurückgeführt werden, wo sie für andere Pflanzen und Lebewesen verfügbar sind. Gleichzeitig diene ich selbst als Nahrungsquelle für verschiedene Vögel und kleinere Raubtiere, die auf Insekten angewiesen sind.
Manchmal werde ich auch in die Gärten und Felder der Menschen verschleppt, wo ich dann als kleiner Störenfried wahrgenommen werde, weil ich die Samen von Nutzpflanzen fresse. Dennoch habe ich im großen Bild der Natur meinen Platz, und mein Wirken trägt dazu bei, die Vielfalt der Pflanzenwelt zu erhalten und den Boden zu bereichern.
Anpassungsfähigkeit
Ein weiterer interessanter Aspekt meines Lebens ist meine Fähigkeit, trockene und karge Umgebungen zu überleben. In meiner Heimat kann es lange Trockenperioden geben, doch ich bin in der Lage, diese Zeiten zu überstehen, indem ich mich an die Ressourcen anpasse, die mir zur Verfügung stehen. Diese Fähigkeit zeigt sich nicht nur in meiner Wahl der Nahrung, sondern auch in meiner Fähigkeit, in verschiedenen klimatischen Bedingungen zu überleben.
Schlusswort
Ich, der Helle Girn, mag auf den ersten Blick unauffällig sein, doch ich erfülle eine bedeutende Rolle im Gleichgewicht der Natur. Mit meiner spezialisierten Ernährungsweise und meiner Anpassungsfähigkeit trage ich zur Stabilität der Lebensräume bei, die ich bewohne. Indem ich Samen fresse und den Nährstoffkreislauf unterstütze, schaffe ich indirekt Lebensraum für viele andere Arten. So trage auch ich meinen Teil dazu bei, die Welt, die ich bewohne, in ihrer Vielfalt zu erhalten und zu fördern.
Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- Der Helle Girn (Ceraleptus lividus)
Artenschutz in Franken®
Rotbraune Sichelwanze (Nabis rugosus)

Rotbraune Sichelwanze (Nabis rugosus)
03/04.10.2024
Sie gehört zu den räuberischen Wanzen und erfüllt in ihrem Ökosystem eine wichtige Rolle als natürlicher Schädlingsbekämpfer.
03/04.10.2024
- Die Rotbraune Sichelwanze (Nabis rugosus) ist ein faszinierendes Insekt aus der Familie der Sichelwanzen (Nabidae), das in ganz Europa verbreitet ist.
Sie gehört zu den räuberischen Wanzen und erfüllt in ihrem Ökosystem eine wichtige Rolle als natürlicher Schädlingsbekämpfer.
Aussehen und Bestimmung
Die Rotbraune Sichelwanze ist leicht an ihrem schmalen, länglichen Körperbau und ihrer charakteristischen Färbung zu erkennen. Der Körper ist meist rötlich-braun bis gelblich gefärbt, was eine gute Tarnung in ihrem natürlichen Lebensraum ermöglicht. Sie erreicht eine Länge von etwa 6–8 mm, und ein weiteres auffälliges Merkmal ist der sichelförmige Rüssel, von dem auch ihr Name abgeleitet ist. Dieser Rüssel dient ihr als zentrales Jagdwerkzeug.
Ihre Flügel sind meist voll ausgebildet, wodurch sie flugfähig ist. Sie zeigt jedoch oft eine Variabilität in der Ausbildung der Flügel (sogenannte Flügelpolymorphie), was bedeutet, dass es auch kurzflügelige Formen gibt, die flugunfähig sind.
Lebensraum und Verhalten
Nabis rugosus ist in einer Vielzahl von Lebensräumen zu finden, bevorzugt jedoch offene, sonnige Bereiche wie Wiesen, Felder und Hecken. Auch in Gärten ist sie keine Seltenheit. Durch ihre Anpassungsfähigkeit kann sie sowohl in natürlichen als auch in anthropogen geprägten Landschaften überleben.
Die Rotbraune Sichelwanze ist eine aktive Räuberin, die sich von kleinen Insekten, wie Blattläusen, Raupen oder Fliegenlarven, ernährt. Mit ihrem kräftigen, sichelartigen Stechrüssel durchbohrt sie die Körper ihrer Beutetiere, injiziert Verdauungsenzyme und saugt dann die verflüssigten Innereien des Opfers auf. Dieser räuberische Lebensstil macht sie zu einem nützlichen Verbündeten in der biologischen Schädlingsbekämpfung, da sie zur Kontrolle von Schadinsekten beiträgt.
Fortpflanzung und Entwicklung
Die Fortpflanzung der Rotbraunen Sichelwanze erfolgt durch Eiablage auf Pflanzenteilen, meist in Bodennähe. Nach einer kurzen Entwicklungszeit schlüpfen die Nymphen, die den erwachsenen Tieren bereits ähnlich sehen, aber noch keine voll ausgebildeten Flügel besitzen. Diese Jungtiere durchlaufen mehrere Häutungen, bevor sie die Adultform erreichen. Der Entwicklungszyklus hängt stark von den Umweltbedingungen ab, vor allem von der Temperatur.
Ökologische Bedeutung
Als Raubwanze trägt Nabis rugosus erheblich zur Kontrolle von Insektenpopulationen bei. Sie spielt eine wichtige Rolle in der Regulierung von Schädlingen und hilft, das Gleichgewicht in verschiedenen Ökosystemen aufrechtzuerhalten. Da sie ohne Unterschied sowohl auf nützliche als auch auf schädliche Insekten jagt, könnte sie in rein landwirtschaftlichen Systemen aber auch als doppelschneidiges Schwert betrachtet werden.
Schlussfolgerung
Die Rotbraune Sichelwanze ist ein kleines, aber beeindruckendes Beispiel für die Komplexität natürlicher Räuber-Beute-Beziehungen. Durch ihren räuberischen Lebensstil trägt sie zur Schädlingsbekämpfung bei, stellt aber gleichzeitig sicher, dass das ökologische Gleichgewicht erhalten bleibt. Ihre Anpassungsfähigkeit und ihre Fähigkeit, eine Vielzahl von Insekten zu jagen, machen sie zu einem wertvollen Bestandteil vieler Lebensräume.
Zusammengefasst zeigt Nabis rugosus, wie auch kleine und unscheinbare Organismen eine bedeutende Rolle in der Natur spielen können, indem sie zur Artenvielfalt und Stabilität von Ökosystemen beitragen.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
Die Rotbraune Sichelwanze ist leicht an ihrem schmalen, länglichen Körperbau und ihrer charakteristischen Färbung zu erkennen. Der Körper ist meist rötlich-braun bis gelblich gefärbt, was eine gute Tarnung in ihrem natürlichen Lebensraum ermöglicht. Sie erreicht eine Länge von etwa 6–8 mm, und ein weiteres auffälliges Merkmal ist der sichelförmige Rüssel, von dem auch ihr Name abgeleitet ist. Dieser Rüssel dient ihr als zentrales Jagdwerkzeug.
Ihre Flügel sind meist voll ausgebildet, wodurch sie flugfähig ist. Sie zeigt jedoch oft eine Variabilität in der Ausbildung der Flügel (sogenannte Flügelpolymorphie), was bedeutet, dass es auch kurzflügelige Formen gibt, die flugunfähig sind.
Lebensraum und Verhalten
Nabis rugosus ist in einer Vielzahl von Lebensräumen zu finden, bevorzugt jedoch offene, sonnige Bereiche wie Wiesen, Felder und Hecken. Auch in Gärten ist sie keine Seltenheit. Durch ihre Anpassungsfähigkeit kann sie sowohl in natürlichen als auch in anthropogen geprägten Landschaften überleben.
Die Rotbraune Sichelwanze ist eine aktive Räuberin, die sich von kleinen Insekten, wie Blattläusen, Raupen oder Fliegenlarven, ernährt. Mit ihrem kräftigen, sichelartigen Stechrüssel durchbohrt sie die Körper ihrer Beutetiere, injiziert Verdauungsenzyme und saugt dann die verflüssigten Innereien des Opfers auf. Dieser räuberische Lebensstil macht sie zu einem nützlichen Verbündeten in der biologischen Schädlingsbekämpfung, da sie zur Kontrolle von Schadinsekten beiträgt.
Fortpflanzung und Entwicklung
Die Fortpflanzung der Rotbraunen Sichelwanze erfolgt durch Eiablage auf Pflanzenteilen, meist in Bodennähe. Nach einer kurzen Entwicklungszeit schlüpfen die Nymphen, die den erwachsenen Tieren bereits ähnlich sehen, aber noch keine voll ausgebildeten Flügel besitzen. Diese Jungtiere durchlaufen mehrere Häutungen, bevor sie die Adultform erreichen. Der Entwicklungszyklus hängt stark von den Umweltbedingungen ab, vor allem von der Temperatur.
Ökologische Bedeutung
Als Raubwanze trägt Nabis rugosus erheblich zur Kontrolle von Insektenpopulationen bei. Sie spielt eine wichtige Rolle in der Regulierung von Schädlingen und hilft, das Gleichgewicht in verschiedenen Ökosystemen aufrechtzuerhalten. Da sie ohne Unterschied sowohl auf nützliche als auch auf schädliche Insekten jagt, könnte sie in rein landwirtschaftlichen Systemen aber auch als doppelschneidiges Schwert betrachtet werden.
Schlussfolgerung
Die Rotbraune Sichelwanze ist ein kleines, aber beeindruckendes Beispiel für die Komplexität natürlicher Räuber-Beute-Beziehungen. Durch ihren räuberischen Lebensstil trägt sie zur Schädlingsbekämpfung bei, stellt aber gleichzeitig sicher, dass das ökologische Gleichgewicht erhalten bleibt. Ihre Anpassungsfähigkeit und ihre Fähigkeit, eine Vielzahl von Insekten zu jagen, machen sie zu einem wertvollen Bestandteil vieler Lebensräume.
Zusammengefasst zeigt Nabis rugosus, wie auch kleine und unscheinbare Organismen eine bedeutende Rolle in der Natur spielen können, indem sie zur Artenvielfalt und Stabilität von Ökosystemen beitragen.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- Rotbraune Sichelwanze (Nabis rugosus)
Artenschutz in Franken®
Ausbaggern von Grabensystemen - Wenn Lebensräume nicht erkannt werden

Ausbaggern von Grabensystemen - Wenn Lebensräume nicht erkannt werden
02/03.010.2024
Das Ausbaggern von Grabensystemen kann für die dort lebenden Organismen äußerst problematisch sein. Hier ist eine Perspektive aus Sicht der Lebenswesen im Grabensystem:
02/03.010.2024
Das Ausbaggern von Grabensystemen kann für die dort lebenden Organismen äußerst problematisch sein. Hier ist eine Perspektive aus Sicht der Lebenswesen im Grabensystem:
- Störung des Lebensraums: Grabensysteme sind oft Heimat für eine Vielzahl von Lebewesen wie Wasserinsekten, Amphibien, Krebstiere und verschiedene Pflanzen. Das Ausbaggern kann ihren Lebensraum stark stören oder sogar zerstören. Durch das Entfernen von Sedimenten und Pflanzen wird die natürliche Umgebung dieser Tiere und Pflanzen stark verändert.
- Verlust von Nahrung und Schutz: Viele Organismen im Grabensystem sind an die dortigen Bedingungen angepasst. Pflanzen dienen als Nahrung und Deckung für viele Tiere, während sich andere direkt von Sedimenten und organischem Material ernähren. Das Ausbaggern kann diese Nahrungsquellen und Schutzvorrichtungen beseitigen, was zu einem Rückgang der Populationen führen kann.
- Veränderung der Wasserqualität: Grabensysteme spielen eine wichtige Rolle bei der Filterung und Reinigung von Wasser. Durch das Ausbaggern können Sedimente und Schadstoffe freigesetzt werden, die die Wasserqualität negativ beeinflussen können. Dies wirkt sich nicht nur auf die im Graben lebenden Organismen aus, sondern auch auf andere aquatische Lebensräume, die vom Graben abhängig sind.
- Störung des Fortpflanzungszyklus: Viele Amphibienarten nutzen Grabensysteme als Laichgewässer. Das Ausbaggern kann den Fortpflanzungszyklus dieser Tiere stören, da die notwendigen Bedingungen für die Eiablage und die Entwicklung der Larven beeinträchtigt werden können.
- Langfristige Auswirkungen: Selbst wenn ein Grabensystem nach dem Ausbaggern wieder hergestellt wird, können die Auswirkungen langfristig spürbar sein. Es kann Jahre dauern, bis sich die Ökosysteme vollständig erholen, und einige Arten könnten dauerhaft verschwinden oder stark dezimiert werden.
Insgesamt ist das Ausbaggern von Grabensystemen also nicht nur eine physische Veränderung der Landschaft, sondern hat auch weitreichende ökologische Konsequenzen für die dort lebenden Lebensformen. Es ist wichtig, diese Auswirkungen sorgfältig zu berücksichtigen und nachhaltige Lösungen zu finden, um die Biodiversität und die Ökosystemdienstleistungen dieser Lebensräume zu erhalten.
In der Aufnahme
- Häufig werden Grabensysteme lediglich als Abwasserrinne angesehen, das hier aktive Ökosysteme anzutreffen sind ist den/der meisten gar nicht bekannt oder es interessiert auch nicht! Also wird gebaggert was das Zeugt hält!
Artenschutz in Franken®
Der Behaarte Erzschnellkäfer (Cidnopus pilosus)

Behaarter Erzschnellkäfer (Cidnopus pilosus)
01/02.10.2024
Als Behaarter Erzschnellkäfer (Cidnopus pilosus) bin ich ein eher unauffälliger, aber dennoch faszinierender Vertreter der Schnellkäfer (Elateridae).
01/02.10.2024
Als Behaarter Erzschnellkäfer (Cidnopus pilosus) bin ich ein eher unauffälliger, aber dennoch faszinierender Vertreter der Schnellkäfer (Elateridae).
- Ich möchte dir meine Welt aus meiner Perspektive näherbringen und dabei einige fachliche Details über mich und meine Lebensweise erklären.
Systematik und Taxonomie:
Ich gehöre zur Familie der Schnellkäfer, die weltweit mit über 10.000 Arten vertreten ist. Innerhalb dieser Familie ist meine Art Cidnopus pilosus bekannt für ihren dichten Haarbewuchs, der meinen Namen beeinflusst hat. Die Familie Elateridae ist nach dem charakteristischen Sprungmechanismus benannt, den wir alle besitzen.
Anatomie und Morphologie:
Mein Körper ist länglich und schmal, typisch für Schnellkäfer. Ich erreiche eine Körperlänge von etwa 8 bis 13 mm. Meine Oberfläche ist braun bis rötlich, mit feinen, goldfarbenen Härchen bedeckt, was mir mein charakteristisches „behaartes“ Erscheinungsbild verleiht. Diese Behaarung schützt mich vor dem Austrocknen und dient als Tarnung in meinem natürlichen Lebensraum.
Eines meiner faszinierendsten Merkmale ist mein „Sprungapparat“. Dieser besteht aus einem scharnierartigen Mechanismus am Prothorax (Vorderbrust), der es mir ermöglicht, mich blitzartig in die Luft zu katapultieren, wenn ich auf dem Rücken liege oder Gefahr droht. Durch das Einrasten meines Brustsegments kann ich mich mit einem Klickgeräusch hoch in die Luft schleudern, um Fressfeinden zu entkommen.
Lebensraum und Verhalten:
Ich bevorzuge trockene, sonnige Habitate, wie Wiesen, Waldränder oder offene Heiden. In diesen Lebensräumen verstecke ich mich tagsüber oft in der Laubschicht, unter Moos oder in lockerem Erdreich, und werde in der Dämmerung oder nachts aktiv. Meine Larven, die sogenannten „Drahtwürmer“, leben im Boden und sind vor allem für ihre lange Entwicklungszeit bekannt, die mehrere Jahre in Anspruch nehmen kann.
Ernährung und Larvalentwicklung:
Als erwachsener Käfer bin ich eher ein Pflanzenfresser, der sich von Pollen, Blüten und weichem Pflanzenmaterial ernährt. Meine Larven hingegen sind räuberischer Natur. Sie leben im Boden und ernähren sich von Wurzeln oder anderen bodenlebenden Insektenlarven. Dies führt manchmal zu einem schlechten Ruf, da Drahtwürmer als Schädlinge in landwirtschaftlichen Kulturen auftreten können.
Die Entwicklung meiner Larven ist jedoch bemerkenswert komplex. Die Larven durchlaufen mehrere Häutungen und können, je nach Nahrungsangebot und Temperatur, bis zu sechs Jahre benötigen, um sich vollständig zu entwickeln. Diese lange Larvalzeit ist eine Anpassung an die oftmals nährstoffarme Umgebung, in der sie leben.
Ökologische Rolle und Bedeutung:
Ich, als Cidnopus pilosus, spiele eine wichtige Rolle im Bodenökosystem. Meine Larven tragen zur Durchmischung und Belüftung des Bodens bei, während sie sich durch das Erdreich bewegen. Durch die Zersetzung von Wurzeln und totem organischem Material tragen sie zur Bodenfruchtbarkeit bei. Gleichzeitig diene ich vielen anderen Tieren, wie Vögeln, Igeln oder Spinnen, als Nahrungsquelle.
Trotz meiner ökologischen Bedeutung werde ich oft als Schädling betrachtet, insbesondere von Landwirten, da meine Larven gelegentlich Wurzeln von Nutzpflanzen wie Getreide, Kartoffeln oder Mais anknabbern und so Schäden verursachen können.
Verteidigung und Anpassungsstrategien:
Neben meinem Sprungmechanismus habe ich noch weitere Strategien zur Verteidigung. Meine braun behaarte Tarnfarbe hilft mir, in meiner Umgebung nicht aufzufallen. Bei Bedrohung stelle ich mich tot – eine Technik, die als Thanatose bekannt ist – oder nutze meinen Sprungmechanismus, um zu entkommen.
Bedrohungen und Erhaltung:
Trotz meiner weiten Verbreitung und meiner Anpassungsfähigkeit sehe ich mich zunehmend mit Bedrohungen konfrontiert. Intensivierte Landwirtschaft, der Einsatz von Pestiziden und die Zerstörung natürlicher Lebensräume führen zu einem Rückgang geeigneter Lebensräume. Auch der Klimawandel könnte meine Populationen beeinflussen, indem er die Bedingungen in meinem bevorzugten Lebensraum verändert.
Insgesamt bin ich ein bescheidener, aber anpassungsfähiger Käfer, der in den Kreislauf der Natur eingebettet ist. Mein Sprungmechanismus und meine Larvalentwicklung machen mich zu einem interessanten Mitglied der Käferwelt – sowohl als wichtiger Bestandteil der Natur als auch als gelegentlicher Schädling, der die Aufmerksamkeit des Menschen auf sich zieht.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
Ich gehöre zur Familie der Schnellkäfer, die weltweit mit über 10.000 Arten vertreten ist. Innerhalb dieser Familie ist meine Art Cidnopus pilosus bekannt für ihren dichten Haarbewuchs, der meinen Namen beeinflusst hat. Die Familie Elateridae ist nach dem charakteristischen Sprungmechanismus benannt, den wir alle besitzen.
Anatomie und Morphologie:
Mein Körper ist länglich und schmal, typisch für Schnellkäfer. Ich erreiche eine Körperlänge von etwa 8 bis 13 mm. Meine Oberfläche ist braun bis rötlich, mit feinen, goldfarbenen Härchen bedeckt, was mir mein charakteristisches „behaartes“ Erscheinungsbild verleiht. Diese Behaarung schützt mich vor dem Austrocknen und dient als Tarnung in meinem natürlichen Lebensraum.
Eines meiner faszinierendsten Merkmale ist mein „Sprungapparat“. Dieser besteht aus einem scharnierartigen Mechanismus am Prothorax (Vorderbrust), der es mir ermöglicht, mich blitzartig in die Luft zu katapultieren, wenn ich auf dem Rücken liege oder Gefahr droht. Durch das Einrasten meines Brustsegments kann ich mich mit einem Klickgeräusch hoch in die Luft schleudern, um Fressfeinden zu entkommen.
Lebensraum und Verhalten:
Ich bevorzuge trockene, sonnige Habitate, wie Wiesen, Waldränder oder offene Heiden. In diesen Lebensräumen verstecke ich mich tagsüber oft in der Laubschicht, unter Moos oder in lockerem Erdreich, und werde in der Dämmerung oder nachts aktiv. Meine Larven, die sogenannten „Drahtwürmer“, leben im Boden und sind vor allem für ihre lange Entwicklungszeit bekannt, die mehrere Jahre in Anspruch nehmen kann.
Ernährung und Larvalentwicklung:
Als erwachsener Käfer bin ich eher ein Pflanzenfresser, der sich von Pollen, Blüten und weichem Pflanzenmaterial ernährt. Meine Larven hingegen sind räuberischer Natur. Sie leben im Boden und ernähren sich von Wurzeln oder anderen bodenlebenden Insektenlarven. Dies führt manchmal zu einem schlechten Ruf, da Drahtwürmer als Schädlinge in landwirtschaftlichen Kulturen auftreten können.
Die Entwicklung meiner Larven ist jedoch bemerkenswert komplex. Die Larven durchlaufen mehrere Häutungen und können, je nach Nahrungsangebot und Temperatur, bis zu sechs Jahre benötigen, um sich vollständig zu entwickeln. Diese lange Larvalzeit ist eine Anpassung an die oftmals nährstoffarme Umgebung, in der sie leben.
Ökologische Rolle und Bedeutung:
Ich, als Cidnopus pilosus, spiele eine wichtige Rolle im Bodenökosystem. Meine Larven tragen zur Durchmischung und Belüftung des Bodens bei, während sie sich durch das Erdreich bewegen. Durch die Zersetzung von Wurzeln und totem organischem Material tragen sie zur Bodenfruchtbarkeit bei. Gleichzeitig diene ich vielen anderen Tieren, wie Vögeln, Igeln oder Spinnen, als Nahrungsquelle.
Trotz meiner ökologischen Bedeutung werde ich oft als Schädling betrachtet, insbesondere von Landwirten, da meine Larven gelegentlich Wurzeln von Nutzpflanzen wie Getreide, Kartoffeln oder Mais anknabbern und so Schäden verursachen können.
Verteidigung und Anpassungsstrategien:
Neben meinem Sprungmechanismus habe ich noch weitere Strategien zur Verteidigung. Meine braun behaarte Tarnfarbe hilft mir, in meiner Umgebung nicht aufzufallen. Bei Bedrohung stelle ich mich tot – eine Technik, die als Thanatose bekannt ist – oder nutze meinen Sprungmechanismus, um zu entkommen.
Bedrohungen und Erhaltung:
Trotz meiner weiten Verbreitung und meiner Anpassungsfähigkeit sehe ich mich zunehmend mit Bedrohungen konfrontiert. Intensivierte Landwirtschaft, der Einsatz von Pestiziden und die Zerstörung natürlicher Lebensräume führen zu einem Rückgang geeigneter Lebensräume. Auch der Klimawandel könnte meine Populationen beeinflussen, indem er die Bedingungen in meinem bevorzugten Lebensraum verändert.
Insgesamt bin ich ein bescheidener, aber anpassungsfähiger Käfer, der in den Kreislauf der Natur eingebettet ist. Mein Sprungmechanismus und meine Larvalentwicklung machen mich zu einem interessanten Mitglied der Käferwelt – sowohl als wichtiger Bestandteil der Natur als auch als gelegentlicher Schädling, der die Aufmerksamkeit des Menschen auf sich zieht.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- Gemeiner Pillenkäfer (Byrrhus pilula)
Artenschutz in Franken®
Der Gemeine Pillenkäfer (Byrrhus pilula)

Gemeiner Pillenkäfer (Byrrhus pilula)
30.09/01.10.2024
Hier ist eine detaillierte Beschreibung aus meiner Sicht:
30.09/01.10.2024
- Als Gemeiner Pillenkäfer (Byrrhus pilula) betrachte ich mich als faszinierendes Beispiel der Käferwelt, spezialisiert auf meine einzigartige Lebensweise und ökologische Rolle.
Hier ist eine detaillierte Beschreibung aus meiner Sicht:
Taxonomie und Klassifikation: Ich gehöre zur Familie der Pillenkäfer (Byrrhidae) innerhalb der Ordnung der Käfer (Coleoptera). Meine Art ist Byrrhus pilula, und ich bin weltweit verbreitet, insbesondere in gemäßigten Regionen.
Morphologie und Anatomie: Mein Körper ist klein und oval geformt, typisch für Pillenkäfer. Ich messe nur etwa 4-6 mm in der Länge und habe eine glänzende schwarze Farbe mit einer leichten bläulichen oder violetten Tönung. Meine Flügel sind verkürzt und ich kann nicht fliegen, was meine Fortbewegung stark einschränkt.
Lebensraum und Lebensweise: Ich bevorzuge feuchte Lebensräume wie Moore, Sümpfe und Ufergebiete von Gewässern, wo ich mich unter Moos, Laub oder Totholz verstecke. Meine Ernährung besteht hauptsächlich aus pflanzlichem Material wie Algen, Pilzen und verrottendem Pflanzenmaterial.
Fortpflanzung und Entwicklung: Nach der Paarung legen die Weibchen ihre Eier in feuchtes Substrat, wo sie sich zu Larven entwickeln. Die Larven ähneln den erwachsenen Käfern, sind jedoch größer und haben einen auffälligeren Körperbau. Sie durchlaufen mehrere Häutungsphasen, bevor sie sich verpuppen und schließlich zu ausgewachsenen Käfern werden.
Ökologische Bedeutung: Als Zersetzer spiele ich eine wichtige Rolle im Ökosystem, da ich dazu beitrage, abgestorbene organische Materie abzubauen und den Nährstoffkreislauf in feuchten Habitaten aufrechtzuerhalten. Meine Präsenz unterstützt auch andere Organismen, die von meiner Zersetzungsarbeit profitieren.
Interaktion mit der Umwelt und Bedrohungen: Meine Art ist anfällig für Veränderungen in ihrem Lebensraum, insbesondere durch menschliche Eingriffe wie Entwässerung von Feuchtgebieten oder Umweltverschmutzung. Die Erhaltung meiner Lebensräume ist entscheidend für mein Überleben und das Gleichgewicht der ökologischen Prozesse, an denen ich beteiligt bin.
Insgesamt bin ich als Gemeiner Pillenkäfer ein bescheidener, aber wichtiger Akteur in den feuchten Ökosystemen, den es zu schätzen gilt und zu schützen gilt, um die Biodiversität und ökologische Integrität unserer Umwelt zu bewahren.
Aufnahme von Bernhard Schmalisch
Morphologie und Anatomie: Mein Körper ist klein und oval geformt, typisch für Pillenkäfer. Ich messe nur etwa 4-6 mm in der Länge und habe eine glänzende schwarze Farbe mit einer leichten bläulichen oder violetten Tönung. Meine Flügel sind verkürzt und ich kann nicht fliegen, was meine Fortbewegung stark einschränkt.
Lebensraum und Lebensweise: Ich bevorzuge feuchte Lebensräume wie Moore, Sümpfe und Ufergebiete von Gewässern, wo ich mich unter Moos, Laub oder Totholz verstecke. Meine Ernährung besteht hauptsächlich aus pflanzlichem Material wie Algen, Pilzen und verrottendem Pflanzenmaterial.
Fortpflanzung und Entwicklung: Nach der Paarung legen die Weibchen ihre Eier in feuchtes Substrat, wo sie sich zu Larven entwickeln. Die Larven ähneln den erwachsenen Käfern, sind jedoch größer und haben einen auffälligeren Körperbau. Sie durchlaufen mehrere Häutungsphasen, bevor sie sich verpuppen und schließlich zu ausgewachsenen Käfern werden.
Ökologische Bedeutung: Als Zersetzer spiele ich eine wichtige Rolle im Ökosystem, da ich dazu beitrage, abgestorbene organische Materie abzubauen und den Nährstoffkreislauf in feuchten Habitaten aufrechtzuerhalten. Meine Präsenz unterstützt auch andere Organismen, die von meiner Zersetzungsarbeit profitieren.
Interaktion mit der Umwelt und Bedrohungen: Meine Art ist anfällig für Veränderungen in ihrem Lebensraum, insbesondere durch menschliche Eingriffe wie Entwässerung von Feuchtgebieten oder Umweltverschmutzung. Die Erhaltung meiner Lebensräume ist entscheidend für mein Überleben und das Gleichgewicht der ökologischen Prozesse, an denen ich beteiligt bin.
Insgesamt bin ich als Gemeiner Pillenkäfer ein bescheidener, aber wichtiger Akteur in den feuchten Ökosystemen, den es zu schätzen gilt und zu schützen gilt, um die Biodiversität und ökologische Integrität unserer Umwelt zu bewahren.
Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- Gemeiner Pillenkäfer (Byrrhus pilula) auf Johannisbeerblatt
Artenschutz in Franken®
Stele der Biodiversität® - Burgwindheim / Kötsch

Stele der Biodiversität® - Burgwindheim / Kötsch
29/30.09.2024
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das vom Markt Burgwindheim, dem Bayernwerk der Deutschen Postcode Lotterie und der Steuerkanzlei Bauerfeind unterstützt wird.
Kötsch / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen.
Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
29/30.09.2024
- Grafik ... Entwicklung weiter fortgeschritten ... Abschluss steht bevor
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das vom Markt Burgwindheim, dem Bayernwerk der Deutschen Postcode Lotterie und der Steuerkanzlei Bauerfeind unterstützt wird.
Kötsch / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen.
Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
Denn wenn (selbst in noch geeigneten Nahrungsstrukturen) keine geeigneten Reproduktionsräume vorhanden sind, ist die Erhaltung der Artenvielfalt gelichfalls zum Scheitern verurteilt.
Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das vom Markt Burgwindheim, dem Bayernwerk der Deutschen Postcode Lotterie und der Steuerkanzlei Bauerfeind unterstützt wird, setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.
In der Aufnahme
Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das vom Markt Burgwindheim, dem Bayernwerk der Deutschen Postcode Lotterie und der Steuerkanzlei Bauerfeind unterstützt wird, setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.
In der Aufnahme
- Am 26.09.2024 ...
Artenschutz in Franken®
Stele der Biodiversität® - Stegaurach / Dellern
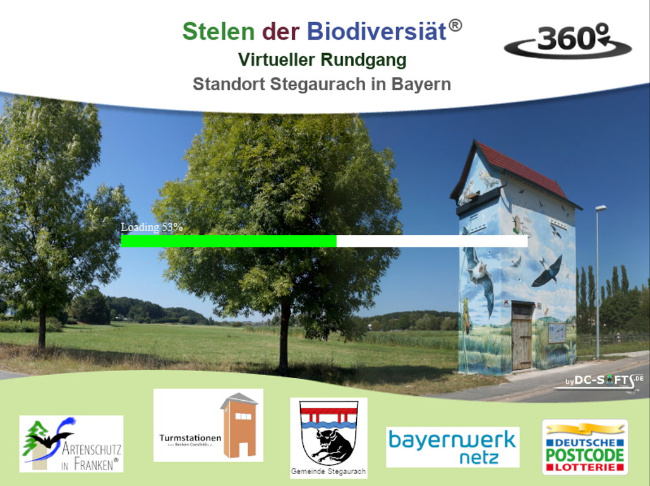
Stele der Biodiversität® - Stegaurach / Dellern
28/29.08.2024
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.
Stegaurach / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
28/29.08.2024
- Der Virtuelle Rundgang - Stele der Biodiversität®
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.
Stegaurach / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
Denn wenn (selbst in noch geeigneten Nahrungsstrukturen) keine geeigneten Reproduktionsräume vorhanden sind, ist die Erhaltung der Artenvielfalt gelichfalls zum Scheitern verurteilt.
Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird., setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.
In der Aufnahme
Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird., setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.
In der Aufnahme
- Mit der Gestaltung des virtuellen Rundgangs schließen wir dieses Projekt ...
Artenschutz in Franken®
Während um uns herum die Biodiversität schwindet ...

Lebensräume erhalten und optimieren
27/28.09.2024
All das findet sich in den Reihen des Artenschutz in Franken® und so war es selbstverständlich, das wir uns auch dieser Herausforderung annahmen.
27/28.09.2024
- Um ein sehr gutes Biotopmanagement gerade in der vielfach ausgeräumten Kulturlandschaft gewährleisten zu können, bedarf es neben einem immensen Fachwissen auch das nötige Fingerspitzengefühl um dieses entsprechend nachhaltig fortführen zu können.
All das findet sich in den Reihen des Artenschutz in Franken® und so war es selbstverständlich, das wir uns auch dieser Herausforderung annahmen.
Aber weshalb wurde dieser Eingriff denn überhaupt relevant?
Immer wieder wird doch auch von uns gefordert Natur einmal Natur sein zu lassen und nicht einzugreifen. Für Großschutzgebiete und auch größere Fläche inmitten naturbelassener Strukturen mag das der effektive Weg sein. Doch hier sprechen wir über eine Fläche von wenigen Hundert Quadratmetern, die sich inmitten intensiv bewirtschafteter Feld-Forststrukturen befindet und hier müssen wir einen etwas anderen Ansatz wählen, wenn diese Fläche tatsächlich zu einem Hotspot der Biodiversität werden und diesen Status auch halten soll.
Stürme hatten in der Vergangenheit dazu geführt, dass hier Bäume aus angrenzenden Flächen auf das Biotop stürzten, auch neigten fließgewässerbegleitende Altbäume dazu, sich sehr weit dem Licht der Biotopfreifläche zuzuneigen, und die Neigung führte dazu das einige Altbäume auf die Biotopfläche zu stürzen drohten, was zu einer wesentlichen Lebensraumverschlechterung geführt hätte.
Welche Arten sprechen wir hier vornehmlich an?
In erster Linie sind es Pflanzenstrukturen die sich, als Hochflurstauden abbilden und deren Lebensraum in unserer vornehmlich industriell-landschaftlich geführten Umwelt als zunehmende Rarität abbildet. Auch der Ansatz zur Erhaltung von Kopfweiden spielt hier eine mitentscheidende Rolle. Ein Kleingewässer, welches in den vergangenen Jahren seine ganz eigenen Lebensraumtypus fand, jedoch zunehmend mit Verschattung zu kämpfen.
In den vergangenen Jahren wurde diese Fläche von Jägern als Anfütterungsstelle für Wildschweine verwendet und beeinträchtigt. Dieses Fehlverhalten wurde nach dem entsprechenden Antreffen von unserer Seite unverzüglich korrigiert und die Verantwortlichen darauf aufmerksam gemacht das bei einer Wiederholung mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen ist.
Wir möchten diese Fläche als Rückzugsraum für zahlreiche Insekten und Amphibienarten angesehen wissen, auch für lebensraumtypische Kleinvögel- und Kleinsäuger soll hier ein geeigneter Überlebensraum vorgehalten werden.
Das kann jedoch nur gelingen, wenn diese kleine Fläche entsprechend professionell gemanagt wird, um deren Bedeutung entsprechend aufrechterhalten zu können.
In der Aufnahme
Immer wieder wird doch auch von uns gefordert Natur einmal Natur sein zu lassen und nicht einzugreifen. Für Großschutzgebiete und auch größere Fläche inmitten naturbelassener Strukturen mag das der effektive Weg sein. Doch hier sprechen wir über eine Fläche von wenigen Hundert Quadratmetern, die sich inmitten intensiv bewirtschafteter Feld-Forststrukturen befindet und hier müssen wir einen etwas anderen Ansatz wählen, wenn diese Fläche tatsächlich zu einem Hotspot der Biodiversität werden und diesen Status auch halten soll.
Stürme hatten in der Vergangenheit dazu geführt, dass hier Bäume aus angrenzenden Flächen auf das Biotop stürzten, auch neigten fließgewässerbegleitende Altbäume dazu, sich sehr weit dem Licht der Biotopfreifläche zuzuneigen, und die Neigung führte dazu das einige Altbäume auf die Biotopfläche zu stürzen drohten, was zu einer wesentlichen Lebensraumverschlechterung geführt hätte.
Welche Arten sprechen wir hier vornehmlich an?
In erster Linie sind es Pflanzenstrukturen die sich, als Hochflurstauden abbilden und deren Lebensraum in unserer vornehmlich industriell-landschaftlich geführten Umwelt als zunehmende Rarität abbildet. Auch der Ansatz zur Erhaltung von Kopfweiden spielt hier eine mitentscheidende Rolle. Ein Kleingewässer, welches in den vergangenen Jahren seine ganz eigenen Lebensraumtypus fand, jedoch zunehmend mit Verschattung zu kämpfen.
In den vergangenen Jahren wurde diese Fläche von Jägern als Anfütterungsstelle für Wildschweine verwendet und beeinträchtigt. Dieses Fehlverhalten wurde nach dem entsprechenden Antreffen von unserer Seite unverzüglich korrigiert und die Verantwortlichen darauf aufmerksam gemacht das bei einer Wiederholung mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen ist.
Wir möchten diese Fläche als Rückzugsraum für zahlreiche Insekten und Amphibienarten angesehen wissen, auch für lebensraumtypische Kleinvögel- und Kleinsäuger soll hier ein geeigneter Überlebensraum vorgehalten werden.
Das kann jedoch nur gelingen, wenn diese kleine Fläche entsprechend professionell gemanagt wird, um deren Bedeutung entsprechend aufrechterhalten zu können.
In der Aufnahme
- Während um uns herum die Biodiversität schwindet ... Biotop im September 2024 - Ohne Frage eine Oase des Überlebens in einer zunehmend ausgeräumten Landschaft ... hierhin können sich Arten zurückziehen die an anderer Stelle keine Möglichkeit mehr erhalten sich niederzulassen ...
Artenschutz in Franken®
Mäuse - Projekt 2024 - 2025

Mäuse - Projekt 2024 - 2025
26/27.09.2024
Regelmäßig erreichen uns Anfragen ob es möglich ist Mäuse auch mittels Mechanismen zu treiben ohne dass diese getötet werden. Immer wieder tauchen hierbei auch Fragen zum Bornavirus oder dem Hantavirus auf, da Mäuse und deren Hinterlassenschaften als Überträger identifiziert wurden.
Diesem Thema haben wir uns angenommen und starten ab dem 01. Juni 2024 eine einjährige Untersuchungsreihe an Standorten an welchen wir mit Sicherheit auf Kleinsäuger (Haus-Rötel-Gelbhals-Feldspitz- und Hausspitzmaus) treffen, diese Bereiche wurden in den vergangenen 6 Monaten intensiv von uns bewertet und sowohl die Lauf-Ruhe- und Fraßplätze der Tiere entsprechend nachdrücklich kartiert.
Ferner haben wir hier Räume mit unterschiedlichen Hauptmaterialien wie Holz-Metall- Kunststoff/Stein in den Fokus genommen, um erkennen zu können, ob und wie etwaige Unterschiede der Effektivität sichtbar werden.
26/27.09.2024
- AiF - Pilotprojekt Nagervergrämung ... die August und ersten Septemberzahlen sind da ...
Regelmäßig erreichen uns Anfragen ob es möglich ist Mäuse auch mittels Mechanismen zu treiben ohne dass diese getötet werden. Immer wieder tauchen hierbei auch Fragen zum Bornavirus oder dem Hantavirus auf, da Mäuse und deren Hinterlassenschaften als Überträger identifiziert wurden.
Diesem Thema haben wir uns angenommen und starten ab dem 01. Juni 2024 eine einjährige Untersuchungsreihe an Standorten an welchen wir mit Sicherheit auf Kleinsäuger (Haus-Rötel-Gelbhals-Feldspitz- und Hausspitzmaus) treffen, diese Bereiche wurden in den vergangenen 6 Monaten intensiv von uns bewertet und sowohl die Lauf-Ruhe- und Fraßplätze der Tiere entsprechend nachdrücklich kartiert.
Ferner haben wir hier Räume mit unterschiedlichen Hauptmaterialien wie Holz-Metall- Kunststoff/Stein in den Fokus genommen, um erkennen zu können, ob und wie etwaige Unterschiede der Effektivität sichtbar werden.
Der Einsatz der Ultraschallgeräte findet in einer natürlichen Umgebung, mit etwas über den Vorgaben der ausgewählten Hersteller angegebenen Geräteanzahl pro Raum und Raumgröße statt. Es wurde darauf geachtet, dass es keine Bereiche mit Ultraschallschatten gibt.
Erst nach Abschluss dieser Untersuchungsreihe können wir von unserer Seite eine belastbare Information über die Wirkungsweise dieser Geräte sichtbar werden lassen.Doch stellen wir bis dahin selbstverständlich regelmäßig Ergebnisse zur Projektentwicklung vor, um unsere Eindrücke temporär zu kommunizieren.
Wir starten am: 31.05.2024 mit der Aktivierungsphase der ausgewählten Geräte und konnten hier bewusst auf batteriebetriebene Geräte zurückgreifen.
Objekte:
3 gleichgroße 30 Quadratmeter umfassende Räume
Bestehen vornehmlich aus:
1., Holz (Verschalung)
2., Metall (Edelstahlverblendung)
3., Stein (Mauerwerk)
Ausstattung:
Jeweils mit 3 Geräten ausgestattet
Wir setzen in den Objekten zusätzlich Maus- Lebendfallen ein und kontrollieren diese mindestens 3mal am Tag auf Besatz um hier eine in unseren Augen sicheren Aussage zur Wirksamkeit treffen zu können. Wir sind gespannt …
Hier noch einige Informationen zum Einsatz von einigen Mausefallentypen und deren mögliche Vor- und Nachteile:
Mäusefallen als Totschlagfallen
Beschreibung:
Totschlagfallen sind sogenannte mechanische Vorrichtungen, die darauf abzielen, Mäuse durch einen schnellen, kräftigen Schlag sofort und unmittelbar zu töten. Es gibt verschiedene Arten von Totschlagfallen, darunter traditionelle Schnappfallen, jedoch auch moderne elektronische Fallen etc.
Mögliche AiF - Vorteile
1. Effektivität: Totschlagfallen sind (meist) sehr effektiv und töten Mäuse in der Regel (jedoch nicht immer wie wir auch selbst erkannten) sofort.
2. Schnell: Mäuse werden (häufig – jedoch sicherlich nicht immer) schnell getötet, was das Leiden minimiert.
3. Kosten: Diese Fallen sind oft relativ preiswert und leicht verfügbar.
4. Wiederverwendbar: Viele Totschlagfallen können mehrfach verwendet werden, jedoch gilt es hier nach unserer Auffassung dringlich auch hygienische Aspekte zu beachten!
5. Kein Gift: Es werden keine Chemikalien oder Gifte verwendet, was sie aus dieser Perspektive gesehen sicherer für den Haushalt macht.
Mögliche AiF - Nachteile
1. Grausamkeit: Die Tötung der Maus kann als grausam empfunden werden, und manchmal sind die Mäuse auch nicht sofort tot, was zu (vermeidbarem) Leiden führt.
2. Sicherheitsrisiken: Für Menschen und Haustiere besteht ein potentielles Verletzungsrisiko, wenn sie versehentlich in die Falle geraten.
3. Entsorgung: Tote Mäuse müssen manuell und fachgerecht entsorgt werden, was für einige Menschen unangenehm sein kann.
4. Nicht selektiv: Diese Fallen unterscheiden nicht zwischen Mäusen und anderen kleinen Tieren.
Maus-Lebendfallen
Beschreibung:
Maus-Lebendfallen sind in der Regel Vorrichtungen, die darauf abzielen, Mäuse lebend zu fangen, ohne sie zu töten oder zu verletzen. Diese Fallen werden nach unserer Auffassung sehr oft aus ethischen Gründen oder auch für wissenschaftliche Zwecke verwendet, um die lebenden Tiere später wieder in die Freiheit zu entlassen. Lebendfallen funktionieren durch verschiedene Mechanismen, welche die Maus in einen geschlossenen Raum locken, aus dem sie nicht (im Idealfall) entkommen kann.
Mögliche AiF - Vorteile
1. Humanität: Mäuse werden lebend gefangen und können bei entsprechender Handhabe in der Regel unversehrt freigelassen werden.
2. Sicherheit: Reduzierte Gefahr für Menschen und Haustiere, da keine tödlichen Mechanismen oder Gifte verwendet werden. Viren könnten jedoch ggf. übertragen werden, deshalb immer Vorsicht.
3. Wiederverwendbar: Die meisten Lebendfallen sind tatsächlich robust und können daher auch mehrfach verwendet werden.
4. Umweltfreundlich: Keine chemischen Rückstände oder toten Tiere, die entsorgt werden müssen, dennoch setzen die Tiere nach unseren langjährigen Erfahrungen immer wieder Kot und Urin ab, deshalb sind hygienische Aspekte relevant!
Mögliche AiF - Nachteile
1. Aufwand: Gefangene Mäuse, oder besser die Fallen müssen immer und mehrfach am Tag regelmäßig kontrolliert und an tatsächlich geeigneten Orten freigelassen werden.
2. Stress für die Maus: Obwohl die Falle die Maus in der Regel nicht verletzt, kann das Fangen und Eingesperrt sein sehr stressig für das Tier sein.
3. Wiederbefall: Wenn die gefangenen Mäuse nicht weit genug vom Fundort entfernt freigelassen werden, können und werden sie meist auch (eigene Erfahrungen) zurückkehren.
4. Begrenzte Effektivität: In stark befallenen Gebieten kann die Fangrate zu gering sein, um das Problem effektiv und nachhaltig zu lösen.
"Mäusefallen / Abwehr" als Ultraschallgeräte
Beschreibung:
Ultraschallgeräte zur Mäuseabwehr senden hochfrequente Schallwellen aus, die für Menschen (meist) nicht hörbar sind, aber für Mäuse und andere Nagetiere nach uns vorliegenden Informationen äußerst unangenehm sein sollen. Diese Geräte sollen die Mäuse vertreiben, ohne sie zu töten.
Mögliche AiF - Vorteile
1. Humanität: Mäuse werden somit durch diesen Einsatz nicht getötet, sondern nur vertrieben.
2. Sicherheit: (Mutmaßlich) Keine Gefahr für Menschen und Haustiere, da keine mechanischen Teile oder Gifte verwendet werden. – dieses werden wir gleichfalls in der Handhabung bewerten.
3. Einfachheit: Sehr einfach in der Anwendung – das Gerät muss lediglich eingesteckt werden – dieses werden wir gleichfalls in der Handhabung bewerten.
4. Wartungsarm: Keine Notwendigkeit, Fallen neu zu stellen oder tote Tiere zu entsorgen. – dieses werden wir gleichfalls in der Handhabung bewerten.
Mögliche AiF – Nachteile
1. Wirksamkeit: Die Wirksamkeit dieser Geräte wird häufig infrage gestellt. Nicht alle Mäuse reagieren wohl auf Ultraschall, und einige können sich wohl daran gewöhnen.
2. Reichweite: Die Effektivität kann wohl durch Hindernisse wie Möbel und Wände beeinträchtigt werden, wodurch wohl mehrere Geräte in verschiedenen Räumen notwendig werden.
3. Störgeräusche: Einige Menschen und Haustiere können wohl die hochfrequenten Geräusche hören, was wohl zu Unbehagen führen kann.
4. Energieverbrauch: Diese Geräte müssen wohl ständig an eine Stromquelle angeschlossen sein, was einen kontinuierlichen Energieverbrauch bedeutet.
Ein erstes AiF - Fazit
Die Wahl zwischen Totschlag- Lebendfallen und Ultraschallgeräten hängt wohl stark von den individuellen Bedürfnissen und ethischen Überzeugungen ab. Totschlagfallen sind wohl meist effektiv und günstig, können jedoch wohl als grausam angesehen werden. Lebendfallen setzen eine hohe und zuverlässige Kontrolleinheit voraus. Ultraschallgeräte bieten wohl eine humane Alternative, deren Effektivität wohl jedoch variieren kann. Es kann wohl ggf. sinnvoll sein, verschiedene Methoden zu kombinieren, um das wohl beste Ergebnis zu erzielen.
Wir werden sehen und berichten sehr objektiv ...
In der Aufnahme von Johannes Rother
Erst nach Abschluss dieser Untersuchungsreihe können wir von unserer Seite eine belastbare Information über die Wirkungsweise dieser Geräte sichtbar werden lassen.Doch stellen wir bis dahin selbstverständlich regelmäßig Ergebnisse zur Projektentwicklung vor, um unsere Eindrücke temporär zu kommunizieren.
Wir starten am: 31.05.2024 mit der Aktivierungsphase der ausgewählten Geräte und konnten hier bewusst auf batteriebetriebene Geräte zurückgreifen.
Objekte:
3 gleichgroße 30 Quadratmeter umfassende Räume
Bestehen vornehmlich aus:
1., Holz (Verschalung)
2., Metall (Edelstahlverblendung)
3., Stein (Mauerwerk)
Ausstattung:
Jeweils mit 3 Geräten ausgestattet
Wir setzen in den Objekten zusätzlich Maus- Lebendfallen ein und kontrollieren diese mindestens 3mal am Tag auf Besatz um hier eine in unseren Augen sicheren Aussage zur Wirksamkeit treffen zu können. Wir sind gespannt …
Hier noch einige Informationen zum Einsatz von einigen Mausefallentypen und deren mögliche Vor- und Nachteile:
Mäusefallen als Totschlagfallen
Beschreibung:
Totschlagfallen sind sogenannte mechanische Vorrichtungen, die darauf abzielen, Mäuse durch einen schnellen, kräftigen Schlag sofort und unmittelbar zu töten. Es gibt verschiedene Arten von Totschlagfallen, darunter traditionelle Schnappfallen, jedoch auch moderne elektronische Fallen etc.
Mögliche AiF - Vorteile
1. Effektivität: Totschlagfallen sind (meist) sehr effektiv und töten Mäuse in der Regel (jedoch nicht immer wie wir auch selbst erkannten) sofort.
2. Schnell: Mäuse werden (häufig – jedoch sicherlich nicht immer) schnell getötet, was das Leiden minimiert.
3. Kosten: Diese Fallen sind oft relativ preiswert und leicht verfügbar.
4. Wiederverwendbar: Viele Totschlagfallen können mehrfach verwendet werden, jedoch gilt es hier nach unserer Auffassung dringlich auch hygienische Aspekte zu beachten!
5. Kein Gift: Es werden keine Chemikalien oder Gifte verwendet, was sie aus dieser Perspektive gesehen sicherer für den Haushalt macht.
Mögliche AiF - Nachteile
1. Grausamkeit: Die Tötung der Maus kann als grausam empfunden werden, und manchmal sind die Mäuse auch nicht sofort tot, was zu (vermeidbarem) Leiden führt.
2. Sicherheitsrisiken: Für Menschen und Haustiere besteht ein potentielles Verletzungsrisiko, wenn sie versehentlich in die Falle geraten.
3. Entsorgung: Tote Mäuse müssen manuell und fachgerecht entsorgt werden, was für einige Menschen unangenehm sein kann.
4. Nicht selektiv: Diese Fallen unterscheiden nicht zwischen Mäusen und anderen kleinen Tieren.
Maus-Lebendfallen
Beschreibung:
Maus-Lebendfallen sind in der Regel Vorrichtungen, die darauf abzielen, Mäuse lebend zu fangen, ohne sie zu töten oder zu verletzen. Diese Fallen werden nach unserer Auffassung sehr oft aus ethischen Gründen oder auch für wissenschaftliche Zwecke verwendet, um die lebenden Tiere später wieder in die Freiheit zu entlassen. Lebendfallen funktionieren durch verschiedene Mechanismen, welche die Maus in einen geschlossenen Raum locken, aus dem sie nicht (im Idealfall) entkommen kann.
Mögliche AiF - Vorteile
1. Humanität: Mäuse werden lebend gefangen und können bei entsprechender Handhabe in der Regel unversehrt freigelassen werden.
2. Sicherheit: Reduzierte Gefahr für Menschen und Haustiere, da keine tödlichen Mechanismen oder Gifte verwendet werden. Viren könnten jedoch ggf. übertragen werden, deshalb immer Vorsicht.
3. Wiederverwendbar: Die meisten Lebendfallen sind tatsächlich robust und können daher auch mehrfach verwendet werden.
4. Umweltfreundlich: Keine chemischen Rückstände oder toten Tiere, die entsorgt werden müssen, dennoch setzen die Tiere nach unseren langjährigen Erfahrungen immer wieder Kot und Urin ab, deshalb sind hygienische Aspekte relevant!
Mögliche AiF - Nachteile
1. Aufwand: Gefangene Mäuse, oder besser die Fallen müssen immer und mehrfach am Tag regelmäßig kontrolliert und an tatsächlich geeigneten Orten freigelassen werden.
2. Stress für die Maus: Obwohl die Falle die Maus in der Regel nicht verletzt, kann das Fangen und Eingesperrt sein sehr stressig für das Tier sein.
3. Wiederbefall: Wenn die gefangenen Mäuse nicht weit genug vom Fundort entfernt freigelassen werden, können und werden sie meist auch (eigene Erfahrungen) zurückkehren.
4. Begrenzte Effektivität: In stark befallenen Gebieten kann die Fangrate zu gering sein, um das Problem effektiv und nachhaltig zu lösen.
"Mäusefallen / Abwehr" als Ultraschallgeräte
Beschreibung:
Ultraschallgeräte zur Mäuseabwehr senden hochfrequente Schallwellen aus, die für Menschen (meist) nicht hörbar sind, aber für Mäuse und andere Nagetiere nach uns vorliegenden Informationen äußerst unangenehm sein sollen. Diese Geräte sollen die Mäuse vertreiben, ohne sie zu töten.
Mögliche AiF - Vorteile
1. Humanität: Mäuse werden somit durch diesen Einsatz nicht getötet, sondern nur vertrieben.
2. Sicherheit: (Mutmaßlich) Keine Gefahr für Menschen und Haustiere, da keine mechanischen Teile oder Gifte verwendet werden. – dieses werden wir gleichfalls in der Handhabung bewerten.
3. Einfachheit: Sehr einfach in der Anwendung – das Gerät muss lediglich eingesteckt werden – dieses werden wir gleichfalls in der Handhabung bewerten.
4. Wartungsarm: Keine Notwendigkeit, Fallen neu zu stellen oder tote Tiere zu entsorgen. – dieses werden wir gleichfalls in der Handhabung bewerten.
Mögliche AiF – Nachteile
1. Wirksamkeit: Die Wirksamkeit dieser Geräte wird häufig infrage gestellt. Nicht alle Mäuse reagieren wohl auf Ultraschall, und einige können sich wohl daran gewöhnen.
2. Reichweite: Die Effektivität kann wohl durch Hindernisse wie Möbel und Wände beeinträchtigt werden, wodurch wohl mehrere Geräte in verschiedenen Räumen notwendig werden.
3. Störgeräusche: Einige Menschen und Haustiere können wohl die hochfrequenten Geräusche hören, was wohl zu Unbehagen führen kann.
4. Energieverbrauch: Diese Geräte müssen wohl ständig an eine Stromquelle angeschlossen sein, was einen kontinuierlichen Energieverbrauch bedeutet.
Ein erstes AiF - Fazit
Die Wahl zwischen Totschlag- Lebendfallen und Ultraschallgeräten hängt wohl stark von den individuellen Bedürfnissen und ethischen Überzeugungen ab. Totschlagfallen sind wohl meist effektiv und günstig, können jedoch wohl als grausam angesehen werden. Lebendfallen setzen eine hohe und zuverlässige Kontrolleinheit voraus. Ultraschallgeräte bieten wohl eine humane Alternative, deren Effektivität wohl jedoch variieren kann. Es kann wohl ggf. sinnvoll sein, verschiedene Methoden zu kombinieren, um das wohl beste Ergebnis zu erzielen.
Wir werden sehen und berichten sehr objektiv ...
In der Aufnahme von Johannes Rother
- Erdmaus
Artenschutz in Franken®
Die Bernstein-Waldschabe (Ectobius vittiventris)

Bernstein-Waldschabe (Ectobius vittiventris)
25/26.09.2024
Sie ist etwa 10-14 mm groß und hat eine bernsteinfarbene Färbung.
25/26.09.2024
- Die Bernstein-Waldschabe (Ectobius vittiventris) ist eine in Europa verbreitete Schabenart, die hauptsächlich im Freien lebt und selten in menschliche Behausungen eindringt.
Sie ist etwa 10-14 mm groß und hat eine bernsteinfarbene Färbung.
Diese Schabe kann als ein innovatives Beispiel für nachhaltige Schädlingsbekämpfung dienen. Statt auf chemische Mittel zurückzugreifen, die die Umwelt belasten, könnten wir natürliche Fressfeinde oder biologische Methoden einsetzen, um ihre Population zu kontrollieren. Dies wäre nicht nur umweltfreundlicher, sondern auch im Sinne nachfolgender Generationen, die von einer intakten und gesunden Natur profitieren sollen.
Kurz gesagt, die Bernstein-Waldschabe erinnert uns daran, dass wir innovative und nachhaltige Lösungen entwickeln müssen, um die Natur zu bewahren und so im Sinne zukünftiger Generationen zu handeln.
Aufnahme von Bernhard Schmalisch
Kurz gesagt, die Bernstein-Waldschabe erinnert uns daran, dass wir innovative und nachhaltige Lösungen entwickeln müssen, um die Natur zu bewahren und so im Sinne zukünftiger Generationen zu handeln.
Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- Bernstein-Waldschabe (Ectobius vittiventris)
Artenschutz in Franken®
Graureiher - auch heute noch im Fadenkreuz

Graureiher - auch heute noch im Fadenkreuz
25/26.09.2024
Obwohl der Graureiher eine elegante und anmutige Erscheinung ist, die in vielen Kulturen für ihre majestätische Ruhe und Jagdgeschicklichkeit geschätzt wird, ist er auch heute leider immer noch Ziel menschlicher Aggression.
25/26.09.2024
- Aus der Sicht des Graureihers lässt sich das Thema der Verfolgung durch den Menschen in eine existenzielle Frage des Überlebens fassen.
Obwohl der Graureiher eine elegante und anmutige Erscheinung ist, die in vielen Kulturen für ihre majestätische Ruhe und Jagdgeschicklichkeit geschätzt wird, ist er auch heute leider immer noch Ziel menschlicher Aggression.
Fischerei und Nahrungskonkurrenz
Der Graureiher ernährt sich überwiegend von Fischen, Amphibien und anderen kleinen Tieren, die er in flachen Gewässern fängt. Diese Nahrungskonkurrenz führt oft zu Konflikten mit kommerziellen und Freizeitfischern. In Gebieten, wo Fischteiche und Aquakulturen betrieben werden, wird der Reiher oft als Schädling angesehen. Aus Sicht der Fischereiwirtschaftwird er vielfach als Raubtier bezeichnet, das ihre Erträge mindert, da er sich in der Nähe von Fischzuchtanlagen oder Seen aufhält und dort leicht Fische fangen kann. Daher kommt es auch heute noch zu Abschüssen oder illegalen Vergiftungen, weil manche Menschen ihn als Bedrohung für ihre wirtschaftliche Existenz wahrnehmen.
Unwissenheit und Vorurteile
Ein weiteres Problem ist der Mangel an Wissen über das Verhalten des Graureihers. Oft wird der Vogel für weit mehr Schäden verantwortlich gemacht, als er tatsächlich verursacht. In vielen Fällen frisst er eher kleinere oder kranke Fische, die ohnehin keine hohe wirtschaftliche Bedeutung haben. Trotzdem hält sich das Vorurteil, dass Reiher massive Schäden an Fischbeständen anrichten. Auch wenn er in der Lage ist, größere Fische zu fangen, sind die Auswirkungen auf den Gesamtbestand oft vernachlässigbar.
Historische und kulturelle Vorurteile
In manchen Gegenden werden Graureiher historisch als "Schädlinge" angesehen. Während des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, als der Graureiher auch wegen seiner Federn bejagt wurde, führte dies zu einer starken Dezimierung der Population. Trotz heutiger Schutzmaßnahmen sind in manchen Regionen diese alten Vorurteile immer noch präsent. Es existiert eine Art kulturelles Misstrauen gegenüber dem Vogel, das zu Übergriffen führt.
Lebensraumverlust und Stress durch menschliche Aktivitäten
Die zunehmende Urbanisierung und der Verlust von Feuchtgebieten zwingen den Graureiher oft in menschliche Siedlungsbereiche oder in stärker genutzte Gewässer. Dies erhöht nicht nur die Konflikte mit dem Menschen, sondern führt auch zu Stresssituationen für den Vogel. Illegale Methoden, wie das Zerstören von Brutplätzen oder das Vergrämen der Tiere, werden manchmal eingesetzt, um die Reiher von diesen Gebieten fernzuhalten. Diese Taten führen indirekt zu Tötungsdelikten, da der Reiher dann gezwungen ist, in unsichere oder unwirtliche Gebiete abzuwandern.
Ethische Überlegungen und Artenschutz
Aus Sicht des Graureihers könnte man argumentieren, dass er sich nur in seinem natürlichen Lebensraum bewegt und auf natürliche Weise jagt. Er könnte sich als Opfer eines Missverständnisses sehen, bei dem der Mensch seine eigenen Interessen über die der Natur stellt. Hier kommen ökologische und ethische Fragestellungen ins Spiel: Ist es gerechtfertigt, ein Tier zu töten oder zu vergiften, weil es seinem natürlichen Instinkt folgt? Immerhin sind Graureiher wichtige Akteure im Ökosystem, die zur Kontrolle von Fischpopulationen und anderen Wasserbewohnern beitragen und somit das ökologische Gleichgewicht erhalten.
Fazit:
Aus der Sicht des Graureihers sind die Menschen jene, die seine natürlichen Lebensräume eingrenzen und ihn als Bedrohung wahrnehmen, obwohl er nur seinen natürlichen Überlebensinstinkten folgt. Illegale Abschüsse, Vergiftungen und Tötungsdelikte beruhen oft auf Missverständnissen und wirtschaftlichen Konflikten, die durch bessere Aufklärung und nachhaltiges Management gelöst werden könnten. Ökologische Gleichgewichte sollten gewahrt werden, um Konflikte zwischen Mensch und Tier zu vermeiden.
In der Aufnahme aus 2024
Der Graureiher ernährt sich überwiegend von Fischen, Amphibien und anderen kleinen Tieren, die er in flachen Gewässern fängt. Diese Nahrungskonkurrenz führt oft zu Konflikten mit kommerziellen und Freizeitfischern. In Gebieten, wo Fischteiche und Aquakulturen betrieben werden, wird der Reiher oft als Schädling angesehen. Aus Sicht der Fischereiwirtschaftwird er vielfach als Raubtier bezeichnet, das ihre Erträge mindert, da er sich in der Nähe von Fischzuchtanlagen oder Seen aufhält und dort leicht Fische fangen kann. Daher kommt es auch heute noch zu Abschüssen oder illegalen Vergiftungen, weil manche Menschen ihn als Bedrohung für ihre wirtschaftliche Existenz wahrnehmen.
Unwissenheit und Vorurteile
Ein weiteres Problem ist der Mangel an Wissen über das Verhalten des Graureihers. Oft wird der Vogel für weit mehr Schäden verantwortlich gemacht, als er tatsächlich verursacht. In vielen Fällen frisst er eher kleinere oder kranke Fische, die ohnehin keine hohe wirtschaftliche Bedeutung haben. Trotzdem hält sich das Vorurteil, dass Reiher massive Schäden an Fischbeständen anrichten. Auch wenn er in der Lage ist, größere Fische zu fangen, sind die Auswirkungen auf den Gesamtbestand oft vernachlässigbar.
Historische und kulturelle Vorurteile
In manchen Gegenden werden Graureiher historisch als "Schädlinge" angesehen. Während des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, als der Graureiher auch wegen seiner Federn bejagt wurde, führte dies zu einer starken Dezimierung der Population. Trotz heutiger Schutzmaßnahmen sind in manchen Regionen diese alten Vorurteile immer noch präsent. Es existiert eine Art kulturelles Misstrauen gegenüber dem Vogel, das zu Übergriffen führt.
Lebensraumverlust und Stress durch menschliche Aktivitäten
Die zunehmende Urbanisierung und der Verlust von Feuchtgebieten zwingen den Graureiher oft in menschliche Siedlungsbereiche oder in stärker genutzte Gewässer. Dies erhöht nicht nur die Konflikte mit dem Menschen, sondern führt auch zu Stresssituationen für den Vogel. Illegale Methoden, wie das Zerstören von Brutplätzen oder das Vergrämen der Tiere, werden manchmal eingesetzt, um die Reiher von diesen Gebieten fernzuhalten. Diese Taten führen indirekt zu Tötungsdelikten, da der Reiher dann gezwungen ist, in unsichere oder unwirtliche Gebiete abzuwandern.
Ethische Überlegungen und Artenschutz
Aus Sicht des Graureihers könnte man argumentieren, dass er sich nur in seinem natürlichen Lebensraum bewegt und auf natürliche Weise jagt. Er könnte sich als Opfer eines Missverständnisses sehen, bei dem der Mensch seine eigenen Interessen über die der Natur stellt. Hier kommen ökologische und ethische Fragestellungen ins Spiel: Ist es gerechtfertigt, ein Tier zu töten oder zu vergiften, weil es seinem natürlichen Instinkt folgt? Immerhin sind Graureiher wichtige Akteure im Ökosystem, die zur Kontrolle von Fischpopulationen und anderen Wasserbewohnern beitragen und somit das ökologische Gleichgewicht erhalten.
Fazit:
Aus der Sicht des Graureihers sind die Menschen jene, die seine natürlichen Lebensräume eingrenzen und ihn als Bedrohung wahrnehmen, obwohl er nur seinen natürlichen Überlebensinstinkten folgt. Illegale Abschüsse, Vergiftungen und Tötungsdelikte beruhen oft auf Missverständnissen und wirtschaftlichen Konflikten, die durch bessere Aufklärung und nachhaltiges Management gelöst werden könnten. Ökologische Gleichgewichte sollten gewahrt werden, um Konflikte zwischen Mensch und Tier zu vermeiden.
In der Aufnahme aus 2024
- getöteter Graureiher
Artenschutz in Franken®
Überlebensräume für Zauneidechse & Co.

Überlebensräume für Zauneidechse & Co.
24/25.09.2024
Bayern. Mit der Neuanlage entsprechender Lebensraumkulissen bemühen wir uns einer möglichst breiten Artenvielfalt die benötigten Strukturen vorzuhalten, um in einer zunehmend vom Menschen geprägten und übernutzen Umwelt überdauern zu können.
Viele Tier- und Pflanzenarten leben bereits viele Millionen Jahre auf diesem Planeten. Der Spezies Mensch ist es nun tatsächlich gelungen diesen Lebensformen den Todesstoß zu versetzen indem sie entweder die Arten direkt oder deren Lebensräume eliminiert.
24/25.09.2024
- Installation der Informationseinheiten abgeschlossen
Bayern. Mit der Neuanlage entsprechender Lebensraumkulissen bemühen wir uns einer möglichst breiten Artenvielfalt die benötigten Strukturen vorzuhalten, um in einer zunehmend vom Menschen geprägten und übernutzen Umwelt überdauern zu können.
Viele Tier- und Pflanzenarten leben bereits viele Millionen Jahre auf diesem Planeten. Der Spezies Mensch ist es nun tatsächlich gelungen diesen Lebensformen den Todesstoß zu versetzen indem sie entweder die Arten direkt oder deren Lebensräume eliminiert.
Der uns nachfolgenden Generation hinterlassen wir, wenn wir noch wenige Jahre so weitermachen wie bisher einen ausgeräumten und lebensfeindlichen Planeten. Der Ansatz zum Klimaschutz darf nicht zulasten der Biodiversität gehen, denn nur wenn beides stimmt, Klima und Artenvielfalt, können wir davon sprechend das es uns gelungen ist, den Planeten Erde für unsere Kinder und Enkelkinder zu erhalten.
In Zusammenarbeit mit dem Betreiber einer Freiflächenfotovoltaikanlage konnten wir in 2024 spezielle Überlebensbereiche für die Leitart Zauneidechse gestalten.
In der Aufnahme
In Zusammenarbeit mit dem Betreiber einer Freiflächenfotovoltaikanlage konnten wir in 2024 spezielle Überlebensbereiche für die Leitart Zauneidechse gestalten.
In der Aufnahme
- Am 20.09.2024 wurde die Installation der Infoeinheiten abgeschlossen, damit wird sichtbar was uns wichtig ist - die Erhaltung und Gestaltung von Überlebensräumen in Sinne uns nachfolgender Generationen!
Artenschutz in Franken®
Die Fleckige Brutwanze (Elasmucha grisea)

Fleckige Brutwanze (Elasmucha grisea)
23/24.09.2024
Ich bin eine kleine Wanze, doch meine Aufgabe ist groß und bedeutend. Man nennt mich Elasmucha grisea, aber die meisten kennen mich als die Fleckige Brutwanze. Ich lebe in den Wäldern, Wiesen und Heckenlandschaften Europas und Nordasiens.
Besonders gerne halte ich mich in der Nähe von Birken, Erlen und Weiden auf, denn diese Bäume bieten mir und meinen Nachkommen Nahrung und Schutz.
23/24.09.2024
- Aus der Sicht der Fleckigen Brutwanze (Elasmucha grisea):
Ich bin eine kleine Wanze, doch meine Aufgabe ist groß und bedeutend. Man nennt mich Elasmucha grisea, aber die meisten kennen mich als die Fleckige Brutwanze. Ich lebe in den Wäldern, Wiesen und Heckenlandschaften Europas und Nordasiens.
Besonders gerne halte ich mich in der Nähe von Birken, Erlen und Weiden auf, denn diese Bäume bieten mir und meinen Nachkommen Nahrung und Schutz.
Meine Farbe hilft mir, mich gut zu tarnen. Mit meinem graubraunen Körper und den unauffälligen Flecken werde ich zwischen Rinden und Blättern leicht übersehen. Doch ich bin nicht nur ein Meister der Tarnung, ich bin auch eine fürsorgliche Mutter – etwas, das bei Insekten nicht oft vorkommt.
Wenn es Zeit wird, meine Eier abzulegen, suche ich mir ein Blatt, vorzugsweise von einer Birke. Dort befestige ich meine kleinen, rundlichen Eier. Mein Mutterinstinkt ist stark: Ich verlasse meine Eier nicht, sondern bleibe bei ihnen und bewache sie. In der Wissenschaft nennt man das Brutpflege – eine Seltenheit unter Wanzen und vielen anderen Insekten. Ich beschütze meine Nachkommen vor Feinden wie Ameisen oder Marienkäferlarven. Diese sind scharf auf die wehrlosen Eier oder später auf meine frisch geschlüpften Nymphen. Ich habe nur meinen Körper und meinen Mut, um sie zu verteidigen. Wenn ein Angreifer kommt, stelle ich mich drohend auf, weite meinen Körper und versuche, ihn durch Abschreckung zu vertreiben. Oft hilft das. Falls nicht, greife ich sogar direkt an.
Meine Brutpflege endet jedoch nicht, wenn die Nymphen schlüpfen. Ich bleibe noch einige Tage bei ihnen, bis sie sich in den ersten Stadien ihrer Entwicklung gefestigt haben. Meine kleinen Nachkommen bleiben in meiner Nähe, und ich führe sie zu den besten Futterquellen. Ihre Hauptnahrung besteht aus Pflanzensäften, die sie aus Blättern und Früchten der Bäume saugen. Ich kann sie zwar nicht ewig begleiten, aber ich sorge zumindest dafür, dass sie einen guten Start ins Leben haben.
Mein Körper ist angepasst an mein Leben als Pflanzensaftsauger. Mein Mundwerkzeug, der Saugrüssel, ist dafür spezialisiert, die Zellwände der Pflanzen zu durchdringen und die nahrhaften Säfte zu saugen. Ich achte darauf, die Wunde so klein wie möglich zu halten, um meine Futterquelle nicht zu schädigen. Doch für die Pflanzen kann meine Anwesenheit und die meiner Jungen manchmal dennoch belastend sein.
Ich bin zwar klein, aber meine Rolle im Ökosystem ist nicht zu unterschätzen. Ich helfe dabei, das Gleichgewicht in den Lebensgemeinschaften der Bäume und Sträucher zu wahren. Und obwohl mein Leben nur kurz ist, ist es geprägt von einer ganz besonderen Aufgabe: der Fürsorge für meine Brut.
Aufnahme von Albert Meier
Wenn es Zeit wird, meine Eier abzulegen, suche ich mir ein Blatt, vorzugsweise von einer Birke. Dort befestige ich meine kleinen, rundlichen Eier. Mein Mutterinstinkt ist stark: Ich verlasse meine Eier nicht, sondern bleibe bei ihnen und bewache sie. In der Wissenschaft nennt man das Brutpflege – eine Seltenheit unter Wanzen und vielen anderen Insekten. Ich beschütze meine Nachkommen vor Feinden wie Ameisen oder Marienkäferlarven. Diese sind scharf auf die wehrlosen Eier oder später auf meine frisch geschlüpften Nymphen. Ich habe nur meinen Körper und meinen Mut, um sie zu verteidigen. Wenn ein Angreifer kommt, stelle ich mich drohend auf, weite meinen Körper und versuche, ihn durch Abschreckung zu vertreiben. Oft hilft das. Falls nicht, greife ich sogar direkt an.
Meine Brutpflege endet jedoch nicht, wenn die Nymphen schlüpfen. Ich bleibe noch einige Tage bei ihnen, bis sie sich in den ersten Stadien ihrer Entwicklung gefestigt haben. Meine kleinen Nachkommen bleiben in meiner Nähe, und ich führe sie zu den besten Futterquellen. Ihre Hauptnahrung besteht aus Pflanzensäften, die sie aus Blättern und Früchten der Bäume saugen. Ich kann sie zwar nicht ewig begleiten, aber ich sorge zumindest dafür, dass sie einen guten Start ins Leben haben.
Mein Körper ist angepasst an mein Leben als Pflanzensaftsauger. Mein Mundwerkzeug, der Saugrüssel, ist dafür spezialisiert, die Zellwände der Pflanzen zu durchdringen und die nahrhaften Säfte zu saugen. Ich achte darauf, die Wunde so klein wie möglich zu halten, um meine Futterquelle nicht zu schädigen. Doch für die Pflanzen kann meine Anwesenheit und die meiner Jungen manchmal dennoch belastend sein.
Ich bin zwar klein, aber meine Rolle im Ökosystem ist nicht zu unterschätzen. Ich helfe dabei, das Gleichgewicht in den Lebensgemeinschaften der Bäume und Sträucher zu wahren. Und obwohl mein Leben nur kurz ist, ist es geprägt von einer ganz besonderen Aufgabe: der Fürsorge für meine Brut.
Aufnahme von Albert Meier
- Fleckige Brutwanze (Elasmucha grisea)
Artenschutz in Franken®
Stele der Biodiversität® - Burgwindheim / Kötsch

Stele der Biodiversität® - Burgwindheim / Kötsch
23/24.09.2024
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das vom Markt Burgwindheim, dem Bayernwerk der Deutschen Postcode Lotterie und der Steuerkanzlei Bauerfeind unterstützt wird.
Kötsch / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen.
Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
23/24.09.2024
- Grafik ... Entwicklung weiter fortgeschritten ...
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das vom Markt Burgwindheim, dem Bayernwerk der Deutschen Postcode Lotterie und der Steuerkanzlei Bauerfeind unterstützt wird.
Kötsch / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen.
Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
Denn wenn (selbst in noch geeigneten Nahrungsstrukturen) keine geeigneten Reproduktionsräume vorhanden sind, ist die Erhaltung der Artenvielfalt gelichfalls zum Scheitern verurteilt.
Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das vom Markt Burgwindheim, dem Bayernwerk der Deutschen Postcode Lotterie und der Steuerkanzlei Bauerfeind unterstützt wird, setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.
In der Aufnahme
Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das vom Markt Burgwindheim, dem Bayernwerk der Deutschen Postcode Lotterie und der Steuerkanzlei Bauerfeind unterstützt wird, setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.
In der Aufnahme
- Am 19.09.2024 ...
Artenschutz in Franken®
Aktueller Ordner:
Archiv
Parallele Themen:
2019-11
2019-10
2019-12
2020-01
2020-02
2020-03
2020-04
2020-05
2020-06
2020-07
2020-08
2020-09
2020-10
2020-11
2020-12
2021-01
2021-02
2021-03
2021-04
2021-05
2021-06
2021-07
2021-08
2021-09
2021-10
2021-11
2021-12
2022-01
2022-02
2022-03
2022-04
2022-05
2022-06
2022-07
2022-08
2022-09
2022-10
2022-11
2022-12
2023-01
2023-02
2023-03
2023-04
2023-05
2023-06
2023-07
2023-08
2023-09
2023-10
2023-11
2023-12
2024-01
2024-02
2024-03
2024-04
2024-05
2024-06
2024-07
2024-08
2024-09
2024-10
2024-11
2024-12
2025-01
2025-02
2025-03
2025-04
2025-05
2025-06
2025-07
2025-08
2025-09
2025-10
2025-11
2025-12
















