Braune Schmuckwanze (Closterotomus fulvomaculatus)

Braune Schmuckwanze (Closterotomus fulvomaculatus)
20/21.05.2024
Die Braune Schmuckwanze, wissenschaftlich bekannt als Closterotomus fulvomaculatus, ist eine Insektenart aus der Familie der Weichwanzen (Miridae). Diese Wanze ist in Europa weit verbreitet und kommt in verschiedenen Lebensräumen vor, von Wäldern bis zu Gärten und landwirtschaftlich genutzten Flächen.
Beschreibung und Merkmale
Die Braune Schmuckwanze ist relativ klein, mit einer Körperlänge von etwa 5 bis 7 Millimetern. Ihr Körper ist schlank und länglich, überwiegend braun gefärbt mit gelblich-braunen Flecken, die ihr ein charakteristisches Aussehen verleihen. Die Wanzen haben lange, dünne Beine und Fühler, die ihnen ein graziles Erscheinungsbild geben. Die Flügel sind gut entwickelt und ermöglichen den Wanzen das Fliegen.
20/21.05.2024
Die Braune Schmuckwanze, wissenschaftlich bekannt als Closterotomus fulvomaculatus, ist eine Insektenart aus der Familie der Weichwanzen (Miridae). Diese Wanze ist in Europa weit verbreitet und kommt in verschiedenen Lebensräumen vor, von Wäldern bis zu Gärten und landwirtschaftlich genutzten Flächen.
Beschreibung und Merkmale
Die Braune Schmuckwanze ist relativ klein, mit einer Körperlänge von etwa 5 bis 7 Millimetern. Ihr Körper ist schlank und länglich, überwiegend braun gefärbt mit gelblich-braunen Flecken, die ihr ein charakteristisches Aussehen verleihen. Die Wanzen haben lange, dünne Beine und Fühler, die ihnen ein graziles Erscheinungsbild geben. Die Flügel sind gut entwickelt und ermöglichen den Wanzen das Fliegen.
Lebensweise und Ernährung
Closterotomus fulvomaculatus ist phytophag, das heißt, sie ernährt sich hauptsächlich von Pflanzensäften. Sie bevorzugt eine Vielzahl von Pflanzen, darunter sowohl krautige Pflanzen als auch Sträucher und Bäume. Die Wanze sticht mit ihrem Stechrüssel in die Pflanzengewebe und saugt die Säfte heraus. Zu ihren bevorzugten Pflanzen gehören verschiedene Arten von Kreuzblütlern (Brassicaceae), Klee (Trifolium) und andere krautige Pflanzen.
Fortpflanzung und Entwicklung
Die Braune Schmuckwanze durchläuft eine unvollständige Metamorphose. Dies bedeutet, dass sie kein Puppenstadium hat, sondern direkt von der Larve zum erwachsenen Insekt wird. Die Weibchen legen ihre Eier auf Pflanzen ab, aus denen nach einiger Zeit die Larven schlüpfen. Diese durchlaufen mehrere Häutungen, bevor sie das adulte Stadium erreichen. Die Entwicklungszeit kann je nach Temperatur und Nahrungsangebot variieren.
Verbreitung und Habitat
Die Braune Schmuckwanze ist in ganz Europa verbreitet und findet sich in verschiedenen Lebensräumen, darunter Wälder, Wiesen, Gärten und landwirtschaftlich genutzte Flächen. Sie ist anpassungsfähig und kann in verschiedenen klimatischen Bedingungen überleben.
Bedeutung für die Landwirtschaft
In der Landwirtschaft kann Closterotomus fulvomaculatus sowohl als Schädling als auch als Nützling betrachtet werden. Auf der einen Seite kann sie durch das Saugen an Kulturpflanzen Schäden verursachen, was zu Ertragsverlusten führt. Besonders betroffen sind oft Gemüsearten und Zierpflanzen. Auf der anderen Seite spielt sie eine Rolle im ökologischen Gleichgewicht, indem sie Unkrautpflanzen schwächt und als Teil des Nahrungsnetzes anderen Tieren als Nahrung dient.
Bekämpfung und Management
Um Schäden durch die Braune Schmuckwanze in der Landwirtschaft zu minimieren, können verschiedene Maßnahmen ergriffen werden. Eine Möglichkeit ist der Einsatz von Insektiziden, jedoch sollte dies mit Bedacht geschehen, um nützliche Insekten nicht zu gefährden. Alternativ können auch biologische Bekämpfungsmethoden zum Einsatz kommen, wie der Einsatz von natürlichen Feinden der Wanze. Zudem können durch Kulturtechniken wie Fruchtwechsel und das Anpflanzen resistenter Pflanzensorten die Populationen der Wanzen reduziert werden.
Fazit
Die Braune Schmuckwanze (Closterotomus fulvomaculatus) ist ein weit verbreitetes Insekt mit einer vielfältigen Ernährungsweise und Anpassungsfähigkeit an verschiedene Lebensräume. Während sie in der Landwirtschaft Schäden verursachen kann, spielt sie auch eine wichtige Rolle im ökologischen Gleichgewicht. Ein ausgewogenes Management und der Einsatz ökologisch verträglicher Maßnahmen sind entscheidend, um negative Auswirkungen zu minimieren und gleichzeitig die Biodiversität zu fördern.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
Closterotomus fulvomaculatus ist phytophag, das heißt, sie ernährt sich hauptsächlich von Pflanzensäften. Sie bevorzugt eine Vielzahl von Pflanzen, darunter sowohl krautige Pflanzen als auch Sträucher und Bäume. Die Wanze sticht mit ihrem Stechrüssel in die Pflanzengewebe und saugt die Säfte heraus. Zu ihren bevorzugten Pflanzen gehören verschiedene Arten von Kreuzblütlern (Brassicaceae), Klee (Trifolium) und andere krautige Pflanzen.
Fortpflanzung und Entwicklung
Die Braune Schmuckwanze durchläuft eine unvollständige Metamorphose. Dies bedeutet, dass sie kein Puppenstadium hat, sondern direkt von der Larve zum erwachsenen Insekt wird. Die Weibchen legen ihre Eier auf Pflanzen ab, aus denen nach einiger Zeit die Larven schlüpfen. Diese durchlaufen mehrere Häutungen, bevor sie das adulte Stadium erreichen. Die Entwicklungszeit kann je nach Temperatur und Nahrungsangebot variieren.
Verbreitung und Habitat
Die Braune Schmuckwanze ist in ganz Europa verbreitet und findet sich in verschiedenen Lebensräumen, darunter Wälder, Wiesen, Gärten und landwirtschaftlich genutzte Flächen. Sie ist anpassungsfähig und kann in verschiedenen klimatischen Bedingungen überleben.
Bedeutung für die Landwirtschaft
In der Landwirtschaft kann Closterotomus fulvomaculatus sowohl als Schädling als auch als Nützling betrachtet werden. Auf der einen Seite kann sie durch das Saugen an Kulturpflanzen Schäden verursachen, was zu Ertragsverlusten führt. Besonders betroffen sind oft Gemüsearten und Zierpflanzen. Auf der anderen Seite spielt sie eine Rolle im ökologischen Gleichgewicht, indem sie Unkrautpflanzen schwächt und als Teil des Nahrungsnetzes anderen Tieren als Nahrung dient.
Bekämpfung und Management
Um Schäden durch die Braune Schmuckwanze in der Landwirtschaft zu minimieren, können verschiedene Maßnahmen ergriffen werden. Eine Möglichkeit ist der Einsatz von Insektiziden, jedoch sollte dies mit Bedacht geschehen, um nützliche Insekten nicht zu gefährden. Alternativ können auch biologische Bekämpfungsmethoden zum Einsatz kommen, wie der Einsatz von natürlichen Feinden der Wanze. Zudem können durch Kulturtechniken wie Fruchtwechsel und das Anpflanzen resistenter Pflanzensorten die Populationen der Wanzen reduziert werden.
Fazit
Die Braune Schmuckwanze (Closterotomus fulvomaculatus) ist ein weit verbreitetes Insekt mit einer vielfältigen Ernährungsweise und Anpassungsfähigkeit an verschiedene Lebensräume. Während sie in der Landwirtschaft Schäden verursachen kann, spielt sie auch eine wichtige Rolle im ökologischen Gleichgewicht. Ein ausgewogenes Management und der Einsatz ökologisch verträglicher Maßnahmen sind entscheidend, um negative Auswirkungen zu minimieren und gleichzeitig die Biodiversität zu fördern.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- letzes Nymphenstadium
Artenschutz in Franken®
Stele der Biodiversität® - Rosendahl / GT - Höven

Stele der Biodiversität® - Rosendahl / GT - Höven
20/21.05.2024
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutzes in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das von der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.
Rosendahl / Nordrhein - Westfalen. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen, kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen.
Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
20/21.05.2024
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutzes in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das von der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.
Rosendahl / Nordrhein - Westfalen. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen, kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen.
Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
In der Aufnahme
... Am 17.05.2024 zeigen sich die grafischen Arbeiten trotz einer "eingeschränkten" Witterung im Entwicklungskorridor ...
Artenschutz in Franken®
Blaumeise ... 4kids
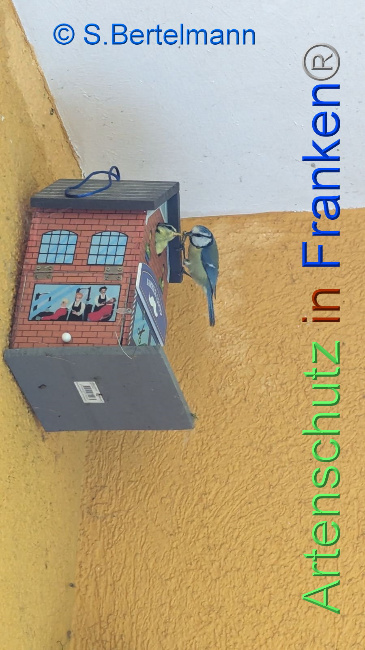
Die Blaumeise ist ein kleiner, bunter Vogel, der in vielen Teilen Europas lebt.
20/21.05.2024
Hier sind einige spannende Dinge über die Blaumeise:
Aussehen
Die Blaumeise ist ein kleiner Vogel, etwa so groß wie ein Apfel. Sie hat leuchtend blaue Federn auf dem Kopf, den Flügeln und dem Schwanz. Ihr Gesicht ist weiß mit einer schwarzen Linie, die wie eine Augenmaske aussieht. Ihr Bauch ist gelb, und der Rücken ist grünlich.
20/21.05.2024
- Sie ist leicht zu erkennen, weil sie so schön bunt ist.
Hier sind einige spannende Dinge über die Blaumeise:
Aussehen
Die Blaumeise ist ein kleiner Vogel, etwa so groß wie ein Apfel. Sie hat leuchtend blaue Federn auf dem Kopf, den Flügeln und dem Schwanz. Ihr Gesicht ist weiß mit einer schwarzen Linie, die wie eine Augenmaske aussieht. Ihr Bauch ist gelb, und der Rücken ist grünlich.
Lebensraum
Blaumeisen leben gerne in Wäldern, Parks und Gärten. Sie mögen besonders Orte, wo es viele Bäume gibt. Man kann sie oft in der Nähe von Häusern sehen, weil sie gerne in Nistkästen brüten, die Menschen aufhängen.
Nahrung
Diese Vögel fressen vor allem kleine Insekten und Spinnen. Im Winter, wenn es weniger Insekten gibt, fressen sie auch Samen und Nüsse. Manchmal besuchen sie Futterhäuschen in Gärten, wo Menschen ihnen Sonnenblumenkerne und Erdnüsse anbieten.
Verhalten
Blaumeisen sind sehr geschickte Kletterer. Sie können kopfüber an Ästen hängen und sogar an Baumstämmen hoch- und runterlaufen. Sie sind neugierige Vögel und oft sehr mutig, kommen manchmal ganz nah an Menschen heran.
Fortpflanzung
Im Frühling baut die Blaumeise ein Nest. Das Nest besteht aus Moos, Gras und Federn und wird oft in einem Baumloch oder einem Nistkasten gebaut. Die Weibchen legen etwa 8 bis 12 Eier, die weiß mit kleinen roten Flecken sind. Nach etwa zwei Wochen schlüpfen die Küken, und beide Elternteile füttern sie mit Insekten, bis sie flügge werden und selbst fliegen können.
Gesang
Die Blaumeise singt oft, besonders im Frühling. Ihr Gesang ist fröhlich und klingt wie "tsee-tsee-tsee". Sie benutzt ihren Gesang, um ein Revier zu markieren und um einen Partner zu finden.
Schutz
Obwohl die Blaumeise ein häufiger Vogel ist, kann sie durch den Verlust von Lebensraum und Nahrungsmangel bedroht sein. Man kann helfen, indem man Nistkästen aufhängt und Futter bereitstellt, besonders im Winter.
Interessante Fakten
Blaumeisen sind sehr intelligent und haben gelernt, wie man an Futter kommt, das in schwierigen Behältern versteckt ist.Sie haben spezielle Schuppen an ihren Füßen, die ihnen helfen, an glatten Oberflächen festzuhalten.
Die Blaumeise ist also ein faszinierender kleiner Vogel, der viel Farbe und Freude in unsere Gärten bringt! Wenn du das nächste Mal eine siehst, schau genau hin – vielleicht entdeckst du etwas Neues über diesen hübschen Vogel.
In der Aufnahme
Blaumeisen leben gerne in Wäldern, Parks und Gärten. Sie mögen besonders Orte, wo es viele Bäume gibt. Man kann sie oft in der Nähe von Häusern sehen, weil sie gerne in Nistkästen brüten, die Menschen aufhängen.
Nahrung
Diese Vögel fressen vor allem kleine Insekten und Spinnen. Im Winter, wenn es weniger Insekten gibt, fressen sie auch Samen und Nüsse. Manchmal besuchen sie Futterhäuschen in Gärten, wo Menschen ihnen Sonnenblumenkerne und Erdnüsse anbieten.
Verhalten
Blaumeisen sind sehr geschickte Kletterer. Sie können kopfüber an Ästen hängen und sogar an Baumstämmen hoch- und runterlaufen. Sie sind neugierige Vögel und oft sehr mutig, kommen manchmal ganz nah an Menschen heran.
Fortpflanzung
Im Frühling baut die Blaumeise ein Nest. Das Nest besteht aus Moos, Gras und Federn und wird oft in einem Baumloch oder einem Nistkasten gebaut. Die Weibchen legen etwa 8 bis 12 Eier, die weiß mit kleinen roten Flecken sind. Nach etwa zwei Wochen schlüpfen die Küken, und beide Elternteile füttern sie mit Insekten, bis sie flügge werden und selbst fliegen können.
Gesang
Die Blaumeise singt oft, besonders im Frühling. Ihr Gesang ist fröhlich und klingt wie "tsee-tsee-tsee". Sie benutzt ihren Gesang, um ein Revier zu markieren und um einen Partner zu finden.
Schutz
Obwohl die Blaumeise ein häufiger Vogel ist, kann sie durch den Verlust von Lebensraum und Nahrungsmangel bedroht sein. Man kann helfen, indem man Nistkästen aufhängt und Futter bereitstellt, besonders im Winter.
Interessante Fakten
Blaumeisen sind sehr intelligent und haben gelernt, wie man an Futter kommt, das in schwierigen Behältern versteckt ist.Sie haben spezielle Schuppen an ihren Füßen, die ihnen helfen, an glatten Oberflächen festzuhalten.
Die Blaumeise ist also ein faszinierender kleiner Vogel, der viel Farbe und Freude in unsere Gärten bringt! Wenn du das nächste Mal eine siehst, schau genau hin – vielleicht entdeckst du etwas Neues über diesen hübschen Vogel.
In der Aufnahme
- Platz ist in der kleinsten "Hütte" ... in den Aufnahmen von S. Bertelmann erkennen wir das Füttern der Jungvögel durch die Alttiere ... das "Vogelhäuschen" diente eigentlich einem optischen Zweck wurde jedoch dann unvermittelt, jedoch nachhaltig von Blaumeisen beflogen und bebrütet .. 3 Jungvögel ist es in 2024 gelungen hier erfolgreich auszufliegen ...
Artenschutz in Franken®
Mauerfuchs (Lasiommata megera)

Der Mauerfuchs (Lasiommata megera) ist ein Schmetterling aus der Familie der Edelfalter (Nymphalidae), der in Europa weit verbreitet ist.
19/20.05.2024
Aussehen
Der Mauerfuchs hat eine Flügelspannweite von etwa 4-5 Zentimetern. Die Oberseite seiner Flügel ist orange-braun gefärbt und weist dunkle Flecken sowie eine gewellte schwarze Linie entlang des Flügelaußenrandes auf. Die Unterseite der Flügel ist heller und hat eine feinere Musterung, die ihm eine gute Tarnung bietet, wenn er auf trockenem Laub oder auf Steinen ruht.
19/20.05.2024
- Hier sind einige Informationen über diesen schönen Schmetterling:
Aussehen
Der Mauerfuchs hat eine Flügelspannweite von etwa 4-5 Zentimetern. Die Oberseite seiner Flügel ist orange-braun gefärbt und weist dunkle Flecken sowie eine gewellte schwarze Linie entlang des Flügelaußenrandes auf. Die Unterseite der Flügel ist heller und hat eine feinere Musterung, die ihm eine gute Tarnung bietet, wenn er auf trockenem Laub oder auf Steinen ruht.
Lebensraum und Verbreitung
Der Mauerfuchs ist in einer Vielzahl von Lebensräumen anzutreffen, darunter trockene Graslandschaften, Lichtungen, Weg- und Waldränder sowie Gärten und Parks. Er ist in ganz Europa verbreitet und kommt auch in Teilen Nordafrikas und Asiens vor.
Verhalten und Ernährung
Als Tagfalter ist der Mauerfuchs aktiv, wenn die Sonne scheint. Er ernährt sich hauptsächlich von Nektar verschiedener Blütenpflanzen, darunter Disteln, Schmetterlingsflieder, Klee und andere. Die Raupen des Mauerfuchses ernähren sich von verschiedenen Gräsern.
Fortpflanzung
Die Weibchen legen ihre Eier einzeln an den Blättern von Gräsern ab. Die Raupen schlüpfen nach etwa zwei Wochen und verbringen die meiste Zeit ihres Lebens am Boden, wo sie sich von Gräsern ernähren. Nach mehreren Häutungen verpuppen sie sich und entwickeln sich zu erwachsenen Schmetterlingen.
Zugverhalten
Der Mauerfuchs ist ein Standschmetterling in den wärmeren Teilen seines Verbreitungsgebiets, aber in den kälteren Regionen kann er wandern oder migrieren, um günstigere Lebensbedingungen zu finden.
Schutzstatus
Der Mauerfuchs gilt aktuell als nicht gefährdet, obwohl wie bei vielen anderen Schmetterlingsarten auch der Verlust von Lebensräumen und die Intensivierung der Landwirtschaft potenzielle Bedrohungen darstellen können.
Zusammenfassend ist der Mauerfuchs ein weit verbreiteter und hübscher Schmetterling, der in verschiedenen Lebensräumen anzutreffen ist. Sein auffälliges Aussehen und sein Verhalten machen ihn zu einem beliebten Ziel für Schmetterlingsbeobachter und Naturliebhaber.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
Der Mauerfuchs ist in einer Vielzahl von Lebensräumen anzutreffen, darunter trockene Graslandschaften, Lichtungen, Weg- und Waldränder sowie Gärten und Parks. Er ist in ganz Europa verbreitet und kommt auch in Teilen Nordafrikas und Asiens vor.
Verhalten und Ernährung
Als Tagfalter ist der Mauerfuchs aktiv, wenn die Sonne scheint. Er ernährt sich hauptsächlich von Nektar verschiedener Blütenpflanzen, darunter Disteln, Schmetterlingsflieder, Klee und andere. Die Raupen des Mauerfuchses ernähren sich von verschiedenen Gräsern.
Fortpflanzung
Die Weibchen legen ihre Eier einzeln an den Blättern von Gräsern ab. Die Raupen schlüpfen nach etwa zwei Wochen und verbringen die meiste Zeit ihres Lebens am Boden, wo sie sich von Gräsern ernähren. Nach mehreren Häutungen verpuppen sie sich und entwickeln sich zu erwachsenen Schmetterlingen.
Zugverhalten
Der Mauerfuchs ist ein Standschmetterling in den wärmeren Teilen seines Verbreitungsgebiets, aber in den kälteren Regionen kann er wandern oder migrieren, um günstigere Lebensbedingungen zu finden.
Schutzstatus
Der Mauerfuchs gilt aktuell als nicht gefährdet, obwohl wie bei vielen anderen Schmetterlingsarten auch der Verlust von Lebensräumen und die Intensivierung der Landwirtschaft potenzielle Bedrohungen darstellen können.
Zusammenfassend ist der Mauerfuchs ein weit verbreiteter und hübscher Schmetterling, der in verschiedenen Lebensräumen anzutreffen ist. Sein auffälliges Aussehen und sein Verhalten machen ihn zu einem beliebten Ziel für Schmetterlingsbeobachter und Naturliebhaber.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
- Ansitzender Mauerfuchs
Artenschutz in Franken®
Die Wilden Bienchen von Weeze

Die Wilden Bienchen von Weeze
19/20.05.2024
Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und der Stadt Weeze das von der Deutschen Postcode Lotterie und von LIKK (Landschaftsschutz im Kreis Kleve unterstützt wird.
Wildbienen - die unbekannten Bestäuber
Eigentlich haben die meisten von uns in ihrem Leben schon einmal Wildbienen gesehen. Doch bewusst als solche wahrgenommen werden diese Tiere kaum. Vielfach werden sie gar mit Wespen oder Fliegen verwechselt. Und hier zeigt sich auch bereits ein elementares Problem. Aufgrund einer weitverbreiteten Unkenntnis werden „die Wildbiene“ und deren Ansprüche an ihre Lebensräume nicht erkannt.
19/20.05.2024
- Erster Flächen Pflegeeinsatz
Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und der Stadt Weeze das von der Deutschen Postcode Lotterie und von LIKK (Landschaftsschutz im Kreis Kleve unterstützt wird.
Wildbienen - die unbekannten Bestäuber
Eigentlich haben die meisten von uns in ihrem Leben schon einmal Wildbienen gesehen. Doch bewusst als solche wahrgenommen werden diese Tiere kaum. Vielfach werden sie gar mit Wespen oder Fliegen verwechselt. Und hier zeigt sich auch bereits ein elementares Problem. Aufgrund einer weitverbreiteten Unkenntnis werden „die Wildbiene“ und deren Ansprüche an ihre Lebensräume nicht erkannt.
Wildbienen - für uns Menschen ungemein wichtig
Wir Menschen sind darauf angewiesen, dass unsere (Kultur) -Pflanzen bestäubt werden. Wildbienen spielen hierbei eine weitaus größere Rolle als bislang angenommen. Doch Wildbienen sichern nicht nur die Ernteerträge in der Landwirtschaft. Da sie häufig in enger Symbiose mit „ihrer Wildpflanze“ leben, sichern die kleinen Insekten auch das Überleben zahlloser Wildpflanzen.
In der Aufnahme von U.Francken
Wir Menschen sind darauf angewiesen, dass unsere (Kultur) -Pflanzen bestäubt werden. Wildbienen spielen hierbei eine weitaus größere Rolle als bislang angenommen. Doch Wildbienen sichern nicht nur die Ernteerträge in der Landwirtschaft. Da sie häufig in enger Symbiose mit „ihrer Wildpflanze“ leben, sichern die kleinen Insekten auch das Überleben zahlloser Wildpflanzen.
In der Aufnahme von U.Francken
- .. einen ersten Pflegeeinsatz auf den Streuobstflächen leisten wir im Mai 2024 ... dabei wurden gezielt Rückzugsbereiche stehen gelassen, um Insekten einen temporären Lebensraum zuzugestehen ... ür die breite Öffentlichkeit dient dieser Bereich als Anschauungsobjekt ...
Artenschutz in Franken®
Stele der Biodiversität® - Rosendahl / GT - Höven

Stele der Biodiversität® - Rosendahl / GT - Höven
19/20.05.2024
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutzes in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das von der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.
Rosendahl / Nordrhein - Westfalen. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen, kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen.
Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
19/20.05.2024
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutzes in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das von der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.
Rosendahl / Nordrhein - Westfalen. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen, kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen.
Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
In der Aufnahme
... Am 16.05.2024 fanden sich die Abschlussarbeiten zur Installation der Sekundärhabitate und der Informationseinheiten ...
Artenschutz in Franken®
Stele der Biodiversität® - Rosendahl / GT - Höven

Stele der Biodiversität® - Rosendahl / GT - Höven
18/19.05.2024
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutzes in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das von der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.
Rosendahl / Nordrhein - Westfalen. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen, kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen.
Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
18/19.05.2024
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutzes in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das von der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.
Rosendahl / Nordrhein - Westfalen. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen, kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen.
Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
In der Aufnahme
... Impressionen vom 16.05.2024 ...
Artenschutz in Franken®
Zottiger Bienenkäfer

Der Zottige Bienenkäfer (Trichodes alvearius)
18/19.05.2024
Dieser Käfer ist in Europa verbreitet und bekannt für seine auffällige Färbung und sein interessantes Lebenszyklusverhalten.
Im Folgenden wird eine detaillierte Beschreibung des Käfers, seines Lebensraums, seiner Lebensweise und seiner ökologischen Bedeutung gegeben.
18/19.05.2024
- Der Zottige Bienenkäfer (Trichodes alvearius) ist ein auffälliges Insekt aus der Familie der Buntkäfer (Cleridae).
Dieser Käfer ist in Europa verbreitet und bekannt für seine auffällige Färbung und sein interessantes Lebenszyklusverhalten.
Im Folgenden wird eine detaillierte Beschreibung des Käfers, seines Lebensraums, seiner Lebensweise und seiner ökologischen Bedeutung gegeben.
Beschreibung
Der Zottige Bienenkäfer ist etwa 8 bis 15 Millimeter lang. Sein Körper ist länglich und robust, mit einer auffälligen Färbung, die ihn leicht erkennbar macht. Der Kopf und der vordere Teil des Körpers (Thorax) sind schwarz, während die Flügeldecken (Elytren) leuchtend rot mit schwarzen Querbinden sind. Diese Warnfärbung dient der Abschreckung von Fressfeinden. Die Beine und Fühler sind ebenfalls schwarz, wobei die Fühler keulenförmig verdickt sind.
Verbreitung und Lebensraum
Trichodes alvearius ist in weiten Teilen Europas verbreitet, von Südskandinavien bis zum Mittelmeerraum. Der Käfer bevorzugt warme, sonnige Lebensräume wie Wiesen, Waldränder und Böschungen. Er ist oft auf blühenden Pflanzen zu finden, insbesondere auf Doldenblütlern (Apiaceae) und Korbblütlern (Asteraceae), wo er nach Nektar und Pollen sucht.
Lebensweise und Verhalten
Der Zottige Bienenkäfer ist ein tagaktives Insekt und zeichnet sich durch sein spezifisches Entwicklungsstadium aus. Die adulten Käfer sind von Mai bis Juli aktiv. Sie ernähren sich von Nektar und Pollen, aber auch von kleinen Insekten, die sie auf Blüten finden. Ein bemerkenswerter Aspekt ihres Lebenszyklus ist die Larvalentwicklung. Die Weibchen legen ihre Eier in die Nester von Wildbienen (oft aus der Familie der Apidae) ab. Die geschlüpften Larven sind räuberisch und ernähren sich von den Larven und Vorräten der Bienen. Diese Art der Brutparasitismus ist als Kleptoparasitismus bekannt.
Ökologische Bedeutung
Der Zottige Bienenkäfer spielt eine Rolle im ökologischen Gleichgewicht seines Lebensraums. Durch die Prädation der Bienenlarven kann er die Populationen von Wildbienen regulieren. Gleichzeitig kann er durch die Bestäubung von Blütenpflanzen zur Pflanzenvermehrung beitragen. Die Wechselwirkungen zwischen dem Käfer und den Wildbienen sind komplex und zeigen die vielfältigen Beziehungen in Ökosystemen.
Bedrohungen und Schutz
Wie viele Insektenarten ist auch der Zottige Bienenkäfer von Lebensraumverlust betroffen. Intensive Landwirtschaft, der Einsatz von Pestiziden und die Zerstörung von natürlichen Lebensräumen bedrohen seine Populationen. Der Erhalt von blütenreichen Wiesen und Waldrändern sowie der Schutz von Wildbienen und ihren Nistplätzen sind wichtige Maßnahmen zum Schutz des Zottigen Bienenkäfers.
Schlussfolgerung
Der Zottige Bienenkäfer (Trichodes alvearius) ist ein faszinierendes Beispiel für die Vielfalt und Komplexität der Insektenwelt. Seine auffällige Färbung und sein interessanter Lebenszyklus machen ihn zu einem wichtigen Bestandteil der Ökosysteme, in denen er lebt. Der Schutz seines Lebensraums und seiner Wirtsarten ist entscheidend für das Überleben dieser interessanten Art.
Aufnahme von Bernhard Schmalisch
Der Zottige Bienenkäfer ist etwa 8 bis 15 Millimeter lang. Sein Körper ist länglich und robust, mit einer auffälligen Färbung, die ihn leicht erkennbar macht. Der Kopf und der vordere Teil des Körpers (Thorax) sind schwarz, während die Flügeldecken (Elytren) leuchtend rot mit schwarzen Querbinden sind. Diese Warnfärbung dient der Abschreckung von Fressfeinden. Die Beine und Fühler sind ebenfalls schwarz, wobei die Fühler keulenförmig verdickt sind.
Verbreitung und Lebensraum
Trichodes alvearius ist in weiten Teilen Europas verbreitet, von Südskandinavien bis zum Mittelmeerraum. Der Käfer bevorzugt warme, sonnige Lebensräume wie Wiesen, Waldränder und Böschungen. Er ist oft auf blühenden Pflanzen zu finden, insbesondere auf Doldenblütlern (Apiaceae) und Korbblütlern (Asteraceae), wo er nach Nektar und Pollen sucht.
Lebensweise und Verhalten
Der Zottige Bienenkäfer ist ein tagaktives Insekt und zeichnet sich durch sein spezifisches Entwicklungsstadium aus. Die adulten Käfer sind von Mai bis Juli aktiv. Sie ernähren sich von Nektar und Pollen, aber auch von kleinen Insekten, die sie auf Blüten finden. Ein bemerkenswerter Aspekt ihres Lebenszyklus ist die Larvalentwicklung. Die Weibchen legen ihre Eier in die Nester von Wildbienen (oft aus der Familie der Apidae) ab. Die geschlüpften Larven sind räuberisch und ernähren sich von den Larven und Vorräten der Bienen. Diese Art der Brutparasitismus ist als Kleptoparasitismus bekannt.
Ökologische Bedeutung
Der Zottige Bienenkäfer spielt eine Rolle im ökologischen Gleichgewicht seines Lebensraums. Durch die Prädation der Bienenlarven kann er die Populationen von Wildbienen regulieren. Gleichzeitig kann er durch die Bestäubung von Blütenpflanzen zur Pflanzenvermehrung beitragen. Die Wechselwirkungen zwischen dem Käfer und den Wildbienen sind komplex und zeigen die vielfältigen Beziehungen in Ökosystemen.
Bedrohungen und Schutz
Wie viele Insektenarten ist auch der Zottige Bienenkäfer von Lebensraumverlust betroffen. Intensive Landwirtschaft, der Einsatz von Pestiziden und die Zerstörung von natürlichen Lebensräumen bedrohen seine Populationen. Der Erhalt von blütenreichen Wiesen und Waldrändern sowie der Schutz von Wildbienen und ihren Nistplätzen sind wichtige Maßnahmen zum Schutz des Zottigen Bienenkäfers.
Schlussfolgerung
Der Zottige Bienenkäfer (Trichodes alvearius) ist ein faszinierendes Beispiel für die Vielfalt und Komplexität der Insektenwelt. Seine auffällige Färbung und sein interessanter Lebenszyklus machen ihn zu einem wichtigen Bestandteil der Ökosysteme, in denen er lebt. Der Schutz seines Lebensraums und seiner Wirtsarten ist entscheidend für das Überleben dieser interessanten Art.
Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- Zottiger Bienenkäfer
Artenschutz in Franken®
Glänzender Blütenprachtkäfer (Anthaxia nitidula)

Der Glänzende Blütenprachtkäfer (Anthaxia nitidula) ist ein auffälliger Käfer aus der Familie der Prachtkäfer (Buprestidae). Diese Familie zeichnet sich durch ihre oft metallisch glänzende und bunt schillernde Färbung aus.
18/19.05.2024
Aussehen
Der Glänzende Blütenprachtkäfer erreicht eine Länge von etwa 6 bis 8 Millimetern. Sein Körper ist abgeflacht und hat eine typische ovale Form. Der Käfer ist für seine metallisch glänzende Färbung bekannt, die meist grünlich, kupferfarben oder golden erscheint. Diese schillernde Färbung wird durch die Mikrostruktur der Flügeldecken verursacht, die das Licht in verschiedene Richtungen reflektiert.
18/19.05.2024
- Hier haben wir einige Informationen über den Glänzenden Blütenprachtkäfer für SIe zusammengefasst:
Aussehen
Der Glänzende Blütenprachtkäfer erreicht eine Länge von etwa 6 bis 8 Millimetern. Sein Körper ist abgeflacht und hat eine typische ovale Form. Der Käfer ist für seine metallisch glänzende Färbung bekannt, die meist grünlich, kupferfarben oder golden erscheint. Diese schillernde Färbung wird durch die Mikrostruktur der Flügeldecken verursacht, die das Licht in verschiedene Richtungen reflektiert.
Lebensraum und Verbreitung
Anthaxia nitidula ist in weiten Teilen Europas verbreitet und kommt auch in Teilen Nordafrikas und Asiens vor. Der Käfer bevorzugt warme und sonnige Lebensräume, wie z.B. Waldränder, Lichtungen und Gärten. Er ist häufig auf blühenden Pflanzen zu finden, insbesondere auf Doldenblütlern (Apiaceae), wo er nach Nektar und Pollen sucht.
Lebensweise und Verhalten
Die Larven des Glänzenden Blütenprachtkäfers entwickeln sich in totem oder geschwächtem Holz von Laubbäumen, insbesondere von Eichen (Quercus), Weiden (Salix) und Pappeln (Populus). Die Larven bohren sich in das Holz und ernähren sich vom Holzgewebe. Die Entwicklung der Larven kann mehrere Jahre dauern, bis sie sich verpuppen und als erwachsene Käfer schlüpfen. Die erwachsenen Käfer sind meist von Mai bis August aktiv. Sie sind tagaktiv und besuchen häufig Blüten, um sich zu ernähren. Dabei spielen sie auch eine Rolle bei der Bestäubung.
Ökologische Bedeutung
Wie viele Prachtkäferarten spielt der Glänzende Blütenprachtkäfer eine Rolle im Ökosystem, insbesondere bei der Zersetzung von totem Holz, wodurch Nährstoffe wieder dem Boden zugeführt werden. Auch als Bestäuber trägt er zur Pflanzenvermehrung bei.
Bedrohungen und Schutz
Der Glänzende Blütenprachtkäfer ist in einigen Regionen aufgrund von Habitatverlust durch Forstwirtschaft und städtische Entwicklung bedroht. Der Rückgang von alten Laubwäldern und totem Holz hat negative Auswirkungen auf seine Populationen. Schutzmaßnahmen beinhalten den Erhalt von totem Holz in Wäldern und Parks sowie die Förderung von naturnahen Gärten, die blühende Pflanzen beherbergen.
Zusammenfassung
Der Glänzende Blütenprachtkäfer (Anthaxia nitidula) ist ein kleiner, aber beeindruckend gefärbter Käfer, der in warmen, sonnenbeschienenen Lebensräumen Europas vorkommt. Mit seiner Rolle in der Zersetzung von totem Holz und der Bestäubung trägt er zu wichtigen ökologischen Prozessen bei. Der Schutz seines Lebensraums ist entscheidend für das Überleben dieser faszinierenden Art.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
Anthaxia nitidula ist in weiten Teilen Europas verbreitet und kommt auch in Teilen Nordafrikas und Asiens vor. Der Käfer bevorzugt warme und sonnige Lebensräume, wie z.B. Waldränder, Lichtungen und Gärten. Er ist häufig auf blühenden Pflanzen zu finden, insbesondere auf Doldenblütlern (Apiaceae), wo er nach Nektar und Pollen sucht.
Lebensweise und Verhalten
Die Larven des Glänzenden Blütenprachtkäfers entwickeln sich in totem oder geschwächtem Holz von Laubbäumen, insbesondere von Eichen (Quercus), Weiden (Salix) und Pappeln (Populus). Die Larven bohren sich in das Holz und ernähren sich vom Holzgewebe. Die Entwicklung der Larven kann mehrere Jahre dauern, bis sie sich verpuppen und als erwachsene Käfer schlüpfen. Die erwachsenen Käfer sind meist von Mai bis August aktiv. Sie sind tagaktiv und besuchen häufig Blüten, um sich zu ernähren. Dabei spielen sie auch eine Rolle bei der Bestäubung.
Ökologische Bedeutung
Wie viele Prachtkäferarten spielt der Glänzende Blütenprachtkäfer eine Rolle im Ökosystem, insbesondere bei der Zersetzung von totem Holz, wodurch Nährstoffe wieder dem Boden zugeführt werden. Auch als Bestäuber trägt er zur Pflanzenvermehrung bei.
Bedrohungen und Schutz
Der Glänzende Blütenprachtkäfer ist in einigen Regionen aufgrund von Habitatverlust durch Forstwirtschaft und städtische Entwicklung bedroht. Der Rückgang von alten Laubwäldern und totem Holz hat negative Auswirkungen auf seine Populationen. Schutzmaßnahmen beinhalten den Erhalt von totem Holz in Wäldern und Parks sowie die Förderung von naturnahen Gärten, die blühende Pflanzen beherbergen.
Zusammenfassung
Der Glänzende Blütenprachtkäfer (Anthaxia nitidula) ist ein kleiner, aber beeindruckend gefärbter Käfer, der in warmen, sonnenbeschienenen Lebensräumen Europas vorkommt. Mit seiner Rolle in der Zersetzung von totem Holz und der Bestäubung trägt er zu wichtigen ökologischen Prozessen bei. Der Schutz seines Lebensraums ist entscheidend für das Überleben dieser faszinierenden Art.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- Der Glänzende Blütenprachtkäfer ist ein Käfer aus der Familie der Prachtkäfer ... er wird etwa fünf bis sieben Millimeter lang. Beim diesem Männchen, etwa 5 mm lang, sind Kopf, Halsschild und Flügeldecken ganz grün ... sie glänzen metallisch je nach Lichteinfall.
Artenschutz in Franken®
Stele der Biodiversität® - Rosendahl / GT - Höven

Stele der Biodiversität® - Rosendahl / GT - Höven
17/18.05.2024
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutzes in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das von der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.
Rosendahl / Nordrhein - Westfalen. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen, kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen.
Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
17/18.05.2024
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutzes in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das von der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.
Rosendahl / Nordrhein - Westfalen. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen, kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen.
Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
In der Aufnahme
... Impressionen vom 15.05.2024 ...
Artenschutz in Franken®
Stele der Biodiversität® - Rosendahl / GT - Höven

Stele der Biodiversität® - Rosendahl / GT - Höven
17/18.05.2024
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutzes in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das von der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.
Rosendahl / Nordrhein - Westfalen. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen, kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen.
Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
17/18.05.2024
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutzes in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das von der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.
Rosendahl / Nordrhein - Westfalen. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen, kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen.
Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
In der Aufnahme
... ab dem 14.05.2024 wurde ebenfalls mit der grafischen Bauköpergestaltung begonnen...
Artenschutz in Franken®
Stele der Biodiversität® - Rosendahl / GT - Höven

Stele der Biodiversität® - Rosendahl / GT - Höven
17/18.05.2024
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutzes in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das von der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.
Rosendahl / Nordrhein - Westfalen. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen, kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen.
Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
17/18.05.2024
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutzes in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das von der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.
Rosendahl / Nordrhein - Westfalen. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen, kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen.
Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
In der Aufnahme
... ab dem 14.05.2024 wurde mit der Installation der Aufputz- Sekundärhabitate begonnen ... wir wählen hier vornehmlich Spaltenquartiere die als Kombihabitat ... Ganzjahres- und als Zwischenquartier ausgeführt wurden und Rückzugsräume bieten die ein umfangreiches Hangplatzspekturm für Fledermäuse vorhalten ...
Artenschutz in Franken®
Stele der Biodiversität® - Umweltpoint: Dorsten – Wulfen

Stele der Biodiversität® - Umweltpoint: Dorsten – Wulfen
16/17.05.2024
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutzes in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das von der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.
Dorsten GT-Wulfen / Nordrhein - Westfalen. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen, kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Baukörper gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen.
16/17.05.2024
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutzes in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das von der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.
Dorsten GT-Wulfen / Nordrhein - Westfalen. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen, kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Baukörper gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen.
Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper und auch deren Umfeld zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
Wenn auch noch die Umweltbildung einen wichtigen Projektaspekt vereinnahmt, dann sind wir der festen Überzeugung, hier einen wertvollen Beitrag für gerade die uns nachfolgende Generation zu leisten!
In der Aufnahme
Wenn auch noch die Umweltbildung einen wichtigen Projektaspekt vereinnahmt, dann sind wir der festen Überzeugung, hier einen wertvollen Beitrag für gerade die uns nachfolgende Generation zu leisten!
In der Aufnahme
- Am 13/14.05.2024 fand die Installation der vorbereiteten Prädatoren Schutzelemente statt. Diese, gebäudeumlaufend unterhalb des Traufkörpes angebracht, verhindern das z.B. Steinmarder durch Baukörperöffnungen in die Fledermaus- Thermokammer vordringen und die hier zu erwartenden Fledermausjung- und Alttiere negativ tangieren können.
Artenschutz in Franken®
Gemeine Keilfleckschwebfliege (Eristalis pertinax)

Gemeine Keilfleckschwebfliege (Eristalis pertinax)
16/17.05.2024
Diese Fliegenart ist in Europa weit verbreitet und kommt auch in Teilen Asiens und Nordafrikas vor. Der Name "Keilfleckschwebfliege" bezieht sich auf das charakteristische Muster auf ihrem Hinterleib, das einem Keil ähnelt.
Hier sind einige Informationen über die Gemeine Keilfleckschwebfliege:
Morphologie: Die Gemeine Keilfleckschwebfliege hat eine typische Fliegenmorphologie mit einem segmentierten Körper, sechs Beinen und zwei transparenten Flügelpaaren. Ihr Körper ist schwarz mit gelben oder orangefarbenen Streifen. Der Hinterleib weist oft ein markantes Muster auf, das aus keilförmigen Flecken besteht, was ihr den Namen gibt. Die Größe variiert, aber im Durchschnitt erreichen sie eine Körperlänge von etwa 8 bis 12 Millimetern.
16/17.05.2024
- Die Gemeine Keilfleckschwebfliege, wissenschaftlich bekannt als Eristalis pertinax, ist eine faszinierende Insektenart aus der Familie der Schwebfliegen (Syrphidae).
Diese Fliegenart ist in Europa weit verbreitet und kommt auch in Teilen Asiens und Nordafrikas vor. Der Name "Keilfleckschwebfliege" bezieht sich auf das charakteristische Muster auf ihrem Hinterleib, das einem Keil ähnelt.
Hier sind einige Informationen über die Gemeine Keilfleckschwebfliege:
Morphologie: Die Gemeine Keilfleckschwebfliege hat eine typische Fliegenmorphologie mit einem segmentierten Körper, sechs Beinen und zwei transparenten Flügelpaaren. Ihr Körper ist schwarz mit gelben oder orangefarbenen Streifen. Der Hinterleib weist oft ein markantes Muster auf, das aus keilförmigen Flecken besteht, was ihr den Namen gibt. Die Größe variiert, aber im Durchschnitt erreichen sie eine Körperlänge von etwa 8 bis 12 Millimetern.
Lebensraum und Verbreitung:
Eristalis pertinax ist in einer Vielzahl von Lebensräumen zu finden, darunter Gärten, Wiesen, Waldlichtungen, landwirtschaftliche Flächen und städtische Gebiete. Sie sind in ganz Europa verbreitet, von Nordspanien und Portugal bis in den Norden Skandinaviens und von Großbritannien bis nach Osteuropa. Außerdem findet man sie in Teilen Asiens und Nordafrikas.
Lebensweise:
Die Gemeine Keilfleckschwebfliege ist während der warmen Monate des Jahres aktiv, in der Regel von Frühling bis Herbst. Sie sind häufige Besucher von Blumen, wo sie Nektar und Pollen fressen.Wie viele Schwebfliegen imitieren sie oft das Aussehen von Wespen oder Bienen, was sie vor potenziellen Raubtieren schützt. Die Larven von Eristalis pertinax sind aquatisch und leben in stehenden oder langsam fließenden Gewässern wie Teichen, Tümpeln oder Gräben. Sie ernähren sich von organischem Material, das im Wasser vorhanden ist, und spielen eine wichtige Rolle bei der Zersetzung von abgestorbenem pflanzlichem Material.
Ökologische Bedeutung:
Als Bestäuber spielen Gemeine Keilfleckschwebfliegen eine wichtige Rolle im Ökosystem, indem sie zur Bestäubung von Blütenpflanzen beitragen. Obwohl sie nicht so effiziente Bestäuber wie Bienen sind, tragen sie dennoch zur Bestäubung von vielen Pflanzenarten bei. Sowohl die erwachsenen Schwebfliegen als auch ihre Larven dienen als Nahrungsquelle für verschiedene Raubtiere, darunter Vögel, Spinnen und Insekten.
Interaktion mit Menschen:
Eristalis pertinax ist für den Menschen im Allgemeinen harmlos und wird oft als nützliches Insekt angesehen, da es zur Bestäubung von Pflanzen beiträgt. Da sie Blumen bestäuben, können sie in Gärten und landwirtschaftlichen Nutzpflanzen von Vorteil sein. In einigen Fällen können die Larven der Keilfleckschwebfliege als Bioindikatoren für die Wasserqualität dienen, da ihre Anwesenheit oder Abwesenheit auf die Qualität des Gewässers hinweisen kann.
Insgesamt ist die Gemeine Keilfleckschwebfliege ein faszinierendes Insekt, das eine wichtige ökologische Rolle spielt und gleichzeitig für den Menschen von Nutzen ist. Ihre auffällige Erscheinung und ihr Verhalten machen sie zu einem interessanten Studienobjekt für Biologen und Naturliebhaber gleichermaßen.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
Eristalis pertinax ist in einer Vielzahl von Lebensräumen zu finden, darunter Gärten, Wiesen, Waldlichtungen, landwirtschaftliche Flächen und städtische Gebiete. Sie sind in ganz Europa verbreitet, von Nordspanien und Portugal bis in den Norden Skandinaviens und von Großbritannien bis nach Osteuropa. Außerdem findet man sie in Teilen Asiens und Nordafrikas.
Lebensweise:
Die Gemeine Keilfleckschwebfliege ist während der warmen Monate des Jahres aktiv, in der Regel von Frühling bis Herbst. Sie sind häufige Besucher von Blumen, wo sie Nektar und Pollen fressen.Wie viele Schwebfliegen imitieren sie oft das Aussehen von Wespen oder Bienen, was sie vor potenziellen Raubtieren schützt. Die Larven von Eristalis pertinax sind aquatisch und leben in stehenden oder langsam fließenden Gewässern wie Teichen, Tümpeln oder Gräben. Sie ernähren sich von organischem Material, das im Wasser vorhanden ist, und spielen eine wichtige Rolle bei der Zersetzung von abgestorbenem pflanzlichem Material.
Ökologische Bedeutung:
Als Bestäuber spielen Gemeine Keilfleckschwebfliegen eine wichtige Rolle im Ökosystem, indem sie zur Bestäubung von Blütenpflanzen beitragen. Obwohl sie nicht so effiziente Bestäuber wie Bienen sind, tragen sie dennoch zur Bestäubung von vielen Pflanzenarten bei. Sowohl die erwachsenen Schwebfliegen als auch ihre Larven dienen als Nahrungsquelle für verschiedene Raubtiere, darunter Vögel, Spinnen und Insekten.
Interaktion mit Menschen:
Eristalis pertinax ist für den Menschen im Allgemeinen harmlos und wird oft als nützliches Insekt angesehen, da es zur Bestäubung von Pflanzen beiträgt. Da sie Blumen bestäuben, können sie in Gärten und landwirtschaftlichen Nutzpflanzen von Vorteil sein. In einigen Fällen können die Larven der Keilfleckschwebfliege als Bioindikatoren für die Wasserqualität dienen, da ihre Anwesenheit oder Abwesenheit auf die Qualität des Gewässers hinweisen kann.
Insgesamt ist die Gemeine Keilfleckschwebfliege ein faszinierendes Insekt, das eine wichtige ökologische Rolle spielt und gleichzeitig für den Menschen von Nutzen ist. Ihre auffällige Erscheinung und ihr Verhalten machen sie zu einem interessanten Studienobjekt für Biologen und Naturliebhaber gleichermaßen.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- Gemeine Keilfleckschwebfliege bei der Augenpflege
Artenschutz in Franken®
Kolken - letzte Überlebensräume für Feuersalamander

Kolken - letzte Überlebensräume für Feuersalamander
16/17.05.2024
Ein innovatives Kooperationsprojekt aufgrund der Initiative von Artenschutz in Franken®, das von den Fachbehörden des Naturschutzes (HNB und UNB), sowie den Bayerischen Staatsforsten AÖR der Stiftung "Unsere Erde", der Deutschen Postcode Lotterie und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. unterstützt wird.
Bayern. Die extreme Trockenheit die in den vergangenen Jahren viele Teile Frankens umfasste gefährdete auch zunehmend den Nachwuchs des Feuersalamanders.Auch traditionelle Laichbiotope die bislang immer in der Lage waren, das für den Nachwuchs überlebenswichtige Wasser zu halten, stoßen zunehmend an ihre Grenzen.
Da kein natürliches Wasser mehr nachfoss, wurde der Lebensraum der den Feuersalamanderlarven verbieb, immer kleiner und qualitativ immer kritischer ...
16/17.05.2024
Ein innovatives Kooperationsprojekt aufgrund der Initiative von Artenschutz in Franken®, das von den Fachbehörden des Naturschutzes (HNB und UNB), sowie den Bayerischen Staatsforsten AÖR der Stiftung "Unsere Erde", der Deutschen Postcode Lotterie und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. unterstützt wird.
Bayern. Die extreme Trockenheit die in den vergangenen Jahren viele Teile Frankens umfasste gefährdete auch zunehmend den Nachwuchs des Feuersalamanders.Auch traditionelle Laichbiotope die bislang immer in der Lage waren, das für den Nachwuchs überlebenswichtige Wasser zu halten, stoßen zunehmend an ihre Grenzen.
Da kein natürliches Wasser mehr nachfoss, wurde der Lebensraum der den Feuersalamanderlarven verbieb, immer kleiner und qualitativ immer kritischer ...
In einer zugegeben nicht alltäglichen Maßnahme versuchten wir die Lebensräume von Feuersalamanderlarven, die vom Austrocknen bedroht waren und mit ihnen die Larven!, so zu erhalten das die Jungtiere eine Chance erhielten ihre Metamorphose abzuschließen.
So wurden als akuter Projektimpuls rund 1000 Liter Frischwasser zugeführt. Sehr interessant war das Verhalten der Larven im Laichgewässer ... die Tiere strömten unmittelbar beim Einlassen des Frischwassers an diesen Bereich, um wohl intensiv Sauerstoff aufzunehmen.
Nach diesem akuten Ersteinsatz wurden diese ausgewählten Bereiche über Monate hinweg in die Lage versetzt den Tieren in einer zugegeben prekären Lage bestmögliche Überlebensbedingungen zu verschaffen. Hier galt es darauf zu achten die sensiblen Zusammensetzungen der Gewässer nicht zu verändern um das Überleben der Tiere nicht zu gefährden.
Somit wurde also "nicht nur" Wasser eingefüllt, im Gegenteil, es fand ein begleitend umfangreiches Monitoring statt das diese Maßnahme in seiner komplexen Entwicklung beobachtete. Dabei konnten wertvolle Erkenntnisse gewonnen werden die uns in die Lage versetzen möglichen erneuten Projekteinsätze ähnlicher Art effektiv zu begegnen.
Seither begleiten wir das Projekt in einem 7jahres Monitoring welches auch elementare Lebenensraumoptimierungen beinhaltet
In der Aufnahme
So wurden als akuter Projektimpuls rund 1000 Liter Frischwasser zugeführt. Sehr interessant war das Verhalten der Larven im Laichgewässer ... die Tiere strömten unmittelbar beim Einlassen des Frischwassers an diesen Bereich, um wohl intensiv Sauerstoff aufzunehmen.
Nach diesem akuten Ersteinsatz wurden diese ausgewählten Bereiche über Monate hinweg in die Lage versetzt den Tieren in einer zugegeben prekären Lage bestmögliche Überlebensbedingungen zu verschaffen. Hier galt es darauf zu achten die sensiblen Zusammensetzungen der Gewässer nicht zu verändern um das Überleben der Tiere nicht zu gefährden.
Somit wurde also "nicht nur" Wasser eingefüllt, im Gegenteil, es fand ein begleitend umfangreiches Monitoring statt das diese Maßnahme in seiner komplexen Entwicklung beobachtete. Dabei konnten wertvolle Erkenntnisse gewonnen werden die uns in die Lage versetzen möglichen erneuten Projekteinsätze ähnlicher Art effektiv zu begegnen.
Seither begleiten wir das Projekt in einem 7jahres Monitoring welches auch elementare Lebenensraumoptimierungen beinhaltet
In der Aufnahme
- Mit großer Freude erkennen wir das die sich die im Monitoring befindlichen Lebensräume nach deren Optimierung großer Beliebtheit erfreuen .. die Weibchen haben ihren Nachwuchs in "unsere Hände" gelegt ... doch man muss tatsächlich schon genau hinsehen wenn man das Ergebnis erkennen möchte ...
Artenschutz in Franken®
Gemeinsam für den Bachmuschel- und Nasenbestand in der Murn

Gemeinsam für den Bachmuschel- und Nasenbestand in der Murn - 25.000 einjährige Nasen in der Murn bei Breitenbach und Weichselbaum besetzt
15/16.05.2024
Eine breite Allianz bestehend aus dem Kreisfischereiverein e.V. Wasserburg, dem Wasserwirtschaftsamt Rosenheim, dem Landratsamt Rosenheim, der Fachberatung für Fischerei Oberbayern und dem Bayerischen Landesamt für Umwelt (LfU) hat am 03.05.2024 25.000 einjährige Nasen in der Murn bei Breitenbach und Weichselbaum besetzt.
Die Tiere stammen aus der Fischzuchtanlage des LfU in Wielenbach und wurden vor dem Besatz mit Bachmuschel-Glochidien infiziert die eigens dafür durch das Kartierungsbüro Beck gewonnen wurden. +++
15/16.05.2024
- Die mit Bachmuschel-Glochidien infizierten einjährigen Nasen werden in der Murn ausgesetzt
Eine breite Allianz bestehend aus dem Kreisfischereiverein e.V. Wasserburg, dem Wasserwirtschaftsamt Rosenheim, dem Landratsamt Rosenheim, der Fachberatung für Fischerei Oberbayern und dem Bayerischen Landesamt für Umwelt (LfU) hat am 03.05.2024 25.000 einjährige Nasen in der Murn bei Breitenbach und Weichselbaum besetzt.
Die Tiere stammen aus der Fischzuchtanlage des LfU in Wielenbach und wurden vor dem Besatz mit Bachmuschel-Glochidien infiziert die eigens dafür durch das Kartierungsbüro Beck gewonnen wurden. +++
Nasen gehören in der Murn zu den wichtigen Wirtsfischen für die seltene Bachmuschel. Der Bachmuschelnachwuchs wird als Larve von Jungfischen mit dem Wasser aufgenommen und heftet sich in den Kiemen fest. Dort ernährt sie sich parasitisch und wächst zur Jungmuschel heran, die nach mehreren Wochen abfällt und ihr weiteres Leben im Gewässerbett verbringt.
Dieser Vorgang wird in der Murn seit mehreren Jahren „künstlich“ unterstützt. Die Erfolge können sich sehen lassen. Vor allem Bereiche, in welchen infizierte Fische besetzt wurden, weisen sehr hohe Dichten an Jungmuscheln der vom Aussterben bedrohten Bachmuschel auf. Erste Ergebnisse aus Fischbestandserhebungen deuten zudem auf einen deutlich gestiegenen Nasenbestand in der Murn hin.
Mit dem Rückbau der Wehranlage in der Murn bei Weichselbaum im Jahr 2019 durch das Wasserwirtschaftsamt Rosenheim ist der kleine Fluss nun über 21 Kilometer freifließend und für Fische und andere Wasserlebewesen durchwanderbar. Zusätzlich wurde ein Altarm geschaffen, in dem Jungfische Nahrung und Schutz bei Hochwasser finden können. Fischarten wie die Nase haben jetzt wieder einen größeren Lebensraum zur Verfügung, können dichtere Bestände aufbauen und stehen so zukünftig für eine erfolgreiche, natürliche Vermehrung der heranwachsenden Bachmuscheln zur Verfügung.
Weitere Informationen zur Bachmuschel und zum Bachmuschelschutz finden Sie unter:
In der Aufnahme
Quelle
Bayerisches Landesamt für Umwelt
Bürgermeister-Ulrich-Straße 160
86179 Augsburg
Stand
Freitag, 10. Mai 2024
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung.Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Dieser Vorgang wird in der Murn seit mehreren Jahren „künstlich“ unterstützt. Die Erfolge können sich sehen lassen. Vor allem Bereiche, in welchen infizierte Fische besetzt wurden, weisen sehr hohe Dichten an Jungmuscheln der vom Aussterben bedrohten Bachmuschel auf. Erste Ergebnisse aus Fischbestandserhebungen deuten zudem auf einen deutlich gestiegenen Nasenbestand in der Murn hin.
Mit dem Rückbau der Wehranlage in der Murn bei Weichselbaum im Jahr 2019 durch das Wasserwirtschaftsamt Rosenheim ist der kleine Fluss nun über 21 Kilometer freifließend und für Fische und andere Wasserlebewesen durchwanderbar. Zusätzlich wurde ein Altarm geschaffen, in dem Jungfische Nahrung und Schutz bei Hochwasser finden können. Fischarten wie die Nase haben jetzt wieder einen größeren Lebensraum zur Verfügung, können dichtere Bestände aufbauen und stehen so zukünftig für eine erfolgreiche, natürliche Vermehrung der heranwachsenden Bachmuscheln zur Verfügung.
Weitere Informationen zur Bachmuschel und zum Bachmuschelschutz finden Sie unter:
- https://www.bestellen.bayern.de/shoplink/lfu_nat_00200.htm
- https://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen/steckbrief/zeige?stbname=Unio+crassus+agg.
In der Aufnahme
- Die mit Bachmuschel-Glochidien infizierten einjährigen Nasen werden in der Murn ausgesetzt (Quelle: Dominik Bernolle, LfU)
Quelle
Bayerisches Landesamt für Umwelt
Bürgermeister-Ulrich-Straße 160
86179 Augsburg
Stand
Freitag, 10. Mai 2024
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung.Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Artenschutz in Franken®
Gelbband-Waffenfliege (Stratiomys potamida)

Die Gelbband-Waffenfliege (Stratiomys potamida) ...
15/16.05.2024
.... ist eine Art von Fliege aus der Familie der Stratiomyidae, die weltweit verbreitet ist. Sie ist häufig in feuchten Lebensräumen wie Sümpfen, Teichen und langsam fließenden Gewässern anzutreffen.
Diese Fliegenart zeichnet sich durch ihr auffälliges Aussehen aus, insbesondere durch die gelben Bänder auf ihrem schwarzen Körper, was ihr den Namen "Gelbband-Waffenfliege" einbrachte. Sie sind mittelgroße Fliegen, die eine Körperlänge von etwa 8 bis 12 Millimetern erreichen können.
15/16.05.2024
.... ist eine Art von Fliege aus der Familie der Stratiomyidae, die weltweit verbreitet ist. Sie ist häufig in feuchten Lebensräumen wie Sümpfen, Teichen und langsam fließenden Gewässern anzutreffen.
Diese Fliegenart zeichnet sich durch ihr auffälliges Aussehen aus, insbesondere durch die gelben Bänder auf ihrem schwarzen Körper, was ihr den Namen "Gelbband-Waffenfliege" einbrachte. Sie sind mittelgroße Fliegen, die eine Körperlänge von etwa 8 bis 12 Millimetern erreichen können.
Die Larven der Gelbband-Waffenfliege leben im Wasser und ernähren sich von organischen Materialien wie abgestorbenen Pflanzen und anderen organischen Ablagerungen. Sie spielen eine wichtige Rolle im Ökosystem, da sie dazu beitragen, abgestorbene Materie abzubauen und somit die Wasserqualität zu verbessern.
Erwachsene Gelbband-Waffenfliegen ernähren sich hauptsächlich von Nektar und Pollen und spielen eine Rolle bei der Bestäubung von Pflanzen. Sie sind auch dafür bekannt, in der Nähe von Gewässern zu leben, wo sie sich paaren und ihre Eier ablegen.
Insgesamt sind Gelbband-Waffenfliegen ein faszinierendes Beispiel für die Vielfalt und Bedeutung von Insekten in aquatischen Ökosystemen.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
Erwachsene Gelbband-Waffenfliegen ernähren sich hauptsächlich von Nektar und Pollen und spielen eine Rolle bei der Bestäubung von Pflanzen. Sie sind auch dafür bekannt, in der Nähe von Gewässern zu leben, wo sie sich paaren und ihre Eier ablegen.
Insgesamt sind Gelbband-Waffenfliegen ein faszinierendes Beispiel für die Vielfalt und Bedeutung von Insekten in aquatischen Ökosystemen.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
- Gelbband-Waffenfliege
Artenschutz in Franken®
Stell dir vor ... die Blindschleiche 4Kids ...

Die Blindschleiche ... 4Kids ...
15/16.05.2024
Die Blindschleiche ist ein lustiges Tier, das wie eine Mischung aus Schlange und Eidechse aussieht. Aber wusstest du, dass sie weder eine Schlange noch eine Eidechse ist? Sie ist eine ganz eigene Art von Tier. Sie hat keinen Panzer wie eine Schildkröte und auch keine Schuppen wie eine Schlange. Stattdessen hat sie eine glatte, weiche Haut.
15/16.05.2024
- Stell dir vor, du bist im Wald spazieren gegangen und plötzlich siehst du etwas Glattes und Schlangenähnliches über den Weg huschen. Es ist keine Schlange, obwohl es so aussehen könnte! Es ist eine Blindschleiche.
Die Blindschleiche ist ein lustiges Tier, das wie eine Mischung aus Schlange und Eidechse aussieht. Aber wusstest du, dass sie weder eine Schlange noch eine Eidechse ist? Sie ist eine ganz eigene Art von Tier. Sie hat keinen Panzer wie eine Schildkröte und auch keine Schuppen wie eine Schlange. Stattdessen hat sie eine glatte, weiche Haut.
Was die Blindschleiche wirklich besonders macht, ist, dass sie keine Beine hat! Ja, du hast richtig gehört, sie gleitet einfach über den Boden. Und ihre Augen sind auch etwas Besonderes. Sie sind so klein, dass man sie kaum sehen kann, weil sie von einer dünnen Haut bedeckt sind. Aber mach dir keine Sorgen, sie kann trotzdem sehen.
Blindschleichen sind super nett, sie essen gerne Käfer, Würmer und andere kleine Insekten. Und rat mal, wer sich gerne von Blindschleichen ernährt? Es sind Eulen, Krähen und sogar manchmal Katzen! Deshalb verstecken sich Blindschleichen gerne unter Blättern oder in kleinen Höhlen, um sich vor diesen Jägern zu schützen.
Aber leider haben Blindschleichen manchmal auch Probleme. Wenn Menschen durch den Wald laufen und nicht aufpassen, könnten sie versehentlich auf eine Blindschleiche treten. Das tut nicht nur der Blindschleiche weh, sondern ist auch traurig für den Wald, weil Blindschleichen dazu beitragen, den Wald sauber zu halten, indem sie Insekten essen.
Also, wenn du das nächste Mal durch den Wald läufst, halte deine Augen offen für diese kleinen, glatten Kreaturen. Sie sind vielleicht schwer zu entdecken, aber wenn du sie siehst, sei vorsichtig und lass sie in Ruhe ihren Weg gehen!
In der Aufnahme von Johannes Rother
Blindschleichen sind super nett, sie essen gerne Käfer, Würmer und andere kleine Insekten. Und rat mal, wer sich gerne von Blindschleichen ernährt? Es sind Eulen, Krähen und sogar manchmal Katzen! Deshalb verstecken sich Blindschleichen gerne unter Blättern oder in kleinen Höhlen, um sich vor diesen Jägern zu schützen.
Aber leider haben Blindschleichen manchmal auch Probleme. Wenn Menschen durch den Wald laufen und nicht aufpassen, könnten sie versehentlich auf eine Blindschleiche treten. Das tut nicht nur der Blindschleiche weh, sondern ist auch traurig für den Wald, weil Blindschleichen dazu beitragen, den Wald sauber zu halten, indem sie Insekten essen.
Also, wenn du das nächste Mal durch den Wald läufst, halte deine Augen offen für diese kleinen, glatten Kreaturen. Sie sind vielleicht schwer zu entdecken, aber wenn du sie siehst, sei vorsichtig und lass sie in Ruhe ihren Weg gehen!
In der Aufnahme von Johannes Rother
- Blindschleiche im Portrait
Artenschutz in Franken®
Krisenfall deutscher Wald

Krisenfall deutscher Wald
14/15.05.2024
Berlin, 13.05.2024: Bundesminister Cem Özdemir hat heute die Waldzustandserhebung 2023 vorgestellt. Susanne Winter, Programmleiterin Wald beim WWF Deutschland, kommentiert:
„Deutschlands Wälder sind krank und brauchen dringend Hilfe. Wetterextreme wie lange Dürre- und Hitzeperioden sind zum Dauerproblem geworden und setzen den Bäumen immer stärker zu. Wir brauchen umgehend einen Paradigmenwechsel hin zu naturnahen Wäldern, die mit der Erderhitzung besser umgehen können. Das Problem ist altbekannt und wurde viel zu lange ignoriert.
14/15.05.2024
- WWF kommentiert die Waldzustandserhebung des BMEL
Berlin, 13.05.2024: Bundesminister Cem Özdemir hat heute die Waldzustandserhebung 2023 vorgestellt. Susanne Winter, Programmleiterin Wald beim WWF Deutschland, kommentiert:
„Deutschlands Wälder sind krank und brauchen dringend Hilfe. Wetterextreme wie lange Dürre- und Hitzeperioden sind zum Dauerproblem geworden und setzen den Bäumen immer stärker zu. Wir brauchen umgehend einen Paradigmenwechsel hin zu naturnahen Wäldern, die mit der Erderhitzung besser umgehen können. Das Problem ist altbekannt und wurde viel zu lange ignoriert.
Mit der Novelle des Bundeswaldgesetzes, die derzeit im Bundestag vorbereitet wird, bietet sich dazu eine große Chance. Das neue Waldgesetz muss die Wälder fitter gegen die Folgen der zunehmenden Wetterextreme machen. Nur so können wir all die wichtigen Funktionen der Wälder erhalten, wie etwa die Versorgung mit sauberem Wasser, der Schutz vor Erosionen, als Kohlenstoffspeicher, Lebensraum unzähliger Arten, Naherholungsgebiet sowie als Holzlieferant.
Zentraler Grund für die Misere ist, dass der Wald jahrzehntelang vor allem als schneller Holzlieferant und nicht als Waldökosystem gesehen wurde. Das rächt sich nun. Im Zentrum des neuen Gesetzes muss der Erhalt des Waldes stehen, damit er auch langfristig all die für uns lebensnotwendigen Funktionen übernehmen kann. Hierfür brauchen wir bundeseinheitliche gesetzliche Vorgaben für eine naturnahe Waldbewirtschaftung.
Waldbesitzende sollten Einkommen zudem nicht nur durch forstliche Nutzung beziehen, sondern auch durch Honorierung von Schutz und Erhalt des Waldes. Dabei dürfen öffentlicher Gelder nur fließen, wenn der ökologische Zustand des Waldes deutlich verbessert oder auf hohem Niveau erhalten wird. Mit einem neuen und zeitgemäßen Bundeswaldgesetz sind enorme Chancen für Natur und Wirtschaft gleichermaßen verbunden. Wollen wir dem Wald nicht weiter beim Sterben zusehen, müssen wir diese einmalige Chance unbedingt nutzen.“
Quelle
WWF
Stand:
13.05.2024
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung.Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
In der Aufnahme
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Zentraler Grund für die Misere ist, dass der Wald jahrzehntelang vor allem als schneller Holzlieferant und nicht als Waldökosystem gesehen wurde. Das rächt sich nun. Im Zentrum des neuen Gesetzes muss der Erhalt des Waldes stehen, damit er auch langfristig all die für uns lebensnotwendigen Funktionen übernehmen kann. Hierfür brauchen wir bundeseinheitliche gesetzliche Vorgaben für eine naturnahe Waldbewirtschaftung.
Waldbesitzende sollten Einkommen zudem nicht nur durch forstliche Nutzung beziehen, sondern auch durch Honorierung von Schutz und Erhalt des Waldes. Dabei dürfen öffentlicher Gelder nur fließen, wenn der ökologische Zustand des Waldes deutlich verbessert oder auf hohem Niveau erhalten wird. Mit einem neuen und zeitgemäßen Bundeswaldgesetz sind enorme Chancen für Natur und Wirtschaft gleichermaßen verbunden. Wollen wir dem Wald nicht weiter beim Sterben zusehen, müssen wir diese einmalige Chance unbedingt nutzen.“
Quelle
WWF
Stand:
13.05.2024
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung.Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
In der Aufnahme
- Was soll das sein ... ein Wald? ... das wir nicht lachen, was wir hier sehen ist eine Bewirtschaftungsform die wir vom Artenschutz in Franken strikt ablehnen .. es ist ein Wirtschaftsforst der sich mutmaßlich einen naturnahen "Anstrich" gibt, nicht mehr und nicht weniger ... mehr zu den dürren Bäumchen des Steigerwaldes hier auf unseren Seiten ... mit Wald hat das in unseren Augen schon lange nichts mehr zu tun!
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Artenschutz in Franken®
Der deutsche Wald an der Belastungsgrenze

Der deutsche Wald an der Belastungsgrenze
14/15.05.2024
Berlin – Laut Waldzustandsbericht 2023 geht es den Wäldern in Deutschland auch weiterhin schlecht. Ein überwiegender Teil der Bäume ist krank. Neben der Klimakrise ist die intensive Forstwirtschaft ein Haupttreiber des Waldsterbens. Der NABU fordert daher ein ambitioniertes Bundeswaldgesetz.
14/15.05.2024
- Krüger: Keine Verbesserung trotz Ende der Dürre / Zeit für ein besseres Bundeswaldgesetz zum Schutz & Erhalt unserer Wälder
Berlin – Laut Waldzustandsbericht 2023 geht es den Wäldern in Deutschland auch weiterhin schlecht. Ein überwiegender Teil der Bäume ist krank. Neben der Klimakrise ist die intensive Forstwirtschaft ein Haupttreiber des Waldsterbens. Der NABU fordert daher ein ambitioniertes Bundeswaldgesetz.
NABU-Präsident Jörg-Andreas Krüger: „Dürren, Borkenkäfer, Waldbrände – es wird zur traurigen Tradition, dass der Waldzustandsbericht jedes Jahr aufs Neue aufzeigt, was längst schon klar ist: Der deutsche Wald steht an der Belastungsgrenze. Während wir dabei zuschauen müssen, wie unsere Wälder weiter sterben, tun einige Lobbyverbände so, als könne alles so bleiben, wie es ist. Doch auch sie können nicht länger die Augen davor verschließen, dass der Wald naturverträglich bewirtschaftet werden muss, damit es ihn morgen noch gibt. Ein Schlüssel ist die Reform des aktuellen Bundeswaldgesetzes. Es muss zu einem Gesetz werden, das unsere Wälder schützt und widerstandsfähig macht.”
Konkret fordert der NABU zeitgemäße gesetzliche Vorgaben für ein Kahlschlagverbot, ein Entwässerungsverbot, mehr Schutz für den Waldboden sowie einen zügigen Waldumbau weg von naturfernen Nadelforsten hin zu stabileren und widerstandsfähigeren Laubmischwäldern. Für den Schutz der Artenvielfalt, den natürlichen Klimaschutz und den Wasserrückhalt muss das neue Waldgesetz verbindliche ökologische Mindeststandards unter anderem für Biotopbäume und Totholz vorgeben.
Hintergrund
Gesunde Wälder sorgen für einen ausgeglichenen Wasserhaushalt, saubere Luft, Erosionsschutz sowie Biodiversität- und Klimaschutz und sind als Wirtschafts- und Erholungsraum unverzichtbar. Das aktuelle Bundeswaldgesetz adressiert jedoch weder die Biodiversitäts- noch die Klimakrise und schafft bisher keinen verlässlichen Rahmen, um diesen großen Herausforderungen wirksam zu begegnen. Aktuell versuchen einige Lobbyverbände aus Industrie und Forstwirtschaft die dringend nötige Novelle des Bundeswaldgesetzes zu verzögern. Dieses Vorgehen ist laut NABU unverantwortlich und eine Missachtung der Not unserer Wälder. Die Gesetzesnovelle eröffnet die große Chance, das Fundament für einen neuen Gesellschaftsvertrag zu legen, der dem Erhalt des Waldes als unsere natürliche Lebensgrundlage dient und langfristig auch neue Einkommensquellen sowie einen attraktiven Erholungsraum sichert.
Quelle
NABU (Naturschutzbund Deutschland) e.V.
Charitéstraße 3
10117 Berlin
Stand
13.05.2024
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung.Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
In der Aufnahme von
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Konkret fordert der NABU zeitgemäße gesetzliche Vorgaben für ein Kahlschlagverbot, ein Entwässerungsverbot, mehr Schutz für den Waldboden sowie einen zügigen Waldumbau weg von naturfernen Nadelforsten hin zu stabileren und widerstandsfähigeren Laubmischwäldern. Für den Schutz der Artenvielfalt, den natürlichen Klimaschutz und den Wasserrückhalt muss das neue Waldgesetz verbindliche ökologische Mindeststandards unter anderem für Biotopbäume und Totholz vorgeben.
Hintergrund
Gesunde Wälder sorgen für einen ausgeglichenen Wasserhaushalt, saubere Luft, Erosionsschutz sowie Biodiversität- und Klimaschutz und sind als Wirtschafts- und Erholungsraum unverzichtbar. Das aktuelle Bundeswaldgesetz adressiert jedoch weder die Biodiversitäts- noch die Klimakrise und schafft bisher keinen verlässlichen Rahmen, um diesen großen Herausforderungen wirksam zu begegnen. Aktuell versuchen einige Lobbyverbände aus Industrie und Forstwirtschaft die dringend nötige Novelle des Bundeswaldgesetzes zu verzögern. Dieses Vorgehen ist laut NABU unverantwortlich und eine Missachtung der Not unserer Wälder. Die Gesetzesnovelle eröffnet die große Chance, das Fundament für einen neuen Gesellschaftsvertrag zu legen, der dem Erhalt des Waldes als unsere natürliche Lebensgrundlage dient und langfristig auch neue Einkommensquellen sowie einen attraktiven Erholungsraum sichert.
Quelle
NABU (Naturschutzbund Deutschland) e.V.
Charitéstraße 3
10117 Berlin
Stand
13.05.2024
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung.Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
In der Aufnahme von
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Artenschutz in Franken®
Der Tod lauert auf den Forstwegen ...

Der Tod lauert auf den Forstwegen ...
14/15.05.2024
... stell dir einen verzauberten Wald vor, wo das Unterholz dicht und das Moos sanft unter deinen Schritten nachgibt. Hier, zwischen den schattigen Bäumen und dem leisen Rascheln der Blätter, lebt eine bescheidene Kreatur, die oft übersehen wird: die Blindschleiche.
Die Blindschleiche, ein faszinierendes Geschöpf, das trotz ihres Namens nicht blind ist, sondern ihre Augen unter einer schützenden Haut verbirgt. Diese schlanken, glatten Reptilien sind eine wichtige Komponente des Ökosystems, da sie sich von Insekten und anderen kleinen Wirbellosen ernähren und selbst Beute für Vögel, Nagetiere und andere Beutegreifer sind.
14/15.05.2024
... stell dir einen verzauberten Wald vor, wo das Unterholz dicht und das Moos sanft unter deinen Schritten nachgibt. Hier, zwischen den schattigen Bäumen und dem leisen Rascheln der Blätter, lebt eine bescheidene Kreatur, die oft übersehen wird: die Blindschleiche.
Die Blindschleiche, ein faszinierendes Geschöpf, das trotz ihres Namens nicht blind ist, sondern ihre Augen unter einer schützenden Haut verbirgt. Diese schlanken, glatten Reptilien sind eine wichtige Komponente des Ökosystems, da sie sich von Insekten und anderen kleinen Wirbellosen ernähren und selbst Beute für Vögel, Nagetiere und andere Beutegreifer sind.
Doch die Idylle des Waldes ist bedroht, wenn der Mensch mit seinen schweren Stiefeln die Pfade betritt. Waldwege, die einst von Pilzsammlern, Wanderern und Naturliebhabern genutzt wurden, sind nun ein zunehmender Gefahrenherd für die Blindschleiche. Diese sanften Geschöpfe, die es bevorzugen, im Verborgenen zu bleiben und sich vor Beutegreifern zu verstecken, werden oft unbeabsichtigt unter den Füßen der Wanderer zermalmt.
Die Gefahr für die Blindschleichen auf Forstwegen ist vielschichtig. Die Zerstörung ihres Lebensraums durch den Bau von Wegen und Wanderpfaden verkleinert ihren Lebensraum und zwingt sie, sich in gefährlichere Gebiete zu wagen. Doch selbst in den verbleibenden Rückzugsgebieten sind sie nicht sicher. Ihre Tarnung und ihre Neigung, sich regungslos zu verhalten, machen sie zu perfekten Opfern für ahnungslose Fußgänger, die ihre Anwesenheit nicht bemerken, bis es zu spät ist.
Jedes zertretene Exemplar ist nicht nur der Verlust eines individuellen Tieres, sondern auch ein Schlag gegen die fragile Balance des Waldes. Denn die Blindschleiche, obwohl sie oft im Verborgenen lebt, spielt eine entscheidende Rolle im Ökosystem, indem sie den Kreislauf der Nahrungskette aufrechterhält und das Gleichgewicht zwischen Beutetieren und Raubtieren beeinflusst.
Die Zukunft der Blindschleiche auf Forstwegen hängt von unserem Verständnis und unserer Achtsamkeit ab. Indem wir uns bewusst sind über die Gefahren, die wir für diese unscheinbaren Kreaturen darstellen, können wir Maßnahmen ergreifen, um ihre Lebensräume zu schützen und sicherzustellen, dass sie weiterhin ein integraler Bestandteil unserer wunderschönen Wälder bleiben.
Auf den Forstwegen des Steigerforstes (ein Wald ist das in unseren Augen seit geraumer zeit nicht mehr) unterliegen Blindschleichen mannigfache Gefahren. Selbst dort wo die Tiere einen wichtigen Lebensraum haben werden diese Strecken für Kraftfahrzeuge und Radfahrer nicht gesperrt .. eigentlich unverantwortlich wie wir finden.
In der Aufnahme
Die Gefahr für die Blindschleichen auf Forstwegen ist vielschichtig. Die Zerstörung ihres Lebensraums durch den Bau von Wegen und Wanderpfaden verkleinert ihren Lebensraum und zwingt sie, sich in gefährlichere Gebiete zu wagen. Doch selbst in den verbleibenden Rückzugsgebieten sind sie nicht sicher. Ihre Tarnung und ihre Neigung, sich regungslos zu verhalten, machen sie zu perfekten Opfern für ahnungslose Fußgänger, die ihre Anwesenheit nicht bemerken, bis es zu spät ist.
Jedes zertretene Exemplar ist nicht nur der Verlust eines individuellen Tieres, sondern auch ein Schlag gegen die fragile Balance des Waldes. Denn die Blindschleiche, obwohl sie oft im Verborgenen lebt, spielt eine entscheidende Rolle im Ökosystem, indem sie den Kreislauf der Nahrungskette aufrechterhält und das Gleichgewicht zwischen Beutetieren und Raubtieren beeinflusst.
Die Zukunft der Blindschleiche auf Forstwegen hängt von unserem Verständnis und unserer Achtsamkeit ab. Indem wir uns bewusst sind über die Gefahren, die wir für diese unscheinbaren Kreaturen darstellen, können wir Maßnahmen ergreifen, um ihre Lebensräume zu schützen und sicherzustellen, dass sie weiterhin ein integraler Bestandteil unserer wunderschönen Wälder bleiben.
Auf den Forstwegen des Steigerforstes (ein Wald ist das in unseren Augen seit geraumer zeit nicht mehr) unterliegen Blindschleichen mannigfache Gefahren. Selbst dort wo die Tiere einen wichtigen Lebensraum haben werden diese Strecken für Kraftfahrzeuge und Radfahrer nicht gesperrt .. eigentlich unverantwortlich wie wir finden.
In der Aufnahme
- Schwebt in Lebensgefahr ... die auf der Forst-Schotterpiste leigende Blindschleiche!
Artenschutz in Franken®
Gefleckter Wollschweber (Bombylius discolor)

Der Gefleckte Wollschweber (Bombylius discolor) ist eine faszinierende Insektengattung aus der Familie der Wollschweber (Bombyliidae).
13/14.05.2024
Der Gefleckte Wollschweber gehört zur Ordnung der Zweiflügler (Diptera) und zur Familie Bombyliidae. Die Gattung Bombylius umfasst mehrere Arten, von denen der Gefleckte Wollschweber eine ist. Diese Art zeichnet sich durch ihr auffälliges Erscheinungsbild aus. Sie sind etwa 8 bis 12 Millimeter lang und haben einen pelzigen Körper, der an einen kleinen Hummel erinnert.
Die Flügel sind transparent und weisen oft dunkle Flecken auf, was ihnen ihren Namen verleiht. Gefleckte Wollschweber sind in vielen Teilen der Welt verbreitet, hauptsächlich in gemäßigten Regionen.
13/14.05.2024
- Hier sind einige Informationen über diese interessante Spezies
Der Gefleckte Wollschweber gehört zur Ordnung der Zweiflügler (Diptera) und zur Familie Bombyliidae. Die Gattung Bombylius umfasst mehrere Arten, von denen der Gefleckte Wollschweber eine ist. Diese Art zeichnet sich durch ihr auffälliges Erscheinungsbild aus. Sie sind etwa 8 bis 12 Millimeter lang und haben einen pelzigen Körper, der an einen kleinen Hummel erinnert.
Die Flügel sind transparent und weisen oft dunkle Flecken auf, was ihnen ihren Namen verleiht. Gefleckte Wollschweber sind in vielen Teilen der Welt verbreitet, hauptsächlich in gemäßigten Regionen.
Sie bevorzugen offene, sonnige Lebensräume wie Wiesen, Gärten und Waldränder. Die Larven des Gefleckten Wollschwebers parasitieren oft die Larven von Solitärbienen. Sie legen ihre Eier in die Nester der Bienen, wo sich ihre Larven von den Vorräten der Biene ernähren. Als Erwachsene ernähren sich Wollschweber von Nektar und sind wichtige Bestäuber für viele Blütenpflanzen.
Gefleckte Wollschweber haben ein charakteristisches Flugverhalten. Sie schweben oft über Blumen und setzen sich dann schnell nieder, um Nektar zu sammeln. Ihr Flugmuster ähnelt dem von Kolibris, was zuweilen zu Verwechslungen führen kann. Als Bestäuber spielen Gefleckte Wollschweber eine wichtige Rolle im Ökosystem. Sie tragen zur Bestäubung von Blütenpflanzen bei und unterstützen so die Fortpflanzung vieler Pflanzenarten.
Obwohl der Gefleckte Wollschweber keine spezifische Schutzstatus hat, können Maßnahmen zum Schutz seiner Lebensräume und der Artenvielfalt im Allgemeinen dazu beitragen, seine Populationen zu erhalten. Der Gefleckte Wollschweber ist also nicht nur ein faszinierendes Insekt, sondern auch ein wichtiger Bestandteil vieler Ökosysteme, insbesondere in Bezug auf die Bestäubung von Pflanzen.
In der Aufnahme
Die Körperlänge des gefleckten Wollschwebers beträgt 10–16 mm ... er ist damit so groß, wohl sogar etwas größer, als der "große Wollschweber" ... sein auffälliger Saugrüssel kann bis zu 10 mm lang werden... der gedrungene Körper ist mit einer braunen und schwarzen Behaarung besetzt.
Zwischen April und Juni können erwachsene Exemplare dabei beobachtet werden, wie sie auf der Suche nach Nektar Blüten anfliegen.Weibchen legen ihre Eier an den Nestern von solitären Bienenarten ab.Die schlüpfenden Larven suchen das Innere der Nester auf und ernähren sich dann parasitoid von den Bienenlarven.Bei den Wirtstieren handelt es sich primär um Sandbienen. Die Forschung hat das noch nicht vollständig klären können.Der Unterschied von parasitär zu parasitoid ist, dass bei parasitoid die Wirtstiere sterben.
In der Aufnahme / Autor
Gefleckte Wollschweber haben ein charakteristisches Flugverhalten. Sie schweben oft über Blumen und setzen sich dann schnell nieder, um Nektar zu sammeln. Ihr Flugmuster ähnelt dem von Kolibris, was zuweilen zu Verwechslungen führen kann. Als Bestäuber spielen Gefleckte Wollschweber eine wichtige Rolle im Ökosystem. Sie tragen zur Bestäubung von Blütenpflanzen bei und unterstützen so die Fortpflanzung vieler Pflanzenarten.
Obwohl der Gefleckte Wollschweber keine spezifische Schutzstatus hat, können Maßnahmen zum Schutz seiner Lebensräume und der Artenvielfalt im Allgemeinen dazu beitragen, seine Populationen zu erhalten. Der Gefleckte Wollschweber ist also nicht nur ein faszinierendes Insekt, sondern auch ein wichtiger Bestandteil vieler Ökosysteme, insbesondere in Bezug auf die Bestäubung von Pflanzen.
In der Aufnahme
Die Körperlänge des gefleckten Wollschwebers beträgt 10–16 mm ... er ist damit so groß, wohl sogar etwas größer, als der "große Wollschweber" ... sein auffälliger Saugrüssel kann bis zu 10 mm lang werden... der gedrungene Körper ist mit einer braunen und schwarzen Behaarung besetzt.
Zwischen April und Juni können erwachsene Exemplare dabei beobachtet werden, wie sie auf der Suche nach Nektar Blüten anfliegen.Weibchen legen ihre Eier an den Nestern von solitären Bienenarten ab.Die schlüpfenden Larven suchen das Innere der Nester auf und ernähren sich dann parasitoid von den Bienenlarven.Bei den Wirtstieren handelt es sich primär um Sandbienen. Die Forschung hat das noch nicht vollständig klären können.Der Unterschied von parasitär zu parasitoid ist, dass bei parasitoid die Wirtstiere sterben.
In der Aufnahme / Autor
- Bernhard Schmalisch
Artenschutz in Franken®
Stele der Biodiversität® - Rosendahl / GT - Darfeld

Stele der Biodiversität® - Rosendahl / GT - Darfeld
13/14.05.2024
Darfeld / Nordrhein-Westfalen. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
13/14.05.2024
- Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das von der Gemeinde Rosendahl, der MN Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co. KG und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.
Darfeld / Nordrhein-Westfalen. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
Denn wenn (selbst in noch geeigneten Nahrungsstrukturen) keine geeigneten Reproduktionsräume vorhanden sind, ist die Erhaltung der Artenvielfalt gelichfalls zum Scheitern verurteilt.
Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V., das von der Gemeinde Rosendahl, der MN Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co. KG und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird, setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.
In der Aufnahme
Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V., das von der Gemeinde Rosendahl, der MN Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co. KG und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird, setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.
In der Aufnahme
- Objekt im Juli 2023 vor der Umgestaltung (links) und Objekt im Mai 2024 nach der Umgestaltung (rechts)
Artenschutz in Franken®
Eine faszinierende Bewohnerin der Natur

Die Goldglänzende Furchenbiene: Eine faszinierende Bewohnerin der Natur
13/14.05.2024
Diese kleinen, aber auffälligen Bienen sind bekannt für ihre brillante goldene Färbung und ihre bedeutende Rolle bei der Bestäubung von Pflanzen. In diesem Aufsatz werden wir die Eigenschaften, das Verhalten und die Bedeutung der Goldglänzenden Furchenbiene näher betrachten.
13/14.05.2024
- Die Goldglänzende Furchenbiene (Halictus subauratus) ist eine bemerkenswerte Spezies, die in der Welt der Insekten eine wichtige Rolle spielt.
Diese kleinen, aber auffälligen Bienen sind bekannt für ihre brillante goldene Färbung und ihre bedeutende Rolle bei der Bestäubung von Pflanzen. In diesem Aufsatz werden wir die Eigenschaften, das Verhalten und die Bedeutung der Goldglänzenden Furchenbiene näher betrachten.
Zunächst einmal zeichnet sich die Goldglänzende Furchenbiene durch ihr markantes Aussehen aus. Erwachsene Exemplare haben einen schlanken Körper und sind in der Regel etwa 6 bis 8 Millimeter lang. Die charakteristische goldene Färbung ihres Körpers verleiht ihnen einen auffälligen und ansprechenden Anblick. Diese Färbung ist jedoch nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern dient auch als Warnsignal für potenzielle Feinde, da viele goldfarbene Insekten giftig oder ungenießbar sind.
Ein weiteres interessantes Merkmal der Goldglänzenden Furchenbiene ist ihr Lebensraum und ihr Verhalten. Diese Bienen sind häufig in offenen Landschaften, Gärten, Wiesen und anderen blühenden Lebensräumen anzutreffen. Sie sind solitäre Bienen, was bedeutet, dass sie nicht in großen sozialen Kolonien leben wie beispielsweise Honigbienen. Stattdessen bauen sie ihre Nester alleine oder in kleinen Gruppen in den Boden oder in andere natürliche Hohlräume.
Die Goldglänzende Furchenbiene spielt eine entscheidende Rolle im Ökosystem als Bestäuberin zahlreicher Pflanzenarten. Während sie Nahrung sammeln, indem sie Nektar und Pollen von Blüten aufnehmen, tragen sie unabsichtlich Pollen von einer Blume zur nächsten und ermöglichen so die Befruchtung und Fortpflanzung vieler Pflanzenarten. Auf diese Weise tragen sie zur Erhaltung der biologischen Vielfalt und zur Fruchtbarkeit von Ökosystemen bei.
Trotz ihrer ökologischen Bedeutung sind die Bestände der Goldglänzenden Furchenbiene wie viele andere Bienenarten bedroht. Verlust und Degradierung von Lebensräumen, der Einsatz von Pestiziden und der Klimawandel sind nur einige der Faktoren, die ihre Populationen gefährden. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, Maßnahmen zum Schutz dieser faszinierenden Insekten zu ergreifen, um ihre wichtige Rolle in der Natur zu erhalten.
Insgesamt ist die Goldglänzende Furchenbiene eine bemerkenswerte Spezies, die nicht nur durch ihr auffälliges Aussehen, sondern auch durch ihre ökologische Bedeutung fasziniert. Durch ihr Verhalten als Bestäuberin und ihre Anpassungsfähigkeit an verschiedene Lebensräume ist sie ein wichtiger Bestandteil des natürlichen Gleichgewichts und verdient unseren Respekt und Schutz.
Aufnahme von Bernhard Schmalisch
Ein weiteres interessantes Merkmal der Goldglänzenden Furchenbiene ist ihr Lebensraum und ihr Verhalten. Diese Bienen sind häufig in offenen Landschaften, Gärten, Wiesen und anderen blühenden Lebensräumen anzutreffen. Sie sind solitäre Bienen, was bedeutet, dass sie nicht in großen sozialen Kolonien leben wie beispielsweise Honigbienen. Stattdessen bauen sie ihre Nester alleine oder in kleinen Gruppen in den Boden oder in andere natürliche Hohlräume.
Die Goldglänzende Furchenbiene spielt eine entscheidende Rolle im Ökosystem als Bestäuberin zahlreicher Pflanzenarten. Während sie Nahrung sammeln, indem sie Nektar und Pollen von Blüten aufnehmen, tragen sie unabsichtlich Pollen von einer Blume zur nächsten und ermöglichen so die Befruchtung und Fortpflanzung vieler Pflanzenarten. Auf diese Weise tragen sie zur Erhaltung der biologischen Vielfalt und zur Fruchtbarkeit von Ökosystemen bei.
Trotz ihrer ökologischen Bedeutung sind die Bestände der Goldglänzenden Furchenbiene wie viele andere Bienenarten bedroht. Verlust und Degradierung von Lebensräumen, der Einsatz von Pestiziden und der Klimawandel sind nur einige der Faktoren, die ihre Populationen gefährden. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, Maßnahmen zum Schutz dieser faszinierenden Insekten zu ergreifen, um ihre wichtige Rolle in der Natur zu erhalten.
Insgesamt ist die Goldglänzende Furchenbiene eine bemerkenswerte Spezies, die nicht nur durch ihr auffälliges Aussehen, sondern auch durch ihre ökologische Bedeutung fasziniert. Durch ihr Verhalten als Bestäuberin und ihre Anpassungsfähigkeit an verschiedene Lebensräume ist sie ein wichtiger Bestandteil des natürlichen Gleichgewichts und verdient unseren Respekt und Schutz.
Aufnahme von Bernhard Schmalisch
Artenschutz in Franken®
Ocellen

Ocellen sind kleine, runde Flecken oder Augenflecken, die auf den Flügeln vieler Schmetterlinge, aber auch auf den Flügeln anderer Insekten wie zum Beispiel Libellen, zu finden sind.
12/13.05.2024
Einige Schmetterlinge haben Ocellen, die denen von größeren Augen ähneln. Diese Augenflecken können potenzielle Fressfeinde wie Vögel oder Eidechsen abschrecken oder verwirren, indem sie den Eindruck erwecken, dass der Schmetterling viel größer ist als er tatsächlich ist.
12/13.05.2024
- Diese markanten Merkmale dienen verschiedenen Zwecken, sowohl in der Kommunikation als auch im Schutz vor Fressfeinden.
Einige Schmetterlinge haben Ocellen, die denen von größeren Augen ähneln. Diese Augenflecken können potenzielle Fressfeinde wie Vögel oder Eidechsen abschrecken oder verwirren, indem sie den Eindruck erwecken, dass der Schmetterling viel größer ist als er tatsächlich ist.
Dies kann dazu beitragen, dass der Schmetterling nicht angegriffen wird, da er für den Feind möglicherweise als zu riskantes Ziel erscheint. Ocellen können auch in der Kommunikation zwischen Artgenossen eine Rolle spielen. Bei einigen Arten dienen sie möglicherweise dazu, das Geschlecht anzuziehen oder Rivalen abzuschrecken. Ocellen können auch eine Rolle bei der Thermoregulation spielen, insbesondere bei kühleren Temperaturen.
Dunkle Flecken absorbieren Wärme, was dazu beitragen kann, die Körpertemperatur des Insekts zu erhöhen und es zu ermöglichen, aktiv zu bleiben. Schließlich können Ocellen auch einfach ästhetische Merkmale sein, die zur Vielfalt und Schönheit der Schmetterlingsflügel beitragen. Insgesamt sind Ocellen faszinierende Merkmale, die eine Vielzahl von Funktionen in der Biologie und dem Verhalten von Schmetterlingen und anderen Insekten erfüllen.
In der Aufnahme
Aufnahme und Autor
Dunkle Flecken absorbieren Wärme, was dazu beitragen kann, die Körpertemperatur des Insekts zu erhöhen und es zu ermöglichen, aktiv zu bleiben. Schließlich können Ocellen auch einfach ästhetische Merkmale sein, die zur Vielfalt und Schönheit der Schmetterlingsflügel beitragen. Insgesamt sind Ocellen faszinierende Merkmale, die eine Vielzahl von Funktionen in der Biologie und dem Verhalten von Schmetterlingen und anderen Insekten erfüllen.
In der Aufnahme
- Ocellen ... auf dem Kopf der Libelle sind in der Mitte 3 Punktaugen zu erkennen, die Ocellen ...viele Tiergruppen haben diese "Zusatzaugen". Die Libellen benötigen sie (wahrscheinlich) als Gleichgewichtsorgen für den horizontalen Flug und wohl auch für schnelle Flugänderungen ...bei genauer Betrachtung sind diese im Dreieck angeordneten Augen bei vielen Insekten, primär Fluginsekten vorhanden ... Sie sind ein Sinnesorgan neben den "normalen" Komplexaugen ... Auch wenn es wissenschaftliche Untersuchungen gibt, wissen wir noch nicht alles über diese Sinnesorgane ...diese Prachtlibelle saß mir heute Modell....
Aufnahme und Autor
- Bernhard Schmalisch
Artenschutz in Franken®
Die Ameisenfliege

Die Ameisenfliege ...
12/13.05.2024
... keine fliegende Ameise, wie ein Betrachter vermuten könnte ... Ameisen haben Fühler, Fliegen nur so genannte Stummelfühler.
12/13.05.2024
... keine fliegende Ameise, wie ein Betrachter vermuten könnte ... Ameisen haben Fühler, Fliegen nur so genannte Stummelfühler.
Fliegen in dieser Familie sind sehr klein und Ameisenähnlich ... diese hier hatte eine Größe von etwa 4 mm, lief schnell auf einem Blatt hin und her und winkte permanent mit den Flügeln.
Aufahme und Autor
Aufahme und Autor
- Bernhard Schmalisch
Artenschutz in Franken®
Bergweißling (Pieris bryoniae)

Bergweißling (Pieris bryoniae)
12/13.05.2024
Diese Art ist in den Gebirgen Eurasiens beheimatet und bewohnt vor allem alpine und subalpine Regionen. Hier sind sie oft in Höhenlagen über 1000 Metern anzutreffen.
Die Flügel des Bergweißlings sind weiß mit schwarzen Spitzen an den Vorderflügeln. Die Unterseite der Flügel zeigt ein charakteristisches Muster aus schwarzen Flecken und Punkten auf einem gelblichen Grund. Die Flügelspannweite beträgt etwa 35 bis 45 Millimeter.
12/13.05.2024
- Der Bergweißling (Pieris bryoniae) ist ein Schmetterling aus der Familie der Weißlinge (Pieridae).
Diese Art ist in den Gebirgen Eurasiens beheimatet und bewohnt vor allem alpine und subalpine Regionen. Hier sind sie oft in Höhenlagen über 1000 Metern anzutreffen.
Die Flügel des Bergweißlings sind weiß mit schwarzen Spitzen an den Vorderflügeln. Die Unterseite der Flügel zeigt ein charakteristisches Muster aus schwarzen Flecken und Punkten auf einem gelblichen Grund. Die Flügelspannweite beträgt etwa 35 bis 45 Millimeter.
Die Raupen des Bergweißlings ernähren sich hauptsächlich von Pflanzen der Gattung Steinbrech (Saxifraga), aber auch von anderen krautigen Pflanzen, die in alpinen Gebieten vorkommen. Sie sind meist grün gefärbt und können sich gut an ihre Umgebung anpassen.
Die Bergweißlinge sind tagaktiv und fliegen in der Regel von Mai bis August. Sie bevorzugen sonnige Hänge und Wiesen in ihren Lebensräumen. Wie viele andere Schmetterlingsarten sind sie aufgrund von Lebensraumveränderungen und Umweltbelastungen durch den Klimawandel bedroht.
Aufnahme von Albert Meier im Mai 2024 in Bayern
Die Bergweißlinge sind tagaktiv und fliegen in der Regel von Mai bis August. Sie bevorzugen sonnige Hänge und Wiesen in ihren Lebensräumen. Wie viele andere Schmetterlingsarten sind sie aufgrund von Lebensraumveränderungen und Umweltbelastungen durch den Klimawandel bedroht.
Aufnahme von Albert Meier im Mai 2024 in Bayern
Artenschutz in Franken®
Die Gelbe Dungfliege

Die Gelbe Dungfliege oder Gemeine Kotfliege (Scathophaga stercoraria)
11/12.05.2024
Ihr Lebensraum erstreckt sich über Wiesen, Weiden und andere Gebiete, in denen Vieh gehalten wird. Diese Fliegenart hat eine wichtige Rolle im Ökosystem, insbesondere in Bezug auf den Abbau von tierischem Kot und die Nährstoffkreisläufe in landwirtschaftlichen Umgebungen.
11/12.05.2024
- Die Gelbe Dungfliege, wissenschaftlich bekannt als Scathophaga stercoraria, ist eine häufige und weit verbreitete Fliegenart, die in vielen Teilen der Welt vorkommt.
Ihr Lebensraum erstreckt sich über Wiesen, Weiden und andere Gebiete, in denen Vieh gehalten wird. Diese Fliegenart hat eine wichtige Rolle im Ökosystem, insbesondere in Bezug auf den Abbau von tierischem Kot und die Nährstoffkreisläufe in landwirtschaftlichen Umgebungen.
Die Gelbe Dungfliege ist mittelgroß und hat eine auffällige gelbe Färbung, die sie leicht von anderen Fliegenarten unterscheidet. Ihr Körper ist schlank und hat auffällige rote Augen. Die Flügel sind transparent mit dunklen Flecken oder Streifen. Diese Merkmale machen sie leicht erkennbar, wenn sie über Weiden oder Feldern fliegen.
Der Lebenszyklus der Gelben Dungfliege beginnt mit der Eiablage auf frischem Tierkot, insbesondere von Säugetieren wie Rindern oder Pferden. Die Weibchen legen ihre Eier in kleinen Gruppen auf oder in der Nähe des Kots ab. Die Larven schlüpfen nach kurzer Zeit und ernähren sich von den organischen Materialien im Kot, wodurch sie zu wichtigen Destruenten werden, die beim Abbau von organischen Substanzen helfen.
Gelbe Dungfliegen sind für ihr auffälliges Flugverhalten bekannt, insbesondere über Weiden, auf denen Vieh gehalten wird. Sie sind oft in großen Schwärmen zu sehen, die sich um frischen Kot sammeln. Dort ernähren sie sich nicht nur von den organischen Materialien, sondern paaren sich auch und legen ihre Eier ab. Sie spielen somit eine wichtige Rolle im Abbau von Tierexkrementen und tragen zur Hygiene in landwirtschaftlichen Umgebungen bei.
Die Gelbe Dungfliege ist ein wesentlicher Bestandteil des Ökosystems, insbesondere in landwirtschaftlichen Gebieten. Durch den Abbau von Tierkot helfen sie, Nährstoffe wieder in den Boden zu bringen und tragen zur Aufrechterhaltung der Bodengesundheit bei. Darüber hinaus dienen sie als Nahrungsquelle für andere Tiere wie Vögel und Spinnen, die von den Fliegen profitieren.
Die Gelbe Dungfliege oder Gemeine Kotfliege (Scathophaga stercoraria) ist ein faszinierendes Insekt, das eine wichtige Rolle im Ökosystem spielt, insbesondere in landwirtschaftlichen Umgebungen. Durch den Abbau von tierischem Kot tragen sie zur Aufrechterhaltung der Bodengesundheit bei und dienen gleichzeitig als Nahrungsquelle für andere Tiere. Ihre auffällige Erscheinung und ihr Verhalten machen sie zu einem interessanten Studienobjekt für Biologen und Naturliebhaber gleichermaßen.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
Der Lebenszyklus der Gelben Dungfliege beginnt mit der Eiablage auf frischem Tierkot, insbesondere von Säugetieren wie Rindern oder Pferden. Die Weibchen legen ihre Eier in kleinen Gruppen auf oder in der Nähe des Kots ab. Die Larven schlüpfen nach kurzer Zeit und ernähren sich von den organischen Materialien im Kot, wodurch sie zu wichtigen Destruenten werden, die beim Abbau von organischen Substanzen helfen.
Gelbe Dungfliegen sind für ihr auffälliges Flugverhalten bekannt, insbesondere über Weiden, auf denen Vieh gehalten wird. Sie sind oft in großen Schwärmen zu sehen, die sich um frischen Kot sammeln. Dort ernähren sie sich nicht nur von den organischen Materialien, sondern paaren sich auch und legen ihre Eier ab. Sie spielen somit eine wichtige Rolle im Abbau von Tierexkrementen und tragen zur Hygiene in landwirtschaftlichen Umgebungen bei.
Die Gelbe Dungfliege ist ein wesentlicher Bestandteil des Ökosystems, insbesondere in landwirtschaftlichen Gebieten. Durch den Abbau von Tierkot helfen sie, Nährstoffe wieder in den Boden zu bringen und tragen zur Aufrechterhaltung der Bodengesundheit bei. Darüber hinaus dienen sie als Nahrungsquelle für andere Tiere wie Vögel und Spinnen, die von den Fliegen profitieren.
Die Gelbe Dungfliege oder Gemeine Kotfliege (Scathophaga stercoraria) ist ein faszinierendes Insekt, das eine wichtige Rolle im Ökosystem spielt, insbesondere in landwirtschaftlichen Umgebungen. Durch den Abbau von tierischem Kot tragen sie zur Aufrechterhaltung der Bodengesundheit bei und dienen gleichzeitig als Nahrungsquelle für andere Tiere. Ihre auffällige Erscheinung und ihr Verhalten machen sie zu einem interessanten Studienobjekt für Biologen und Naturliebhaber gleichermaßen.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- Die Gelbe Dungfliege (Scathophaga stercoraria) ist eine etwa 10 mm große Fliegenart. Sie zeichnet sich durch ihre gelbe Körperfärbung und metallisch glänzende Augen aus. Als Saprophage ernährt sie sich von Exkrementen und Aas.Diese Fliegenart spielt eine wichtige ökologische Rolle, da sie bei der Zersetzung von organischen Materialien hilft und so Nährstoffe im Ökosystem recycelt. In der Paarungszeit bilden Männchen und Weibchen Paare, wobei die Weibchen ihre Eier in Dung oder Verwesungsstoffe legen. Die Gelbe Dungfliege ist ein faszinierendes Beispiel für die Bedeutung von Insekten in der Natur und ihrer Rolle im Nährstoffkreislauf.
Artenschutz in Franken®
Waldmaikäfer (Melolontha hippocastani)

Der Waldmaikäfer (Melolontha hippocastani): Ein Symbol der Frühlingszeit und ein faszinierendes Insekt des Waldes
1/12.05.2024
Mit seinem markanten Erscheinungsbild und seinem Verhalten hat dieser Käfer eine lange Geschichte der Faszination und des Interesses bei Naturforschern, Naturliebhabern und sogar in der Folklore.
1/12.05.2024
- Der Waldmaikäfer (Melolontha hippocastani) ist eine bemerkenswerte Kreatur, die oft als Symbol für den Beginn des Frühlings und das Erwachen der Natur angesehen wird.
Mit seinem markanten Erscheinungsbild und seinem Verhalten hat dieser Käfer eine lange Geschichte der Faszination und des Interesses bei Naturforschern, Naturliebhabern und sogar in der Folklore.
Zunächst einmal ist der Waldmaikäfer ein Mitglied der Familie der Blatthornkäfer (Scarabaeidae) und gehört zur Gattung der Maikäfer. Sein wissenschaftlicher Name, Melolontha hippocastani, deutet auf seine enge Verwandtschaft mit anderen Arten von Maikäfern hin. Diese Käfer sind in Europa heimisch und kommen in Laubwäldern, Obstgärten und anderen Baumbeständen vor, wo sie eine wichtige Rolle im Ökosystem spielen.
Das markanteste Merkmal des Waldmaikäfers ist zweifellos sein Erscheinungsbild. Er ist ein mittelgroßer Käfer mit einem robusten Körper und einer dunkelbraunen bis schwarzen Färbung. Sein Körper ist mit kleinen, dichten Haaren bedeckt, die ihm ein mattes Aussehen verleihen. Die Flügeldecken haben eine rötlich-braune Färbung, die ihnen ein gewisses Maß an Kontrast verleiht. Diese Merkmale machen den Waldmaikäfer leicht erkennbar, besonders wenn er während der Abenddämmerung oder in der Nacht aktiv ist, wenn er oft am häufigsten gesichtet wird.
Das Verhalten des Waldmaikäfers ist ebenfalls faszinierend. Als Käfer, die hauptsächlich nachtaktiv sind, verbringen sie den größten Teil ihres Lebens im Boden, wo ihre Larven als Engerlinge leben. Diese Larven ernähren sich von den Wurzeln von Gräsern und anderen Pflanzen und können in großen Mengen auftreten, was zu Schäden in landwirtschaftlichen und gärtnerischen Kulturen führen kann. Als erwachsene Käfer sind sie jedoch hauptsächlich an Laub und Blättern interessiert, obwohl sie gelegentlich auch Blüten und Früchte fressen können.
Ein weiteres faszinierendes Merkmal des Waldmaikäfers ist sein Lebenszyklus, der eng mit den Jahreszeiten verbunden ist. Die Käfer erscheinen typischerweise im Frühling, oft um die Zeit des Maifeiertags herum, was ihnen ihren gebräuchlichen Namen eingebracht hat. Diese Massenerscheinungen von Käfern können zu spektakulären Phänomenen führen, wenn Tausende von Käfern gleichzeitig aus dem Boden schlüpfen und sich auf der Suche nach Nahrung und einem Partner in die Luft erheben.
In der Folklore und Literatur haben Waldmaikäfer oft eine symbolische Bedeutung als Zeichen des Frühlings und des Neubeginns. Sie werden oft mit Fruchtbarkeit, Wachstum und Erneuerung in Verbindung gebracht und haben daher in vielen Kulturen eine positive Bedeutung.
Insgesamt ist der Waldmaikäfer ein faszinierendes Insekt, das nicht nur aufgrund seines markanten Aussehens, sondern auch aufgrund seiner Rolle im Ökosystem und seiner kulturellen Bedeutung geschätzt wird. Durch seine Massenerscheinungen im Frühling erinnert er uns daran, dass die Natur ein endloses Wunder ist, das es zu bewundern und zu schützen gilt.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
Das markanteste Merkmal des Waldmaikäfers ist zweifellos sein Erscheinungsbild. Er ist ein mittelgroßer Käfer mit einem robusten Körper und einer dunkelbraunen bis schwarzen Färbung. Sein Körper ist mit kleinen, dichten Haaren bedeckt, die ihm ein mattes Aussehen verleihen. Die Flügeldecken haben eine rötlich-braune Färbung, die ihnen ein gewisses Maß an Kontrast verleiht. Diese Merkmale machen den Waldmaikäfer leicht erkennbar, besonders wenn er während der Abenddämmerung oder in der Nacht aktiv ist, wenn er oft am häufigsten gesichtet wird.
Das Verhalten des Waldmaikäfers ist ebenfalls faszinierend. Als Käfer, die hauptsächlich nachtaktiv sind, verbringen sie den größten Teil ihres Lebens im Boden, wo ihre Larven als Engerlinge leben. Diese Larven ernähren sich von den Wurzeln von Gräsern und anderen Pflanzen und können in großen Mengen auftreten, was zu Schäden in landwirtschaftlichen und gärtnerischen Kulturen führen kann. Als erwachsene Käfer sind sie jedoch hauptsächlich an Laub und Blättern interessiert, obwohl sie gelegentlich auch Blüten und Früchte fressen können.
Ein weiteres faszinierendes Merkmal des Waldmaikäfers ist sein Lebenszyklus, der eng mit den Jahreszeiten verbunden ist. Die Käfer erscheinen typischerweise im Frühling, oft um die Zeit des Maifeiertags herum, was ihnen ihren gebräuchlichen Namen eingebracht hat. Diese Massenerscheinungen von Käfern können zu spektakulären Phänomenen führen, wenn Tausende von Käfern gleichzeitig aus dem Boden schlüpfen und sich auf der Suche nach Nahrung und einem Partner in die Luft erheben.
In der Folklore und Literatur haben Waldmaikäfer oft eine symbolische Bedeutung als Zeichen des Frühlings und des Neubeginns. Sie werden oft mit Fruchtbarkeit, Wachstum und Erneuerung in Verbindung gebracht und haben daher in vielen Kulturen eine positive Bedeutung.
Insgesamt ist der Waldmaikäfer ein faszinierendes Insekt, das nicht nur aufgrund seines markanten Aussehens, sondern auch aufgrund seiner Rolle im Ökosystem und seiner kulturellen Bedeutung geschätzt wird. Durch seine Massenerscheinungen im Frühling erinnert er uns daran, dass die Natur ein endloses Wunder ist, das es zu bewundern und zu schützen gilt.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
- Paarung der Waldmaikäfer
Artenschutz in Franken®
Gebänderte Prachtlibelle (Calopteryx splendens)

Die Gebänderte Prachtlibelle (Calopteryx splendens) ist eine atemberaubend schöne Libellenart, die in Europa weit verbreitet ist.
10/11.05.2024
Diese Libellenart ist in weiten Teilen Europas verbreitet und kommt in Fließgewässern wie Bächen, Flüssen und Kanälen vor, die sauberes und langsam fließendes Wasser bieten.
10/11.05.2024
- Die Gebänderte Prachtlibelle gehört zur Familie der Prachtlibellen (Calopterygidae) und zur Ordnung der Libellen (Odonata).
Diese Libellenart ist in weiten Teilen Europas verbreitet und kommt in Fließgewässern wie Bächen, Flüssen und Kanälen vor, die sauberes und langsam fließendes Wasser bieten.
Männliche Gebänderte Prachtlibellen sind besonders auffällig mit ihren metallisch glänzenden, tiefblauen Flügeln und dem dunklen, gebänderten Muster auf ihren Flügeln. Die Weibchen sind eher bräunlich gefärbt und haben durchsichtige Flügel. Gebänderte Prachtlibellen sind vor allem während der warmen Monate aktiv und ernähren sich von kleinen Insekten, die sie während ihres Fluges aus der Luft schnappen. Sie sind agile Flieger und können blitzschnelle Manöver ausführen, um Beute zu fangen und Rivalen zu vermeiden.
Die Paarung bei Gebänderten Prachtlibellen findet typischerweise in der Nähe von Gewässern statt. Die Weibchen legen ihre Eier in das Wasser, wo sie sich zu Larven entwickeln, die als Nymphen bezeichnet werden. Diese Larven leben im Wasser und ernähren sich von kleinen Wasserinsekten und anderen Beutetieren, bis sie sich schließlich zu ausgewachsenen Libellen entwickeln.
Obwohl die Gebänderte Prachtlibelle in vielen Teilen Europas recht häufig ist, sind ihre Populationen dennoch durch Lebensraumverlust und Verschmutzung von Gewässern bedroht. Maßnahmen zum Schutz ihrer Lebensräume sind daher wichtig, um langfristig das Überleben dieser faszinierenden Libellenart zu sichern. Die Gebänderte Prachtlibelle ist nicht nur ein visuell beeindruckendes Insekt, sondern auch ein wichtiger Bestandteil vieler aquatischer Ökosysteme, und ihr Schutz trägt zum Erhalt der biologischen Vielfalt bei.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
Die Paarung bei Gebänderten Prachtlibellen findet typischerweise in der Nähe von Gewässern statt. Die Weibchen legen ihre Eier in das Wasser, wo sie sich zu Larven entwickeln, die als Nymphen bezeichnet werden. Diese Larven leben im Wasser und ernähren sich von kleinen Wasserinsekten und anderen Beutetieren, bis sie sich schließlich zu ausgewachsenen Libellen entwickeln.
Obwohl die Gebänderte Prachtlibelle in vielen Teilen Europas recht häufig ist, sind ihre Populationen dennoch durch Lebensraumverlust und Verschmutzung von Gewässern bedroht. Maßnahmen zum Schutz ihrer Lebensräume sind daher wichtig, um langfristig das Überleben dieser faszinierenden Libellenart zu sichern. Die Gebänderte Prachtlibelle ist nicht nur ein visuell beeindruckendes Insekt, sondern auch ein wichtiger Bestandteil vieler aquatischer Ökosysteme, und ihr Schutz trägt zum Erhalt der biologischen Vielfalt bei.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- Gebänderte Prachtlibelle im Mai 2024
Artenschutz in Franken®
Neuntöter (Lanius collurio)

Der Neuntöter (Lanius collurio) ist ein faszinierender Singvogel, der in Europa, Teilen Asiens und Nordafrikas verbreitet ist.
10/11.05.2024
Der Neuntöter gehört zur Familie der Würger (Laniidae) und zur Ordnung der Sperlingsvögel (Passeriformes).Neuntöter sind Zugvögel und verbringen den Winter in Afrika südlich der Sahara. Im Sommer brüten sie in offenen Landschaften wie Heiden, Buschland, Wiesen und Weiden mit isolierten Bäumen oder Büschen.
10/11.05.2024
- Hier sind einige interessante Fakten über diese Art:
Der Neuntöter gehört zur Familie der Würger (Laniidae) und zur Ordnung der Sperlingsvögel (Passeriformes).Neuntöter sind Zugvögel und verbringen den Winter in Afrika südlich der Sahara. Im Sommer brüten sie in offenen Landschaften wie Heiden, Buschland, Wiesen und Weiden mit isolierten Bäumen oder Büschen.
Männliche Neuntöter haben ein auffälliges Gefieder mit einem grauen Kopf, einem schwarzen Augenstreif und einem rostbraunen Rücken. Die Weibchen sind weniger kontrastreich gefärbt und haben eine braun gestreifte Unterseite. Neuntöter sind Fleischfresser und ernähren sich hauptsächlich von Insekten wie Käfern, Heuschrecken, Schmetterlingen und Spinnen. Sie jagen von Ansitzwarten aus und stoßen dann blitzschnell auf ihre Beute zu.
Während der Brutzeit verteidigen Neuntöter aggressiv ihr Territorium. Sie bauen ihre Nester in dornigen Büschen oder Bäumen und legen gewöhnlich vier bis sechs Eier.Neuntöter sind dafür bekannt, ihre Beute auf Dornen oder Stacheldraht zu spießen. Dieses Verhalten dient dazu, die Nahrung zu lagern, indem sie sie für später verzehren. Sie werden daher auch manchmal als "Fleischräuber" bezeichnet.
In einigen Teilen Europas, insbesondere in Großbritannien, ist der Bestand des Neuntöters rückläufig. Dies ist auf Lebensraumverlust durch intensive Landwirtschaft, Pestizideinsatz und Verlust von Brutplätzen zurückzuführen. In anderen Regionen, wie zum Beispiel in Teilen von Osteuropa, ist der Neuntöter jedoch häufiger anzutreffen.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
Während der Brutzeit verteidigen Neuntöter aggressiv ihr Territorium. Sie bauen ihre Nester in dornigen Büschen oder Bäumen und legen gewöhnlich vier bis sechs Eier.Neuntöter sind dafür bekannt, ihre Beute auf Dornen oder Stacheldraht zu spießen. Dieses Verhalten dient dazu, die Nahrung zu lagern, indem sie sie für später verzehren. Sie werden daher auch manchmal als "Fleischräuber" bezeichnet.
In einigen Teilen Europas, insbesondere in Großbritannien, ist der Bestand des Neuntöters rückläufig. Dies ist auf Lebensraumverlust durch intensive Landwirtschaft, Pestizideinsatz und Verlust von Brutplätzen zurückzuführen. In anderen Regionen, wie zum Beispiel in Teilen von Osteuropa, ist der Neuntöter jedoch häufiger anzutreffen.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
- Junger Neuntöter
Artenschutz in Franken®
Gänsesäger (Mergus merganser)

Gänsesäger (Mergus merganser)
10/11.05.2024
Er ist bekannt für sein auffälliges Erscheinungsbild und sein spezialisiertes Verhalten beim Fischen. Männliche Gänsesäger haben ein auffälliges schwarz-weißes Federkleid mit grün schimmerndem Kopf. Sie haben einen langen, dünnen Schnabel und einen schlanken Körperbau. Weibliche Gänsesäger sind eher braun mit einem rostfarbenen Kopf.
10/11.05.2024
- Der Gänsesäger (Mergus merganser) ist eine Art von Wasservogel aus der Familie der Entenvögel.
Er ist bekannt für sein auffälliges Erscheinungsbild und sein spezialisiertes Verhalten beim Fischen. Männliche Gänsesäger haben ein auffälliges schwarz-weißes Federkleid mit grün schimmerndem Kopf. Sie haben einen langen, dünnen Schnabel und einen schlanken Körperbau. Weibliche Gänsesäger sind eher braun mit einem rostfarbenen Kopf.
Gänsesäger leben hauptsächlich in bewaldeten Gewässern wie Flüssen, Seen und Küstenregionen. Sie bevorzugen klare Gewässer mit reichlich Fischbestand. Diese Vögel sind spezialisierte Fischer. Sie tauchen unter Wasser, um nach Fischen zu jagen. Ihr schmales, scharfes Schnabel hilft ihnen dabei, ihre Beute zu fangen. Sie ernähren sich hauptsächlich von kleinen Fischen, aber auch von Krebstieren und anderen aquatischen Wirbellosen.
Gänsesäger brüten in Höhlen in der Nähe von Gewässern. Sie legen ihre Eier in einem Nest aus Federn und Pflanzenmaterial ab. Nach dem Schlüpfen führen die Eltern ihre Jungen zum Wasser, wo sie lernen zu schwimmen und zu tauchen.Einige Populationen von Gänsesägern sind Zugvögel und ziehen im Winter in wärmere Gebiete. Andere bleiben das ganze Jahr über in ihren Brutgebieten.
Der Gänsesäger ist in vielen Teilen seines Verbreitungsgebiets recht häufig und wird von verschiedenen Schutzmaßnahmen profitieren, die darauf abzielen, die Wasserqualität und die Lebensräume zu erhalten, die für sein Überleben wichtig sind.Insgesamt ist der Gänsesäger ein faszinierender Vogel mit einer Reihe von Anpassungen an sein Leben in und um das Wasser. Sein auffälliges Aussehen und sein interessantes Verhalten machen ihn zu einem beliebten Objekt für Vogelbeobachter und Naturliebhaber.
In der Aufnahme von Albert Meier
Gänsesäger brüten in Höhlen in der Nähe von Gewässern. Sie legen ihre Eier in einem Nest aus Federn und Pflanzenmaterial ab. Nach dem Schlüpfen führen die Eltern ihre Jungen zum Wasser, wo sie lernen zu schwimmen und zu tauchen.Einige Populationen von Gänsesägern sind Zugvögel und ziehen im Winter in wärmere Gebiete. Andere bleiben das ganze Jahr über in ihren Brutgebieten.
Der Gänsesäger ist in vielen Teilen seines Verbreitungsgebiets recht häufig und wird von verschiedenen Schutzmaßnahmen profitieren, die darauf abzielen, die Wasserqualität und die Lebensräume zu erhalten, die für sein Überleben wichtig sind.Insgesamt ist der Gänsesäger ein faszinierender Vogel mit einer Reihe von Anpassungen an sein Leben in und um das Wasser. Sein auffälliges Aussehen und sein interessantes Verhalten machen ihn zu einem beliebten Objekt für Vogelbeobachter und Naturliebhaber.
In der Aufnahme von Albert Meier
- Gänsesägerweibchen im Habitat
Artenschutz in Franken®
Ringelnatter (Natrix natrix)

Die Ringelnatter (Natrix natrix) ... ist eine nicht giftige Schlangenart, die zur Familie der Nattern (Colubridae) gehört.
09/10.05.2024
Anatomisch betrachtet ist die Ringelnatter schlank und langgestreckt mit einer durchschnittlichen Länge von 60 bis 100 Zentimetern, obwohl einige Individuen bis zu 150 Zentimeter lang werden können. Ihre Körperfärbung variiert je nach Lebensraum und kann von olivgrün bis graubraun reichen, oft mit dunklen Flecken oder Streifen entlang des Rückens und der Seiten. Die Unterseite ist in der Regel heller und kann gelblich oder orange gefärbt sein.
09/10.05.2024
- Sie ist in Europa und Teilen Asiens weit verbreitet und bewohnt eine Vielzahl von Lebensräumen, einschließlich Feuchtgebiete, Wälder, Wiesen und sogar städtische Umgebungen.
Anatomisch betrachtet ist die Ringelnatter schlank und langgestreckt mit einer durchschnittlichen Länge von 60 bis 100 Zentimetern, obwohl einige Individuen bis zu 150 Zentimeter lang werden können. Ihre Körperfärbung variiert je nach Lebensraum und kann von olivgrün bis graubraun reichen, oft mit dunklen Flecken oder Streifen entlang des Rückens und der Seiten. Die Unterseite ist in der Regel heller und kann gelblich oder orange gefärbt sein.
Ringelnattern sind semi-aquatisch und ausgezeichnete Schwimmer. Sie ernähren sich hauptsächlich von Amphibien wie Fröschen, Kröten und Molchen, aber auch von kleinen Fischen und gelegentlich kleinen Säugetieren oder Vögeln. Ihr Jagdverhalten ist typisch für Schlangen: Sie lauern ihrer Beute auf, schleichen sich an sie heran und greifen dann blitzschnell an, um sie zu ergreifen.Fortpflanzungstechnisch sind Ringelnattern ovovivipar, was bedeutet, dass die Eier im Körper der Mutter ausgebrütet werden und sie lebende Jungschlangen zur Welt bringt. Die Paarung erfolgt im Frühjahr, und die Weibchen bringen im Spätsommer oder Herbst normalerweise eine Vielzahl von Jungschlangen zur Welt.
Aus ökologischer Sicht spielen Ringelnattern eine wichtige Rolle in ihren Ökosystemen, sowohl als Prädatoren von kleinen Wirbeltieren als auch als Beute für größere Raubtiere. Sie helfen, das Gleichgewicht in den Populationen ihrer Beutetiere zu regulieren, und dienen als Indikator für die Gesundheit von Feuchtgebieten und anderen Lebensräumen, in denen sie vorkommen. Insgesamt ist die Ringelnatter eine faszinierende Schlangenart, die gut an ihre Umgebung angepasst ist und eine wichtige Rolle in den Ökosystemen Europas und Asiens spielt.
Ringelnatter bei der Nahrungsaufnahme ...
... die Ringelnatter ist eine Schlangenart, die sich von Amphibien, wie Fröschen, ernährt. Der Prozess, wie eine Ringelnatter einen Wasserfrosch frisst, beginnt oft mit der Jagd. Ringelnattern sind ausgezeichnete Jäger und nutzen ihre Schnelligkeit und Tarnung, um ihre Beute zu überraschen. Sobald die Ringelnatter den Wasserfrosch entdeckt hat, schleicht sie sich langsam an ihn heran, um ihn nicht zu erschrecken. Sobald sie in Reichweite ist, greift sie blitzschnell an und ergreift den Frosch mit ihrem mächtigen Kiefer. Ihre Zähne sind nach hinten gerichtet, was es dem Frosch schwer macht zu entkommen. Sobald die Ringelnatter den Frosch ergriffen hat, wickelt sie sich oft um ihn herum, um ihn zu ersticken. Ringelnattern haben einen starken Griff und können ihre Beute festhalten, während sie sich um sie herumwinden.
Sobald der Frosch tot ist, beginnt die Schlange, ihn zu verschlingen.
Der Verdauungsprozess bei Schlangen ist langsam und kann je nach Größe der Beute mehrere Tage dauern. Die Ringelnatter wird den Frosch langsam schlucken, indem sie ihre Kiefer auseinander bewegt und die Beute nach und nach in ihren Körper schiebt. Warum eine Ringelnatter einen Wasserfrosch frisst, liegt in ihrer natürlichen Ernährung und ihrem Überlebensinstinkt begründet. Frösche sind eine reichhaltige Proteinquelle für Schlangen und stellen eine wichtige Nahrungsquelle dar. Durch das Fressen von Fröschen können Ringelnattern ihre Energie und Nährstoffe erhalten, die sie zum Überleben benötigen.
Aufnahme von Albert Meier
Aus ökologischer Sicht spielen Ringelnattern eine wichtige Rolle in ihren Ökosystemen, sowohl als Prädatoren von kleinen Wirbeltieren als auch als Beute für größere Raubtiere. Sie helfen, das Gleichgewicht in den Populationen ihrer Beutetiere zu regulieren, und dienen als Indikator für die Gesundheit von Feuchtgebieten und anderen Lebensräumen, in denen sie vorkommen. Insgesamt ist die Ringelnatter eine faszinierende Schlangenart, die gut an ihre Umgebung angepasst ist und eine wichtige Rolle in den Ökosystemen Europas und Asiens spielt.
Ringelnatter bei der Nahrungsaufnahme ...
... die Ringelnatter ist eine Schlangenart, die sich von Amphibien, wie Fröschen, ernährt. Der Prozess, wie eine Ringelnatter einen Wasserfrosch frisst, beginnt oft mit der Jagd. Ringelnattern sind ausgezeichnete Jäger und nutzen ihre Schnelligkeit und Tarnung, um ihre Beute zu überraschen. Sobald die Ringelnatter den Wasserfrosch entdeckt hat, schleicht sie sich langsam an ihn heran, um ihn nicht zu erschrecken. Sobald sie in Reichweite ist, greift sie blitzschnell an und ergreift den Frosch mit ihrem mächtigen Kiefer. Ihre Zähne sind nach hinten gerichtet, was es dem Frosch schwer macht zu entkommen. Sobald die Ringelnatter den Frosch ergriffen hat, wickelt sie sich oft um ihn herum, um ihn zu ersticken. Ringelnattern haben einen starken Griff und können ihre Beute festhalten, während sie sich um sie herumwinden.
Sobald der Frosch tot ist, beginnt die Schlange, ihn zu verschlingen.
Der Verdauungsprozess bei Schlangen ist langsam und kann je nach Größe der Beute mehrere Tage dauern. Die Ringelnatter wird den Frosch langsam schlucken, indem sie ihre Kiefer auseinander bewegt und die Beute nach und nach in ihren Körper schiebt. Warum eine Ringelnatter einen Wasserfrosch frisst, liegt in ihrer natürlichen Ernährung und ihrem Überlebensinstinkt begründet. Frösche sind eine reichhaltige Proteinquelle für Schlangen und stellen eine wichtige Nahrungsquelle dar. Durch das Fressen von Fröschen können Ringelnattern ihre Energie und Nährstoffe erhalten, die sie zum Überleben benötigen.
Aufnahme von Albert Meier
- Ringelnatter bei der Nahrungsaufnahme
Artenschutz in Franken®
Vogelschlag an Bauwerken ...

Vogelschlag an Bauwerken ...
08/09.05.2024
... ein nicht zu unterschätzendes Problem innerhalb der Biodiversitätssicherung. Wir haben hier einige Informationen zu diesem Thema niedergeschrieben um eine kleine Diskussionsgrundlage zur Vermeidung dieser Todesfalle sichtbar werden zu lassen.
Vogelschlag an Bauwerken tritt auf, wenn Vögel versehentlich gegen Gebäude oder andere menschliche Strukturen fliegen.
Dies geschieht aus verschiedenen Gründen, darunter:
• Reflexionen: Glasfassaden können für Vögel reflektieren, was sie dazu verleitet, sie als offenen Raum zu betrachten und direkt darauf zuzufliegen.
• Lichtverschmutzung: Nachts beleuchtete Gebäude können Vögel anziehen und sie verwirren, sodass sie gegen beleuchtete Fenster oder Gebäudeteile fliegen.
• Habitatfragmentierung: Bauwerke können natürliche Lebensräume von Vögeln unterbrechen oder zerstören, was dazu führt, dass sie während des Fluges mit diesen Strukturen kollidieren.
• Navigation: In städtischen Gebieten können hohe Gebäude die natürliche Navigation von Vögeln stören, was zu Kollisionen führen kann.
08/09.05.2024
... ein nicht zu unterschätzendes Problem innerhalb der Biodiversitätssicherung. Wir haben hier einige Informationen zu diesem Thema niedergeschrieben um eine kleine Diskussionsgrundlage zur Vermeidung dieser Todesfalle sichtbar werden zu lassen.
Vogelschlag an Bauwerken tritt auf, wenn Vögel versehentlich gegen Gebäude oder andere menschliche Strukturen fliegen.
Dies geschieht aus verschiedenen Gründen, darunter:
• Reflexionen: Glasfassaden können für Vögel reflektieren, was sie dazu verleitet, sie als offenen Raum zu betrachten und direkt darauf zuzufliegen.
• Lichtverschmutzung: Nachts beleuchtete Gebäude können Vögel anziehen und sie verwirren, sodass sie gegen beleuchtete Fenster oder Gebäudeteile fliegen.
• Habitatfragmentierung: Bauwerke können natürliche Lebensräume von Vögeln unterbrechen oder zerstören, was dazu führt, dass sie während des Fluges mit diesen Strukturen kollidieren.
• Navigation: In städtischen Gebieten können hohe Gebäude die natürliche Navigation von Vögeln stören, was zu Kollisionen führen kann.
Um Vogelschlag an Bauwerken zu reduzieren, gibt es verschiedene Lösungen:
Fenstermarkierungen: Das Anbringen von Aufklebern, Markierungen oder Netzen an Fenstern kann Vögel davon abhalten, gegen Glasflächen zu fliegen, indem sie sie als Hindernis erkennen. Im Handel gibt es hier bereits interessante Produkte die auch sehr gut wirken, darüber hinaus gibt es auch Produkte die eben nicht funktionieren. Gerade in den letzten Jahren ist konnten hier wertvolle Entwicklungsschritte gemacht werden. Die Aufbringung von Greifvogelsilhouetten "reicht hier sicherlich nicht aus".
Reduzierung von Lichtverschmutzung: Die Reduzierung oder Abschaltung von nächtlicher Beleuchtung an Gebäuden kann verhindern, dass Vögel von künstlichem Licht angezogen werden.
Strukturelle Änderungen: Die Gestaltung von Gebäuden mit abgewinkelten Glasflächen oder anderen Hindernissen kann verhindern, dass Vögel gegen sie fliegen.
Naturnahe Gestaltung: Die Integration von Pflanzen oder anderen natürlichen Elementen in städtische Gebäude kann Vögeln alternative Lebensräume bieten und sie von Glasflächen ablenken.
Umweltbildungsmaßnahmen: Die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für das Problem des Vogelschlags und die Förderung von Maßnahmen zum Schutz von Vögeln können dazu beitragen, das Bewusstsein für dieses Thema zu schärfen und Lösungen zu fördern.
Diese Maßnahmen können einzeln oder in Kombination angewendet werden, um Vogelschlag an Bauwerken zu reduzieren und die Sicherheit von Vögeln zu gewährleisten. Doch nicht "nur" an Bauwerken tritt Vogelschlag auf, auch der Straßenverkehr stellt eine nicht zu unterschätzende Gefahrenquelle in dieser Hinsicht da.
Vogelschlag im Straßenverkehr tritt auf, wenn Vögel mit Fahrzeugen kollidieren, während sie über Straßen fliegen oder diese überqueren. Dies kann gefährlich sein, sowohl für die Vögel als auch für die Insassen der Fahrzeuge. Es kann zu Schäden an Fahrzeugen führen und in einigen Fällen sogar Unfälle verursachen.
Hier sind einige Gründe für Vogelschlag im Straßenverkehr:
Um Vogelschlag im Straßenverkehr zu vermeiden, können folgende Maßnahmen ergriffen werden:
Geschwindigkeitsreduzierung: Durch die Reduzierung der Geschwindigkeit können Fahrer mehr Zeit haben, auf Vögel zu reagieren, die die Straße überqueren oder in der Nähe fliegen.
Warnschilder: Das Aufstellen von Warnschildern an Stellen, an denen bekannt ist, dass sich Vögel häufig über Straßen bewegen, kann Fahrer auf die potenzielle Gefahr aufmerksam machen und sie zu erhöhter Vorsicht anhalten.
Tierbrücken: In einigen Gebieten werden spezielle Brücken oder Unterführungen für Wildtiere gebaut, um ihnen das sichere Überqueren von Straßen zu ermöglichen. Diese können auch für Vögel eingerichtet werden.
Umweltbildung: Die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für das Thema Vogelschlag im Straßenverkehr kann dazu beitragen, dass Fahrer vorsichtiger sind und potenzielle Gefahren besser einschätzen können.
Vegetationsmanagement: Die Pflege von Grünflächen entlang von Straßen kann dazu beitragen, Lebensräume für Vögel zu schaffen, die sie von den Straßen fernhalten.
Durch die Kombination dieser Maßnahmen können Vogelschlagunfälle im Straßenverkehr reduziert werden, was sowohl den Vögeln als auch den Fahrzeuginsassen zugutekommt.
Doch gerade auch beim Vogelschlag auf Straßen möchten wir einen weiteren Punkt ins Gespräch bringen, das Ansitzen von Vögel auf den "Achsen der Mobilität".
Doch weshalb sitzen eigentlich Vögel auf den Straßen?
Es gibt mehrere Gründe, warum Vögel auf Straßen sitzen:
Obwohl Straßen für Vögel attraktiv sein können, birgt das Sitzen oder Herumlaufen auf ihnen auch Gefahren, insbesondere durch den Verkehr. Kollisionen mit Fahrzeugen stellen eine ernsthafte Bedrohung für Vögel dar, und viele werden jedes Jahr Opfer von Verkehrsunfällen. Daher ist es wichtig, dass Autofahrer besonders vorsichtig sind, wenn sie Straßen durchqueren, die von Vögeln frequentiert werden könnten, und ihre Geschwindigkeit reduzieren, um Kollisionen zu vermeiden.
In der Aufnahme
Möchten Sie mehr zu diesem Thema erfahren?
Kontaktieren Sie uns!
Artenschutz in Franken®
Fenstermarkierungen: Das Anbringen von Aufklebern, Markierungen oder Netzen an Fenstern kann Vögel davon abhalten, gegen Glasflächen zu fliegen, indem sie sie als Hindernis erkennen. Im Handel gibt es hier bereits interessante Produkte die auch sehr gut wirken, darüber hinaus gibt es auch Produkte die eben nicht funktionieren. Gerade in den letzten Jahren ist konnten hier wertvolle Entwicklungsschritte gemacht werden. Die Aufbringung von Greifvogelsilhouetten "reicht hier sicherlich nicht aus".
Reduzierung von Lichtverschmutzung: Die Reduzierung oder Abschaltung von nächtlicher Beleuchtung an Gebäuden kann verhindern, dass Vögel von künstlichem Licht angezogen werden.
Strukturelle Änderungen: Die Gestaltung von Gebäuden mit abgewinkelten Glasflächen oder anderen Hindernissen kann verhindern, dass Vögel gegen sie fliegen.
Naturnahe Gestaltung: Die Integration von Pflanzen oder anderen natürlichen Elementen in städtische Gebäude kann Vögeln alternative Lebensräume bieten und sie von Glasflächen ablenken.
Umweltbildungsmaßnahmen: Die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für das Problem des Vogelschlags und die Förderung von Maßnahmen zum Schutz von Vögeln können dazu beitragen, das Bewusstsein für dieses Thema zu schärfen und Lösungen zu fördern.
Diese Maßnahmen können einzeln oder in Kombination angewendet werden, um Vogelschlag an Bauwerken zu reduzieren und die Sicherheit von Vögeln zu gewährleisten. Doch nicht "nur" an Bauwerken tritt Vogelschlag auf, auch der Straßenverkehr stellt eine nicht zu unterschätzende Gefahrenquelle in dieser Hinsicht da.
Vogelschlag im Straßenverkehr tritt auf, wenn Vögel mit Fahrzeugen kollidieren, während sie über Straßen fliegen oder diese überqueren. Dies kann gefährlich sein, sowohl für die Vögel als auch für die Insassen der Fahrzeuge. Es kann zu Schäden an Fahrzeugen führen und in einigen Fällen sogar Unfälle verursachen.
Hier sind einige Gründe für Vogelschlag im Straßenverkehr:
- Niedrige Flughöhe: Vögel fliegen manchmal in niedrigen Höhen über Straßen, um Nahrung zu suchen oder zu migrieren. Dies bringt sie in direkte Nähe von Fahrzeugen.
- Überqueren von Straßen: Vögel überqueren manchmal Straßen, um zu anderen Nahrungsquellen oder Brutgebieten zu gelangen. Dabei können sie mit Fahrzeugen kollidieren.
- Blendung durch Fahrzeuge: Fahrzeuge können Vögel durch ihre Lichter oder Reflexionen von Scheiben blenden, was zu unvorhersehbarem Flugverhalten führt und Kollisionen begünstigt.
Um Vogelschlag im Straßenverkehr zu vermeiden, können folgende Maßnahmen ergriffen werden:
Geschwindigkeitsreduzierung: Durch die Reduzierung der Geschwindigkeit können Fahrer mehr Zeit haben, auf Vögel zu reagieren, die die Straße überqueren oder in der Nähe fliegen.
Warnschilder: Das Aufstellen von Warnschildern an Stellen, an denen bekannt ist, dass sich Vögel häufig über Straßen bewegen, kann Fahrer auf die potenzielle Gefahr aufmerksam machen und sie zu erhöhter Vorsicht anhalten.
Tierbrücken: In einigen Gebieten werden spezielle Brücken oder Unterführungen für Wildtiere gebaut, um ihnen das sichere Überqueren von Straßen zu ermöglichen. Diese können auch für Vögel eingerichtet werden.
Umweltbildung: Die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für das Thema Vogelschlag im Straßenverkehr kann dazu beitragen, dass Fahrer vorsichtiger sind und potenzielle Gefahren besser einschätzen können.
Vegetationsmanagement: Die Pflege von Grünflächen entlang von Straßen kann dazu beitragen, Lebensräume für Vögel zu schaffen, die sie von den Straßen fernhalten.
Durch die Kombination dieser Maßnahmen können Vogelschlagunfälle im Straßenverkehr reduziert werden, was sowohl den Vögeln als auch den Fahrzeuginsassen zugutekommt.
Doch gerade auch beim Vogelschlag auf Straßen möchten wir einen weiteren Punkt ins Gespräch bringen, das Ansitzen von Vögel auf den "Achsen der Mobilität".
Doch weshalb sitzen eigentlich Vögel auf den Straßen?
Es gibt mehrere Gründe, warum Vögel auf Straßen sitzen:
- Nahrungssuche: Vögel suchen oft entlang von Straßen nach Nahrung, sei es in Form von Insekten, Samen oder anderen Nahrungsquellen, die in der Nähe zu finden sind. Besonders in ländlichen Gebieten, wo landwirtschaftliche Flächen an Straßen grenzen, können Vögel dort häufig nach Futter suchen.
- Wärme: Asphalt und Beton absorbieren Wärme, wodurch Straßen oft wärmer sind als die umgebende Umgebung. Besonders in kühleren Jahreszeiten können Vögel Straßen als warmen Ort zum Ausruhen wählen.
- Sichtbarkeit: Straßen können für Vögel eine freie Sichtlinie bieten, was es ihnen ermöglicht, potenzielle Bedrohungen wie Raubtiere leichter zu erkennen. Dies macht Straßen zu beliebten Orten für Vögel, um sich niederzulassen und nach Gefahren Ausschau zu halten.
- Rastplätze: Während ihrer Migration legen viele Vogelarten lange Strecken zurück. Straßen können als praktische Rastplätze dienen, wo sich Vögel ausruhen und Energie für ihre Reise sammeln können.
- Gewohnheit: In manchen Fällen können Vögel sich an das Sitzen auf Straßen gewöhnen, insbesondere wenn sie positive Erfahrungen damit gemacht haben, zum Beispiel wenn sie regelmäßig Nahrung oder Schutz an Straßen finden.
Obwohl Straßen für Vögel attraktiv sein können, birgt das Sitzen oder Herumlaufen auf ihnen auch Gefahren, insbesondere durch den Verkehr. Kollisionen mit Fahrzeugen stellen eine ernsthafte Bedrohung für Vögel dar, und viele werden jedes Jahr Opfer von Verkehrsunfällen. Daher ist es wichtig, dass Autofahrer besonders vorsichtig sind, wenn sie Straßen durchqueren, die von Vögeln frequentiert werden könnten, und ihre Geschwindigkeit reduzieren, um Kollisionen zu vermeiden.
In der Aufnahme
- Im Straßenverkehr (hier sogar auf Forststraßen) getöteter Buchfink. Gerade auch in der Brutzeit fällt mit jedem getöteten Tier auch der gesamte Nachwuchs aus!
Möchten Sie mehr zu diesem Thema erfahren?
Kontaktieren Sie uns!
Artenschutz in Franken®
Artenschutz in Franken®
Das Sterben der Eisvogel - Unwetter und Hochwasser der Erft

Das Sterben der Eisvogel - Unwetter und Hochwasser der Erft
07/08.05.2024
(...) Einige Naturhöhlen vom Eisvogel wurden vom letzten Hochwasser überschwemmt.
Drei Bruten waren betroffen, weil sie nur knapp über dem normalen Wasserspiegel
gegraben wurden. Alle Jungen sind verendet ...
07/08.05.2024
- Bedburg / Nordrhein-Westfalen. Rolf Thiemann berichtet über einen Vorgang der mit dem Klimawandel wohl noch häufiger anzutreffen sein wird.
(...) Einige Naturhöhlen vom Eisvogel wurden vom letzten Hochwasser überschwemmt.
Drei Bruten waren betroffen, weil sie nur knapp über dem normalen Wasserspiegel
gegraben wurden. Alle Jungen sind verendet ...
Die künstlichen Brutwände wurden von uns immer höher, als das zu erwartende Hochwasser, installiert. Diese künstlichen Brutwände sind alle intakt und der Eisvogel kann da seine Jungen ungestört aufziehen.
Um diese Situation für die Eisvögel zu entschärfen, schaffen wir in den betroffenen Gebieten Eisvogelbrutwände die höher liegen als das Überschwemmungsgebiet.
Die Brutstätten werden immer so angelegt, dass sie sich in der Umgebung anpassen und nicht zu erkennen sind.
Nicht nur das Hochwasser macht den Eisvögeln das Überleben schwer, sondern auch die extreme Wassertrübung, die ein erkennen von Beute unmöglich macht. Da wir noch viele Seitenarme, Gräben, Tümpel und Teiche mit klarem Wasser haben die nicht überschwemmt wurden, können die Vögel dort nach Nahrung fischen.
In der Aufnahme
Autor und Aufnahme
Rolf Thiemann
Gewässer und Naturschutz im Erftkreis
Flora-Fauna-Artenschutz
Naturschutzökologie
50181 Bedburg
Um diese Situation für die Eisvögel zu entschärfen, schaffen wir in den betroffenen Gebieten Eisvogelbrutwände die höher liegen als das Überschwemmungsgebiet.
Die Brutstätten werden immer so angelegt, dass sie sich in der Umgebung anpassen und nicht zu erkennen sind.
Nicht nur das Hochwasser macht den Eisvögeln das Überleben schwer, sondern auch die extreme Wassertrübung, die ein erkennen von Beute unmöglich macht. Da wir noch viele Seitenarme, Gräben, Tümpel und Teiche mit klarem Wasser haben die nicht überschwemmt wurden, können die Vögel dort nach Nahrung fischen.
In der Aufnahme
- ... gut durchdachte und gemachte Sekundärhabitate können als wertvolle Ergänzung zu Primärlebensräumen dienen ... gerade in sich zusehens wandelnde Zeitspannen ...
Autor und Aufnahme
Rolf Thiemann
Gewässer und Naturschutz im Erftkreis
Flora-Fauna-Artenschutz
Naturschutzökologie
50181 Bedburg
Artenschutz in Franken®
Ausblicke sichtbar werden lassen …

Ausblicke sichtbar werden lassen …
06/07.05.2024
Deutschland. Dieses Ökosystem haben wir seit geraumer Zeit in den A.i.F-Fokus gestellt. In einem weiteren innovativen Kooperationsprojekt implementieren wir hier erneut interessante Artenschutzzeichen auch und gerade, um die zunehmend gefährdete Biodiversität nachhaltig zu unterstützen.
06/07.05.2024
Deutschland. Dieses Ökosystem haben wir seit geraumer Zeit in den A.i.F-Fokus gestellt. In einem weiteren innovativen Kooperationsprojekt implementieren wir hier erneut interessante Artenschutzzeichen auch und gerade, um die zunehmend gefährdete Biodiversität nachhaltig zu unterstützen.
In den Mittelpunkt nehmen wir gleich drei Arten, die wir vornehmlich eigentlich in den urbanen Bereich verordnen würden. Doch nun gehen wir abermals neue und nicht weniger eindrucksvolle Wege um den Aspekt des Artenschutzes auch an anderer, dieser Stelle wirken zu lassen.
Selbstverständlich werden wir zu gegebener Zeit auch umfangreich über dieses Projekt berichten und das wie üblich hier auf den Seiten des Artenschutz in Franken®.
Selbstverständlich werden wir zu gegebener Zeit auch umfangreich über dieses Projekt berichten und das wie üblich hier auf den Seiten des Artenschutz in Franken®.
Artenschutz in Franken®
Tot oder lebendig ...

Tot oder lebendig ...
05/06.05.2024
Bayern. Bis gut über einen Meter lang kann "Sie" (die Ringelnatter -Natrix natrix-) werden, die mit ihren weißen / gelblichen Flecken am Seiten- Hinterkopf auffällige ungiftige Ringelnatter.
Häufig erkennen wir die Ringelnatter schwimmend in ungestörten stehenden Gewässerbereichen. Ihre Eier legt das Tier gerne in Komposthaufen ab. Als Nahrung dienen der Schlange auch Frösche oder Kleinsäuger.
Doch auch auf Flurwegen, oder besser "Flurautobahnen" treffen wir immer wieder Exemplare die sich in den Strahlen der Sonne aufwärmen. Vielfach sind diese Tiere jedoch bereits tot - denn diese Idee war vielfach die letzte Entscheidung in ihrem vielfach kurzen Leben.
05/06.05.2024
- Rote Liste .. kaum Entspannung in Sicht
Bayern. Bis gut über einen Meter lang kann "Sie" (die Ringelnatter -Natrix natrix-) werden, die mit ihren weißen / gelblichen Flecken am Seiten- Hinterkopf auffällige ungiftige Ringelnatter.
Häufig erkennen wir die Ringelnatter schwimmend in ungestörten stehenden Gewässerbereichen. Ihre Eier legt das Tier gerne in Komposthaufen ab. Als Nahrung dienen der Schlange auch Frösche oder Kleinsäuger.
Doch auch auf Flurwegen, oder besser "Flurautobahnen" treffen wir immer wieder Exemplare die sich in den Strahlen der Sonne aufwärmen. Vielfach sind diese Tiere jedoch bereits tot - denn diese Idee war vielfach die letzte Entscheidung in ihrem vielfach kurzen Leben.
Darüber hinaus verenden unzählige der Tiere, in der immer intensiver werdenden Landwirtschaft, wo sie Opfer z.B. der Kreiselmähwerke werden. In dem einen oder anderen Bundesland wird die Blindschleiche bereits als Art der Vorwarnliste, als Gefährdet - Freistaat Bayern - oder gar als stark gefährde Art geführt und doch kann man sich dem Eindruck nicht verwehren, dass das Sterben dieser Tiere einfach weitergeht. Wir sehen einfach zu und da die Tiere eine häufig nur unzureichende Lobby haben wird das bis zum letzten Exemplar wohl auch so weitergehen.
Gerade wir in Deutschland haben gegenüber auch dieser Art eine Verantwortung zur Erhaltung dieser Art.
Wann nur nehmen wir diese endlich wahr?
Auch Zweiradfahrer die ausgestattet mit "moderner Technik" gefühlt auf nahezu jedem Wald- und Feldweg anzutreffen sind werden für die Tiere zur Gefahr da diese einfach überrollt werden und elendig verenden. Bei hohen Geschwindigkeiten die vielfach mit diesen Geräten gefahren werden können, wird sicherlich kaum mehr abgebremst werden ... wegen einer Schlange!
In der Aufnahme
Gerade wir in Deutschland haben gegenüber auch dieser Art eine Verantwortung zur Erhaltung dieser Art.
Wann nur nehmen wir diese endlich wahr?
Auch Zweiradfahrer die ausgestattet mit "moderner Technik" gefühlt auf nahezu jedem Wald- und Feldweg anzutreffen sind werden für die Tiere zur Gefahr da diese einfach überrollt werden und elendig verenden. Bei hohen Geschwindigkeiten die vielfach mit diesen Geräten gefahren werden können, wird sicherlich kaum mehr abgebremst werden ... wegen einer Schlange!
In der Aufnahme
- So finden wir Ringelnattern immer wieder vor ... von den landwirtschaftlichen Großgeräten werden diese Tiere vielfach gar nicht mehr wahrgenommen und wenn ... Wer würde schon absteigen um das Tier von den Wegen zu nehmen?
Artenschutz in Franken®
Kein andauerndes fressen und gefressen werden ...

Kein andauerndes fressen und gefressen werden ...
04/05.05.2024
Oft genießen Insekten Sonnenstrahlen gemeinsam. Es gibt kein dauerndes fressen und gefressen werden im Tierreich ... wir haben schon Listspinnen mit Wanzen und Käfern unmittelbar nebeneinander gesehen.
04/05.05.2024
Oft genießen Insekten Sonnenstrahlen gemeinsam. Es gibt kein dauerndes fressen und gefressen werden im Tierreich ... wir haben schon Listspinnen mit Wanzen und Käfern unmittelbar nebeneinander gesehen.
Hier ist es rot in Rot, die Marienkäfer werden gemocht, die roten Wanzen machen auch niemanden etwas, sind aber eher unbeliebt ...
Aufnahme und Autor
Aufnahme und Autor
- Bernhard Schmalisch
Artenschutz in Franken®
Nistplatzverbesserung für die Große Wiesenameise (Formica pratensis)

Nistplatzverbesserung für die Große Wiesenameise (Formica pratensis)
04/05.05.2024
Da die meisten heimischen Ameisenarten im Boden oder an der Bodenoberfläche nisten sind diese vielfach durch eine zu starke Höhen- und Dichtezunahme der Krautschicht, oder den Aufwuchs von Gehölzen negativ tangiert. Vielfach bedeutet dieses "Überwuchern" das Ende der Vorkommen vieler Arten xerothermer Offenland- bzw. Saumhabitate.
Artenschutz in Franken® setzt sich bereits seit vielen Jahrzehnten für die Erhaltung von Ameisen ein und so ist es uns ein Anliegen ausgewählte Nistbereiche in ein nachhaltiges Monitoring zu überführen und diese Nistplätze entsprechend den Ameisenvorlieben zu optimieren.
04/05.05.2024
- Von den insgesamt 87 in Bayern im Freiland vorkommenden Ameisenarten werden fast 70% in der aktuellen Roten Liste geführt.
Da die meisten heimischen Ameisenarten im Boden oder an der Bodenoberfläche nisten sind diese vielfach durch eine zu starke Höhen- und Dichtezunahme der Krautschicht, oder den Aufwuchs von Gehölzen negativ tangiert. Vielfach bedeutet dieses "Überwuchern" das Ende der Vorkommen vieler Arten xerothermer Offenland- bzw. Saumhabitate.
Artenschutz in Franken® setzt sich bereits seit vielen Jahrzehnten für die Erhaltung von Ameisen ein und so ist es uns ein Anliegen ausgewählte Nistbereiche in ein nachhaltiges Monitoring zu überführen und diese Nistplätze entsprechend den Ameisenvorlieben zu optimieren.
Ein Ameisennest wird oft von Bewuchs freigehalten, um die Lebensbedingungen für die Ameisen zu verbessern. Hier sind einige Gründe:
Ameisen benötigen Luftzirkulation innerhalb ihres Nestes, um eine gesunde Umgebung aufrechtzuerhalten. Bewuchs wie Gras oder Pflanzen kann die Luftzirkulation behindern, was zu einem stickigen oder feuchten Umfeld führen kann, das für die Ameisen ungeeignet ist. Ein freier Bereich um das Ameisennest herum ermöglicht einen effizienten Wärmeaustausch. Ameisen müssen die Temperatur in ihrem Nest regulieren, um eine optimale Umgebung für ihre Brut zu schaffen. Ein zu dichter Bewuchs kann diesen Prozess beeinträchtigen, indem er die Wärmeabfuhr behindert.
Ein freier Bereich um das Nest herum kann den Ameisen einen besseren Schutz vor Räubern bieten. Wenn das Nest von Bewuchs umgeben ist, haben Feinde wie Spinnen oder andere Insekten möglicherweise eine leichtere Zeit, sich den Ameisen zu nähern, ohne bemerkt zu werden. Freier Platz um das Nest herum bietet den Ameisen Raum für Aktivitäten wie Futtersuche, Verteidigung und Kommunikation. Ein übermäßiger Bewuchs könnte diese Aktivitäten behindern oder erschweren. Indem man den Bereich um das Ameisennest frei von Bewuchs hält, schafft man also vielfach optimale Bedingungen für die Ameisen, um ein gesundes und produktives Leben zu führen.
In der Aufnahme
Ameisen benötigen Luftzirkulation innerhalb ihres Nestes, um eine gesunde Umgebung aufrechtzuerhalten. Bewuchs wie Gras oder Pflanzen kann die Luftzirkulation behindern, was zu einem stickigen oder feuchten Umfeld führen kann, das für die Ameisen ungeeignet ist. Ein freier Bereich um das Ameisennest herum ermöglicht einen effizienten Wärmeaustausch. Ameisen müssen die Temperatur in ihrem Nest regulieren, um eine optimale Umgebung für ihre Brut zu schaffen. Ein zu dichter Bewuchs kann diesen Prozess beeinträchtigen, indem er die Wärmeabfuhr behindert.
Ein freier Bereich um das Nest herum kann den Ameisen einen besseren Schutz vor Räubern bieten. Wenn das Nest von Bewuchs umgeben ist, haben Feinde wie Spinnen oder andere Insekten möglicherweise eine leichtere Zeit, sich den Ameisen zu nähern, ohne bemerkt zu werden. Freier Platz um das Nest herum bietet den Ameisen Raum für Aktivitäten wie Futtersuche, Verteidigung und Kommunikation. Ein übermäßiger Bewuchs könnte diese Aktivitäten behindern oder erschweren. Indem man den Bereich um das Ameisennest frei von Bewuchs hält, schafft man also vielfach optimale Bedingungen für die Ameisen, um ein gesundes und produktives Leben zu führen.
In der Aufnahme
- Ein Nistplatz der Großen Wiesenameise (Formica pratensis) ... den wir seit geraumer Zeit im Monitoring eingeschlossen haben und um den wir uns bemühen. Ein Feldgehölz das diesen Nistplatz umschließt hat einenen positivene Effekt ... es verhinderte bisher das Überfahren des Nistplatzes mit schweren Land-Forstmaschinen und einen negativen Effekt ... es überwächst den Nistplatz und macht diesen für die Tiere unbewohnbar. Durch das Offenhalten des Nestes geben wir auch diesem Staat eine Chance.
Artenschutz in Franken®
Kleiner Asseljäger (Dysdera erythrina)

Der Kleine Asseljäger (Dysdera erythrina) ist eine Spinnenart aus der Familie der Dysderidae, die in Europa heimisch ist.
04/05.05.2024
Der Kleine Asseljäger ist eine relativ kleine Spinne mit einer Körperlänge von (Weibchen 9–14 mm und Männchen 6–8 mm). Sie hat einen ovalen Körper und ist normalerweise braun oder grau gefärbt. Charakteristisch sind ihre kräftigen, nach vorne gerichteten Cheliceren (Kieferklauen), mit denen sie ihre Beute greifen kann.
04/05.05.2024
- Hier einige Informationen über diese Spinne:
Der Kleine Asseljäger ist eine relativ kleine Spinne mit einer Körperlänge von (Weibchen 9–14 mm und Männchen 6–8 mm). Sie hat einen ovalen Körper und ist normalerweise braun oder grau gefärbt. Charakteristisch sind ihre kräftigen, nach vorne gerichteten Cheliceren (Kieferklauen), mit denen sie ihre Beute greifen kann.
Diese Spinnenart ist in verschiedenen Lebensräumen anzutreffen, darunter Wälder, Gärten, Parks und unter Steinen oder Holzstämmen. Sie bevorzugt feuchte Umgebungen, in denen sie eine reichhaltige Beute an Asseln und anderen wirbellosen Tieren finden kann.
Wie der Name schon sagt, ist der Kleine Asseljäger spezialisiert auf die Jagd und den Verzehr von Asseln. Sie sind effektive Jäger, die ihre Beute mit ihren kräftigen Kieferklauen ergreifen und dann mit Verdauungsenzymen aussaugen. Der Kleine Asseljäger ist nachtaktiv und versteckt sich tagsüber in Verstecken wie Spalten, unter Steinen oder in Erdhöhlen. In der Nacht gehen sie auf die Jagd nach Beute, insbesondere nach Asseln, die sie in der Regel aktiv suchen. Die Fortpflanzung des Kleinen Asseljägers umfasst ein balzartiges Ritual, bei dem das Männchen das Weibchen umwirbt. Nach der Paarung legt das Weibchen ihre Eier in einen Kokon, den sie bewacht, bis die Jungspinnen schlüpfen.
Obwohl einige Menschen Spinnen möglicherweise als unangenehm empfinden, spielen Kleine Asseljäger eine wichtige Rolle in der Regulation von Asselpopulationen und anderen wirbellosen Tieren in ihrem Lebensraum. Sie sind daher ein nützlicher Bestandteil des Ökosystems.
Der Kleine Asseljäger ist ein faszinierendes Beispiel für die Vielfalt der Spinnenarten und ihre wichtige Rolle in der Regulation von Arthropodenpopulationen in natürlichen Lebensräumen. Trotz ihrer oft als unheimlich empfundenen Erscheinung leisten sie einen wertvollen Beitrag zur Aufrechterhaltung des ökologischen Gleichgewichts.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
Wie der Name schon sagt, ist der Kleine Asseljäger spezialisiert auf die Jagd und den Verzehr von Asseln. Sie sind effektive Jäger, die ihre Beute mit ihren kräftigen Kieferklauen ergreifen und dann mit Verdauungsenzymen aussaugen. Der Kleine Asseljäger ist nachtaktiv und versteckt sich tagsüber in Verstecken wie Spalten, unter Steinen oder in Erdhöhlen. In der Nacht gehen sie auf die Jagd nach Beute, insbesondere nach Asseln, die sie in der Regel aktiv suchen. Die Fortpflanzung des Kleinen Asseljägers umfasst ein balzartiges Ritual, bei dem das Männchen das Weibchen umwirbt. Nach der Paarung legt das Weibchen ihre Eier in einen Kokon, den sie bewacht, bis die Jungspinnen schlüpfen.
Obwohl einige Menschen Spinnen möglicherweise als unangenehm empfinden, spielen Kleine Asseljäger eine wichtige Rolle in der Regulation von Asselpopulationen und anderen wirbellosen Tieren in ihrem Lebensraum. Sie sind daher ein nützlicher Bestandteil des Ökosystems.
Der Kleine Asseljäger ist ein faszinierendes Beispiel für die Vielfalt der Spinnenarten und ihre wichtige Rolle in der Regulation von Arthropodenpopulationen in natürlichen Lebensräumen. Trotz ihrer oft als unheimlich empfundenen Erscheinung leisten sie einen wertvollen Beitrag zur Aufrechterhaltung des ökologischen Gleichgewichts.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- Kleiner Asseljäger
Artenschutz in Franken®
Mandarinente (Aix galericulata)

Die Mandarinente (Aix galericulata) ist eine auffällige und farbenfrohe Entenart, die in Ostasien beheimatet ist.
03/04.05.2024
Die Männchen der Mandarinente sind für ihre atemberaubende Färbung und auffälligen Federn bekannt. Sie haben einen leuchtend orangefarbenen Schnabel, einen weißen Kragen um den Hals, einen bräunlichen Körper mit blauen "Segeln" auf den Flügeln, orangefarbene "Segel" auf dem Rücken und leuchtend orangefarbene Wangen. Die Weibchen sind weniger auffällig und haben ein überwiegend braunes Federkleid mit einigen blauen Akzenten auf den Flügeln.
03/04.05.2024
- Wir möchten Ihnen hier einige weiterführende Informationen über diese Art vermitteln:
Die Männchen der Mandarinente sind für ihre atemberaubende Färbung und auffälligen Federn bekannt. Sie haben einen leuchtend orangefarbenen Schnabel, einen weißen Kragen um den Hals, einen bräunlichen Körper mit blauen "Segeln" auf den Flügeln, orangefarbene "Segel" auf dem Rücken und leuchtend orangefarbene Wangen. Die Weibchen sind weniger auffällig und haben ein überwiegend braunes Federkleid mit einigen blauen Akzenten auf den Flügeln.
Mandarinenten bewohnen vor allem feuchte Wälder, Sümpfe, Teiche und Seen in Ostasien, insbesondere in China, Japan und Korea. Sie bevorzugen ruhige Gewässer mit reichlich Deckung und Vegetation. Diese Enten ernähren sich hauptsächlich von Pflanzen, Samen, Früchten, Insekten und kleinen Wirbellosen, die sie im flachen Wasser oder am Ufer finden.
Mandarinenten sind Höhlenbrüter und nisten oft in Baumhöhlen, die in der Nähe von Gewässern liegen. Das Weibchen legt eine kleine Anzahl von Eiern und kümmert sich um die Aufzucht der Küken. Aufgrund ihrer auffälligen Färbung und ihres eleganten Erscheinungsbilds sind Mandarinenten bei Vogelbeobachtern und in der Geflügelzucht sehr beliebt. Sie werden oft in Parks und Gärten außerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebiets gehalten.
Obwohl die Mandarinente nicht als bedrohte Art gilt, sind bestimmte Populationen durch Lebensraumverlust und den Rückgang geeigneter Brutplätze gefährdet. Der Schutz und die Erhaltung ihrer natürlichen Lebensräume sind entscheidend für ihre langfristige Überlebensfähigkeit.
Die Mandarinente ist nicht nur ein Symbol für Schönheit und Eleganz, sondern auch ein wichtiger Bestandteil der Ökosysteme in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet. Ihre farbenfrohen Federn und ihr anmutiges Verhalten machen sie zu einer faszinierenden Art für Vogelbeobachter und Naturliebhaber auf der ganzen Welt.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
Mandarinenten sind Höhlenbrüter und nisten oft in Baumhöhlen, die in der Nähe von Gewässern liegen. Das Weibchen legt eine kleine Anzahl von Eiern und kümmert sich um die Aufzucht der Küken. Aufgrund ihrer auffälligen Färbung und ihres eleganten Erscheinungsbilds sind Mandarinenten bei Vogelbeobachtern und in der Geflügelzucht sehr beliebt. Sie werden oft in Parks und Gärten außerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebiets gehalten.
Obwohl die Mandarinente nicht als bedrohte Art gilt, sind bestimmte Populationen durch Lebensraumverlust und den Rückgang geeigneter Brutplätze gefährdet. Der Schutz und die Erhaltung ihrer natürlichen Lebensräume sind entscheidend für ihre langfristige Überlebensfähigkeit.
Die Mandarinente ist nicht nur ein Symbol für Schönheit und Eleganz, sondern auch ein wichtiger Bestandteil der Ökosysteme in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet. Ihre farbenfrohen Federn und ihr anmutiges Verhalten machen sie zu einer faszinierenden Art für Vogelbeobachter und Naturliebhaber auf der ganzen Welt.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
- Mandarinenten
Artenschutz in Franken®
Rücksicht auf die Biodiversität - Fehlanzeige

Rücksicht auf die Biodiversität - Fehlanzeige
03/04.05.2024
Das intensivere Mähen von Grünland und die Umwandlung von Grünland in andere landwirtschaftliche Nutzungen wie Ackerland können eine Vielzahl von negativen Auswirkungen auf die Biodiversität haben.
Hier sind einige Gründe, warum diese Praktiken problematisch sind:
Grünlandflächen bieten Lebensraum für eine Vielzahl von Pflanzen- und Tierarten, einschließlich Wildbienen, Schmetterlingen, Vögeln und Säugetieren. Durch das Intensivieren des Mähens und das Umwandeln von Grünland in Ackerland gehen diese Lebensräume verloren, was zu einem Rückgang der Artenvielfalt führt.
03/04.05.2024
Das intensivere Mähen von Grünland und die Umwandlung von Grünland in andere landwirtschaftliche Nutzungen wie Ackerland können eine Vielzahl von negativen Auswirkungen auf die Biodiversität haben.
Hier sind einige Gründe, warum diese Praktiken problematisch sind:
Grünlandflächen bieten Lebensraum für eine Vielzahl von Pflanzen- und Tierarten, einschließlich Wildbienen, Schmetterlingen, Vögeln und Säugetieren. Durch das Intensivieren des Mähens und das Umwandeln von Grünland in Ackerland gehen diese Lebensräume verloren, was zu einem Rückgang der Artenvielfalt führt.
Grünlandökosysteme beherbergen eine Vielzahl von Pflanzenarten, darunter Gräser, Kräuter und Blumen. Intensiveres Mähen kann dazu führen, dass empfindlichere Pflanzenarten verdrängt werden, was zu einem Rückgang der Pflanzenvielfalt führt. Der Verlust von Pflanzenvielfalt kann sich negativ auf die gesamte Nahrungskette auswirken, da viele Tiere auf bestimmte Pflanzenarten angewiesen sind.
Grünland bietet vielen Vogelarten ideale Brutplätze. Das intensive Mähen kann jedoch zur Zerstörung von Nestern und zur Tötung von Jungvögeln führen. Darüber hinaus beherbergt Grünland eine Vielzahl von Insektenarten, die ebenfalls von der Veränderung ihrer Lebensräume betroffen sind. Intensives Mähen und Bewirtschaftung kann zu einer Verschlechterung der Bodenqualität führen, einschließlich Erosion, Verlust von Bodenfruchtbarkeit und Versauerung des Bodens. Dies wirkt sich nicht nur negativ auf die Pflanzenwelt aus, sondern auch auf die gesamten Ökosystemdienstleistungen, die der Boden erbringt.
Durch die Umwandlung von Grünland in Ackerland und den Einsatz intensiver landwirtschaftlicher Methoden geht auch die genetische Vielfalt von Pflanzen- und Tierarten verloren. Dies kann langfristige Auswirkungen auf die Anpassungsfähigkeit von Arten an sich ändernde Umweltbedingungen haben.
Insgesamt können das intensivere Mähen von Grünland und die Umwandlung in andere landwirtschaftliche Nutzungen zu einem erheblichen Verlust an Biodiversität führen und die ökologische Stabilität von Ökosystemen gefährden. Es ist wichtig, nachhaltige Landnutzungspraktiken zu fördern, die den Erhalt von Grünlandökosystemen und ihrer vielfältigen Artenvielfalt unterstützen.
In der Aufnahme
Artenschutz in Franken®
02.05.2024
Grünland bietet vielen Vogelarten ideale Brutplätze. Das intensive Mähen kann jedoch zur Zerstörung von Nestern und zur Tötung von Jungvögeln führen. Darüber hinaus beherbergt Grünland eine Vielzahl von Insektenarten, die ebenfalls von der Veränderung ihrer Lebensräume betroffen sind. Intensives Mähen und Bewirtschaftung kann zu einer Verschlechterung der Bodenqualität führen, einschließlich Erosion, Verlust von Bodenfruchtbarkeit und Versauerung des Bodens. Dies wirkt sich nicht nur negativ auf die Pflanzenwelt aus, sondern auch auf die gesamten Ökosystemdienstleistungen, die der Boden erbringt.
Durch die Umwandlung von Grünland in Ackerland und den Einsatz intensiver landwirtschaftlicher Methoden geht auch die genetische Vielfalt von Pflanzen- und Tierarten verloren. Dies kann langfristige Auswirkungen auf die Anpassungsfähigkeit von Arten an sich ändernde Umweltbedingungen haben.
Insgesamt können das intensivere Mähen von Grünland und die Umwandlung in andere landwirtschaftliche Nutzungen zu einem erheblichen Verlust an Biodiversität führen und die ökologische Stabilität von Ökosystemen gefährden. Es ist wichtig, nachhaltige Landnutzungspraktiken zu fördern, die den Erhalt von Grünlandökosystemen und ihrer vielfältigen Artenvielfalt unterstützen.
In der Aufnahme
- Wurden Wiesen früher höchstens dreimal im Jahr gemäht, so kommen diese heute bis zu sechsmal unter die Messer ... und mit ihnen auch zahllose Tier- und Pflanzenarten ... intensiv gedüngt wird diese hohe Frequenz erreicht ... eine ebenso intensive Verarmung der "Wiesen" ist überall erkennbar ...
Artenschutz in Franken®
02.05.2024
Artenschutz in Franken®
Schmalbienen ...

... Schmalbienen, auch bekannt unter ihrem wissenschaftlichen Namen Lasioglossum, sind eine große Gattung von Wildbienen, die in verschiedenen Teilen der Welt vorkommen.
03/04.05.2024
Hier sind einige Informationen über diese faszinierenden Bienen:
Die Gattung Lasioglossum umfasst eine enorme Vielfalt an Arten, von denen viele sich in Größe, Färbung und Verhalten unterscheiden. Insgesamt gibt es weltweit mehrere Hundert Arten von Schmalbienen. Schmalbienen sind im Allgemeinen recht klein und haben einen schlanken Körperbau.
03/04.05.2024
Hier sind einige Informationen über diese faszinierenden Bienen:
Die Gattung Lasioglossum umfasst eine enorme Vielfalt an Arten, von denen viele sich in Größe, Färbung und Verhalten unterscheiden. Insgesamt gibt es weltweit mehrere Hundert Arten von Schmalbienen. Schmalbienen sind im Allgemeinen recht klein und haben einen schlanken Körperbau.
Ihre Farben können von metallisch glänzendem Grün über blau bis hin zu braun oder schwarz reichen. Einige Arten weisen auffällige Haarfransen an den Hinterbeinen auf, die dazu dienen, Pollen zu sammeln und zu transportieren.
Schmalbienen bewohnen eine Vielzahl von Lebensräumen, darunter offene Grasflächen, Wälder, Gärten und städtische Gebiete. Sie sind oft in der Nähe von Blütenpflanzen anzutreffen, von denen sie Nektar und Pollen sammeln. Die meisten Schmalbienenarten sind solitär, was bedeutet, dass sie ihre Nester alleine bauen und keine koloniebildenden Strukturen wie Honigbienen aufweisen. Einige Arten können jedoch in lockeren Gemeinschaften nisten und ihre Nester in der Nähe anderer Bienen bauen.
Die Nistplätze von Schmalbienen können variieren. Einige graben ihre Nester in den Boden, während andere Hohlräume in Totholz oder anderen strukturreichen Materialien nutzen. Die Weibchen bauen Brutzellen, in denen sie Nahrungsvorräte sammeln und Eier ablegen. Schmalbienen spielen eine wichtige Rolle als Bestäuber vieler Pflanzenarten, darunter Obstbäume, Gemüsepflanzen und Wildblumen. Ihre Effizienz als Bestäuber ist eng mit ihrer Fähigkeit verbunden, Pollen von Blume zu Blume zu transportieren, während sie Nahrung sammeln.
Schmalbienen sind ein wichtiger Bestandteil der wilden Bestäubergemeinschaft und tragen zur Erhaltung der Biodiversität und zur Produktion von Nahrungsmitteln bei. Ihre Vielfalt und Anpassungsfähigkeit machen sie zu faszinierenden Objekten der wissenschaftlichen Forschung und zum wichtigen Faktor im Ökosystem.
Aufnahme von Willibald Lang
Schmalbienen bewohnen eine Vielzahl von Lebensräumen, darunter offene Grasflächen, Wälder, Gärten und städtische Gebiete. Sie sind oft in der Nähe von Blütenpflanzen anzutreffen, von denen sie Nektar und Pollen sammeln. Die meisten Schmalbienenarten sind solitär, was bedeutet, dass sie ihre Nester alleine bauen und keine koloniebildenden Strukturen wie Honigbienen aufweisen. Einige Arten können jedoch in lockeren Gemeinschaften nisten und ihre Nester in der Nähe anderer Bienen bauen.
Die Nistplätze von Schmalbienen können variieren. Einige graben ihre Nester in den Boden, während andere Hohlräume in Totholz oder anderen strukturreichen Materialien nutzen. Die Weibchen bauen Brutzellen, in denen sie Nahrungsvorräte sammeln und Eier ablegen. Schmalbienen spielen eine wichtige Rolle als Bestäuber vieler Pflanzenarten, darunter Obstbäume, Gemüsepflanzen und Wildblumen. Ihre Effizienz als Bestäuber ist eng mit ihrer Fähigkeit verbunden, Pollen von Blume zu Blume zu transportieren, während sie Nahrung sammeln.
Schmalbienen sind ein wichtiger Bestandteil der wilden Bestäubergemeinschaft und tragen zur Erhaltung der Biodiversität und zur Produktion von Nahrungsmitteln bei. Ihre Vielfalt und Anpassungsfähigkeit machen sie zu faszinierenden Objekten der wissenschaftlichen Forschung und zum wichtigen Faktor im Ökosystem.
Aufnahme von Willibald Lang
- Schmalbiene an einer Mohnblüte
Artenschutz in Franken®
Ovale Kleesandbiene (Andrena ovatula)

Die Ovale Kleesandbiene ...
02/03.05.2024
... wissenschaftlich bekannt als Andrena ovata, ist eine weitere faszinierende Art von Wildbienen, die in Europa heimisch ist.
Hier sind einige interessante Informationen über diese Biene:
Die Ovale Kleesandbiene ist ähnlich wie die Kleesandbiene, aber etwas größer. Die Weibchen haben eine schwarze Farbe mit auffälligen gelben Haarbändern auf dem Hinterleib, während die Männchen dunkelbraun bis schwarz gefärbt sind. Diese Biene ist oft in ähnlichen Lebensräumen wie die Kleesandbiene anzutreffen, nämlich in offenen Landschaften mit sandigen Böden. Sie bevorzugt jedoch möglicherweise etwas feuchtere Lebensräume und ist daher möglicherweise in verschiedenen Habitatbereichen anzutreffen.
02/03.05.2024
... wissenschaftlich bekannt als Andrena ovata, ist eine weitere faszinierende Art von Wildbienen, die in Europa heimisch ist.
Hier sind einige interessante Informationen über diese Biene:
Die Ovale Kleesandbiene ist ähnlich wie die Kleesandbiene, aber etwas größer. Die Weibchen haben eine schwarze Farbe mit auffälligen gelben Haarbändern auf dem Hinterleib, während die Männchen dunkelbraun bis schwarz gefärbt sind. Diese Biene ist oft in ähnlichen Lebensräumen wie die Kleesandbiene anzutreffen, nämlich in offenen Landschaften mit sandigen Böden. Sie bevorzugt jedoch möglicherweise etwas feuchtere Lebensräume und ist daher möglicherweise in verschiedenen Habitatbereichen anzutreffen.
Wie viele andere Bienen ernährt sich auch die Ovale Kleesandbiene von Nektar und Pollen. Sie besucht bevorzugt Blüten von Klee- und Hülsenfruchtpflanzen sowie von anderen Wildblumen in ihrem Lebensraum. Das Nistverhalten der ovalen Kleesandbiene ähnelt dem anderer Arten der Gattung Andrena. Die Weibchen graben einzelne Brutzellen in den Boden, in denen sie Nahrungsvorräte für ihre Larven sammeln und dann ein Ei legen. Die Larven entwickeln sich in diesen Zellen und verpuppen sich, bevor sie im nächsten Frühjahr schlüpfen.
Wie viele andere Wildbienenarten ist auch die Ovale Kleesandbiene durch den Verlust geeigneter Lebensräume und die Intensivierung der Landwirtschaft bedroht. Erhaltungsmaßnahmen, die darauf abzielen, sandige Lebensräume zu schützen und zu fördern sowie die Vielfalt der Blühpflanzen in diesen Gebieten zu erhöhen, können dazu beitragen, ihren Bestand zu sichern.
Die Ovale Kleesandbiene ist ein weiteres wichtiges Mitglied der Wildbienenfamilie und trägt zur Bestäubung von Pflanzen in ihrem Lebensraum bei. Ihre Erhaltung ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der Biodiversität und der Ökosystemdienstleistungen, die von Bestäubern erbracht werden.
Aufnahme von Bernhard Schmalisch
Wie viele andere Wildbienenarten ist auch die Ovale Kleesandbiene durch den Verlust geeigneter Lebensräume und die Intensivierung der Landwirtschaft bedroht. Erhaltungsmaßnahmen, die darauf abzielen, sandige Lebensräume zu schützen und zu fördern sowie die Vielfalt der Blühpflanzen in diesen Gebieten zu erhöhen, können dazu beitragen, ihren Bestand zu sichern.
Die Ovale Kleesandbiene ist ein weiteres wichtiges Mitglied der Wildbienenfamilie und trägt zur Bestäubung von Pflanzen in ihrem Lebensraum bei. Ihre Erhaltung ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der Biodiversität und der Ökosystemdienstleistungen, die von Bestäubern erbracht werden.
Aufnahme von Bernhard Schmalisch
Artenschutz in Franken®
Der Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros)

Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros)
02/03.05.2024
Hier sind einige Informationen über diese Vogelart:
Der Hausrotschwanz hat ein auffälliges Erscheinungsbild. Das Männchen hat ein schwarzes Gefieder mit einem markanten roten Schwanz, der ihm seinen Namen gibt. Das Weibchen und die Jungvögel sind eher graubraun gefärbt und haben einen weniger auffälligen Schwanz. Der Hausrotschwanz ist in weiten Teilen Europas und Asiens verbreitet. Er ist ein häufiger Brutvogel in städtischen und ländlichen Gebieten und kommt oft in der Nähe menschlicher Siedlungen vor.
02/03.05.2024
- Der Hausrotschwanz, wissenschaftlich bekannt als "Phoenicurus ochruros", ist ein kleiner Singvogel aus der Familie der Fliegenschnäpper.
Hier sind einige Informationen über diese Vogelart:
Der Hausrotschwanz hat ein auffälliges Erscheinungsbild. Das Männchen hat ein schwarzes Gefieder mit einem markanten roten Schwanz, der ihm seinen Namen gibt. Das Weibchen und die Jungvögel sind eher graubraun gefärbt und haben einen weniger auffälligen Schwanz. Der Hausrotschwanz ist in weiten Teilen Europas und Asiens verbreitet. Er ist ein häufiger Brutvogel in städtischen und ländlichen Gebieten und kommt oft in der Nähe menschlicher Siedlungen vor.
Diese Vögel bevorzugen eine Vielzahl von Lebensräumen, darunter Gärten, Parks, Wälder, Gebirge und städtische Bereiche. Sie sind oft in der Nähe von Gebäuden und Felsen zu finden, wo sie Nistplätze finden können. Hausrotschwänze ernähren sich hauptsächlich von Insekten, die sie beim Suchen auf dem Boden oder im Flug fangen. Sie fressen auch Beeren und kleine Früchte, besonders während der Herbst- und Wintermonate, wenn Insekten knapp sind.
Diese Vögel sind oft aktiv und beweglich, hüpfen auf dem Boden herum und fliegen geschickt von Ast zu Ast, während sie nach Nahrung suchen. Sie haben ein charakteristisches Flugmuster mit kurzen Flügen, gefolgt von abrupten Stopps. Das Männchen des Hausrotschwanzes singt ein vielfältiges und melodisches Lied, das oft als angenehm und beruhigend empfunden wird. Sie singen besonders während der Brutzeit, um ihr Revier zu verteidigen und Weibchen anzulocken.
Die Brutzeit für Hausrotschwänze liegt normalerweise zwischen April und Juli. Sie bauen ihre Nester in natürlichen Hohlräumen, Nischen oder auch in künstlichen Strukturen wie Vogelhäusern oder Schuppen. Das Weibchen legt in der Regel 4-6 Eier, die beide Elternteile für etwa zwei Wochen ausbrüten. Die Jungvögel werden dann von beiden Elternteilen gefüttert, bis sie flügge sind.
Der Hausrotschwanz ist ein faszinierender Vogel, der sowohl durch sein auffälliges Aussehen als auch durch seinen schönen Gesang beeindruckt. Er ist ein häufiger Besucher in vielen Gärten und städtischen Gebieten und wird oft von Vogelbeobachtern und Naturfreunden geschätzt.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
- Hausrotschwanz Männchen
Diese Vögel sind oft aktiv und beweglich, hüpfen auf dem Boden herum und fliegen geschickt von Ast zu Ast, während sie nach Nahrung suchen. Sie haben ein charakteristisches Flugmuster mit kurzen Flügen, gefolgt von abrupten Stopps. Das Männchen des Hausrotschwanzes singt ein vielfältiges und melodisches Lied, das oft als angenehm und beruhigend empfunden wird. Sie singen besonders während der Brutzeit, um ihr Revier zu verteidigen und Weibchen anzulocken.
Die Brutzeit für Hausrotschwänze liegt normalerweise zwischen April und Juli. Sie bauen ihre Nester in natürlichen Hohlräumen, Nischen oder auch in künstlichen Strukturen wie Vogelhäusern oder Schuppen. Das Weibchen legt in der Regel 4-6 Eier, die beide Elternteile für etwa zwei Wochen ausbrüten. Die Jungvögel werden dann von beiden Elternteilen gefüttert, bis sie flügge sind.
Der Hausrotschwanz ist ein faszinierender Vogel, der sowohl durch sein auffälliges Aussehen als auch durch seinen schönen Gesang beeindruckt. Er ist ein häufiger Besucher in vielen Gärten und städtischen Gebieten und wird oft von Vogelbeobachtern und Naturfreunden geschätzt.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
- Hausrotschwanz Männchen
Artenschutz in Franken®
Stele der Biodiversität® - Rosendahl / GT - Darfeld

Stele der Biodiversität® - Rosendahl / GT - Darfeld
02/03.05.2024
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das von der Gemeinde Rosendahl und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.
Darfeld / Nordrhein-Westfalen. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
02/03.05.2024
- Türlackierungen
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das von der Gemeinde Rosendahl und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.
Darfeld / Nordrhein-Westfalen. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
Denn wenn (selbst in noch geeigneten Nahrungsstrukturen) keine geeigneten Reproduktionsräume vorhanden sind, ist die Erhaltung der Artenvielfalt gleichfalls zum Scheitern verurteilt.
Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V., das von der Gemeinde Rosendahl und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird, setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.
In der Aufnahme
Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V., das von der Gemeinde Rosendahl und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird, setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.
In der Aufnahme
- ... mit der Lackierung der Türen wird der nächste Bearbeitungsschritt sichtbar ...
Artenschutz in Franken®
Der Grünspecht (Picus viridis)

Der Grünspecht (Picus viridis)
01/02.05.2024
Er ist bekannt für sein auffälliges grünes Gefieder auf dem Rücken und seinen charakteristischen roten Scheitel auf dem Kopf.
Hier sind einige interessante Informationen über den Grünspecht:
Der Grünspecht hat ein auffälliges Erscheinungsbild. Sein Rücken ist überwiegend grün gefärbt, während sein Bauch gelblich ist. Der Kopf ist mit einem roten Scheitel gekrönt, der bei Männchen oft leuchtender ist. Eine schwarze Augenbinde verläuft von seinem Schnabel bis zum Hinterkopf. Sein Schwanz ist kurz und steif, was ihm hilft, sich an Baumstämmen festzuhalten.
01/02.05.2024
- Der Grünspecht, wissenschaftlich bekannt als "Picus viridis", ist eine mittelgroße Spechtart, die in Europa und Teilen Asiens beheimatet ist.
Er ist bekannt für sein auffälliges grünes Gefieder auf dem Rücken und seinen charakteristischen roten Scheitel auf dem Kopf.
Hier sind einige interessante Informationen über den Grünspecht:
Der Grünspecht hat ein auffälliges Erscheinungsbild. Sein Rücken ist überwiegend grün gefärbt, während sein Bauch gelblich ist. Der Kopf ist mit einem roten Scheitel gekrönt, der bei Männchen oft leuchtender ist. Eine schwarze Augenbinde verläuft von seinem Schnabel bis zum Hinterkopf. Sein Schwanz ist kurz und steif, was ihm hilft, sich an Baumstämmen festzuhalten.
Grünspechte leben in verschiedenen Lebensräumen, darunter Laub- und Mischwälder, Parkanlagen, Obstgärten und Felder mit Baumgruppen. Sie bevorzugen Gebiete mit alten Bäumen, in deren Höhlen sie ihre Nester bauen können. Die Hauptnahrung des Grünspechts sind Ameisen. Mit seinem langen, klebrigen Zungen kann er Ameisen aus ihren Nestern herausholen. Neben Ameisen frisst er auch andere Insekten, Beeren und Früchte.
Grünspechte sind meistens auf dem Boden zu finden, wo sie nach Ameisen suchen. Sie sind weniger häufig dabei zu beobachten, wie sie an Baumstämmen hämmern, im Vergleich zu anderen Spechtarten. Sie sind jedoch immer noch in der Lage, Bäume zu bearbeiten, um Höhlen für die Brut zu schaffen. Die Brutzeit für Grünspechte liegt in der Regel zwischen April und Juni. Das Weibchen legt normalerweise 5-8 Eier in die Höhle eines Baumes, die dann von beiden Elternteilen für etwa 14 Tage bebrütet werden. Die Jungen werden von beiden Eltern gefüttert und bleiben für etwa einen Monat im Nest, bevor sie flügge werden.
Der Grünspecht ist eine faszinierende Vogelart, die durch ihre Farbenpracht, ihr interessantes Verhalten und ihre Anpassungsfähigkeit an verschiedene Lebensräume beeindruckt.
In der Aufnahme von Johannes Rother
Grünspechte sind meistens auf dem Boden zu finden, wo sie nach Ameisen suchen. Sie sind weniger häufig dabei zu beobachten, wie sie an Baumstämmen hämmern, im Vergleich zu anderen Spechtarten. Sie sind jedoch immer noch in der Lage, Bäume zu bearbeiten, um Höhlen für die Brut zu schaffen. Die Brutzeit für Grünspechte liegt in der Regel zwischen April und Juni. Das Weibchen legt normalerweise 5-8 Eier in die Höhle eines Baumes, die dann von beiden Elternteilen für etwa 14 Tage bebrütet werden. Die Jungen werden von beiden Eltern gefüttert und bleiben für etwa einen Monat im Nest, bevor sie flügge werden.
Der Grünspecht ist eine faszinierende Vogelart, die durch ihre Farbenpracht, ihr interessantes Verhalten und ihre Anpassungsfähigkeit an verschiedene Lebensräume beeindruckt.
In der Aufnahme von Johannes Rother
- Mit seiner Zunge ständig auf der Suche nach Fressbarem ....
Artenschutz in Franken®
Der Schmutzgeier (Neophron percnopterus)

Der Schmutzgeier (Neophron percnopterus)
01/02.05.2024
Sein wissenschaftlicher Name lautet "Neophron percnopterus". Er ist auch unter verschiedenen anderen Namen bekannt, darunter der "Weißrückengeier" oder der "Ägyptische Geier". Diese Vögel sind in Afrika, dem Nahen Osten und Teilen Europas beheimatet.
Der Schmutzgeier ist ein mittelgroßer Geier mit einem auffälligen Aussehen. Seine Federn sind größtenteils weiß, aber er hat schwarze Flügelspitzen und eine markante schwarze Schwanzspitze. Diese Farbgebung hilft ihm, sich von anderen Geierarten zu unterscheiden.
01/02.05.2024
- Der Schmutzgeier ist ein Vogel, der zur Familie der Geier gehört.
Sein wissenschaftlicher Name lautet "Neophron percnopterus". Er ist auch unter verschiedenen anderen Namen bekannt, darunter der "Weißrückengeier" oder der "Ägyptische Geier". Diese Vögel sind in Afrika, dem Nahen Osten und Teilen Europas beheimatet.
Der Schmutzgeier ist ein mittelgroßer Geier mit einem auffälligen Aussehen. Seine Federn sind größtenteils weiß, aber er hat schwarze Flügelspitzen und eine markante schwarze Schwanzspitze. Diese Farbgebung hilft ihm, sich von anderen Geierarten zu unterscheiden.
Was seinen Lebensraum betrifft, bevorzugt der Schmutzgeier offene Landschaften wie Savannen, Halbwüsten und felsige Gebiete. Er ernährt sich hauptsächlich von Aas, das er durch kreisende Flüge und Beobachtung von anderen Geiern oder Raubvögeln findet. Darüber hinaus füttert er sich auch von Abfällen, was ihm den Namen "Schmutzgeier" einbrachte.
Eine interessante Eigenschaft des Schmutzgeiers ist sein soziales Verhalten. Sie leben oft in Kolonien, die man als "Monokulturen" bezeichnet. Diese Gemeinschaften können sich aus Hunderten von Paaren zusammensetzen, die ihre Nester in felsigen Klippen oder Bäumen bauen.
In einigen Gebieten sind Schmutzgeier bedroht, hauptsächlich aufgrund des Verlusts ihres Lebensraums, Vergiftungen durch Pestizide und die Verringerung der Verfügbarkeit von Aas. Einige Naturschutzmaßnahmen zielen darauf ab, diese faszinierenden Vögel zu schützen, um ihr Überleben zu sichern.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
Eine interessante Eigenschaft des Schmutzgeiers ist sein soziales Verhalten. Sie leben oft in Kolonien, die man als "Monokulturen" bezeichnet. Diese Gemeinschaften können sich aus Hunderten von Paaren zusammensetzen, die ihre Nester in felsigen Klippen oder Bäumen bauen.
In einigen Gebieten sind Schmutzgeier bedroht, hauptsächlich aufgrund des Verlusts ihres Lebensraums, Vergiftungen durch Pestizide und die Verringerung der Verfügbarkeit von Aas. Einige Naturschutzmaßnahmen zielen darauf ab, diese faszinierenden Vögel zu schützen, um ihr Überleben zu sichern.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
- Schmutzgeier
Artenschutz in Franken®
Stele der Biodiversität® - Rosendahl / GT- Höven

Stele der Biodiversität® - Rosendahl / GT- Höven
01/02.05.2024
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutzes in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das von der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.
Rosendahl / Nordrhein - Westfalen. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen, kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen.
01/02.05.2024
- Fassade fast vollständig zur nachfolgenden Aufbringung der Grafik vorbereitet.
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutzes in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das von der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.
Rosendahl / Nordrhein - Westfalen. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen, kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen.
Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
In der Aufnahme
In der Aufnahme
- Ende April 2024 schließen wir die Arbeiten an der Fassade nahezu vollständig ab.
Artenschutz in Franken®
Artenschutz in Franken®

Artenschutz in Franken®
Text ausklappbar...
Artenschutz in Franken®
Die Wolfsspinne ...

Die Wolfsspinne ist eine faszinierende Gruppe von Spinnen, die zur Familie der Lycosidae gehört.
30.04./01.05.2024
Hier sind einige interessante Punkte über sie:
Wolfsspinnen sind auf der ganzen Welt verbreitet und bewohnen eine Vielzahl von Lebensräumen, von Wüsten über Wälder bis hin zu Grasland.Sie sind mittelgroße bis große Spinnen mit kräftigen Beinen und einem robusten Körper. Ihr Aussehen variiert je nach Art und Lebensraum, aber viele haben eine braune oder graue Färbung, die ihnen hilft, sich in ihrer Umgebung zu tarnen.
30.04./01.05.2024
- Diese Spinnen sind bekannt für ihre jagdlichen Fähigkeiten und ihr Verhalten, das dem von Wölfen ähnelt, daher der Name "Wolfsspinne".
Hier sind einige interessante Punkte über sie:
Wolfsspinnen sind auf der ganzen Welt verbreitet und bewohnen eine Vielzahl von Lebensräumen, von Wüsten über Wälder bis hin zu Grasland.Sie sind mittelgroße bis große Spinnen mit kräftigen Beinen und einem robusten Körper. Ihr Aussehen variiert je nach Art und Lebensraum, aber viele haben eine braune oder graue Färbung, die ihnen hilft, sich in ihrer Umgebung zu tarnen.
Wolfsspinnen sind Jäger und gehen aktiv auf Beutejagd. Im Gegensatz zu einigen anderen Spinnen weben sie keine Netze, um ihre Beute zu fangen. Stattdessen lauern sie Beute auf und jagen sie aktiv, indem sie sich schnell auf sie stürzen. Sie sind dafür bekannt, sehr schnell zu sein und können auch gut sehen, was ihnen hilft, ihre Beute zu verfolgen.
Die Fortpflanzung bei Wolfsspinnen ist oft faszinierend. Nach der Paarung legen die Weibchen Eier in einen Kokon und tragen diesen an ihrem Körper, bis die Jungspinnen schlüpfen. Einige Arten tragen ihre Jungen sogar auf dem Rücken, bis sie groß genug sind, um alleine zu jagen.
Wie viele Spinnen sind auch Wolfsspinnen nützliche Insektenjäger, die dazu beitragen, das ökologische Gleichgewicht aufrechtzuerhalten, indem sie die Populationen von Schädlingen kontrollieren. In der Regel sind Wolfsspinnen für Menschen nicht gefährlich. Sie sind nicht aggressiv und beißen nur, wenn sie sich bedroht fühlen. Die meisten Arten haben einen Biss, der für Menschen nicht ernsthaft gefährlich ist, obwohl er schmerzhaft sein kann.
Insgesamt sind Wolfsspinnen faszinante Kreaturen, die einen wichtigen Platz in vielen Ökosystemen einnehmen und eine wichtige Rolle bei der Regulierung von Insektenpopulationen spielen.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
Die Fortpflanzung bei Wolfsspinnen ist oft faszinierend. Nach der Paarung legen die Weibchen Eier in einen Kokon und tragen diesen an ihrem Körper, bis die Jungspinnen schlüpfen. Einige Arten tragen ihre Jungen sogar auf dem Rücken, bis sie groß genug sind, um alleine zu jagen.
Wie viele Spinnen sind auch Wolfsspinnen nützliche Insektenjäger, die dazu beitragen, das ökologische Gleichgewicht aufrechtzuerhalten, indem sie die Populationen von Schädlingen kontrollieren. In der Regel sind Wolfsspinnen für Menschen nicht gefährlich. Sie sind nicht aggressiv und beißen nur, wenn sie sich bedroht fühlen. Die meisten Arten haben einen Biss, der für Menschen nicht ernsthaft gefährlich ist, obwohl er schmerzhaft sein kann.
Insgesamt sind Wolfsspinnen faszinante Kreaturen, die einen wichtigen Platz in vielen Ökosystemen einnehmen und eine wichtige Rolle bei der Regulierung von Insektenpopulationen spielen.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- Wolfsspinne
Artenschutz in Franken®
Systoechus ctenopterus

Systoechus ctenopterus ...
30.04/01.05.2024
... so ein Wollschweber ist ein großer Flugkünstler ... einer der Besten die ich kenne. In der Luft stehen, abrupte Richtungswechsel, vorwärts, rückwärts, in alle Richtungen, kein Problem ...
30.04/01.05.2024
... so ein Wollschweber ist ein großer Flugkünstler ... einer der Besten die ich kenne. In der Luft stehen, abrupte Richtungswechsel, vorwärts, rückwärts, in alle Richtungen, kein Problem ...
Hier: Systoechus ctenopterus eine, von den etwa 40 Arten die es bei uns gibt. Seltener und etwas kleiner als der "Große Wollschweber" ... die Larven sollen sich von den Eiern verschiedener Feldheuschreckenarten ernähren.
Aufnahme und Autor
Aufnahme und Autor
- Bernhard Schmalisch
Artenschutz in Franken®
Stele der Biodiversität® - Umweltpoint: Dorsten – Wulfen

Stele der Biodiversität® - Umweltpoint: Dorsten – Wulfen
30.04/01.05.2024
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutzes in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das von der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.
Dorsten GT-Wulfen / Nordrhein - Westfalen. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen, kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Baukörper gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper und auch deren Umfeld zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
30.04/01.05.2024
- Aufbringung der Dachhaut - Einbau der Fledermaus-Zuflugelemente
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutzes in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das von der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.
Dorsten GT-Wulfen / Nordrhein - Westfalen. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen, kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Baukörper gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper und auch deren Umfeld zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
Wenn auch noch die Umweltbildung einen wichtigen Projektaspekt vereinnahmt, dann sind wir der festen Überzeugung, hier einigen wertvollen Beitrag für gerade die uns nachfolgende Generation zu leisten!
Am 22. April 2024 starten wir mit dem ersten umfangreichen Schritt, um die Belange des praktischen Artenschutzes sichtbar werden zu lassen. Der Dachkörper des Objekts wurde in der Vergangenheit immer wieder von Fledermäusen frequentiert, auch Todfunde von drei Langohrfledermäusen signalisierten uns diese Präsenz. Doch sie zeigten uns auch den eklatanten Mangel der Dachhaut auf, denn diese war in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten "durchlässig" geworden.
Und das nicht nur für Fledermäuse, auch Waldkäuze und Steinmarder konnten somit ungestört in die Dachhautund den Dachstuhl vordringen und führten damit auch zum Erlöschen der vormals hier aktiven Fledermauskolonie. Mit der Aufbringung einer neuen Dachhaut und deren Ausformung zu einer Fledermaus-Thermokammer gehen wir hier nun einen wichtigen Schritt zum Schutz heimischer Fledermausbestände und Arten. Mehr noch, wir bieten den vielfach im Bestand gefährdeten Kleinsäugern eine wertvolle Überlebensperspektive in zunehmend herausfordernden Zeiten.
Die Maßnahme schafft somit einen tatsächlichen Überlebensraum. Hierhin können sich Fledermäuse zurückziehen und auch Wochenstuben gründen ohne Gefahr laufen zu müssen das sie gestört oder gar „gefressen“ werden. Viele Jahrzehnte hinweg wird der hier nun geschaffene Bereich in der Lage sein diese wichtige Funktion auszuführen!
In der Aufnahme
Am 22. April 2024 starten wir mit dem ersten umfangreichen Schritt, um die Belange des praktischen Artenschutzes sichtbar werden zu lassen. Der Dachkörper des Objekts wurde in der Vergangenheit immer wieder von Fledermäusen frequentiert, auch Todfunde von drei Langohrfledermäusen signalisierten uns diese Präsenz. Doch sie zeigten uns auch den eklatanten Mangel der Dachhaut auf, denn diese war in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten "durchlässig" geworden.
Und das nicht nur für Fledermäuse, auch Waldkäuze und Steinmarder konnten somit ungestört in die Dachhautund den Dachstuhl vordringen und führten damit auch zum Erlöschen der vormals hier aktiven Fledermauskolonie. Mit der Aufbringung einer neuen Dachhaut und deren Ausformung zu einer Fledermaus-Thermokammer gehen wir hier nun einen wichtigen Schritt zum Schutz heimischer Fledermausbestände und Arten. Mehr noch, wir bieten den vielfach im Bestand gefährdeten Kleinsäugern eine wertvolle Überlebensperspektive in zunehmend herausfordernden Zeiten.
Die Maßnahme schafft somit einen tatsächlichen Überlebensraum. Hierhin können sich Fledermäuse zurückziehen und auch Wochenstuben gründen ohne Gefahr laufen zu müssen das sie gestört oder gar „gefressen“ werden. Viele Jahrzehnte hinweg wird der hier nun geschaffene Bereich in der Lage sein diese wichtige Funktion auszuführen!
In der Aufnahme
- MIt der Aufbringung der Dachhaut gehen wir den nächsten Entwicklungsschritt.
Artenschutz in Franken®
Das Große Heupferd (Tettigonia viridissima)

Großes Heupferd (Tettigonia viridissima)
29/30.04.2024
Das Grüne Heupferd ist unsere größte heimische Heuschrecke ... in Mitteleuropa ist sie weit verbreitet und gilt daher als nicht gefährdet. Die Familie der Heuschrecken hat 19 Unterfamilien und umfasst weltweit etwa 6000 Arten ...
29/30.04.2024
Das Grüne Heupferd ist unsere größte heimische Heuschrecke ... in Mitteleuropa ist sie weit verbreitet und gilt daher als nicht gefährdet. Die Familie der Heuschrecken hat 19 Unterfamilien und umfasst weltweit etwa 6000 Arten ...
... in Deutschland zählt die Deutsche Gesellschaft für Orthopterologie e. V. aktuell genau 90 Heuschreckenarten.
Dieses Prachtexemplar hat eine Körperlänge von etwa 50 mm.
Aufnahme und Autor
Dieses Prachtexemplar hat eine Körperlänge von etwa 50 mm.
Aufnahme und Autor
- Willibald Lang
Artenschutz in Franken®
Die Rostgans (Tadorna ferruginea)

Die Rostgans (Tadorna ferruginea)
29/30.04.2024
Bayern / Steigerwald. Seit einigen Jahren hat sich hier die Rostgans etabliert. War sie vor einigen Jahren noch selten, hat sich diese "Halbgans" inzwischen eingelebt. Ihre trompetenden Rufe werden häufiger, der Bestand nimmt zu. Während der Brutzeit sind sie aggressiv, ob ihr Vorkommen den heimischen Wasservogelbestand vermindert, bleibt ab zu warten.
29/30.04.2024
Bayern / Steigerwald. Seit einigen Jahren hat sich hier die Rostgans etabliert. War sie vor einigen Jahren noch selten, hat sich diese "Halbgans" inzwischen eingelebt. Ihre trompetenden Rufe werden häufiger, der Bestand nimmt zu. Während der Brutzeit sind sie aggressiv, ob ihr Vorkommen den heimischen Wasservogelbestand vermindert, bleibt ab zu warten.
Der Bestand wächst, die Erfolgsgeschichte der invasiven Nilgänse kann sich wiederholen. Die Nilgänse sind inzwischen ein häufiger Wasservogel hier, am Rande des Steigerwaldes, im Land der vielen Teiche.
Aufnahme und Autor
Aufnahme und Autor
- Bernhard Schmalisch
Artenschutz in Franken®
Setting an example - preserving biodiversity

Setting an example - preserving biodiversity - Informationspfad / Umweltpädagogik Parcours Steigerwald
29/30.04.2024
Flurwege spielen eine wichtige ökologische Rolle in ausgeräumten Landschaften, insbesondere in intensiv genutzten land-wirtschaftlichen Gebieten oder urbanisierten Regionen.
Hier stellen wir Ihnen einige ökologische Bedeutungen von Flurwegen vor:
Flurwege können als Verbindungselemente dienen und verschiedene Lebensräume miteinander verbinden. Sie schaffen somit eine Biotopvernetzung, die es Pflanzen und Tieren ermöglicht, sich zwischen isolierten Gebieten zu bewegen. Dies fördert den genetischen Austausch und trägt zur Erhaltung der Artenvielfalt bei. Flurwege können eine einzigartige Umgebung bieten, die von bestimmten Pflanzenarten bevorzugt wird. Randbereiche entlang der Wege können als Lebensraum für spezialisierte Flora und Fauna dienen, die in den intensiv genutzten Flächen möglicherweise keine geeigneten Bedingungen finden.
Durch die natürliche Sukzession entlang der Flurwege kann eine vielfältige Pflanzengemeinschaft entstehen. Unterschiedliche Bodenbedingungen und Mikroklimata entlang der Wege können zu einer größeren Vielfalt von Pflanzenarten führen. Flurwege bieten Lebensraum für verschiedene Insekten, darunter Bienen, Schmetterlinge und Käfer. Diese Insekten spielen eine entscheidende Rolle bei der Bestäubung von Pflanzen und der Aufrechterhaltung des ökologischen Gleichgewichts.
Wildtiere nutzen Flurwege als Korridore für ihre Wanderungen. Dies erleichtert die Bewegung von Populationen, was wichtig ist, um genetische Vielfalt zu erhalten und das Überleben von Arten in fragmentierten Landschaften zu unterstützen. Gut gestaltete Flurwege können dazu beitragen, die Bodenerosion zu minimieren. Sie können als Barrieren gegen Wasserabfluss wirken und somit dazu beitragen, den Boden und darin enthaltene Nährstoffe zu erhalten. Es ist wichtig, dass die Pflege und Planung von Flurwegen unter Berücksichtigung ökologischer Gesichtspunkte erfolgt, um ihre positiven Auswirkungen auf die Umwelt zu maximieren und negative Effekte zu minimieren.
Und wie sieht die Realität dieser Bereiche an zahlreichen Standorten in unserem Land aus?
29/30.04.2024
- Flurwege weit mehr als nur landwirtschaftliche Verbindungstrassen zweiten Grades
Flurwege spielen eine wichtige ökologische Rolle in ausgeräumten Landschaften, insbesondere in intensiv genutzten land-wirtschaftlichen Gebieten oder urbanisierten Regionen.
Hier stellen wir Ihnen einige ökologische Bedeutungen von Flurwegen vor:
Flurwege können als Verbindungselemente dienen und verschiedene Lebensräume miteinander verbinden. Sie schaffen somit eine Biotopvernetzung, die es Pflanzen und Tieren ermöglicht, sich zwischen isolierten Gebieten zu bewegen. Dies fördert den genetischen Austausch und trägt zur Erhaltung der Artenvielfalt bei. Flurwege können eine einzigartige Umgebung bieten, die von bestimmten Pflanzenarten bevorzugt wird. Randbereiche entlang der Wege können als Lebensraum für spezialisierte Flora und Fauna dienen, die in den intensiv genutzten Flächen möglicherweise keine geeigneten Bedingungen finden.
Durch die natürliche Sukzession entlang der Flurwege kann eine vielfältige Pflanzengemeinschaft entstehen. Unterschiedliche Bodenbedingungen und Mikroklimata entlang der Wege können zu einer größeren Vielfalt von Pflanzenarten führen. Flurwege bieten Lebensraum für verschiedene Insekten, darunter Bienen, Schmetterlinge und Käfer. Diese Insekten spielen eine entscheidende Rolle bei der Bestäubung von Pflanzen und der Aufrechterhaltung des ökologischen Gleichgewichts.
Wildtiere nutzen Flurwege als Korridore für ihre Wanderungen. Dies erleichtert die Bewegung von Populationen, was wichtig ist, um genetische Vielfalt zu erhalten und das Überleben von Arten in fragmentierten Landschaften zu unterstützen. Gut gestaltete Flurwege können dazu beitragen, die Bodenerosion zu minimieren. Sie können als Barrieren gegen Wasserabfluss wirken und somit dazu beitragen, den Boden und darin enthaltene Nährstoffe zu erhalten. Es ist wichtig, dass die Pflege und Planung von Flurwegen unter Berücksichtigung ökologischer Gesichtspunkte erfolgt, um ihre positiven Auswirkungen auf die Umwelt zu maximieren und negative Effekte zu minimieren.
Und wie sieht die Realität dieser Bereiche an zahlreichen Standorten in unserem Land aus?
Der Begriff "stiefmütterlich behandeln" zeigt sich bezogen auf diese Strukturen häufig noch als recht harmlos denn ...
Flurwege werden oft als Durchgangsbereiche betrachtet, die primär der Fortbewegung dienen. Die Pflege und Gestaltung solcher Bereiche stehen möglicherweise nicht ganz oben auf der Prioritätenliste, besonders wenn Ressourcen und Aufmerksamkeit auf andere Bereiche wie Hauptwege oder Grünanlagen gerichtet sind.
Flurwege sind in erster Linie für den Verkehr gedacht, sei es zu Fuß oder mit Fahrzeugen. Pflanzungen könnten als störend empfunden werden, wenn sie die Sicht behindern, den Verkehrsfluss beeinträchtigen oder zusätzliche Wartung erfordern.
Budgetbeschränkungen: Die Pflege von Grünflächen erfordert Ressourcen wie Arbeitskraft, Wasser und Dünger. In Zeiten begrenzter finanzieller Mittel könnten Flurwegbepflanzungen zugunsten anderer Projekte vernachlässigt werden.
Flurwege werden möglicherweise als weniger wichtig oder ästhetisch ansprechend angesehen, was zu einer geringeren Wertschätzung für ihre Gestaltung und Pflege führt.In manchen Fällen werden Flurwegbereiche möglicherweise nicht angemessen in die Gesamtplanung von Grünflächen einbezogen. Dies kann dazu führen, dass sie bei der Gestaltung und Pflege übersehen werden.
... ausgestattet mit diesen Inhalten führen diese Bereiche häufig ein jämmerliches Dasein ...
Doch häufig ist es auch einfach Desinteresse oder Mangel an Wissen der zu diesem stark negativen Aspekt beiträgt. Und so haben wir uns in 2024 aufgemacht ein Projekt zu starten das hier konkret ansetzt und auch den Ansatz einer lebendigen Umweltpädagogik nicht übersieht.
In der Aufnahme
... immer noch festigt sich der Eindruck das es sich Flächen dieser Art ... obwohl diese als ökologisch bedeutsam ausgewiesen wurden, als Niemandland angesehen und damit auch entsprechend sträflich behandelt werden ...
Flurwege werden oft als Durchgangsbereiche betrachtet, die primär der Fortbewegung dienen. Die Pflege und Gestaltung solcher Bereiche stehen möglicherweise nicht ganz oben auf der Prioritätenliste, besonders wenn Ressourcen und Aufmerksamkeit auf andere Bereiche wie Hauptwege oder Grünanlagen gerichtet sind.
Flurwege sind in erster Linie für den Verkehr gedacht, sei es zu Fuß oder mit Fahrzeugen. Pflanzungen könnten als störend empfunden werden, wenn sie die Sicht behindern, den Verkehrsfluss beeinträchtigen oder zusätzliche Wartung erfordern.
Budgetbeschränkungen: Die Pflege von Grünflächen erfordert Ressourcen wie Arbeitskraft, Wasser und Dünger. In Zeiten begrenzter finanzieller Mittel könnten Flurwegbepflanzungen zugunsten anderer Projekte vernachlässigt werden.
Flurwege werden möglicherweise als weniger wichtig oder ästhetisch ansprechend angesehen, was zu einer geringeren Wertschätzung für ihre Gestaltung und Pflege führt.In manchen Fällen werden Flurwegbereiche möglicherweise nicht angemessen in die Gesamtplanung von Grünflächen einbezogen. Dies kann dazu führen, dass sie bei der Gestaltung und Pflege übersehen werden.
... ausgestattet mit diesen Inhalten führen diese Bereiche häufig ein jämmerliches Dasein ...
Doch häufig ist es auch einfach Desinteresse oder Mangel an Wissen der zu diesem stark negativen Aspekt beiträgt. Und so haben wir uns in 2024 aufgemacht ein Projekt zu starten das hier konkret ansetzt und auch den Ansatz einer lebendigen Umweltpädagogik nicht übersieht.
In der Aufnahme
... immer noch festigt sich der Eindruck das es sich Flächen dieser Art ... obwohl diese als ökologisch bedeutsam ausgewiesen wurden, als Niemandland angesehen und damit auch entsprechend sträflich behandelt werden ...
Artenschutz in Franken®
Überlebensräume für Zauneidechse & Co.

Überlebensräume für Zauneidechse & Co.
28/29.04.2024
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und einem europaweit tätigem Freiflächen Fotoviltaikanlagen-betreiber.
• Projektumsetzung abgeschlossen - Lebensraum steht zur Neubesiedlung bereit.
Bayern. Mit der Neuanlage entsprechender Lebensraumkulissen bemühen wir uns einer möglichst breiten Artenvielfalt die benötigten Strukturen vorzuhalten, um in einer zunehmend vom Menschen geprägten und übernutzen Umwelt überdauern zu können.
Viele Tier- und Pflanzenarten leben bereits viele Millionen Jahre auf diesem Planeten. Der Spezies Mensch ist es nun tatsächlich gelungen diesen Lebensformen den Todesstoß zu versetzen indem sie entweder die Arten direkt oder deren Lebensräume eliminiert.
28/29.04.2024
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und einem europaweit tätigem Freiflächen Fotoviltaikanlagen-betreiber.
• Projektumsetzung abgeschlossen - Lebensraum steht zur Neubesiedlung bereit.
Bayern. Mit der Neuanlage entsprechender Lebensraumkulissen bemühen wir uns einer möglichst breiten Artenvielfalt die benötigten Strukturen vorzuhalten, um in einer zunehmend vom Menschen geprägten und übernutzen Umwelt überdauern zu können.
Viele Tier- und Pflanzenarten leben bereits viele Millionen Jahre auf diesem Planeten. Der Spezies Mensch ist es nun tatsächlich gelungen diesen Lebensformen den Todesstoß zu versetzen indem sie entweder die Arten direkt oder deren Lebensräume eliminiert.
Der uns nachfolgenden Generation hinterlassen wir, wenn wir noch wenige Jahre so weitermachen wie bisher einen ausgeräumten und lebensfeindlichen Planeten. Der Ansatz zum Klimaschutz darf nicht zulasten der Biodiversität gehen, denn nur wenn beides stimmt, Klima und Artenvielfalt, können wir davon sprechend das es uns gelungen ist, den Planeten Erde für unsere Kinder und Enkelkinder zu erhalten.
In Zusammenarbeit mit dem Betreiber einer Freiflächenfotovoltaikanlage konnten wir am 22. April 2024 den Abschluss der Arbeiten, die einen wichtigen Baustein zum regionalen Artenschutz leisten, finden.
Auf unseren Seiten haben wie vielfältige neue Eindrücke eingestellt welche die Umgestaltung der Fläche eindrucksvoll sichtbar werden lassen.
In der Aufnahme ...
... in einer umfangreichen Artenschutzmaßnahme wurden neue Lebensräume geschaffen und somit erhält die Freiflächen Fotovoltaikanlage auch einen weiteren wichtigen Baustein als Überlebensraum für auch im Bestand gefährdete Tier- und Pflanzenarten in einer zunehmen ausgeräumten Umwelt.
In Zusammenarbeit mit dem Betreiber einer Freiflächenfotovoltaikanlage konnten wir am 22. April 2024 den Abschluss der Arbeiten, die einen wichtigen Baustein zum regionalen Artenschutz leisten, finden.
Auf unseren Seiten haben wie vielfältige neue Eindrücke eingestellt welche die Umgestaltung der Fläche eindrucksvoll sichtbar werden lassen.
In der Aufnahme ...
... in einer umfangreichen Artenschutzmaßnahme wurden neue Lebensräume geschaffen und somit erhält die Freiflächen Fotovoltaikanlage auch einen weiteren wichtigen Baustein als Überlebensraum für auch im Bestand gefährdete Tier- und Pflanzenarten in einer zunehmen ausgeräumten Umwelt.
Artenschutz in Franken®
Stele der Biodiversität® - Unterweiler

Stele der Biodiversität® - Unterweiler
23/24.04.2024
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® das vom Markt Burgwindheim, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.
Unterweiler / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
23/24.04.2024
- Making of ... erleben Sie die Entwicklung des Außenbereichs
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® das vom Markt Burgwindheim, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.
Unterweiler / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
Denn wenn (selbst in noch geeigneten Nahrungsstrukturen) keine geeigneten Reproduktionsräume vorhanden sind, ist die Erhaltung der Artenvielfalt gleichfalls zum Scheitern verurteilt.
Ein Projekt des Artenschutz in Franken® das vom Markt Burgwindheim, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.
In der Aufnahme
Ein Projekt des Artenschutz in Franken® das vom Markt Burgwindheim, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.
In der Aufnahme
- Wir haben die Projektrubrik um zahlreiche neue Aufnahmen ergänzt und möchten Ihnen einen Eindruck ermöglichen wie es gelang die Außenfläche temporär zu gestalten.
Artenschutz in Franken®
Stele der Biodiversität® - Umweltpoint: Dorsten – Wulfen

Stele der Biodiversität® - Umweltpoint: Dorsten – Wulfen
26/27.04.2024
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutzes in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das von der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.
Dorsten GT-Wulfen / Nordrhein - Westfalen. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen, kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Baukörper gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper und auch deren Umfeld zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
26/27.04.2024
- Errichtung der Fledermaus-Thermokammer
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutzes in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das von der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.
Dorsten GT-Wulfen / Nordrhein - Westfalen. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen, kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Baukörper gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper und auch deren Umfeld zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
Wenn auch noch die Umweltbildung einen wichtigen Projektaspekt vereinnahmt, dann sind wir der festen Überzeugung, hier einigen wertvollen Beitrag für gerade die uns nachfolgende Generation zu leisten!
Am 22. April 2024 starten wir mit dem ersten umfangreichen Schritt, um die Belange des praktischen Artenschutzes sichtbar werden zu lassen. Der Dachkörper des Objekts wurde in der Vergangenheit immer wieder von Fledermäusen frequentiert, auch Todfunde von drei Langohrfledermäusen signalisierten uns diese Präsenz. Doch sie zeigten uns auch den eklatanten Mangel der Dachhaut auf, denn diese war in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten "durchlässig" geworden.
Und das nicht nur für Fledermäuse, auch Waldkäuze und Steinmarder konnten somit ungestört in die Dachhautund den Dachstuhl vordringen und führten damit auch zum Erlöschen der vormals hier aktiven Fledermauskolonie. Mit der Aufbringung einer neuen Dachhaut und deren Ausformung zu einer Fledermaus-Thermokammer gehen wir hier nun einen wichtigen Schritt zum Schutz heimischer Fledermausbestände und Arten. Mehr noch, wir bieten den vielfach im Bestand gefährdeten Kleinsäugern eine wertvolle Überlebensperspektive in zunehmend herausfordernden Zeiten.
Die Maßnahme schafft somit einen tatsächlichen Überlebensraum. Hierhin können sich Fledermäuse zurückziehen und auch Wochenstuben gründen ohne Gefahr laufen zu müssen das sie gestört oder gar „gefressen“ werden. Viele Jahrzehnte hinweg wird der hier nun geschaffene Bereich in der Lage sein diese wichtige Funktion auszuführen!
In der Aufnahme
Am 22. April 2024 starten wir mit dem ersten umfangreichen Schritt, um die Belange des praktischen Artenschutzes sichtbar werden zu lassen. Der Dachkörper des Objekts wurde in der Vergangenheit immer wieder von Fledermäusen frequentiert, auch Todfunde von drei Langohrfledermäusen signalisierten uns diese Präsenz. Doch sie zeigten uns auch den eklatanten Mangel der Dachhaut auf, denn diese war in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten "durchlässig" geworden.
Und das nicht nur für Fledermäuse, auch Waldkäuze und Steinmarder konnten somit ungestört in die Dachhautund den Dachstuhl vordringen und führten damit auch zum Erlöschen der vormals hier aktiven Fledermauskolonie. Mit der Aufbringung einer neuen Dachhaut und deren Ausformung zu einer Fledermaus-Thermokammer gehen wir hier nun einen wichtigen Schritt zum Schutz heimischer Fledermausbestände und Arten. Mehr noch, wir bieten den vielfach im Bestand gefährdeten Kleinsäugern eine wertvolle Überlebensperspektive in zunehmend herausfordernden Zeiten.
Die Maßnahme schafft somit einen tatsächlichen Überlebensraum. Hierhin können sich Fledermäuse zurückziehen und auch Wochenstuben gründen ohne Gefahr laufen zu müssen das sie gestört oder gar „gefressen“ werden. Viele Jahrzehnte hinweg wird der hier nun geschaffene Bereich in der Lage sein diese wichtige Funktion auszuführen!
In der Aufnahme
- Einblick in eines der 4 hier neu geschaffenen Spaltenquartiere, die in Ergänzung mit der diese umhüllenden Gesamtinnenraumkomponente einen hochwertigen Lebens- und Fortpflanzungsbereich für Fledermäuse schaffen.
Artenschutz in Franken®
Gefahrenquelle - Greifvogelansitz am Straßenrand

Gefahrenquelle - Greifvogelansitz am Straßenrand
25/26.04.2024
Greifvögel nutzen Ansitze, um nach Beute Ausschau zu halten und sich auszuruhen. Wenn diese Ansitze in der Nähe von Straßen liegen, können die Vögel leicht von vorbeifahrenden Fahrzeugen getroffen werden. Die schnelle Geschwindigkeit der Autos macht es schwierig für die Vögel, rechtzeitig auszuweichen.
Der Lärm und die Bewegungen des Verkehrs können die Greifvögel stören und sie davon abhalten, sich sicher auszuruhen oder nach Nahrung zu suchen. Greifvögel sind oft auf ihre Sinne angewiesen, um Beute zu entdecken, und laute Geräusche können diese Fähigkeit beeinträchtigen.
25/26.04.2024
- Es ist nach unserer Auffassung für Greifvögel gefährlich, Ansitze zu nahe am Straßenrand zu bauen und das aus aus mehreren Gründen.
Greifvögel nutzen Ansitze, um nach Beute Ausschau zu halten und sich auszuruhen. Wenn diese Ansitze in der Nähe von Straßen liegen, können die Vögel leicht von vorbeifahrenden Fahrzeugen getroffen werden. Die schnelle Geschwindigkeit der Autos macht es schwierig für die Vögel, rechtzeitig auszuweichen.
Der Lärm und die Bewegungen des Verkehrs können die Greifvögel stören und sie davon abhalten, sich sicher auszuruhen oder nach Nahrung zu suchen. Greifvögel sind oft auf ihre Sinne angewiesen, um Beute zu entdecken, und laute Geräusche können diese Fähigkeit beeinträchtigen.
Straßenränder sind oft Orte, an denen sich Abfälle und Schadstoffe ansammeln können. Diese Verschmutzung kann sowohl direkt als auch indirekt die Gesundheit der Greifvögel beeinträchtigen, sei es durch direktes Vergiften oder durch die Beeinträchtigung der Nahrungsquellen. Der Bau von Ansitzen entlang von Straßen kann dazu führen, dass das natürliche Habitat der Greifvögel fragmentiert wird. Dies kann ihre Bewegungen einschränken, den Zugang zu Nahrung und Brutplätzen erschweren und letztendlich die Populationen gefährden.
Insgesamt können Ansitze am Straßenrand für Greifvögel eine ernsthafte Gefahr darstellen und dazu beitragen, dass sie verletzt oder getötet werden, sowie ihre Lebensräume beeinträchtigen. Es ist wichtig, dass bei der Planung von Straßen und anderen Infrastrukturprojekten die Bedürfnisse und Lebensräume von Wildtieren berücksichtigt werden, um solche Konflikte zu minimieren.
Keine Vogelansitze an Straßen.
Immer wieder sind Greifvögel an den Ansitzwarten (Jule) am Straßenrand zu finden. An Feldwegen sollten diese Hilfen stehen aber nicht an Land-Kreis-Schnellstraßen. Der Sog von großen Fahrzeugen (100 km/h) in einem Abstand von 10 Meter ist enorm. Klar bleiben Tiere auch im Straßenverkehr an Windrädern und Glasscheiben auf der Strecke. Man sollte das aber wo es machbar ist ausschließen !
In der Aufnahme von Rolf Thiemann
Quelle
Rolf Thiemann
Gewässer und Naturschutz im Erftkreis
Flora-Fauna-Artenschutz
Naturschutzökologie
Eisvogelweg 1
50181 Bedburg
Insgesamt können Ansitze am Straßenrand für Greifvögel eine ernsthafte Gefahr darstellen und dazu beitragen, dass sie verletzt oder getötet werden, sowie ihre Lebensräume beeinträchtigen. Es ist wichtig, dass bei der Planung von Straßen und anderen Infrastrukturprojekten die Bedürfnisse und Lebensräume von Wildtieren berücksichtigt werden, um solche Konflikte zu minimieren.
Keine Vogelansitze an Straßen.
Immer wieder sind Greifvögel an den Ansitzwarten (Jule) am Straßenrand zu finden. An Feldwegen sollten diese Hilfen stehen aber nicht an Land-Kreis-Schnellstraßen. Der Sog von großen Fahrzeugen (100 km/h) in einem Abstand von 10 Meter ist enorm. Klar bleiben Tiere auch im Straßenverkehr an Windrädern und Glasscheiben auf der Strecke. Man sollte das aber wo es machbar ist ausschließen !
In der Aufnahme von Rolf Thiemann
- durch den "Unterdruck / Sog" von Fahrzeugen getöteter Turmfalke
Quelle
Rolf Thiemann
Gewässer und Naturschutz im Erftkreis
Flora-Fauna-Artenschutz
Naturschutzökologie
Eisvogelweg 1
50181 Bedburg
Artenschutz in Franken®
Philodromus cespitum

Philodromus cespitum ...
24/25.04.2024
... Eine größere heimische Laufspinne, ist bei uns weit verbreitet. Weibchen (Abbildung) erreicht eine Körperlänge von 4 bis 7 mm, Männchen sind 3,5–5 mm lang.
24/25.04.2024
... Eine größere heimische Laufspinne, ist bei uns weit verbreitet. Weibchen (Abbildung) erreicht eine Körperlänge von 4 bis 7 mm, Männchen sind 3,5–5 mm lang.
Aufnahme / Autor Bernhard Schmalisch
Artenschutz in Franken®
Nationalparktag in Ebrach
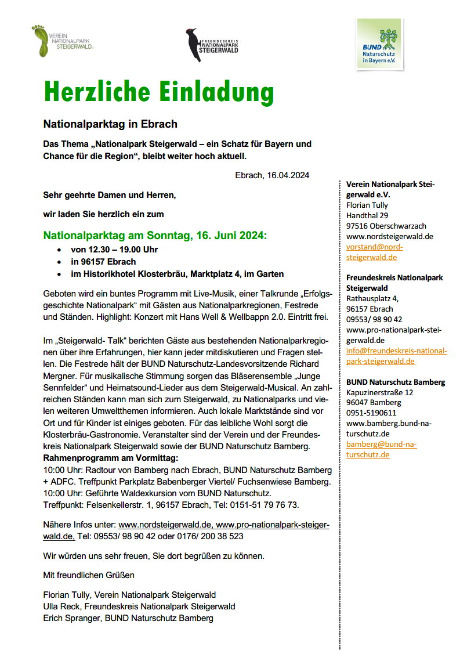
Herzliche Einladung -
24/25.04.2024
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir laden Sie herzlich ein zum Nationalparktag am Sonntag, 16. Juni 2024:
• von 12.30 – 19.00 Uhr
• in 96157 Ebrach
• im Historikhotel Klosterbräu, Marktplatz 4, im Garten
Geboten wird ein buntes Programm mit Live-Musik, einer Talkrunde „Erfolgsgeschichte Nationalpark“ mit Gästen aus Nationalparkregionen, Festrede und Ständen. Highlight: Konzert mit Hans Well & Wellbappn 2.0. Eintritt frei.
24/25.04.2024
- Nationalparktag in Ebrach
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir laden Sie herzlich ein zum Nationalparktag am Sonntag, 16. Juni 2024:
• von 12.30 – 19.00 Uhr
• in 96157 Ebrach
• im Historikhotel Klosterbräu, Marktplatz 4, im Garten
Geboten wird ein buntes Programm mit Live-Musik, einer Talkrunde „Erfolgsgeschichte Nationalpark“ mit Gästen aus Nationalparkregionen, Festrede und Ständen. Highlight: Konzert mit Hans Well & Wellbappn 2.0. Eintritt frei.
Im „Steigerwald- Talk“ berichten Gäste aus bestehenden Nationalparkregionen über ihre Erfahrungen, hier kann jeder mitdiskutieren und Fragen stellen. Die Festrede hält der BUND Naturschutz-Landesvorsitzende Richard Mergner. Für musikalische Stimmung sorgen das Bläserensemble „Junge Sennfelder“ und Heimatsound-Lieder aus dem Steigerwald-Musical.
An zahlreichen Ständen kann man sich zum Steigerwald, zu Nationalparks und vielen weiteren Umweltthemen informieren. Auch lokale Marktstände sind vor Ort und für Kinder ist einiges geboten. Für das leibliche Wohl sorgt die
Klosterbräu-Gastronomie. Veranstalter sind der Verein und der Freundeskreis Nationalpark Steigerwald sowie der BUND Naturschutz Bamberg.
Rahmenprogramm am Vormittag:
10:00 Uhr: Radtour von Bamberg nach Ebrach, BUND Naturschutz Bamberg + ADFC. Treffpunkt Parkplatz Babenberger Viertel/ Fuchsenwiese Bamberg.
10:00 Uhr: Geführte Waldexkursion vom BUND Naturschutz. Treffpunkt: Felsenkellerstr. 1, 96157 Ebrach, Tel: 0151-51 79 76 73.
Nähere Infos unter: www.nordsteigerwald.de, www.pro-nationalpark-steigerwald.de, Tel: 09553/ 98 90 42 oder 0176/ 200 38 523
Wir würden uns sehr freuen, Sie dort begrüßen zu können.
Mit freundlichen Grüßen
Florian Tully, Verein Nationalpark Steigerwald
Ulla Reck, Freundeskreis Nationalpark Steigerwald
Erich Spranger, BUND Naturschutz Bamberg
BAUMPATEN-PROJEKT STEIGERWALD
Bund Naturschutz in Bayern e.V.
https://www.bund-naturschutz.de/spenden-helfen/patenschaft
Informationsbüro Freundeskreis
Nationalpark Steigerwald
Rathausplatz 4, 96157 Ebrach
Tel.: 09553/9890-42
Mobil: 0176/ 200 38 523
info@freundeskreis-nationalpark-steigerwald.de
www.pro-nationalpark-steigerwald.de
Öffnungszeiten:
Di - Do von 9.00 - 16.00 Uhr
Das Büro ist aufgrund von Außendienst nur unregelmäßig besetzt.
Quelle / Abbildung
Informationsbüro Freundeskreis
Nationalpark Steigerwald
Rathausplatz 4, 96157 Ebrach
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung.Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
An zahlreichen Ständen kann man sich zum Steigerwald, zu Nationalparks und vielen weiteren Umweltthemen informieren. Auch lokale Marktstände sind vor Ort und für Kinder ist einiges geboten. Für das leibliche Wohl sorgt die
Klosterbräu-Gastronomie. Veranstalter sind der Verein und der Freundeskreis Nationalpark Steigerwald sowie der BUND Naturschutz Bamberg.
Rahmenprogramm am Vormittag:
10:00 Uhr: Radtour von Bamberg nach Ebrach, BUND Naturschutz Bamberg + ADFC. Treffpunkt Parkplatz Babenberger Viertel/ Fuchsenwiese Bamberg.
10:00 Uhr: Geführte Waldexkursion vom BUND Naturschutz. Treffpunkt: Felsenkellerstr. 1, 96157 Ebrach, Tel: 0151-51 79 76 73.
Nähere Infos unter: www.nordsteigerwald.de, www.pro-nationalpark-steigerwald.de, Tel: 09553/ 98 90 42 oder 0176/ 200 38 523
Wir würden uns sehr freuen, Sie dort begrüßen zu können.
Mit freundlichen Grüßen
Florian Tully, Verein Nationalpark Steigerwald
Ulla Reck, Freundeskreis Nationalpark Steigerwald
Erich Spranger, BUND Naturschutz Bamberg
BAUMPATEN-PROJEKT STEIGERWALD
Bund Naturschutz in Bayern e.V.
https://www.bund-naturschutz.de/spenden-helfen/patenschaft
Informationsbüro Freundeskreis
Nationalpark Steigerwald
Rathausplatz 4, 96157 Ebrach
Tel.: 09553/9890-42
Mobil: 0176/ 200 38 523
info@freundeskreis-nationalpark-steigerwald.de
www.pro-nationalpark-steigerwald.de
Öffnungszeiten:
Di - Do von 9.00 - 16.00 Uhr
Das Büro ist aufgrund von Außendienst nur unregelmäßig besetzt.
Quelle / Abbildung
Informationsbüro Freundeskreis
Nationalpark Steigerwald
Rathausplatz 4, 96157 Ebrach
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung.Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Artenschutz in Franken®
Die Große Schwebfliege / Gemeine Garten-Schwebfliege (Syrphus ribesii)

Die Große Schwebfliege oder Gemeine Garten-Schwebfliege ...
25/26.04.2024
... hier lutscht sie an dem Blatt, eventuell Honigtau, das sind die Blattlausausscheidungen.
Als "Helfer der Gärtner" legen sie ihre Eier in Blattlauskolonien oder deren Nähe. Eine Larve dieser Tiere vertilgt bis zu 150 Blattläuse am Tag. Die erwachsenen Schwebfliegen sind völlig harmlos und ihre schwarz/gelbe Warnzeichnung soll sie vor Fressfeinden schützen.
25/26.04.2024
... hier lutscht sie an dem Blatt, eventuell Honigtau, das sind die Blattlausausscheidungen.
Als "Helfer der Gärtner" legen sie ihre Eier in Blattlauskolonien oder deren Nähe. Eine Larve dieser Tiere vertilgt bis zu 150 Blattläuse am Tag. Die erwachsenen Schwebfliegen sind völlig harmlos und ihre schwarz/gelbe Warnzeichnung soll sie vor Fressfeinden schützen.
Sie ernähren sich großteils von Nektar, Pollen und auch den süßen Ausscheidungen von Blattläusen. Gartenbesitzer sollten wissen, dass sie mit Blattlaus-bekämpfungsmitteln alle Insekten vernichten, auch ihre Helfer.
Es ist wichtig, paar Tage Geduld zu haben, damit die Gilde der Blattlaus und Milbenfresser eine Chance hat, das Gleichgesicht wieder her zu stellen. Selten ist der Befall so groß, dass er in der Chemie freien Kompostwirtschaft, die gesunde Pflanzen schafft, Schäden anrichtet.
Aufnahme und Autor
Bernhard Schmalisch
Es ist wichtig, paar Tage Geduld zu haben, damit die Gilde der Blattlaus und Milbenfresser eine Chance hat, das Gleichgesicht wieder her zu stellen. Selten ist der Befall so groß, dass er in der Chemie freien Kompostwirtschaft, die gesunde Pflanzen schafft, Schäden anrichtet.
Aufnahme und Autor
Bernhard Schmalisch
Artenschutz in Franken®
Der Trauer-Rosenkäfer (Oxythyrea funesta)

Trauer-Rosenkäfer (Oxythyrea funesta)
24/25.04.2024
Der Lebensraum dieser Art war bisher in Nordafrika sowie dem restlichen Mittelmeerraum vorzufinden, mittlerweile ist er auch am Oberrhein, Rhein-Main-Gebiet und Rheinland-Pfalz anzutreffen.
24/25.04.2024
Der Lebensraum dieser Art war bisher in Nordafrika sowie dem restlichen Mittelmeerraum vorzufinden, mittlerweile ist er auch am Oberrhein, Rhein-Main-Gebiet und Rheinland-Pfalz anzutreffen.
In der Roten Liste - Deutschland, wird die Art mit RL2 (stark gefährdet) geführt.
Körperlänge von 8 - 13 mm.
Aufnahmen und Autor
Willibald Lang - 20.April 2024
Körperlänge von 8 - 13 mm.
Aufnahmen und Autor
Willibald Lang - 20.April 2024
Artenschutz in Franken®
Stele der Biodiversität® - Unterweiler

Stele der Biodiversität® - Unterweiler
23/24.04.2024
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® das vom Markt Burgwindheim, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.
Unterweiler / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
23/24.04.2024
- finale Gestaltung des Bauwerkumgriffs
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® das vom Markt Burgwindheim, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.
Unterweiler / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
Denn wenn (selbst in noch geeigneten Nahrungsstrukturen) keine geeigneten Reproduktionsräume vorhanden sind, ist die Erhaltung der Artenvielfalt gleichfalls zum Scheitern verurteilt.
Ein Projekt des Artenschutz in Franken® das vom Markt Burgwindheim, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.
In der Aufnahme
Ein Projekt des Artenschutz in Franken® das vom Markt Burgwindheim, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.
In der Aufnahme
- am 19.04.2024 konnten wir die finale Gestaltung des Bauwerkumgriffs vornehmen, dabei fand die Entnahme standortfremder Gehölze, bzw. deren Wurzelstöcke statt .. nun kann sich hier eine standorttypische Fauna und Flora entwickeln ...
Artenschutz in Franken®
Was ein Teebeutel über das Insektensterben erzählen kann

Was ein Teebeutel über das Insektensterben erzählen kann
22/23.04.2024
Forschende der Universität Trier haben ein Verfahren entwickelt, mit dem sich Erbgut-Spuren von Insekten aus getrockneten Pflanzen gewinnen und auswerten lassen.
22/23.04.2024
- Ein Biogeograph hat mithilfe von eDNA aus getrockneten Pflanzen dem Biomonitoring eine neue Dimension eröffnet.
Forschende der Universität Trier haben ein Verfahren entwickelt, mit dem sich Erbgut-Spuren von Insekten aus getrockneten Pflanzen gewinnen und auswerten lassen.
In der Aufnahme von Willibald Lang
- Eine Grüne Reiswanze krabbelt über ein Blatt und hinterlässt DNA-Spuren.
Quelle
Universität Trier
Universitätsring 15
54296 Trier
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung.Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Artenschutz in Franken®
Stele der Biodiversität® - Lechtingen

Stele der Biodiversität® - Lechtingen
22/23.04.2024
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und dem Windmühle Lechtingen e.V. das von der Audi Stiftung für Umwelt und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.
Lechtingen/Niedersachsen.Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trofostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
22/23.04.2024
- Die Fortpflanzung der "kleinen Mäusefänger", die im "Mausefallenmuseum" nisten, hat begonnen.
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und dem Windmühle Lechtingen e.V. das von der Audi Stiftung für Umwelt und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.
Lechtingen/Niedersachsen.Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trofostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
Denn wenn (selbst in noch geeigneten Nahrungsstrukturen) keine geeigneten Reproduktionsräume vorhanden sind, ist die Erhaltung der Artenvielfalt gleichfalls zum Scheitern verurteilt.
In der Aufnahme
In der Aufnahme
- Eine Nisthilfe, die sich im Baukörperinneren befindet, ermöglicht es Turmfalken sich fortzupflanzen. Das erste 2024er Ei wurde am 19. April gelegt.
Artenschutz in Franken®
Überlebensräume für Zauneidechse & Co.

Überlebensräume für Zauneidechse & Co.
21/22.04.2024
• Projektstart vor wenigen Tagen erfolgt - Freiflächen Fotovoltaikanlage im Fokus.
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und einem europaweit tätigem Freiflächen Fotoviltaikanlagenbetreiber.
Bayern. Mit der Neuanlage entsprechender Lebensraumkulissen bemühen wir uns einer möglichst breiten Artenvielfalt die benötigten Strukturen vorzuhalten, um in einer zunehmend vom Menschen geprägten und übernutzen Umwelt überdauern zu können.
Viele Tier- und Pflanzenarten leben bereits viele Millionen Jahre auf diesem Planeten. Der Spezies Mensch ist es nun tatsächlich gelungen diesen Lebensformen den Todesstoß zu versetzen indem sie entweder die Arten direkt oder deren Lebensräume eliminiert.
21/22.04.2024
• Projektstart vor wenigen Tagen erfolgt - Freiflächen Fotovoltaikanlage im Fokus.
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und einem europaweit tätigem Freiflächen Fotoviltaikanlagenbetreiber.
Bayern. Mit der Neuanlage entsprechender Lebensraumkulissen bemühen wir uns einer möglichst breiten Artenvielfalt die benötigten Strukturen vorzuhalten, um in einer zunehmend vom Menschen geprägten und übernutzen Umwelt überdauern zu können.
Viele Tier- und Pflanzenarten leben bereits viele Millionen Jahre auf diesem Planeten. Der Spezies Mensch ist es nun tatsächlich gelungen diesen Lebensformen den Todesstoß zu versetzen indem sie entweder die Arten direkt oder deren Lebensräume eliminiert.
Der uns nachfolgenden Generation hinterlassen wir, wenn wir noch wenige Jahre so weitermachen wie bisher einen ausgeräumten und lebensfeindlichen Planeten. Der Ansatz zum Klimaschutz darf nicht zulasten der Biodiversität gehen, denn nur wenn beides stimmt, Klima und Artenvielfalt, können wir davon sprechend das es uns gelungen ist, den Planeten Erde für unsere Kinder und Enkelkinder zu erhalten.
In Zusammenarbeit mit dem Betreiber einer Freiflächenfotovoltaikanlage konnten wir am 12. April 2024 mit der Anlage speziell für die Leitart Zauneidechse ausgerichteter Habitatstrukturen beginnen. In einer neuen Rubrik möchten wir Ihnen einige Eindrücke von der Gestaltung der Lebensraumanlage vermitteln. An einem sonnigen Tag wurden die ersten Arbeitsschritte generiert.
In der Aufnahme ...
... wird die Fläche entlang des rund 300 Meter langen Fotovoltaikfeldes sichtbar auf dem die Lebensraumkulisse installiert wurde.
In Zusammenarbeit mit dem Betreiber einer Freiflächenfotovoltaikanlage konnten wir am 12. April 2024 mit der Anlage speziell für die Leitart Zauneidechse ausgerichteter Habitatstrukturen beginnen. In einer neuen Rubrik möchten wir Ihnen einige Eindrücke von der Gestaltung der Lebensraumanlage vermitteln. An einem sonnigen Tag wurden die ersten Arbeitsschritte generiert.
In der Aufnahme ...
... wird die Fläche entlang des rund 300 Meter langen Fotovoltaikfeldes sichtbar auf dem die Lebensraumkulisse installiert wurde.
Artenschutz in Franken®
Die Rauchschwalbenkids

Die Rauchschwalbenkids
20/21.04.2024
Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und dem Bauernhofkindergarten Lindenbaum in Bruckmühl, das von der Deutschen Postcode Lotterie und Kunze Vermietung & Service GmbH unterstützt wird.
Bruckmühl/Bayern. Der Rückgang der Artenvielfalt nimmt immer bedrohlichere Ausmaße an. Auch bei unseren Schwalbenarten wird der Bestandsschwund immer deutlicher.
Brütende Rauchschwalben werden zur Seltenheit und selbst auf den Bauernhöfen wird der Zugvogel immer seltener angetroffen.Neben Nahrungsmangel sind es auch fehlende, geeignete Brutmöglichkeiten welche zu diesem Rückgang beitragen.
20/21.04.2024
- Projektbaustein Turmfalkenschutz zeigt erste Erfolge
Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und dem Bauernhofkindergarten Lindenbaum in Bruckmühl, das von der Deutschen Postcode Lotterie und Kunze Vermietung & Service GmbH unterstützt wird.
Bruckmühl/Bayern. Der Rückgang der Artenvielfalt nimmt immer bedrohlichere Ausmaße an. Auch bei unseren Schwalbenarten wird der Bestandsschwund immer deutlicher.
Brütende Rauchschwalben werden zur Seltenheit und selbst auf den Bauernhöfen wird der Zugvogel immer seltener angetroffen.Neben Nahrungsmangel sind es auch fehlende, geeignete Brutmöglichkeiten welche zu diesem Rückgang beitragen.
In einem Gemeinschaftsprojekt versuchen wir hier in 2021 / 2022-2023 sichtbare Zeichen zum Schutz der Rauschwalben zu setzen.
Darüber hinaus haben wir den Greifvogel/Eulenschutz mit in das Projekt integriert und hier erkennen wir in diesem Jahr ein Turmfalkenpaar welches die von unserer Seite installierte Nisthilfen seit einigen Tagen als Ort der Fortpflanzung auserkoren hat.
Das Turmfalkenweibchen hat sechs Eier gelegt und brütet diese nun seit wenigen Tagen aus. Über eine Webcam ist es möglich live und 24/7 mit dabei zu sein wenn die Jungen in rund 25 Tagen schlüpfen werden.
In der Aufnahme
Darüber hinaus haben wir den Greifvogel/Eulenschutz mit in das Projekt integriert und hier erkennen wir in diesem Jahr ein Turmfalkenpaar welches die von unserer Seite installierte Nisthilfen seit einigen Tagen als Ort der Fortpflanzung auserkoren hat.
Das Turmfalkenweibchen hat sechs Eier gelegt und brütet diese nun seit wenigen Tagen aus. Über eine Webcam ist es möglich live und 24/7 mit dabei zu sein wenn die Jungen in rund 25 Tagen schlüpfen werden.
In der Aufnahme
- Webcamaufnahmen
Artenschutz in Franken®
Aktueller Ordner:
Archiv
Parallele Themen:
2019-11
2019-10
2019-12
2020-01
2020-02
2020-03
2020-04
2020-05
2020-06
2020-07
2020-08
2020-09
2020-10
2020-11
2020-12
2021-01
2021-02
2021-03
2021-04
2021-05
2021-06
2021-07
2021-08
2021-09
2021-10
2021-11
2021-12
2022-01
2022-02
2022-03
2022-04
2022-05
2022-06
2022-07
2022-08
2022-09
2022-10
2022-11
2022-12
2023-01
2023-02
2023-03
2023-04
2023-05
2023-06
2023-07
2023-08
2023-09
2023-10
2023-11
2023-12
2024-01
2024-02
2024-03
2024-04
2024-05
2024-06
2024-07
2024-08
2024-09
2024-10
2024-11
2024-12
2025-01
2025-02
2025-03
2025-04
2025-05
2025-06
2025-07
2025-08
2025-09
2025-10
2025-11
2025-12
















