Die Goldglänzende Furchenbiene

Die Goldglänzende Furchenbiene: Eine faszinierende Bewohnerin der Natur
22/23.09.2024
Diese kleinen, aber auffälligen Bienen sind bekannt für ihre brillante goldene Färbung und ihre bedeutende Rolle bei der Bestäubung von Pflanzen. In diesem Aufsatz werden wir die Eigenschaften, das Verhalten und die Bedeutung der Goldglänzenden Furchenbiene näher betrachten.
22/23.09.2024
- Die Goldglänzende Furchenbiene (Halictus subauratus) ist eine bemerkenswerte Spezies, die in der Welt der Insekten eine wichtige Rolle spielt.
Diese kleinen, aber auffälligen Bienen sind bekannt für ihre brillante goldene Färbung und ihre bedeutende Rolle bei der Bestäubung von Pflanzen. In diesem Aufsatz werden wir die Eigenschaften, das Verhalten und die Bedeutung der Goldglänzenden Furchenbiene näher betrachten.
Zunächst einmal zeichnet sich die Goldglänzende Furchenbiene durch ihr markantes Aussehen aus. Erwachsene Exemplare haben einen schlanken Körper und sind in der Regel etwa 6 bis 8 Millimeter lang. Die charakteristische goldene Färbung ihres Körpers verleiht ihnen einen auffälligen und ansprechenden Anblick. Diese Färbung ist jedoch nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern dient auch als Warnsignal für potenzielle Feinde, da viele goldfarbene Insekten giftig oder ungenießbar sind.
Ein weiteres interessantes Merkmal der Goldglänzenden Furchenbiene ist ihr Lebensraum und ihr Verhalten. Diese Bienen sind häufig in offenen Landschaften, Gärten, Wiesen und anderen blühenden Lebensräumen anzutreffen. Sie sind solitäre Bienen, was bedeutet, dass sie nicht in großen sozialen Kolonien leben wie beispielsweise Honigbienen. Stattdessen bauen sie ihre Nester alleine oder in kleinen Gruppen in den Boden oder in andere natürliche Hohlräume.
Die Goldglänzende Furchenbiene spielt eine entscheidende Rolle im Ökosystem als Bestäuberin zahlreicher Pflanzenarten. Während sie Nahrung sammeln, indem sie Nektar und Pollen von Blüten aufnehmen, tragen sie unabsichtlich Pollen von einer Blume zur nächsten und ermöglichen so die Befruchtung und Fortpflanzung vieler Pflanzenarten. Auf diese Weise tragen sie zur Erhaltung der biologischen Vielfalt und zur Fruchtbarkeit von Ökosystemen bei.
Trotz ihrer ökologischen Bedeutung sind die Bestände der Goldglänzenden Furchenbiene wie viele andere Bienenarten bedroht. Verlust und Degradierung von Lebensräumen, der Einsatz von Pestiziden und der Klimawandel sind nur einige der Faktoren, die ihre Populationen gefährden. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, Maßnahmen zum Schutz dieser faszinierenden Insekten zu ergreifen, um ihre wichtige Rolle in der Natur zu erhalten.
Insgesamt ist die Goldglänzende Furchenbiene eine bemerkenswerte Spezies, die nicht nur durch ihr auffälliges Aussehen, sondern auch durch ihre ökologische Bedeutung fasziniert. Durch ihr Verhalten als Bestäuberin und ihre Anpassungsfähigkeit an verschiedene Lebensräume ist sie ein wichtiger Bestandteil des natürlichen Gleichgewichts und verdient unseren Respekt und Schutz.
Aufnahme von Bernhard Schmalisch
Ein weiteres interessantes Merkmal der Goldglänzenden Furchenbiene ist ihr Lebensraum und ihr Verhalten. Diese Bienen sind häufig in offenen Landschaften, Gärten, Wiesen und anderen blühenden Lebensräumen anzutreffen. Sie sind solitäre Bienen, was bedeutet, dass sie nicht in großen sozialen Kolonien leben wie beispielsweise Honigbienen. Stattdessen bauen sie ihre Nester alleine oder in kleinen Gruppen in den Boden oder in andere natürliche Hohlräume.
Die Goldglänzende Furchenbiene spielt eine entscheidende Rolle im Ökosystem als Bestäuberin zahlreicher Pflanzenarten. Während sie Nahrung sammeln, indem sie Nektar und Pollen von Blüten aufnehmen, tragen sie unabsichtlich Pollen von einer Blume zur nächsten und ermöglichen so die Befruchtung und Fortpflanzung vieler Pflanzenarten. Auf diese Weise tragen sie zur Erhaltung der biologischen Vielfalt und zur Fruchtbarkeit von Ökosystemen bei.
Trotz ihrer ökologischen Bedeutung sind die Bestände der Goldglänzenden Furchenbiene wie viele andere Bienenarten bedroht. Verlust und Degradierung von Lebensräumen, der Einsatz von Pestiziden und der Klimawandel sind nur einige der Faktoren, die ihre Populationen gefährden. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, Maßnahmen zum Schutz dieser faszinierenden Insekten zu ergreifen, um ihre wichtige Rolle in der Natur zu erhalten.
Insgesamt ist die Goldglänzende Furchenbiene eine bemerkenswerte Spezies, die nicht nur durch ihr auffälliges Aussehen, sondern auch durch ihre ökologische Bedeutung fasziniert. Durch ihr Verhalten als Bestäuberin und ihre Anpassungsfähigkeit an verschiedene Lebensräume ist sie ein wichtiger Bestandteil des natürlichen Gleichgewichts und verdient unseren Respekt und Schutz.
Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- Männchen auf "Fetthenne"
Artenschutz in Franken®
Die Kappenammer (Emberiza melanocephala)

Die Kappenammer (Emberiza melanocephala) ist eine Singvogelart, die zur Familie der Ammern (Emberizidae) gehört.
22/23.09.2024
22/23.09.2024
- Als Kappenammer selbst kann ich dir aus meiner Perspektive einiges über meine Art erzählen:
Ich bin bekannt für mein auffälliges Erscheinungsbild mit einem schwarzen Kopf und einer gelben Kehle, die von einer schwarzen Umrandung begrenzt wird. Mein Rücken ist grau und ich habe weiße Flügelabzeichen. Diese Farben helfen mir, mich gut in meiner natürlichen Umgebung zu tarnen, während ich in offenen Gebieten nach Nahrung suche.
Ich bevorzuge Lebensräume wie offene Busch- und Waldlandschaften sowie landwirtschaftlich genutzte Flächen mit reichlichem Bewuchs. Dort ernähre ich mich hauptsächlich von Samen, aber auch Insekten stehen auf meinem Speiseplan, besonders während der Brutzeit, wenn meine Jungen proteinreiche Nahrung benötigen.
Im Frühling und Sommer baue ich mein Nest in Bodennähe oder in niedrigem Gebüsch, oft gut versteckt zwischen Gräsern oder Zweigen. Mein Nest ist eine kunstvolle Konstruktion aus Gras, Zweigen und manchmal auch feinen Wurzeln, die ich geschickt zu einem stabilen Bau zusammenfüge.
Während der Brutzeit bin ich ein aufmerksamer Elternteil, der das Nest verteidigt und Nahrung für meine Jungen sammelt. Ich kommuniziere mit meinen Artgenossen über melodische Rufe und Singgesang, besonders während der Paarungszeit, um meine Verfügbarkeit und Revieransprüche zu signalisieren.
Die Kappenammer ist eine Zugvogelart, die im Winter in wärmere Regionen zieht, oft in den Mittelmeerraum oder nach Nordafrika. Dort finde ich geeignete Lebensbedingungen, um zu überwintern und genug Energie für die Rückkehr in meine Brutgebiete im Frühjahr zu sammeln.
Insgesamt bin ich als Kappenammer anpassungsfähig an verschiedene Lebensräume, solange sie ausreichend Nahrung und Deckung bieten. Meine Art ist nicht nur ein wichtiger Bestandteil des ökologischen Gleichgewichts in meinen Lebensräumen, sondern auch ein wertvoller Indikator für die Gesundheit und Vielfalt der Lebensräume, die ich bewohne.
Aufnahme von Helga Zinnecker
Ich bevorzuge Lebensräume wie offene Busch- und Waldlandschaften sowie landwirtschaftlich genutzte Flächen mit reichlichem Bewuchs. Dort ernähre ich mich hauptsächlich von Samen, aber auch Insekten stehen auf meinem Speiseplan, besonders während der Brutzeit, wenn meine Jungen proteinreiche Nahrung benötigen.
Im Frühling und Sommer baue ich mein Nest in Bodennähe oder in niedrigem Gebüsch, oft gut versteckt zwischen Gräsern oder Zweigen. Mein Nest ist eine kunstvolle Konstruktion aus Gras, Zweigen und manchmal auch feinen Wurzeln, die ich geschickt zu einem stabilen Bau zusammenfüge.
Während der Brutzeit bin ich ein aufmerksamer Elternteil, der das Nest verteidigt und Nahrung für meine Jungen sammelt. Ich kommuniziere mit meinen Artgenossen über melodische Rufe und Singgesang, besonders während der Paarungszeit, um meine Verfügbarkeit und Revieransprüche zu signalisieren.
Die Kappenammer ist eine Zugvogelart, die im Winter in wärmere Regionen zieht, oft in den Mittelmeerraum oder nach Nordafrika. Dort finde ich geeignete Lebensbedingungen, um zu überwintern und genug Energie für die Rückkehr in meine Brutgebiete im Frühjahr zu sammeln.
Insgesamt bin ich als Kappenammer anpassungsfähig an verschiedene Lebensräume, solange sie ausreichend Nahrung und Deckung bieten. Meine Art ist nicht nur ein wichtiger Bestandteil des ökologischen Gleichgewichts in meinen Lebensräumen, sondern auch ein wertvoller Indikator für die Gesundheit und Vielfalt der Lebensräume, die ich bewohne.
- Weitere Aufnahmen der Kappenammer haben wir in der Rubrik: Tiere/Vögel/Kappenammer für Sie eingestellt.
Aufnahme von Helga Zinnecker
- Kappenammer (Emberiza melanocephala) - Männchen
Artenschutz in Franken®
Die Dungwaffenfliege (Sargus bipunctatus)

Dungwaffenfliege (Sargus bipunctatus)
22/29.09.2024
Ich bin eine Vertreterin der Waffenfliegen (Stratiomyidae), und mein Name „Dungwaffenfliege“ verrät schon einiges über meinen Lebensraum. Ich mag feuchte, verrottende organische Substanzen, besonders Mist und Komposthaufen. Dort legen wir, die Weibchen, unsere Eier ab, und meine Larven helfen dann beim Zersetzen dieser Materialien. Sie sind sogar nützlich für das Ökosystem, da sie den Zersetzungsprozess beschleunigen und Nährstoffe wieder dem Boden zuführen.
22/29.09.2024
- Aus meiner Perspektive als Dungwaffenfliege (Sargus bipunctatus) könnte ich dir folgendes über mich erzählen:
Ich bin eine Vertreterin der Waffenfliegen (Stratiomyidae), und mein Name „Dungwaffenfliege“ verrät schon einiges über meinen Lebensraum. Ich mag feuchte, verrottende organische Substanzen, besonders Mist und Komposthaufen. Dort legen wir, die Weibchen, unsere Eier ab, und meine Larven helfen dann beim Zersetzen dieser Materialien. Sie sind sogar nützlich für das Ökosystem, da sie den Zersetzungsprozess beschleunigen und Nährstoffe wieder dem Boden zuführen.
Mein Körper ist mittelgroß, ich werde etwa 7-11 mm lang. Ich trage einen metallisch glänzenden Panzer, der in der Sonne oft schimmert, meist in einem leuchtenden Grün oder Bronze. Mein auffälligstes Merkmal sind die zwei hellen Punkte auf meinem Thorax, die mir den Namen bipunctatus eingebracht haben – lateinisch für „zwei Punkte“. Diese leuchtenden Punkte unterscheiden mich von anderen Fliegenarten. Meine durchsichtigen Flügel tragen ebenfalls zu meinem eleganten Erscheinungsbild bei.
Wie viele andere Fliegen, habe ich Facettenaugen, die es mir ermöglichen, Bewegungen in meiner Umgebung sehr schnell wahrzunehmen. Das ist besonders nützlich, um Raubtieren zu entkommen oder auch, um schnell auf Nahrungssuche zu gehen. Mein Nahrungsspektrum umfasst verschiedene organische Substanzen, aber auch Nektar, den ich an Blüten finde. Das gibt mir Energie für die Fortpflanzung und das Fliegen.
Eine interessante technische Besonderheit: Ich bin eine sogenannte „holometabole“ Insektenart, das bedeutet, ich durchlaufe eine vollständige Metamorphose. Meine Entwicklung startet als Ei, dann schlüpfen Larven, die sich später verpuppen und schließlich als ausgewachsene Fliegen, so wie ich es bin, aus der Puppe schlüpfen.
Während meiner kurzen Lebenszeit als ausgewachsenes Insekt suche ich nach Partnern zur Fortpflanzung, wobei ich mich stark auf meine visuellen und chemischen Sinne verlasse, um Weibchen (oder Männchen, je nach Perspektive) zu finden. Danach ist es wieder an der nächsten Generation von Larven, unsere wichtige Rolle im Abbau von organischen Abfällen zu übernehmen.
Das bin ich – Sargus bipunctatus, eine schimmernde und nützliche Bewohnerin der Welt des Zerfalls!
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
Wie viele andere Fliegen, habe ich Facettenaugen, die es mir ermöglichen, Bewegungen in meiner Umgebung sehr schnell wahrzunehmen. Das ist besonders nützlich, um Raubtieren zu entkommen oder auch, um schnell auf Nahrungssuche zu gehen. Mein Nahrungsspektrum umfasst verschiedene organische Substanzen, aber auch Nektar, den ich an Blüten finde. Das gibt mir Energie für die Fortpflanzung und das Fliegen.
Eine interessante technische Besonderheit: Ich bin eine sogenannte „holometabole“ Insektenart, das bedeutet, ich durchlaufe eine vollständige Metamorphose. Meine Entwicklung startet als Ei, dann schlüpfen Larven, die sich später verpuppen und schließlich als ausgewachsene Fliegen, so wie ich es bin, aus der Puppe schlüpfen.
Während meiner kurzen Lebenszeit als ausgewachsenes Insekt suche ich nach Partnern zur Fortpflanzung, wobei ich mich stark auf meine visuellen und chemischen Sinne verlasse, um Weibchen (oder Männchen, je nach Perspektive) zu finden. Danach ist es wieder an der nächsten Generation von Larven, unsere wichtige Rolle im Abbau von organischen Abfällen zu übernehmen.
Das bin ich – Sargus bipunctatus, eine schimmernde und nützliche Bewohnerin der Welt des Zerfalls!
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- Dungwaffenfliege (Sargus bipunctatus) - Weibchen
Artenschutz in Franken®
Stele der Biodiversität® - Burgwindheim / Kötsch

Stele der Biodiversität® - Burgwindheim / Kötsch
21/22.09.2024
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das vom Markt Burgwindheim, dem Bayernwerk der Deutschen Postcode Lotterie und der Steuerkanzlei Bauerfeind unterstützt wird.
Kötsch / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen.
Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
21/22.09.2024
- Grafik ... Entwicklung weiter fortgeschritten ...
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das vom Markt Burgwindheim, dem Bayernwerk der Deutschen Postcode Lotterie und der Steuerkanzlei Bauerfeind unterstützt wird.
Kötsch / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen.
Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
Denn wenn (selbst in noch geeigneten Nahrungsstrukturen) keine geeigneten Reproduktionsräume vorhanden sind, ist die Erhaltung der Artenvielfalt gelichfalls zum Scheitern verurteilt.
Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das vom Markt Burgwindheim, dem Bayernwerk der Deutschen Postcode Lotterie und der Steuerkanzlei Bauerfeind unterstützt wird, setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.
In der Aufnahme
Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das vom Markt Burgwindheim, dem Bayernwerk der Deutschen Postcode Lotterie und der Steuerkanzlei Bauerfeind unterstützt wird, setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.
In der Aufnahme
- Am 16.09.2024 ... wir schreiten grafisch zielstrebig voran ...
Artenschutz in Franken®
Referenzflächen im Fokus des Artenschutz in Franken®

Referenzflächen im Fokus des Artenschutz in Franken®
20/21.09.2024
Wir haben einfach genug von den standardisierten Wäldern die in unseren Augen schon lange keine Wälder im eigentlichen Sinn mehr sind und zu mehr oder minder einförmigen Forsten mutieren.
20/21.09.2024
- Das Gerede vom Klimawald der Zukunft und dem Verbissdruck der durch Rehwild hervorgerufen wird und den Wald nicht mehr „hochkommen lässt“ können wir einfach nicht mehr hören.
Wir haben einfach genug von den standardisierten Wäldern die in unseren Augen schon lange keine Wälder im eigentlichen Sinn mehr sind und zu mehr oder minder einförmigen Forsten mutieren.
So haben wir 10 Flächen auserkoren und nachhaltig in den Fokus eines internen Monitorings des Artenschutz in Franken® gestellt. Diese Flächen waren in den vergangenen Jahren durch starken Borkenkäferbefall ausgefallen und wurden nahezu Baumfrei gestellt.
Nun dürfen sie sich entwickeln wie sie möchten und wir sind hautnah dabei. Alljährlich werden wir in den kommenden Jahren immer wieder zum gleichen Zeitpunkt einige Aufnahme erstellen und damit deren Entwicklung darstellen.
In der Aufnahme
Nun dürfen sie sich entwickeln wie sie möchten und wir sind hautnah dabei. Alljährlich werden wir in den kommenden Jahren immer wieder zum gleichen Zeitpunkt einige Aufnahme erstellen und damit deren Entwicklung darstellen.
In der Aufnahme
- Wie konnten sich die Flächen nach einem Jahr entwickeln ... wir zeigen es Ihnen.
Artenschutz in Franken®
Gymnomerus laevipes

Gymnomerus laevipes ist eine solitäre Faltenwespe ohne deutschen Namen ...
20/21.09.2024
Gymnomerus laevipes legt ihre Nester hauptsächlich in den Stängeln von Brombeeren an ... dazu wird das Mark ausgenagt und die Zelle mit Lehm ausgekleidet ... das Nest wird durch das Mark des Stängels verschlossen ...d ie Brut wird mit Larven von Rüsselkäfern versorgt.
20/21.09.2024
Gymnomerus laevipes legt ihre Nester hauptsächlich in den Stängeln von Brombeeren an ... dazu wird das Mark ausgenagt und die Zelle mit Lehm ausgekleidet ... das Nest wird durch das Mark des Stängels verschlossen ...d ie Brut wird mit Larven von Rüsselkäfern versorgt.
Nutzt also den Menschen, aber auch diese Wespen haben Gegenspieler. Eine andere Wespenart parasitiert in den von ihnen gebauten Wohnungen der Larven, legt da die eigenen Eier rein.
Aufnahme und Autor Bernhard Schmalisch
Aufnahme und Autor Bernhard Schmalisch
Artenschutz in Franken®
Stomorhina lunata

Stomorhina lunata
19/20.09.2024
Sie scheint sich den Gegebenheiten hier angepasst zu haben. Stomorhina lunata ist laut Literatur in D. seit Ende der 90 er Jahre immer wieder mal anzutreffen.
♂ etwa 4-7mm
♀ etwa 5-9mm
19/20.09.2024
- Zunehmend sehe ich diese Fliege häufiger, so Bernhard Schmalisch der auch diese Aufnahme erstellt hat.
Sie scheint sich den Gegebenheiten hier angepasst zu haben. Stomorhina lunata ist laut Literatur in D. seit Ende der 90 er Jahre immer wieder mal anzutreffen.
♂ etwa 4-7mm
♀ etwa 5-9mm
In der Aufnahme das kleinere Männchen.Sie sind somit etwa gleich groß, eher kleiner als unsere Hausfliegen.Diese Fliegen legen ihre Eier in die Nähe oder auf Eigelege von Kurzfühlerschrecken, in den Ursprungsgebieten sind das verschiedene Wanderheuschrecken.
Die Maden fressen diese Eier und sind praktisch Antagonisten der Heuschrecken, die im Mittelmeerraum die Ernten bedrohen.Gelten dort wohl als Nutzinsekten.Durch ein vermehrtes Auftreten der Arten in klimatisch begünstigten Regionen zeichnet sich auch bei uns in Deutschland, in unserer nahen Heimat, die Spur der Klimaveränderung ab.
Aufnahme und Autor Bernhard Schmalisch
Die Maden fressen diese Eier und sind praktisch Antagonisten der Heuschrecken, die im Mittelmeerraum die Ernten bedrohen.Gelten dort wohl als Nutzinsekten.Durch ein vermehrtes Auftreten der Arten in klimatisch begünstigten Regionen zeichnet sich auch bei uns in Deutschland, in unserer nahen Heimat, die Spur der Klimaveränderung ab.
Aufnahme und Autor Bernhard Schmalisch
- Stomorhina lunata - Männchen
Artenschutz in Franken®
Ich bin ein Wildschutzzaun ... "sagt" der nicht gekennzeichnete Wildschutzzaun ...

Ich bin ein Wildschutzzaun ... "sagt" der nicht gekennzeichnete Wildschutzzaun ...
19/20.09.2024
Wir möchten hier potenzielle Risiken sowie einige rechtliche Grundlagen in Deutschland erläutern:
19/20.09.2024
- Elektrische Wildzäune, wie sie zum Beispiel zur Abwehr von Wildschweinen eingesetzt werden, haben sowohl Risiken als auch rechtliche Vorgaben, die beim Aufstellen beachtet werden müssen.
Wir möchten hier potenzielle Risiken sowie einige rechtliche Grundlagen in Deutschland erläutern:
Potentielle Risiken von elektrischen Wildzäunen
Gefährdung für Menschen:
Gefährdung für Tiere:
Technische Risiken:
Umweltrisiken:
Einige Rechtliche Grundlagen für Wildschutzzäune in Deutschland:
Die Errichtung von Wildschutzzäunen, insbesondere elektrischen Zäunen, unterliegt rechtlichen Regelungen. Diese betreffen sowohl den Tierschutz als auch die Sicherheit für Menschen und Umwelt.
Tierschutzgesetz (TierSchG):
Verkehrssicherungspflicht:
Baurechtliche Vorschriften:
Naturschutzrecht:
Forst- und Jagdrecht:
DIN-Normen und technische Vorschriften:
Fazit
Elektrische Wildzäune sind ein effektives Mittel zur Abwehr von Wildschweinen, bergen jedoch Risiken für Menschen und Tiere. Eine ordnungsgemäße Installation, regelmäßige Wartung und klare Kennzeichnung sind essenziell, um diese Risiken zu minimieren. Gleichzeitig muss der Betreiber rechtliche Vorgaben beachten, die von Tierschutzbestimmungen über baurechtliche Anforderungen bis hin zum
Naturschutzrecht reichen.
In der Aufnahme
Gefährdung für Menschen:
- Unfälle: Menschen, die unwissentlich in Berührung mit dem elektrischen Zaun kommen, können Stromschläge erleiden. Diese Stromschläge sind in der Regel nicht tödlich, aber sie können bei empfindlichen Personen, Kindern oder älteren Menschen Schmerzen und Schreckreaktionen verursachen, was indirekt zu Verletzungen führen kann (z.B. Stürze).
- Nicht ausreichende Kennzeichnung: Ohne deutliche Warnhinweise kann es zu Unfällen kommen, da nicht jeder erkennen wird, dass der Zaun unter Spannung steht. Daher sind gut sichtbare Warnschilder erforderlich.
Gefährdung für Tiere:
- Nicht-zielgerichtete Tiere: Auch andere Wildtiere oder Haustiere können den elektrischen Zaun berühren und Stromschläge erleiden, was insbesondere für kleinere Tiere (wie Hasen, Füchse oder Vögel) unangenehm oder schädlich sein kann.
- Verletzungsrisiko bei Panikreaktionen: Tiere, die in Panik geraten, könnten durch den Schock fliehen und sich dabei verletzen, beispielsweise an Zäunen, Ästen oder durch Stürze.
Technische Risiken:
- Kurzschlüsse oder Fehlfunktionen: Durch Vegetation, die den Zaun berührt, kann es zu Kurzschlüssen kommen. Dies kann die Funktion des Zaunes beeinträchtigen und möglicherweise Brandgefahr darstellen.
- Fehlende Wartung: Wenn der Zaun nicht regelmäßig überprüft wird, können technische Defekte auftreten, die entweder die Effektivität des Zaunes verringern oder das Risiko von Verletzungen erhöhen.
Umweltrisiken:
- Boden- und Wasserleitungen: Durch unsachgemäße Erdung können elektrische Ströme in den Boden oder in Gewässer gelangen und dort Schäden verursachen oder andere unerwünschte Effekte hervorrufen.
Einige Rechtliche Grundlagen für Wildschutzzäune in Deutschland:
Die Errichtung von Wildschutzzäunen, insbesondere elektrischen Zäunen, unterliegt rechtlichen Regelungen. Diese betreffen sowohl den Tierschutz als auch die Sicherheit für Menschen und Umwelt.
Tierschutzgesetz (TierSchG):
- Laut dem Tierschutzgesetz müssen Maßnahmen zur Tierabwehr so gestaltet sein, dass sie den Tieren keinen unnötigen Schmerz, Leid oder Schäden zufügen. Elektrische Zäune müssen daher so dimensioniert sein, dass der Stromschlag nur abschreckend, aber nicht verletzend wirkt. Die Stärke des elektrischen Impulses ist gesetzlich geregelt.
Verkehrssicherungspflicht:
- Wer einen elektrischen Zaun errichtet, hat eine Verkehrssicherungspflicht. Das bedeutet, dass Dritte nicht zu Schaden kommen dürfen. Der Betreiber des Zauns muss sicherstellen, dass der Zaun deutlich als solcher erkennbar ist und gut sichtbar Warnschilder angebracht sind. Besonders an öffentlich zugänglichen Orten müssen solche Warnhinweise gut sichtbar und in regelmäßigen Abständen angebracht sein.
Baurechtliche Vorschriften:
- In einigen Bundesländern oder Gemeinden können baurechtliche Vorschriften greifen, die die Errichtung eines Wildschutzzaunes regeln. Für Zäune, die eine bestimmte Höhe überschreiten, kann eine Genehmigung erforderlich sein. Je nach Standort können auch die Abstände zu Straßen, Wegen oder Nachbargrundstücken relevant sein.
Naturschutzrecht:
- Wenn der Wildschutzzaun in einem Naturschutzgebiet errichtet wird, sind zusätzliche Genehmigungen nach dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) erforderlich. Hier muss sichergestellt werden, dass die Natur nicht beeinträchtigt wird, und es könnten besondere Auflagen für den Schutz von bedrohten Arten gelten.
Forst- und Jagdrecht:
- In Gebieten, die jagdlich genutzt werden, müssen Zäune mit den zuständigen Behörden und Jagdpächtern abgestimmt werden, da diese Zäune das Wildverhalten und die Jagdausübung beeinflussen können.
DIN-Normen und technische Vorschriften:
- Elektrische Zäune müssen den einschlägigen Normen entsprechen, wie z.B. der DIN EN 60335-2-76. Diese Norm beschreibt die maximal zulässige Spannung und Stromstärke, die bei einem elektrischen Zaun verwendet werden darf. Zudem gibt es technische Vorschriften zur Erdung und Absicherung.
Fazit
Elektrische Wildzäune sind ein effektives Mittel zur Abwehr von Wildschweinen, bergen jedoch Risiken für Menschen und Tiere. Eine ordnungsgemäße Installation, regelmäßige Wartung und klare Kennzeichnung sind essenziell, um diese Risiken zu minimieren. Gleichzeitig muss der Betreiber rechtliche Vorgaben beachten, die von Tierschutzbestimmungen über baurechtliche Anforderungen bis hin zum
Naturschutzrecht reichen.
In der Aufnahme
- Besonders an öffentlich zugänglichen Orten (und wie hier noch dazu auf öffentlichem Grund!), müssen solche Warnhinweise gut sichtbar und in regelmäßigen Abständen angebracht sein. Auch dann wenn jagdliche Aspekte tangiert werden um landwirtschaftliche Flächen wie hier, die einer Person gehören und die hiervon allein partizipiert. Das Gemeinwohl geht auch hier in jedem Fall vor! Kennzeichnung? - Fehlanzeige! ... Professionalität sieht hier in useren Augen ganz anders aus ...
Artenschutz in Franken®
Der Eichelhäher (Garrulus glandarius)

Eichelhäher (Garrulus glandarius)
18/19.09.2024
Im April beginnt der bunte Vogel sein Moosnest zu errichten.Hier hinein legt er seine karikierten 7 eier ab und bebrütet diese 17 Tage. Nach etwa 20 Tagen verlassen die Junghäher das Nest leben jedoch noch mit den Altvögeln weiter zusammen.
Durch seine Nahrungsaufnahme, sowie der Ablage dergleichen finden Prozesse statt, die es Pflanzen ermöglichen innerhalb kurzer Zeit Standortvorteile aufzuschlüsseln und neue Areale zu erschließen.Durch diese Möglichkeiten gelingt es dem Eichelhäher bislang vielfach "unberührte" Sektionen mit seinem Lebensraum , der auch uns sehr wertvoll erscheint zu "überziehen".
18/19.09.2024
- Mit einer geschätzten Brutvogelpaardichte von rund 200.000 Brutpaaren, ist der Eichelhäher in Bayern noch regelmäßig anzutreffen. Allein der Name sagt schon viel über den bevorzugten Lebensraum aus.
Im April beginnt der bunte Vogel sein Moosnest zu errichten.Hier hinein legt er seine karikierten 7 eier ab und bebrütet diese 17 Tage. Nach etwa 20 Tagen verlassen die Junghäher das Nest leben jedoch noch mit den Altvögeln weiter zusammen.
Durch seine Nahrungsaufnahme, sowie der Ablage dergleichen finden Prozesse statt, die es Pflanzen ermöglichen innerhalb kurzer Zeit Standortvorteile aufzuschlüsseln und neue Areale zu erschließen.Durch diese Möglichkeiten gelingt es dem Eichelhäher bislang vielfach "unberührte" Sektionen mit seinem Lebensraum , der auch uns sehr wertvoll erscheint zu "überziehen".
Der Eichelhäher (Garrulus glandarius) ist ein mittelgroßer Vogel aus der Familie der Rabenvögel und spielt eine bedeutende Rolle in verschiedenen Ökosystemen.
Hier sind einige Aspekte seiner Bedeutung:
Verbreitung von Eicheln: Eichelhäher sind dafür bekannt, Eicheln zu sammeln und zu vergraben, um sie später als Nahrungsquelle zu nutzen. Einige dieser Eicheln werden jedoch vergessen oder nicht gefunden, und dadurch tragen Eichelhäher zur Verbreitung von Eichenbäumen bei. Dieser Vorgang unterstützt die ökologische Vielfalt, indem er neue Lebensräume für Pflanzen und Tiere schafft.
Beutegreifer Verhalten: Eichelhäher ernähren sich von einer Vielzahl von Nahrungskomponenten, einschließlich Insekten, Beeren und kleinen Wirbeltieren. Durch ihre Gewohnheiten helfen sie, das Gleichgewicht innerhalb der Nahrungsketten zu erhalten, indem sie die Populationen von bestimmten Beutetieren ganz natürlich kontrollieren.
Verhalten als Indikator: Das Verhalten von Eichelhähern kann auch als Indikator für Veränderungen in der Umwelt dienen. Zum Beispiel reagieren sie auf Störungen in ihrem Lebensraum, und ihre Anwesenheit oder Abwesenheit kann auf Umweltveränderungen oder ökologische Probleme hinweisen.
Die Jagd auf Eichelhäher kann jedoch negative Auswirkungen auf das Ökosystem haben, und es gibt mehrere Nachteile:
Störung des Gleichgewichts: Die Entnahme von Eichelhähern aus einem Ökosystem kann das natürliche Gleichgewicht stören. Wenn ihre Population stark abnimmt, kann dies zu einer Überpopulation bestimmter Beutetiere führen, was wiederum andere Arten beeinflussen kann.
Verminderte Samenverbreitung: Da Eichelhäher eine wichtige Rolle bei der Verbreitung von Samen spielen, kann die Jagd auf sie zu einer Verringerung der Samenverbreitung führen. Dies könnte Auswirkungen auf die Pflanzenvielfalt und die Wiederbewaldung haben.
Verlust der ökologischen Funktion: Eichelhäher tragen durch ihre Nahrungsgewohnheiten und das Sammeln von Eicheln zur ökologischen Vielfalt und zum Funktionieren des Ökosystems bei. Die Jagd auf sie könnte dazu führen, dass diese ökologischen Funktionen geschwächt oder gestört werden.
In vielen Regionen gibt es daher Gesetze und Vorschriften, die die Jagd auf bestimmte Vogelarten, einschließlich des Eichelhähers, regeln, um sicherzustellen, dass ihre ökologische Rolle und Funktion im Ökosystem erhalten bleibt.
In Bayern dürfen jedoch noch immer Eichelhäher geschossen werden, wie widersprüchlich denn zum einen wird ein naturnaher Waldumbau gefordert, zum anderen werden Tiere getötet die dazu beitragen diesen Umbau zu unterstützen.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
Hier sind einige Aspekte seiner Bedeutung:
Verbreitung von Eicheln: Eichelhäher sind dafür bekannt, Eicheln zu sammeln und zu vergraben, um sie später als Nahrungsquelle zu nutzen. Einige dieser Eicheln werden jedoch vergessen oder nicht gefunden, und dadurch tragen Eichelhäher zur Verbreitung von Eichenbäumen bei. Dieser Vorgang unterstützt die ökologische Vielfalt, indem er neue Lebensräume für Pflanzen und Tiere schafft.
Beutegreifer Verhalten: Eichelhäher ernähren sich von einer Vielzahl von Nahrungskomponenten, einschließlich Insekten, Beeren und kleinen Wirbeltieren. Durch ihre Gewohnheiten helfen sie, das Gleichgewicht innerhalb der Nahrungsketten zu erhalten, indem sie die Populationen von bestimmten Beutetieren ganz natürlich kontrollieren.
Verhalten als Indikator: Das Verhalten von Eichelhähern kann auch als Indikator für Veränderungen in der Umwelt dienen. Zum Beispiel reagieren sie auf Störungen in ihrem Lebensraum, und ihre Anwesenheit oder Abwesenheit kann auf Umweltveränderungen oder ökologische Probleme hinweisen.
Die Jagd auf Eichelhäher kann jedoch negative Auswirkungen auf das Ökosystem haben, und es gibt mehrere Nachteile:
Störung des Gleichgewichts: Die Entnahme von Eichelhähern aus einem Ökosystem kann das natürliche Gleichgewicht stören. Wenn ihre Population stark abnimmt, kann dies zu einer Überpopulation bestimmter Beutetiere führen, was wiederum andere Arten beeinflussen kann.
Verminderte Samenverbreitung: Da Eichelhäher eine wichtige Rolle bei der Verbreitung von Samen spielen, kann die Jagd auf sie zu einer Verringerung der Samenverbreitung führen. Dies könnte Auswirkungen auf die Pflanzenvielfalt und die Wiederbewaldung haben.
Verlust der ökologischen Funktion: Eichelhäher tragen durch ihre Nahrungsgewohnheiten und das Sammeln von Eicheln zur ökologischen Vielfalt und zum Funktionieren des Ökosystems bei. Die Jagd auf sie könnte dazu führen, dass diese ökologischen Funktionen geschwächt oder gestört werden.
In vielen Regionen gibt es daher Gesetze und Vorschriften, die die Jagd auf bestimmte Vogelarten, einschließlich des Eichelhähers, regeln, um sicherzustellen, dass ihre ökologische Rolle und Funktion im Ökosystem erhalten bleibt.
In Bayern dürfen jedoch noch immer Eichelhäher geschossen werden, wie widersprüchlich denn zum einen wird ein naturnaher Waldumbau gefordert, zum anderen werden Tiere getötet die dazu beitragen diesen Umbau zu unterstützen.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
- Eichelhäher (Garrulus glandarius) im Flug
Artenschutz in Franken®
Die Vierbindige Furchenbiene (Halictus quadricinctus)

Vierbindige Furchenbiene (Halictus quadricinctus)
17/18.09.2024
Ich gehöre zu den sogenannten Schweißbienen, weil meine Artgenossen gelegentlich Schweiß trinken, um an Salz zu gelangen. Doch ich werde euch nicht nur davon erzählen, sondern euch auch in mein komplexes Leben als sozialer Organismus einführen.
17/18.09.2024
- Als Vierbindige Furchenbiene, oder Halictus quadricinctus, bin ich eine der größeren Vertreterinnen meiner Familie, den Halictidae.
Ich gehöre zu den sogenannten Schweißbienen, weil meine Artgenossen gelegentlich Schweiß trinken, um an Salz zu gelangen. Doch ich werde euch nicht nur davon erzählen, sondern euch auch in mein komplexes Leben als sozialer Organismus einführen.
Aussehen und Merkmale: Mit meinen etwa 10–12 mm Länge falle ich sofort durch die vier hellen, cremefarbenen Querbinden auf meinem dunkelbraunen Hinterleib auf. Diese Bänderung dient als Erkennungsmerkmal meiner Art und hilft mir, mich von anderen Wildbienen zu unterscheiden. Mein Körper ist robust und kräftig gebaut, damit ich meine Umgebung effektiv erkunden und Nistplätze graben kann. Die feinen Härchen an meinen Beinen sind perfekt, um Pollen zu sammeln, was für die Ernährung meiner Nachkommen von zentraler Bedeutung ist.
Nistverhalten und Sozialstruktur: Anders als viele andere Bienen bin ich nicht immer solitär, sondern lebe in kleinen, primitiven sozialen Gruppen. Eine Besonderheit von mir ist, dass ich je nach Umweltbedingungen sowohl alleine als auch in Gruppen nisten kann. Meistens wähle ich sandige oder lehmige Böden aus, in denen ich tiefgründige Niströhren anlege. Innerhalb dieser Röhren entwickle ich separate Brutzellen, in denen ich Nektar und Pollen als Proviant für meine Larven einlagere. Manchmal übernehmen ältere Weibchen die Rolle einer Königin, während andere Weibchen als Arbeiterinnen fungieren und mir bei der Versorgung des Nachwuchses helfen.
Ernährung und Bestäubung: Ich bin eine polylektische Biene, das heißt, ich besuche viele verschiedene Pflanzenarten, um sowohl Nektar als auch Pollen zu sammeln. Dabei bevorzuge ich Blüten von Korbblütlern und Lippenblütlern. Meine Vorliebe für eine Vielzahl von Pflanzen macht mich zu einem wichtigen Bestäuber in meinem Ökosystem. Ohne mich würden viele Pflanzenarten nicht so effektiv bestäubt werden, was wiederum die Pflanzenvielfalt und die Nahrungsquellen für andere Tiere beeinträchtigen würde.
Flugzeit und Lebenszyklus: Meine Aktivität als vierbindige Furchenbiene beginnt im späten Frühjahr und erstreckt sich bis in den Hochsommer. In dieser Zeit arbeite ich unermüdlich daran, genug Pollen und Nektar zu sammeln, um den Nachwuchs zu versorgen. Nach der Paarung beginnt die Gründung neuer Nester, in denen ich die Eier ablege. Die Larven entwickeln sich über mehrere Wochen und schlüpfen dann als ausgewachsene Bienen.
Interaktion mit der Umwelt: Leider bin ich wie viele meiner Verwandten durch den Verlust meines Lebensraumes und den Einsatz von Pestiziden gefährdet. Monokulturen und die Zerstörung von Blühflächen schränken meine Nahrungsquellen ein und machen es mir schwer, geeignete Nistplätze zu finden. Glücklicherweise gibt es zunehmend Bemühungen, Blühstreifen und Insektenfreundliche Gärten zu schaffen, die mir und anderen Bestäubern helfen, zu überleben.
Insgesamt bin ich als Vierbindige Furchenbiene ein unverzichtbarer Teil meines Ökosystems und spiele eine entscheidende Rolle bei der Bestäubung vieler Pflanzenarten. Ich hoffe, dass Menschen mein komplexes Leben und meinen Wert erkennen und Maßnahmen ergreifen, um meine Umwelt zu schützen.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
Nistverhalten und Sozialstruktur: Anders als viele andere Bienen bin ich nicht immer solitär, sondern lebe in kleinen, primitiven sozialen Gruppen. Eine Besonderheit von mir ist, dass ich je nach Umweltbedingungen sowohl alleine als auch in Gruppen nisten kann. Meistens wähle ich sandige oder lehmige Böden aus, in denen ich tiefgründige Niströhren anlege. Innerhalb dieser Röhren entwickle ich separate Brutzellen, in denen ich Nektar und Pollen als Proviant für meine Larven einlagere. Manchmal übernehmen ältere Weibchen die Rolle einer Königin, während andere Weibchen als Arbeiterinnen fungieren und mir bei der Versorgung des Nachwuchses helfen.
Ernährung und Bestäubung: Ich bin eine polylektische Biene, das heißt, ich besuche viele verschiedene Pflanzenarten, um sowohl Nektar als auch Pollen zu sammeln. Dabei bevorzuge ich Blüten von Korbblütlern und Lippenblütlern. Meine Vorliebe für eine Vielzahl von Pflanzen macht mich zu einem wichtigen Bestäuber in meinem Ökosystem. Ohne mich würden viele Pflanzenarten nicht so effektiv bestäubt werden, was wiederum die Pflanzenvielfalt und die Nahrungsquellen für andere Tiere beeinträchtigen würde.
Flugzeit und Lebenszyklus: Meine Aktivität als vierbindige Furchenbiene beginnt im späten Frühjahr und erstreckt sich bis in den Hochsommer. In dieser Zeit arbeite ich unermüdlich daran, genug Pollen und Nektar zu sammeln, um den Nachwuchs zu versorgen. Nach der Paarung beginnt die Gründung neuer Nester, in denen ich die Eier ablege. Die Larven entwickeln sich über mehrere Wochen und schlüpfen dann als ausgewachsene Bienen.
Interaktion mit der Umwelt: Leider bin ich wie viele meiner Verwandten durch den Verlust meines Lebensraumes und den Einsatz von Pestiziden gefährdet. Monokulturen und die Zerstörung von Blühflächen schränken meine Nahrungsquellen ein und machen es mir schwer, geeignete Nistplätze zu finden. Glücklicherweise gibt es zunehmend Bemühungen, Blühstreifen und Insektenfreundliche Gärten zu schaffen, die mir und anderen Bestäubern helfen, zu überleben.
Insgesamt bin ich als Vierbindige Furchenbiene ein unverzichtbarer Teil meines Ökosystems und spiele eine entscheidende Rolle bei der Bestäubung vieler Pflanzenarten. Ich hoffe, dass Menschen mein komplexes Leben und meinen Wert erkennen und Maßnahmen ergreifen, um meine Umwelt zu schützen.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- Vierbindige Furchenbiene (Halictus quadricinctus) - Männchen
Artenschutz in Franken®
Fotovoltaik - Freiflächen aus Überlebensräume

Fotovoltaik - Freiflächen aus Überlebensräume
17/18.09.2024
Bayern. Seit geraumer Zeit haben wir unterschiedliche Freiflächenanlagen im Fokus und Monitoring, im Jahre 2024 haben wir nun damit begonnen einige dieser Flächen mit Nisthilfen auszustatten, um eine Lebensraumergänzung zu erreichen.
Keinesfalls muss eine Freiflächenphotovoltaikanlage ökologisch wertvoll sein. Es gibt Anlagen, die als Lebensraum für heimische Spezies kaum etwas hergeben, andere wiederum haben das Potenzial als hochwertiger Lebensraum zu fungieren.
17/18.09.2024
- Artenschutz in Franken® stattet Freiflächen mit Nisthilfen für Kleinvögel und Wildbienen aus.
Bayern. Seit geraumer Zeit haben wir unterschiedliche Freiflächenanlagen im Fokus und Monitoring, im Jahre 2024 haben wir nun damit begonnen einige dieser Flächen mit Nisthilfen auszustatten, um eine Lebensraumergänzung zu erreichen.
Keinesfalls muss eine Freiflächenphotovoltaikanlage ökologisch wertvoll sein. Es gibt Anlagen, die als Lebensraum für heimische Spezies kaum etwas hergeben, andere wiederum haben das Potenzial als hochwertiger Lebensraum zu fungieren.
Solche haben wir nun auserkoren, um deren bereits interessante Lebensraumstruktur weiter zu verbessern. Nisthilfen stellen eine solche Lebensraumverbesserung dar. Auf geschützter Fläche können nun Kleinvögel- und Wildbienen neben Nahrung auch Fortpflanzungsmöglichkeiten finden.
In einer mehr und mehr ausgeräumten Freiflur bieten gut gemachte und gut durchdachte Fotovoltaikanlagen einen wertvollen Überlebensraum für zunehmend im Bestand gefährdete Tier- und Pflanzenarten. Artenschutz in Franken® bringt sich gerne ein, diese Bereiche professionell zu optimieren.
In der Aufnahme
In einer mehr und mehr ausgeräumten Freiflur bieten gut gemachte und gut durchdachte Fotovoltaikanlagen einen wertvollen Überlebensraum für zunehmend im Bestand gefährdete Tier- und Pflanzenarten. Artenschutz in Franken® bringt sich gerne ein, diese Bereiche professionell zu optimieren.
In der Aufnahme
- Rund 60 Nisthilfen für Kleinvögel und Wildbienen wurden vor wenigen Tagen auf einigen Fotovoltaikanlagen installiert. Konkreter Artenschutz ... hier setzen wir vom Artenschutz in Franken® an ...
Artenschutz in Franken®
Die Marmorierte Baumwanze (Halyomorpha halys)

Marmorierte Baumwanze (Halyomorpha halys)
16/17.09.2024
Als Marmorierte Baumwanze selbst könnte ich folgendermaßen über mein Leben und meine Merkmale berichten:
16/17.09.2024
- Die Marmorierte Baumwanze, wissenschaftlich bekannt als Halyomorpha halys, ist eine mittelgroße Wanzenart, die oft wegen ihres auffälligen Aussehens und ihres Verhaltens bemerkt wird.
Als Marmorierte Baumwanze selbst könnte ich folgendermaßen über mein Leben und meine Merkmale berichten:
Lebensraum und Verbreitung: Ich bin eine invasive Art, die ursprünglich in Ostasien beheimatet war. In den letzten Jahrzehnten habe ich jedoch zahlreiche Regionen der Welt erobert, einschließlich Nordamerikas und Europas. Meine Fähigkeit, mich an verschiedene Umgebungen anzupassen, hat dazu beigetragen, dass ich mich schnell ausgebreitet habe.
Aussehen und Merkmale: Mein Körper ist etwa 1,5 cm lang und weist eine markante marmorierte Färbung auf, die aus dunkelbraunen und weißen Flecken besteht. Diese Marmorierung dient nicht nur als Tarnung vor Fressfeinden, sondern auch als thermoregulatorisches Merkmal, das mir hilft, meine Körpertemperatur zu regulieren.
Ernährung und ökologische Rolle: Als Pflanzenfresser ernähre ich mich hauptsächlich von einer Vielzahl von Nutzpflanzen, einschließlich Obstbäumen, Gemüse und Getreide. Mein Appetit und meine Fähigkeit, schnell große Populationen aufzubauen, haben mich zu einem bedeutenden Schädling gemacht, der landwirtschaftliche Erträge gefährden kann.
Verhaltensweisen und Fortpflanzung: Im Frühjahr und Sommer suche ich nach geeigneten Nahrungsquellen und parke mich dann zur Paarung. Die Weibchen legen ihre Eier auf der Unterseite von Blättern ab, und die Larven entwickeln sich durch mehrere Häutungen, bevor sie erwachsen werden. Meine Fähigkeit, große Entfernungen zu überwinden und mich schnell zu vermehren, trägt zur schnellen Ausbreitung meiner Population bei.
Interaktion mit der menschlichen Umgebung: Meine Präsenz in menschlichen Siedlungen führt oft zu Konflikten mit Landwirten und Hausbesitzern, da ich bedeutende Schäden an landwirtschaftlichen Kulturen verursachen kann. Der Einsatz von Pestiziden und anderen Bekämpfungsmaßnahmen kann zwar kurzfristig effektiv sein, aber langfristig werden Strategien zur integrierten Schädlingsbekämpfung bevorzugt, um sowohl ökologische als auch wirtschaftliche Auswirkungen zu minimieren.
Insgesamt bin ich als marmorierte Baumwanze eine bemerkenswerte Spezies, die aufgrund meiner Fähigkeit zur Anpassung und schnellen Vermehrung sowohl Interesse als auch Herausforderungen für Mensch und Umwelt darstellt.
In der Aufnahme von Albert Meier
Aussehen und Merkmale: Mein Körper ist etwa 1,5 cm lang und weist eine markante marmorierte Färbung auf, die aus dunkelbraunen und weißen Flecken besteht. Diese Marmorierung dient nicht nur als Tarnung vor Fressfeinden, sondern auch als thermoregulatorisches Merkmal, das mir hilft, meine Körpertemperatur zu regulieren.
Ernährung und ökologische Rolle: Als Pflanzenfresser ernähre ich mich hauptsächlich von einer Vielzahl von Nutzpflanzen, einschließlich Obstbäumen, Gemüse und Getreide. Mein Appetit und meine Fähigkeit, schnell große Populationen aufzubauen, haben mich zu einem bedeutenden Schädling gemacht, der landwirtschaftliche Erträge gefährden kann.
Verhaltensweisen und Fortpflanzung: Im Frühjahr und Sommer suche ich nach geeigneten Nahrungsquellen und parke mich dann zur Paarung. Die Weibchen legen ihre Eier auf der Unterseite von Blättern ab, und die Larven entwickeln sich durch mehrere Häutungen, bevor sie erwachsen werden. Meine Fähigkeit, große Entfernungen zu überwinden und mich schnell zu vermehren, trägt zur schnellen Ausbreitung meiner Population bei.
Interaktion mit der menschlichen Umgebung: Meine Präsenz in menschlichen Siedlungen führt oft zu Konflikten mit Landwirten und Hausbesitzern, da ich bedeutende Schäden an landwirtschaftlichen Kulturen verursachen kann. Der Einsatz von Pestiziden und anderen Bekämpfungsmaßnahmen kann zwar kurzfristig effektiv sein, aber langfristig werden Strategien zur integrierten Schädlingsbekämpfung bevorzugt, um sowohl ökologische als auch wirtschaftliche Auswirkungen zu minimieren.
Insgesamt bin ich als marmorierte Baumwanze eine bemerkenswerte Spezies, die aufgrund meiner Fähigkeit zur Anpassung und schnellen Vermehrung sowohl Interesse als auch Herausforderungen für Mensch und Umwelt darstellt.
In der Aufnahme von Albert Meier
- persönlicher Erstnachweis am 15.09.2024 - Die Marmorierte Baumwanze
Artenschutz in Franken®
Überlebensräume für Zauneidechse & Co.

Überlebensräume für Zauneidechse & Co.
16/17.09.2024
Bayern. Mit der Neuanlage entsprechender Lebensraumkulissen bemühen wir uns einer möglichst breiten Artenvielfalt die benötigten Strukturen vorzuhalten, um in einer zunehmend vom Menschen geprägten und übernutzen Umwelt überdauern zu können.
Viele Tier- und Pflanzenarten leben bereits viele Millionen Jahre auf diesem Planeten. Der Spezies Mensch ist es nun tatsächlich gelungen diesen Lebensformen den Todesstoß zu versetzen indem sie entweder die Arten direkt oder deren Lebensräume eliminiert.
16/17.09.2024
- Installation der Informationseinheiten
Bayern. Mit der Neuanlage entsprechender Lebensraumkulissen bemühen wir uns einer möglichst breiten Artenvielfalt die benötigten Strukturen vorzuhalten, um in einer zunehmend vom Menschen geprägten und übernutzen Umwelt überdauern zu können.
Viele Tier- und Pflanzenarten leben bereits viele Millionen Jahre auf diesem Planeten. Der Spezies Mensch ist es nun tatsächlich gelungen diesen Lebensformen den Todesstoß zu versetzen indem sie entweder die Arten direkt oder deren Lebensräume eliminiert.
Der uns nachfolgenden Generation hinterlassen wir, wenn wir noch wenige Jahre so weitermachen wie bisher einen ausgeräumten und lebensfeindlichen Planeten. Der Ansatz zum Klimaschutz darf nicht zulasten der Biodiversität gehen, denn nur wenn beides stimmt, Klima und Artenvielfalt, können wir davon sprechend das es uns gelungen ist, den Planeten Erde für unsere Kinder und Enkelkinder zu erhalten.
In Zusammenarbeit mit dem Betreiber einer Freiflächenfotovoltaikanlage konnten wir in 2024 spezielle Überlebensbereiche für die Leitart Zauneidechse gestalten.
In der Aufnahme
In Zusammenarbeit mit dem Betreiber einer Freiflächenfotovoltaikanlage konnten wir in 2024 spezielle Überlebensbereiche für die Leitart Zauneidechse gestalten.
In der Aufnahme
- Am 12.09.2024 wurde mit der Einbringung der Informationseinheiten begonnen.
Artenschutz in Franken®
Sich zu früh begeistert gezeigt ...
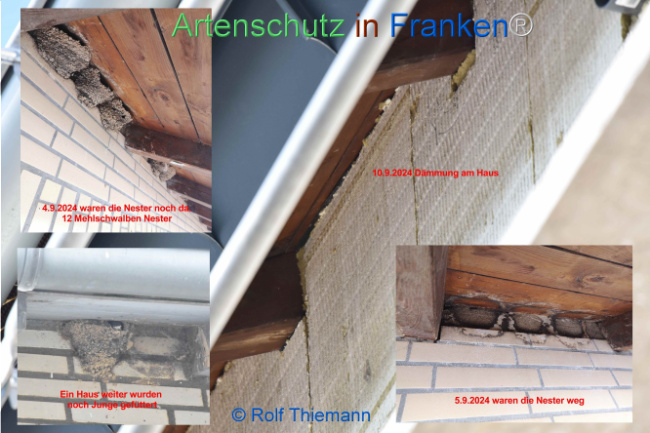
Betrifft: Bausanierung / Mehlschwalben Nester am Haus.
15/16.09.2024
Vor ein paar Tagen haben wir das Vorgehen der Baufirma beim Hausdämmen noch gelobt!
Das Haus, an welchem die Mehlschwalben genistet und ihre Jungen aufgezogen haben wurde mit einer Außendämmung verkleidet. Im Vorfeld hatte der verantwortliche Bauträger eine Befreiung bei der Naturschutzbehörde beantragt. Die Befreiung galt ab 1. Oktober 2024 und es wurden Ausgleichsmaßnahmen (1 zu 1) gefordert.
Das heißt, ab 1. Oktober durften die Nester entfernt werden (wenn nicht besetzt). Leider wurden durch sogenannte Subunternehmer die 12 Nester schon Anfang September zerstört. Was uns sehr ärgert, ist das niemand vorher da nachschauen war, ob die Nistplätze noch beflogen wurden.
15/16.09.2024
Vor ein paar Tagen haben wir das Vorgehen der Baufirma beim Hausdämmen noch gelobt!
- Jetzt ist die Sache eine Schande für jede Bausanierungsfirma!
Das Haus, an welchem die Mehlschwalben genistet und ihre Jungen aufgezogen haben wurde mit einer Außendämmung verkleidet. Im Vorfeld hatte der verantwortliche Bauträger eine Befreiung bei der Naturschutzbehörde beantragt. Die Befreiung galt ab 1. Oktober 2024 und es wurden Ausgleichsmaßnahmen (1 zu 1) gefordert.
Das heißt, ab 1. Oktober durften die Nester entfernt werden (wenn nicht besetzt). Leider wurden durch sogenannte Subunternehmer die 12 Nester schon Anfang September zerstört. Was uns sehr ärgert, ist das niemand vorher da nachschauen war, ob die Nistplätze noch beflogen wurden.
- Es wurde keine artenschutzrechtliche Kontrolle vorgenommen.
Da ein Haus weiter noch zwei Nester beflogen und Junge gefüttert werden, ist davon auszugehen das in den 12 entfernten Nestern (in einem oder mehreren) noch Junge gefüttert wurden.Nachweisen lässt sich das nicht mehr, da alle Nester und Reste nicht mehr auffindbar sind. Anzumerken ist auch das auf der Baustelle 4 Firmen gleichzeitig arbeiten und kein Bauleiter weder Namen noch Telefonnummer vorhanden war.So was darf nicht passieren!
- Die zuständige Behörde wurde von uns informiert!
Bei einem Bauvorhaben, wie beispielsweise einer energetischen Sanierung, ist grundsätzlich vorab zu prüfen, ob dadurch geschützte Tierarten betroffen sein könnten. Rechtliche Grundlage hierfür ist § 44 Abs. 1 BNatSchG. Bei Bauvorhaben an bestehenden Gebäuden ist demnach von den Bauherren sicher zu stellen, dass keine Individuen geschützter Arten verletzt oder getötet werden und dass für die Arten auch nach Fertigstellung des Vorhabens Lebensräume in gleicher Quantität und Qualität wie vorher zur Verfügung stehen. Dies kann durch sogenannte CEF-Maßnahmen und FCS-Maßnahmen umgesetzt werden.
Quelle und Aufnahmen
Rolf Thiemann
...................................................................................................................................
Gewässer und Naturschutz im Erftkreis
Flora-Fauna-Artenschutz
Naturschutzökologie
Rolf Thiemann
Naturschutzberater
Eisvogelweg 1
50181 Bedburg
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung.Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Artenschutz in Franken®
Artenschutzmaßnahme Kirchendohle & Co.

Artenschutzmaßnahme Kirchendohle & Co.
14/15.09.2024
Rattelsdorf / Bayern. Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutzes in Franken®, der Pfarrei St. Peter und Paul Rattelsdorf und Turmstationen Deutschland e.V., das von der Deutschen Postcode Lotterie sowie von den Fachbehörden des Naturschutzes und des Denkmalschutzes unterstützt wird.
14/15.09.2024
- Installation der Dohlennisthilfen ist erfolgt
Rattelsdorf / Bayern. Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutzes in Franken®, der Pfarrei St. Peter und Paul Rattelsdorf und Turmstationen Deutschland e.V., das von der Deutschen Postcode Lotterie sowie von den Fachbehörden des Naturschutzes und des Denkmalschutzes unterstützt wird.
Die Dohle (Corvus monedula) ist in Bayern aktuell im Bestand bedroht, hauptsächlich aufgrund von Lebensraumverlust und Nistplatzmangel. Diese Vögel nisten bevorzugt in alten Gebäuden oder Baumhöhlen, die durch moderne Bauweisen und Renovierungen seltener geworden sind.
Zusätzlich verschwinden ihre natürlichen Lebensräume wie offene Wiesen und Weiden, da diese Flächen oft landwirtschaftlich intensiv genutzt oder bebaut werden. Der Einsatz von Pestiziden reduziert zudem das Nahrungsangebot der Dohlen, da Insekten und andere Kleintiere, die sie fressen, weniger verfügbar sind. Diese Faktoren führen zusammen zu einem Rückgang der Population.
Mit diesem Kooperationsprojekt möchten wir den kleinen Rabenvögel hier in Rattelsdorf eine nachhaltige Übelebensperspektive bieten
In der Aufnahme
Zusätzlich verschwinden ihre natürlichen Lebensräume wie offene Wiesen und Weiden, da diese Flächen oft landwirtschaftlich intensiv genutzt oder bebaut werden. Der Einsatz von Pestiziden reduziert zudem das Nahrungsangebot der Dohlen, da Insekten und andere Kleintiere, die sie fressen, weniger verfügbar sind. Diese Faktoren führen zusammen zu einem Rückgang der Population.
Mit diesem Kooperationsprojekt möchten wir den kleinen Rabenvögel hier in Rattelsdorf eine nachhaltige Übelebensperspektive bieten
In der Aufnahme
- vor wenigen Tagen wurden die alten Nisthilfen de- und die neuen Nisthilfen montiert.
Artenschutz in Franken®
Libelloides baeticus - Schmetterlingshaft

Libelloides baeticus
13/14.09.2024
Lasst mich euch aus meiner Perspektive berichten, wie ich lebe, welche Eigenschaften mich auszeichnen und welche Rolle ich im Ökosystem spiele!
13/14.09.2024
- Hallo, ich bin Libelloides baeticus, ein stolzes Mitglied der Familie der Schmetterlingshafte (Ascalaphidae) und ein einzigartiger Netzflügler, der in den warmen, trockenen Landschaften des Mittelmeerraums beheimatet ist.
Lasst mich euch aus meiner Perspektive berichten, wie ich lebe, welche Eigenschaften mich auszeichnen und welche Rolle ich im Ökosystem spiele!
Mein Lebensraum und Verbreitung
Ich liebe es, in den warmen und trockenen Regionen Südeuropas, insbesondere auf der Iberischen Halbinsel, zu leben. Ihr werdet mich vor allem in Spanien und Portugal antreffen, wobei ich die offenen, sonnigen und steppenartigen Lebensräume bevorzuge. Diese Orte bieten mir nicht nur viel Sonnenlicht, das ich brauche, um meine Flügel aufzuwärmen, sondern auch viele Insekten als Beute.
Meine bevorzugten Habitate bestehen aus Trockenrasen, lichten Wäldern und felsigen Hängen, die nur selten durch menschliche Aktivitäten gestört werden. Obwohl ich wärmeliebend bin, meide ich die extremen Wüsten. Stattdessen suche ich Gebiete mit vielfältiger Vegetation, in denen ich mich zwischen den Pflanzen und Felsen bewegen und meine Jagd nach Insekten ausüben kann.
Mein Aussehen und Morphologie
Was mich sofort auffällig macht, sind meine farbenprächtigen Flügel. Sie sind breit und durchscheinend, mit einem schönen gelb-schwarzen Muster. Die Flügelspannweite beträgt ungefähr 5 bis 6 Zentimeter. Man könnte mich fast mit einem Schmetterling verwechseln – daher auch mein Name „Schmetterlingshaft“. Aber meine Flugkünste und mein Körperbau unterscheiden mich deutlich von den Schmetterlingen, die nur Nektar sammeln. Ich bin ein Raubtier.
Meine langen, fadenförmigen Antennen sind sehr charakteristisch. An ihrem Ende befindet sich ein verdicktes Knötchen, das mir hilft, mich in meiner Umgebung zu orientieren und Vibrationen in der Luft zu spüren. Diese sensorischen Fähigkeiten sind für mich entscheidend, um Beute in meiner Nähe zu erkennen. Mein schlanker, aber kräftiger Körper und meine starken Beine unterstützen mich bei der Jagd und im Flug. Ich bin schnell, präzise und sehr wendig.
Mein Verhalten und meine Jagd
Als geschickter Flieger verbringe ich viel Zeit in der Luft, um nach Beute Ausschau zu halten. Meine bevorzugten Opfer sind kleine fliegende Insekten wie Mücken, Fliegen oder Blattläuse. Dank meiner scharfen Augen und der Fähigkeit, schnell zu reagieren, bin ich ein effektiver Jäger. Wenn ich eine Beute erspähe, stürze ich mich blitzschnell auf sie, packe sie mit meinen kräftigen Mandibeln und verspeise sie oft schon im Flug. Diese Technik verleiht mir eine beeindruckende Erfolgsquote bei der Jagd.
Während ich fliege, liebe ich es, die thermischen Aufwinde zu nutzen, um mühelos durch die Luft zu gleiten. Das spart Energie und erlaubt mir, weite Flächen zu überblicken, um potenzielle Beute zu erspähen.
Mein Lebenszyklus und Fortpflanzung
Mein Leben beginnt als Ei, das ich auf Pflanzen oder am Boden ablege. Nach kurzer Zeit schlüpfe ich als Larve, und hier nimmt mein Leben eine völlig andere Wendung. Im Gegensatz zu meinem späteren, luftigen Erwachsenenstadium, verbringe ich meine Larvenzeit am Boden oder in der Vegetation. Als Larve bin ich ein Lauerjäger: ich bin mit kräftigen Kiefern ausgestattet, die es mir ermöglichen, kleine Insekten, die sich meinem Versteck nähern, zu fangen.
Die Larvenphase kann eine ganze Weile andauern, manchmal bis zu einem Jahr oder länger, abhängig von den Umweltbedingungen. Schließlich verpuppe ich mich und durchlaufe eine Metamorphose, bis ich als erwachsener Schmetterlingshaft schlüpfe und flugfähig bin. Das ist für mich der Zeitpunkt, an dem ich aktiv werde, mich paare und selbst zur Fortpflanzung beitrage.
Ökologische Bedeutung und Bedrohungen
Als effektiver Räuber trage ich zur Regulierung der Insektenpopulationen in meinem Lebensraum bei. Ich helfe, Schädlinge in Schach zu halten, die sonst die Vegetation schädigen könnten. Meine Rolle im Ökosystem ist daher nicht nur die eines Jägers, sondern auch die eines Gleichgewichtsbringers.
Doch leider sind auch meine Lebensräume bedroht. Die Zerstörung von Trockenrasen, die Intensivierung der Landwirtschaft und der Verlust natürlicher Vegetation setzen mir und meinen Artgenossen stark zu. Der Klimawandel, der mein heißes Habitat zusätzlich beeinträchtigt, könnte ebenfalls meine Verbreitung und mein Überleben gefährden. In vielen Teilen meines Verbreitungsgebiets gelten wir bereits als gefährdet, da die geeigneten Lebensräume schrumpfen.
Schutzmaßnahmen
Der Schutz meiner Lebensräume ist von größter Bedeutung, damit ich weiterhin als Libelloides baeticus durch die Lüfte gleiten kann. Die Erhaltung von Trockenrasen, der Verzicht auf intensive Landwirtschaft in sensiblen Gebieten und die Förderung naturnaher Landschaftspflege sind essenziell. Wenn wir es schaffen, diese Lebensräume zu bewahren, können auch meine Nachkommen weiterhin durch die warmen Lüfte der Mittelmeerregion fliegen.
Fazit
Ich, Libelloides baeticus, bin nicht nur ein faszinierendes Insekt mit einer beeindruckenden Jagdtechnik und auffälligen Flügeln, sondern auch ein wichtiger Bestandteil meines Ökosystems. Mein Überleben hängt eng mit dem Schutz meiner Lebensräume zusammen. Die Artenvielfalt und das ökologische Gleichgewicht, das ich mit meiner Jagd unterstütze, sind entscheidend für die Gesundheit der Natur in meiner Heimat.
Aufnahme von Helga Zinnecker
Ich liebe es, in den warmen und trockenen Regionen Südeuropas, insbesondere auf der Iberischen Halbinsel, zu leben. Ihr werdet mich vor allem in Spanien und Portugal antreffen, wobei ich die offenen, sonnigen und steppenartigen Lebensräume bevorzuge. Diese Orte bieten mir nicht nur viel Sonnenlicht, das ich brauche, um meine Flügel aufzuwärmen, sondern auch viele Insekten als Beute.
Meine bevorzugten Habitate bestehen aus Trockenrasen, lichten Wäldern und felsigen Hängen, die nur selten durch menschliche Aktivitäten gestört werden. Obwohl ich wärmeliebend bin, meide ich die extremen Wüsten. Stattdessen suche ich Gebiete mit vielfältiger Vegetation, in denen ich mich zwischen den Pflanzen und Felsen bewegen und meine Jagd nach Insekten ausüben kann.
Mein Aussehen und Morphologie
Was mich sofort auffällig macht, sind meine farbenprächtigen Flügel. Sie sind breit und durchscheinend, mit einem schönen gelb-schwarzen Muster. Die Flügelspannweite beträgt ungefähr 5 bis 6 Zentimeter. Man könnte mich fast mit einem Schmetterling verwechseln – daher auch mein Name „Schmetterlingshaft“. Aber meine Flugkünste und mein Körperbau unterscheiden mich deutlich von den Schmetterlingen, die nur Nektar sammeln. Ich bin ein Raubtier.
Meine langen, fadenförmigen Antennen sind sehr charakteristisch. An ihrem Ende befindet sich ein verdicktes Knötchen, das mir hilft, mich in meiner Umgebung zu orientieren und Vibrationen in der Luft zu spüren. Diese sensorischen Fähigkeiten sind für mich entscheidend, um Beute in meiner Nähe zu erkennen. Mein schlanker, aber kräftiger Körper und meine starken Beine unterstützen mich bei der Jagd und im Flug. Ich bin schnell, präzise und sehr wendig.
Mein Verhalten und meine Jagd
Als geschickter Flieger verbringe ich viel Zeit in der Luft, um nach Beute Ausschau zu halten. Meine bevorzugten Opfer sind kleine fliegende Insekten wie Mücken, Fliegen oder Blattläuse. Dank meiner scharfen Augen und der Fähigkeit, schnell zu reagieren, bin ich ein effektiver Jäger. Wenn ich eine Beute erspähe, stürze ich mich blitzschnell auf sie, packe sie mit meinen kräftigen Mandibeln und verspeise sie oft schon im Flug. Diese Technik verleiht mir eine beeindruckende Erfolgsquote bei der Jagd.
Während ich fliege, liebe ich es, die thermischen Aufwinde zu nutzen, um mühelos durch die Luft zu gleiten. Das spart Energie und erlaubt mir, weite Flächen zu überblicken, um potenzielle Beute zu erspähen.
Mein Lebenszyklus und Fortpflanzung
Mein Leben beginnt als Ei, das ich auf Pflanzen oder am Boden ablege. Nach kurzer Zeit schlüpfe ich als Larve, und hier nimmt mein Leben eine völlig andere Wendung. Im Gegensatz zu meinem späteren, luftigen Erwachsenenstadium, verbringe ich meine Larvenzeit am Boden oder in der Vegetation. Als Larve bin ich ein Lauerjäger: ich bin mit kräftigen Kiefern ausgestattet, die es mir ermöglichen, kleine Insekten, die sich meinem Versteck nähern, zu fangen.
Die Larvenphase kann eine ganze Weile andauern, manchmal bis zu einem Jahr oder länger, abhängig von den Umweltbedingungen. Schließlich verpuppe ich mich und durchlaufe eine Metamorphose, bis ich als erwachsener Schmetterlingshaft schlüpfe und flugfähig bin. Das ist für mich der Zeitpunkt, an dem ich aktiv werde, mich paare und selbst zur Fortpflanzung beitrage.
Ökologische Bedeutung und Bedrohungen
Als effektiver Räuber trage ich zur Regulierung der Insektenpopulationen in meinem Lebensraum bei. Ich helfe, Schädlinge in Schach zu halten, die sonst die Vegetation schädigen könnten. Meine Rolle im Ökosystem ist daher nicht nur die eines Jägers, sondern auch die eines Gleichgewichtsbringers.
Doch leider sind auch meine Lebensräume bedroht. Die Zerstörung von Trockenrasen, die Intensivierung der Landwirtschaft und der Verlust natürlicher Vegetation setzen mir und meinen Artgenossen stark zu. Der Klimawandel, der mein heißes Habitat zusätzlich beeinträchtigt, könnte ebenfalls meine Verbreitung und mein Überleben gefährden. In vielen Teilen meines Verbreitungsgebiets gelten wir bereits als gefährdet, da die geeigneten Lebensräume schrumpfen.
Schutzmaßnahmen
Der Schutz meiner Lebensräume ist von größter Bedeutung, damit ich weiterhin als Libelloides baeticus durch die Lüfte gleiten kann. Die Erhaltung von Trockenrasen, der Verzicht auf intensive Landwirtschaft in sensiblen Gebieten und die Förderung naturnaher Landschaftspflege sind essenziell. Wenn wir es schaffen, diese Lebensräume zu bewahren, können auch meine Nachkommen weiterhin durch die warmen Lüfte der Mittelmeerregion fliegen.
Fazit
Ich, Libelloides baeticus, bin nicht nur ein faszinierendes Insekt mit einer beeindruckenden Jagdtechnik und auffälligen Flügeln, sondern auch ein wichtiger Bestandteil meines Ökosystems. Mein Überleben hängt eng mit dem Schutz meiner Lebensräume zusammen. Die Artenvielfalt und das ökologische Gleichgewicht, das ich mit meiner Jagd unterstütze, sind entscheidend für die Gesundheit der Natur in meiner Heimat.
Aufnahme von Helga Zinnecker
- Libelloides baeticus
Artenschutz in Franken®
Der Östliche Schmetterlingshaft (Libelloides macaronius)

Östlicher Schmetterlingshaft
12/130.9.2024
Als Insekt gehöre ich zur Familie der Netzflügler (Neuroptera), genauer gesagt zur Familie der Schmetterlingshafte (Ascalaphidae). Lasst mich euch in meine Welt entführen und euch aus meiner Sicht schildern, wie ich lebe und welche Besonderheiten ich aufweise!
12/130.9.2024
- Hallo, ich bin der Östliche Schmetterlingshaft (Libelloides macaronius), ein faszinierender Bewohner der sonnigen, offenen Landschaften Europas und Asiens.
Als Insekt gehöre ich zur Familie der Netzflügler (Neuroptera), genauer gesagt zur Familie der Schmetterlingshafte (Ascalaphidae). Lasst mich euch in meine Welt entführen und euch aus meiner Sicht schildern, wie ich lebe und welche Besonderheiten ich aufweise!
Mein Lebensraum und Verbreitung
Ich bevorzuge trockene, sonnige Habitate mit viel Vegetation, wie steppenartige Wiesen, Halbtrockenrasen oder lichte Wälder. Diese offenen Lebensräume sind optimal, da ich gerne in der Sonne fliege und mich auf wärmeliebende Pflanzen niederlasse. In Europa findet ihr mich hauptsächlich in den östlichen Regionen, etwa in den Karpaten oder auf den Balkan-Halbinseln. In Asien reiche ich bis nach Anatolien und weiter. Meine Verbreitung ist jedoch eng mit geeigneten klimatischen und ökologischen Bedingungen verknüpft, weshalb ich in kühl-feuchten Regionen nicht anzutreffen bin.
Mein Aussehen und Morphologie
Was mich wohl am meisten von anderen Insekten unterscheidet, sind meine durchsichtigen, breiten Flügel, die in ihrer Form und Musterung an Schmetterlinge erinnern – daher mein Name! Die Flügelspannweite beträgt etwa 4–5 Zentimeter, und sie zeigen ein kontrastreiches Muster aus schwarzen, gelben und transparenten Bereichen. Dieses auffällige Aussehen dient nicht nur der Tarnung, sondern auch als Warnsignal für Fressfeinde.
Mein Körperbau ist schlank, und ich habe lange, fadenförmige Antennen mit einem verdickten Ende, die mir bei der Orientierung und dem Aufspüren von Beute helfen. Im Gegensatz zu Schmetterlingen, deren Lebensweise ich oberflächlich ähnle, habe ich kräftige Beine und bin ein äußerst effizienter Jäger.
Mein Verhalten und meine Jagdmethoden
Ich bin ein schneller, wendiger Flieger und verbringe viel Zeit in der Luft, wo ich aktiv nach Nahrung suche. Meine bevorzugte Beute sind kleine fliegende Insekten, die ich mit meiner Fähigkeit, scharf zu sehen und schnell zu reagieren, erbeute. Ich fliege mit hoher Präzision und kann Insekten in der Luft jagen, ähnlich wie eine Libelle. Wenn ich eine Beute erspähe, stürze ich mich auf sie, packe sie mit meinen kräftigen Mandibeln und verzehre sie direkt. Diese Jagdmethoden gehören zu meinen größten Stärken.
Meine Entwicklung und mein Lebenszyklus
Mein Leben beginnt als Ei, das von meiner Mutter in der Nähe von Vegetation oder am Boden abgelegt wird. Aus dem Ei schlüpfe ich als Larve, und hier wird es spannend: Meine Larvenphase unterscheidet sich stark von meinem erwachsenen Stadium. Als Larve verbringe ich viel Zeit im Boden oder in der Streuschicht und bin dort ein geduldiger Lauerjäger. Meine Larvenform ist unscheinbar und robust, mit kräftigen Kiefern zum Beutefang. Diese Phase kann mehrere Monate andauern, manchmal sogar bis zu zwei Jahre, abhängig von den klimatischen Bedingungen.
Nachdem ich genug Nahrung zu mir genommen und mich ausreichend entwickelt habe, verpuppe ich mich und gehe in die Metamorphose über, um als ausgewachsenes Insekt zu erscheinen. Diese Wandlung ist bemerkenswert und führt zu meiner endgültigen Gestalt, die so anders ist als die meines Larvenstadiums.
Ökologische Bedeutung und Schutzstatus
Als Räuber spiele ich eine wichtige Rolle im Ökosystem, indem ich die Population kleinerer Insekten in Balance halte. Durch mein Jagdverhalten trage ich zur biologischen Kontrolle von Insekten bei, die potenziell schädlich für die Vegetation sein könnten. Mein Bestand ist jedoch in vielen Regionen rückläufig, da ich auf spezifische Habitate angewiesen bin, die durch landwirtschaftliche Nutzung und Urbanisierung bedroht sind. Durch den Verlust von Trockenwiesen und die Fragmentierung meiner Lebensräume finde ich immer weniger geeignete Plätze zum Leben und Jagen.
Mein Schutzstatus variiert je nach Region, aber in vielen Gebieten stehe ich unter Schutz oder werde als gefährdet eingestuft. In der EU zum Beispiel bin ich in einigen Ländern auf nationalen Roten Listen geführt. Der Erhalt meiner Lebensräume, insbesondere der trockenen Wiesen und offenen Landschaften, ist entscheidend für mein Überleben. Pflegeprogramme für solche Biotope und eine naturnahe Landnutzung sind von zentraler Bedeutung, damit ich und meine Artgenossen weiterhin überleben können.
Fazit
Als Östlicher Schmetterlingshaft bin ich ein einzigartiger und spezialisierter Netzflügler, der durch seine Jagdfähigkeiten, seine Rolle im Ökosystem und seine Anpassungen an steppenartige Lebensräume heraussticht. Mein Überleben hängt von der Erhaltung dieser spezifischen Habitate ab, und ich hoffe, dass ihr mein schönes, komplexes Leben in der Luft und auf der Erde nun ein wenig besser versteht.
In der Aufnahme von Helga Zinnecker
Ich bevorzuge trockene, sonnige Habitate mit viel Vegetation, wie steppenartige Wiesen, Halbtrockenrasen oder lichte Wälder. Diese offenen Lebensräume sind optimal, da ich gerne in der Sonne fliege und mich auf wärmeliebende Pflanzen niederlasse. In Europa findet ihr mich hauptsächlich in den östlichen Regionen, etwa in den Karpaten oder auf den Balkan-Halbinseln. In Asien reiche ich bis nach Anatolien und weiter. Meine Verbreitung ist jedoch eng mit geeigneten klimatischen und ökologischen Bedingungen verknüpft, weshalb ich in kühl-feuchten Regionen nicht anzutreffen bin.
Mein Aussehen und Morphologie
Was mich wohl am meisten von anderen Insekten unterscheidet, sind meine durchsichtigen, breiten Flügel, die in ihrer Form und Musterung an Schmetterlinge erinnern – daher mein Name! Die Flügelspannweite beträgt etwa 4–5 Zentimeter, und sie zeigen ein kontrastreiches Muster aus schwarzen, gelben und transparenten Bereichen. Dieses auffällige Aussehen dient nicht nur der Tarnung, sondern auch als Warnsignal für Fressfeinde.
Mein Körperbau ist schlank, und ich habe lange, fadenförmige Antennen mit einem verdickten Ende, die mir bei der Orientierung und dem Aufspüren von Beute helfen. Im Gegensatz zu Schmetterlingen, deren Lebensweise ich oberflächlich ähnle, habe ich kräftige Beine und bin ein äußerst effizienter Jäger.
Mein Verhalten und meine Jagdmethoden
Ich bin ein schneller, wendiger Flieger und verbringe viel Zeit in der Luft, wo ich aktiv nach Nahrung suche. Meine bevorzugte Beute sind kleine fliegende Insekten, die ich mit meiner Fähigkeit, scharf zu sehen und schnell zu reagieren, erbeute. Ich fliege mit hoher Präzision und kann Insekten in der Luft jagen, ähnlich wie eine Libelle. Wenn ich eine Beute erspähe, stürze ich mich auf sie, packe sie mit meinen kräftigen Mandibeln und verzehre sie direkt. Diese Jagdmethoden gehören zu meinen größten Stärken.
Meine Entwicklung und mein Lebenszyklus
Mein Leben beginnt als Ei, das von meiner Mutter in der Nähe von Vegetation oder am Boden abgelegt wird. Aus dem Ei schlüpfe ich als Larve, und hier wird es spannend: Meine Larvenphase unterscheidet sich stark von meinem erwachsenen Stadium. Als Larve verbringe ich viel Zeit im Boden oder in der Streuschicht und bin dort ein geduldiger Lauerjäger. Meine Larvenform ist unscheinbar und robust, mit kräftigen Kiefern zum Beutefang. Diese Phase kann mehrere Monate andauern, manchmal sogar bis zu zwei Jahre, abhängig von den klimatischen Bedingungen.
Nachdem ich genug Nahrung zu mir genommen und mich ausreichend entwickelt habe, verpuppe ich mich und gehe in die Metamorphose über, um als ausgewachsenes Insekt zu erscheinen. Diese Wandlung ist bemerkenswert und führt zu meiner endgültigen Gestalt, die so anders ist als die meines Larvenstadiums.
Ökologische Bedeutung und Schutzstatus
Als Räuber spiele ich eine wichtige Rolle im Ökosystem, indem ich die Population kleinerer Insekten in Balance halte. Durch mein Jagdverhalten trage ich zur biologischen Kontrolle von Insekten bei, die potenziell schädlich für die Vegetation sein könnten. Mein Bestand ist jedoch in vielen Regionen rückläufig, da ich auf spezifische Habitate angewiesen bin, die durch landwirtschaftliche Nutzung und Urbanisierung bedroht sind. Durch den Verlust von Trockenwiesen und die Fragmentierung meiner Lebensräume finde ich immer weniger geeignete Plätze zum Leben und Jagen.
Mein Schutzstatus variiert je nach Region, aber in vielen Gebieten stehe ich unter Schutz oder werde als gefährdet eingestuft. In der EU zum Beispiel bin ich in einigen Ländern auf nationalen Roten Listen geführt. Der Erhalt meiner Lebensräume, insbesondere der trockenen Wiesen und offenen Landschaften, ist entscheidend für mein Überleben. Pflegeprogramme für solche Biotope und eine naturnahe Landnutzung sind von zentraler Bedeutung, damit ich und meine Artgenossen weiterhin überleben können.
Fazit
Als Östlicher Schmetterlingshaft bin ich ein einzigartiger und spezialisierter Netzflügler, der durch seine Jagdfähigkeiten, seine Rolle im Ökosystem und seine Anpassungen an steppenartige Lebensräume heraussticht. Mein Überleben hängt von der Erhaltung dieser spezifischen Habitate ab, und ich hoffe, dass ihr mein schönes, komplexes Leben in der Luft und auf der Erde nun ein wenig besser versteht.
In der Aufnahme von Helga Zinnecker
- Östlicher Schmetterlingshaft (Libelloides macaronius)
Artenschutz in Franken®
Die Moorente (Aythya nyroca)

Moorente (Aythya nyroca)
11/12.09.2024
Mit meinem kastanienbraunen Gefieder, meinen weißen Augen und meinem kontrastierenden weißen Bauch bin ich relativ klein, aber unverkennbar. Ich gehöre zur Familie der Entenvögel und bewohne hauptsächlich Süßwassergebiete, besonders in Moorlandschaften, Schilfgürteln und flachen Seen.
11/12.09.2024
- Ich bin die Moorente (Aythya nyroca) – ein Vogel, der oft in ruhigen, flachen Gewässern zu finden ist.
Mit meinem kastanienbraunen Gefieder, meinen weißen Augen und meinem kontrastierenden weißen Bauch bin ich relativ klein, aber unverkennbar. Ich gehöre zur Familie der Entenvögel und bewohne hauptsächlich Süßwassergebiete, besonders in Moorlandschaften, Schilfgürteln und flachen Seen.
Meine bevorzugten Lebensräume
Als Moorente bevorzuge ich ruhige, flache Gewässer, oft in der Nähe von dichten Schilfbeständen. Diese dichten Ufervegetationen bieten mir nicht nur Schutz vor Raubtieren, sondern auch ideale Nistplätze. Schilf, Seggen und Binsen bieten mir Deckung und Sicherheit, sowohl für die Aufzucht meiner Küken als auch für mich selbst während der Mauser, wenn ich besonders verwundbar bin. Der Zustand dieser Schilfbestände ist entscheidend für mein Überleben. Wenn die Wasserqualität sinkt oder Schilf durch menschliche Eingriffe wie Gewässerregulierungen oder Landwirtschaft zurückgeht, finde ich keinen geeigneten Schutz mehr.
Meine Nahrungsgewohnheiten
Ich bin ein Allesfresser, wobei ich mich hauptsächlich von Wasserpflanzen, Insekten, Krebstieren und Schnecken ernähre. Ich liebe seichte Gewässer, wo ich durch Tauchgänge und Schwimmen meine Nahrung suche. Im Sommer stehen vor allem wasserlebende Insektenlarven auf meiner Speisekarte, während ich in den Wintermonaten vermehrt auf pflanzliche Nahrung umstelle. Das macht mich relativ flexibel, aber ich bin dennoch auf gesunde Feuchtgebiete angewiesen, die reich an aquatischer Flora und Fauna sind.
Fortpflanzung und Aufzucht
Ich niste gut versteckt im dichten Schilf oder in der Nähe von Wasser, um meinen Nachwuchs vor Feinden zu schützen. Meine Gelege bestehen meist aus 6 bis 12 Eiern, die ich etwa 25 Tage lang bebrüte. Die Jungvögel sind schon bald nach dem Schlüpfen in der Lage, mir ins Wasser zu folgen, doch sie bleiben auf mich angewiesen, um Schutz und Nahrung zu finden. Die Nähe zu gut erhaltenen Feuchtgebieten ist dabei essenziell, denn nur in ungestörten Habitaten können meine Küken sicher aufwachsen.
Bedrohungen und Herausforderungen
Leider stehe ich auf der Roten Liste der bedrohten Arten in vielen europäischen Ländern, da mein Lebensraum zunehmend zerstört wird. Der Verlust von Feuchtgebieten und die Verschlechterung der Wasserqualität durch Eutrophierung, Landwirtschaft und Urbanisierung bedrohen mein Überleben. Viele meiner einstigen Brut- und Rastgebiete sind heute durch menschliche Eingriffe zerstört oder stark degradiert.
Besonders gefährlich sind für mich:
Schutzmaßnahmen aus meiner Sicht
Um mich und meine Art zu schützen, ist der Erhalt und die Wiederherstellung von natürlichen Feuchtgebieten entscheidend. Dazu gehören:
Ich brauche ungestörte und gut geschützte Gebiete, um mich fortzupflanzen und zu überwintern. Internationale Schutzprogramme wie das Ramsar-Übereinkommen sind wichtige Schritte, um meine Lebensräume langfristig zu sichern. Auch die Förderung einer extensiven Landwirtschaft in Gewässernähe kann dazu beitragen, den Nährstoffeintrag zu reduzieren und meine Umwelt zu schonen.
Fazit aus meiner Perspektive
Ich, die Moorente, bin auf eine funktionierende Wasserlandschaft angewiesen. Ohne gesunde Feuchtgebiete mit dichtem Schilf, klarem Wasser und reichhaltigen Nahrungsquellen bin ich bedroht. Der Schutz und die Wiederherstellung meiner Lebensräume sind essenziell, damit ich und meine Artgenossen weiterhin in den Mooren und Sümpfen dieser Welt schwimmen und brüten können.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
Als Moorente bevorzuge ich ruhige, flache Gewässer, oft in der Nähe von dichten Schilfbeständen. Diese dichten Ufervegetationen bieten mir nicht nur Schutz vor Raubtieren, sondern auch ideale Nistplätze. Schilf, Seggen und Binsen bieten mir Deckung und Sicherheit, sowohl für die Aufzucht meiner Küken als auch für mich selbst während der Mauser, wenn ich besonders verwundbar bin. Der Zustand dieser Schilfbestände ist entscheidend für mein Überleben. Wenn die Wasserqualität sinkt oder Schilf durch menschliche Eingriffe wie Gewässerregulierungen oder Landwirtschaft zurückgeht, finde ich keinen geeigneten Schutz mehr.
Meine Nahrungsgewohnheiten
Ich bin ein Allesfresser, wobei ich mich hauptsächlich von Wasserpflanzen, Insekten, Krebstieren und Schnecken ernähre. Ich liebe seichte Gewässer, wo ich durch Tauchgänge und Schwimmen meine Nahrung suche. Im Sommer stehen vor allem wasserlebende Insektenlarven auf meiner Speisekarte, während ich in den Wintermonaten vermehrt auf pflanzliche Nahrung umstelle. Das macht mich relativ flexibel, aber ich bin dennoch auf gesunde Feuchtgebiete angewiesen, die reich an aquatischer Flora und Fauna sind.
Fortpflanzung und Aufzucht
Ich niste gut versteckt im dichten Schilf oder in der Nähe von Wasser, um meinen Nachwuchs vor Feinden zu schützen. Meine Gelege bestehen meist aus 6 bis 12 Eiern, die ich etwa 25 Tage lang bebrüte. Die Jungvögel sind schon bald nach dem Schlüpfen in der Lage, mir ins Wasser zu folgen, doch sie bleiben auf mich angewiesen, um Schutz und Nahrung zu finden. Die Nähe zu gut erhaltenen Feuchtgebieten ist dabei essenziell, denn nur in ungestörten Habitaten können meine Küken sicher aufwachsen.
Bedrohungen und Herausforderungen
Leider stehe ich auf der Roten Liste der bedrohten Arten in vielen europäischen Ländern, da mein Lebensraum zunehmend zerstört wird. Der Verlust von Feuchtgebieten und die Verschlechterung der Wasserqualität durch Eutrophierung, Landwirtschaft und Urbanisierung bedrohen mein Überleben. Viele meiner einstigen Brut- und Rastgebiete sind heute durch menschliche Eingriffe zerstört oder stark degradiert.
Besonders gefährlich sind für mich:
- Zerstörung von Schilfgebieten: Ohne ausreichende Ufervegetation habe ich keine geschützten Brutplätze.
- Wasserstandsschwankungen: Durch Staudämme, Entwässerung oder künstliche Wasserregulierungen werden meine Brutplätze oft überflutet oder trocknen aus.
- Umweltverschmutzung: Überdüngung führt zur Eutrophierung, und Pestizide beeinträchtigen die Qualität meiner Nahrungsquellen.
Schutzmaßnahmen aus meiner Sicht
Um mich und meine Art zu schützen, ist der Erhalt und die Wiederherstellung von natürlichen Feuchtgebieten entscheidend. Dazu gehören:
- Renaturierung von Moor- und Schilfgebieten, damit ich wieder sichere Brutplätze finde.
- Sicherung von Flachwasserzonen, die reich an Vegetation und aquatischem Leben sind, um Nahrung und Schutz zu bieten.
- Minimierung von Wasserverschmutzung, um die Qualität meiner Nahrung und meines Lebensraumes zu gewährleisten.
Ich brauche ungestörte und gut geschützte Gebiete, um mich fortzupflanzen und zu überwintern. Internationale Schutzprogramme wie das Ramsar-Übereinkommen sind wichtige Schritte, um meine Lebensräume langfristig zu sichern. Auch die Förderung einer extensiven Landwirtschaft in Gewässernähe kann dazu beitragen, den Nährstoffeintrag zu reduzieren und meine Umwelt zu schonen.
Fazit aus meiner Perspektive
Ich, die Moorente, bin auf eine funktionierende Wasserlandschaft angewiesen. Ohne gesunde Feuchtgebiete mit dichtem Schilf, klarem Wasser und reichhaltigen Nahrungsquellen bin ich bedroht. Der Schutz und die Wiederherstellung meiner Lebensräume sind essenziell, damit ich und meine Artgenossen weiterhin in den Mooren und Sümpfen dieser Welt schwimmen und brüten können.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
- Moorente (Aythya nyroca)am NIstplatz
Artenschutz in Franken®
Mehlschwalbenschutz - Sparkasse Bedburg

Betreff: Gebäudebrüter Schwalben am Haus.
09/10.09.2024
Bedburg / NRW. An der Sparkasse in Bedburg Kaster wird eine Fassadendämmung angebracht ... am Gebäude befinden sich einige Mehlschwalbennester. Am Haus daneben finden sich noch junge Schwalben in den Nestern, die gefüttert werden.
09/10.09.2024
- Ein Bericht von Rolf Thiemann
Bedburg / NRW. An der Sparkasse in Bedburg Kaster wird eine Fassadendämmung angebracht ... am Gebäude befinden sich einige Mehlschwalbennester. Am Haus daneben finden sich noch junge Schwalben in den Nestern, die gefüttert werden.
Der zuständige Architekt hat den Vorgang in der Bauleitpase Artenschutz (Gebäudebrüter) bei der UNB angezeigt und eine Befreiung bekommen. Als Ersatzmaßnahme wurde ein vollstäniger Nistplatzausgleich gefordert.
Zugriffsverbote (§ 44 Abs. 1 BNatSchG) Im Zusammenhang mit der Bauleitplanung und der Genehmigung von Vorhaben sind für die
europäisch geschützten Arten die in § 44 Abs. 1 BNatSchG formulierten Zugriffsverbote zu beachten.
Es ist verboten…
- Verbot Nr. 1: … Tiere zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus
der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,
- Verbot Nr. 2: … Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und
Wanderungszeiten so erheblich zu stören, dass sich der Erhaltungszustand
der lokalen Population verschlechtert,
- Verbot Nr. 3: … Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der Tiere aus der Natur zu entnehmen, zu
beschädigen oder zu zerstören,
- Verbot Nr. 4: … Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie
oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören.
Mehl- und Rauchschwalbe sind nach dem Bundesnaturschutzgesetz geschützte Arten. Das heißt, sie dürfen weder gestört, gefangen, getötet noch ihre Quartiere zerstört werden. Der Schutz gilt nicht nur für die Vögel selbst, sondern auch für Brutstätten und Gelege. Sind Brutplätze von Schwalben bei
Baumaßnahmen betroffen, müssen die Eingriffe mit der Unteren Naturschutzbehörde abgesprochen und ggf. genehmigt werden. Bei frühzeitiger Planung (ggf. Einbeziehung von Artexperten) lassen sich meist einfache Lösungen finden, um den Arten trotz Sanierung auch weiterhin Platz zu bieten.
Quelle
Autor / Aufnahmen
Rolf Thiemann
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Gewässer und Naturschutz im Erftkreis
Flora-Fauna-Artenschutz
Naturschutzökologie
Rolf Thiemann
Naturschutzberater
Eisvogelweg 1
50181 Bedburg
Stand
04.09.2024
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung.Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
- Klasse , das ist ja perfekt gelaufen !!!
Zugriffsverbote (§ 44 Abs. 1 BNatSchG) Im Zusammenhang mit der Bauleitplanung und der Genehmigung von Vorhaben sind für die
europäisch geschützten Arten die in § 44 Abs. 1 BNatSchG formulierten Zugriffsverbote zu beachten.
Es ist verboten…
- Verbot Nr. 1: … Tiere zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus
der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,
- Verbot Nr. 2: … Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und
Wanderungszeiten so erheblich zu stören, dass sich der Erhaltungszustand
der lokalen Population verschlechtert,
- Verbot Nr. 3: … Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der Tiere aus der Natur zu entnehmen, zu
beschädigen oder zu zerstören,
- Verbot Nr. 4: … Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie
oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören.
Mehl- und Rauchschwalbe sind nach dem Bundesnaturschutzgesetz geschützte Arten. Das heißt, sie dürfen weder gestört, gefangen, getötet noch ihre Quartiere zerstört werden. Der Schutz gilt nicht nur für die Vögel selbst, sondern auch für Brutstätten und Gelege. Sind Brutplätze von Schwalben bei
Baumaßnahmen betroffen, müssen die Eingriffe mit der Unteren Naturschutzbehörde abgesprochen und ggf. genehmigt werden. Bei frühzeitiger Planung (ggf. Einbeziehung von Artexperten) lassen sich meist einfache Lösungen finden, um den Arten trotz Sanierung auch weiterhin Platz zu bieten.
Quelle
Autor / Aufnahmen
Rolf Thiemann
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Gewässer und Naturschutz im Erftkreis
Flora-Fauna-Artenschutz
Naturschutzökologie
Rolf Thiemann
Naturschutzberater
Eisvogelweg 1
50181 Bedburg
Stand
04.09.2024
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung.Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Artenschutz in Franken®
Stele der Biodiversität® - Burgwindheim / Kötsch

Stele der Biodiversität® - Burgwindheim / Kötsch
10/11.09.2024
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das vom Markt Burgwindheim, dem Bayernwerk der Deutschen Postcode Lotterie und der Steuerkanzlei Bauerfeind unterstützt wird.
Kötsch / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen.
Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
10/11.09.2024
- Grafik ... Eindrücke vor dem Witterungsumschwung
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das vom Markt Burgwindheim, dem Bayernwerk der Deutschen Postcode Lotterie und der Steuerkanzlei Bauerfeind unterstützt wird.
Kötsch / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen.
Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
Denn wenn (selbst in noch geeigneten Nahrungsstrukturen) keine geeigneten Reproduktionsräume vorhanden sind, ist die Erhaltung der Artenvielfalt gelichfalls zum Scheitern verurteilt.
Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das vom Markt Burgwindheim, dem Bayernwerk der Deutschen Postcode Lotterie und der Steuerkanzlei Bauerfeind unterstützt wird, setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.
In der Aufnahme
Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das vom Markt Burgwindheim, dem Bayernwerk der Deutschen Postcode Lotterie und der Steuerkanzlei Bauerfeind unterstützt wird, setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.
In der Aufnahme
- Am 07.09.2024 ... wurden diese Impressionen sichtbar ...
Artenschutz in Franken®
Stele der Biodiversität® - Burgwindheim / Kötsch

Stele der Biodiversität® - Burgwindheim / Kötsch
08/09.09.2024
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das vom Markt Burgwindheim, dem Bayernwerk der Deutschen Postcode Lotterie und der Steuerkanzlei Bauerfeind unterstützt wird.
Kötsch / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen.
Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
08/09.09.2024
- Grafik entwickelt sich weiter ...
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das vom Markt Burgwindheim, dem Bayernwerk der Deutschen Postcode Lotterie und der Steuerkanzlei Bauerfeind unterstützt wird.
Kötsch / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen.
Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
Denn wenn (selbst in noch geeigneten Nahrungsstrukturen) keine geeigneten Reproduktionsräume vorhanden sind, ist die Erhaltung der Artenvielfalt gelichfalls zum Scheitern verurteilt.
Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das vom Markt Burgwindheim, dem Bayernwerk der Deutschen Postcode Lotterie und der Steuerkanzlei Bauerfeind unterstützt wird, setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.
In der Aufnahme
Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das vom Markt Burgwindheim, dem Bayernwerk der Deutschen Postcode Lotterie und der Steuerkanzlei Bauerfeind unterstützt wird, setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.
In der Aufnahme
- Am 04.09.2024 ... wurden diese Impressionen sichtbar ...
Artenschutz in Franken®
Mauswiesel im Komposthaufen

Mauswiesel im Komposthaufen
07/08.09.2024
Einige Mäuse haben sich in unserem Komposthaufen einquartiert. Doch die beste Burg nützt nichts, wenn der Feind so schlank ist. dass er auch durch die engen Gänge flitzen kann. Kaum ist das Mauswiesel aufgetaucht haben ...
07/08.09.2024
- Ein aktueller Kurzfilm von Helga und HunHubertus Zinnecker
Einige Mäuse haben sich in unserem Komposthaufen einquartiert. Doch die beste Burg nützt nichts, wenn der Feind so schlank ist. dass er auch durch die engen Gänge flitzen kann. Kaum ist das Mauswiesel aufgetaucht haben ...
... die Mäuse die Flucht ergriffen und somit ist das Mauswiesel so schnell, wie es gekommen ist, wieder verschwunden.
In der Abbildung
- Mauswiesel im Komposthaufen
Artenschutz in Franken®
Zum Glück waren dort keine Unkenbiotope!

Zu: Windrad-Demontage in Bedburg.
07/08.09.2024
• Zum Glück waren dort keine Unkenbiotope!
Bedburg/NRW. Mit großem Bedauern haben wir aus der Presse erfahren, dass einige Politiker, Tier- und Naturliebhaber das Projekt „Windradfüße werden Unkenbiotop“ befürworten und für gut befinden.
Aus unserer Sicht heraus haben die Befürworter leider ein unvollständiges Hintergrundwissen, was dieses Wissensdefizit gleichfalls für die Tiere bedeutet. Zahlreiche sachkundige Naturschützer und Biologen sind jedoch über diese Aussage entsetzt.
07/08.09.2024
• Zum Glück waren dort keine Unkenbiotope!
Bedburg/NRW. Mit großem Bedauern haben wir aus der Presse erfahren, dass einige Politiker, Tier- und Naturliebhaber das Projekt „Windradfüße werden Unkenbiotop“ befürworten und für gut befinden.
Aus unserer Sicht heraus haben die Befürworter leider ein unvollständiges Hintergrundwissen, was dieses Wissensdefizit gleichfalls für die Tiere bedeutet. Zahlreiche sachkundige Naturschützer und Biologen sind jedoch über diese Aussage entsetzt.
Unsere Organisation stünde einem solchen Unterfangen nicht zwingend ablehnend gegenüber, wenn dieser Ansatz nach einem erfolgten Rückbau der Windkraftanlage generiert werden würde.
Solange jedoch ein Windrad in Betrieb ist, können die Tötungs- und Vermeidungsgebote (§ 13 und 15 Abs.1BNatSchG) nach (BNatSchG §39-§44-§42) für geschützte oder sogar streng geschützte Arten nach unserer Sichtweise eben nicht ausgeschlossen werden. Das Verbot, die Lebensräume und Reproduktionsareale zu stören, verändern oder gar zu zerstören sind im laufenden Betrieb sicherlich nicht ohne weiteres einzuhalten.
Alleine bei Wartungs- und Reparaturarbeiten/ Kontrollen usw. muss die Fläche unter den Windrädern in der Regel befahren werden. Es kommt noch, wie in etlichen Berichten und Dokumentationen aufgezeigt, der Fett- und Ölverlust auf der Fußfläche dazu. Ohne noch die übergreifenden in der Landwirtschaft genutzten Pflanzenschutzmittel oder auch Düngemitteln fokussieren zu wollen.
Mit der Anlage solcher (Schutz) - Strukturen werden womöglich gar noch natürliche Fressfeinde der als unterstützungswürdig angesehenen Spezies an das Windrad herangeführt. Bei fliegenden Vogel- und Säugetierarten scheinen kollosionsrelevante Aspekte somit nicht von der Hand zu weisen zu sein. Unserer Bedenken zu einem solchen Projekt nachdrücklich zu formulieren scheint legitim und so führen wir diesen Ansatz hier sichtbar aus.
In der Aufnahme
Quelle - Autor und Aufnahmen
Gewässer und Naturschutz im Erftkreis
Flora-Fauna-Artenschutz
Naturschutzökologie
Rolf Thiemann
Naturschutzberater
Eisvogelweg 1
50181 Bedburg
www. Naturschutzberater.de
Stand
01.09.2024
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung.Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Solange jedoch ein Windrad in Betrieb ist, können die Tötungs- und Vermeidungsgebote (§ 13 und 15 Abs.1BNatSchG) nach (BNatSchG §39-§44-§42) für geschützte oder sogar streng geschützte Arten nach unserer Sichtweise eben nicht ausgeschlossen werden. Das Verbot, die Lebensräume und Reproduktionsareale zu stören, verändern oder gar zu zerstören sind im laufenden Betrieb sicherlich nicht ohne weiteres einzuhalten.
Alleine bei Wartungs- und Reparaturarbeiten/ Kontrollen usw. muss die Fläche unter den Windrädern in der Regel befahren werden. Es kommt noch, wie in etlichen Berichten und Dokumentationen aufgezeigt, der Fett- und Ölverlust auf der Fußfläche dazu. Ohne noch die übergreifenden in der Landwirtschaft genutzten Pflanzenschutzmittel oder auch Düngemitteln fokussieren zu wollen.
Mit der Anlage solcher (Schutz) - Strukturen werden womöglich gar noch natürliche Fressfeinde der als unterstützungswürdig angesehenen Spezies an das Windrad herangeführt. Bei fliegenden Vogel- und Säugetierarten scheinen kollosionsrelevante Aspekte somit nicht von der Hand zu weisen zu sein. Unserer Bedenken zu einem solchen Projekt nachdrücklich zu formulieren scheint legitim und so führen wir diesen Ansatz hier sichtbar aus.
In der Aufnahme
- Mäusebussard Kadaver am undweit des Windkraftanlagen Fundaments
Quelle - Autor und Aufnahmen
Gewässer und Naturschutz im Erftkreis
Flora-Fauna-Artenschutz
Naturschutzökologie
Rolf Thiemann
Naturschutzberater
Eisvogelweg 1
50181 Bedburg
www. Naturschutzberater.de
Stand
01.09.2024
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung.Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Artenschutz in Franken®
Der Ortolan (Emberiza hortulana)

Ortolan (Emberiza hortulana)
06/07.09.2024
Ich bin ein kleiner Singvogel, der vor allem in den offenen Landschaften Europas und Teilen Asiens zu finden ist. Mein Gefieder ist in sanften Brauntönen gehalten, was mir hilft, mich in meinem natürlichen Lebensraum zu tarnen.
Besonders auffällig ist mein gelber Bauch und die charakteristische grüne Kopfzeichnung, die mich von anderen Vögeln unterscheidet.
06/07.09.2024
- Hallo! Ich bin der Ortolan, wissenschaftlich bekannt als Emberiza hortulana. Ich freue mich, dir ein wenig über mich und meine Art zu erzählen!
Ich bin ein kleiner Singvogel, der vor allem in den offenen Landschaften Europas und Teilen Asiens zu finden ist. Mein Gefieder ist in sanften Brauntönen gehalten, was mir hilft, mich in meinem natürlichen Lebensraum zu tarnen.
Besonders auffällig ist mein gelber Bauch und die charakteristische grüne Kopfzeichnung, die mich von anderen Vögeln unterscheidet.
Ich lebe in einer Vielzahl von Lebensräumen, darunter Wiesen, Felder und Hecken. Diese Umgebungen bieten mir nicht nur Schutz, sondern auch eine reichhaltige Nahrungsquelle. Ich ernähre mich hauptsächlich von Samen, Insekten und anderen kleinen Wirbellosen, die ich in der Vegetation finde. Meine Fähigkeit, verschiedene Nahrungsquellen zu nutzen, ist entscheidend für mein Überleben, besonders während der Brutzeit, wenn ich zusätzliche Energie benötige.
In der Fortpflanzungszeit, die typischerweise im späten Frühling beginnt, suche ich nach einem geeigneten Partner. Mein Gesang, der melodisch und ansprechend ist, spielt eine wichtige Rolle bei der Anwerbung von Weibchen. Ich baue mein Nest meist am Boden, gut versteckt zwischen Gräsern und Sträuchern, um meine Eier und Küken vor Fressfeinden zu schützen.
Leider bin ich in den letzten Jahren aufgrund von Lebensraumverlust und Jagd unter Druck geraten. In einigen Regionen bin ich sogar als gefährdet eingestuft. Es ist wichtig, dass wir Menschen und Vögel zusammenarbeiten, um unsere Lebensräume zu schützen und die Biodiversität zu bewahren.
Ich hoffe, ich konnte dir einen kleinen Einblick in mein Leben als Ortolan geben!
In der Aufnahme von Helga Zinnecker
In der Fortpflanzungszeit, die typischerweise im späten Frühling beginnt, suche ich nach einem geeigneten Partner. Mein Gesang, der melodisch und ansprechend ist, spielt eine wichtige Rolle bei der Anwerbung von Weibchen. Ich baue mein Nest meist am Boden, gut versteckt zwischen Gräsern und Sträuchern, um meine Eier und Küken vor Fressfeinden zu schützen.
Leider bin ich in den letzten Jahren aufgrund von Lebensraumverlust und Jagd unter Druck geraten. In einigen Regionen bin ich sogar als gefährdet eingestuft. Es ist wichtig, dass wir Menschen und Vögel zusammenarbeiten, um unsere Lebensräume zu schützen und die Biodiversität zu bewahren.
Ich hoffe, ich konnte dir einen kleinen Einblick in mein Leben als Ortolan geben!
In der Aufnahme von Helga Zinnecker
- Rote Liste Bayern: Vom Aussterben bedroht ...Der Ortolan
Artenschutz in Franken®
So wertvoll und doch so schlecht behandelt

So wertvoll und doch so schlecht behandelt
06.09.2024
Aus der Sicht der Hecke und im Kontext der biologischen Vielfalt lassen sich folgende fachliche Komponenten hervorheben:
06.09.2024
- Feldhecken spielen eine zentrale Rolle in der Landschaftsökologie und sind besonders wichtig für viele Tierarten als Brutplatz und Unterschlupf.
Aus der Sicht der Hecke und im Kontext der biologischen Vielfalt lassen sich folgende fachliche Komponenten hervorheben:
Strukturvielfalt und Habitatkomplexität
Feldhecken bieten durch ihre vielschichtige Struktur – von der Krautschicht über Sträucher bis hin zu Bäumen – eine Vielzahl von Nischen und Lebensräumen. Diese Strukturvielfalt schafft unterschiedliche Mikroklimata und Bedingungen, die verschiedenen Tierarten, insbesondere Vögeln und Insekten, optimale Bedingungen für die Brut bieten. Für Vogelarten, die in Hecken brüten, bieten die dichten Zweige Schutz vor Raubtieren und Wettereinflüssen.
Nahrungsquelle
Feldhecken sind reich an unterschiedlichen Pflanzenarten, die wiederum eine Fülle an Nahrung für Tiere bereitstellen. Beeren, Früchte, Samen und Insekten, die in oder um Hecken leben, bilden eine wichtige Nahrungsgrundlage, insbesondere für Vögel während der Brutzeit, wenn der Energiebedarf erhöht ist.
Schutz und Rückzugsmöglichkeit
Die dichte Vegetation der Feldhecken bietet Tieren Schutz vor Feinden und extremen Witterungsbedingungen. Säugetiere, Reptilien und Amphibien finden hier Unterschlupf und Schutz vor Raubtieren. Insbesondere in der landwirtschaftlich genutzten Landschaft, wo offene Felder wenig Deckung bieten, sind Hecken als Rückzugsgebiete essentiell.
Förderung der Biodiversität
Hecken tragen wesentlich zur Erhaltung und Förderung der Biodiversität bei, indem sie als Korridore in der Landschaft fungieren und isolierte Lebensräume miteinander verbinden. Diese Vernetzung ermöglicht es Tieren, sich zwischen verschiedenen Lebensräumen zu bewegen, was genetischen Austausch und die Erhaltung stabiler Populationen fördert.
Ökologische Pufferzonen
Feldhecken fungieren auch als ökologische Pufferzonen zwischen landwirtschaftlich genutzten Flächen und naturnahen Lebensräumen. Sie mindern die Auswirkungen von landwirtschaftlichen Praktiken, wie Pestizideinsatz und Bodenbearbeitung, auf benachbarte Ökosysteme und tragen so zur Stabilität der Landschaft bei.
Erhalt traditioneller Kulturlandschaften
Neben ihrer ökologischen Bedeutung tragen Feldhecken zur Erhaltung traditioneller Kulturlandschaften bei, die für viele Arten ein historisch gewachsenes Refugium darstellen. Ihr Erhalt ist daher nicht nur aus ökologischer Sicht, sondern auch aus kulturhistorischer Perspektive von Bedeutung.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Feldhecken durch ihre Struktur, ihre Funktion als Nahrungsquelle und Unterschlupf, sowie durch ihre Rolle als Biodiversitäts-Hotspots von unschätzbarem Wert für viele Tierarten sind. Sie tragen erheblich zur Stabilität von Ökosystemen und zur Erhaltung der Artenvielfalt in landwirtschaftlich geprägten Landschaften bei.
In der Aufnahme
Feldhecken bieten durch ihre vielschichtige Struktur – von der Krautschicht über Sträucher bis hin zu Bäumen – eine Vielzahl von Nischen und Lebensräumen. Diese Strukturvielfalt schafft unterschiedliche Mikroklimata und Bedingungen, die verschiedenen Tierarten, insbesondere Vögeln und Insekten, optimale Bedingungen für die Brut bieten. Für Vogelarten, die in Hecken brüten, bieten die dichten Zweige Schutz vor Raubtieren und Wettereinflüssen.
Nahrungsquelle
Feldhecken sind reich an unterschiedlichen Pflanzenarten, die wiederum eine Fülle an Nahrung für Tiere bereitstellen. Beeren, Früchte, Samen und Insekten, die in oder um Hecken leben, bilden eine wichtige Nahrungsgrundlage, insbesondere für Vögel während der Brutzeit, wenn der Energiebedarf erhöht ist.
Schutz und Rückzugsmöglichkeit
Die dichte Vegetation der Feldhecken bietet Tieren Schutz vor Feinden und extremen Witterungsbedingungen. Säugetiere, Reptilien und Amphibien finden hier Unterschlupf und Schutz vor Raubtieren. Insbesondere in der landwirtschaftlich genutzten Landschaft, wo offene Felder wenig Deckung bieten, sind Hecken als Rückzugsgebiete essentiell.
Förderung der Biodiversität
Hecken tragen wesentlich zur Erhaltung und Förderung der Biodiversität bei, indem sie als Korridore in der Landschaft fungieren und isolierte Lebensräume miteinander verbinden. Diese Vernetzung ermöglicht es Tieren, sich zwischen verschiedenen Lebensräumen zu bewegen, was genetischen Austausch und die Erhaltung stabiler Populationen fördert.
Ökologische Pufferzonen
Feldhecken fungieren auch als ökologische Pufferzonen zwischen landwirtschaftlich genutzten Flächen und naturnahen Lebensräumen. Sie mindern die Auswirkungen von landwirtschaftlichen Praktiken, wie Pestizideinsatz und Bodenbearbeitung, auf benachbarte Ökosysteme und tragen so zur Stabilität der Landschaft bei.
Erhalt traditioneller Kulturlandschaften
Neben ihrer ökologischen Bedeutung tragen Feldhecken zur Erhaltung traditioneller Kulturlandschaften bei, die für viele Arten ein historisch gewachsenes Refugium darstellen. Ihr Erhalt ist daher nicht nur aus ökologischer Sicht, sondern auch aus kulturhistorischer Perspektive von Bedeutung.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Feldhecken durch ihre Struktur, ihre Funktion als Nahrungsquelle und Unterschlupf, sowie durch ihre Rolle als Biodiversitäts-Hotspots von unschätzbarem Wert für viele Tierarten sind. Sie tragen erheblich zur Stabilität von Ökosystemen und zur Erhaltung der Artenvielfalt in landwirtschaftlich geprägten Landschaften bei.
In der Aufnahme
- Artenschutz in Franken® setzt sich seit vielen Jahren für die Erhaltung von Feldgehölzen ein ... deren große Bedeutung wird vielfach von der "modernen-industriell geformten" nicht erkannt und entsprechend negativ werden diese Strukturen auch behandelt.
Artenschutz in Franken®
Die Dorngrasmücke (Curruca communis)

Dorngrasmücke (Curruca communis)
04/05.09.2024
Mit meinen etwa 13 bis 15 Zentimetern Länge und meinem Gewicht von nur etwa 13 bis 20 Gramm bin ich zwar zierlich, aber ich habe Fähigkeiten und Anpassungen entwickelt, die mich zu einem erfolgreichen Überlebenskünstler machen.
04/05.09.2024
- Ich bin die Dorngrasmücke, auch bekannt als Curruca communis. Ich bin ein kleiner Singvogel, aber unterschätzt mich nicht!
Mit meinen etwa 13 bis 15 Zentimetern Länge und meinem Gewicht von nur etwa 13 bis 20 Gramm bin ich zwar zierlich, aber ich habe Fähigkeiten und Anpassungen entwickelt, die mich zu einem erfolgreichen Überlebenskünstler machen.
Mein Lebensraum und Revier
Ich bevorzuge offene Landschaften mit dichten Sträuchern und Hecken, wo ich Schutz und Nahrung finde. Diese Gebüsche bieten mir sowohl Sicherheit vor Fressfeinden als auch ideale Nistplätze. Hier kann ich mein Nest gut verstecken, oft tief in einem dichten Busch, wo Feinde wie Katzen oder größere Vögel mich schwer erreichen können. Diese Landschaften geben mir auch die Möglichkeit, mein Revier mit meinem charakteristischen Gesang zu markieren.
Mein Gesang und Verhalten
Ich bin stolz auf meinen Gesang. Er ist ziemlich abwechslungsreich und besteht aus einer Reihe von schnarrenden, schmetternden Tönen, die ich rhythmisch wiederhole. Diesen Gesang nutze ich, um mein Revier zu verteidigen und ein Weibchen anzulocken. Besonders im Frühling und Frühsommer hört man mich oft, wenn ich auf einer exponierten Stelle sitze und singe. Wenn es um das Balzverhalten geht, zeige ich gern meine akrobatischen Fähigkeiten. Ich fliege oft auffällig und mache dabei beeindruckende Flugmanöver, um meine Partnerin zu beeindrucken.
Meine Ernährung
Meine Nahrung besteht hauptsächlich aus Insekten, die ich in den Blättern und Zweigen meiner Umgebung finde. Im Sommer stehen Schmetterlingsraupen, Fliegen und Spinnen auf meinem Speiseplan. Im Herbst, wenn die Insekten seltener werden, stelle ich meine Ernährung um und esse gerne Beeren, um mich auf den langen Flug in meine Winterquartiere vorzubereiten.
Mein Zugverhalten
Ja, ich bin ein Zugvogel. Wenn die Tage kürzer werden und das Nahrungsangebot abnimmt, mache ich mich auf eine weite Reise. Mein Ziel ist das südliche Afrika, wo ich den Winter verbringe. Die Reise dorthin ist gefährlich, aber ich folge instinktiv den Zugrouten, die meine Vorfahren seit Generationen benutzt haben.
Meine Fortpflanzung
Im Frühjahr, wenn ich aus meinem Winterquartier zurückkehre, beginne ich damit, ein Nest zu bauen. Ich wähle einen geschützten Platz in einem dichten Strauch und baue ein kleines, aber robustes Nest aus Gras, Moos und anderen Pflanzenfasern. Mein Weibchen legt darin meist 4 bis 5 Eier, die wir gemeinsam ausbrüten. Nach etwa zwei Wochen schlüpfen die Küken, die wir dann fleißig mit Insekten füttern.
Bedrohungen und Schutz
Leider bin ich nicht ganz frei von Bedrohungen. Fressfeinde wie Katzen, Greifvögel und Schlangen lauern überall. Auch die zunehmende Zerstörung meines Lebensraums durch die Landwirtschaft und Urbanisierung machen mir das Leben schwer. Doch ich bin zäh und anpassungsfähig. Mit etwas Glück und Schutzmaßnahmen seitens der Menschen kann ich meinen Bestand aufrechterhalten.
Ich hoffe, du hast jetzt ein besseres Verständnis von mir, der Dorngrasmücke. Ich mag klein sein, aber in meiner Welt bin ich ein stolzer und entschlossener Vogel!
In der Aufnahme von Vogelbilder.com
Ich bevorzuge offene Landschaften mit dichten Sträuchern und Hecken, wo ich Schutz und Nahrung finde. Diese Gebüsche bieten mir sowohl Sicherheit vor Fressfeinden als auch ideale Nistplätze. Hier kann ich mein Nest gut verstecken, oft tief in einem dichten Busch, wo Feinde wie Katzen oder größere Vögel mich schwer erreichen können. Diese Landschaften geben mir auch die Möglichkeit, mein Revier mit meinem charakteristischen Gesang zu markieren.
Mein Gesang und Verhalten
Ich bin stolz auf meinen Gesang. Er ist ziemlich abwechslungsreich und besteht aus einer Reihe von schnarrenden, schmetternden Tönen, die ich rhythmisch wiederhole. Diesen Gesang nutze ich, um mein Revier zu verteidigen und ein Weibchen anzulocken. Besonders im Frühling und Frühsommer hört man mich oft, wenn ich auf einer exponierten Stelle sitze und singe. Wenn es um das Balzverhalten geht, zeige ich gern meine akrobatischen Fähigkeiten. Ich fliege oft auffällig und mache dabei beeindruckende Flugmanöver, um meine Partnerin zu beeindrucken.
Meine Ernährung
Meine Nahrung besteht hauptsächlich aus Insekten, die ich in den Blättern und Zweigen meiner Umgebung finde. Im Sommer stehen Schmetterlingsraupen, Fliegen und Spinnen auf meinem Speiseplan. Im Herbst, wenn die Insekten seltener werden, stelle ich meine Ernährung um und esse gerne Beeren, um mich auf den langen Flug in meine Winterquartiere vorzubereiten.
Mein Zugverhalten
Ja, ich bin ein Zugvogel. Wenn die Tage kürzer werden und das Nahrungsangebot abnimmt, mache ich mich auf eine weite Reise. Mein Ziel ist das südliche Afrika, wo ich den Winter verbringe. Die Reise dorthin ist gefährlich, aber ich folge instinktiv den Zugrouten, die meine Vorfahren seit Generationen benutzt haben.
Meine Fortpflanzung
Im Frühjahr, wenn ich aus meinem Winterquartier zurückkehre, beginne ich damit, ein Nest zu bauen. Ich wähle einen geschützten Platz in einem dichten Strauch und baue ein kleines, aber robustes Nest aus Gras, Moos und anderen Pflanzenfasern. Mein Weibchen legt darin meist 4 bis 5 Eier, die wir gemeinsam ausbrüten. Nach etwa zwei Wochen schlüpfen die Küken, die wir dann fleißig mit Insekten füttern.
Bedrohungen und Schutz
Leider bin ich nicht ganz frei von Bedrohungen. Fressfeinde wie Katzen, Greifvögel und Schlangen lauern überall. Auch die zunehmende Zerstörung meines Lebensraums durch die Landwirtschaft und Urbanisierung machen mir das Leben schwer. Doch ich bin zäh und anpassungsfähig. Mit etwas Glück und Schutzmaßnahmen seitens der Menschen kann ich meinen Bestand aufrechterhalten.
Ich hoffe, du hast jetzt ein besseres Verständnis von mir, der Dorngrasmücke. Ich mag klein sein, aber in meiner Welt bin ich ein stolzer und entschlossener Vogel!
In der Aufnahme von Vogelbilder.com
- Männchen mit einer Raupe
Artenschutz in Franken®
Artenschutzmast Geiselwind

Ein Mast für die Kinderstube fränkischer Weißstörche und mehr ...
04/05.09.2024
Ein Gemeinschaftsprojekt bei dem Artenschutz im Steigerwald , Bayerische Staatsforsten/Fortbetrieb Ebrach , Dennert Baustoffe , Drei - Franken - Schule Geiselwind , Landratsamt Kitzingen / Untere Naturschutzbehörde , Markt Geiselwind , Sparkasse Mainfranken beteiligt waren, möchte dem "Kitzinger Weißstorch" mit der Bereitstellung eines Nistmastes die Möglichkeit einräumen sich erfolgreich fortpflanzen zu können.
04/05.09.2024
- Das Making-of ... wir fassen die De- und Neumontage für Sie zusammen ..
Ein Gemeinschaftsprojekt bei dem Artenschutz im Steigerwald , Bayerische Staatsforsten/Fortbetrieb Ebrach , Dennert Baustoffe , Drei - Franken - Schule Geiselwind , Landratsamt Kitzingen / Untere Naturschutzbehörde , Markt Geiselwind , Sparkasse Mainfranken beteiligt waren, möchte dem "Kitzinger Weißstorch" mit der Bereitstellung eines Nistmastes die Möglichkeit einräumen sich erfolgreich fortpflanzen zu können.
Im August 2024 musste der Mast der die Nistplattform trug ausgetauscht werden, da Spechte ihre Nisthöhlen in den Stamm geschlagen hatten... die Witterung ließ den Mast morsch werden und die Nistplattform drohte abzukippen ...
... und so wurde in 2024 mit Unterstützung der Deutschen Postcode Lotterie und Turmstationen Deutschland e.V. und nicht zuletzt von Artenschutz in Franken® ein in dieser Form wohl nicht alltäglicher Metallmast gestellt ...
... um weiteren Arten hier eine Option zur Fortpflanzung einzuräumen wurde der Mast mit Nisthilfen für Turmfalke und Mauersegler ausgestattet ...
In der Aufnahme von R. Dreißig
... und so wurde in 2024 mit Unterstützung der Deutschen Postcode Lotterie und Turmstationen Deutschland e.V. und nicht zuletzt von Artenschutz in Franken® ein in dieser Form wohl nicht alltäglicher Metallmast gestellt ...
... um weiteren Arten hier eine Option zur Fortpflanzung einzuräumen wurde der Mast mit Nisthilfen für Turmfalke und Mauersegler ausgestattet ...
In der Aufnahme von R. Dreißig
- ... Entnahme des Altmastes ...
Artenschutz in Franken®
Stele der Biodiversität® - Burgwindheim / Kötsch

Stele der Biodiversität® - Burgwindheim / Kötsch
05/06.09.2024
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das vom Markt Burgwindheim, dem Bayernwerk der Deutschen Postcode Lotterie und der Steuerkanzlei Bauerfeind unterstützt wird.
Kötsch / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen.
Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
05/06.09.2024
- Grafische Gestaltung startet ...
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das vom Markt Burgwindheim, dem Bayernwerk der Deutschen Postcode Lotterie und der Steuerkanzlei Bauerfeind unterstützt wird.
Kötsch / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen.
Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
Denn wenn (selbst in noch geeigneten Nahrungsstrukturen) keine geeigneten Reproduktionsräume vorhanden sind, ist die Erhaltung der Artenvielfalt gelichfalls zum Scheitern verurteilt.
Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das vom Markt Burgwindheim, dem Bayernwerk der Deutschen Postcode Lotterie und der Steuerkanzlei Bauerfeind unterstützt wird, setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.
In der Aufnahme
Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das vom Markt Burgwindheim, dem Bayernwerk der Deutschen Postcode Lotterie und der Steuerkanzlei Bauerfeind unterstützt wird, setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.
In der Aufnahme
- Am 27.08.2024 starten wir mit der grafischen Baukörpergestaltung ...
Artenschutz in Franken®
Wer wird Vogel des Jahres 2025?

Wer wird Vogel des Jahres 2025?
03/04.09.2024
Berlin – Am 3. September starten NABU und sein bayerischer Partner LBV (Landesbund für Vogel- und Naturschutz) zum fünften Mal die öffentliche Wahl – alle können mitmachen und entscheiden, wer der nächste Jahresvogel werden und dem Kiebitz nachfolgen soll.
„Mit Hausrotschwanz, Kranich, Schwarzspecht, Schwarzstorch und Waldohreule stellen sich fünf sehr unterschiedliche und spannende Kandidaten zur Wahl“, sagt NABU-Vogelschutzexperte Martin Rümmler. „Jeder von ihnen steht für ein Naturschutzthema, das unsere Aufmerksamkeit braucht – jeder der fünf hat es verdient, gewählt zu werden.“
03/04.09.2024
- Hausrotschwanz, Kranich, Schwarzspecht, Schwarzstorch und Waldohreule stehen zur Wahl
Berlin – Am 3. September starten NABU und sein bayerischer Partner LBV (Landesbund für Vogel- und Naturschutz) zum fünften Mal die öffentliche Wahl – alle können mitmachen und entscheiden, wer der nächste Jahresvogel werden und dem Kiebitz nachfolgen soll.
„Mit Hausrotschwanz, Kranich, Schwarzspecht, Schwarzstorch und Waldohreule stellen sich fünf sehr unterschiedliche und spannende Kandidaten zur Wahl“, sagt NABU-Vogelschutzexperte Martin Rümmler. „Jeder von ihnen steht für ein Naturschutzthema, das unsere Aufmerksamkeit braucht – jeder der fünf hat es verdient, gewählt zu werden.“
Der Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros) ist ein früher Vogel – schon 70 Minuten vor Sonnenaufgang ertönt sein melodischer und lautstarker Gesang. Den Winter verbringt der zierliche Singvogel in Nordafrika. Als Insektenfresser ist er vom Insektenrückgang durch die intensive Landwirtschaft und naturferne Gärten stark betroffen. Außerdem vertritt er die Gruppe der Gebäudebrüter, die es durch Sanierungen immer schwerer hat, Nistmöglichkeiten zu finden. Sein Wahlslogan lautet daher: „Mut zur Lücke!“
Mit seinem typischen Trompeten stellt sich der Kranich (Grus grus) zur Wahl. Der Zugvogel ist in vielerlei Hinsicht ein spektakulärer Kandidat. Mit bis zu 116 cm Körperhöhe ist er größer als ein Weißstorch. Seine eleganten Balztänze im Frühjahr und sein Zug in großen Keilformationen im Herbst sind Naturschauspiele, die jedes Jahr viele Menschen anlocken und faszinieren. In vielen Ländern gilt er als Symbol für Glück und Frieden. Weil er Feuchtgebiete zur Rast und Brut braucht, lautet sein Slogan: „Nasse Füße fürs Klima!“
Der etwa krähengroße Schwarzspecht (Dryocopus martius) bewohnt am liebsten alte Mischwälder. Der Vogelkandidat ist leicht zu erkennen: Sein Gefieder ist schwarz bis auf den tiefroten Mittelscheitel. Er frisst baumbewohnende Insekten und deren Larven. Für seine Bruthöhlen, die er mit spitzem Schnabel in den Stamm hämmert, braucht er alte Bäume. Er ist der Zimmermann des Waldes, denn seine Höhlen werden von über 60 verschiedenen „Nachmietern“ genutzt, unter anderem von Siebenschläfer, Fledermaus und Hohltaube. „Trommeln für Vielfalt!“ ist darum sein Wahlslogan.
Kandidat Nummer vier ist viel scheuer und daher seltener zu sehen als sein weißer Namensvetter: Der Schwarzstorch (Ciconia nigra). Sein Gefieder ist überwiegend schwarz mit grünlich violettem Metallglanz. Er lebt zurückgezogen in großen Waldflächen und zieht einen Monat später als der Weißstorch nach Afrika zum Überwintern. Zur Nahrungssuche begibt er sich häufig an Gewässer, wo er unter anderem Frösche und Fische fängt. Daher sein Wahlspruch: „Freiheit für Flüsse!“
Die Waldohreule (Asio otus) ist neben dem Waldkauz die häufigste Eule in Deutschland. Optisch ähnelt sie dem Uhu, ist aber kleiner und schlanker. Ihre „Ohren“ sind keine, sondern Federpuschel, die nichts mit der Hörfunktion zu tun haben. Die Wahlohreule lebt beispielsweise in lichten Wäldern, jagt Mäuse und Wühlmäuse im Offenland und nistet gern in alten Krähennestern. Wie alle Eulen kann sie völlig geräuschlos fliegen. Bei der nächtlichen Jagd ortet sie ihre Beute akustisch. Ihr Wahlslogan: „Ohren auf: Natur an!“
Am 3. September um 9 Uhr wird das virtuelle Wahllokal unter www.vogeldesjahres.de freigeschaltet. Bis zum 10. Oktober, 11 Uhr, kann abgestimmt werden. Noch am selben Tag wird der Sieger bekanntgegeben. Der „Vogel des Jahres“ wurde in Deutschland erstmals im Jahr 1971 gekürt. Seit 2021 wird er durch eine öffentliche Wahl bestimmt.
Quelle
NABU (Naturschutzbund Deutschland) e.V.
Bundesgeschäftsstelle
Pressestelle
Charitéstraße 3
10117 Berlin
Stand
NABU-Pressemitteilung
02.09.2024
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung.Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
In der Aufnahme von Ulrich Rösch
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Mit seinem typischen Trompeten stellt sich der Kranich (Grus grus) zur Wahl. Der Zugvogel ist in vielerlei Hinsicht ein spektakulärer Kandidat. Mit bis zu 116 cm Körperhöhe ist er größer als ein Weißstorch. Seine eleganten Balztänze im Frühjahr und sein Zug in großen Keilformationen im Herbst sind Naturschauspiele, die jedes Jahr viele Menschen anlocken und faszinieren. In vielen Ländern gilt er als Symbol für Glück und Frieden. Weil er Feuchtgebiete zur Rast und Brut braucht, lautet sein Slogan: „Nasse Füße fürs Klima!“
Der etwa krähengroße Schwarzspecht (Dryocopus martius) bewohnt am liebsten alte Mischwälder. Der Vogelkandidat ist leicht zu erkennen: Sein Gefieder ist schwarz bis auf den tiefroten Mittelscheitel. Er frisst baumbewohnende Insekten und deren Larven. Für seine Bruthöhlen, die er mit spitzem Schnabel in den Stamm hämmert, braucht er alte Bäume. Er ist der Zimmermann des Waldes, denn seine Höhlen werden von über 60 verschiedenen „Nachmietern“ genutzt, unter anderem von Siebenschläfer, Fledermaus und Hohltaube. „Trommeln für Vielfalt!“ ist darum sein Wahlslogan.
Kandidat Nummer vier ist viel scheuer und daher seltener zu sehen als sein weißer Namensvetter: Der Schwarzstorch (Ciconia nigra). Sein Gefieder ist überwiegend schwarz mit grünlich violettem Metallglanz. Er lebt zurückgezogen in großen Waldflächen und zieht einen Monat später als der Weißstorch nach Afrika zum Überwintern. Zur Nahrungssuche begibt er sich häufig an Gewässer, wo er unter anderem Frösche und Fische fängt. Daher sein Wahlspruch: „Freiheit für Flüsse!“
Die Waldohreule (Asio otus) ist neben dem Waldkauz die häufigste Eule in Deutschland. Optisch ähnelt sie dem Uhu, ist aber kleiner und schlanker. Ihre „Ohren“ sind keine, sondern Federpuschel, die nichts mit der Hörfunktion zu tun haben. Die Wahlohreule lebt beispielsweise in lichten Wäldern, jagt Mäuse und Wühlmäuse im Offenland und nistet gern in alten Krähennestern. Wie alle Eulen kann sie völlig geräuschlos fliegen. Bei der nächtlichen Jagd ortet sie ihre Beute akustisch. Ihr Wahlslogan: „Ohren auf: Natur an!“
Am 3. September um 9 Uhr wird das virtuelle Wahllokal unter www.vogeldesjahres.de freigeschaltet. Bis zum 10. Oktober, 11 Uhr, kann abgestimmt werden. Noch am selben Tag wird der Sieger bekanntgegeben. Der „Vogel des Jahres“ wurde in Deutschland erstmals im Jahr 1971 gekürt. Seit 2021 wird er durch eine öffentliche Wahl bestimmt.
- Mehr Infos und Stimmabgabe: www.vogeldesjahres.de (ab 3.9. freigeschaltet)
- Medieninfoseite mit Grafiken, Fotos und Vogelstimmen: www.NABU.de/medieninfos-vogelwahl (ab 3.9. freigeschaltet)
- Vogelporträts: www.NABU.de/vogelportraets
Quelle
NABU (Naturschutzbund Deutschland) e.V.
Bundesgeschäftsstelle
Pressestelle
Charitéstraße 3
10117 Berlin
Stand
NABU-Pressemitteilung
02.09.2024
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung.Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
In der Aufnahme von Ulrich Rösch
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Artenschutz in Franken®
Stele der Biodiversität® - Burgwindheim / Kötsch

Stele der Biodiversität® - Burgwindheim / Kötsch
03/04.09.2024
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das vom Markt Burgwindheim, dem Bayernwerk der Deutschen Postcode Lotterie und der Steuerkanzlei Bauerfeind unterstützt wird.
Kötsch / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen.
Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
03/04.09.2024
- Start zur Anbringung der Mehlschwalbennisthilfen
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das vom Markt Burgwindheim, dem Bayernwerk der Deutschen Postcode Lotterie und der Steuerkanzlei Bauerfeind unterstützt wird.
Kötsch / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen.
Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
Denn wenn (selbst in noch geeigneten Nahrungsstrukturen) keine geeigneten Reproduktionsräume vorhanden sind, ist die Erhaltung der Artenvielfalt gelichfalls zum Scheitern verurteilt.
Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das vom Markt Burgwindheim, dem Bayernwerk der Deutschen Postcode Lotterie und der Steuerkanzlei Bauerfeind unterstützt wird, setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.
In der Aufnahme
Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das vom Markt Burgwindheim, dem Bayernwerk der Deutschen Postcode Lotterie und der Steuerkanzlei Bauerfeind unterstützt wird, setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.
In der Aufnahme
- Am 23.08.2024 wurde damit begonnen die Mehlschwalbenisthilfen zu montieren ..
Artenschutz in Franken®
Der Schwalbenschwanz (Papilio machaon)
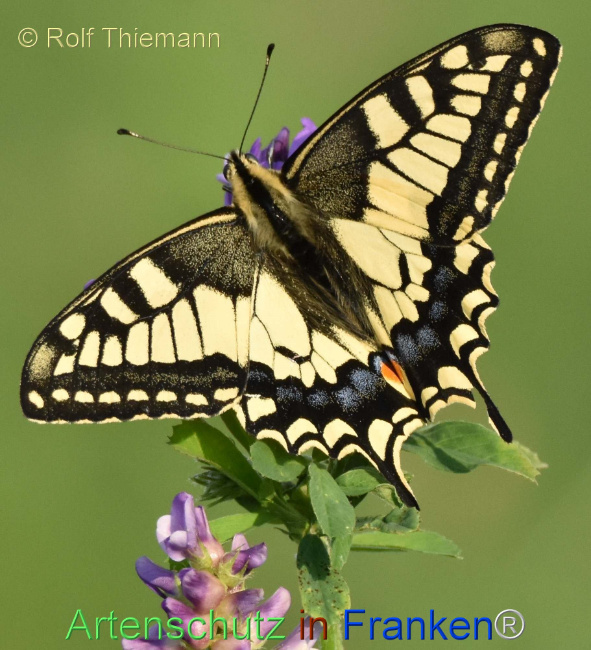
Schwalbenschwanz (Papilio machaon)
01/02.09.2024
Mein Lebensraum erstreckt sich über weite Teile Europas, Asiens und Nordamerikas, wo ich in offenen Landschaften, Gärten und Wiesen anzutreffen bin.
01/02.09.2024
- Als Schwalbenschwanz (Papilio machaon) betrachte ich mich als ein prächtiger Vertreter der Familie der Papilionidae, bekannt für meine markanten, geschwungenen Flügel mit einer auffälligen Gelb- und Schwarzkombination.
Mein Lebensraum erstreckt sich über weite Teile Europas, Asiens und Nordamerikas, wo ich in offenen Landschaften, Gärten und Wiesen anzutreffen bin.
Fachlich betrachtet gehöre ich zur Ordnung der Schmetterlinge (Lepidoptera) und zeige typische Merkmale dieser Gruppe, wie zum Beispiel schuppige Flügel und einen saugenden Rüssel. Mein wissenschaftlicher Name, Papilio machaon, verweist auf meine Zugehörigkeit zur Gattung Papilio und spezifiziert meine Art.
Mein Leben beginnt als Ei, das an Pflanzen der Familie der Doldenblütler (Apiaceae) abgelegt wird. Nach dem Schlüpfen entwickle ich mich durch mehrere Larvenstadien, in denen ich mich von den Blättern meiner Wirtspflanzen ernähre, typischerweise von Fenchel, Möhren oder Dill. Während dieser Phase bin ich anfällig für Prädatoren, weshalb meine auffällige Warnfärbung eine Rolle spielt, um Feinde abzuschrecken.
Nachdem ich mich verpuppt habe, verbringe ich einige Zeit als Puppe, während mein Körper umgestaltet wird und meine Flügel ihre endgültige Form annehmen. Als fertiger Schmetterling trage ich eine Mischung aus gelben, schwarzen und blauen Farben auf meinen Flügeln, die nicht nur schön anzusehen sind, sondern auch meiner Art helfen, sich zu reproduzieren und zu überleben.
Mein Leben als erwachsener Schwalbenschwanz ist von kurzen, aber intensiven Flugphasen geprägt, während derer ich auf Nektarsuche bin und oft weite Strecken zurücklege, um geeignete Nahrungsquellen zu finden. Meine Flugweise ist elegant und oft von schnellen, zickzackförmigen Bewegungen geprägt, die es mir ermöglichen, mich geschickt vor potenziellen Fressfeinden zu schützen.
Insgesamt bin ich als Schmetterling ein faszinierendes Beispiel für die Schönheit und Anpassungsfähigkeit der Natur, deren Lebenszyklus und Verhalten durch eine Vielzahl von wissenschaftlichen Studien und Beobachtungen untersucht wurden, um das Verständnis für die ökologische Rolle und den Schutz meiner Art zu vertiefen.
Aufnahme von Klaus Sanwald
Mein Leben beginnt als Ei, das an Pflanzen der Familie der Doldenblütler (Apiaceae) abgelegt wird. Nach dem Schlüpfen entwickle ich mich durch mehrere Larvenstadien, in denen ich mich von den Blättern meiner Wirtspflanzen ernähre, typischerweise von Fenchel, Möhren oder Dill. Während dieser Phase bin ich anfällig für Prädatoren, weshalb meine auffällige Warnfärbung eine Rolle spielt, um Feinde abzuschrecken.
Nachdem ich mich verpuppt habe, verbringe ich einige Zeit als Puppe, während mein Körper umgestaltet wird und meine Flügel ihre endgültige Form annehmen. Als fertiger Schmetterling trage ich eine Mischung aus gelben, schwarzen und blauen Farben auf meinen Flügeln, die nicht nur schön anzusehen sind, sondern auch meiner Art helfen, sich zu reproduzieren und zu überleben.
Mein Leben als erwachsener Schwalbenschwanz ist von kurzen, aber intensiven Flugphasen geprägt, während derer ich auf Nektarsuche bin und oft weite Strecken zurücklege, um geeignete Nahrungsquellen zu finden. Meine Flugweise ist elegant und oft von schnellen, zickzackförmigen Bewegungen geprägt, die es mir ermöglichen, mich geschickt vor potenziellen Fressfeinden zu schützen.
Insgesamt bin ich als Schmetterling ein faszinierendes Beispiel für die Schönheit und Anpassungsfähigkeit der Natur, deren Lebenszyklus und Verhalten durch eine Vielzahl von wissenschaftlichen Studien und Beobachtungen untersucht wurden, um das Verständnis für die ökologische Rolle und den Schutz meiner Art zu vertiefen.
Aufnahme von Klaus Sanwald
- Einer unserer schönsten Falter ( auch im Raupenstadium farbschön ) ist der Schwalbenschwanz.
Artenschutz in Franken®
Bald ausgesungen - Die Feldlerche (Alauda arvensis)

Feldlerche (Alauda arvensis)
02/03.09.2024
Ich bin eine kleine Singvogelart, die in offenen Landschaften wie Feldern, Wiesen und Brachland lebt. Mein Gefieder ist bräunlich mit dunklen Flecken und ich zeichne mich besonders durch meinen melodischen Gesang aus, den ich während des Fluges oder von erhöhten Positionen aus vortrage, um mein Revier zu markieren und nach Partnern zu rufen.
02/03.09.2024
- Als Feldlerche, wissenschaftlich bekannt als Alauda arvensis, kann ich dir eine Perspektive auf mein Leben und die Herausforderungen geben, denen ich gegenüberstehe.
Ich bin eine kleine Singvogelart, die in offenen Landschaften wie Feldern, Wiesen und Brachland lebt. Mein Gefieder ist bräunlich mit dunklen Flecken und ich zeichne mich besonders durch meinen melodischen Gesang aus, den ich während des Fluges oder von erhöhten Positionen aus vortrage, um mein Revier zu markieren und nach Partnern zu rufen.
In den letzten Jahrzehnten habe ich jedoch starke Bestandseinbußen erlebt, hauptsächlich aufgrund der intensiven Veränderungen in der landwirtschaftlichen Praxis. Moderne landwirtschaftliche Methoden wie der vermehrte Einsatz von Pestiziden, die Umwandlung von Wiesen in Ackerland und der Einsatz schwerer Maschinen während der Brutzeit haben meine Lebensräume stark dezimiert. Diese Veränderungen führen dazu, dass ich immer weniger geeignete Orte finde, um zu brüten und Nahrung zu suchen.
Die Bedrohung durch den Verlust von Lebensraum ist besonders akut in intensiv genutzten Agrarlandschaften, wo naturnahe Flächen zunehmend selten werden. Darüber hinaus sind auch der Klimawandel und die damit verbundenen Veränderungen in der Vegetationsstruktur meiner Heimatländer bedeutende Faktoren, die sich negativ auf meine Population auswirken.
Trotz der Bestrebungen von Naturschützern und Umweltorganisationen, meine Population zu stabilisieren, bleibt mein Bestandsstatus besorgniserregend. Es bedarf daher dringender Maßnahmen, um meine Lebensräume zu schützen und wiederherzustellen, sowie um die landwirtschaftlichen Praktiken anzupassen, um auch meiner Art eine Zukunft in unseren veränderten Landschaften zu ermöglichen.
Aufnahme von Werner Oppermann
Die Bedrohung durch den Verlust von Lebensraum ist besonders akut in intensiv genutzten Agrarlandschaften, wo naturnahe Flächen zunehmend selten werden. Darüber hinaus sind auch der Klimawandel und die damit verbundenen Veränderungen in der Vegetationsstruktur meiner Heimatländer bedeutende Faktoren, die sich negativ auf meine Population auswirken.
Trotz der Bestrebungen von Naturschützern und Umweltorganisationen, meine Population zu stabilisieren, bleibt mein Bestandsstatus besorgniserregend. Es bedarf daher dringender Maßnahmen, um meine Lebensräume zu schützen und wiederherzustellen, sowie um die landwirtschaftlichen Praktiken anzupassen, um auch meiner Art eine Zukunft in unseren veränderten Landschaften zu ermöglichen.
Aufnahme von Werner Oppermann
- Die Feldlerche ist in Bayern gefährdet, ursächlich für deren Niedergang sind auch die Intensivierung der Landwirtschaft durch eine starke Düngung der Lebensräumung,eine zu häufige Mahd, sowie weiteren intensiven Bearbeitungsschritten in der Landwirtschaft und nicht zu vergessen der Einsatz von Bioziden. Einhergehend mit der zunehmenden Versiegelung unserer Landschaft und dem Erlöschen der Insektenbestände verlieren wir zunehmend die Feldlerche. Auch wollen wir nicht vergessen auf die gravierenden Verluste hinzuweisen welche die Feldlerche auf ihrem Zug in die Winterquartiere durch den unsäglichen Vogelfang erfährt.
Artenschutz in Franken®
Stele der Biodiversität® - Stegaurach
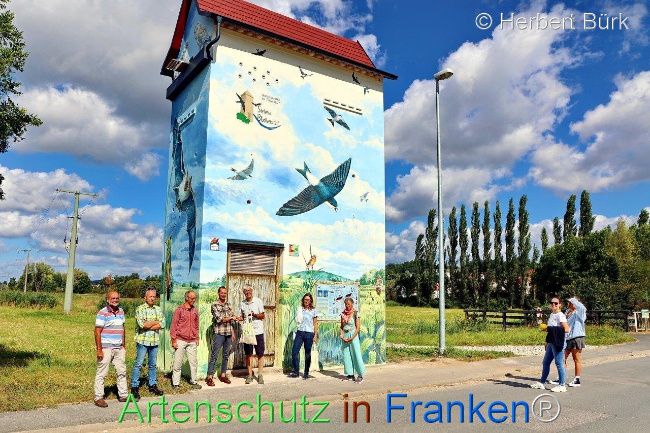
Stele der Biodiversität® - Stegaurach
01/02.09.2024
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.
Stegaurach / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
01/02.09.2024
- Offizielle Projekteröffung - Stele der Biodiversität®
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.
Stegaurach / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
Denn wenn (selbst in noch geeigneten Nahrungsstrukturen) keine geeigneten Reproduktionsräume vorhanden sind, ist die Erhaltung der Artenvielfalt gelichfalls zum Scheitern verurteilt.
Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird., setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.
In der Aufnahme
Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird., setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.
In der Aufnahme
- Am 21.08.2024 wurde die Stele im Beisein regionaler Medien offiziell ihrer Funktion übergeben ...
Artenschutz in Franken®
Der Neuntöter (Lanius collurio)

Neuntöter (Lanius collurio)
01/02.09.2024
Hier sind einige interessante Fakten über diese Art:
Der Neuntöter gehört zur Familie der Würger (Laniidae) und zur Ordnung der Sperlingsvögel (Passeriformes).Neuntöter sind Zugvögel und verbringen den Winter in Afrika südlich der Sahara. Im Sommer brüten sie in offenen Landschaften wie Heiden, Buschland, Wiesen und Weiden mit isolierten Bäumen oder Büschen.
01/02.09.2024
- Der Neuntöter (Lanius collurio) ist ein faszinierender Singvogel, der in Europa, Teilen Asiens und Nordafrikas verbreitet ist.
Hier sind einige interessante Fakten über diese Art:
Der Neuntöter gehört zur Familie der Würger (Laniidae) und zur Ordnung der Sperlingsvögel (Passeriformes).Neuntöter sind Zugvögel und verbringen den Winter in Afrika südlich der Sahara. Im Sommer brüten sie in offenen Landschaften wie Heiden, Buschland, Wiesen und Weiden mit isolierten Bäumen oder Büschen.
Männliche Neuntöter haben ein auffälliges Gefieder mit einem grauen Kopf, einem schwarzen Augenstreif und einem rostbraunen Rücken. Die Weibchen sind weniger kontrastreich gefärbt und haben eine braun gestreifte Unterseite. Neuntöter sind Fleischfresser und ernähren sich hauptsächlich von Insekten wie Käfern, Heuschrecken, Schmetterlingen und Spinnen. Sie jagen von Ansitzwarten aus und stoßen dann blitzschnell auf ihre Beute zu.
Während der Brutzeit verteidigen Neuntöter aggressiv ihr Territorium. Sie bauen ihre Nester in dornigen Büschen oder Bäumen und legen gewöhnlich vier bis sechs Eier.Neuntöter sind dafür bekannt, ihre Beute auf Dornen oder Stacheldraht zu spießen. Dieses Verhalten dient dazu, die Nahrung zu lagern, indem sie sie für später verzehren. Sie werden daher auch manchmal als "Fleischräuber" bezeichnet.
In einigen Teilen Europas, insbesondere in Großbritannien, ist der Bestand des Neuntöters rückläufig. Dies ist auf Lebensraumverlust durch intensive Landwirtschaft, Pestizideinsatz und Verlust von Brutplätzen zurückzuführen. In anderen Regionen, wie zum Beispiel in Teilen von Osteuropa, ist der Neuntöter jedoch häufiger anzutreffen.
Diese Informationen geben einen Einblick in das faszinierende Leben und Verhalten des Neuntöters, eines bemerkenswerten Singvogels mit einer Vielzahl von Anpassungen an seine Umwelt.
In der Aufnahme von Rolf Thiemann
Während der Brutzeit verteidigen Neuntöter aggressiv ihr Territorium. Sie bauen ihre Nester in dornigen Büschen oder Bäumen und legen gewöhnlich vier bis sechs Eier.Neuntöter sind dafür bekannt, ihre Beute auf Dornen oder Stacheldraht zu spießen. Dieses Verhalten dient dazu, die Nahrung zu lagern, indem sie sie für später verzehren. Sie werden daher auch manchmal als "Fleischräuber" bezeichnet.
In einigen Teilen Europas, insbesondere in Großbritannien, ist der Bestand des Neuntöters rückläufig. Dies ist auf Lebensraumverlust durch intensive Landwirtschaft, Pestizideinsatz und Verlust von Brutplätzen zurückzuführen. In anderen Regionen, wie zum Beispiel in Teilen von Osteuropa, ist der Neuntöter jedoch häufiger anzutreffen.
Diese Informationen geben einen Einblick in das faszinierende Leben und Verhalten des Neuntöters, eines bemerkenswerten Singvogels mit einer Vielzahl von Anpassungen an seine Umwelt.
In der Aufnahme von Rolf Thiemann
- Neuntöter Jungtier
Artenschutz in Franken®
Stele der Biodiversität® - Burgwindheim / Kötsch
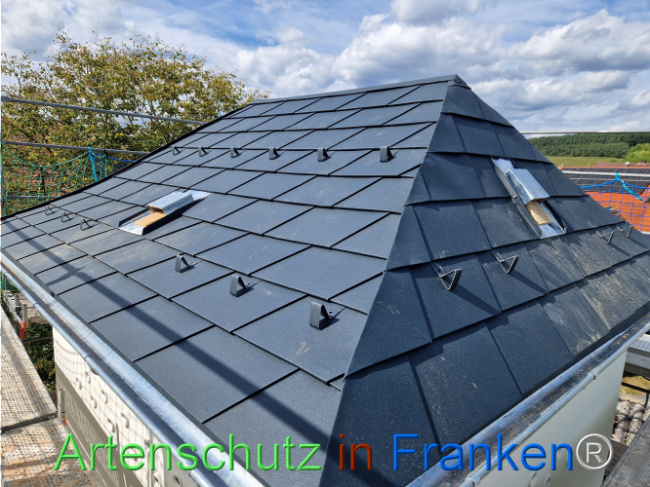
Stele der Biodiversität® - Burgwindheim / Kötsch
01/02.09.2024
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das vom Markt Burgwindheim, dem Bayernwerk der Deutschen Postcode Lotterie und der Steuerkanzlei Bauerfeind unterstützt wird.
Kötsch / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen.
Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
01/02.09.2024
- Montage der Dachhaut abgeschlossen
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das vom Markt Burgwindheim, dem Bayernwerk der Deutschen Postcode Lotterie und der Steuerkanzlei Bauerfeind unterstützt wird.
Kötsch / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen.
Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
Denn wenn (selbst in noch geeigneten Nahrungsstrukturen) keine geeigneten Reproduktionsräume vorhanden sind, ist die Erhaltung der Artenvielfalt gelichfalls zum Scheitern verurteilt.
Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das vom Markt Burgwindheim, dem Bayernwerk der Deutschen Postcode Lotterie und der Steuerkanzlei Bauerfeind unterstützt wird, setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.
In der Aufnahme
Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das vom Markt Burgwindheim, dem Bayernwerk der Deutschen Postcode Lotterie und der Steuerkanzlei Bauerfeind unterstützt wird, setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.
In der Aufnahme
- Am 21.08.2024 fand sich der Abschluss der Dachhautmontage, in die auch spezielle Fledermauseinflüge eingebracht wurden ...
Artenschutz in Franken®
Die Rothalsgans (Branta ruficollis)

Rothalsgans (Branta ruficollis)
31.08/01.09.2024
Meine Art gehört zur Familie der Entenvögel (Anatidae), und ich bin eine der kleineren Gänsearten, mit einer Körperlänge von etwa 53 bis 56 Zentimetern und einem Gewicht von 1 bis 1,5 Kilogramm.
31.08/01.09.2024
- Als Rothalsgans (Branta ruficollis) bin ich eine auffällige und farbenprächtige Gans, die vor allem durch meinen leuchtend roten Halsbereich, der mir auch meinen Namen gegeben hat, leicht zu erkennen ist.
Meine Art gehört zur Familie der Entenvögel (Anatidae), und ich bin eine der kleineren Gänsearten, mit einer Körperlänge von etwa 53 bis 56 Zentimetern und einem Gewicht von 1 bis 1,5 Kilogramm.
Meine Heimat ist die arktische Tundra Sibiriens, wo ich während des kurzen, aber intensiven Sommers brüte. Hier, in den unwirtlichen Weiten, baue ich mein Nest oft in der Nähe von Raubvogelhorsten, wie denen des Wanderfalken oder der Raubmöwe. Diese ungewöhnliche Strategie bietet mir Schutz, denn die Raubvögel halten potentielle Fressfeinde wie den Polarfuchs fern. Mein Nest besteht aus Pflanzenteilen und Daunen, die meine Eier warm halten, während ich sie bebrüte.
Mein Lebenszyklus ist stark von den Jahreszeiten geprägt. Im Frühjahr, nach einer langen und kräftezehrenden Migration, die oft Tausende von Kilometern umfasst, erreiche ich die Brutgebiete. Während des Sommers ziehe ich meinen Nachwuchs groß, und sobald die Jungen flügge sind, beginnt die Rückreise in die Überwinterungsgebiete. Ich verbringe den Winter hauptsächlich in den wärmeren Regionen entlang des Schwarzen Meeres, vor allem in Bulgarien, Rumänien und der Ukraine.
Während meiner Reise bilde ich oft große Schwärme mit anderen Gänsen, was uns Schutz vor Raubtieren bietet und die Navigation erleichtert. Mein Sozialverhalten ist stark ausgeprägt, und ich halte enge familiäre Bindungen. Wir kommunizieren ständig durch verschiedene Rufe, die uns helfen, in den oft riesigen Schwärmen zusammenzubleiben.
Ökologisch spiele ich eine wichtige Rolle, sowohl in meinen Brutgebieten als auch in den Überwinterungsgebieten. Als Pflanzenfresser beeinflusse ich die Vegetation, indem ich Gräser, Kräuter und Sämereien fresse. Gleichzeitig bin ich ein wichtiger Bestandteil des Nahrungssystems und diene verschiedenen Raubtieren als Beute.
Leider bin ich auch stark von menschlichen Aktivitäten betroffen. Veränderungen in meinem Lebensraum durch Landnutzung, Klimawandel und Jagd gefährden meine Population. Schutzmaßnahmen, wie die Einrichtung von Naturschutzgebieten und internationale Abkommen, sind entscheidend für mein Überleben.
Insgesamt bin ich als Rothalsgans ein Vogel, der durch seine Anpassungsfähigkeit und die Schönheit meines Gefieders besticht. Mein Leben ist eng mit den natürlichen Rhythmen der Erde verbunden, und ich bin stolz darauf, ein Symbol für die Wildnis und die ökologischen Zusammenhänge zu sein, die unseren Planeten prägen.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
Mein Lebenszyklus ist stark von den Jahreszeiten geprägt. Im Frühjahr, nach einer langen und kräftezehrenden Migration, die oft Tausende von Kilometern umfasst, erreiche ich die Brutgebiete. Während des Sommers ziehe ich meinen Nachwuchs groß, und sobald die Jungen flügge sind, beginnt die Rückreise in die Überwinterungsgebiete. Ich verbringe den Winter hauptsächlich in den wärmeren Regionen entlang des Schwarzen Meeres, vor allem in Bulgarien, Rumänien und der Ukraine.
Während meiner Reise bilde ich oft große Schwärme mit anderen Gänsen, was uns Schutz vor Raubtieren bietet und die Navigation erleichtert. Mein Sozialverhalten ist stark ausgeprägt, und ich halte enge familiäre Bindungen. Wir kommunizieren ständig durch verschiedene Rufe, die uns helfen, in den oft riesigen Schwärmen zusammenzubleiben.
Ökologisch spiele ich eine wichtige Rolle, sowohl in meinen Brutgebieten als auch in den Überwinterungsgebieten. Als Pflanzenfresser beeinflusse ich die Vegetation, indem ich Gräser, Kräuter und Sämereien fresse. Gleichzeitig bin ich ein wichtiger Bestandteil des Nahrungssystems und diene verschiedenen Raubtieren als Beute.
Leider bin ich auch stark von menschlichen Aktivitäten betroffen. Veränderungen in meinem Lebensraum durch Landnutzung, Klimawandel und Jagd gefährden meine Population. Schutzmaßnahmen, wie die Einrichtung von Naturschutzgebieten und internationale Abkommen, sind entscheidend für mein Überleben.
Insgesamt bin ich als Rothalsgans ein Vogel, der durch seine Anpassungsfähigkeit und die Schönheit meines Gefieders besticht. Mein Leben ist eng mit den natürlichen Rhythmen der Erde verbunden, und ich bin stolz darauf, ein Symbol für die Wildnis und die ökologischen Zusammenhänge zu sein, die unseren Planeten prägen.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
- Rothalsgans (Branta ruficollis)
Artenschutz in Franken®
Stele der Biodiversität® - Stegaurach / Dellern

Stele der Biodiversität® - Stegaurach / Dellern
31.08/01.09.2024
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.
Stegaurach / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
31.08/01.09.2024
- Die grafische Gestaltung ... Stimmungen an der Stele der Biodiversität®
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.
Stegaurach / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
Denn wenn (selbst in noch geeigneten Nahrungsstrukturen) keine geeigneten Reproduktionsräume vorhanden sind, ist die Erhaltung der Artenvielfalt gelichfalls zum Scheitern verurteilt.
Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird., setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.
In der Aufnahme
Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird., setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.
In der Aufnahme
- Am 19.08.2024 wurde der Baukörper vom Montage- und Schutzgerüst befreit und zeigte sich uns in dieser Form ... nun sind noch die grafischen Bodenarbeiten abzuleisten ...
Artenschutz in Franken®
Die Gammaeule (Autographa gamma)

Gammaeule (Autographa gamma)
30/31.08.2024
Als Vertreterin dieser Familie bin ich eine mittelgroße Motte mit einer Flügelspannweite von etwa 30 bis 40 Millimetern. Mein Körper und meine Flügel sind von einer variablen Musterung geprägt, die mir hilft, mich in unterschiedlichen Umgebungen zu tarnen und vor Feinden zu schützen.
30/31.08.2024
- Die Gammaeule (Autographa gamma) ist eine faszinierende Spezies, die zur Familie der Eulenfalter (Noctuidae) gehört.
Als Vertreterin dieser Familie bin ich eine mittelgroße Motte mit einer Flügelspannweite von etwa 30 bis 40 Millimetern. Mein Körper und meine Flügel sind von einer variablen Musterung geprägt, die mir hilft, mich in unterschiedlichen Umgebungen zu tarnen und vor Feinden zu schützen.
Mein Lebenszyklus beginnt als Ei, das ich auf Pflanzenblättern ablege, die für meine Raupen als Nahrung dienen. Als Raupe durchlaufe ich mehrere Häutungen, um zu wachsen, und ernähre mich dabei von einer Vielzahl von Pflanzen, einschließlich Brennnesseln, Disteln und anderen krautigen Gewächsen. Während dieser Phase bin ich anfällig für Fressfeinde wie Vögel und andere Insekten, weshalb ich mich oft versteckt halte oder mich durch warnende Farbmuster verteidige, die potenzielle Angreifer abschrecken sollen.
Sobald ich mich verpuppe, durchlaufe ich eine Phase der Metamorphose, in der mein Körper umstrukturiert wird, um schließlich als erwachsener Falter hervorzugehen. Als Falter habe ich eine kurze Lebensspanne, die oft nur wenige Wochen beträgt. In dieser Zeit konzentriere ich mich auf die Fortpflanzung, um den Fortbestand meiner Art zu sichern. Meine Flügel dienen nicht nur dem Fliegen, sondern sind auch mit Duftstoffen und visuellen Signalen ausgestattet, die bei der Partnerfindung eine Rolle spielen.
Ökologisch betrachtet spiele ich eine wichtige Rolle im Nahrungsnetzwerk. Als Raupe beeinflusse ich durch mein Fressverhalten das Pflanzenwachstum und als Falter diene ich vielen Tieren als Nahrungsquelle. Gleichzeitig bin ich auch von Umweltfaktoren wie Temperatur und Tageslicht abhängig, die meinen Lebenszyklus stark beeinflussen können.
Insgesamt bin ich als Gammaeule ein vielseitiges und anpassungsfähiges Insekt, das in verschiedenen Lebensräumen von städtischen Gärten bis hin zu ländlichen Feldern zu finden ist. Meine Existenz ist eng mit der Natur verbunden, und meine Lebensweise ist ein faszinierendes Beispiel für die Anpassungsfähigkeit und die biologischen Mechanismen der Natur.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
Sobald ich mich verpuppe, durchlaufe ich eine Phase der Metamorphose, in der mein Körper umstrukturiert wird, um schließlich als erwachsener Falter hervorzugehen. Als Falter habe ich eine kurze Lebensspanne, die oft nur wenige Wochen beträgt. In dieser Zeit konzentriere ich mich auf die Fortpflanzung, um den Fortbestand meiner Art zu sichern. Meine Flügel dienen nicht nur dem Fliegen, sondern sind auch mit Duftstoffen und visuellen Signalen ausgestattet, die bei der Partnerfindung eine Rolle spielen.
Ökologisch betrachtet spiele ich eine wichtige Rolle im Nahrungsnetzwerk. Als Raupe beeinflusse ich durch mein Fressverhalten das Pflanzenwachstum und als Falter diene ich vielen Tieren als Nahrungsquelle. Gleichzeitig bin ich auch von Umweltfaktoren wie Temperatur und Tageslicht abhängig, die meinen Lebenszyklus stark beeinflussen können.
Insgesamt bin ich als Gammaeule ein vielseitiges und anpassungsfähiges Insekt, das in verschiedenen Lebensräumen von städtischen Gärten bis hin zu ländlichen Feldern zu finden ist. Meine Existenz ist eng mit der Natur verbunden, und meine Lebensweise ist ein faszinierendes Beispiel für die Anpassungsfähigkeit und die biologischen Mechanismen der Natur.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
- Gammaeule (Autographa gamma)
Artenschutz in Franken®
Stele der Biodiversität® - Stegaurach / Dellern

Stele der Biodiversität® - Stegaurach / Dellern
30/31.08.2024
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.
Stegaurach / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
30/31.08.2024
- Die grafische Gestaltung ... Stimmungen an der Stele der Biodiversität®
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.
Stegaurach / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
Denn wenn (selbst in noch geeigneten Nahrungsstrukturen) keine geeigneten Reproduktionsräume vorhanden sind, ist die Erhaltung der Artenvielfalt gelichfalls zum Scheitern verurteilt.
Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird., setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.
In der Aufnahme
Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird., setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.
In der Aufnahme
- Eindrücke vom 17.08.2024 ... Einstreueingabe in die TF Nisthilfe ...
Artenschutz in Franken®
Der Hirtenregenpfeifer (Charadrius pecuarius)

Hirtenregenpfeifer (Charadrius pecuarius)
29/30.08.2024
Als solcher möchte ich dir aus meiner eigenen Perspektive als Hirtenregenpfeifer über meine Art berichten.
29/30.08.2024
- Der Hirtenregenpfeifer (Charadrius pecuarius) ist eine faszinierende Vogelart, die in den offenen Landschaften auch Südarfikas beheimatet ist.
Als solcher möchte ich dir aus meiner eigenen Perspektive als Hirtenregenpfeifer über meine Art berichten.
Als Mitglied der Familie der Regenpfeifer (Charadriidae) bin ich spezialisiert auf das Leben in offenen Graslandschaften und Feuchtgebieten, wo ich nach Nahrung suche und brüte. Unser charakteristisches Aussehen umfasst ein Gefieder mit verschiedenen Braun- und Grautönen, das uns gut an unsere Lebensräume anpasst und uns hilft, uns vor Raubtieren zu tarnen.
Unsere Lebensweise ist stark von den saisonalen Regenfällen und den damit verbundenen Veränderungen der Wasservorkommen geprägt. Während der Trockenzeit konzentrieren wir uns auf die Suche nach Insekten und anderen kleinen wirbellosen Tieren, die wir auf dem Boden finden. In der Regenzeit ändern sich unsere Aktivitäten, da sich die Wasserstände erhöhen und wir in der Nähe von Flüssen und temporären Seen nach Nahrung suchen.
Unsere Fortpflanzungsstrategie ist ebenfalls an diese Umweltbedingungen angepasst. Wir bauen unsere Nester oft in flachen Mulden auf dem Boden, meist gut getarnt zwischen Grasbüscheln oder Steinen. Diese Nester sind einfach, aber effektiv, um unsere Eier vor den Augen von Raubtieren zu schützen, die in unseren Lebensräumen ebenfalls vorkommen.
In Bezug auf die Ökologie spielen wir eine wichtige Rolle im Nahrungsnetz, indem wir Insektenpopulationen kontrollieren und als Beute für größere Raubtiere dienen. Unsere Anpassungsfähigkeit an die saisonalen Veränderungen in unseren Lebensräumen ermöglicht es uns, auch in einem oft unberechenbaren Umfeld erfolgreich zu sein.
Als Hirtenregenpfeifer habe ich gelernt, wie wichtig es ist, unsere natürlichen Lebensräume zu schützen. Die zunehmende Umwandlung von Grasland in landwirtschaftlich genutzte Flächen und andere menschliche Aktivitäten bedrohen jedoch unsere Populationen. Der Schutz unserer Brutgebiete und die Erhaltung der Wasserressourcen sind entscheidend für unser Überleben als Art.
Zusammengefasst können wir Hirtenregenpfeifer als anpassungsfähige Vögel betrachten, die eng mit den saisonalen Regenfällen und den damit verbundenen Umweltbedingungen interagieren. Unsere Lebensweise, Fortpflanzungsstrategie und ökologische Rolle machen uns zu einem faszinierenden Beispiel für die Vielfalt und Anpassungsfähigkeit der Natur.
Aufnahme von Klaus Sanwald
Unsere Lebensweise ist stark von den saisonalen Regenfällen und den damit verbundenen Veränderungen der Wasservorkommen geprägt. Während der Trockenzeit konzentrieren wir uns auf die Suche nach Insekten und anderen kleinen wirbellosen Tieren, die wir auf dem Boden finden. In der Regenzeit ändern sich unsere Aktivitäten, da sich die Wasserstände erhöhen und wir in der Nähe von Flüssen und temporären Seen nach Nahrung suchen.
Unsere Fortpflanzungsstrategie ist ebenfalls an diese Umweltbedingungen angepasst. Wir bauen unsere Nester oft in flachen Mulden auf dem Boden, meist gut getarnt zwischen Grasbüscheln oder Steinen. Diese Nester sind einfach, aber effektiv, um unsere Eier vor den Augen von Raubtieren zu schützen, die in unseren Lebensräumen ebenfalls vorkommen.
In Bezug auf die Ökologie spielen wir eine wichtige Rolle im Nahrungsnetz, indem wir Insektenpopulationen kontrollieren und als Beute für größere Raubtiere dienen. Unsere Anpassungsfähigkeit an die saisonalen Veränderungen in unseren Lebensräumen ermöglicht es uns, auch in einem oft unberechenbaren Umfeld erfolgreich zu sein.
Als Hirtenregenpfeifer habe ich gelernt, wie wichtig es ist, unsere natürlichen Lebensräume zu schützen. Die zunehmende Umwandlung von Grasland in landwirtschaftlich genutzte Flächen und andere menschliche Aktivitäten bedrohen jedoch unsere Populationen. Der Schutz unserer Brutgebiete und die Erhaltung der Wasserressourcen sind entscheidend für unser Überleben als Art.
Zusammengefasst können wir Hirtenregenpfeifer als anpassungsfähige Vögel betrachten, die eng mit den saisonalen Regenfällen und den damit verbundenen Umweltbedingungen interagieren. Unsere Lebensweise, Fortpflanzungsstrategie und ökologische Rolle machen uns zu einem faszinierenden Beispiel für die Vielfalt und Anpassungsfähigkeit der Natur.
Aufnahme von Klaus Sanwald
- Junger Hirtenregenpfeifer (Charadrius pecuarius)
Artenschutz in Franken®
Manure meets butterfly – Gülle trifft Schmetterling

Manure meets butterfly – Gülle trifft Schmetterling
29/30.08.2024
Gestern fuhren wir an einem Feld vorbei, auf dem gerade Gülle ausgebracht wurde. Es roch sehr unangenehm! Als wir heute wieder dort vorbeikamen, staunten wir nicht schlecht. An einigen Stellen flogen hunderte weiße Schmetterlinge (Kleiner Kohlweißling -Pieris rapae) zusammen und gingen auf dem Acker nieder.
Wir sahen uns das Geschehen aus der Nähe an.
29/30.08.2024
- Ein Situationsbericht von Rolf Thiemann
Gestern fuhren wir an einem Feld vorbei, auf dem gerade Gülle ausgebracht wurde. Es roch sehr unangenehm! Als wir heute wieder dort vorbeikamen, staunten wir nicht schlecht. An einigen Stellen flogen hunderte weiße Schmetterlinge (Kleiner Kohlweißling -Pieris rapae) zusammen und gingen auf dem Acker nieder.
Wir sahen uns das Geschehen aus der Nähe an.
Etliche Weißlinge saßen auf der Gülle und steckten ihren langen Rüssel hinein. So etwas habe ich schon an Schlammwasser-Pfützen gesehen, wo die Tiere Mineralien aufnehmen.
Dass die Schmetterlinge auf Gülle sitzen war uns neu.
Die Gülle besteht aus einer Mischung aus Kot und Harn von Nutztieren wie Rind, Schwein und Geflügel und besteht zum Teil aus Wasser, in dem sich gelöste Nährstoffe, organische Substanzen und Mineralstoffe befinden. Das in der Gülle auch Mineralien sind ist bekannt, aber was ist mit der Aufnahme von Antibiotika, Medikamentenresten und den resistenten Keimen (Bakterien), die mit aufgenommen werden?
In einer Studie waren von 19 Gülle-Proben 13 Proben mit Resistenzen gegen eine oder gleich mehrere Antibiotikagruppen gefunden worden.
Das wäre doch mal eine Untersuchung wert, was das für Auswirkungen auf die Population von Schmetterlingen hat oder?
Vor allem auch auf deren Prädatoren.
In der Aufnahme
Quelle / Aufnahmen
Rolf Thiemann
Gewässer und Naturschutz im Erftkreis
Flora-Fauna-Artenschutz
Naturschutzökologie
Naturschutzberater
50181 Bedburg
www. Naturschutzberater.de
Projekte:
www. Eisvogelschutz-Deutschland.de
www. Naturtreff-Bedburg.de
Stand
18.08.2024
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung.Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Dass die Schmetterlinge auf Gülle sitzen war uns neu.
Die Gülle besteht aus einer Mischung aus Kot und Harn von Nutztieren wie Rind, Schwein und Geflügel und besteht zum Teil aus Wasser, in dem sich gelöste Nährstoffe, organische Substanzen und Mineralstoffe befinden. Das in der Gülle auch Mineralien sind ist bekannt, aber was ist mit der Aufnahme von Antibiotika, Medikamentenresten und den resistenten Keimen (Bakterien), die mit aufgenommen werden?
In einer Studie waren von 19 Gülle-Proben 13 Proben mit Resistenzen gegen eine oder gleich mehrere Antibiotikagruppen gefunden worden.
Das wäre doch mal eine Untersuchung wert, was das für Auswirkungen auf die Population von Schmetterlingen hat oder?
Vor allem auch auf deren Prädatoren.
In der Aufnahme
- Kleine Kohlweißlinge in aufgebrachter Gülle
Quelle / Aufnahmen
Rolf Thiemann
Gewässer und Naturschutz im Erftkreis
Flora-Fauna-Artenschutz
Naturschutzökologie
Naturschutzberater
50181 Bedburg
www. Naturschutzberater.de
Projekte:
www. Eisvogelschutz-Deutschland.de
www. Naturtreff-Bedburg.de
Stand
18.08.2024
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung.Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Artenschutz in Franken®
Der Haussperling (Passer domesticus)

Der Haussperling (Passer domesticus)
28/29.08.2024
Der Haussperling, auch als Spatz bekannt, gehört zu den bekanntesten und am weitesten verbreiteten Vögeln weltweit. Sein wissenschaftlicher Name ist Passer domesticus, und er gehört zur Familie der Sperlinge (Passeridae).
Aufgrund seiner Anpassungsfähigkeit und Nähe zum menschlichen Lebensraum hat der Haussperling eine bedeutende Rolle sowohl in der Natur als auch in der Kulturgeschichte vieler Länder. Dieser Aufsatz beleuchtet verschiedene Aspekte des Haussperlings, einschließlich seiner Morphologie, Lebensweise, Fortpflanzung, Ernährung, ökologischen Rolle und kulturellen Bedeutung.
28/29.08.2024
- Ein Portrait zur Art:
Der Haussperling, auch als Spatz bekannt, gehört zu den bekanntesten und am weitesten verbreiteten Vögeln weltweit. Sein wissenschaftlicher Name ist Passer domesticus, und er gehört zur Familie der Sperlinge (Passeridae).
Aufgrund seiner Anpassungsfähigkeit und Nähe zum menschlichen Lebensraum hat der Haussperling eine bedeutende Rolle sowohl in der Natur als auch in der Kulturgeschichte vieler Länder. Dieser Aufsatz beleuchtet verschiedene Aspekte des Haussperlings, einschließlich seiner Morphologie, Lebensweise, Fortpflanzung, Ernährung, ökologischen Rolle und kulturellen Bedeutung.
Morphologie
Der Haussperling ist ein kleiner Vogel mit einer durchschnittlichen Körperlänge von etwa 14-16 cm und einem Gewicht von 24-39 Gramm. Es gibt einen deutlichen Geschlechtsdimorphismus, das heißt, Männchen und Weibchen unterscheiden sich im Aussehen.
Der Haussperling hat einen kräftigen, kegelförmigen Schnabel, der hervorragend zum Knacken von Samen geeignet ist. Seine Beine und Füße sind kräftig und ermöglichen ihm ein geschicktes Klettern und Landen in dichtem Gebüsch oder Gebäudestrukturen.
Lebensraum und Verbreitung
Der Haussperling ist nahezu weltweit verbreitet, außer in extrem kalten oder dichten Regenwaldgebieten. Ursprünglich aus Eurasien stammend, wurde er durch den Menschen in viele Teile der Welt eingeführt, darunter Nordamerika, Australien, Neuseeland und Südamerika. Er bevorzugt urbane und landwirtschaftliche Umgebungen und ist oft in der Nähe menschlicher Siedlungen zu finden, wo er Nistplätze und Nahrungsquellen leicht findet.
Fortpflanzung
Die Fortpflanzungszeit des Haussperlings variiert je nach geografischer Lage, beginnt aber in der Regel im Frühling. Sie kann mehrere Gelege pro Jahr umfassen, besonders in warmen Klimazonen.
Ernährung
Der Haussperling ist ein Allesfresser mit einer Präferenz für Samen und Getreide, was ihn zu einem häufigen Besucher von landwirtschaftlichen Flächen macht. Er passt seine Ernährung jedoch flexibel an die verfügbaren Nahrungsquellen an und frisst auch Insekten, besonders während der Brutzeit, um den Proteinbedarf der Jungvögel zu decken. In städtischen Gebieten ernähren sich Haussperlinge oft von Essensresten und Abfällen.
Verhalten und Lebensweise
Haussperlinge sind gesellige Vögel, die oft in Schwärmen anzutreffen sind. Sie zeigen ein komplexes soziales Verhalten und kommunizieren durch verschiedene Rufe und Körperhaltungen. Ihr Zwitschern ist ein vertrauter Klang in vielen Städten und Dörfern.
Ökologische Rolle
Haussperlinge spielen eine bedeutende Rolle in ihren Ökosystemen. Als Insektenfresser helfen sie bei der Kontrolle von Schädlingen, und als Samenfresser tragen sie zur Verbreitung von Pflanzen bei. Sie sind auch eine wichtige Nahrungsquelle für natürliche Beutegreifer und andere Fleischfresser.
Bedrohungen und Schutz
Trotz ihrer weiten Verbreitung haben Haussperlinge in einigen Regionen, besonders in Westeuropa, einen Rückgang erlebt. Ursachen hierfür sind unter anderem:
In vielen Ländern stehen Haussperlinge unter Schutz, und es gibt verschiedene Maßnahmen zur Förderung ihrer Population, wie das Anbringen von Nistkästen und die Bereitstellung von Futterstellen.
Kulturelle Bedeutung
Der Haussperling hat eine lange Geschichte der Interaktion mit Menschen. In vielen Kulturen symbolisiert er Häuslichkeit und Geselligkeit. Er wird in Volksliedern, Gedichten und Literatur erwähnt und ist in vielen Regionen ein vertrauter Bestandteil des täglichen Lebens. In der Bibel und anderen religiösen Texten wird der Spatz oft als Beispiel für Gottes Fürsorge und Aufmerksamkeit für die kleinen Dinge im Leben zitiert.
Schlussfolgerung
Der Haussperling ist ein bemerkenswerter Vogel, der durch seine Anpassungsfähigkeit und Nähe zum Menschen eine besondere Stellung einnimmt. Seine Rolle in der Natur als Samenverbreiter und Schädlingsbekämpfer, seine komplexe soziale Struktur und seine kulturelle Bedeutung machen ihn zu einem faszinierenden und wichtigen Teil unserer Umwelt. Der Schutz und die Förderung des Haussperlings sind nicht nur für die Erhaltung der Biodiversität wichtig, sondern auch für die Bewahrung einer jahrhundertealten Verbindung zwischen Mensch und Natur.
In der Aufnahme von Helga Zinnecker
Der Haussperling ist ein kleiner Vogel mit einer durchschnittlichen Körperlänge von etwa 14-16 cm und einem Gewicht von 24-39 Gramm. Es gibt einen deutlichen Geschlechtsdimorphismus, das heißt, Männchen und Weibchen unterscheiden sich im Aussehen.
- Männchen: Sie haben eine graue Kopfkappe, schwarze Kehle und Brust sowie eine kastanienbraune Nackenpartie. Die Flügel sind braun mit schwarzen Streifen und weißen Flügelbinden.
- Weibchen: Sie sind eher unscheinbar gefärbt mit einem bräunlich-grauen Gefieder, einem helleren Überaugenstreif und weniger auffälligen Flügelbinden.
Der Haussperling hat einen kräftigen, kegelförmigen Schnabel, der hervorragend zum Knacken von Samen geeignet ist. Seine Beine und Füße sind kräftig und ermöglichen ihm ein geschicktes Klettern und Landen in dichtem Gebüsch oder Gebäudestrukturen.
Lebensraum und Verbreitung
Der Haussperling ist nahezu weltweit verbreitet, außer in extrem kalten oder dichten Regenwaldgebieten. Ursprünglich aus Eurasien stammend, wurde er durch den Menschen in viele Teile der Welt eingeführt, darunter Nordamerika, Australien, Neuseeland und Südamerika. Er bevorzugt urbane und landwirtschaftliche Umgebungen und ist oft in der Nähe menschlicher Siedlungen zu finden, wo er Nistplätze und Nahrungsquellen leicht findet.
Fortpflanzung
Die Fortpflanzungszeit des Haussperlings variiert je nach geografischer Lage, beginnt aber in der Regel im Frühling. Sie kann mehrere Gelege pro Jahr umfassen, besonders in warmen Klimazonen.
- Nestbau: Die Nester werden in Höhlen, Gebäudespalten, unter Dachvorsprüngen oder in dichten Hecken gebaut. Beide Geschlechter beteiligen sich am Bau des Nests, das aus Gras, Stroh und Federn besteht.
- Eier und Brutpflege: Ein Gelege besteht meist aus 3-7 Eiern, die etwa 10-14 Tage lang bebrütet werden. Die Jungvögel schlüpfen nackt und blind und sind vollständig auf die elterliche Fürsorge angewiesen. Beide Elternteile füttern die Nestlinge, die nach etwa zwei Wochen flügge werden.
Ernährung
Der Haussperling ist ein Allesfresser mit einer Präferenz für Samen und Getreide, was ihn zu einem häufigen Besucher von landwirtschaftlichen Flächen macht. Er passt seine Ernährung jedoch flexibel an die verfügbaren Nahrungsquellen an und frisst auch Insekten, besonders während der Brutzeit, um den Proteinbedarf der Jungvögel zu decken. In städtischen Gebieten ernähren sich Haussperlinge oft von Essensresten und Abfällen.
Verhalten und Lebensweise
Haussperlinge sind gesellige Vögel, die oft in Schwärmen anzutreffen sind. Sie zeigen ein komplexes soziales Verhalten und kommunizieren durch verschiedene Rufe und Körperhaltungen. Ihr Zwitschern ist ein vertrauter Klang in vielen Städten und Dörfern.
- Territorialverhalten: Während der Brutzeit verteidigen Männchen energisch ihre Nistplätze gegen Eindringlinge.
- Körpersprache: Durch verschiedene Haltungen und Bewegungen kommunizieren sie soziale Hierarchien und Paarungsbereitschaft.
Ökologische Rolle
Haussperlinge spielen eine bedeutende Rolle in ihren Ökosystemen. Als Insektenfresser helfen sie bei der Kontrolle von Schädlingen, und als Samenfresser tragen sie zur Verbreitung von Pflanzen bei. Sie sind auch eine wichtige Nahrungsquelle für natürliche Beutegreifer und andere Fleischfresser.
Bedrohungen und Schutz
Trotz ihrer weiten Verbreitung haben Haussperlinge in einigen Regionen, besonders in Westeuropa, einen Rückgang erlebt. Ursachen hierfür sind unter anderem:
- Verlust von Lebensräumen: Urbanisierung und Veränderungen in der Landwirtschaft haben zu weniger geeigneten Nistplätzen und Nahrung geführt.
- Pestizide: Der Einsatz von Pestiziden reduziert das Insektenangebot, was besonders während der Brutzeit problematisch ist.
In vielen Ländern stehen Haussperlinge unter Schutz, und es gibt verschiedene Maßnahmen zur Förderung ihrer Population, wie das Anbringen von Nistkästen und die Bereitstellung von Futterstellen.
Kulturelle Bedeutung
Der Haussperling hat eine lange Geschichte der Interaktion mit Menschen. In vielen Kulturen symbolisiert er Häuslichkeit und Geselligkeit. Er wird in Volksliedern, Gedichten und Literatur erwähnt und ist in vielen Regionen ein vertrauter Bestandteil des täglichen Lebens. In der Bibel und anderen religiösen Texten wird der Spatz oft als Beispiel für Gottes Fürsorge und Aufmerksamkeit für die kleinen Dinge im Leben zitiert.
Schlussfolgerung
Der Haussperling ist ein bemerkenswerter Vogel, der durch seine Anpassungsfähigkeit und Nähe zum Menschen eine besondere Stellung einnimmt. Seine Rolle in der Natur als Samenverbreiter und Schädlingsbekämpfer, seine komplexe soziale Struktur und seine kulturelle Bedeutung machen ihn zu einem faszinierenden und wichtigen Teil unserer Umwelt. Der Schutz und die Förderung des Haussperlings sind nicht nur für die Erhaltung der Biodiversität wichtig, sondern auch für die Bewahrung einer jahrhundertealten Verbindung zwischen Mensch und Natur.
In der Aufnahme von Helga Zinnecker
- Haussperling - Weibchen
Artenschutz in Franken®
Überlebensräume für Zauneidechse & Co.

Überlebensräume für Zauneidechse & Co.
28/29.08.2024
Bayern. Mit der Neuanlage entsprechender Lebensraumkulissen bemühen wir uns einer möglichst breiten Artenvielfalt die benötigten Strukturen vorzuhalten, um in einer zunehmend vom Menschen geprägten und übernutzen Umwelt überdauern zu können.
28/29.08.2024
- Während an anderer Stelle Zauneidechse & Co. „dahingemulcht“ werden zeigen sich unserer Kooperationsprojekte als lebendige Überlebensräume in einer zunehmend monotonen Umwelt
Bayern. Mit der Neuanlage entsprechender Lebensraumkulissen bemühen wir uns einer möglichst breiten Artenvielfalt die benötigten Strukturen vorzuhalten, um in einer zunehmend vom Menschen geprägten und übernutzen Umwelt überdauern zu können.
Viele Tier- und Pflanzenarten leben bereits viele Millionen Jahre auf diesem Planeten. Der Spezies Mensch ist es nun tatsächlich gelungen diesen Lebensformen den Todesstoß zu versetzen indem sie entweder die Arten direkt oder deren Lebensräume eliminiert.
Der uns nachfolgenden Generation hinterlassen wir, wenn wir noch wenige Jahre so weitermachen wie bisher einen ausgeräumten und lebensfeindlichen Planeten. Der Ansatz zum Klimaschutz darf nicht zulasten der Biodiversität gehen, denn nur wenn beides stimmt, Klima und Artenvielfalt, können wir davon sprechen dass es uns gelungen ist, den Planeten Erde für unsere Kinder und Enkelkinder zu erhalten.
In Zusammenarbeit mit dem Betreiber einer Freiflächenfotovoltaikanlage konnten wir am 12. April 2024 mit der Anlage speziell für die Leitart Zauneidechse ausgerichteter Habitatstrukturen beginnen. In dieser Rubrik möchten wir Ihnen einige Eindrücke von der Gestaltung der Lebensraumanlage vermitteln. An einem sonnigen Tag wurden die ersten Arbeitsschritte generiert.
In der Aufnahme ... unseres Monitorings vom 17.08.2024 ...
- Leben und Tod nur wenige Meter voneinander getrennt ... während zahlreiche Grünflächen geschnitten oder wie hier dahingemulcht wurden, zeigt sich der von uns kooperativ Geschaffene Überlebensraum als höchst vital ...
Artenschutz in Franken®
Die Rötelmaus (Myodes glareolus)

Rötelmaus (Myodes glareolus)
27/28.08.2024
Rötelmäuse bevorzugen Laub- und Mischwälder sowie Wiesen mit dichtem Unterholz, da sie dort Nahrung finden und Verstecke bauen können. Sie sind nachtaktiv, was ihnen hilft, Raubtiere zu vermeiden, und sie haben eine hohe Fortpflanzungsrate, um ihre Population zu sichern.
27/28.08.2024
- Die Rötelmaus (Myodes glareolus) ist eine kleine Nagetierart, die in Europa und Teilen Asiens verbreitet ist. Aus ihrer Sicht betrachtet, ist ihr Lebensraum entscheidend.
Rötelmäuse bevorzugen Laub- und Mischwälder sowie Wiesen mit dichtem Unterholz, da sie dort Nahrung finden und Verstecke bauen können. Sie sind nachtaktiv, was ihnen hilft, Raubtiere zu vermeiden, und sie haben eine hohe Fortpflanzungsrate, um ihre Population zu sichern.
Die Ernährung der Rötelmaus besteht hauptsächlich aus Samen, Früchten, Beeren und Insekten. Sie sind Allesfresser und passen ihre Nahrung je nach Jahreszeit an. Dies ist wichtig, um genug Energie für den Winter zu speichern, wenn Nahrung knapp ist.
Sozial gesehen leben Rötelmäuse meist solitär, außerhalb der Paarungszeit, wenn sie territoriale Grenzen respektieren und sich gegenseitig bekämpfen können. Ihre Lebensweise ist stark vom Wetter und der Verfügbarkeit von Ressourcen abhängig, was ihre Fähigkeit zur Anpassung an Veränderungen in ihrem Lebensraum zeigt.
In ökologischer Hinsicht sind Rötelmäuse ein wichtiger Bestandteil des Nahrungsnetzes, da sie Beute für Raubtiere wie Eulen, Füchse und Schlangen darstellen. Gleichzeitig tragen sie zur Verbreitung von Samen und zur Auflockerung des Bodens bei, was die Biodiversität fördert.
Die Populationsdynamik der Rötelmaus wird stark von Umweltfaktoren wie Nahrungsverfügbarkeit, Wetterbedingungen und Prädationsdruck beeinflusst. Ihre kurze Lebensdauer und schnelle Fortpflanzungsrate ermöglichen es ihnen, sich rasch an veränderte Umweltbedingungen anzupassen, was ihre Überlebensfähigkeit in verschiedenen Ökosystemen sichert.
In der Aufnahme von Helga Zinnecker
Da sich diese Tiere auch gerne in menschlichen Gebäuden / Schuppen etc. ( Winterhalbjahr / Herbst ) aufhalten und hier ihre Hinterlassenschaften absetzen, ist bei der Reinigung dieser Bauwerke höchste Vorsicht ( trockener Kot bringt beim Reinigen / Kehren , Vieren in die Luft ( Aufwirbelungen ) und damit in die Atemwege des Menschen ) geboten! Kontakt zu den Fachstellen des Landkreises / Stadt ist angeraten. Hier werden weiterführende Informationen vermittelt.
Sozial gesehen leben Rötelmäuse meist solitär, außerhalb der Paarungszeit, wenn sie territoriale Grenzen respektieren und sich gegenseitig bekämpfen können. Ihre Lebensweise ist stark vom Wetter und der Verfügbarkeit von Ressourcen abhängig, was ihre Fähigkeit zur Anpassung an Veränderungen in ihrem Lebensraum zeigt.
In ökologischer Hinsicht sind Rötelmäuse ein wichtiger Bestandteil des Nahrungsnetzes, da sie Beute für Raubtiere wie Eulen, Füchse und Schlangen darstellen. Gleichzeitig tragen sie zur Verbreitung von Samen und zur Auflockerung des Bodens bei, was die Biodiversität fördert.
Die Populationsdynamik der Rötelmaus wird stark von Umweltfaktoren wie Nahrungsverfügbarkeit, Wetterbedingungen und Prädationsdruck beeinflusst. Ihre kurze Lebensdauer und schnelle Fortpflanzungsrate ermöglichen es ihnen, sich rasch an veränderte Umweltbedingungen anzupassen, was ihre Überlebensfähigkeit in verschiedenen Ökosystemen sichert.
In der Aufnahme von Helga Zinnecker
- Auch in den Laubmischwäldern des Steigerwaldes beheimatet, ist diese Kleinsäugerart innerhalb von Invasionsjahren ,eine der Haupt - Nahrungstiere heimischer Greife und Eulenarten. Rötelmäuse, die eine Körperlänge von etwa 12cm, sowie ein Körpergewicht nahe an 40 Gramm erreichen, zeichnen sich durch eine hohe Fruchtbarkeit aus, die es ihnen erlaubt extreme Bestandseinbrüche relativ rasch zu kompensieren.Bei hohem Nahrungsangebot ( Mastjahre ) gerne werden Sämerein , Insekten, jedoch auch Wurzelteile verzehrt, gelingen bis zu 4 ( 5 ) Jahreswürfe.Ein Wurf beinhaltet durchschnittlich 5 Jungmäuse. Die Sterblichkeit der Jungtiere liegt im ersten Jahr bei circa 80 % .In den letzten beiden Jahren viel die Rötemaus vor allem durch Negativmeldungen auf, die sich auf die Übertragung von Krankheiten , hervorgerufen durch die Ausscheidungen der Tiere , konzentrierten.( Hantavieren )
Da sich diese Tiere auch gerne in menschlichen Gebäuden / Schuppen etc. ( Winterhalbjahr / Herbst ) aufhalten und hier ihre Hinterlassenschaften absetzen, ist bei der Reinigung dieser Bauwerke höchste Vorsicht ( trockener Kot bringt beim Reinigen / Kehren , Vieren in die Luft ( Aufwirbelungen ) und damit in die Atemwege des Menschen ) geboten! Kontakt zu den Fachstellen des Landkreises / Stadt ist angeraten. Hier werden weiterführende Informationen vermittelt.
Artenschutz in Franken®
Stele der Biodiversität® - Burgwindheim / Kötsch

Stele der Biodiversität® - Burgwindheim / Kötsch
27/28.08.2024
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das vom Markt Burgwindheim, dem Bayernwerk der Deutschen Postcode Lotterie und der Steuerkanzlei Bauerfeind unterstützt wird.
Kötsch / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen.
Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
27/28.08.2024
- Aufbringung des Putzes ist abgeschlossen ... Farb-Grundanstrich ist aufgebracht
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das vom Markt Burgwindheim, dem Bayernwerk der Deutschen Postcode Lotterie und der Steuerkanzlei Bauerfeind unterstützt wird.
Kötsch / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen.
Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
Denn wenn (selbst in noch geeigneten Nahrungsstrukturen) keine geeigneten Reproduktionsräume vorhanden sind, ist die Erhaltung der Artenvielfalt gelichfalls zum Scheitern verurteilt.
Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das vom Markt Burgwindheim, dem Bayernwerk der Deutschen Postcode Lotterie und der Steuerkanzlei Bauerfeind unterstützt wird, setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.
In der Aufnahme
Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das vom Markt Burgwindheim, dem Bayernwerk der Deutschen Postcode Lotterie und der Steuerkanzlei Bauerfeind unterstützt wird, setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.
In der Aufnahme
- Am 14.08.2024 wurde auf Anregung von Artenschutz in Franken® das Fremdgehölz vor dem Trafoturm entfernt ...
Artenschutz in Franken®
Das Mauswiesel (Mustela nivalis)
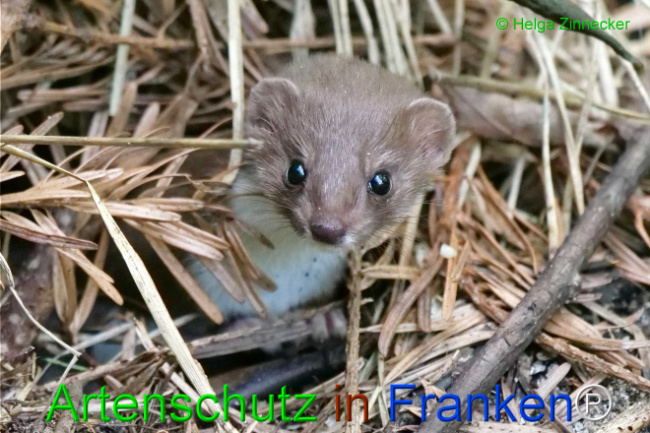
Mauswiesel (Mustela nivalis)
26/27.08.2024
Ich gehöre zur Familie der Marder und bin ein kleiner Beutegreifer, das für seine Schnelligkeit und Geschicklichkeit bekannt ist. Meine Körperform ist lang und schlank, was es mir ermöglicht, mich mühelos durch enge Spalten und unterirdische Gänge zu bewegen, um meine Beute zu jagen.
26/27.08.2024
- Als Mauswiesel (Mustela nivalis) betrachte ich meine Existenz in der Tierwelt aus einer faszinierenden Perspektive.
Ich gehöre zur Familie der Marder und bin ein kleiner Beutegreifer, das für seine Schnelligkeit und Geschicklichkeit bekannt ist. Meine Körperform ist lang und schlank, was es mir ermöglicht, mich mühelos durch enge Spalten und unterirdische Gänge zu bewegen, um meine Beute zu jagen.
Meine Hauptnahrung sind kleine Nagetiere wie Mäuse und Wühlmäuse. Dank meiner scharfen Sinne kann ich Beute schon aus großer Entfernung wahrnehmen und sie blitzschnell erbeuten. Meine Zähne und Krallen sind perfekt angepasst, um meine Beute zu töten und zu zerlegen.Mein Lebensraum erstreckt sich über weite Teile Europas, Asiens und Nordamerikas, vor allem in offenen Landschaften wie Wiesen, Feldern und Heiden. Ich bin anpassungsfähig und kann mich auch in verschiedenen Lebensräumen wie Wäldern oder Gebirgen gut zurechtfinden.
Als Mauswiesel habe ich eine wichtige Rolle im Ökosystem. Ich reguliere die Populationen von kleinen Nagetieren, was dazu beiträgt, das Gleichgewicht in der Natur aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig bin ich selbst Beute für größere Beutegreifer wie Greifvögel, Füchse und Eulen, was mich zu einem wichtigen Glied in der Nahrungskette macht. In Bezug auf meine Fortpflanzung bin ich polygam und suche mir mehrere Partner während der Paarungszeit. Die Jungtiere kommen nach einer kurzen Tragzeit zur Welt und werden von mir als Mutter liebevoll umsorgt, bis sie alt genug sind, um auf eigenen Beinen zu stehen.
Meine Art ist anpassungsfähig und robust, aber dennoch von Bedrohungen wie Lebensraumverlust und menschlicher Verfolgung betroffen. Der Schutz meiner Lebensräume und die Erhaltung der natürlichen Balance sind entscheidend für mein Überleben und das meines Ökosystems insgesamt.
Zusammengefasst bin ich als Mauswiesel ein faszinierendes Raubtier, das sowohl in ökologischer als auch in biologischer Hinsicht eine wichtige Rolle spielt. Meine Anpassungsfähigkeit und Jagdtechniken ermöglichen es mir, in verschiedenen Lebensräumen erfolgreich zu überleben und zur Vielfalt der Natur beizutragen.
In der Aufnahme von Helga Zinnecker
Als Mauswiesel habe ich eine wichtige Rolle im Ökosystem. Ich reguliere die Populationen von kleinen Nagetieren, was dazu beiträgt, das Gleichgewicht in der Natur aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig bin ich selbst Beute für größere Beutegreifer wie Greifvögel, Füchse und Eulen, was mich zu einem wichtigen Glied in der Nahrungskette macht. In Bezug auf meine Fortpflanzung bin ich polygam und suche mir mehrere Partner während der Paarungszeit. Die Jungtiere kommen nach einer kurzen Tragzeit zur Welt und werden von mir als Mutter liebevoll umsorgt, bis sie alt genug sind, um auf eigenen Beinen zu stehen.
Meine Art ist anpassungsfähig und robust, aber dennoch von Bedrohungen wie Lebensraumverlust und menschlicher Verfolgung betroffen. Der Schutz meiner Lebensräume und die Erhaltung der natürlichen Balance sind entscheidend für mein Überleben und das meines Ökosystems insgesamt.
Zusammengefasst bin ich als Mauswiesel ein faszinierendes Raubtier, das sowohl in ökologischer als auch in biologischer Hinsicht eine wichtige Rolle spielt. Meine Anpassungsfähigkeit und Jagdtechniken ermöglichen es mir, in verschiedenen Lebensräumen erfolgreich zu überleben und zur Vielfalt der Natur beizutragen.
In der Aufnahme von Helga Zinnecker
- Als das kleinste "Raubtier" der Welt wird es bezeichnet. - Das Mauswiesel! Allein schon der Name Raubtier birgt eine deutlich falsche Aussage in sich. Denn was raubt denn das Mauswiesel? Es ernährt sich als auch fleischfressendes Säugetier von anderen Arten. Nicht mehr und nicht weniger. Dafür wurde es von der Evolution auserkoren. Es trägt einen wichtigen Part inmitten der in sich greifenden Umwelt bei. Als natürlicher Regulator ist die diese hoch interessante Art wohl besser bezeichnet. Das Mauswiesel ist so klein, dass es seiner Hauptbeute, den kleinen Wühlmausarten in ihre Gangsystem folgen kann. Ein herausragender Spezialist im Naturhaushalt.
Artenschutz in Franken®
Artenschutzmast Geiselwind

Ein Mast für die Kinderstube fränkischer Weißstörche und mehr ...
26/27.08.2024
Ein Gemeinschaftsprojekt bei dem Artenschutz im Steigerwald , Bayerische Staatsforsten/Fortbetrieb Ebrach , Dennert Baustoffe , Drei - Franken - Schule Geiselwind , Landratsamt Kitzingen / Untere Naturschutzbehörde , Markt Geiselwind , Sparkasse Mainfranken beteiligt waren, möchte dem "Kitzinger Weißstorch" mit der Bereitstellung eines Nistmastes die Möglichkeit einräumen sich erfolgreich fortpflanzen zu können.
26/27.08.2024
- Ausgetauscht ... Metall ersetzt ab sofort Holz
Ein Gemeinschaftsprojekt bei dem Artenschutz im Steigerwald , Bayerische Staatsforsten/Fortbetrieb Ebrach , Dennert Baustoffe , Drei - Franken - Schule Geiselwind , Landratsamt Kitzingen / Untere Naturschutzbehörde , Markt Geiselwind , Sparkasse Mainfranken beteiligt waren, möchte dem "Kitzinger Weißstorch" mit der Bereitstellung eines Nistmastes die Möglichkeit einräumen sich erfolgreich fortpflanzen zu können.
Im August 2024 musste der Mast der die Nistplattform trug ausgetauscht werden, da Spechte ihre Nisthöhlen in den Stamm geschlagen hatten... die Witterung ließ den Mast morsch werden und die Nistplattform drohte abzukippen ...
... und so wurde in 2024 mit Unterstützung der Deutschen Postcode Lotterie und Turmstationen Deutschland e.V. und nicht zuletzt von Artenschutz in Franken® ein in dieser Form wohl nicht alltäglicher Metallmast gestellt ...
... um weiteren Arten hier eine Option zur Fortpflanzung einzuräumen wurde der Mast mit Nisthilfen für Turmfalke und Mauersegler ausgestattet ...
In der Aufnahme vom 16.08.2024 von Jasmin Wegener
... und so wurde in 2024 mit Unterstützung der Deutschen Postcode Lotterie und Turmstationen Deutschland e.V. und nicht zuletzt von Artenschutz in Franken® ein in dieser Form wohl nicht alltäglicher Metallmast gestellt ...
... um weiteren Arten hier eine Option zur Fortpflanzung einzuräumen wurde der Mast mit Nisthilfen für Turmfalke und Mauersegler ausgestattet ...
In der Aufnahme vom 16.08.2024 von Jasmin Wegener
- ... Blick auf den neu installierten Artenschutzmast ...
Artenschutz in Franken®
Stele der Biodiversität® - Stegaurach / Dellern

Stele der Biodiversität® - Stegaurach / Dellern
25/26.08.2024
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.
Stegaurach / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
25/26.08.2024
- Die grafische Gestaltung ... Stimmungen an der Stele der Biodiversität®
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.
Stegaurach / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
Denn wenn (selbst in noch geeigneten Nahrungsstrukturen) keine geeigneten Reproduktionsräume vorhanden sind, ist die Erhaltung der Artenvielfalt gelichfalls zum Scheitern verurteilt.
Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird., setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.
In der Aufnahme
Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird., setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.
In der Aufnahme
- Eindrücke vom 15.08.2024 ... der Turmfalke hat "Platz genommen" ...
Artenschutz in Franken®
Neue Nistkästen warten auf Mauersegler

Neue Nistkästen warten auf Mauersegler
24/25.08.2024
Artenreichtum in der Stadt? Das tut uns und unserer Umwelt gut. Deshalb nimmt die Stadt Bamberg gerne Finanzmittel des Bundes an, um an Gebäuden brütende Vogelarten zu unterstützen. Nach Projekten an der Montessorischule, am E.T.A. Hoffmann-Gymnasium und am Pfarrheim der Wunderburgkirche rückte das denkmalgeschützte Universitätsgebäude am Markusplatz in den Mittelpunkt. An ihm wurden spezielle Kästen für Mauersegler angebracht.
24/25.08.2024
- Universität unterstützt großes Biodiversitätsprojekt
Artenreichtum in der Stadt? Das tut uns und unserer Umwelt gut. Deshalb nimmt die Stadt Bamberg gerne Finanzmittel des Bundes an, um an Gebäuden brütende Vogelarten zu unterstützen. Nach Projekten an der Montessorischule, am E.T.A. Hoffmann-Gymnasium und am Pfarrheim der Wunderburgkirche rückte das denkmalgeschützte Universitätsgebäude am Markusplatz in den Mittelpunkt. An ihm wurden spezielle Kästen für Mauersegler angebracht.
Patrick Weiß, Mitarbeiter des IT-Services der Otto-Friedrich-Universität, hatte von den Projekten für Gebäudebrüter erfahren. Seine Idee, am so genannten Marcus-Haus, der ehemaligen Staatlichen Frauenklinik, Domizile für Mauersegler zu errichten, griffen Dr. Jürgen Gerdes, Projektbetreuer im städtischen Klima- und Umweltamt, sowie Thomas Köhler, ehrenamtlicher Partner des Amtes und Vorsitzender der Initiative Artenschutz in Franken, gerne auf.
Köhler wählte geeignete Kästen aus und erstellte einen Plan für deren Installation. Das war nicht einfach, denn Mauersegler sind anspruchsvoll. Das Dach der Kästen muss schräg sein, damit sich keine Tauben oder Greifvögel darauf setzen können. Zudem muss die Öffnung nach unten zeigen, weil sich die Segler gern in den Flug fallen lassen.
Dem Plan stimmten Steffi Häfner vom Staatlichen Bauamt, das für den Unterhalt des denkmalgeschützten Universitätsgebäudes am Markusplatz verantwortlich ist, und Martin Brandl, Referatsleiter der Denkmalpflege in Schloss Seehof, zu. Allerdings nur unter der Voraussetzung, dass die ursprünglich grauen Kästen in der Farbe des Gebäudes gestrichen werden müssen und das Gebäude durch die Montage keinen Schaden nimmt. Für Thomas Köhler war das dank seiner großen Erfahrung mit solchen Vorhaben kein Problem, siehe www.artenschutz-franken.de
Nach Langstreckenflug sicher wieder in Bamberg
Die Kästen wurden in Ocker getaucht und dann von einer Spezialfirma aus Burgwindheim montiert. Jetzt braucht es etwas Geduld. Denn die Mauersegler sind schon längst wieder unterwegs zu ihrem Winterquartier südlich der Sahara. Sicher ist, dass sie zum Brüten im nächsten Jahr wiederkommen werden, sehr zuverlässig Ende April bzw. Anfang Mai nach einem Langstreckenflug von fast 10.000 Kilometern. Das funktioniert, weil Mauersegler eine außergewöhnliche Fähigkeit haben – sie können im Flug schlafen.
Info
Das Hilfsprojekt für Gebäudebrüter ist eines von sechs städtischen Projekten, die aus dem Bundesprogramm Biologische Vielfalt unter der Bezeichnung „Bamberger Stadtgrün“ von 2022 bis 2027 mit 1,4 Millionen Euro gefördert werden. Dazu zählen u.a. auch die Entschlammung des Hainweihers und die Anlage eines naturnahen Flachufers an seinem südlichen Ende sowie Renaturierungsmaßnahmen im Stadtwald. Weitere Informationen unter https://www.bfn.de/projektsteckbriefe/bamberger-stadtgruen.
In der Aufnahme von © Artenschutz in Franken
Quelle
Stadtverwaltung Bamberg • Maximiliansplatz 3 • 96047 Bamberg • 0951 87-0 • 0951 87-1964
Stand
19.08.2024
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung.Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Köhler wählte geeignete Kästen aus und erstellte einen Plan für deren Installation. Das war nicht einfach, denn Mauersegler sind anspruchsvoll. Das Dach der Kästen muss schräg sein, damit sich keine Tauben oder Greifvögel darauf setzen können. Zudem muss die Öffnung nach unten zeigen, weil sich die Segler gern in den Flug fallen lassen.
Dem Plan stimmten Steffi Häfner vom Staatlichen Bauamt, das für den Unterhalt des denkmalgeschützten Universitätsgebäudes am Markusplatz verantwortlich ist, und Martin Brandl, Referatsleiter der Denkmalpflege in Schloss Seehof, zu. Allerdings nur unter der Voraussetzung, dass die ursprünglich grauen Kästen in der Farbe des Gebäudes gestrichen werden müssen und das Gebäude durch die Montage keinen Schaden nimmt. Für Thomas Köhler war das dank seiner großen Erfahrung mit solchen Vorhaben kein Problem, siehe www.artenschutz-franken.de
Nach Langstreckenflug sicher wieder in Bamberg
Die Kästen wurden in Ocker getaucht und dann von einer Spezialfirma aus Burgwindheim montiert. Jetzt braucht es etwas Geduld. Denn die Mauersegler sind schon längst wieder unterwegs zu ihrem Winterquartier südlich der Sahara. Sicher ist, dass sie zum Brüten im nächsten Jahr wiederkommen werden, sehr zuverlässig Ende April bzw. Anfang Mai nach einem Langstreckenflug von fast 10.000 Kilometern. Das funktioniert, weil Mauersegler eine außergewöhnliche Fähigkeit haben – sie können im Flug schlafen.
Info
Das Hilfsprojekt für Gebäudebrüter ist eines von sechs städtischen Projekten, die aus dem Bundesprogramm Biologische Vielfalt unter der Bezeichnung „Bamberger Stadtgrün“ von 2022 bis 2027 mit 1,4 Millionen Euro gefördert werden. Dazu zählen u.a. auch die Entschlammung des Hainweihers und die Anlage eines naturnahen Flachufers an seinem südlichen Ende sowie Renaturierungsmaßnahmen im Stadtwald. Weitere Informationen unter https://www.bfn.de/projektsteckbriefe/bamberger-stadtgruen.
In der Aufnahme von © Artenschutz in Franken
- Neue Nistkästen warten auf Mauersegler
Quelle
Stadtverwaltung Bamberg • Maximiliansplatz 3 • 96047 Bamberg • 0951 87-0 • 0951 87-1964
Stand
19.08.2024
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung.Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Artenschutz in Franken®
Stele der Biodiversität® - Stegaurach / Dellern

Stele der Biodiversität® - Stegaurach / Dellern
24/25.08.2024
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.
Stegaurach / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
24/25.08.2024
- Die grafische Gestaltung ... Stimmungen an der Stele der Biodiversität®
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.
Stegaurach / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
Denn wenn (selbst in noch geeigneten Nahrungsstrukturen) keine geeigneten Reproduktionsräume vorhanden sind, ist die Erhaltung der Artenvielfalt gelichfalls zum Scheitern verurteilt.
Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird., setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.
In der Aufnahme
Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird., setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.
In der Aufnahme
- Eindrücke vom 14.08.2024 ...
Artenschutz in Franken®
Die Westliche Riesensmaragdeidechse (Lacerta trilineata)

Westliche Riesensmaragdeidechse (Lacerta trilineata)
23/24.08.2024
Ich bin eine der größten Eidechsenarten in Europa und werde oft mit meiner Verwandten, der Smaragdeidechse (Lacerta bilineata), verwechselt.
Aber ich habe ein paar einzigartige Merkmale, die mich wirklich auszeichnen!
23/24.08.2024
- Hey, ich bin die Westliche Riesensmaragdeidechse, auch bekannt als Lacerta trilineata.
Ich bin eine der größten Eidechsenarten in Europa und werde oft mit meiner Verwandten, der Smaragdeidechse (Lacerta bilineata), verwechselt.
Aber ich habe ein paar einzigartige Merkmale, die mich wirklich auszeichnen!
Ich lebe vor allem in den wärmeren Regionen des Balkans und in Teilen Griechenlands, aber auch in Italien und der Türkei kann man mich antreffen. Mein bevorzugter Lebensraum sind warme, sonnige und buschige Gebiete, gerne mit viel Vegetation und einigen Felsen. Das bietet mir Schutz vor Fressfeinden und eine Vielzahl von Insekten, die ich als Beute bevorzuge.
Als Jungtier trage ich oft drei gelbliche Längsstreifen auf meinem Rücken, daher auch mein wissenschaftlicher Name "trilineata", was „drei Linien“ bedeutet. Aber wenn ich älter werde, ändert sich mein Aussehen drastisch. Mein glänzender, smaragdgrüner Körper zieht die Aufmerksamkeit auf sich, und mein Bauch nimmt eine leuchtend gelbe oder grüne Farbe an. Männchen wie ich haben oft noch intensivere Farben, besonders in der Paarungszeit – was mir hilft, Weibchen anzulocken und Rivalen zu beeindrucken.
Ich bin ein ziemlich guter Läufer und Kletterer und nutze meine Schnelligkeit, um Beute zu fangen oder vor Gefahr zu fliehen. Mein Körper ist lang und schlank, mit kräftigen Beinen und einem langen Schwanz, den ich bei Bedarf abwerfen kann, um einem Fressfeind zu entkommen. Keine Sorge, der wächst nach, obwohl er nie wieder so lang und schön wird wie der Originale.
Ein weiteres interessantes Detail ist mein Verhalten während der Paarungszeit. Als Männchen messe ich mich mit anderen Männchen in Kämpfen, die oft aus beeindruckenden Schaukämpfen bestehen. Wir beißen uns, drücken uns mit unseren Körpern, und der Stärkere gewinnt das Recht, sich mit einem Weibchen zu paaren. Das Weibchen legt dann einige Wochen später Eier in eine gut versteckte Erdhöhle, aus denen nach ein paar Monaten die Jungtiere schlüpfen.
Wenn es um meine Ernährung geht, bin ich ein opportunistischer Jäger. Ich fresse alles, was ich fangen kann: Insekten, Spinnen, kleine Wirbeltiere, und manchmal auch Pflanzenmaterial. Mein starkes Gebiss hilft mir, auch harte Beutetiere wie Käfer zu knacken.
Ich bin ein faszinierendes Beispiel für die Anpassungsfähigkeit und Schönheit der Natur. Aber auch ich habe mit Bedrohungen zu kämpfen: Der Mensch zerstört oft meinen Lebensraum, und in einigen Gebieten bin ich durch den Verlust dieser Lebensräume gefährdet. Ich hoffe, dass mein Lebensraum geschützt wird, damit meine Art noch lange in den sonnigen Landschaften Europas leben kann.
Aufnahme aus 2024 von Helga Zinnecker
Als Jungtier trage ich oft drei gelbliche Längsstreifen auf meinem Rücken, daher auch mein wissenschaftlicher Name "trilineata", was „drei Linien“ bedeutet. Aber wenn ich älter werde, ändert sich mein Aussehen drastisch. Mein glänzender, smaragdgrüner Körper zieht die Aufmerksamkeit auf sich, und mein Bauch nimmt eine leuchtend gelbe oder grüne Farbe an. Männchen wie ich haben oft noch intensivere Farben, besonders in der Paarungszeit – was mir hilft, Weibchen anzulocken und Rivalen zu beeindrucken.
Ich bin ein ziemlich guter Läufer und Kletterer und nutze meine Schnelligkeit, um Beute zu fangen oder vor Gefahr zu fliehen. Mein Körper ist lang und schlank, mit kräftigen Beinen und einem langen Schwanz, den ich bei Bedarf abwerfen kann, um einem Fressfeind zu entkommen. Keine Sorge, der wächst nach, obwohl er nie wieder so lang und schön wird wie der Originale.
Ein weiteres interessantes Detail ist mein Verhalten während der Paarungszeit. Als Männchen messe ich mich mit anderen Männchen in Kämpfen, die oft aus beeindruckenden Schaukämpfen bestehen. Wir beißen uns, drücken uns mit unseren Körpern, und der Stärkere gewinnt das Recht, sich mit einem Weibchen zu paaren. Das Weibchen legt dann einige Wochen später Eier in eine gut versteckte Erdhöhle, aus denen nach ein paar Monaten die Jungtiere schlüpfen.
Wenn es um meine Ernährung geht, bin ich ein opportunistischer Jäger. Ich fresse alles, was ich fangen kann: Insekten, Spinnen, kleine Wirbeltiere, und manchmal auch Pflanzenmaterial. Mein starkes Gebiss hilft mir, auch harte Beutetiere wie Käfer zu knacken.
Ich bin ein faszinierendes Beispiel für die Anpassungsfähigkeit und Schönheit der Natur. Aber auch ich habe mit Bedrohungen zu kämpfen: Der Mensch zerstört oft meinen Lebensraum, und in einigen Gebieten bin ich durch den Verlust dieser Lebensräume gefährdet. Ich hoffe, dass mein Lebensraum geschützt wird, damit meine Art noch lange in den sonnigen Landschaften Europas leben kann.
Aufnahme aus 2024 von Helga Zinnecker
- Westliche Riesensmaragdeidechse (Lacerta trilineata)
Artenschutz in Franken®
Stele der Biodiversität® - Burgwindheim / Kötsch

Stele der Biodiversität® - Burgwindheim / Kötsch
23/24.08.2024
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das vom Markt Burgwindheim, dem Bayernwerk der Deutschen Postcode Lotterie und der Steuerkanzlei Bauerfeind unterstützt wird.
Kötsch / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen.
Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
23/24.08.2024
- Aufbringung des Putzes ist abgeschlossen ... Farb-Grundanstrich ist aufgebracht
Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das vom Markt Burgwindheim, dem Bayernwerk der Deutschen Postcode Lotterie und der Steuerkanzlei Bauerfeind unterstützt wird.
Kötsch / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen.
Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.
Denn wenn (selbst in noch geeigneten Nahrungsstrukturen) keine geeigneten Reproduktionsräume vorhanden sind, ist die Erhaltung der Artenvielfalt gelichfalls zum Scheitern verurteilt.
Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das vom Markt Burgwindheim, dem Bayernwerk der Deutschen Postcode Lotterie und der Steuerkanzlei Bauerfeind unterstützt wird, setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.
In der Aufnahme
Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das vom Markt Burgwindheim, dem Bayernwerk der Deutschen Postcode Lotterie und der Steuerkanzlei Bauerfeind unterstützt wird, setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.
In der Aufnahme
- Projektfortschritt am 13.08.2024 ...
Artenschutz in Franken®
Ein Welterbe für den Mauersegler

"Mauersegler sind anspruchsvoll": Spezielle Nistkästen für Vögel installiert
22/23.08.2024
22/23.08.2024
- In Bamberg wurden neue Nistkästen für Mauersegler installiert. Kein einfaches Vorhaben, denn Mauersegler sind anspruchsvoll. Nach diversen Projekten ist nun ein Gebäude Markusplatz mit den Kästen versehen worden.
An einem Gebäude am Markusplatz in Bamberg wurden jüngst neue Nistkästen für Mauersegler installiert. "Artenreichtum in der Stadt? Das tut uns und unserer Umwelt gut", erklärt die Stadt Bamberg.
Weiter heißt es: Deshalb nimmt die Stadt Bamberg gerne Finanzmittel des Bundes an, um an Gebäuden brütende Vogelarten zu unterstützen. Nach Projekten an der Montessorischule, am E.T.A. Hoffmann-Gymnasium und am Pfarrheim der Wunderburgkirche rückte das denkmalgeschützte Universitätsgebäude am Markusplatz in den Mittelpunkt. An ihm wurden spezielle Kästen für Mauersegler angebracht.
Artenschutz in Franken®
Die Schlingnatter (Coronella austriaca)

Schlingnatter (Coronella austriaca)
22/23.08.2024
Mein Körper ist schlank und kann eine Länge von bis zu 80 Zentimetern erreichen. Meine Färbung variiert stark, aber typischerweise habe ich eine graue bis bräunliche Grundfarbe mit einer Reihe dunkler Flecken auf dem Rücken. Diese Flecken können oft zu einem Zickzack-Muster verschmelzen.
22/23.08.2024
- Als Schlingnatter (Coronella austriaca) betrachte ich mich als eine eher scheue und friedliche Schlange, die in verschiedenen Lebensräumen von Europa bis nach Asien anzutreffen ist.
Mein Körper ist schlank und kann eine Länge von bis zu 80 Zentimetern erreichen. Meine Färbung variiert stark, aber typischerweise habe ich eine graue bis bräunliche Grundfarbe mit einer Reihe dunkler Flecken auf dem Rücken. Diese Flecken können oft zu einem Zickzack-Muster verschmelzen.
Ich bevorzuge Lebensräume wie Wiesen, Heiden, lichte Wälder und Waldränder, wo ich mich unter Steinen, in Totholz oder im Laub verstecken kann. Meine Nahrung besteht hauptsächlich aus kleinen Wirbeltieren wie Eidechsen, Fröschen, kleinen Säugetieren und gelegentlich auch Vogeleiern.
Im Vergleich zur Kreuzotter (Vipera berus) gibt es mehrere deutliche Unterschiede:
Insgesamt bin ich als Schlingnatter ein wichtiger Bestandteil vieler Ökosysteme und trage zur Regulation von kleinen Beutetieren bei. Meine natürliche Scheu und Ungiftigkeit machen mich für Menschen ungefährlich, aber dennoch faszinierend in meiner Lebensweise und Anpassungsfähigkeit.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
Im Vergleich zur Kreuzotter (Vipera berus) gibt es mehrere deutliche Unterschiede:
- Giftigkeit und Bissverhalten: Die Kreuzotter ist giftig, während ich als Schlingnatter ungiftig bin. Kreuzottern nutzen ihr Gift, um ihre Beute zu lähmen und sind in der Lage, bei Bedrohung zu beißen und das Gift zu injizieren. Ich hingegen bin harmlos und beiße nur im äußersten Verteidigungsfall, ohne Gift zu spritzen.
- Körperbau und Merkmale: Kreuzottern haben einen gedrungeneren Körperbau mit einer markanten Zeichnung, die aus einem dunklen Zickzack-Band auf dem Rücken und einer oft rötlichen bis bräunlichen Grundfarbe besteht. Im Gegensatz dazu bin ich schlanker und meine Musterung ist variabler, oft mit kleineren Flecken oder einem undeutlichen Zickzack-Muster.
- Lebensraum und Verhalten: Kreuzottern sind häufiger in feuchteren, dichteren Lebensräumen wie Wäldern, Heiden und Mooren anzutreffen, während ich als Schlingnatter offene, sonnige Gebiete bevorzuge, die weniger dicht bewachsen sind.
- Verhalten und Fortpflanzung: Kreuzottern sind ovovivipar, was bedeutet, dass sie lebende Junge gebären, während ich Eier lege (ovipar) und meine Eier an geschützten Stellen ablege, wo sie sich dann entwickeln.
Insgesamt bin ich als Schlingnatter ein wichtiger Bestandteil vieler Ökosysteme und trage zur Regulation von kleinen Beutetieren bei. Meine natürliche Scheu und Ungiftigkeit machen mich für Menschen ungefährlich, aber dennoch faszinierend in meiner Lebensweise und Anpassungsfähigkeit.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
- Bis zu 70 cm lang kann eine unserer Schlangenarten werden, die Schlingnatter. Oft wird das ungiftige Tier mit Kreuzottern verwechselt. Wobei diese Schlangenart jedoch gerne Waldlichtungen und offenes ( Wiesen ) Gelände bevorzugt. Sie ernährt sich gerne von Kleinsäugern und Eidechsen.
Artenschutz in Franken®
Ein Welterbe für den Mauersegler

Ein Welterbe für den Mauersegler
22/23.08.2024
Bamberg / Bayern. Wie auch in anderen Städten der Republik erkennen wir seit geraumer Zeit auf in der Stadt Bamberg einen elementaren Rückgang der Vogelart Mauersegler. Neben Nahrungsmangel sind es vornehmlich fehlende Fortpflanzungsstätten die es den Tieren zunehmend schwerer machen sich einer erfolgreichen Arterhaltung zu widmen.
Artenschutz in Franken®, Stadt Bamberg – Umweltamt und Universität Bamberg möchten dem Verlust der Biodiversität mit einem konkreten, regionalem Schutzprojekt entgegenwirken. Gefördert wird das Projekt durch das Bundesamt für Naturschutz (BfN) mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV). Unterstützung erfuhren wir vom Staatllichen Bauamt sowie den Fachbehörden des Denkmalsschutzes.
22/23.08.2024
- Ein innovatives Gemeinschaftsprojekt engagiert sich für die Erhaltung der letzten Mauersegler in der Stadt Bamberg.
Bamberg / Bayern. Wie auch in anderen Städten der Republik erkennen wir seit geraumer Zeit auf in der Stadt Bamberg einen elementaren Rückgang der Vogelart Mauersegler. Neben Nahrungsmangel sind es vornehmlich fehlende Fortpflanzungsstätten die es den Tieren zunehmend schwerer machen sich einer erfolgreichen Arterhaltung zu widmen.
Artenschutz in Franken®, Stadt Bamberg – Umweltamt und Universität Bamberg möchten dem Verlust der Biodiversität mit einem konkreten, regionalem Schutzprojekt entgegenwirken. Gefördert wird das Projekt durch das Bundesamt für Naturschutz (BfN) mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV). Unterstützung erfuhren wir vom Staatllichen Bauamt sowie den Fachbehörden des Denkmalsschutzes.
Mit der Installation spezieller Mauerseglernisthilfen an der Baukörperfassade, knapp unterhalb der Dachtraufe , wurden nachhaltige Reproduktionsmöglichkeiten geschaffen. Diese Niststätten bieten kulturfolgenden Kleinvogelarten wie z. B. dem Mauersegler nun geeignete, prädatorensichere Reproduktionsmöglichkeiten. Auch klimatische Faktoren waren Bestandteil des Projekts, denn mehr und mehr (auch traditionelle) Brutplätze verlieren aufgrund des Klimawandels ihre Funktionalität und damit verenden viele Jungtiere, bereits in überhitzen Brutnischen ohne jemals einen ersten Flügelschlag im freien Luftraum erleben zu dürfen.
Die nun hier installierten Nisthilfen wurden neben einer Ansitzschräge, die natürliche Fressfeinde, die an den Reproduktionsstandorten in Erscheinung treten könnten, davon abhalten, sich hier niederzulassen, mit Maßnahmen zur Reduzierung einer Brutplatzüberhitzung ausgestattet. Selbstredend das die Nisthilfen in einer nachhaltigen Konzeption ausgeführt wurden, um nach einer Annahme auch viele Jahrzehnte ihrer wertvollen Aufgabe nachkommen zu können.
Der Mauerseglerschutz durch die Anbringung spezieller Nisthilfen ist wichtig für die Arterhaltung der Mauersegler in den Städten aus mehreren Gründen:
Durch die Installation von speziellen Nisthilfen an Gebäuden können diese Probleme angegangen werden. Diese Nisthilfen imitieren natürliche Brutbedingungen und bieten den Mauerseglern sichere Plätze zum Brüten und Aufziehen ihrer Jungen. Dadurch wird ihre Fortpflanzung gefördert und ihr Bestand in städtischen Gebieten gesichert, was letztlich zur Arterhaltung beiträgt.
In der Aufnahme
Die nun hier installierten Nisthilfen wurden neben einer Ansitzschräge, die natürliche Fressfeinde, die an den Reproduktionsstandorten in Erscheinung treten könnten, davon abhalten, sich hier niederzulassen, mit Maßnahmen zur Reduzierung einer Brutplatzüberhitzung ausgestattet. Selbstredend das die Nisthilfen in einer nachhaltigen Konzeption ausgeführt wurden, um nach einer Annahme auch viele Jahrzehnte ihrer wertvollen Aufgabe nachkommen zu können.
Der Mauerseglerschutz durch die Anbringung spezieller Nisthilfen ist wichtig für die Arterhaltung der Mauersegler in den Städten aus mehreren Gründen:
- Verlust natürlicher Brutplätze: Mauersegler sind auf natürliche Brutplätze an Felswänden angewiesen. In städtischen Gebieten gibt es jedoch oft wenige natürliche Nistmöglichkeiten. Durch Modernisierungen an Gebäuden werden auch natürliche Nischen und Spalten, die als Brutplätze dienen könnten, häufig verschlossen oder entfernt.
- Anpassung an städtische Umgebung: Mauersegler haben sich im Laufe der Zeit an das urbane Umfeld angepasst und nutzen Gebäudestrukturen als Ersatz für natürliche Felsen. Ohne geeignete Nisthilfen fehlen ihnen jedoch oft sichere Brutplätze, was ihre Fortpflanzung gefährdet.
- Populationsrückgang: In vielen Städten ist ein Rückgang der Mauerseglerpopulationen zu beobachten, teilweise aufgrund des Mangels an geeigneten Nistmöglichkeiten. Dies könnte langfristig zu einem Bedeutungsverlust oder sogar zum Verschwinden dieser Art aus städtischen Gebieten führen.
- Erhalt der Biodiversität: Mauersegler spielen eine wichtige Rolle im Ökosystem, da sie sich von fliegenden Insekten ernähren. Ihr Verlust könnte das ökologische Gleichgewicht in städtischen Gebieten beeinträchtigen.
Durch die Installation von speziellen Nisthilfen an Gebäuden können diese Probleme angegangen werden. Diese Nisthilfen imitieren natürliche Brutbedingungen und bieten den Mauerseglern sichere Plätze zum Brüten und Aufziehen ihrer Jungen. Dadurch wird ihre Fortpflanzung gefördert und ihr Bestand in städtischen Gebieten gesichert, was letztlich zur Arterhaltung beiträgt.
In der Aufnahme
- Montierte Nisthilfen mit installierter Ansitzschräge die an der Fassade kaum auffallen
Artenschutz in Franken®
Aktueller Ordner:
Archiv
Parallele Themen:
2019-11
2019-10
2019-12
2020-01
2020-02
2020-03
2020-04
2020-05
2020-06
2020-07
2020-08
2020-09
2020-10
2020-11
2020-12
2021-01
2021-02
2021-03
2021-04
2021-05
2021-06
2021-07
2021-08
2021-09
2021-10
2021-11
2021-12
2022-01
2022-02
2022-03
2022-04
2022-05
2022-06
2022-07
2022-08
2022-09
2022-10
2022-11
2022-12
2023-01
2023-02
2023-03
2023-04
2023-05
2023-06
2023-07
2023-08
2023-09
2023-10
2023-11
2023-12
2024-01
2024-02
2024-03
2024-04
2024-05
2024-06
2024-07
2024-08
2024-09
2024-10
2024-11
2024-12
2025-01
2025-02
2025-03
2025-04
2025-05
2025-06
2025-07
2025-08
2025-09
2025-10
2025-11
2025-12
















