Neukartierung bayerischer Brutvögel-Vorkommen

Neukartierung bayerischer Brutvögel-Vorkommen
18/19.02.2025
Von 2005 bis 2009 sammelten über 700 begeisterte Ornithologinnen und Ornithologen in Bayern beeindruckende 137.000 Datensätze auf einer Fläche von 70.000 Quadratkilometern für den bundesweiten Brutvogelatlas ADEBAR. Nun geht das Projekt in die nächste Runde.
2025 startet die Aktualisierung von ADEBAR und bringt innovative Methoden und einen frischen Blick auf Bayerns Brutvogelwelt. Gefördert mit rund 1,6 Millionen Euro und einer eigenen Projektstelle des Bayerischen Landesamtes für Umwelt (LfU) wird das Projekt in den kommenden fünf Jahren vorangetrieben. +++
18/19.02.2025
- Auftakt zur Aktualisierung des Brutvogelatlasses ADEBAR
Von 2005 bis 2009 sammelten über 700 begeisterte Ornithologinnen und Ornithologen in Bayern beeindruckende 137.000 Datensätze auf einer Fläche von 70.000 Quadratkilometern für den bundesweiten Brutvogelatlas ADEBAR. Nun geht das Projekt in die nächste Runde.
2025 startet die Aktualisierung von ADEBAR und bringt innovative Methoden und einen frischen Blick auf Bayerns Brutvogelwelt. Gefördert mit rund 1,6 Millionen Euro und einer eigenen Projektstelle des Bayerischen Landesamtes für Umwelt (LfU) wird das Projekt in den kommenden fünf Jahren vorangetrieben. +++
„Mit unserem bayerischen Beitrag zum Atlas deutscher Brutvogelarten wollen wir nicht nur neue Daten zur Verbreitung und Dichte unserer heimischen Brutvögel erheben, sondern auch die Begeisterung und das Wissen um Bayerns Natur an eine neue Generation weitergeben. Das Projekt ist ein Meilenstein für den Vogelschutz und die Biodiversitätsforschung in Bayern,“ erklärt Dr. Monika Kratzer, Präsidentin des Bayerischen Landesamts für Umwelt. „Dank modernster Technologien wie digitaler Meldeportale und akustischer Methoden können wir die Erhebungen noch präziser und effizienter gestalten.“
Das Projekt ADEBAR ist ein bundesweites Vorhaben unter Leitung des Dachverbandes der Deutschen Avifaunisten. Es besteht eine enge Zusammenarbeit mit den staatlichen Vogelschutzwarten, Fachgesellschaften und Ehrenamtlichen. Die Ornithologische Gesellschaft in Bayern sowie die Landesverbände des BUND Naturschutzes und des Landesbunds für Vogel- und Naturschutz sind dabei zentrale Partner. „ADEBAR schafft eine unverzichtbare Grundlage, um Bayerns Vogelwelt besser zu verstehen und gezielt zu schützen,“ erläutert Robert Pfeifer, Generalsekretär der Ornithologischen Gesellschaft in Bayern. „Dank der wissenschaftlich fundierten Erhebungen können wir Veränderungen in den Beständen unserer Brutvögel präzise dokumentieren und für die Zukunft absichern. Es ist eine Freude, dieses wichtige Projekt mit unserer Expertise zu unterstützen.“
Der neue Brutvogelatlas wird wichtige Informationen über die Verbreitung von rund 250 Vogelarten in Bayern und ganz Deutschland liefern. Die Erhebungen fließen in den nationalen Bericht zur EU-Vogelschutzrichtlinie ein und sind Grundlage für den Schutz der heimischen Brutvögel. Besonders im Hinblick auf die ehrenamtliche Mitarbeit ist der Landesbund für Vogel- und Naturschutz in Bayern ein bedeutender Projektpartner. Dessen Vorsitzender Dr. Norbert Schäffer hebt hervor: „Die Mithilfe von Ehrenamtlichen ist essenziell, um eine flächendeckende Erfassung der Brutvögel in Bayern zu ermöglichen. Das Projekt ADEBAR zeigt einmal mehr, wie wir gemeinsam die Grundlagen für die Vogelschutzarbeit der Zukunft schaffen können – und jede Person kann Teil davon sein.“
Auch der Bund Naturschutz in Bayern e.V. ist ein engagierter Partner. Dessen Artenschutzreferent, Dr. Andreas Zahn, betont: „Die Aktualisierung von ADEBAR ist ein entscheidender Schritt, um die vielfältigen Lebensräume unserer Brutvögel zu sichern. Gerade in Zeiten des Klimawandels müssen wir über fundierte Daten verfügen, um wirkungsvolle Schutzmaßnahmen ergreifen zu können. Dieses Projekt zeigt eindrucksvoll, wie wissenschaftliche Expertise und ehrenamtliches Engagement Hand in Hand gehen können, um die biologische Vielfalt zu bewahren.“
Mit digitalen Plattformen und der Unterstützung erfahrener Mentorinnen und Mentoren bietet ADEBAR eine einfache Möglichkeit, Vogelkundige und Naturbegeisterte in ganz Bayern zu vernetzen. Dabei spielen das Meldeportal ornitho.de sowie die App NaturaList eine zentrale Rolle, um die Beobachtungen systematisch und bayernweit zu dokumentieren. Die Ergebnisse von ADEBAR werden voraussichtlich 2030 vorliegen und dienen als Grundlage für Schutz- und Erhaltungsmaßnahmen in Bayern und darüber hinaus.
Quelle
Bayerisches Landesamt für Umwelt
Bürgermeister-Ulrich-Straße 160
86179 Augsburg
Stand
03.02.2025
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung. Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Das Projekt ADEBAR ist ein bundesweites Vorhaben unter Leitung des Dachverbandes der Deutschen Avifaunisten. Es besteht eine enge Zusammenarbeit mit den staatlichen Vogelschutzwarten, Fachgesellschaften und Ehrenamtlichen. Die Ornithologische Gesellschaft in Bayern sowie die Landesverbände des BUND Naturschutzes und des Landesbunds für Vogel- und Naturschutz sind dabei zentrale Partner. „ADEBAR schafft eine unverzichtbare Grundlage, um Bayerns Vogelwelt besser zu verstehen und gezielt zu schützen,“ erläutert Robert Pfeifer, Generalsekretär der Ornithologischen Gesellschaft in Bayern. „Dank der wissenschaftlich fundierten Erhebungen können wir Veränderungen in den Beständen unserer Brutvögel präzise dokumentieren und für die Zukunft absichern. Es ist eine Freude, dieses wichtige Projekt mit unserer Expertise zu unterstützen.“
Der neue Brutvogelatlas wird wichtige Informationen über die Verbreitung von rund 250 Vogelarten in Bayern und ganz Deutschland liefern. Die Erhebungen fließen in den nationalen Bericht zur EU-Vogelschutzrichtlinie ein und sind Grundlage für den Schutz der heimischen Brutvögel. Besonders im Hinblick auf die ehrenamtliche Mitarbeit ist der Landesbund für Vogel- und Naturschutz in Bayern ein bedeutender Projektpartner. Dessen Vorsitzender Dr. Norbert Schäffer hebt hervor: „Die Mithilfe von Ehrenamtlichen ist essenziell, um eine flächendeckende Erfassung der Brutvögel in Bayern zu ermöglichen. Das Projekt ADEBAR zeigt einmal mehr, wie wir gemeinsam die Grundlagen für die Vogelschutzarbeit der Zukunft schaffen können – und jede Person kann Teil davon sein.“
Auch der Bund Naturschutz in Bayern e.V. ist ein engagierter Partner. Dessen Artenschutzreferent, Dr. Andreas Zahn, betont: „Die Aktualisierung von ADEBAR ist ein entscheidender Schritt, um die vielfältigen Lebensräume unserer Brutvögel zu sichern. Gerade in Zeiten des Klimawandels müssen wir über fundierte Daten verfügen, um wirkungsvolle Schutzmaßnahmen ergreifen zu können. Dieses Projekt zeigt eindrucksvoll, wie wissenschaftliche Expertise und ehrenamtliches Engagement Hand in Hand gehen können, um die biologische Vielfalt zu bewahren.“
Mit digitalen Plattformen und der Unterstützung erfahrener Mentorinnen und Mentoren bietet ADEBAR eine einfache Möglichkeit, Vogelkundige und Naturbegeisterte in ganz Bayern zu vernetzen. Dabei spielen das Meldeportal ornitho.de sowie die App NaturaList eine zentrale Rolle, um die Beobachtungen systematisch und bayernweit zu dokumentieren. Die Ergebnisse von ADEBAR werden voraussichtlich 2030 vorliegen und dienen als Grundlage für Schutz- und Erhaltungsmaßnahmen in Bayern und darüber hinaus.
Quelle
Bayerisches Landesamt für Umwelt
Bürgermeister-Ulrich-Straße 160
86179 Augsburg
Stand
03.02.2025
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung. Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Artenschutz in Franken®
Ramsar-Nationalbericht zum Schutz von Feuchtgebieten vorgelegt

Ramsar-Nationalbericht zum Schutz von Feuchtgebieten vorgelegt
17/18.02.2025
Der Bericht dokumentiert erfolgreiche Maßnahmen und Aktivitäten des Bundes und der Bundesländer zur Erhaltung und Förderung von Feuchtgebieten in den letzten drei Jahren.
17/18.02.2025
- Berlin. Die Bundesregierung hat ihren nationalen Bericht zum Schutz, zur Wiederherstellung und zur nachhaltigen Nutzung von Feuchtgebieten im Rahmen der internationalen Ramsar-Konvention vorgelegt.
Der Bericht dokumentiert erfolgreiche Maßnahmen und Aktivitäten des Bundes und der Bundesländer zur Erhaltung und Förderung von Feuchtgebieten in den letzten drei Jahren.
Zentrale Elemente zur Umsetzung in Deutschland sind in dieser Berichtsperiode die Nationale Moorschutzstrategie und das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz der Bundesregierung unter Federführung des Bundesumweltministeriums (BMUV). Auch international fördert die Bundesregierung Projekte zur Erhaltung und Wiederherstellung von Feuchtgebieten im Rahmen der Internationalen Klimaschutzinitiative (IKI). Deutschland ist zudem der Danube WILDisland Ramsar-Regionalinitiative in der Donau-Region beigetreten. Außerdem hat das BMUV erstmals einen nationalen Jugendvertreter für die Ramsar-Konvention ernannt.
Bundesumweltministerin Steffi Lemke: „Feuchtgebiete, wie Moore, Auen und Marschland, spielen eine entscheidende Rolle beim natürlichen Klimaschutz und der Anpassung an die Folgen der Klimakrise. Mit dem Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz fördern wir in Deutschland Maßnahmen, um den Zustand dieser Ökosysteme und ihre Klimaschutzleistungen zu verbessern. Im Rahmen der Nationalen Moorschutzstrategie ist neben dem Schutz intakter Moore auch die Wiederherstellung und nachhaltige Bewirtschaftung bisher entwässerter Moorböden ein zentrales Thema“.
BfN-Präsidentin Sabine Riewenherm: „Feuchtgebiete, wie Moore, Küsten, Seen, Flüsse, Mangroven sind die vielseitigsten und gleichzeitig am stärksten bedrohten Ökosysteme der Erde. Auf nationaler Ebene unterstützt Deutschland den Schutz, die Wiederherstellung und die nachhaltige Nutzung von Feuchtgebieten auf vielfältige Weise, so zum Beispiel auch durch die Renaturierung von Bundeswasserstraßen und ihren Auen im Rahmen des Bundesprogramms 'Blaues Band'.“
Die Ramsar-Nationalberichte sind zentrale Bestandteile der Vorbereitung auf die Vertragsstaatenkonferenzen der Ramsar-Konvention. Alle drei Jahre legen die Mitgliedsstaaten der Ramsar-Konvention anhand dieser detaillierten Berichte die Umsetzung der Konvention dar. Die nächste Vertragsstaatenkonferenz findet vom 23. bis 31. Juli 2025 in Simbabwe statt. Neben der Nationalen Moorschutzstrategie und dem Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz stellt der Bericht die folgenden Maßnahmen und Aktivitäten Deutschlands vor:
Beitritt Deutschlands zur Danube WILDisland Ramsar-Regionalinitiative in der Donau-Region
Die „wilden Inseln“ der Donau gelten als ökologisch besonders hochwertig und stehen im Mittelpunkt der Initiative. Durch die gesteigerte grenz- und länderübergreifende Zusammenarbeit auf einem Gebiet von 3.000 Kilometer Flusslänge in zehn Ländern, sollen über 900 dieser Inseln geschützt und bewahrt werden. Übergeordnetes Ziel ist, die ökologische Konnektivität entlang der Donau zu stärken, die natürliche Wildnis im Herzen Europas zu bewahren, Feuchtgebiete zu erhalten und die Flussdynamik der Donau zu fördern. Das BMUV wird die Initiative über drei Jahre mit rund 225.000 EUR beim Aufbau von Kapazitäten, Maßnahmen zur Vernetzung und Kommunikation unterstützen. Die Initiative wurde von der Dachorganisation der Donauschutzgebiete DANUBEPARKS entwickelt.
Auch über den Donauraum hinaus leistet Deutschland einen Beitrag zum Schutz, zur Wiederherstellung und zur nachhaltigen Nutzung von Feuchtgebietsökosystemen. Im Rahmen der Internationalen Klimaschutzinitiative (IKI) fördert die Bundesregierung mit 8 Millionen Euro beispielsweise die Erhaltung und Wiederherstellung von Seen und Feuchtgebieten sowie den Schutz der damit verbundenen Biodiversität in zehn Ländern Südamerikas, Afrikas und Asiens.
Ausweitung der Öffentlichkeits- und Jugendarbeit zur Bedeutung von Feuchtgebieten:
Um das Bewusstsein für Feuchtgebiete bei jungen Menschen zu stärken, hat Deutschland einen Jugendvertreter für die Feuchtgebietskonvention ernannt, welcher auch die Belange junger Menschen in die Arbeit zur Umsetzung der Konvention in Deutschland, aber auch international einbringen soll.
Um die Öffentlichkeitsarbeit in der Zukunft zu unterstützen, wird in diesem Jahr eine Broschüre zu den deutschen Ramsar Gebieten entwickelt. Über eine Wanderausstellung werden die Inhalte zudem einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt.
Aktivitäten zur Vernetzung:
Ende November 2024 organisierte das Bundesamt für Naturschutz (BfN) einen wichtigen Workshop zu nationalen Feuchtgebietsinventaren in Europa. Vertreter aus 23 europäischen Ländern tauschten sich über ihre Ansätze dazu aus, einschließlich der Nutzung neuer Technologien hinsichtlich Erdbeobachtung und künstlicher Intelligenz. Die Erfassung des Potentials von Feuchtgebieten für die Speicherung von Kohlenstoff, aber auch für andere wichtige Ökosystemleistungen, setzt eine Inventarisierung der Gebiete voraus.
Hintergrund
Ramsar-Konvention
Die internationale Konvention zum Schutz von Feuchtgebieten verfolgt das Ziel, Feuchtgebiete ganzheitlich zu schützen, nachhaltig zu nutzen sowie Forschung, Bildung und Kommunikation, Weiterbildung und internationale Zusammenarbeit hierzu zu fördern. Die Bundesrepublik Deutschland ist der Ramsar-Konvention im Jahr 1976 beigetreten und beherbergt derzeit 35 Ramsar Gebiete auf einer Fläche von 868.320 Hektar, darunter drei grenzüberschreitende Ramsar Gebiete.
Jährlich wird am 2. Februar mit dem „Weltfeuchtgebietstag“ auf die Bedeutung von Feuchtgebieten und das Bestehen dieses völkerrechtlichen Abkommens hingewiesen. Mittlerweile zählt die Konvention 172 Mitgliedsstaaten. Weltweit konnten bisher 2525 „Feuchtgebiete von internationaler Bedeutung“ ausgewiesen werden.
Mit einer Ausweisung von Ramsar-Feuchtgebieten verpflichten sich die Mitgliedsländer der Ramsar-Konvention zugleich, dafür zu sorgen, dass auch die übrigen Feuchtgebiete innerhalb ihrer Grenzen nachhaltig genutzt werden. Weiterhin sind die Vertragsstaaten zur internationalen Zusammenarbeit aufgefordert. Alle drei Jahre muss eine ausführliche Berichterstattung erfolgen.
In der Aufnahme von © Untere Naturschutzbehörde Rosenheim
Quelle
Bundesamt für Naturschutz (BfN)
Konstantinstr. 110
53179 Bonn
Stand
31.01.2025
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung. Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Bundesumweltministerin Steffi Lemke: „Feuchtgebiete, wie Moore, Auen und Marschland, spielen eine entscheidende Rolle beim natürlichen Klimaschutz und der Anpassung an die Folgen der Klimakrise. Mit dem Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz fördern wir in Deutschland Maßnahmen, um den Zustand dieser Ökosysteme und ihre Klimaschutzleistungen zu verbessern. Im Rahmen der Nationalen Moorschutzstrategie ist neben dem Schutz intakter Moore auch die Wiederherstellung und nachhaltige Bewirtschaftung bisher entwässerter Moorböden ein zentrales Thema“.
BfN-Präsidentin Sabine Riewenherm: „Feuchtgebiete, wie Moore, Küsten, Seen, Flüsse, Mangroven sind die vielseitigsten und gleichzeitig am stärksten bedrohten Ökosysteme der Erde. Auf nationaler Ebene unterstützt Deutschland den Schutz, die Wiederherstellung und die nachhaltige Nutzung von Feuchtgebieten auf vielfältige Weise, so zum Beispiel auch durch die Renaturierung von Bundeswasserstraßen und ihren Auen im Rahmen des Bundesprogramms 'Blaues Band'.“
Die Ramsar-Nationalberichte sind zentrale Bestandteile der Vorbereitung auf die Vertragsstaatenkonferenzen der Ramsar-Konvention. Alle drei Jahre legen die Mitgliedsstaaten der Ramsar-Konvention anhand dieser detaillierten Berichte die Umsetzung der Konvention dar. Die nächste Vertragsstaatenkonferenz findet vom 23. bis 31. Juli 2025 in Simbabwe statt. Neben der Nationalen Moorschutzstrategie und dem Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz stellt der Bericht die folgenden Maßnahmen und Aktivitäten Deutschlands vor:
Beitritt Deutschlands zur Danube WILDisland Ramsar-Regionalinitiative in der Donau-Region
Die „wilden Inseln“ der Donau gelten als ökologisch besonders hochwertig und stehen im Mittelpunkt der Initiative. Durch die gesteigerte grenz- und länderübergreifende Zusammenarbeit auf einem Gebiet von 3.000 Kilometer Flusslänge in zehn Ländern, sollen über 900 dieser Inseln geschützt und bewahrt werden. Übergeordnetes Ziel ist, die ökologische Konnektivität entlang der Donau zu stärken, die natürliche Wildnis im Herzen Europas zu bewahren, Feuchtgebiete zu erhalten und die Flussdynamik der Donau zu fördern. Das BMUV wird die Initiative über drei Jahre mit rund 225.000 EUR beim Aufbau von Kapazitäten, Maßnahmen zur Vernetzung und Kommunikation unterstützen. Die Initiative wurde von der Dachorganisation der Donauschutzgebiete DANUBEPARKS entwickelt.
Auch über den Donauraum hinaus leistet Deutschland einen Beitrag zum Schutz, zur Wiederherstellung und zur nachhaltigen Nutzung von Feuchtgebietsökosystemen. Im Rahmen der Internationalen Klimaschutzinitiative (IKI) fördert die Bundesregierung mit 8 Millionen Euro beispielsweise die Erhaltung und Wiederherstellung von Seen und Feuchtgebieten sowie den Schutz der damit verbundenen Biodiversität in zehn Ländern Südamerikas, Afrikas und Asiens.
Ausweitung der Öffentlichkeits- und Jugendarbeit zur Bedeutung von Feuchtgebieten:
Um das Bewusstsein für Feuchtgebiete bei jungen Menschen zu stärken, hat Deutschland einen Jugendvertreter für die Feuchtgebietskonvention ernannt, welcher auch die Belange junger Menschen in die Arbeit zur Umsetzung der Konvention in Deutschland, aber auch international einbringen soll.
Um die Öffentlichkeitsarbeit in der Zukunft zu unterstützen, wird in diesem Jahr eine Broschüre zu den deutschen Ramsar Gebieten entwickelt. Über eine Wanderausstellung werden die Inhalte zudem einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt.
Aktivitäten zur Vernetzung:
Ende November 2024 organisierte das Bundesamt für Naturschutz (BfN) einen wichtigen Workshop zu nationalen Feuchtgebietsinventaren in Europa. Vertreter aus 23 europäischen Ländern tauschten sich über ihre Ansätze dazu aus, einschließlich der Nutzung neuer Technologien hinsichtlich Erdbeobachtung und künstlicher Intelligenz. Die Erfassung des Potentials von Feuchtgebieten für die Speicherung von Kohlenstoff, aber auch für andere wichtige Ökosystemleistungen, setzt eine Inventarisierung der Gebiete voraus.
Hintergrund
Ramsar-Konvention
Die internationale Konvention zum Schutz von Feuchtgebieten verfolgt das Ziel, Feuchtgebiete ganzheitlich zu schützen, nachhaltig zu nutzen sowie Forschung, Bildung und Kommunikation, Weiterbildung und internationale Zusammenarbeit hierzu zu fördern. Die Bundesrepublik Deutschland ist der Ramsar-Konvention im Jahr 1976 beigetreten und beherbergt derzeit 35 Ramsar Gebiete auf einer Fläche von 868.320 Hektar, darunter drei grenzüberschreitende Ramsar Gebiete.
Jährlich wird am 2. Februar mit dem „Weltfeuchtgebietstag“ auf die Bedeutung von Feuchtgebieten und das Bestehen dieses völkerrechtlichen Abkommens hingewiesen. Mittlerweile zählt die Konvention 172 Mitgliedsstaaten. Weltweit konnten bisher 2525 „Feuchtgebiete von internationaler Bedeutung“ ausgewiesen werden.
Mit einer Ausweisung von Ramsar-Feuchtgebieten verpflichten sich die Mitgliedsländer der Ramsar-Konvention zugleich, dafür zu sorgen, dass auch die übrigen Feuchtgebiete innerhalb ihrer Grenzen nachhaltig genutzt werden. Weiterhin sind die Vertragsstaaten zur internationalen Zusammenarbeit aufgefordert. Alle drei Jahre muss eine ausführliche Berichterstattung erfolgen.
In der Aufnahme von © Untere Naturschutzbehörde Rosenheim
- Rosenheimer Stammbeckenmoore
Quelle
Bundesamt für Naturschutz (BfN)
Konstantinstr. 110
53179 Bonn
Stand
31.01.2025
Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung. Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.
Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.
A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F
Artenschutz in Franken®
Das Eurasische Eichhörnchen an der Winterfütterung

Das Eurasische Eichhörnchen an der Winterfütterung
16/17.02.2025
Hier sind die wichtigsten Gründe und möglichen Probleme:
16/17.02.2025
- Das Eurasische Eichhörnchen (Sciurus vulgaris) besucht im Winter häufig Vogel-Futterstellen, da diese eine leicht zugängliche Nahrungsquelle darstellen.
Hier sind die wichtigsten Gründe und möglichen Probleme:
Gründe für den Besuch von Vogel-Futterstellen durch Eichhörnchen:
Nahrungsmangel im Winter:
Attraktive Futterarten:
Leicht zugängliche Nahrung:
Instinktives Vorratsverhalten:
Probleme durch Eichhörnchen an Vogelfütterungen:
Konkurrenz um Futter:
Zerstörung von Futterspendern:
Verunreinigung des Futters:
Ungewollte Fütterung großer Populationen:
Lösungen:
In der Aufnahme von Helga Zinnecker
Nahrungsmangel im Winter:
- Eichhörnchen ernähren sich hauptsächlich von Nüssen, Samen, Beeren und Pilzen. Im Winter, wenn das Nahrungsangebot knapp ist, bieten Vogelhäuschen eine wertvolle Energiequelle.
Attraktive Futterarten:
- Besonders Sonnenblumenkerne, Nüsse und Fettfutter (z. B. Meisenknödel) sind für Eichhörnchen sehr nahrhaft und daher begehrt.
Leicht zugängliche Nahrung:
- Eichhörnchen sind geschickte Kletterer und können problemlos Futterhäuser oder -silos erreichen, selbst wenn sie für Vögel gedacht sind.
Instinktives Vorratsverhalten:
- Eichhörnchen nehmen oft mehr Futter mit, als sie sofort fressen, und vergraben es als Vorrat für später.
Probleme durch Eichhörnchen an Vogelfütterungen:
Konkurrenz um Futter:
- Eichhörnchen können große Mengen Futter aufnehmen und verdrängen dabei kleinere Vögel, die auf die Winterfütterung angewiesen sind.
Zerstörung von Futterspendern:
- Sie knabbern Plastik- oder Holzkonstruktionen an, um an das Futter zu gelangen, was langfristig zu Schäden führen kann.
Verunreinigung des Futters:
- Eichhörnchen klettern mit schmutzigen Pfoten ins Futter, was zur Verbreitung von Bakterien und Parasiten führen kann.
Ungewollte Fütterung großer Populationen:
- Eine ständige Futterquelle kann dazu führen, dass sich Eichhörnchenpopulationen lokal stark vermehren, was zu weiteren Problemen führt.
Lösungen:
- Eichhörnchen-sichere Futterspender (mit Metallkäfig oder rutschigen Oberflächen)
- Getrennte Futterstellen für Eichhörnchen mit Nüssen in speziellen Futterboxen
- Aufhängung von Vogelhäusern an glatten Metallstangen oder mit speziellen Schutzmanschetten
In der Aufnahme von Helga Zinnecker
- Eichhörnchen an einer Winterfütterung die für Kleinvögel errichtet wurde.
Artenschutz in Franken®
Ein Welterbe für den Mauersegler - Bamberg / Gaustadt 2025

Ein Welterbe für den Mauersegler
15/16.02.2025
Bamberg - Gaustadt / Bayern. Wie auch in anderen Städten der Republik erkennen wir seit geraumer Zeit einen elementaren Rückgang der Vogelart Mauersegler. Neben Nahrungsmangel sind es vornehmlich fehlende Fortpflanzungsstätten die es den Tieren zunehmend schwerer machen sich einer erfolgreichen Arterhaltung zu widmen.
15/16.02.2025
- Ein innovatives Gemeinschaftsprojekt engagiert sich für die Erhaltung der letzten Mauersegler in der Stadt Bamberg.
Bamberg - Gaustadt / Bayern. Wie auch in anderen Städten der Republik erkennen wir seit geraumer Zeit einen elementaren Rückgang der Vogelart Mauersegler. Neben Nahrungsmangel sind es vornehmlich fehlende Fortpflanzungsstätten die es den Tieren zunehmend schwerer machen sich einer erfolgreichen Arterhaltung zu widmen.
Artenschutz in Franken®, Stadt Bamberg – Umweltamt und Privateigentümer möchten dem Verlust der Biodiversität mit einem konkreten, regionalem Schutzprojekt entgegenwirken. Gefördert wird das Projekt durch das Bundesamt für Naturschutz (BfN) mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV)
Mit der Installation einer speziellen Nisthilfenkette wurden vor wenigen Tagen neue Mauersegler Reproduktionsmöglichkeiten geschaffen. An einer geeigneten Bauwerkfassade konnten 5 Nistplätze an einem Privathaus in Gaustadt mit einem Hubsteiger montiert werden.Diese Niststätten bieten kulturfolgenden Kleinvogelarten wie z. B. dem Mauersegler nun geeignete, prädatorensichere Reproduktionsmöglichkeiten. Auch klimatische Faktoren waren Bestandteil des Projekts, denn mehr und mehr (auch traditionelle) Brutplätze verlieren aufgrund des Klimawandels ihre Funktionalität und damit verenden viele Jungtiere, bereits in überhitzen Brutnischen ohne jemals einen ersten Flügelschlag im freien Luftraum erleben zu dürfen.
Die nun hier installierten Nisthilfen wurden neben einer Ansitzschräge die natürliche Fressfeinde, die an den Reproduktionsstandorten in Erscheinung treten könnten, davon abhalten, sich hier niederzulassen, mit Maßnahmen zur Reduzierung einer Brutplatzüberhitzung ausgestattet. Selbstredend das die Nisthilfen in einer nachhaltigen Konzeption ausgeführt wurden, um nach einer Annahme auch viele Jahrzehnte ihrer wertvollen Aufgabe nachkommen zu können.
In der Aufnahme
Mit der Installation einer speziellen Nisthilfenkette wurden vor wenigen Tagen neue Mauersegler Reproduktionsmöglichkeiten geschaffen. An einer geeigneten Bauwerkfassade konnten 5 Nistplätze an einem Privathaus in Gaustadt mit einem Hubsteiger montiert werden.Diese Niststätten bieten kulturfolgenden Kleinvogelarten wie z. B. dem Mauersegler nun geeignete, prädatorensichere Reproduktionsmöglichkeiten. Auch klimatische Faktoren waren Bestandteil des Projekts, denn mehr und mehr (auch traditionelle) Brutplätze verlieren aufgrund des Klimawandels ihre Funktionalität und damit verenden viele Jungtiere, bereits in überhitzen Brutnischen ohne jemals einen ersten Flügelschlag im freien Luftraum erleben zu dürfen.
Die nun hier installierten Nisthilfen wurden neben einer Ansitzschräge die natürliche Fressfeinde, die an den Reproduktionsstandorten in Erscheinung treten könnten, davon abhalten, sich hier niederzulassen, mit Maßnahmen zur Reduzierung einer Brutplatzüberhitzung ausgestattet. Selbstredend das die Nisthilfen in einer nachhaltigen Konzeption ausgeführt wurden, um nach einer Annahme auch viele Jahrzehnte ihrer wertvollen Aufgabe nachkommen zu können.
In der Aufnahme
- Montierte Nisthilfenkette mit vorgehaltener Ansitzschräge die auch einen Traufkörper imitiert.
Artenschutz in Franken®
Goldammer (Emberiza citrinella)

Die Goldammer (Emberiza citrinella)
14/15.02.2025
Wenn die ersten Strahlen der Sonne das Gras küssen, erhebe ich mich aus dem Gebüsch und singe mein Lied. Ein Lied, das meine Vorfahren schon gesungen haben, lange bevor Menschen Felder pflügten und Straßen bauten. Es ist einfach, aber erfüllt von der Sehnsucht nach einem grenzenlosen Himmel und der Wärme eines sicheren Nestes.
14/15.02.2025
- Ich bin die Goldammer (Emberiza citrinella), ein Geschöpf der Felder und Hecken, ein Sänger in der Morgenröte.
Wenn die ersten Strahlen der Sonne das Gras küssen, erhebe ich mich aus dem Gebüsch und singe mein Lied. Ein Lied, das meine Vorfahren schon gesungen haben, lange bevor Menschen Felder pflügten und Straßen bauten. Es ist einfach, aber erfüllt von der Sehnsucht nach einem grenzenlosen Himmel und der Wärme eines sicheren Nestes.
Ich lebe von dem, was die Erde mir schenkt – Samen, kleine Insekten, manchmal ein Wurm. Meine Füße spüren die raue Rinde der Büsche, mein Blick schweift über das Land, das einst wilder war, grüner, lebendiger. Heute sehe ich Felder, die sich in strengen Linien erstrecken, weniger Hecken, weniger unberührte Wiesen. Manchmal frage ich mich: Werden meine Kinder noch genügend Platz zum Leben finden?
Ich bin nicht allein. Ich habe einen Partner, eine Familie, ein Nest verborgen im dichten Gestrüpp. Ich baue es mit Geduld, mit Halmen und Moos, in der Hoffnung, dass kein Fuchs, keine Sense, kein Traktor es zerstört. Doch die Welt verändert sich schnell, schneller als meine Flügel mich tragen können.
Und doch singe ich. Denn mein Lied ist mein Erbe, meine Sprache, mein Herz. Es trägt meine Hoffnung in die Welt, auf dass sie mich nicht vergisst.
In der Aufnahme von Helga Zinnecker
Ich bin nicht allein. Ich habe einen Partner, eine Familie, ein Nest verborgen im dichten Gestrüpp. Ich baue es mit Geduld, mit Halmen und Moos, in der Hoffnung, dass kein Fuchs, keine Sense, kein Traktor es zerstört. Doch die Welt verändert sich schnell, schneller als meine Flügel mich tragen können.
Und doch singe ich. Denn mein Lied ist mein Erbe, meine Sprache, mein Herz. Es trägt meine Hoffnung in die Welt, auf dass sie mich nicht vergisst.
In der Aufnahme von Helga Zinnecker
- Goldammer (Emberiza citrinella)
Artenschutz in Franken®
Amsel (Turdus merula)

Die Amsel (Turdus merula)
13/14.02.2025
Meine Gestalt ist von einer eleganten Schlichtheit geprägt: schwarz mit einem auffälligen orangefarbenen Schnabel, der meine Art leicht erkennbar macht.
13/14.02.2025
- Als Amsel (Turdus merula) betrachtet man mich oft als eine der vertrautesten Singvogelarten in vielen Lebensräumen Europas und darüber hinaus.
Meine Gestalt ist von einer eleganten Schlichtheit geprägt: schwarz mit einem auffälligen orangefarbenen Schnabel, der meine Art leicht erkennbar macht.
In meinem täglichen Leben erforsche ich die Welt hauptsächlich durch meine Lieder und mein Verhalten. Mein Gesang ist nicht nur ein Mittel zur Kommunikation, sondern auch eine künstlerische Äußerung meiner Selbst und meines Territoriums. Die melodischen Töne, die ich von mir gebe, sind Teil eines komplexen Codes, der sowohl die Weibchen anzieht als auch andere Männchen warnt, dass dieses Territorium besetzt ist.
Meine Nahrungssuche ist ebenfalls eine kritische Aktivität. Als Allesfresser ernähre ich mich von Insekten, Würmern, Beeren und Früchten. Dies hält mich nicht nur gesund, sondern ermöglicht es mir auch, ein wichtiger Teil des ökologischen Gleichgewichts zu sein, indem ich die Populationen von Schädlingen reguliere und Samen verbreite.
Jenseits meines alltäglichen Lebens spiegeln sich in meinem Verhalten tiefe Überlegungen wider. Die Wahl meines Nistplatzes, die Art und Weise, wie ich mein Territorium verteidige, und sogar die Komplexität meines Gesangs sind Zeugnisse für die evolutionäre Anpassung und die enge Verbundenheit mit meiner Umwelt. Als Individuum und als Art strebe ich danach, mich anzupassen und zu überleben, während ich gleichzeitig zur Vielfalt und zum Wohlergehen der natürlichen Welt beitrage.
So betrachtet, bin ich nicht nur eine Amsel, sondern auch ein lebendiges Beispiel für die Schönheit und den Sinn in der Natur, durchdrungen von einem feinen Netzwerk biologischer und ökologischer Interaktionen.
In der Aufnahme von Helga Zinnecker
Meine Nahrungssuche ist ebenfalls eine kritische Aktivität. Als Allesfresser ernähre ich mich von Insekten, Würmern, Beeren und Früchten. Dies hält mich nicht nur gesund, sondern ermöglicht es mir auch, ein wichtiger Teil des ökologischen Gleichgewichts zu sein, indem ich die Populationen von Schädlingen reguliere und Samen verbreite.
Jenseits meines alltäglichen Lebens spiegeln sich in meinem Verhalten tiefe Überlegungen wider. Die Wahl meines Nistplatzes, die Art und Weise, wie ich mein Territorium verteidige, und sogar die Komplexität meines Gesangs sind Zeugnisse für die evolutionäre Anpassung und die enge Verbundenheit mit meiner Umwelt. Als Individuum und als Art strebe ich danach, mich anzupassen und zu überleben, während ich gleichzeitig zur Vielfalt und zum Wohlergehen der natürlichen Welt beitrage.
So betrachtet, bin ich nicht nur eine Amsel, sondern auch ein lebendiges Beispiel für die Schönheit und den Sinn in der Natur, durchdrungen von einem feinen Netzwerk biologischer und ökologischer Interaktionen.
In der Aufnahme von Helga Zinnecker
- Amselmännchen
Artenschutz in Franken®
Ein Welterbe für den Mauersegler 2025 - Auferstehungskirche - Bamberg

Ein Welterbe für den Mauersegler 2025 - Auferstehungskirche - Bamberg
12/13.02.2025
• Ein innovatives Gemeinschaftsprojekt engagiert sich für die Erhaltung der letzten Mauersegler in der Stadt Bamberg.
Bamberg / Bayern. Wie auch in anderen Städten der Republik erkennen wir seit geraumer Zeit einen elementaren Rückgang der Vogelart Mauersegler. Neben Nahrungsmangel sind es vornehmlich fehlende Fortpflanzungsstätten die den Tieren zunehmend schwerer machen sich einer erfolgreichen Arterhaltung zu widmen.
Artenschutz in Franken®, Stadt Bamberg – Umweltamt und die Evang.-Luth. Kirchengemeinde Auferstehungskirche Bamberg möchten dem Verlust der Biodiversität mit einem konkreten, regionalem Schutzprojekt entgegenwirken. Gefördert wird das Projekt durch das Bundesamt für Naturschutz (BfN) mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV).
12/13.02.2025
• Ein innovatives Gemeinschaftsprojekt engagiert sich für die Erhaltung der letzten Mauersegler in der Stadt Bamberg.
Bamberg / Bayern. Wie auch in anderen Städten der Republik erkennen wir seit geraumer Zeit einen elementaren Rückgang der Vogelart Mauersegler. Neben Nahrungsmangel sind es vornehmlich fehlende Fortpflanzungsstätten die den Tieren zunehmend schwerer machen sich einer erfolgreichen Arterhaltung zu widmen.
Artenschutz in Franken®, Stadt Bamberg – Umweltamt und die Evang.-Luth. Kirchengemeinde Auferstehungskirche Bamberg möchten dem Verlust der Biodiversität mit einem konkreten, regionalem Schutzprojekt entgegenwirken. Gefördert wird das Projekt durch das Bundesamt für Naturschutz (BfN) mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV).
- Mit der Installation einer speziellen Nisthilfenkette wurden neue Mauersegler Reproduktionsmöglichkeiten geschaffen werden.
Diese Niststätten bieten kulturfolgenden Kleinvogelarten wie z. B. dem Mauersegler nun geeignete, prädatorensichere Reproduktionsmöglichkeiten. Auch klimatische Faktoren waren Bestandteil des Projekts, denn mehr und mehr (auch traditionelle) Brutplätze verlieren aufgrund des Klimawandels ihre Funktionalität und damit verenden viele Jungtiere, bereits in überhitzen Brutnischen ohne jemals einen ersten Flügelschlag im freien Luftraum erleben zu dürfen.
Die hier vorgesehenen Nisthilfen, die wir von diesem Hersteller bereits mehrfach mit Erfolg einsetzten, sind mit einer Ansitzschräge ausgestattet, welche natürliche Fressfeinde, die an den Reproduktionsstandorten in Erscheinung treten könnten, davon abhalten, sich hier niederzulassen.Selbstredend das die Nisthilfen in einer nachhaltigen Konzeption ausgeführt wurden, um nach einer Annahme auch viele Jahrzehnte ihrer wertvollen Aufgabe nachkommen zu können.
Mauersegler sind faszinierende Vögel, die oft in urbanen Umgebungen wie Kirchen nisten. Der Schutz dieser Art ist wichtig, da ihr Bestand in vielen Regionen rückläufig ist. Um Mauerseglern an Kirchen zu helfen, haben wir speziell auf die Gegebenheiten zugeschnittene Nisthilfen verwendet.
Diese Nisthilfen wurden exakt in die Zwischenräume der Schalllamellen eingepasst und in den Dachstuhl Innenbereich geführt.Solche Artenschutzmaßnahmen sind von großer Bedeutung, da sie helfen, den Lebensraum für gefährdete Arten wie den Mauersegler in städtischen Gebieten zu bewahren. Durch den Schutz ihrer Nistplätze tragen diese Maßnahmen dazu bei, dass diese Vögel auch in Zukunft einen sicheren Rückzugsort finden können, trotz der zunehmenden urbanen Entwicklung und der damit verbundenen Herausforderungen.
In der Aufnahme
• Eingebrachte Nisthilfen nach erfolgreicher Montage - lediglich die Anflugrosetten sind aus der Ferne erkennbar.
Die hier vorgesehenen Nisthilfen, die wir von diesem Hersteller bereits mehrfach mit Erfolg einsetzten, sind mit einer Ansitzschräge ausgestattet, welche natürliche Fressfeinde, die an den Reproduktionsstandorten in Erscheinung treten könnten, davon abhalten, sich hier niederzulassen.Selbstredend das die Nisthilfen in einer nachhaltigen Konzeption ausgeführt wurden, um nach einer Annahme auch viele Jahrzehnte ihrer wertvollen Aufgabe nachkommen zu können.
Mauersegler sind faszinierende Vögel, die oft in urbanen Umgebungen wie Kirchen nisten. Der Schutz dieser Art ist wichtig, da ihr Bestand in vielen Regionen rückläufig ist. Um Mauerseglern an Kirchen zu helfen, haben wir speziell auf die Gegebenheiten zugeschnittene Nisthilfen verwendet.
Diese Nisthilfen wurden exakt in die Zwischenräume der Schalllamellen eingepasst und in den Dachstuhl Innenbereich geführt.Solche Artenschutzmaßnahmen sind von großer Bedeutung, da sie helfen, den Lebensraum für gefährdete Arten wie den Mauersegler in städtischen Gebieten zu bewahren. Durch den Schutz ihrer Nistplätze tragen diese Maßnahmen dazu bei, dass diese Vögel auch in Zukunft einen sicheren Rückzugsort finden können, trotz der zunehmenden urbanen Entwicklung und der damit verbundenen Herausforderungen.
In der Aufnahme
• Eingebrachte Nisthilfen nach erfolgreicher Montage - lediglich die Anflugrosetten sind aus der Ferne erkennbar.
Artenschutz in Franken®
Die Amsel (Turdus merula)

Amsel (Turdus merula)
11/12.02.2025
Meine Gestalt ist von einer eleganten Schlichtheit geprägt: schwarz mit einem auffälligen orangefarbenen Schnabel, der meine Art leicht erkennbar macht.
11/12.02.2025
- Als Amsel (Turdus merula) betrachtet man mich oft als eine der vertrautesten Singvogelarten in vielen Lebensräumen Europas und darüber hinaus.
Meine Gestalt ist von einer eleganten Schlichtheit geprägt: schwarz mit einem auffälligen orangefarbenen Schnabel, der meine Art leicht erkennbar macht.
In meinem täglichen Leben erforsche ich die Welt hauptsächlich durch meine Lieder und mein Verhalten. Mein Gesang ist nicht nur ein Mittel zur Kommunikation, sondern auch eine künstlerische Äußerung meiner Selbst und meines Territoriums. Die melodischen Töne, die ich von mir gebe, sind Teil eines komplexen Codes, der sowohl die Weibchen anzieht als auch andere Männchen warnt, dass dieses Territorium besetzt ist.
Meine Nahrungssuche ist ebenfalls eine kritische Aktivität. Als Allesfresser ernähre ich mich von Insekten, Würmern, Beeren und Früchten. Dies hält mich nicht nur gesund, sondern ermöglicht es mir auch, ein wichtiger Teil des ökologischen Gleichgewichts zu sein, indem ich die Populationen von Schädlingen reguliere und Samen verbreite.
Jenseits meines alltäglichen Lebens spiegeln sich in meinem Verhalten tiefe Überlegungen wider. Die Wahl meines Nistplatzes, die Art und Weise, wie ich mein Territorium verteidige, und sogar die Komplexität meines Gesangs sind Zeugnisse für die evolutionäre Anpassung und die enge Verbundenheit mit meiner Umwelt. Als Individuum und als Art strebe ich danach, mich anzupassen und zu überleben, während ich gleichzeitig zur Vielfalt und zum Wohlergehen der natürlichen Welt beitrage.
So betrachtet, bin ich nicht nur eine Amsel, sondern auch ein lebendiges Beispiel für die Schönheit und den Sinn in der Natur, durchdrungen von einem feinen Netzwerk biologischer und ökologischer Interaktionen.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
Meine Nahrungssuche ist ebenfalls eine kritische Aktivität. Als Allesfresser ernähre ich mich von Insekten, Würmern, Beeren und Früchten. Dies hält mich nicht nur gesund, sondern ermöglicht es mir auch, ein wichtiger Teil des ökologischen Gleichgewichts zu sein, indem ich die Populationen von Schädlingen reguliere und Samen verbreite.
Jenseits meines alltäglichen Lebens spiegeln sich in meinem Verhalten tiefe Überlegungen wider. Die Wahl meines Nistplatzes, die Art und Weise, wie ich mein Territorium verteidige, und sogar die Komplexität meines Gesangs sind Zeugnisse für die evolutionäre Anpassung und die enge Verbundenheit mit meiner Umwelt. Als Individuum und als Art strebe ich danach, mich anzupassen und zu überleben, während ich gleichzeitig zur Vielfalt und zum Wohlergehen der natürlichen Welt beitrage.
So betrachtet, bin ich nicht nur eine Amsel, sondern auch ein lebendiges Beispiel für die Schönheit und den Sinn in der Natur, durchdrungen von einem feinen Netzwerk biologischer und ökologischer Interaktionen.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
- Männchen auf einem Ast der mit dem Pilz "Gelber Zitterling" besetzt ist.
Artenschutz in Franken®
Erdkröte (Bufo bufo)

Die Erdkröte (Bufo bufo)
10/11.02.2025
Sie spielt eine wichtige Rolle in vielen Ökosystemen und hat einige faszinierende Eigenschaften.
Hier ist eine Übersicht:
10/11.02.2025
- Die Erdkröte (Bufo bufo) ist eine der bekanntesten Amphibienarten Europas und gehört zur Familie der Kröten (Bufonidae).
Sie spielt eine wichtige Rolle in vielen Ökosystemen und hat einige faszinierende Eigenschaften.
Hier ist eine Übersicht:
Aussehen
Lebensraum und Verbreitung
Verhalten
Fortpflanzung
Besonderheiten
Gefährdung
Erdkröten sind keine akut bedrohte Art, aber sie leiden unter Lebensraumverlust, dem Bau von Straßen (viele sterben während der Krötenwanderung) und der Verschmutzung von Gewässern. Viele Naturschützer bauen sogenannte Krötentunnel oder Zäune, um sie während ihrer Wanderungen zu schützen. Die Erdkröte mag unscheinbar wirken, aber sie ist ein wichtiger Bestandteil unseres Ökosystems – ein kleiner, stiller Held, der für das Gleichgewicht in der Natur sorgt!
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
- Größe: Weibchen sind mit 8–13 cm deutlich größer als Männchen (5–9 cm).
- Farbe: Erdkröten sind meist braun, olivfarben oder rötlich, was ihnen eine hervorragende Tarnung in ihrem natürlichen Lebensraum verleiht.
- Haut: Ihre warzige Haut ist ein charakteristisches Merkmal und schützt sie vor Feinden. Die Hautdrüsen produzieren ein leicht giftiges Sekret (Bufotoxin), das für viele Fressfeinde unappetitlich ist.
Lebensraum und Verbreitung
- Lebensraum: Erdkröten leben in Wäldern, Wiesen, Parks und Gärten. Sie bevorzugen feuchte Lebensräume, sind aber auch in trockeneren Umgebungen anzutreffen.
- Verbreitung: Sie kommen in weiten Teilen Europas und Asiens vor, von Spanien bis nach Sibirien.
Verhalten
- Nachtaktiv: Erdkröten sind vor allem nachts aktiv und verbringen den Tag oft versteckt unter Laub, Steinen oder in Erdlöchern.
- Bewegung: Sie bewegen sich meist kriechend oder in kurzen Sprüngen – anders als die agilen Frösche, die weit springen.
- Ernährung: Erdkröten sind Fleischfresser. Sie ernähren sich von Insekten, Schnecken, Würmern und anderen kleinen Tieren, die sie mit ihrer klebrigen Zunge fangen.
Fortpflanzung
- Laichzeit: Im Frühjahr wandern Erdkröten oft kilometerweit zu Gewässern, um sich fortzupflanzen. Diese Wanderungen sind bekannt als „Krötenwanderungen“.
- Paarung: Die Männchen klammern sich an den Weibchen fest (sogenannter „Amplexus“) und begleiten sie ins Wasser.
- Laich: Weibchen legen lange Laichschnüre mit Tausenden von Eiern in stehenden oder langsam fließenden Gewässern ab. Die Kaulquappen schlüpfen nach wenigen Tagen und entwickeln sich innerhalb von 2–3 Monaten zu kleinen Kröten.
Besonderheiten
- Schutzmechanismen: Ihr Bufotoxin schützt sie vor vielen Fressfeinden wie Füchsen oder Ratten, ist aber für Menschen ungefährlich, solange es nicht in die Augen oder in den Mund gelangt.
- Langlebigkeit: In der Natur können Erdkröten 10–12 Jahre alt werden, in Gefangenschaft sogar noch älter.
- Nützliche Helfer: Sie fressen viele Schädlinge und tragen so zur natürlichen Schädlingsbekämpfung bei.
Gefährdung
Erdkröten sind keine akut bedrohte Art, aber sie leiden unter Lebensraumverlust, dem Bau von Straßen (viele sterben während der Krötenwanderung) und der Verschmutzung von Gewässern. Viele Naturschützer bauen sogenannte Krötentunnel oder Zäune, um sie während ihrer Wanderungen zu schützen. Die Erdkröte mag unscheinbar wirken, aber sie ist ein wichtiger Bestandteil unseres Ökosystems – ein kleiner, stiller Held, der für das Gleichgewicht in der Natur sorgt!
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
- Erdkrötenpaar
Artenschutz in Franken®
Die Tollkirsche (Atropa)

Tollkirsche (Atropa)
09/10.02.2025
Sie umfasst mehrere Arten, darunter Atropa belladonna, die am bekanntesten ist.
09/10.02.2025
- Die Tollkirsche, wissenschaftlich bekannt als Atropa, ist eine Pflanzengattung in der Familie der Nachtschattengewächse (Solanaceae).
Sie umfasst mehrere Arten, darunter Atropa belladonna, die am bekanntesten ist.
Botanik und Aussehen:
Verbreitung und Habitat:
Chemische Bestandteile:
Toxische Wirkung und Gefahren:
Historische und medizinische Verwendung:
Kulturelle Bedeutung und Mythologie:
Die Tollkirsche ist also eine faszinierende Pflanze mit einer reichen Geschichte, jedoch wegen ihrer starken Toxizität und potenziell tödlichen Wirkung sollte sie mit äußerster Vorsicht behandelt werden.
In der Aufnahme von Helga Zinnecker
- Atropa belladonna ist eine mehrjährige krautige Pflanze, die eine Höhe von bis zu 1,5 Metern erreichen kann. Sie hat große, elliptische Blätter und wächst buschig.
- Die Blüten sind glockenförmig, purpurfarben und hängen einzeln an kurzen Stielen.
Verbreitung und Habitat:
- Tollkirschen sind in Europa, Westasien und Teilen Nordafrikas heimisch. Sie bevorzugen schattige Wälder und wachsen oft an Waldrändern.
Chemische Bestandteile:
- Hauptwirkstoffe der Tollkirsche sind Alkaloide wie Atropin, Scopolamin und Hyoscyamin. Diese Alkaloide sind stark toxisch und wirken auf das zentrale Nervensystem sowie das vegetative Nervensystem.
Toxische Wirkung und Gefahren:
- Alle Teile der Tollkirschen, insbesondere die Beeren, enthalten die giftigen Alkaloide. Der Verzehr kann zu schwerwiegenden Vergiftungen führen, die lebensbedrohlich sein können.
- Symptome einer Vergiftung sind unter anderem Mundtrockenheit, Erbrechen, Sehstörungen, Halluzinationen, Krämpfe und im Extremfall Atemlähmung.
Historische und medizinische Verwendung:
- Historisch wurde Atropa belladonna in der Medizin verwendet, hauptsächlich als starkes Mittel gegen Krämpfe und zur Pupillenerweiterung.
- Heutzutage ist die Verwendung aufgrund der Toxizität stark eingeschränkt und wird vor allem in der pharmazeutischen Industrie unter strengen Kontrollen genutzt.
Kulturelle Bedeutung und Mythologie:
- Tollkirschen haben eine lange Geschichte in der Folklore und Mythologie. Sie wurden mit Hexerei und mystischen Kräften in Verbindung gebracht, was ihre Aura der Gefährlichkeit verstärkt.
Die Tollkirsche ist also eine faszinierende Pflanze mit einer reichen Geschichte, jedoch wegen ihrer starken Toxizität und potenziell tödlichen Wirkung sollte sie mit äußerster Vorsicht behandelt werden.
In der Aufnahme von Helga Zinnecker
- Tollkirsche in Blüt
Artenschutz in Franken®
Artenschutzmaßnahme Zauneidechse
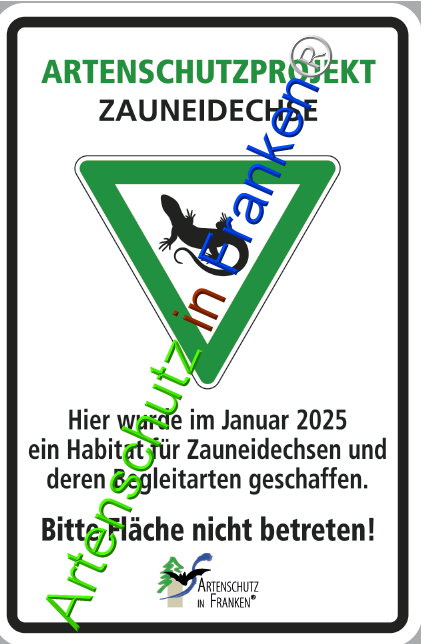
A.i.F- Artenschutzmaßnahme Zauneidechse 2025
08/09.02.2025
Die Zauneidechse (Lacerta agilis) ist eine bedeutende Reptilienart in Mitteleuropa, die aufgrund ihrer Lebensweise und Habitatansprüche stark von landwirtschaftlichen Veränderungen betroffen ist. In agrarisch geprägten Landschaften spielen Artenschutzmaßnahmen eine entscheidende Rolle für den Erhalt und die Förderung dieser Art sowie der sie begleitenden Biotopgemeinschaften.
08/09.02.2025
- Bericht über die Bedeutung von Artenschutzmaßnahmen für die Zauneidechse und Begleitarten entlang von Flurwegen in landwirtschaftlich beeinträchtigten Gebieten
Die Zauneidechse (Lacerta agilis) ist eine bedeutende Reptilienart in Mitteleuropa, die aufgrund ihrer Lebensweise und Habitatansprüche stark von landwirtschaftlichen Veränderungen betroffen ist. In agrarisch geprägten Landschaften spielen Artenschutzmaßnahmen eine entscheidende Rolle für den Erhalt und die Förderung dieser Art sowie der sie begleitenden Biotopgemeinschaften.
Die Zauneidechse bevorzugt trockene, sonnenexponierte Lebensräume wie Magerrasen, Heiden und offene Waldgebiete. Diese Habitate sind jedoch durch intensive Landwirtschaft, insbesondere durch großflächige Monokulturen und intensive Bewirtschaftung, stark fragmentiert und gefährdet. Die Zerschneidung ihrer Lebensräume durch Straßen und landwirtschaftliche Nutzflächen sowie der Verlust von Strukturelementen wie Steinriegeln und Totholz stellen bedeutende Bedrohungen für die Populationen dar.
Artenschutzmaßnahmen für die Zauneidechse und ihre Begleitarten sind essentiell, um die Biodiversität in agrarisch genutzten Landschaften zu erhalten. Diese Maßnahmen umfassen die Schaffung und Pflege von strukturreichen Flächen entlang von Flurwegen, die als wichtige Korridore und Refugien für die Art dienen. Durch gezielte Renaturierungsmaßnahmen können ehemals intensiv genutzte Bereiche wieder naturnäher gestaltet werden, indem beispielsweise Hecken, Steinhaufen und extensiv bewirtschaftete Randstreifen angelegt werden.
Besonders entlang von Flurwegen entfalten Artenschutzmaßnahmen ihre hohe Bedeutung für die Zauneidechse. Diese Wege dienen nicht nur als Verbindungselemente zwischen verschiedenen Habitaten, sondern bieten durch ihre oft extensivere Nutzung und die Anlage struktur- und artenreicher Begleitflächen ideale Bedingungen für die Eidechsenpopulationen. Hier können sich Populationen stabilisieren und ausbreiten, wenn ihnen geeignete Lebensraumstrukturen zur Verfügung gestellt werden.
Effektive Maßnahmen zur Förderung der Zauneidechse entlang von Flurwegen umfassen die Anlage von sonnenexponierten Aufwärmplätzen, die gezielte Bepflanzung mit standorttypischen Gehölzen und die Schaffung von Strukturelementen wie Totholzhaufen und Steinhaufen. Zudem ist eine extensive Bewirtschaftung der Randbereiche von Flurwegen von großer Bedeutung, um die Biodiversität zu fördern und Nahrungsgrundlagen sowie Deckungsmöglichkeiten für die Zauneidechse zu gewährleisten.
Fazit: Die Umsetzung von Artenschutzmaßnahmen für die Zauneidechse entlang von Flurwegen in landwirtschaftlich genutzten Gebieten ist von herausragender Bedeutung für den Erhalt dieser artenreichen Lebensräume. Durch die gezielte Anlage und Pflege strukturreicher Flächen können nicht nur die Lebensbedingungen der Zauneidechse verbessert, sondern auch die Biodiversität insgesamt gefördert werden. Es gilt, diese Maßnahmen weiter zu intensivieren und durch gezielte Monitoringprogramme zu begleiten, um langfristig den Schutz und die Stabilität der Populationen zu gewährleisten.
In der Abbildung
Artenschutzmaßnahmen für die Zauneidechse und ihre Begleitarten sind essentiell, um die Biodiversität in agrarisch genutzten Landschaften zu erhalten. Diese Maßnahmen umfassen die Schaffung und Pflege von strukturreichen Flächen entlang von Flurwegen, die als wichtige Korridore und Refugien für die Art dienen. Durch gezielte Renaturierungsmaßnahmen können ehemals intensiv genutzte Bereiche wieder naturnäher gestaltet werden, indem beispielsweise Hecken, Steinhaufen und extensiv bewirtschaftete Randstreifen angelegt werden.
Besonders entlang von Flurwegen entfalten Artenschutzmaßnahmen ihre hohe Bedeutung für die Zauneidechse. Diese Wege dienen nicht nur als Verbindungselemente zwischen verschiedenen Habitaten, sondern bieten durch ihre oft extensivere Nutzung und die Anlage struktur- und artenreicher Begleitflächen ideale Bedingungen für die Eidechsenpopulationen. Hier können sich Populationen stabilisieren und ausbreiten, wenn ihnen geeignete Lebensraumstrukturen zur Verfügung gestellt werden.
Effektive Maßnahmen zur Förderung der Zauneidechse entlang von Flurwegen umfassen die Anlage von sonnenexponierten Aufwärmplätzen, die gezielte Bepflanzung mit standorttypischen Gehölzen und die Schaffung von Strukturelementen wie Totholzhaufen und Steinhaufen. Zudem ist eine extensive Bewirtschaftung der Randbereiche von Flurwegen von großer Bedeutung, um die Biodiversität zu fördern und Nahrungsgrundlagen sowie Deckungsmöglichkeiten für die Zauneidechse zu gewährleisten.
Fazit: Die Umsetzung von Artenschutzmaßnahmen für die Zauneidechse entlang von Flurwegen in landwirtschaftlich genutzten Gebieten ist von herausragender Bedeutung für den Erhalt dieser artenreichen Lebensräume. Durch die gezielte Anlage und Pflege strukturreicher Flächen können nicht nur die Lebensbedingungen der Zauneidechse verbessert, sondern auch die Biodiversität insgesamt gefördert werden. Es gilt, diese Maßnahmen weiter zu intensivieren und durch gezielte Monitoringprogramme zu begleiten, um langfristig den Schutz und die Stabilität der Populationen zu gewährleisten.
In der Abbildung
- Um auch "Unwissende" ... die gerne als solche auftreten explizit auf die Maßnahme hinzuweisen wurden entsprechende Infoeinheiten entwickelt.
Artenschutz in Franken®
Die Glänzende Binsenjungfer (Lestes dryas)

Ein Tag im Leben der Glänzenden Binsenjungfer (Lestes dryas)
07/08.02.2025
Cool, oder? Klingt fast wie der Name einer Superheldin. Und irgendwie bin ich das auch – naja, zumindest in meinem kleinen Reich. Ich lebe gerne an stillen Teichen, Tümpeln und Wassergräben. Mein schimmerndes Kleid aus Grün, Blau und ein bisschen Gold glitzert, wenn die Sonne auf mich fällt. Also, wenn du mich mal siehst, dann guck genau hin – ich bin quasi die Disco-Kugel der Libellenwelt!
07/08.02.2025
- Hey du! Ich bin Lestes dryas, aber die meisten nennen mich Glänzende Binsenjungfer.
Cool, oder? Klingt fast wie der Name einer Superheldin. Und irgendwie bin ich das auch – naja, zumindest in meinem kleinen Reich. Ich lebe gerne an stillen Teichen, Tümpeln und Wassergräben. Mein schimmerndes Kleid aus Grün, Blau und ein bisschen Gold glitzert, wenn die Sonne auf mich fällt. Also, wenn du mich mal siehst, dann guck genau hin – ich bin quasi die Disco-Kugel der Libellenwelt!
Mein Alltag – Arbeit und Spaß
Mein Tag beginnt, wenn die Sonne aufgeht. Da setze ich mich auf einen Halm oder einen Ast in der Nähe vom Wasser und wärme meine Flügel auf. Ohne Sonne bin ich nämlich ziemlich faul. Aber sobald ich warmgelaufen bin – oder besser gesagt, warmgeflattert –, geht’s los! Ich sause los und patrouilliere über das Wasser. Ich halte Ausschau nach kleinen Insekten, die ich fangen und futtern kann. Man könnte sagen, ich bin eine ziemlich gute Fliegerin, so eine Art Flugakrobatin. Einmal habe ich einen Mückenwirt im Flug geschnappt – das war ein richtiger Volltreffer!
Manchmal halte ich kurz inne, setze mich an ein Blatt und denke nach. Zum Beispiel darüber, wie verrückt es ist, dass ich mit meinen riesigen Augen fast alles um mich herum sehen kann. Stell dir mal vor, du könntest mit deinen Augen fast bis in den Hinterkopf gucken! Aber trotzdem, obwohl ich alles sehe, frage ich mich manchmal, ob ihr Menschen uns Libellen überhaupt bemerkt.
Lustige Momente
Ich muss zugeben, dass ich auch ziemlich eitel bin. Wenn meine Flügel nicht perfekt glänzen, kann ich stundenlang damit beschäftigt sein, sie zu putzen. Einmal habe ich so lange an meinen Flügeln herumgewischt, dass ich fast einen vorbeifliegenden Kollegen übersehen hätte. Wir sind dann zusammen fast in einen Schilfhalm gekracht! Ich lache immer noch, wenn ich daran denke.
Und was die Jungs angeht … oh Mann! Wenn ein Männchen mich beeindrucken will, tanzt er manchmal wie ein kleiner Showstar um mich herum. Manche sind echt süß, aber andere machen so viel Drama, dass ich einfach wegfliege.
Meine Sorgen
Obwohl mein Leben glänzend aussieht, habe ich manchmal auch dunkle Gedanken. Früher gab es überall Tümpel und Teiche, wo ich leben konnte. Jetzt verschwinden sie immer mehr. Ihr Menschen macht alles trocken oder baut Häuser darauf. Ich frage mich oft: Was passiert, wenn es irgendwann keine Teiche mehr gibt? Wo soll ich dann hin?
Und dann gibt’s da noch diese großen Maschinen, die die Wiesen mähen, ohne darauf zu achten, dass da jemand wie ich sitzt. Ich meine, hallo? Könnt ihr nicht ein bisschen vorsichtiger sein?
Mein Wunsch an euch
Ich wünschte, ihr würdet uns Libellen ein bisschen mehr Platz lassen. Lasst die Wiesen am Wasser ruhig ein bisschen wild wachsen, damit wir uns verstecken und nisten können. Und wenn ihr mal an einem Teich seid, schaut genau hin. Vielleicht entdeckt ihr mich oder meine Freunde. Wir Libellen sind nicht nur hübsch, sondern auch wichtig. Wir futtern Mücken und andere nervige Insekten und sorgen dafür, dass die Natur im Gleichgewicht bleibt.
Zum Schluss …
Ich bin vielleicht klein, aber ich lebe schnell, wild und glänzend. Wenn ich eines gelernt habe, dann das: Genieße jeden Moment! Denn wer weiß, was morgen kommt? Also, falls ihr mal einen Moment für uns habt, schnappt euch einen Liegestuhl, setzt euch an einen Teich, und schaut uns bei unseren Flugshows zu. Ich verspreche, es wird glänzend!
Eure Glänzende Binsenjungfer
In der Aufnahme von Albert Meier
Mein Tag beginnt, wenn die Sonne aufgeht. Da setze ich mich auf einen Halm oder einen Ast in der Nähe vom Wasser und wärme meine Flügel auf. Ohne Sonne bin ich nämlich ziemlich faul. Aber sobald ich warmgelaufen bin – oder besser gesagt, warmgeflattert –, geht’s los! Ich sause los und patrouilliere über das Wasser. Ich halte Ausschau nach kleinen Insekten, die ich fangen und futtern kann. Man könnte sagen, ich bin eine ziemlich gute Fliegerin, so eine Art Flugakrobatin. Einmal habe ich einen Mückenwirt im Flug geschnappt – das war ein richtiger Volltreffer!
Manchmal halte ich kurz inne, setze mich an ein Blatt und denke nach. Zum Beispiel darüber, wie verrückt es ist, dass ich mit meinen riesigen Augen fast alles um mich herum sehen kann. Stell dir mal vor, du könntest mit deinen Augen fast bis in den Hinterkopf gucken! Aber trotzdem, obwohl ich alles sehe, frage ich mich manchmal, ob ihr Menschen uns Libellen überhaupt bemerkt.
Lustige Momente
Ich muss zugeben, dass ich auch ziemlich eitel bin. Wenn meine Flügel nicht perfekt glänzen, kann ich stundenlang damit beschäftigt sein, sie zu putzen. Einmal habe ich so lange an meinen Flügeln herumgewischt, dass ich fast einen vorbeifliegenden Kollegen übersehen hätte. Wir sind dann zusammen fast in einen Schilfhalm gekracht! Ich lache immer noch, wenn ich daran denke.
Und was die Jungs angeht … oh Mann! Wenn ein Männchen mich beeindrucken will, tanzt er manchmal wie ein kleiner Showstar um mich herum. Manche sind echt süß, aber andere machen so viel Drama, dass ich einfach wegfliege.
Meine Sorgen
Obwohl mein Leben glänzend aussieht, habe ich manchmal auch dunkle Gedanken. Früher gab es überall Tümpel und Teiche, wo ich leben konnte. Jetzt verschwinden sie immer mehr. Ihr Menschen macht alles trocken oder baut Häuser darauf. Ich frage mich oft: Was passiert, wenn es irgendwann keine Teiche mehr gibt? Wo soll ich dann hin?
Und dann gibt’s da noch diese großen Maschinen, die die Wiesen mähen, ohne darauf zu achten, dass da jemand wie ich sitzt. Ich meine, hallo? Könnt ihr nicht ein bisschen vorsichtiger sein?
Mein Wunsch an euch
Ich wünschte, ihr würdet uns Libellen ein bisschen mehr Platz lassen. Lasst die Wiesen am Wasser ruhig ein bisschen wild wachsen, damit wir uns verstecken und nisten können. Und wenn ihr mal an einem Teich seid, schaut genau hin. Vielleicht entdeckt ihr mich oder meine Freunde. Wir Libellen sind nicht nur hübsch, sondern auch wichtig. Wir futtern Mücken und andere nervige Insekten und sorgen dafür, dass die Natur im Gleichgewicht bleibt.
Zum Schluss …
Ich bin vielleicht klein, aber ich lebe schnell, wild und glänzend. Wenn ich eines gelernt habe, dann das: Genieße jeden Moment! Denn wer weiß, was morgen kommt? Also, falls ihr mal einen Moment für uns habt, schnappt euch einen Liegestuhl, setzt euch an einen Teich, und schaut uns bei unseren Flugshows zu. Ich verspreche, es wird glänzend!
Eure Glänzende Binsenjungfer
In der Aufnahme von Albert Meier
Artenschutz in Franken®
Die Dickkopf-Schmalbiene (Lasioglossum glabriusculum)

Mein Leben als Dickkopf-Schmalbiene (Lasioglossum glabriusculum)
06/07.02.2025
Manche sagen, ich sei unscheinbar, weil ich so klein bin und meine Flügel nicht schillernd wie bei anderen Bienen aussehen. Aber für mich bin ich etwas Besonderes, und ich möchte euch von meinem Leben erzählen, so wie ich es sehe.
06/07.02.2025
- Hallo! Ich bin eine Dickkopf-Schmalbiene, oder wie die Wissenschaftler mich nennen: Lasioglossum glabriusculum.
Manche sagen, ich sei unscheinbar, weil ich so klein bin und meine Flügel nicht schillernd wie bei anderen Bienen aussehen. Aber für mich bin ich etwas Besonderes, und ich möchte euch von meinem Leben erzählen, so wie ich es sehe.
Ich bin ungefähr so lang wie der Fingernagel von einem Menschenkind. Mein Körper ist dunkel und glänzend, fast schwarz, aber wenn die Sonne auf mich scheint, blitze ich manchmal ein bisschen. Ich habe zarte Flügel, die mir helfen, Blumen zu besuchen. Ich liebe Blumen! Nicht nur, weil sie schön aussehen, sondern weil sie mein Zuhause und meine Küche sind.
Jeden Tag fliege ich los und suche nach Nektar und Pollen. Ich mag es, auf kleine, unscheinbare Blüten zu fliegen, die andere Bienen oft übersehen. Wisst ihr, ich fühle mich manchmal wie eine Beschützerin von Pflanzen, die sonst vielleicht niemand beachten würde. Vielleicht ist das mein Job hier in der Welt – den kleinen, stillen Blumen zu helfen.
Warum wir Bienen wichtig sind
Ich weiß, ihr Menschen denkt oft an Honigbienen, wenn ihr "Biene" hört. Aber wir Wildbienen sind genauso wichtig! Ohne uns gäbe es viele Früchte und Pflanzen nicht, weil wir sie bestäuben. Wenn ich von einer Blume zur nächsten fliege, nehme ich Pollen mit. Es ist, als ob ich Blumen helfe, Babys zu bekommen. Ist das nicht irgendwie wunderschön?
Manchmal fühle ich mich aber auch traurig. Ihr Menschen seid so groß, und oft merkt ihr gar nicht, dass wir da sind. Unsere Nester sind in der Erde, an Stellen, die trocken und sandig sind. Doch immer öfter wird dort gebaut oder alles zugepflastert. Dann weiß ich nicht, wo ich noch leben soll.
Was mich beschäftigt
Manchmal frage ich mich, ob die Welt uns Wildbienen irgendwann vergisst. Viele von uns sind schon ausgestorben. Manchmal, wenn ich unterwegs bin und es plötzlich keine Blumen mehr gibt, habe ich Angst. Was, wenn es morgen keinen Nektar mehr gibt? Oder keine Plätze, um ein Nest zu bauen?
Ich finde, die Menschen könnten ein bisschen mehr wie wir sein. Wir nehmen nur, was wir wirklich brauchen, und wir kümmern uns um die Blumen, die uns ernähren. Wir haben keine großen Häuser oder Maschinen, aber wir machen die Welt ein kleines Stückchen besser, weil wir sie bunter und lebendiger machen.
Mein Wunsch
Wenn ich mir etwas von euch Menschenkindern wünschen dürfte, dann wäre es: schaut genau hin! Seht, wie viele kleine Lebewesen um euch herum existieren, und helft uns. Baut vielleicht ein kleines Blumenbeet oder lasst uns eine Ecke in eurem Garten, wo es wild bleiben darf.
Ich bin nur eine kleine Biene, aber ich glaube fest daran, dass wir alle – ob groß oder klein – etwas Besonderes beitragen können. Ich hoffe, dass ihr uns Wildbienen nicht vergesst, denn ohne uns wäre die Welt nicht nur weniger bunt, sondern auch ein Stück leerer.
Danke, dass ihr mir zuhört.
Eure Dickkopf-Schmalbiene
Aufnahme von Willibald Lang
Jeden Tag fliege ich los und suche nach Nektar und Pollen. Ich mag es, auf kleine, unscheinbare Blüten zu fliegen, die andere Bienen oft übersehen. Wisst ihr, ich fühle mich manchmal wie eine Beschützerin von Pflanzen, die sonst vielleicht niemand beachten würde. Vielleicht ist das mein Job hier in der Welt – den kleinen, stillen Blumen zu helfen.
Warum wir Bienen wichtig sind
Ich weiß, ihr Menschen denkt oft an Honigbienen, wenn ihr "Biene" hört. Aber wir Wildbienen sind genauso wichtig! Ohne uns gäbe es viele Früchte und Pflanzen nicht, weil wir sie bestäuben. Wenn ich von einer Blume zur nächsten fliege, nehme ich Pollen mit. Es ist, als ob ich Blumen helfe, Babys zu bekommen. Ist das nicht irgendwie wunderschön?
Manchmal fühle ich mich aber auch traurig. Ihr Menschen seid so groß, und oft merkt ihr gar nicht, dass wir da sind. Unsere Nester sind in der Erde, an Stellen, die trocken und sandig sind. Doch immer öfter wird dort gebaut oder alles zugepflastert. Dann weiß ich nicht, wo ich noch leben soll.
Was mich beschäftigt
Manchmal frage ich mich, ob die Welt uns Wildbienen irgendwann vergisst. Viele von uns sind schon ausgestorben. Manchmal, wenn ich unterwegs bin und es plötzlich keine Blumen mehr gibt, habe ich Angst. Was, wenn es morgen keinen Nektar mehr gibt? Oder keine Plätze, um ein Nest zu bauen?
Ich finde, die Menschen könnten ein bisschen mehr wie wir sein. Wir nehmen nur, was wir wirklich brauchen, und wir kümmern uns um die Blumen, die uns ernähren. Wir haben keine großen Häuser oder Maschinen, aber wir machen die Welt ein kleines Stückchen besser, weil wir sie bunter und lebendiger machen.
Mein Wunsch
Wenn ich mir etwas von euch Menschenkindern wünschen dürfte, dann wäre es: schaut genau hin! Seht, wie viele kleine Lebewesen um euch herum existieren, und helft uns. Baut vielleicht ein kleines Blumenbeet oder lasst uns eine Ecke in eurem Garten, wo es wild bleiben darf.
Ich bin nur eine kleine Biene, aber ich glaube fest daran, dass wir alle – ob groß oder klein – etwas Besonderes beitragen können. Ich hoffe, dass ihr uns Wildbienen nicht vergesst, denn ohne uns wäre die Welt nicht nur weniger bunt, sondern auch ein Stück leerer.
Danke, dass ihr mir zuhört.
Eure Dickkopf-Schmalbiene
Aufnahme von Willibald Lang
- Dickkopf-Schmalbiene
Artenschutz in Franken®
Fledermäuse als Profiteur von PV Freiflächenanlagen – Eine Untersuchung des AiF

Fledermäuse als Profiteur von PV Freiflächenanlagen – Eine Untersuchung des Artenschutz in Franken®
05/06.02.2025
Eine neue Untersuchung des Artenschutz in Franken® die 3 PV Freiflächenanlagen über 3,5 Jahre hinweg in den Fokus nahm (2021 - 2025) und noch immer nimmt, konnte interessante Ergebnisse dokumentieren. Diese Fläche waren vormals intensiv landwirtschaftlich genutzt und stellten sich in den ersten beiden Jahren als nahezu fledermausfrei dar. Bereits im ersten Jahr der Flächenumgestaltung traten erste Fledermäuse in Erscheinung, die sich hier zur Nahrungsaufnahme einfanden. Dieses Ergebnis zeigte sich in zunehmender Form auch im darauffolgenden Jahr. Wir setzen unsere Untersuchung weitere 5 Jahre fort, um eine möglichst aussagekräftige Studie vorhalten zu können.
05/06.02.2025
Eine neue Untersuchung des Artenschutz in Franken® die 3 PV Freiflächenanlagen über 3,5 Jahre hinweg in den Fokus nahm (2021 - 2025) und noch immer nimmt, konnte interessante Ergebnisse dokumentieren. Diese Fläche waren vormals intensiv landwirtschaftlich genutzt und stellten sich in den ersten beiden Jahren als nahezu fledermausfrei dar. Bereits im ersten Jahr der Flächenumgestaltung traten erste Fledermäuse in Erscheinung, die sich hier zur Nahrungsaufnahme einfanden. Dieses Ergebnis zeigte sich in zunehmender Form auch im darauffolgenden Jahr. Wir setzen unsere Untersuchung weitere 5 Jahre fort, um eine möglichst aussagekräftige Studie vorhalten zu können.
- Fledermäuse können tatsächlich von Photovoltaik (PV) Freiflächenanlagen profitieren, insbesondere wenn diese Anlagen ökologischen Prinzipien folgen und in Gebieten errichtet werden, die zuvor kaum natürliche Lebensräume boten, wie zum Beispiel sterile Feldfluren.
Hier sind einige Wege, wie das geschehen kann:
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass PV-Freiflächenanlagen für Fledermäuse unter bestimmten ökologischen Bedingungen vorteilhaft sein können, indem sie neue Lebensräume schaffen, die Nahrungsverfügbarkeit erhöhen und zur Vernetzung von Lebensräumen beitragen. Durch eine ökologisch sinnvolle Gestaltung können solche Anlagen positive Auswirkungen auf die lokale Biodiversität haben, einschließlich der Populationen von Fledermäusen.
In der Aufnahme von Johannes Rother
- Schaffung neuer Lebensräume: PV-Anlagen können als Struktur genutzt werden, um Lebensräume für Fledermäuse zu schaffen. Unter den PV-Modulen entsteht oft ein mikroklimatischer Raum, der für Fledermäuse attraktiv sein kann, da er Schutz vor Witterung bietet.
- Insektenreichtum: Ökologisch gestaltete PV-Anlagen können dazu beitragen, dass sich die Insektenpopulationen in der Umgebung erhöhen. Fledermäuse ernähren sich hauptsächlich von Insekten, daher profitieren sie indirekt von einer reichhaltigen Nahrungsquelle in der Nähe der Anlagen.
- Verbindung von Lebensräumen: PV-Anlagen können als Teil eines Netzwerks von Grünflächen und Lebensräumen fungieren, die es Fledermäusen ermöglichen, sich zwischen verschiedenen Gebieten zu bewegen und zu leben. Dies ist besonders wichtig in stark fragmentierten Landschaften.
- Minimaler Flächenverbrauch: Im Vergleich zu anderen Energieerzeugungsmethoden wie großen Windparks oder konventionellen Kraftwerken nehmen PV-Anlagen weniger Platz ein und können daher weniger Lebensraum zerstören, was für viele Arten, einschließlich Fledermäusen, vorteilhaft ist.
- Reduktion von Lichtverschmutzung: Gut gestaltete PV-Anlagen können dazu beitragen, Lichtverschmutzung zu reduzieren, was für nachtaktive Tiere wie Fledermäuse wichtig ist, da sie auf ein minimales Lichtniveau angewiesen sind, um ihre natürlichen Verhaltensweisen beizubehalten.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass PV-Freiflächenanlagen für Fledermäuse unter bestimmten ökologischen Bedingungen vorteilhaft sein können, indem sie neue Lebensräume schaffen, die Nahrungsverfügbarkeit erhöhen und zur Vernetzung von Lebensräumen beitragen. Durch eine ökologisch sinnvolle Gestaltung können solche Anlagen positive Auswirkungen auf die lokale Biodiversität haben, einschließlich der Populationen von Fledermäusen.
In der Aufnahme von Johannes Rother
Artenschutz in Franken®
Das Affen-Knabenkraut (Orchis simia)

Affen-Knabenkraut (Orchis simia)
04/05.02.2025
Mein Name? Eine Anspielung auf meine Blüten, die tatsächlich wie kleine, baumelnde Äffchen aussehen – lustig, oder? Aber lass mich dir erzählen, wer ich bin und warum ich eine ganz besondere Orchidee bin.
04/05.02.2025
- Hallo! Ich bin das Affen-Knabenkraut, oder wie die Botaniker mich nennen: Orchis simia.
Mein Name? Eine Anspielung auf meine Blüten, die tatsächlich wie kleine, baumelnde Äffchen aussehen – lustig, oder? Aber lass mich dir erzählen, wer ich bin und warum ich eine ganz besondere Orchidee bin.
Fachlich: Mein botanischer Lebenslauf
Ich bin eine Orchideenart, die in warmen, sonnigen Gegenden Europas und Westasiens zu finden ist. Mein bevorzugter Wohnort sind lichte Wälder, Magerrasen und kalkhaltige Böden. Meine Blütenstände sind dicht gepackt, und jede einzelne Blüte sieht aus wie ein kleines Äffchen – mit Armen, Beinen und einem frechen Kopf! Aber die Ähnlichkeit ist kein Zufall: Es gibt viele Theorien, warum ich so aussehe. Manche sagen, ich locke damit Insekten an, die neugierig auf meinen „affenartigen“ Look sind.
Doch ehrlich gesagt, ich bin nicht so sehr auf Bestäuber angewiesen wie andere Orchideen. Warum? Weil ich zu den selbstbestäubenden Arten gehöre. Das bedeutet, dass ich, wenn mal keine bestäubenden Insekten in der Nähe sind, den Job selbst erledige. Praktisch, oder?
Lustige Seiten: Mein Name sorgt für Lacher
Hast du je bemerkt, wie Menschen über meinen Namen schmunzeln? „Affen-Knabenkraut“ – das klingt wie eine Mischung aus Zirkus und Botanik. Aber hey, wenn ich mit meinem Namen ein Lächeln auf Gesichter zaubern kann, dann habe ich schon einen Teil meiner Mission erfüllt!
Nachdenklich: Die Bedeutung meiner Existenz
Während ich hier so wachse und meine Äffchen-Bühne präsentiere, werde ich oft daran erinnert, wie zerbrechlich meine Welt ist. Ich bin ein Kind der Natur, und mein Überleben hängt von den Böden, den Insekten und dem Klima ab. Leider wird mein Lebensraum durch menschliche Eingriffe wie Landwirtschaft, Bebauung und Klimawandel immer knapper. Dabei bin ich nicht nur eine Orchidee, ich bin ein kleiner Botschafter für die Schönheit und den Reichtum der Natur.
Wenn du mich siehst, nimm dir einen Moment Zeit, um innezuhalten. Meine Äffchen sind nicht nur witzig, sie erzählen auch eine Geschichte über das Zusammenspiel von Evolution, Schönheit und Zerbrechlichkeit. Und wer weiß? Vielleicht erinnere ich dich daran, dass selbst die kleinsten Dinge in der Natur – wie eine Blume mit Äffchen-Blüten – eine große Bedeutung haben.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
Ich bin eine Orchideenart, die in warmen, sonnigen Gegenden Europas und Westasiens zu finden ist. Mein bevorzugter Wohnort sind lichte Wälder, Magerrasen und kalkhaltige Böden. Meine Blütenstände sind dicht gepackt, und jede einzelne Blüte sieht aus wie ein kleines Äffchen – mit Armen, Beinen und einem frechen Kopf! Aber die Ähnlichkeit ist kein Zufall: Es gibt viele Theorien, warum ich so aussehe. Manche sagen, ich locke damit Insekten an, die neugierig auf meinen „affenartigen“ Look sind.
Doch ehrlich gesagt, ich bin nicht so sehr auf Bestäuber angewiesen wie andere Orchideen. Warum? Weil ich zu den selbstbestäubenden Arten gehöre. Das bedeutet, dass ich, wenn mal keine bestäubenden Insekten in der Nähe sind, den Job selbst erledige. Praktisch, oder?
Lustige Seiten: Mein Name sorgt für Lacher
Hast du je bemerkt, wie Menschen über meinen Namen schmunzeln? „Affen-Knabenkraut“ – das klingt wie eine Mischung aus Zirkus und Botanik. Aber hey, wenn ich mit meinem Namen ein Lächeln auf Gesichter zaubern kann, dann habe ich schon einen Teil meiner Mission erfüllt!
Nachdenklich: Die Bedeutung meiner Existenz
Während ich hier so wachse und meine Äffchen-Bühne präsentiere, werde ich oft daran erinnert, wie zerbrechlich meine Welt ist. Ich bin ein Kind der Natur, und mein Überleben hängt von den Böden, den Insekten und dem Klima ab. Leider wird mein Lebensraum durch menschliche Eingriffe wie Landwirtschaft, Bebauung und Klimawandel immer knapper. Dabei bin ich nicht nur eine Orchidee, ich bin ein kleiner Botschafter für die Schönheit und den Reichtum der Natur.
Wenn du mich siehst, nimm dir einen Moment Zeit, um innezuhalten. Meine Äffchen sind nicht nur witzig, sie erzählen auch eine Geschichte über das Zusammenspiel von Evolution, Schönheit und Zerbrechlichkeit. Und wer weiß? Vielleicht erinnere ich dich daran, dass selbst die kleinsten Dinge in der Natur – wie eine Blume mit Äffchen-Blüten – eine große Bedeutung haben.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
- Das Affen - Knabenkraut ... die Form ihrer Blüten gab ihr den Namen. Und tatsächlich bei genauem Hinsehen sehen diese wie aufrecht stehende kleine Äffchen aus. Eventuell hat auch dies dazu geführt das diese schöne Orchidee sehr selten geworden ist.
Artenschutz in Franken®
Die Bienen-Ragwurz (Ophrys apifera)

Bienen-Ragwurz (Ophrys apifera)
03/04.02.2025
Also, ich bin eine faszinierende Orchideenart, die für ihre bemerkenswerte Ähnlichkeit mit einer Biene bekannt ist. Das ist nicht nur ein Zufall, sondern eine clevere Evolutionstrick, um männliche Bienen anzulocken und zur Bestäubung zu verführen.
03/04.02.2025
- Als Bienen-Ragwurz (Ophrys apifera) kann ich dir aus meiner eigenen Perspektive einiges über mich erzählen!
Also, ich bin eine faszinierende Orchideenart, die für ihre bemerkenswerte Ähnlichkeit mit einer Biene bekannt ist. Das ist nicht nur ein Zufall, sondern eine clevere Evolutionstrick, um männliche Bienen anzulocken und zur Bestäubung zu verführen.
Fachlich gesehen bin ich ein Meister der Täuschung. Meine Blütenblätter und Form imitieren die Gestalt und Textur einer weiblichen Biene so perfekt, dass selbst erfahrene Bienenmännchen irregeführt werden. Wenn sie mich umkreisen, denken sie, sie hätten eine potenzielle Partnerin gefunden, und währenddessen transferieren sie unbewusst Pollen von einer meiner Blüten zur nächsten.
Lustig wird es, wenn man bedenkt, wie ich die Instinkte der Bienen ausnutze. Sie sind so fasziniert von mir, dass sie ihre Zeit damit verbringen, mich zu umschwärmen, ohne zu bemerken, dass sie in Wirklichkeit nur meinen Fortpflanzungserfolg fördern. Man könnte sagen, ich habe eine ziemlich erfolgreiche Karriere als Blüten-Bee-täuscherin!
Nachdenklich betrachtet, zeigt meine Existenz, wie raffiniert und anpassungsfähig die Natur sein kann. Die Evolution hat mich perfektioniert, um in einer Umgebung zu gedeihen, in der jede kleine Anpassung über Leben und Tod entscheiden kann. Meine Täuschungskünste sind ein Beispiel dafür, wie Organismen sich im Laufe der Zeit entwickeln, um spezifische ökologische Nischen zu besetzen und ihre Fortpflanzung zu sichern.
Also, das nächste Mal, wenn du eine Bienen-Ragwurz siehst, denk daran, dass hinter meiner vermeintlichen Einfachheit eine komplexe Strategie steckt, die mich zu einem Meister der Überlebenskunst macht!
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
Lustig wird es, wenn man bedenkt, wie ich die Instinkte der Bienen ausnutze. Sie sind so fasziniert von mir, dass sie ihre Zeit damit verbringen, mich zu umschwärmen, ohne zu bemerken, dass sie in Wirklichkeit nur meinen Fortpflanzungserfolg fördern. Man könnte sagen, ich habe eine ziemlich erfolgreiche Karriere als Blüten-Bee-täuscherin!
Nachdenklich betrachtet, zeigt meine Existenz, wie raffiniert und anpassungsfähig die Natur sein kann. Die Evolution hat mich perfektioniert, um in einer Umgebung zu gedeihen, in der jede kleine Anpassung über Leben und Tod entscheiden kann. Meine Täuschungskünste sind ein Beispiel dafür, wie Organismen sich im Laufe der Zeit entwickeln, um spezifische ökologische Nischen zu besetzen und ihre Fortpflanzung zu sichern.
Also, das nächste Mal, wenn du eine Bienen-Ragwurz siehst, denk daran, dass hinter meiner vermeintlichen Einfachheit eine komplexe Strategie steckt, die mich zu einem Meister der Überlebenskunst macht!
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
- Trockenrasen werden vom Bienen- Ragwurz bevorzugt bewachsen. Die Wuchshöhe der Rote Listen Art kann bis über einen halben Meter betragen.Blütezeit vom Mai bis Juli
Artenschutz in Franken®
Mittelspecht (Leiopicus medius)

Der Mittelspecht (Leiopicus medius)
02/03.02.2025
Hier sind einige ausführliche Informationen über diese Vogelart:
02/03.02.2025
- Der Mittelspecht (Leiopicus medius) ist eine mittelgroße Spechtart, die in Europa und Teilen Asiens verbreitet ist.
Hier sind einige ausführliche Informationen über diese Vogelart:
Beschreibung:
Der Mittelspecht ist etwa 20-22 cm lang und damit etwas kleiner als der Buntspecht. Er hat eine auffällige schwarze und weiße Zeichnung am Gefieder, die ihm eine kontrastreiche Erscheinung verleiht. Die Oberseite ist vorwiegend schwarz mit weißen Flecken, während die Unterseite weißlich bis leicht rosa gefärbt ist. Auffällig sind auch die rote Kappe und die roten "Hosen" bei männlichen Individuen.
Verbreitung und Lebensraum:
Sein Verbreitungsgebiet erstreckt sich über große Teile Europas und Asiens. In Europa findet man ihn vor allem in Laub- und Mischwäldern, aber auch in Parks und größeren Gärten. Er ist kein Zugvogel und verbringt das ganze Jahr in seinem Lebensraum.
Verhalten und Ernährung:
Der Mittelspecht ernährt sich hauptsächlich von Insekten, die er durch Klopfen und Hacken aus der Rinde von Bäumen herauslöst. Dabei bevorzugt er vor allem Buchen- und Eichenwälder, wo er in der Rinde nach Nahrung sucht. Er ist ein geschickter Kletterer und kann sich gut an senkrechten Baumstämmen festhalten.
Fortpflanzung:
Die Brutzeit des Mittelspechts beginnt im Frühjahr. Das Weibchen legt in eine Baumhöhle, die es selbst hackt, etwa 4-6 Eier. Beide Elternvögel beteiligen sich an der Brut und der Aufzucht der Jungen, die nach dem Schlupf etwa 3-4 Wochen im Nest verbringen, bevor sie flügge werden.
Schutzstatus und Gefährdung:
Der Mittelspecht gilt in vielen Teilen seines Verbreitungsgebiets als nicht gefährdet. Dennoch sind einige Populationen durch den Verlust ihres Lebensraums und Pestizideinsatz bedroht. In einigen Ländern steht er unter Naturschutz, um seine Bestände zu schützen.
Interaktion mit Menschen:
Obwohl der Mittelspecht weniger scheu als andere Spechtarten ist, ist er aufgrund seines Lebensraums oft schwer zu beobachten. Sein charakteristischer Trommelruf, der zum Revierverhalten gehört, ist jedoch oft zu hören, besonders im Frühjahr während der Paarungszeit.
Fazit:
Der Mittelspecht ist ein faszinierender Vogel, der durch seine auffällige Färbung und sein Verhalten im Wald besticht. Seine Rolle im Ökosystem als Insektenfresser und sein Verhalten bei der Brut machen ihn zu einem wichtigen Teil der natürlichen Fauna in Europa und Asien.
Aufnahme von Helga Zinnecker
Der Mittelspecht ist etwa 20-22 cm lang und damit etwas kleiner als der Buntspecht. Er hat eine auffällige schwarze und weiße Zeichnung am Gefieder, die ihm eine kontrastreiche Erscheinung verleiht. Die Oberseite ist vorwiegend schwarz mit weißen Flecken, während die Unterseite weißlich bis leicht rosa gefärbt ist. Auffällig sind auch die rote Kappe und die roten "Hosen" bei männlichen Individuen.
Verbreitung und Lebensraum:
Sein Verbreitungsgebiet erstreckt sich über große Teile Europas und Asiens. In Europa findet man ihn vor allem in Laub- und Mischwäldern, aber auch in Parks und größeren Gärten. Er ist kein Zugvogel und verbringt das ganze Jahr in seinem Lebensraum.
Verhalten und Ernährung:
Der Mittelspecht ernährt sich hauptsächlich von Insekten, die er durch Klopfen und Hacken aus der Rinde von Bäumen herauslöst. Dabei bevorzugt er vor allem Buchen- und Eichenwälder, wo er in der Rinde nach Nahrung sucht. Er ist ein geschickter Kletterer und kann sich gut an senkrechten Baumstämmen festhalten.
Fortpflanzung:
Die Brutzeit des Mittelspechts beginnt im Frühjahr. Das Weibchen legt in eine Baumhöhle, die es selbst hackt, etwa 4-6 Eier. Beide Elternvögel beteiligen sich an der Brut und der Aufzucht der Jungen, die nach dem Schlupf etwa 3-4 Wochen im Nest verbringen, bevor sie flügge werden.
Schutzstatus und Gefährdung:
Der Mittelspecht gilt in vielen Teilen seines Verbreitungsgebiets als nicht gefährdet. Dennoch sind einige Populationen durch den Verlust ihres Lebensraums und Pestizideinsatz bedroht. In einigen Ländern steht er unter Naturschutz, um seine Bestände zu schützen.
Interaktion mit Menschen:
Obwohl der Mittelspecht weniger scheu als andere Spechtarten ist, ist er aufgrund seines Lebensraums oft schwer zu beobachten. Sein charakteristischer Trommelruf, der zum Revierverhalten gehört, ist jedoch oft zu hören, besonders im Frühjahr während der Paarungszeit.
Fazit:
Der Mittelspecht ist ein faszinierender Vogel, der durch seine auffällige Färbung und sein Verhalten im Wald besticht. Seine Rolle im Ökosystem als Insektenfresser und sein Verhalten bei der Brut machen ihn zu einem wichtigen Teil der natürlichen Fauna in Europa und Asien.
Aufnahme von Helga Zinnecker
- Mittelspecht an Futtrestelle welche von Menschen eingerichtet wurde
Artenschutz in Franken®
Der Gänsegeier (Gyps fulvus)

Der Gänsegeier (Gyps fulvus)
01/02.02.2025
Meine Perspektive ist anders als die der Lebewesen, die am Boden verweilen. Ich sehe alles von oben, aus Höhen, die so weit reichen, dass selbst eure Sorgen klein wirken. Doch auch wir Geier haben unsere Gedanken, und unser Leben ist ein ständiger Balanceakt zwischen Existenz und dem Verschwinden.
01/02.02.2025
- Ein Gruß von den Lüften – ich bin der Gänsegeier (Gyps fulvus), ein Herrscher der Thermik und ein stiller Zeuge der Zyklen des Lebens.
Meine Perspektive ist anders als die der Lebewesen, die am Boden verweilen. Ich sehe alles von oben, aus Höhen, die so weit reichen, dass selbst eure Sorgen klein wirken. Doch auch wir Geier haben unsere Gedanken, und unser Leben ist ein ständiger Balanceakt zwischen Existenz und dem Verschwinden.
Wer ich bin
Ich bin ein großer, kräftiger Vogel, der mit einer Spannweite von bis zu 2,8 Metern majestätisch durch die Lüfte gleitet. Mein Körper ist mit hellbraunen bis beigen Federn bedeckt, während mein Hals, umgeben von einem weißen Kragen aus Flaumfedern, nackt ist – eine Anpassung, die mir hilft, sauber zu bleiben, wenn ich Nahrung finde. Mein Schnabel, stark und gebogen, ist perfekt, um Fleisch von Knochen zu lösen. Ihr nennt mich oft „Aasfresser“, doch für mich bin ich ein Reiniger der Natur, ein stiller Helfer im ewigen Kreislauf des Lebens.
Mein Alltag in der Luft und am Boden
Ich bin ein Geschöpf des Himmels, das stundenlang auf der Suche nach Nahrung durch die Lüfte gleitet. Meine Augen sind scharf wie Messer, und mit ihnen entdecke ich selbst aus großer Höhe, was für euch verborgen bleibt: die Zeichen des Endes.Es ist nicht einfach, das zu tun, was ich tue. Ihr Menschen seht mich manchmal als düsteres Symbol, als Begleiter des Todes. Doch ich sehe es anders: Ich helfe, die Natur sauber und gesund zu halten. Ohne mich würden die Überreste der Sterblichen verrotten und Krankheiten verbreiten.
Wenn ich Nahrung finde, arbeite ich mit meinen Artgenossen zusammen. Gemeinsam zerlegen wir das, was übrig geblieben ist. Es ist eine Szene, die vielleicht chaotisch wirkt, aber sie ist ein Teil der Ordnung des Lebens. Selbst wenn ich den Boden berühre, bin ich ein Vogel der Lüfte, und ich kehre bald zurück in meine Welt über den Wolken.
Mein Zuhause
Ich niste hoch in den Felsen, an Orten, die sicher und schwer zugänglich sind. Dort ziehe ich meine Jungen groß – mit Geduld und Hingabe. Unser Nest ist einfach, aber es ist mein ganzes Universum in diesen Momenten. Die Aufzucht eines einzigen Kükens pro Jahr ist eine Herausforderung, aber es ist meine größte Aufgabe. In diesen Augenblicken bin ich nicht nur Geier, sondern auch Beschützer, Lehrer und Begleiter.
Die Welt, wie ich sie sehe
Von oben betrachtet ist die Welt wunderschön – endlose Wälder, weite Felder und tiefe Schluchten. Doch ich sehe auch, wie sich diese Welt verändert. Eure Dörfer wachsen, eure Straßen zerschneiden unsere Flugrouten, und eure Giftköder liegen wie Fallen, die wir nicht verstehen.
Die Sorgen eines Geiers
Gift und Gier:
Der Verlust der Herden:
Die Angst vor Unwissenheit:
Was ich euch mitgeben möchte
Ich fliege höher, als ihr euch je erheben könnt, und doch bin ich Teil derselben Erde wie ihr. Mein Leben mag für euch fremd erscheinen, doch ich trage zur Balance bei, von der auch ihr abhängt. Seht in mir keinen düsteren Boten, sondern einen Partner, der hilft, das Leben in seiner ganzen Schönheit und Ordnung zu bewahren.
Wenn ihr mich das nächste Mal am Himmel seht, denkt an meinen Flug. Er ist schwerelos und doch voller Bedeutung. Die Welt ist ein Netz, und ich bin nur ein Faden darin – ein Faden, der ebenso wertvoll ist wie alle anderen.
In der Aufnahme von Vogelfotos.de
Ich bin ein großer, kräftiger Vogel, der mit einer Spannweite von bis zu 2,8 Metern majestätisch durch die Lüfte gleitet. Mein Körper ist mit hellbraunen bis beigen Federn bedeckt, während mein Hals, umgeben von einem weißen Kragen aus Flaumfedern, nackt ist – eine Anpassung, die mir hilft, sauber zu bleiben, wenn ich Nahrung finde. Mein Schnabel, stark und gebogen, ist perfekt, um Fleisch von Knochen zu lösen. Ihr nennt mich oft „Aasfresser“, doch für mich bin ich ein Reiniger der Natur, ein stiller Helfer im ewigen Kreislauf des Lebens.
Mein Alltag in der Luft und am Boden
Ich bin ein Geschöpf des Himmels, das stundenlang auf der Suche nach Nahrung durch die Lüfte gleitet. Meine Augen sind scharf wie Messer, und mit ihnen entdecke ich selbst aus großer Höhe, was für euch verborgen bleibt: die Zeichen des Endes.Es ist nicht einfach, das zu tun, was ich tue. Ihr Menschen seht mich manchmal als düsteres Symbol, als Begleiter des Todes. Doch ich sehe es anders: Ich helfe, die Natur sauber und gesund zu halten. Ohne mich würden die Überreste der Sterblichen verrotten und Krankheiten verbreiten.
Wenn ich Nahrung finde, arbeite ich mit meinen Artgenossen zusammen. Gemeinsam zerlegen wir das, was übrig geblieben ist. Es ist eine Szene, die vielleicht chaotisch wirkt, aber sie ist ein Teil der Ordnung des Lebens. Selbst wenn ich den Boden berühre, bin ich ein Vogel der Lüfte, und ich kehre bald zurück in meine Welt über den Wolken.
Mein Zuhause
Ich niste hoch in den Felsen, an Orten, die sicher und schwer zugänglich sind. Dort ziehe ich meine Jungen groß – mit Geduld und Hingabe. Unser Nest ist einfach, aber es ist mein ganzes Universum in diesen Momenten. Die Aufzucht eines einzigen Kükens pro Jahr ist eine Herausforderung, aber es ist meine größte Aufgabe. In diesen Augenblicken bin ich nicht nur Geier, sondern auch Beschützer, Lehrer und Begleiter.
Die Welt, wie ich sie sehe
Von oben betrachtet ist die Welt wunderschön – endlose Wälder, weite Felder und tiefe Schluchten. Doch ich sehe auch, wie sich diese Welt verändert. Eure Dörfer wachsen, eure Straßen zerschneiden unsere Flugrouten, und eure Giftköder liegen wie Fallen, die wir nicht verstehen.
Die Sorgen eines Geiers
Gift und Gier:
- Ihr Menschen legt Giftköder aus, um Tiere zu töten, die ihr als Bedrohung seht. Doch oft fressen wir Geier davon und sterben einen grausamen Tod.
Der Verlust der Herden:
- Vormals profitierten wir auch vom Verhaltensmuster des Menschen und deren Tiere welche sie in unsere Lebensräume brachten. Wir ernährten und hier von bereits verendeten Tieren, somit von Aas.Doch mit der intensiven Bekämpfung des natürlichen Beutegreifers Wolf, der vormals durch den Menschen auch vergiftet wurde, brachen auch unsere Bestände in sich zusamen, denn auch wir wurden vergifetet und gnadenlos abgeschossen.Ohne Nahrung ist unser Überleben nicht möglich!
Die Angst vor Unwissenheit:
- Viele von euch verstehen nicht, dass wir nützlich sind. Ihr fürchtet uns, weil wir euch an den Tod erinnern. Aber ohne uns bleibt das Leben unvollständig.
Was ich euch mitgeben möchte
Ich fliege höher, als ihr euch je erheben könnt, und doch bin ich Teil derselben Erde wie ihr. Mein Leben mag für euch fremd erscheinen, doch ich trage zur Balance bei, von der auch ihr abhängt. Seht in mir keinen düsteren Boten, sondern einen Partner, der hilft, das Leben in seiner ganzen Schönheit und Ordnung zu bewahren.
Wenn ihr mich das nächste Mal am Himmel seht, denkt an meinen Flug. Er ist schwerelos und doch voller Bedeutung. Die Welt ist ein Netz, und ich bin nur ein Faden darin – ein Faden, der ebenso wertvoll ist wie alle anderen.
In der Aufnahme von Vogelfotos.de
- Der Hoffnung Ausdruck gewährend sieht der Gänsegeier auch in Deutschland einer wieder besseren Zukunft entgegen
Artenschutz in Franken®
Die Haus-Feldwespe (Polistes dominula)

Haus-Feldwespe (Polistes dominula)
31.01./01.02.2025
Es ist ein aufregendes Leben, voller Summen, Nektar, und, naja, manchmal ein bisschen Ärger von euch Menschen. Aber lass mich dir zeigen, wie die Welt aus meiner Perspektive aussieht – aus den Facetten meiner wachen, kleinen Augen.
31.01./01.02.2025
- Oh, hallo da unten! Ich bin die Haus-Feldwespe, Polistes dominula, und ich freue mich, dir ein wenig von meinem Leben zu erzählen.
Es ist ein aufregendes Leben, voller Summen, Nektar, und, naja, manchmal ein bisschen Ärger von euch Menschen. Aber lass mich dir zeigen, wie die Welt aus meiner Perspektive aussieht – aus den Facetten meiner wachen, kleinen Augen.
Meine Familie und unser Zuhause
Ich bin keine dieser chaotischen Wespen, die euch im Spätsommer um euer Essen streiten. Wir von der Haus-Feldwespen-Crew sind elegante Minimalisten. Unser Nest ist klein, offen und filigran – ein wahres Meisterwerk der Architektur. Es sieht aus wie ein winziger Regenschirm aus sechseckigen Zellen, den wir aus einem Papierbrei bauen, den wir aus Holzfasern und Speichel herstellen. Wir hängen es gern an geschützten Orten auf: unter Dachvorsprüngen, in Garagen oder an Bäumen.Unsere Kolonie ist eine Gemeinschaft. Die Königin führt uns mit Weisheit und Pheromonen, während wir Arbeiterinnen uns um die Brut kümmern, das Nest erweitern und auf Nahrungssuche gehen. Es ist ein Leben voller Teamwork!
Meine Arbeit als Jägerin und Sammlerin
Ich bin Jägerin, ja, aber auch eine Feinschmeckerin! Während meiner täglichen Flüge bin ich auf der Suche nach Raupen, Fliegen und anderen kleinen Insekten, die ich zerkleinere und zu einer proteinreichen Paste forme. Diese Paste ist das perfekte Babyfutter für unsere Larven. Für mich selbst gönne ich mir jedoch lieber Nektar – das süße Lebenselixier, das die Blumen für uns bereithalten. Manchmal nasche ich auch an reifem Obst oder dem Honigtau von Blattläusen. Keine Sorge, ich lasse eure Kuchen und Getränke meistens in Ruhe – wir Haus-Feldwespen haben Manieren!
Mein Körper – ein Wunderwerk der Natur
Ich bin schlank und zierlich mit einer eleganten Taille. Mein gelb-schwarzes Muster ist nicht nur ein Hingucker, sondern auch eine Warnung: „Achtung, ich kann stechen!“ Doch ehrlich gesagt, bin ich eher friedlich. Mein Stachel dient nur zur Verteidigung, und ich setze ihn nur ein, wenn ich wirklich keine andere Wahl habe. Meine Flügel tragen mich elegant durch die Lüfte, und meine Facettenaugen lassen mich ein weites Sichtfeld genießen. Ich sehe dich schon von weitem, wenn du dich meinem Nest näherst!
Mein Sozialleben
Wir sind soziale Insekten, und meine Schwestern und ich arbeiten eng zusammen. Es ist faszinierend: Jede von uns hat ihre Aufgabe, aber wir können auch flexibel sein. Wenn die Königin mal ausfällt, können wir eine neue Königin unter uns wählen – ein echter Demokratie-Moment, findest du nicht? Unsere Kommunikation ist ein Tanz aus Bewegungen, Gerüchen und Berührungen. Pheromone sind unsere Sprache, mit der wir Gefahren melden, Nahrung teilen und unsere Gemeinschaft zusammenhalten.
Unsere Herausforderungen und Sorgen
Aus meiner Sicht scheint die Welt manchmal gefährlich und voller Herausforderungen:
Warum ich wichtig bin
Ich bin mehr als nur ein hübsches Gesicht mit einem Stachel. Wir Feldwespen spielen eine wichtige Rolle im Ökosystem. Wir kontrollieren Schädlinge, bestäuben Pflanzen und sind ein Teil des natürlichen Kreislaufs. Ohne uns würden viele Blumen weniger Früchte tragen, und die Population einiger Schadinsekten würde explodieren.
Ein Appell an euch Menschen
Seht uns mit anderen Augen. Wir sind keine Eindringlinge, sondern Nachbarn, die versuchen, ihren Platz in dieser großen Welt zu finden. Lasst unsere kleinen Nester, wo sie euch nicht stören, und beobachtet uns, wie wir unsere Meisterwerke bauen und für die Natur arbeiten. Ihr werdet sehen, wie faszinierend und friedlich wir wirklich sind.
So, jetzt muss ich wieder los – die Larven rufen, und die nächste Mahlzeit wartet. Möge euer Tag genauso produktiv sein wie meiner!
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
Ich bin keine dieser chaotischen Wespen, die euch im Spätsommer um euer Essen streiten. Wir von der Haus-Feldwespen-Crew sind elegante Minimalisten. Unser Nest ist klein, offen und filigran – ein wahres Meisterwerk der Architektur. Es sieht aus wie ein winziger Regenschirm aus sechseckigen Zellen, den wir aus einem Papierbrei bauen, den wir aus Holzfasern und Speichel herstellen. Wir hängen es gern an geschützten Orten auf: unter Dachvorsprüngen, in Garagen oder an Bäumen.Unsere Kolonie ist eine Gemeinschaft. Die Königin führt uns mit Weisheit und Pheromonen, während wir Arbeiterinnen uns um die Brut kümmern, das Nest erweitern und auf Nahrungssuche gehen. Es ist ein Leben voller Teamwork!
Meine Arbeit als Jägerin und Sammlerin
Ich bin Jägerin, ja, aber auch eine Feinschmeckerin! Während meiner täglichen Flüge bin ich auf der Suche nach Raupen, Fliegen und anderen kleinen Insekten, die ich zerkleinere und zu einer proteinreichen Paste forme. Diese Paste ist das perfekte Babyfutter für unsere Larven. Für mich selbst gönne ich mir jedoch lieber Nektar – das süße Lebenselixier, das die Blumen für uns bereithalten. Manchmal nasche ich auch an reifem Obst oder dem Honigtau von Blattläusen. Keine Sorge, ich lasse eure Kuchen und Getränke meistens in Ruhe – wir Haus-Feldwespen haben Manieren!
Mein Körper – ein Wunderwerk der Natur
Ich bin schlank und zierlich mit einer eleganten Taille. Mein gelb-schwarzes Muster ist nicht nur ein Hingucker, sondern auch eine Warnung: „Achtung, ich kann stechen!“ Doch ehrlich gesagt, bin ich eher friedlich. Mein Stachel dient nur zur Verteidigung, und ich setze ihn nur ein, wenn ich wirklich keine andere Wahl habe. Meine Flügel tragen mich elegant durch die Lüfte, und meine Facettenaugen lassen mich ein weites Sichtfeld genießen. Ich sehe dich schon von weitem, wenn du dich meinem Nest näherst!
Mein Sozialleben
Wir sind soziale Insekten, und meine Schwestern und ich arbeiten eng zusammen. Es ist faszinierend: Jede von uns hat ihre Aufgabe, aber wir können auch flexibel sein. Wenn die Königin mal ausfällt, können wir eine neue Königin unter uns wählen – ein echter Demokratie-Moment, findest du nicht? Unsere Kommunikation ist ein Tanz aus Bewegungen, Gerüchen und Berührungen. Pheromone sind unsere Sprache, mit der wir Gefahren melden, Nahrung teilen und unsere Gemeinschaft zusammenhalten.
Unsere Herausforderungen und Sorgen
Aus meiner Sicht scheint die Welt manchmal gefährlich und voller Herausforderungen:
- Menschen und ihre Besen – Ihr räumt unsere Nester oft ab, obwohl wir euch kaum stören. Dabei sind wir nützlich! Wir fressen Schädlinge, die eure Gärten zerstören würden.
- Pestizide – Eure Gifte töten nicht nur die Insekten, die ihr loswerden wollt, sondern auch uns und unsere Brut.
- Klimawandel – Plötzliche Wetterextreme und längere Kälteperioden gefährden unsere Nester und erschweren es uns, genug Nahrung zu finden.
Warum ich wichtig bin
Ich bin mehr als nur ein hübsches Gesicht mit einem Stachel. Wir Feldwespen spielen eine wichtige Rolle im Ökosystem. Wir kontrollieren Schädlinge, bestäuben Pflanzen und sind ein Teil des natürlichen Kreislaufs. Ohne uns würden viele Blumen weniger Früchte tragen, und die Population einiger Schadinsekten würde explodieren.
Ein Appell an euch Menschen
Seht uns mit anderen Augen. Wir sind keine Eindringlinge, sondern Nachbarn, die versuchen, ihren Platz in dieser großen Welt zu finden. Lasst unsere kleinen Nester, wo sie euch nicht stören, und beobachtet uns, wie wir unsere Meisterwerke bauen und für die Natur arbeiten. Ihr werdet sehen, wie faszinierend und friedlich wir wirklich sind.
So, jetzt muss ich wieder los – die Larven rufen, und die nächste Mahlzeit wartet. Möge euer Tag genauso produktiv sein wie meiner!
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
- Haus-Feldwespe (Polistes dominula)
Artenschutz in Franken®
Aspisviper (Vipera aspis)

Die Aspisviper (Vipera aspis)
30/31.01.2025
Zu finden ist sie hier in ihrem bevorzugten Lebensraum, der sonnige, trockene, steinige Hänge umfasst.
30/31.01.2025
- Sie wird als die "typische Giftschlange Europas" bezeichnet, die Aspisviper.Ihr Verbreitungsbegeit erstreckt sich über weiten Teilen von West-, Mittel- und Südeuropa (Nordspanien, Frankreich, Schweiz, Italien, Deutschland/Schwarzwald).
Zu finden ist sie hier in ihrem bevorzugten Lebensraum, der sonnige, trockene, steinige Hänge umfasst.
Die Aspisviper (Vipera aspis) erreicht eine Gesamtlänge von etwa 60 bis 70 cm und ist damit etwas kleiner als die heimische Kreuzotter (Vipera berus). Der Kopf, zeigt eine dreieckige Form. Aspisvipern sind bevorzugt tagaktiv.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
- Aspisviper (Vipera aspis)
Artenschutz in Franken®
Große Königslibelle (Anax imperator

Die Große Königslibelle (Anax imperator)
29/30.01.2025
Mein Leben beginnt in einem unscheinbaren Ei, das im Wasser ruht. Dort durchlebe ich eine faszinierende Metamorphose, in der ich mich von einer winzigen Larve zu einer herrlichen Libelle entwickle.
29/30.01.2025
- Als Große Königslibelle, oder Anax imperator, bin ich ein majestätisches Wesen der Lüfte und der Wasser.
Mein Leben beginnt in einem unscheinbaren Ei, das im Wasser ruht. Dort durchlebe ich eine faszinierende Metamorphose, in der ich mich von einer winzigen Larve zu einer herrlichen Libelle entwickle.
In meinen Larvenjahren, die oft über Jahre hinweg dauern können, bin ich ein "räuberisches Ungeheuer" im Wasser. Mit meinen kräftigen Kiefern jage ich andere kleine Wasserbewohner und wachse kontinuierlich heran. Doch eines Tages verspüre ich den unwiderstehlichen Drang, meine schützende Unterwasserwelt zu verlassen.
Der Aufstieg zur Oberfläche ist eine metamorphische Herausforderung, die mein ganzes Wesen fordert. Als ich endlich die Wasseroberfläche durchbreche, spüre ich die wärmenden Strahlen der Sonne auf meinen Flügeln, die noch feucht und zerbrechlich sind. Es ist ein Moment der Verwundbarkeit und der Neugeburt zugleich.
Mit der Zeit härtet meine Haut aus und meine Flügel entfalten sich zu ihrer vollen Pracht. Ich bin nun eine Große Königslibelle, König der Lüfte und Meister der Jagd über den Gewässern. Meine großen, facettenreichen Augen ermöglichen es mir, die Welt in einem Panorama der Farben und Bewegungen wahrzunehmen.
Wenn ich durch die Luft schwebe, verbinde ich Anmut und Effizienz. Meine Flügel schlagen synchron, und ich nutze Luftströmungen geschickt, um über große Entfernungen zu gleiten. In diesen Momenten fühle ich mich wie ein König der Lüfte, der frei ist, das Leben in all seinen Facetten zu erforschen.
Doch trotz meiner königlichen Erscheinung und meiner flüchtigen Freiheit sind meine Tage gezählt. Als Libelle habe ich nur eine kurze Zeit auf dieser Welt. Aber selbst in dieser Kürze finde ich Erfüllung, sei es durch die Jagd nach Insekten in der Luft oder durch die Fortpflanzung, die den Kreislauf meines Lebens schließt.
Ich bin ein Symbol für Transformation und Vergänglichkeit zugleich. Meine Existenz erinnert daran, dass jeder Moment kostbar ist, sei es als Larve im Wasser, als aufsteigende Libelle oder als flüchtiger König der Lüfte. Mögen meine Flüge und mein Leben in seiner Kürze eine Inspiration sein, das eigene Dasein in vollem Glanz zu leben und jeden Augenblick zu schätzen.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
Der Aufstieg zur Oberfläche ist eine metamorphische Herausforderung, die mein ganzes Wesen fordert. Als ich endlich die Wasseroberfläche durchbreche, spüre ich die wärmenden Strahlen der Sonne auf meinen Flügeln, die noch feucht und zerbrechlich sind. Es ist ein Moment der Verwundbarkeit und der Neugeburt zugleich.
Mit der Zeit härtet meine Haut aus und meine Flügel entfalten sich zu ihrer vollen Pracht. Ich bin nun eine Große Königslibelle, König der Lüfte und Meister der Jagd über den Gewässern. Meine großen, facettenreichen Augen ermöglichen es mir, die Welt in einem Panorama der Farben und Bewegungen wahrzunehmen.
Wenn ich durch die Luft schwebe, verbinde ich Anmut und Effizienz. Meine Flügel schlagen synchron, und ich nutze Luftströmungen geschickt, um über große Entfernungen zu gleiten. In diesen Momenten fühle ich mich wie ein König der Lüfte, der frei ist, das Leben in all seinen Facetten zu erforschen.
Doch trotz meiner königlichen Erscheinung und meiner flüchtigen Freiheit sind meine Tage gezählt. Als Libelle habe ich nur eine kurze Zeit auf dieser Welt. Aber selbst in dieser Kürze finde ich Erfüllung, sei es durch die Jagd nach Insekten in der Luft oder durch die Fortpflanzung, die den Kreislauf meines Lebens schließt.
Ich bin ein Symbol für Transformation und Vergänglichkeit zugleich. Meine Existenz erinnert daran, dass jeder Moment kostbar ist, sei es als Larve im Wasser, als aufsteigende Libelle oder als flüchtiger König der Lüfte. Mögen meine Flüge und mein Leben in seiner Kürze eine Inspiration sein, das eigene Dasein in vollem Glanz zu leben und jeden Augenblick zu schätzen.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
- Als nicht besonders anspruchsvolle Libellenart erschließt sich die etwa 8 cm lange und mit einer etwa 111 mm Spannweite versehene Libellenart gerne mittelgroße bis große, pflanzenreiche Stillgewässerbereiche.Königslibellen zeichnen sich durch ein stark ausgeprägtes territoriales Verhaltensmuster aus.Wie bei vielen anderen Liebellenarten wird der zukünftige Nachwuchs häufig in Pflanzeneile eingestochen.
Artenschutz in Franken®
Der Graureiher (Ardea cinerea)

Der Graureiher (Ardea cinerea)
28/29.01.2025
Meine Beine, dünn und elegant wie die Halme im Schilf, tragen mich durch die stillen Flachwasserzonen. Ich schreite langsam, fast meditativ, denn jede Bewegung zählt. Meine Haltung ist aufrecht, ein Bild der Geduld, doch meine Augen – gelb wie die Sonne – durchdringen die Oberfläche. Für das Leben, das unter dem Wasser glitzert, bin ich ein lautloser Schatten des Schicksals.
28/29.01.2025
- Ich bin der Graureiher, Ardea cinerea, ein Geschöpf der Gewässer und des Windes, das von den Menschen oft ehrfurchtsvoll als "Fischreiher" bezeichnet wird.
Meine Beine, dünn und elegant wie die Halme im Schilf, tragen mich durch die stillen Flachwasserzonen. Ich schreite langsam, fast meditativ, denn jede Bewegung zählt. Meine Haltung ist aufrecht, ein Bild der Geduld, doch meine Augen – gelb wie die Sonne – durchdringen die Oberfläche. Für das Leben, das unter dem Wasser glitzert, bin ich ein lautloser Schatten des Schicksals.
Mit meinem langen Hals, der sich wie ein geölter Schwanenhals biegt, und meinem dolchartigen Schnabel jage ich präzise. Ein Stich, ein Zucken, und der Fisch – oder der Frosch, die Libelle – wird zu einem Teil von mir. Nicht aus Gier, sondern aus Notwendigkeit. Jedes Leben, das ich nehme, erinnert mich daran, wie zerbrechlich das Gleichgewicht ist, von dem ich selbst abhängig bin. Der Mensch nennt es Nahrungskette, doch für mich ist es Kreislauf, eine Verbindung, die alles Leben umfasst.
Meine Flügel, weit wie der Himmel selbst, tragen mich durch die Lüfte, während ich von oben meine Reviere überblicke. Ein Flügelschlag wie ein Gedicht in Bewegung, ein stiller Tribut an die Leichtigkeit des Seins. Doch auch in der Luft trage ich die Verantwortung für mein Überleben. Meine Brutzeit ist eine Phase der Hingabe. Hoch oben in den Baumkronen baue ich mit meinem Partner ein Nest, das dem Wind trotzt. Meine Jungen – flauschig und hungrig – fordern alles von mir, und ich gebe es, wissend, dass nur wenige von ihnen den ersten Flug überleben werden.
Doch ich bin mehr als Jäger und Elternteil. Ich bin ein Wächter der Gewässer. Das Rascheln des Schilfs, das Glitzern der Flüsse, das endlose Spiel von Leben und Tod – all das fließt durch mich hindurch. Die Menschen haben begonnen, meine Welt zu verändern. Die Feuchtgebiete schwinden, die Flüsse tragen oft die Last ihrer Abfälle, und die Fische, meine Lebensgrundlage, werden seltener. Ich sehe es und fühle es – denn wo einst Stille und Nahrung waren, herrschen nun Kargheit und Gefahr.
Doch ich bin anpassungsfähig. Ich jage in Stadtparks, ich stehe auf künstlichen Teichen, während das Wasser von Autoscheinwerfern beleuchtet wird. Ich tue, was getan werden muss, um zu überleben. Aber ich frage mich: Wie lange kann ich mich noch anpassen? Wann wird der Tag kommen, an dem selbst meine Flügel mich nicht mehr aus der Reichweite der Zerstörung tragen können?
Ich, der Graureiher, bin ein Symbol für das Gleichgewicht der Natur. Was mit mir geschieht, ist ein Echo dessen, was mit dem ganzen Netz des Lebens geschieht. Meine Schritte mögen still sein, aber sie sind voller Bedeutung. Jedes Wasser, das ich durchschreite, trägt Geschichten. Und ich, der lautlose Wanderer, erzähle sie weiter – so lange, bis ich nicht mehr kann.
Aufnahme von Klaus Sanwald
Meine Flügel, weit wie der Himmel selbst, tragen mich durch die Lüfte, während ich von oben meine Reviere überblicke. Ein Flügelschlag wie ein Gedicht in Bewegung, ein stiller Tribut an die Leichtigkeit des Seins. Doch auch in der Luft trage ich die Verantwortung für mein Überleben. Meine Brutzeit ist eine Phase der Hingabe. Hoch oben in den Baumkronen baue ich mit meinem Partner ein Nest, das dem Wind trotzt. Meine Jungen – flauschig und hungrig – fordern alles von mir, und ich gebe es, wissend, dass nur wenige von ihnen den ersten Flug überleben werden.
Doch ich bin mehr als Jäger und Elternteil. Ich bin ein Wächter der Gewässer. Das Rascheln des Schilfs, das Glitzern der Flüsse, das endlose Spiel von Leben und Tod – all das fließt durch mich hindurch. Die Menschen haben begonnen, meine Welt zu verändern. Die Feuchtgebiete schwinden, die Flüsse tragen oft die Last ihrer Abfälle, und die Fische, meine Lebensgrundlage, werden seltener. Ich sehe es und fühle es – denn wo einst Stille und Nahrung waren, herrschen nun Kargheit und Gefahr.
Doch ich bin anpassungsfähig. Ich jage in Stadtparks, ich stehe auf künstlichen Teichen, während das Wasser von Autoscheinwerfern beleuchtet wird. Ich tue, was getan werden muss, um zu überleben. Aber ich frage mich: Wie lange kann ich mich noch anpassen? Wann wird der Tag kommen, an dem selbst meine Flügel mich nicht mehr aus der Reichweite der Zerstörung tragen können?
Ich, der Graureiher, bin ein Symbol für das Gleichgewicht der Natur. Was mit mir geschieht, ist ein Echo dessen, was mit dem ganzen Netz des Lebens geschieht. Meine Schritte mögen still sein, aber sie sind voller Bedeutung. Jedes Wasser, das ich durchschreite, trägt Geschichten. Und ich, der lautlose Wanderer, erzähle sie weiter – so lange, bis ich nicht mehr kann.
Aufnahme von Klaus Sanwald
- Graureiher mit erbeuteter Nahrung
Artenschutz in Franken®
Das Hermelin (Mustela erminea)

Das Hermelin (Mustela erminea)
27/28.01.2025
Die Tiere, die der Familie der Marder zuzurechnen sind, werden mit Schwanz rund 40 Zentimeter lang und bis etwa 350 Gramm schwer.
27/28.01.2025
- Das Hermelin, das auch Großes Wiesel genannt wird, zeigt sich in diesen Wochen in seinem markanten fast reinweißen Winterfell.
Die Tiere, die der Familie der Marder zuzurechnen sind, werden mit Schwanz rund 40 Zentimeter lang und bis etwa 350 Gramm schwer.
Der bevorzugte Lebensraum umfasst strukturreiche Landschaften, jedoch meiden die Tiere (wie zahlreiche andere Arten auch) Geländeformationen, in welchen sie keine Deckung finden. In unserer zunehmend ausgeräumten, vornehmlich industriell geformten Landschaft sind sie in zahlreichen Bereichen selten geworden.
Während Hermeline im Sommer ein kastanienfarbenes Fell tragen wird dies mit dem winterlichen Fellwechsel weiß, dass auch, um optisch an ihren Lebensraum angepasst zu sein. Interessant wird es wie sich die Tiere mit dem Klimawandel verhalten. Liegen uns doch nun bereits erste Ergebnisse vor das sich der Fellwechsel in den vergangenen 25 Jahren zeitlich verzögert.Hermelinweibchen sind sehr Ortstreue Tiere, die zuverlässig innerhalb ihres Reviers ganzjährig von uns angetroffen werden können. Diese Tiere ernähren sich bevorzugt von Fleisch und erbeuten deshalb gerne Kleinsäuger wie Feld-Rötel-oder auch Schermäuse. Jedoch stehen auch Amphibien und Reptilien neben Insekten auf ihrem Speiseplan.
Doch auch Säugetiere, die etwa die Größe eines Junghasen erreichen können, erfolgreich erbeutet werden. Alles kein Problem, denn dieser Beutegreifer trägt zur natürlichen Bestandsregulierung innerhalb des ökologischen Gleichgewichts bei. Problematisch wurde dieses Vorgehen erst mit dem Auftreten des Menschen und dessen Zerstörung der Lebensräume. Vielerorts wurde und wird dieses wunderschöne Tier dann als „Raubtier“ betitelt und auch entsprechend bejagt.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
Während Hermeline im Sommer ein kastanienfarbenes Fell tragen wird dies mit dem winterlichen Fellwechsel weiß, dass auch, um optisch an ihren Lebensraum angepasst zu sein. Interessant wird es wie sich die Tiere mit dem Klimawandel verhalten. Liegen uns doch nun bereits erste Ergebnisse vor das sich der Fellwechsel in den vergangenen 25 Jahren zeitlich verzögert.Hermelinweibchen sind sehr Ortstreue Tiere, die zuverlässig innerhalb ihres Reviers ganzjährig von uns angetroffen werden können. Diese Tiere ernähren sich bevorzugt von Fleisch und erbeuten deshalb gerne Kleinsäuger wie Feld-Rötel-oder auch Schermäuse. Jedoch stehen auch Amphibien und Reptilien neben Insekten auf ihrem Speiseplan.
Doch auch Säugetiere, die etwa die Größe eines Junghasen erreichen können, erfolgreich erbeutet werden. Alles kein Problem, denn dieser Beutegreifer trägt zur natürlichen Bestandsregulierung innerhalb des ökologischen Gleichgewichts bei. Problematisch wurde dieses Vorgehen erst mit dem Auftreten des Menschen und dessen Zerstörung der Lebensräume. Vielerorts wurde und wird dieses wunderschöne Tier dann als „Raubtier“ betitelt und auch entsprechend bejagt.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
- Das Große Wiesel im Winterfell
Artenschutz in Franken®
Das Mauswiesel (Mustela nivalis)

Das Mauswiesel (Mustela nivalis)
26/27.01.2025
Ich gehöre zur Familie der Marder und bin ein kleiner Beutegreifer, das für seine Schnelligkeit und Geschicklichkeit bekannt ist. Meine Körperform ist lang und schlank, was es mir ermöglicht, mich mühelos durch enge Spalten und unterirdische Gänge zu bewegen, um meine Beute zu jagen.
26/27.01.2025
- Als Mauswiesel (Mustela nivalis) betrachte ich meine Existenz in der Tierwelt aus einer faszinierenden Perspektive.
Ich gehöre zur Familie der Marder und bin ein kleiner Beutegreifer, das für seine Schnelligkeit und Geschicklichkeit bekannt ist. Meine Körperform ist lang und schlank, was es mir ermöglicht, mich mühelos durch enge Spalten und unterirdische Gänge zu bewegen, um meine Beute zu jagen.
Meine Hauptnahrung sind kleine Nagetiere wie Mäuse und Wühlmäuse. Dank meiner scharfen Sinne kann ich Beute schon aus großer Entfernung wahrnehmen und sie blitzschnell erbeuten. Meine Zähne und Krallen sind perfekt angepasst, um meine Beute zu töten und zu zerlegen.Mein Lebensraum erstreckt sich über weite Teile Europas, Asiens und Nordamerikas, vor allem in offenen Landschaften wie Wiesen, Feldern und Heiden. Ich bin anpassungsfähig und kann mich auch in verschiedenen Lebensräumen wie Wäldern oder Gebirgen gut zurechtfinden.
Als Mauswiesel habe ich eine wichtige Rolle im Ökosystem. Ich reguliere die Populationen von kleinen Nagetieren, was dazu beiträgt, das Gleichgewicht in der Natur aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig bin ich selbst Beute für größere Beutegreifer wie Greifvögel, Füchse und Eulen, was mich zu einem wichtigen Glied in der Nahrungskette macht. In Bezug auf meine Fortpflanzung bin ich polygam und suche mir mehrere Partner während der Paarungszeit. Die Jungtiere kommen nach einer kurzen Tragzeit zur Welt und werden von mir als Mutter liebevoll umsorgt, bis sie alt genug sind, um auf eigenen Beinen zu stehen.
Meine Art ist anpassungsfähig und robust, aber dennoch von Bedrohungen wie Lebensraumverlust und menschlicher Verfolgung betroffen. Der Schutz meiner Lebensräume und die Erhaltung der natürlichen Balance sind entscheidend für mein Überleben und das meines Ökosystems insgesamt.
Zusammengefasst bin ich als Mauswiesel ein faszinierendes Raubtier, das sowohl in ökologischer als auch in biologischer Hinsicht eine wichtige Rolle spielt. Meine Anpassungsfähigkeit und Jagdtechniken ermöglichen es mir, in verschiedenen Lebensräumen erfolgreich zu überleben und zur Vielfalt der Natur beizutragen.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
Als Mauswiesel habe ich eine wichtige Rolle im Ökosystem. Ich reguliere die Populationen von kleinen Nagetieren, was dazu beiträgt, das Gleichgewicht in der Natur aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig bin ich selbst Beute für größere Beutegreifer wie Greifvögel, Füchse und Eulen, was mich zu einem wichtigen Glied in der Nahrungskette macht. In Bezug auf meine Fortpflanzung bin ich polygam und suche mir mehrere Partner während der Paarungszeit. Die Jungtiere kommen nach einer kurzen Tragzeit zur Welt und werden von mir als Mutter liebevoll umsorgt, bis sie alt genug sind, um auf eigenen Beinen zu stehen.
Meine Art ist anpassungsfähig und robust, aber dennoch von Bedrohungen wie Lebensraumverlust und menschlicher Verfolgung betroffen. Der Schutz meiner Lebensräume und die Erhaltung der natürlichen Balance sind entscheidend für mein Überleben und das meines Ökosystems insgesamt.
Zusammengefasst bin ich als Mauswiesel ein faszinierendes Raubtier, das sowohl in ökologischer als auch in biologischer Hinsicht eine wichtige Rolle spielt. Meine Anpassungsfähigkeit und Jagdtechniken ermöglichen es mir, in verschiedenen Lebensräumen erfolgreich zu überleben und zur Vielfalt der Natur beizutragen.
In der Aufnahme von Klaus Sanwald
- Als das kleinste "Raubtier" der Welt wird es bezeichnet. - Das Mauswiesel! Allein schon der Name Raubtier birgt eine deutlich falsche Aussage in sich. Denn was raubt denn das Mauswiesel? Es ernährt sich als auch fleischfressendes Säugetier von anderen Arten. Nicht mehr und nicht weniger. Dafür wurde es von der Evolution auserkoren. Es trägt einen wichtigen Part inmitten der in sich greifenden Umwelt bei. Als natürlicher Regulator ist die diese hoch interessante Art wohl besser bezeichnet. Das Mauswiesel ist so klein, dass es seiner Hauptbeute, den kleinen Wühlmausarten in ihre Gangsystem folgen kann. Ein herausragender Spezialist im Naturhaushalt.
Artenschutz in Franken®
Hornissenschutz 2025

Schutz von Hornissen und die Bedeutung von Hornissennistkästen
25/26.01.2025
Leider gelten sie in vielen Regionen als bedroht, vor allem durch den Verlust natürlicher Lebensräume und die weitverbreitete Fehlinterpretation ihrer Gefährlichkeit. Der Schutz dieser faszinierenden Tiere ist nicht nur aus ökologischen, sondern auch aus rechtlichen Gründen (in Deutschland gemäß Bundesnaturschutzgesetz) von hoher Bedeutung.
Ein zentraler Aspekt des Hornissenschutzes ist die Bereitstellung geeigneter Nistmöglichkeiten, wie zum Beispiel Hornissennistkästen. Diese Kästen bieten eine Alternative zu natürlichen Nisthöhlen, die in modernen, intensiv bewirtschafteten Landschaften immer seltener werden...
25/26.01.2025
- Hornissen (Vespa crabro) spielen eine essenzielle Rolle in unserem Ökosystem. Sie tragen zur Bestäubung von Pflanzen bei und regulieren die Populationen anderer Insektenarten.
Leider gelten sie in vielen Regionen als bedroht, vor allem durch den Verlust natürlicher Lebensräume und die weitverbreitete Fehlinterpretation ihrer Gefährlichkeit. Der Schutz dieser faszinierenden Tiere ist nicht nur aus ökologischen, sondern auch aus rechtlichen Gründen (in Deutschland gemäß Bundesnaturschutzgesetz) von hoher Bedeutung.
Ein zentraler Aspekt des Hornissenschutzes ist die Bereitstellung geeigneter Nistmöglichkeiten, wie zum Beispiel Hornissennistkästen. Diese Kästen bieten eine Alternative zu natürlichen Nisthöhlen, die in modernen, intensiv bewirtschafteten Landschaften immer seltener werden...
Bedeutung von Hornissennistkästen
Hornissennistkästen sind speziell entwickelte künstliche Nisthilfen, die Hornissen einen geschützten Raum zur Fortpflanzung und zum Aufbau ihrer Staaten bieten. Ihre Anbringung hat mehrere Vorteile:
Anbringung von Hornissennistkästen
Die korrekte Installation von Hornissennistkästen ist entscheidend, um ihre Wirksamkeit sicherzustellen. Die wichtigsten Punkte sind:
Standortwahl:
Ausrichtung und Schutz:
Material und Bauweise:
Wartung und Kontrolle:
Fazit
Hornissennistkästen sind ein wirkungsvolles Mittel, um die Population von Hornissen zu fördern und ihren Lebensraum zu schützen. Sie stellen nicht nur einen wichtigen Beitrag zum Artenschutz dar, sondern fördern auch ein harmonisches Zusammenleben zwischen Mensch und Tier. Durch die gezielte Anbringung und Pflege solcher Kästen können wir nicht nur Konflikte vermeiden, sondern auch ein wertvolles Zeichen für den Schutz unserer Umwelt setzen.
Der Schutz der Hornissen beginnt mit dem Verständnis ihrer Bedeutung. Jeder, der einen Garten besitzt oder Zugang zu geeigneten Flächen hat, kann durch das Aufstellen von Hornissennistkästen einen wertvollen Beitrag zum Erhalt dieser faszinierenden Insekten leisten.
In der Aufnahme
Hornissennistkästen sind speziell entwickelte künstliche Nisthilfen, die Hornissen einen geschützten Raum zur Fortpflanzung und zum Aufbau ihrer Staaten bieten. Ihre Anbringung hat mehrere Vorteile:
- Erhalt der Artenvielfalt: Durch das Bereitstellen geeigneter Nistplätze wird der Fortbestand von Hornissenkolonien gefördert, was direkt zum Schutz der Biodiversität beiträgt.
- Reduktion von Konflikten: Hornissennistkästen ermöglichen es, die Tiere gezielt an sicheren und geeigneten Orten anzusiedeln, wodurch potenzielle Konflikte mit Menschen vermieden werden können.
- Wissenschaftliche Beobachtung: Die Kästen bieten eine hervorragende Möglichkeit zur Forschung und Bildung. Sie erlauben einen kontrollierten Einblick in das Leben dieser sozialen Insekten und fördern so das Verständnis und die Akzeptanz in der Bevölkerung.
Anbringung von Hornissennistkästen
Die korrekte Installation von Hornissennistkästen ist entscheidend, um ihre Wirksamkeit sicherzustellen. Die wichtigsten Punkte sind:
Standortwahl:
- Hornissennistkästen sollten in einer Höhe von mindestens 3–4 Metern angebracht werden, um sie vor Störungen durch Menschen und Tiere zu schützen.
- Ein ruhiger und schattiger Ort, vorzugsweise am Waldrand oder in großen Gärten, ist ideal. Direkte Sonneneinstrahlung und starker Wind sollten vermieden werden.
Ausrichtung und Schutz:
- Die Öffnung des Kastens sollte in Richtung Südosten zeigen, um morgens ausreichend Wärme zu bekommen, aber nicht überhitzt zu werden.
- Der Kasten muss wetterfest sein und vor Regen und Schnee geschützt montiert werden.
Material und Bauweise:
- Der Nistkasten kann auch aus unbehandeltem Holz bestehen, um eine natürliche Umgebung zu simulieren. Ein Innenraum von etwa 40–60 Litern ist ideal für die Entwicklung eines gesunden Staates. Wir bevorzugen bei der Materialauswahl jedoch Holzbetonnisthilfen, gerade wegen ihrer Langlebigkeit.
Wartung und Kontrolle:
- Nach dem Ende der Brutzeit kann der Kasten gereinigt werden, um ihn für die nächste Saison vorzubereiten. Dabei dürfen keine Chemikalien oder scharfen Reinigungsmittel verwendet werden. Es gilt auf darauf zu achten das sich keine überwinternden Tiere in der Nisthilfe befinden. Wir belassen unsere Hornissennisthilfen jedoch 3-4 Jahr ungereinigt an Ort und Stelle, denn in den Kasten ziehen im Folgejahr nach Auflösung des Hornissenstaats gerne auch Hummeln oder Kleinmeisen ein. Nach einiger zeit zerfällt das Hornissennest und wird ggf. auch als Nistmaterial verwendet. Erst nach der sekundären Besiedlung renigen wir die Kästen.
Fazit
Hornissennistkästen sind ein wirkungsvolles Mittel, um die Population von Hornissen zu fördern und ihren Lebensraum zu schützen. Sie stellen nicht nur einen wichtigen Beitrag zum Artenschutz dar, sondern fördern auch ein harmonisches Zusammenleben zwischen Mensch und Tier. Durch die gezielte Anbringung und Pflege solcher Kästen können wir nicht nur Konflikte vermeiden, sondern auch ein wertvolles Zeichen für den Schutz unserer Umwelt setzen.
Der Schutz der Hornissen beginnt mit dem Verständnis ihrer Bedeutung. Jeder, der einen Garten besitzt oder Zugang zu geeigneten Flächen hat, kann durch das Aufstellen von Hornissennistkästen einen wertvollen Beitrag zum Erhalt dieser faszinierenden Insekten leisten.
In der Aufnahme
- Hornissennisthilfe an Biotopeiche
Artenschutz in Franken®
Neue Voliere für kleine Patienten

Neue Voliere für kleine Patienten
24/25.01.2025
In einer Welt, in der die Natur immer stärker unter Druck gerät, ist es unsere Verantwortung, den verletzlichsten Lebewesen eine Stimme zu geben. Mit großer Freude verkünden wir die Anschaffung einer neuen Wildvogelvoliere – ein Ort der Heilung und Hoffnung für kleine gefiederte Patienten.
24/25.01.2025
- Eine neue Chance für kleine Patienten – Unsere neue Wildvogelvoliere
In einer Welt, in der die Natur immer stärker unter Druck gerät, ist es unsere Verantwortung, den verletzlichsten Lebewesen eine Stimme zu geben. Mit großer Freude verkünden wir die Anschaffung einer neuen Wildvogelvoliere – ein Ort der Heilung und Hoffnung für kleine gefiederte Patienten.
Diese speziell gestaltete Voliere dient als temporäre Unterkunft für Wildvögel, die verletzt, geschwächt oder krank gefunden werden. Hier finden sie Schutz und die nötige Pflege, um ihre Flügel erneut zu stärken und ihre natürliche Freiheit zurückzugewinnen. Jeder Flügelschlag, den wir unterstützen, bringt uns näher an das, was die Natur uns lehrt: Mitgefühl, Geduld und die Kraft der Wiederherstellung.
Die Voliere wurde mit Bedacht entworfen, um die Bedürfnisse unterschiedlichster Wildvogelarten zu erfüllen – jeder Gast wird hier artgerecht untergebracht. Durch die Integration natürlicher Elemente wie Äste, Gräser und Wasserstellen schaffen wir eine Umgebung, die den Vögeln Sicherheit und Wohlbefinden bietet.
Doch es geht nicht nur um den Schutzraum. Diese Voliere symbolisiert die Chance auf einen Neuanfang. Sobald die gefiederten Patienten wieder flugfähig sind, dürfen sie zurück in die Freiheit – dorthin, wo sie hingehören. Jeder Moment des Abschieds ist ein stiller Triumph, der uns daran erinnert, warum diese Arbeit so wichtig ist.
Hinter diesem Projekt stehen unzählige helfende Hände: Tierärzte, Pfleger und engagierte Freiwillige, die Tag für Tag ihr Herzblut in die Rettung der Wildvögel investieren. Doch auch Sie, unsere Unterstützer, sind Teil dieser Mission. Mit Ihrer Hilfe können wir sicherstellen, dass diese Voliere nicht nur ein sicherer Ort bleibt, sondern auch ein Symbol für den Respekt gegenüber der Natur.
Die ersten Gäste haben bereits Einzug gehalten, und der Anblick ihrer Genesung erfüllt uns mit tiefer Dankbarkeit. Wir freuen uns auf viele weitere Geschichten, die hier ihren Anfang nehmen – und auf die magischen Momente, wenn die Türen der Voliere sich öffnen und ein Vogel in die Freiheit fliegt.
Gemeinsam geben wir den Wildvögeln ihre Flügel zurück.
In der Aufnahme
Die Voliere wurde mit Bedacht entworfen, um die Bedürfnisse unterschiedlichster Wildvogelarten zu erfüllen – jeder Gast wird hier artgerecht untergebracht. Durch die Integration natürlicher Elemente wie Äste, Gräser und Wasserstellen schaffen wir eine Umgebung, die den Vögeln Sicherheit und Wohlbefinden bietet.
Doch es geht nicht nur um den Schutzraum. Diese Voliere symbolisiert die Chance auf einen Neuanfang. Sobald die gefiederten Patienten wieder flugfähig sind, dürfen sie zurück in die Freiheit – dorthin, wo sie hingehören. Jeder Moment des Abschieds ist ein stiller Triumph, der uns daran erinnert, warum diese Arbeit so wichtig ist.
Hinter diesem Projekt stehen unzählige helfende Hände: Tierärzte, Pfleger und engagierte Freiwillige, die Tag für Tag ihr Herzblut in die Rettung der Wildvögel investieren. Doch auch Sie, unsere Unterstützer, sind Teil dieser Mission. Mit Ihrer Hilfe können wir sicherstellen, dass diese Voliere nicht nur ein sicherer Ort bleibt, sondern auch ein Symbol für den Respekt gegenüber der Natur.
Die ersten Gäste haben bereits Einzug gehalten, und der Anblick ihrer Genesung erfüllt uns mit tiefer Dankbarkeit. Wir freuen uns auf viele weitere Geschichten, die hier ihren Anfang nehmen – und auf die magischen Momente, wenn die Türen der Voliere sich öffnen und ein Vogel in die Freiheit fliegt.
Gemeinsam geben wir den Wildvögeln ihre Flügel zurück.
In der Aufnahme
- Gut verpackt erreichte uns die neue Voliere
Artenschutz in Franken®
Der Bergfink oder auch Nordfink (Fringilla montifringilla)

Der Bergfink oder auch Nordfink (Fringilla montifringilla)
23/24.01.2025
Ich, Fringilla montifringilla, auch Bergfink oder Nordfink genannt, bin ein Vogel mit einer Mission: Überleben, Fortpflanzen und – wenn die Zeit es erlaubt – das Leben genießen. Vom dichten Taiga-Wald bis zu den Futterstellen in euren Gärten, ich durchstreife Welten, die größer sind, als man es sich aus meinem Federkleid vorstellen kann.
23/24.01.2025
- Ein Tag als Bergfink (Fringilla montifringilla): Die Welt aus meinen kleinen, aber entschlossenen Augen
Ich, Fringilla montifringilla, auch Bergfink oder Nordfink genannt, bin ein Vogel mit einer Mission: Überleben, Fortpflanzen und – wenn die Zeit es erlaubt – das Leben genießen. Vom dichten Taiga-Wald bis zu den Futterstellen in euren Gärten, ich durchstreife Welten, die größer sind, als man es sich aus meinem Federkleid vorstellen kann.
Mein winterlicher Streifzug nach Süden
Wenn die Tage kürzer werden und die nordischen Winter ihre eisigen Finger über mein Brutgebiet legen, packe ich nicht nur sprichwörtlich meine Flügel und mache mich auf den Weg in den Süden. Als Nomade ziehe ich oft mit zehntausenden meiner Artgenossen durch die Lüfte. Manchmal landen wir in euren Wäldern oder Gärten und hinterlassen dabei eine Spur von Faszination – und vielleicht ein wenig Vogelkot.
Ihr Menschen staunt oft über unsere riesigen Schwärme, aber aus meiner Sicht hat dieses Schauspiel eine einfache Erklärung: Sicherheit in der Masse. Ein Habicht oder Sperber hat es schwer, einen einzelnen Bergfink in der flirrenden Menge auszumachen. Und ganz ehrlich, ich schätze die Gesellschaft meiner Artgenossen – zumindest, solange niemand mir das letzte Sonnenblumenkernchen vor der Nase wegschnappt.
Vom Leben in der Taiga
In meinen Sommerquartieren hoch im Norden Europas und Asiens lebe ich ein anderes Leben. Dort bin ich kein „Zugvogel“, sondern ein sesshafter Architekt. Mit akribischer Präzision baue ich mein Nest in den Zweigen der Birken und Kiefern. Meine Partnerin und ich teilen uns die Verantwortung, doch seien wir ehrlich: Sie hat ein besseres Auge für Details, während ich für die Bewachung zuständig bin.
Doch in der Taiga lauern Gefahren. Feinde wie Marder und Eulen sind immer auf der Suche nach einem unachtsamen Moment. Manchmal frage ich mich, ob sie jemals das beeindruckende Werk eines Vogelnests zu schätzen wissen – vermutlich nicht.
Humor in der Vogelwelt
Als Bergfink darf ich mit Stolz behaupten, dass ich einer der wenigen bin, die es schaffen, gleichzeitig elegant und etwas tollpatschig zu sein. Habt ihr schon einmal einen Bergfink gesehen, der versucht, an einem gefrorenen Apfel Halt zu finden? Oder wie wir uns gegenseitig an den Futterstellen necken und wie kleine Akrobaten an Meisenknödeln hängen? Wir sind nicht nur Überlebenskünstler, wir sind auch Entertainer.
Manchmal scherzen wir untereinander, dass die Menschen uns als "Eintagsfreunde" betrachten. Im Frühling verschwinden wir wieder Richtung Norden, und ihr fragt euch, ob wir je zurückkehren. Aber wir Bergfinken wissen, dass unser Wiedersehen genauso sicher ist wie der Wechsel der Jahreszeiten.
Nachdenkliches aus dem Federkleid
Was mich nachdenklich stimmt, ist die Geschwindigkeit, mit der sich unsere Welt verändert. Einst durchstreiften wir unberührte Wälder, heute sind viele unserer Rastplätze fragmentiert oder verschwunden. Besonders die alten, samenreichen Wälder, die uns Nahrung und Schutz bieten, sind bedroht. Während ihr Menschen uns oft bewundert, vergessen viele, dass eure Entscheidungen tief in unser Leben eingreifen.
Doch wir Bergfinken sind optimistische Wesen. Solange es Bäume gibt, die Samen tragen, Wiesen, die blühen, und Menschen, die sich für unsere Bedürfnisse interessieren, werden wir weiterziehen, brüten und mit unserem Gesang die Welt bereichern.
Ein Wunsch aus meiner Perspektive
Also, wenn ihr das nächste Mal einen Schwarm Bergfinken seht, denkt daran, dass wir mehr sind als gefiederte Reisende. Wir sind ein Symbol für die Wunder der Natur – zart, flüchtig und untrennbar mit dieser Erde verbunden. Vielleicht stellt ihr ja eine Extraportion Sonnenblumenkerne bereit? Für einen kleinen Fink wie mich wäre das das größte Geschenk.
Euer Fringilla montifringilla, der Bergfink, Nomade der Lüfte und Meister des charmanten Chaos.
In der Aufnahme von Helga Zinnecker
Wenn die Tage kürzer werden und die nordischen Winter ihre eisigen Finger über mein Brutgebiet legen, packe ich nicht nur sprichwörtlich meine Flügel und mache mich auf den Weg in den Süden. Als Nomade ziehe ich oft mit zehntausenden meiner Artgenossen durch die Lüfte. Manchmal landen wir in euren Wäldern oder Gärten und hinterlassen dabei eine Spur von Faszination – und vielleicht ein wenig Vogelkot.
Ihr Menschen staunt oft über unsere riesigen Schwärme, aber aus meiner Sicht hat dieses Schauspiel eine einfache Erklärung: Sicherheit in der Masse. Ein Habicht oder Sperber hat es schwer, einen einzelnen Bergfink in der flirrenden Menge auszumachen. Und ganz ehrlich, ich schätze die Gesellschaft meiner Artgenossen – zumindest, solange niemand mir das letzte Sonnenblumenkernchen vor der Nase wegschnappt.
Vom Leben in der Taiga
In meinen Sommerquartieren hoch im Norden Europas und Asiens lebe ich ein anderes Leben. Dort bin ich kein „Zugvogel“, sondern ein sesshafter Architekt. Mit akribischer Präzision baue ich mein Nest in den Zweigen der Birken und Kiefern. Meine Partnerin und ich teilen uns die Verantwortung, doch seien wir ehrlich: Sie hat ein besseres Auge für Details, während ich für die Bewachung zuständig bin.
Doch in der Taiga lauern Gefahren. Feinde wie Marder und Eulen sind immer auf der Suche nach einem unachtsamen Moment. Manchmal frage ich mich, ob sie jemals das beeindruckende Werk eines Vogelnests zu schätzen wissen – vermutlich nicht.
Humor in der Vogelwelt
Als Bergfink darf ich mit Stolz behaupten, dass ich einer der wenigen bin, die es schaffen, gleichzeitig elegant und etwas tollpatschig zu sein. Habt ihr schon einmal einen Bergfink gesehen, der versucht, an einem gefrorenen Apfel Halt zu finden? Oder wie wir uns gegenseitig an den Futterstellen necken und wie kleine Akrobaten an Meisenknödeln hängen? Wir sind nicht nur Überlebenskünstler, wir sind auch Entertainer.
Manchmal scherzen wir untereinander, dass die Menschen uns als "Eintagsfreunde" betrachten. Im Frühling verschwinden wir wieder Richtung Norden, und ihr fragt euch, ob wir je zurückkehren. Aber wir Bergfinken wissen, dass unser Wiedersehen genauso sicher ist wie der Wechsel der Jahreszeiten.
Nachdenkliches aus dem Federkleid
Was mich nachdenklich stimmt, ist die Geschwindigkeit, mit der sich unsere Welt verändert. Einst durchstreiften wir unberührte Wälder, heute sind viele unserer Rastplätze fragmentiert oder verschwunden. Besonders die alten, samenreichen Wälder, die uns Nahrung und Schutz bieten, sind bedroht. Während ihr Menschen uns oft bewundert, vergessen viele, dass eure Entscheidungen tief in unser Leben eingreifen.
Doch wir Bergfinken sind optimistische Wesen. Solange es Bäume gibt, die Samen tragen, Wiesen, die blühen, und Menschen, die sich für unsere Bedürfnisse interessieren, werden wir weiterziehen, brüten und mit unserem Gesang die Welt bereichern.
Ein Wunsch aus meiner Perspektive
Also, wenn ihr das nächste Mal einen Schwarm Bergfinken seht, denkt daran, dass wir mehr sind als gefiederte Reisende. Wir sind ein Symbol für die Wunder der Natur – zart, flüchtig und untrennbar mit dieser Erde verbunden. Vielleicht stellt ihr ja eine Extraportion Sonnenblumenkerne bereit? Für einen kleinen Fink wie mich wäre das das größte Geschenk.
Euer Fringilla montifringilla, der Bergfink, Nomade der Lüfte und Meister des charmanten Chaos.
In der Aufnahme von Helga Zinnecker
- Bergfink Männchen
Artenschutz in Franken®
Der Grünfink (Chloris chloris)

Der Grünfink (Chloris chloris)
22/23.01.2025
Aus meiner Sicht – Chloris chloris, der Grünfink – ist das Leben ein Balanceakt zwischen Überfluss und Unsicherheit, Überlebenskunst und Anpassung. Meine Tage sind erfüllt von der Suche nach Nahrung, dem Schutz meines Reviers und – wenn die Jahreszeit es erlaubt – dem Werben um die Aufmerksamkeit einer Partnerin. Doch hinter meinem scheinbar gewöhnlichen Leben steckt ein faszinierendes Zusammenspiel von Ökologie, Evolution und den Herausforderungen einer sich verändernden Welt.
22/23.01.2025
- Ein Tag im Leben eines Grünfinks (Chloris chloris): Perspektiven eines Federkleids
Aus meiner Sicht – Chloris chloris, der Grünfink – ist das Leben ein Balanceakt zwischen Überfluss und Unsicherheit, Überlebenskunst und Anpassung. Meine Tage sind erfüllt von der Suche nach Nahrung, dem Schutz meines Reviers und – wenn die Jahreszeit es erlaubt – dem Werben um die Aufmerksamkeit einer Partnerin. Doch hinter meinem scheinbar gewöhnlichen Leben steckt ein faszinierendes Zusammenspiel von Ökologie, Evolution und den Herausforderungen einer sich verändernden Welt.
Die Welt durch meine Augen
Mein Federkleid, in schimmernden Grüntönen gehalten, ist mehr als ein Schmuckstück – es ist eine Waffe im Wettbewerb und ein Signal an Rivalen und potenzielle Partnerinnen. Wenn ich auf einem Zweig sitze, die Sonne mein Gefieder streift und ich meinen typischen "dzüüü" Ruf erklingen lasse, zeige ich nicht nur meine Präsenz, sondern auch meine Fitness. Die Evolution hat uns gelehrt, dass Schönheit Stärke bedeutet – für uns Grünfinken sind Farben nicht nur schön, sie entscheiden über unsere Zukunft.
Die Kunst des Überlebens
Doch meine grüne Pracht schützt mich auch. Sie tarnt mich im Blätterwerk, wo ich Nahrung suche: Samen, Knospen, manchmal ein Blattlaus-Snack. Nahrung ist der Schlüssel zu allem – ein Tag ohne Nahrung kann über Leben und Tod entscheiden. Aber mit dem Menschen kommen neue Gefahren. Fütterungsstellen sind ein Segen im Winter, doch sie bergen Risiken: Krankheiten wie die Trichomonadose sind tückische Gegner. Wir sterben leise, wenn die Hygiene vernachlässigt wird – daran denkt kaum jemand, der uns füttert.
Die Schatten der Veränderung
Unsere Welt wird unübersichtlicher. Gärten, die einst reich an Wildpflanzen waren, werden zu Steingärten, Hecken verschwinden zugunsten von Zäunen. Das klingt für manche trivial, aber für uns ist es der Unterschied zwischen einem sicheren Nistplatz und dem Verlust unserer Brut. Auch die Insektizide des Menschen, unsichtbar für euch, sind für uns bittere Realität. Sie nehmen uns nicht nur Nahrung, sondern die Basis für das Leben zukünftiger Generationen.
Nachdenkliches aus dem Federkleid
Was ich mich frage, wenn ich hoch oben auf einem Baum sitze, während die Welt unter mir pulsiert: Warum tun Menschen oft, was uns schadet, obwohl sie uns bewundern? Ihr hängt Vogelhäuser auf und zählt uns in euren Gärten, aber gleichzeitig verändert ihr unsere Landschaft. Warum könnt ihr nicht erkennen, dass eure kleinen Entscheidungen – eine ungemähte Wiese hier, ein Verzicht auf Chemie dort – das Leben eines so kleinen Wesens wie mir beeinflussen können?
Ein Wunsch an die Menschheit
Wir Grünfinken sind keine Philosophen, aber wir sind aufmerksam. Wir sehen, wie ihr mit eurer Umwelt umgeht, und hoffen, dass ihr lernt, die Vielfalt der Natur zu respektieren. Denn jedes Samenkorn, jede Blume, jeder Vogel, der singt, ist Teil eines größeren Ganzen. Für uns Grünfinken ist das Leben kurz – aber in diesem kurzen Leben streben wir nach dem, was zählt: Balance, Harmonie und das Überleben unserer Art.
Vielleicht, wenn ihr die Welt durch unsere Augen seht, könnt ihr uns ein wenig helfen, dieses Gleichgewicht zu bewahren.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
Mein Federkleid, in schimmernden Grüntönen gehalten, ist mehr als ein Schmuckstück – es ist eine Waffe im Wettbewerb und ein Signal an Rivalen und potenzielle Partnerinnen. Wenn ich auf einem Zweig sitze, die Sonne mein Gefieder streift und ich meinen typischen "dzüüü" Ruf erklingen lasse, zeige ich nicht nur meine Präsenz, sondern auch meine Fitness. Die Evolution hat uns gelehrt, dass Schönheit Stärke bedeutet – für uns Grünfinken sind Farben nicht nur schön, sie entscheiden über unsere Zukunft.
Die Kunst des Überlebens
Doch meine grüne Pracht schützt mich auch. Sie tarnt mich im Blätterwerk, wo ich Nahrung suche: Samen, Knospen, manchmal ein Blattlaus-Snack. Nahrung ist der Schlüssel zu allem – ein Tag ohne Nahrung kann über Leben und Tod entscheiden. Aber mit dem Menschen kommen neue Gefahren. Fütterungsstellen sind ein Segen im Winter, doch sie bergen Risiken: Krankheiten wie die Trichomonadose sind tückische Gegner. Wir sterben leise, wenn die Hygiene vernachlässigt wird – daran denkt kaum jemand, der uns füttert.
Die Schatten der Veränderung
Unsere Welt wird unübersichtlicher. Gärten, die einst reich an Wildpflanzen waren, werden zu Steingärten, Hecken verschwinden zugunsten von Zäunen. Das klingt für manche trivial, aber für uns ist es der Unterschied zwischen einem sicheren Nistplatz und dem Verlust unserer Brut. Auch die Insektizide des Menschen, unsichtbar für euch, sind für uns bittere Realität. Sie nehmen uns nicht nur Nahrung, sondern die Basis für das Leben zukünftiger Generationen.
Nachdenkliches aus dem Federkleid
Was ich mich frage, wenn ich hoch oben auf einem Baum sitze, während die Welt unter mir pulsiert: Warum tun Menschen oft, was uns schadet, obwohl sie uns bewundern? Ihr hängt Vogelhäuser auf und zählt uns in euren Gärten, aber gleichzeitig verändert ihr unsere Landschaft. Warum könnt ihr nicht erkennen, dass eure kleinen Entscheidungen – eine ungemähte Wiese hier, ein Verzicht auf Chemie dort – das Leben eines so kleinen Wesens wie mir beeinflussen können?
Ein Wunsch an die Menschheit
Wir Grünfinken sind keine Philosophen, aber wir sind aufmerksam. Wir sehen, wie ihr mit eurer Umwelt umgeht, und hoffen, dass ihr lernt, die Vielfalt der Natur zu respektieren. Denn jedes Samenkorn, jede Blume, jeder Vogel, der singt, ist Teil eines größeren Ganzen. Für uns Grünfinken ist das Leben kurz – aber in diesem kurzen Leben streben wir nach dem, was zählt: Balance, Harmonie und das Überleben unserer Art.
Vielleicht, wenn ihr die Welt durch unsere Augen seht, könnt ihr uns ein wenig helfen, dieses Gleichgewicht zu bewahren.
In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch
- Grünfink
Artenschutz in Franken®
Aktueller Ordner:
Archiv
Parallele Themen:
2019-11
2019-10
2019-12
2020-01
2020-02
2020-03
2020-04
2020-05
2020-06
2020-07
2020-08
2020-09
2020-10
2020-11
2020-12
2021-01
2021-02
2021-03
2021-04
2021-05
2021-06
2021-07
2021-08
2021-09
2021-10
2021-11
2021-12
2022-01
2022-02
2022-03
2022-04
2022-05
2022-06
2022-07
2022-08
2022-09
2022-10
2022-11
2022-12
2023-01
2023-02
2023-03
2023-04
2023-05
2023-06
2023-07
2023-08
2023-09
2023-10
2023-11
2023-12
2024-01
2024-02
2024-03
2024-04
2024-05
2024-06
2024-07
2024-08
2024-09
2024-10
2024-11
2024-12
2025-01
2025-02
2025-03
2025-04
2025-05
2025-06
2025-07
2025-08
2025-09
2025-10
2025-11
2025-12
















